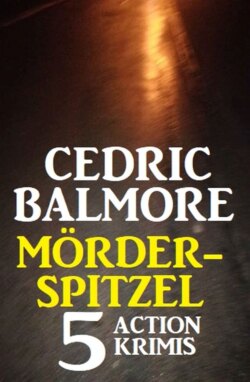Читать книгу Mörder-Spitzel: 5 Action Krimis - Cedric Balmore - Страница 6
Statt harter Dollars eine Leiche von Cedric Balmore
ОглавлениеEddie Floyd holte tief Luft. In seinen Augen funkelte wilder Triumph. Sie hatten es so gut wie geschafft. Von der Millionenbeute trennten sie nur noch ein kleines, gefräßiges Flämmchen und der Paukenschlag der Explosion.
»He, worauf wartest du noch?« fragte ihn sein Komplize Joe Marks ungeduldig.
»Ich genieße das, ich koste es aus, weißt du?« flüsterte Eddie Floyd. »Dies ist ein großer Augenblick, Joe.«
»Spinnst du?« giftete Joe Marks. »Jetzt ist keine Zeit für sentimentale Anwandlungen. Wir haben keine Zeit mehr. Draußen wird es hell.«
»Schon gut, schon gut«, sagte Eddie Floyd und knipste sein Feuerzeug an. Das Flämmchen sprang auf die bereitgehaltene Zündschnur über. Die Männer hasteten in Deckung. Siebzehn Sekunden später erreichte sie die Druckwelle der dumpfen, heftigen Detonation. Sie richteten sich auf, die Taschentücher vor den Mund gepreßt, bemüht, den beißenden, dichten Explosionsqualm mit ihren Blicken zu durchdringen.
Eddie Floyd war zuerst an dem Safe. »Perfekt«, sagte er hustend. »Einfach großartig- Unser schärfster Job seit langem, was? Schau dir das an, alter Junge. Die Ladung war genau richtig dosiert. Jetzt brauchen wir nur noch die verdammte Tür aufzuziehen und zuzugreifen, wie im Selbstbedienungsladen...«
Nun übermannte es plötzlich Joe Marks. Er grinste breit und zog hörbar die Luft durch die Nase. Die zähe stundenlange Bohr- und Schweißarbeit hatte sich gelohnt, das große, strahlende Millionenziel war erreicht.
»Lös, Mann!« drängte Joe Marks.
Eddie Floyd war es zumute, als müßte er ersticken. Sein Herz hämmerte hoch oben im Hals. Er streckte beinahe feierlich seine Rechte aus. Sie war mit einem schmutziggrauen Asbesthandschuh bekleidet. Die Safetür schwang mit einem absurden Quietschlaut zurück.
Im nächsten Moment fiel Eddie Floyds Arm wie kraftlos nach unten. Joe Marks Atem kam laut und pfeifend, geradezu asthmatisch. Fassungslos starrten die Männer in den Safe.
Es schien, als könnten sie nicht glauben, was sie sahen, als erwarteten sie, daß der Anblick sich in eine Fata Morgana auflösen würde. Aber er blieb.
In dem Safe kauerte eine Tote.
***
Sie war nackt.
Ihr Kopf ruhte mit dem Gesicht nach unten auf den angezogenen Knien. Das lange Blondhaar fiel wie ein Vorhang über ihre Gesichtszüge. Die untadelige Glätte der straffen gebräunten Haut machte klar, daß das Mädchen nicht sehr alt geworden sein konnte. Neunzehn vielleicht, höchstens zwanzig.
»Ich brauche einen Schnaps«, murmelte Joe Marks. Er machte kehrt, trat an eines der Fenster und riß die daran befestigte Wolldecke herab. Er öffnete das Fenster, steckte seinen Kopf ins Freie und pumpte sich die Lungen voll frischer Luft.
Der Morgen schob sich mit tristem Grau über Dächer und Straßen. In den Ecken hockte noch das Dunkel der Nacht.
Eddie Floyd stand immer noch vor dem Safe. Das Mädchen füllte ihn bis zur Hälfte aus. Über ihr befanden sich einige Fächer und Schubladen. Eddie Floyd durchsuchte sie. Außer Papieren, die ihn nicht interessierten, entdeckte er ganze dreihundert Dollar in bar. Joe Marks trat neben ihn.
»So eine Pleite«, sagte er.
»Findest du?« fragte Eddie Floyd.
Joe Marks musterte ihn stirnrunzelnd. »Tickst du noch richtig? Wir haben umsonst gearbeitet!«
»Nicht ganz«, sagte Eddie Floyd. »Die Tote kann eine Menge wert sein.«
»Spuck schon aus, woran du denkst — aber schnell, bitte. Ich möchte von hier verschwinden. Ich habe keine Lust, in eine Mordgeschichte verwickelt zu werden.«
»Kennst du das Mädchen?« fragte Eddie Floyd und schob mit der Hand den blonden Haarvorhang beiseite.
Joe Marks stieß einen Pfiff aus. »Klasseprofil«, sagte er. »Nein, nie gesehen. Leider.«
»Ich auch nicht — aber sie erinnert mich an jemand«, meinte Eddie Floyd.
»Du spinnst.«
»Nein, nein — aber mir ist es so, als hätte ich das Gesicht schon oft auf Fotos gesehen. In Zeitungen und Illustrierten. Schau es dir noch einmal genau an.«
»Es ist kalt und tot«, sagte Joe Marks. »Genauso fühle ich mich. Hundeelend. Unser großer Job! Scheiße. Wie konnten wir nur auf diesen idiotischen Tip fliegen?«
»Jetzt denke einmal nach«, meinte Eddie Floyd. »Das Büro und der Safe gehören Hamilton Turner, dem Baumillionär. Nur er kann die Tote in seinem Safe.versteckt haben...«
»Warum sollte er so etwas tun?« unterbrach Joe Marks.
»Weil er etwas zu verbergen hat. Einen Mord zum Beispiel.«
Joe Marks stieß einen Pfiff aus.
»Und du denkst...?«
»Ja, ich denke, daß wir damit ein bißchen Geld machen können«, sagte Eddie Floyd. »Eine ganze Menge sogar. Mindestens soviel, wie wir aus dem Safe zu holen hofften.«
»Mann, daß ich nicht gleich daran gedacht habe!« meinte Joe Marks und kratzte sich aufgeregt am Hinterkopf. »Weiter — wie willst du ihn in die Mangel nehmen?«
»Laß mich nachdenken. Wenn wir die Leiche hierlassen, bietet sich ihm die Möglichkeit, die Tote wegzuzaubern. Aber wenn wir sie mitnehmen, könnte uns das Verbrechen in die Schuhe geschoben werden...«
»Ist nicht einfach, was?« fragte Joe Marks und musterte seinen Komplizen ängstlich. Wenn es darum ging, eine Entscheidung zu treffen, baute er ganz auf Eddie.
»Gib mir eine Zigarette«, sagte Eddie Floyd.
»Mann, wir müssen von hier verschwinden, es ist gleich sechs Uhr«, sagte Joe Marks.
»Heute ist Sonntag«, meinte Eddie Floyd, »da kommt niemand ins Büro. Ich wette, das hat Turner in Rechnung gestellt, sonst hätte er es nicht wagen können, die Puppe in seinen Safe zu stecken.«
»Er kann sie nicht bis Montag drinlassen, er muß sie vorher ’rausholen, nicht wahr?«
»Genau«, sagte Eddie Floyd. »Diesen Moment müssen wir abpassen.«
»Und fotografieren?«
»Gar kein schlechter Gedanke«, meinte Eddie Floyd. »Die Frage ist nur, was Hamilton Turner tun wird, wenn er den aufgebrochenen Safe sieht.«
»Er muß das tote Mädchen trotzdem wegbringen, unter allen Umständen«, sagte Joe Marks.
»Das muß er keineswegs.«
Joe Marks riß die Augen auf. »Jetzt komme ich nicht mehr mit«, meinte er. »Ich denke, er hat die Puppe umgebracht? Wenn das stimmt, muß er die Leiche aus dem Verkehr ziehen — Einbruch hin, Einbruch her.«
»Turner könnte sich das Safeknacken zunutze machen und uns den Mord an dem Mädchen in die Schuhe zu schieben versuchen«, meinte Eddie Floyd. »Wo bleibt die Zigarette?«
»Er hat doch keine Ahnung, wer wir sind!«
»Um so besser für ihn. Da kann er den Bruch und den Mord völlig Unbekannten in die Schuhe schieben.«
»Hier, mein Junge«, sagte Joe Marks. Er gab seinem Freund eine Zigarette und Feuer. »Jetzt begreife ich gar nichts mehr. Safeknacker kommen, um etwas zu holen. Sie bringen nichts. Schon gar keine Leichen. Du solltest deine Phantasie etwas zügeln, Eddie. So kommen wir nicht weiter.«
»Versuche bitte einmal, dich in Hamilton Turners Lage zu versetzen«, meinte Eddie Floyd und inhalierte tief. »Er weiß plötzlich, daß es Mitwisser gibt. Er kennt uns nicht, aber ihm ist klar, welche Gefahr wir für ihn bedeuten. Wir haben ein Mordopfer entdeckt, das offenbar auf sein Konto geht. Was kann und wird er tun? Er wird den Spieß einfach umkehren, er wird behaupten, das Mädchen weder gekannt noch in den Safe gepackt zu haben, er wird erklären, daß wir die Tote mitgebracht haben.«
»Unsinn! Warum hätten wir so etwas tun sollen?«
»Warum«, fragte Eddie Floyd, »hätte Turner ein totes Mädchen in seinen Safe legen sollen? So wird er argumentieren, alter Junge. Und die Greifer werden ihm glauben, nicht uns. Hamilton Turner ist mehrfacher Millionär, ein geachteter, mächtiger Mann, Vorsitzender in mehreren Wohlfahrtsorganisationen. Und was sind wir? Vorbestrafte Schränker, für die Öffentlichkeit Männer ohne Glaubwürdigkeit — für die Greifer der letzte Dreck.«
»Wenn die Dinge so liegen, sollten wir schleunigst unser Werkzeug zusammenpacken und verschwinden«, meinte Joe Marks-. »Dann haben wir gegen ihn keine Chance.«
»Doch, die haben wir«, erklärte Eddie Floyd mit verkniffenen Augen. »Es kommt nur darauf an, richtig zu handeln. Wir müssen unseren Vorteil nutzen. Wir kennen Turners Geheimnis, nicht wahr? Nur wir! Vielleicht gelingt uns damit ein Überraschungscoup. Aber du hast recht. Von unserem nächtlichen Besuch darf keine Spur außer dem geöffneten Safe Zurückbleiben.« Die nächste Viertelstunde verbrachten sie damit, die Decken von den Fenstern zu reißen und ihr Werkzeug zu dem außerhalb des umzäunten Firmengrundstücks parkenden Dodge zu bringen. Sie hatten ihn eigens für diesen Job gestohlen.
Hamilton Turners Firma befand sich am Ende einer Sackgasse unweit der Surf Avenue. Die schmale Straße wurde ausschließlich von Fabriken und Lagerhäusern gesäumt.
»Was nun?« fragte Joe Marks, als sie wieder in Hamilton Turners Privatoffice standen.
»Wenn wir bloß wüßten, wer sie ist«, murmelte Eddie Floyd.
»Trägt sie kein Kettchen mit einer Namensplatte?« fragte Joe Marks hoffnungsvoll.
»Nein — nicht mal einen Ring«, seufzte Eddie Floyd.
»Wir müssen sie mitnehmen«, sagte Joe Marks. »Wir wickeln sie in eine der Decken und legen sie in den Wagen.«
»Und dann?«
»Dann telefonieren wir mit Turner.«
»Nur immer weiter. Was willst du ihm sagen?«
»Daß wir ihm auf die Schliche gekommen sind und die Leiche an uns genommen haben. Und...«
»Und?«
»Verdammt, ich weiß es nicht.«
»Wenn wir so handelten, wie du es vorschlägst, würden wir nichts erreichen«, sagte Ecldie Floyd. »Turner würde sich dumm ' stellen. Er würde behaupten, das Mädchen nicht zu kennen. Vielleicht gibt es ein oder zwei Prokuristen. Vielleicht haben drei oder mehr Leute zu dem Safe Zugang.«
»Wenn man dich hört, könnte man meinen, daß es dir geradezu Spaß macht, die Dinge zu komplizieren.«
»Wir müssen an alles denken, um keinen Fehler zu machen«, sagte Eddie Floyd.
»Einen haben wir schon gemacht«, meinte Joe Marks grimmig. »Wir haben einen Safe geöffnet, der nur eine Leiche enthält.«
»Stimmt — aber wenn wir Glück haben, entwickelt sich daraus das große Geschäft.«
»Hör bloß auf damit! Seitdem ich in diesem Scheißland lebe, erzählt mir jeder, das Geld liege auf der Straße, man brauche es nur aufzuheben. Alles Mist! Reich wird man nur, wenn man Köpfchen hat. Ideen. Und die habe ich nicht. Du auch nicht — sonst wäre dir längst etwas eingefallen.«
»Reg dich ab, Joe. Ich weiß jetzt, was wir machen«, sagte Eddie Floyd.
***
Mein Freund und Kollege Milo Tucker kletterte mit mir aus dem Kastenwagen, der in bunten Lettern die Aufschrift »Bill Owens Garden Specialists« trug. Wir luden ein paar Werkzeuge aus, Harken, Baumscheren, eine Motorsäge. Ich fand, daß mein grüner Overall um eine Nummer zu groß war, aber das störte mich nicht.
»Ganz hübscher Kasten«, meinte Milo und warf einen Blick auf das große weiße Haus. »Mindestens zwanzig Zimmer. Ob die Tochter so hübsch ist wie das Haus?«
»Jedenfalls mindestens so wertvoll«, sagte ich leise. »Sonst hätte man sie nicht entführt.«
Wir schulterten das Werkzeug und marschierten auf das Hausportal zu. Es wurde von einem bronzenen Löwenkopf verziert, der als Türklopfer diente. Ein frostig wirkender Butler öffnete uns.
»Firma Owens«, sagte ich. »Wir kommen wegen der Birken. Mr. Turner weiß Bescheid.«
»Gehen Sie bitte um das Haus herum«, meinte der Butler. »Mr. Turner sitzt auf der Terrasse.«
Wir trafen den Hausherrn im Schatten eines Sonnenschirmes am Rande des nierenförmig angelegten Swimming-pools. Hamilton Turner war ein großer, zur Fülle neigender Endfünfziger, der in seiner modern geblümten und fast knielangen Badehose vielleicht lächerlich gewirkt hätte, wenn er nicht zur Kompensation mit einem imponierenden Schädel ausgerüstet gewesen wäre. Er hatte eine scharfe Nase, sehr klare, helle Augen und ein markantes, energisches Kinn. Sein volles dunkelblondes Haar reichte ihm bis weit in den Nacken.
»Ich weiß nicht, ob wir beobachtet werden«, sagte er leise. »Gehen Sie erst einmal zum hinteren Ende des Gartens. Sie können die Birkengruppe nicht übersehen. Fummeln Sie dort ein bißchen herum. Ich geselle mich später zu Ihnen. Das wirkt weniger auffällig.«
Milo und ich taten, worum er uns bat. »Ein hübscher Job«, sagte Milo grimmig. »Und das am Sonntag!«
»Es ist unser gutes Recht, mit Schwarzarbeit ein paar Bucks extra zu machen«, spottete ich. »Genau wie die anderen.«
»Was hältst du von Turner?«
»Ein Millionär wie tausend andere«, sagte ich.
»Nicht mein Typ.«
»Du hast was gegen das Kapital«, spottete ich.
»Nur gegen das, was andere besitzen«, meinte Milo grinsend. »Legen wir einen um?«
»Einen Baum? Klar, es muß schön echt wirken. Das Grundstück ist verdammt groß. Ein Park. In den angrenzenden Gärten kann irgendein Beobachter sitzen.«
»Glaubst du das?«
»Nein, aber wir müssen jede Möglichkeit einkalkulieren«, sagte ich. »Gib mir mal die Motorsäge rüber.«
»Wir sind wirklich Experten«, lachte Milo. »Erstens hast du das Anschlußkabel vergessen — und zweitens gibt es hier weit und breit keine Steckdose.«
Wir wandten die Köpfe, als wir das Knacken von Zweigen hörten. Hamilton Turner tauchte auf. Er hatte sich einen Bademantel übergestreift und einen Strohhut aufgesetzt.
»Hier können wir reden, aber nicht zu lange — das würde auffallen«, sagte er.
»Haben sich die Erpresser schon wieder gemeldet?« fragte Milo.
»Ja«, sagte er. »Sie haben ihre Forderung auf eine Million Dollar hochgeschraubt. Ich denke, ich werde zahlen.« Er holte zwei Fotos aus seiner Tasche und drückte sie uns in die Hand. »Das ist meine Tochter Phyllis«, sagte er.
»Wie alt ist sie?« fragte Milo. »Neunzehn.«
»Kennen Sie ihre Freunde?« erkundigte ich mich.
»Nein.«
»Nein?«
»Na ja, ein paar schon — vom Ansehen«, erwiderte Turner. »Einige davon bringt sie manchmal mit. Sie lümmeln dann am Swimming-pool herum, trinken meinen Whisky und lassen ihre Radios förmlich explodieren. Ich muß zugeben, daß ich mich für diese jungen Leute nicht interessiere.«
»Warum?« fragte Milo, der immer noch das Foto anstarrte.
Das abgebildete Mädchen war in der Tat sehenswert. Hellblond und großäugig, eine Schönheit. Sie lachte dem Betrachter atemlos ins Gesicht, in den Augen leuchtende Erwartung und auch heimliche Lockung — aber auch das Wissen um die eigene Faszination.
»Warum ich mich nicht um diese jungen Leute bemühe?« fragte Hamilton Turner. »Sie machen mich nervös. Sie sind mir zu laut, zu selbstsicher, zu fremd. Und zu unreif. Ich kann mit dieser Generation einfach nichts beginnen.«
»Wann und wo haben Sie Ihre Tochter zuletzt gesehen und gesprochen?«
»Das war gestern nachmittag, am Sonnabend, so gegen achtzehn Uhr, hier im Hause. Sie brauchte Geld. Ich gab ihr einen Hunderter. Damit zog sie ab.«
»Hat sie kein festes Taschengeld?«
»Doch, achthundert Dollar im Monat, aber damit kommt sie selten aus.«
»Wohin wollte sie gehen?«
»Keine Ahnung«, erwiderte Hamilton Turner. »Ich habe mir längst abgewöhnt, mit Phyllis über ihre Ziele, Absichten und Freunde zu sprechen. Dabei kommt nichts heraus. Offen gestanden interessieren mich diese Dinge auch nicht.« Er rückte an seinem Strohhut herum. »Was hätte ich wohl davon, wfenn Phyllis mir sagte, daß sie ins Zoom-Zoom, ins Dixy oder in irgendein anderes Lokal geht? Ich kenne diese Diskotheken nicht. Jede Woche ist eine andere ›in‹. Man kann sich die Namen sowieso nicht merken.«
»Ist Phyllis abgeholt worden?« fragte Milo und ließ endlich das Bild sinken.
»Nein, sie fuhr gegen zwanzig Uhr in ihrem grünen Triumph weg«, sagte Hamilton Turner.
»Wir brauchen die Nummer«, meinte Milo.
»Ich habe sie Ihnen aufgeschrieben, zusammen mit den wichtigsten anderen Daten wie Phyllis’ Körpergröße, besondere Kennzeichen und dergleichen mehr«, sagte Hamilton Turner und überreichte mir einen zusammengefalteten Zettel. Ich warf einen flüchtigen Blick darauf und steckte ihn ein.
»Wer war in letzter Zeit ihr Favorit?« fragte ich.
»Ein Junge namens Lincoln Montano«, erwiderte Hamilton Turner. »Sie hat oft von ihm gesprochen. Er kann singen und Gitarre spielen. Ich habe ihn zwei- oder dreimal gesehen. Ein hübscher Junge mit großen Augen und fast schulterlangem Haar. Möglich, daß Phyllis ein wenig in ihn verknallt ist — aber ich bezweifle, daß es sie ernstlich erwischt hat. Phyllis ist kein Mädchen mit einem Hang zur Romantik, sie ist eher etwas oberflächlich. Ich glaube nicht, daß Lincoln Montano in die Entführung verwickelt ist. Ihm fehlt es für eine solche Sache einfach an Härte.«
»Sie haben mit einem der Entführer telefoniert«, sagte ich. »Welchen Eindruck gewannen Sie dabei?«
»Der Bursche kann nicht mehr ganz jung gewesen sein, das machte seine Stimme deutlich — obwohl er sie verstellte. Er hat nur ein paar Sätze gesagt und dann aufgelegt. Daß Phyllis sterben müßte, wenn ich nicht zahle. Daß ich schnellstens das Geld besorgen soll — und daß ich unter keinen Umständen das FBI oder die Polizei einschalten dürfe.«
»Haben Sie nichts vergessen?« fragte Milo.
»Doch«, meinte Hamilton Turner, der plötzlich zu frieren schien, obwohl die Mittagsschwüle wie ein unsichtbares Gewicht auf den Garten drückte. Er schloß seinen Bademantel und stellte den Kragen hoch. »Der Gangster sprach davon, daß mein Haus beobachtet würde. Und ich. Deshalb mußte ich Sie darum bitten, in dieser Verkleidung zu erscheinen.«
»Als Gärtner an einem Sonntag, so ganz ideal ist das wohl nicht«, meinte Milo zweifelnd.
»Machen Sie sich darüber bitte keine Gedanken«, sagte Hamilton Turner. »Sonntagsarbeit ist doch längst üblich geworden. Ich telefoniere morgen mit meiner Hausbank und lasse das Lösegeld bereitstellen.«
»Sie müssen versuchen, vorher mit Ihrer Tochter zu sprechen«, sagte Milo.
»Das ist mir klar. Ich habe das auch dem Gangster am Telefon mitgeteilt. Er schien bereit, meine Forderung zu erfüllen. Ich habe Sie eigentlich nur hergebeten, damit Sie mir helfen, die Aktion abzusichern. Ich möchte, daß im Notfall Hilfe zur Stelle ist. Außerdem will ich nicht nur Phyllis, sondern auch mein Geld zurückhaben. Ich baue darauf, daß Sie inzwischen die notwendigen Vorbereitungen treffen.«
»Wir brauchen erst einmal die Erlaubnis zum Abhören Ihres Telefons«, sagte Milo. »In einer unserer Werkzeugtaschen befindet sich ein anschlußfertiges Tonbandgerät. Wir erklären Ihnen später, was Sie damit machen müssen.«
»Ich werde gar nichts damit machen«, sagte Hamilton Turner entschlossen. »Ich werde erst einmal zahlen. Morgen oder übermorgen, wie es die Gangster fordern. Versuchen Sie inzwischen, Phyllis’ Wagen zu finden. Aber seien Sie um Himmels willen vorsichtig. Die Gangster dürfen nicht merken, daß ich mich mit Ihnen in Verbindung gesetzt habe. Im übrigen wünsche ich keine gezielte FBI-Aktion, ehe Phyllis wieder bei mir ist.«
Er sagte noch mehr in dieser Richtung und ließ keinen Zweifel daran zu, daß er jede Panne, die auf unser etwaiges Fehlverhalten zurückgeführt werden konnte, unnachsichtig anprangern würde.
Milo nickte ungeduldig. Es gab noch ein paar Dinge, die wir wissen mußten. »Wo lebt Phyllis’ Mutter?« fragte er. »Ganz in der Nähe, in Hillcrest«, antwortete Hamilton Turner. »Wie Sie wissen, wurden wir vor drei Jahren geschieden.«
»Woran liegt es, daß Phyllis Ihnen zugesprochen wurde?« fragte Milo.
»Ich konnte nachweisen, daß Miriam mit einem Dutzend Verehrern die eheliche Treue gebrochen hatte«, sagte Hamilton Turner.
»Wovon lebt Ihre ehemalige Frau jetzt?«
»Sie hat wieder geheiratet. Es geht ihr gut. Ihren Mann schätze ich auf fünf bis sechs Millionen reines Privatvermögen. Soviel ich hörte, vergöttert er Miriam. Ob sie ihn betrügt, weiß ich nicht. Es ist mir egal. Jedenfalls scheidet sie als Entführerin aus. Sie hat sich schon früher nichts aus ihrer Tochter gemacht. Sie war schockiert, als sie schwanger wurde, sie hat sogar versucht, das Kind wegbringen zu lassen. Ohne mein massives Eingreifen wäre es sicherlich zum Äußersten gekommen.«
»Sie hat keine weiteren Kinder bekommen?«
»Nein, sie haßt Kinder.«
»Soll das heißen, daß Mutter und Tochter niemals Zusammentreffen?« fragte ich ihn.
»Nein, nein, so ist das nicht. Jetzt, wo Phyllis sich zu einem jungen, attraktiven Mädchen entwickelt hat, gibt Miriam gern mit ihr an. Sie treffen sich gelegentlich in der Stadt. Soviel ich weiß, verstehen sie sich gut. Kunststück! Miriam ist schön und charmant, sie hat das Talent, Menschen zu bezaubern — aber sie ist falsch.«
»Vielleicht kann uns Ihre Exfrau weiterhelfen«, sagte Milo. »Zwischen Frauen wird oft über Dinge gesprochen, die ein Mann nie erfährt — schon gar nicht der Vater.«
Hamilton Turner legte die Stirn in Falten. »Das geht nicht«, meinte er nach kurzer Pause. »Miriam weiß nicht, daß...« Er unterbrach sich, als vom Haus her eine helle Stimme ertönte. »Hamilton, wo steckst du?«
»Das ist sie«, meinte Turner verblüfft. »Wenn man vom Teufel spricht! Das ist Miriam. Ich habe keine Ahnung, was sie von mir will. Sie hat ihren Besuch nicht angekündigt.«
»Ihre Exfrau weiß nicht, daß Phyllis entführt wurde?« erkundigte ich mich.
»Niemand weiß es — außer mir, den Entführern und Ihnen«, sagte Hamilton Turner. »Nicht einmal das Personal ist informiert.«
»Apropos Personal«, meinte Milo. »Wie viele Leute beschäftigen Sie?«
»Einen Butler, einen Koch und zwei Mädchen. Der Koch und die Mädchen wohnen außerhalb.«
»Hamilto-o-o-on!« tönte es durch den Garten.
»Ich bin neugierig, was sie herführt«, meinte Turner. Er machte kehrt und ging davon.
Milo und ich schnippelten mit unseren Scheren an den Ästen herum und kamen uns dabei reichlich unbeholfen vor. Eine Stunde später kreuzte Turner auf. Er hatte sich umgezogen. In einer leichten Sommerkombination sah er elegant und recht dynamisch aus.
»Ich habe ihr ein Märchen über Phyllis erzählt und sie wieder weggeschickt«, sagte er. »Rauchen Sie?«
Er bot uns ägyptische Zigaretten an und schüttelte den Kopf, als er uns Feuer gab.
»Ich begreife das nicht. Miriam wollte angeblich zu Phyllis, aber ich möchte wetten, daß dies nur ein alberner Vorwand war. Miriam sah übrigens fabelhaft aus, wirklich. Sie ist zweiundvierzig, aber wer ihr Alter zu schätzen versucht, tippt allenfalls auf dreiunddreißig oder fünfunddreißig. Was, zum Teufel, kann sie nur gewollt haben? Ich habe ihr gesagt, daß Phyllis übers Wochenende weggefahren sei. Damit gab sie sich zufrieden.«
»Fangen Sie an, Miriam mit der Entführung Ihrer Tochter in Verbindung zu bringen?«
»Unsinn. Phyllis ist auch Miriams Tochter. Solche Hypothesen führen zu nichts.«
»Es ist aber ganz offenkundig, daß der Besuch Ihrer geschiedenen Frau Sie beschäftigt«, sagte Milo.
»Es ist das erstemal nach der Scheidung, daß sie sich hier blicken läßt«, meinte Hamilton Turner. »Und das ausgerechnet heute! Würde Ihnen das an meiner Stelle nicht zu denken geben? Aber es kann sich nur um einen Zufall handeln, eine andere Erklärung gibt es nicht.«
Wir wandten die Köpfe, als wir das Brechen und Knacken von Zweigen hörten. Der Butler kam herangehechelt. Er hatte einen hochroten Kopf und war so außer Atem, daß er sich an einem der Bäume festhalten mußte, ehe er zu sprechen vermochte.
»Kommen Sie bitte sofort, Sir«, würgte er hervor. »Der gnädigen Frau ist etwas Schreckliches passiert...«
Hamilton Turner hob das Kinn. »Was denn, um Himmels willen?« fragte er irritiert.
»Sie ist — sie ist ermordet worden«, murmelte der Butler. Dann verließen ihn die Kräfte. Er brach bewußtlos zusammen.
***
In Hamilton Turners Gesicht zuckte kein Muskel. »Er muß den Verstand verloren haben«, sagte er.
»Kommen Sie«, sagte ich und warf die Gartenschere auf den Boden. »Wenn es stimmt, was er behauptet, ist es sinnlos geworden, unsere Rolle weiterzuführen.«
Wir rannten los. Milo und ich erreichten das Haus mit weitem Vorsprung vor Turner. Neben dem Swimming-pool blieben wir stehen und schauten uns um. Die Sonne schien. Vögel zwitscherten. Irgendwo knatterte ein Rasenmäher.
»Ich sehe nichts«, sagte Milo.
»Laß uns um das Haus herumgehen«, meinte ich.
Wir stoppten, als wir die Schmalseite des Gebäudes erreicht hatten. »Da«, sagte Milo. »Im Rosenbeet.«
Die Frau trug ein weißes Kostüm. Sie lag mit dem Gesicht nach unten in einem kreisrunden Beet. Aus ihrem Rücken ragte ein langer Pfeil mit Stabilisierungsflossen.
Ich war als erster bei der Frau. Unter mir knickten ein paar blutrote Rosen weg. Das Blut, das das Kostüm der Frau färbte und gierig von dem Stoff aufgesogen wurde, hatte nahezu die gleiche Farbe.
Ich bückte mich und drehte die Frau behutsam auf die Seite. Ein Blick in ihre weitoffenen, gebrochenen Augen zeigte mir, daß für sie jede Hilfe zu spät kam. Ich richtete mich auf.
»Mein Gott«, sagte Milo leise.
Hamilton Turner kam herangehechelt. Er hatte unterwegs seinen Strohhut verloren. »Ist sie tatsächlich...?« Er blieb neben uns stehen und führte den Satz nicht zu Ende.
»Ja«, sagte ich. »Sie ist tot.«
»Mit Pfeil und Bogen«, murmelte Hamilton Turner fassungslos. »Das muß ein Unfall gewesen sein. Ein spielendes Kind. Eine andere Erklärung gibt es nicht.«
»Nein, nein«, sagte ich. »Ein Pfeil dieser Größenordnung wird von einem großen Sportbogen abgeschossen. Den konnte kein Kind spannen.«
»Wie kommt sie bloß in das Rosenbeet?« fragte Hamilton Turner, auf dessen Stirn sich kleine Schweißperlen gebildet hatten.
Ich wies auf den Weg. »Sie war auf dem Weg zür Straße, nehme ich an. Als der Pfeil sie traf, ist sie ein paar Schritte zur Seite getorkelt und hier zusammengebrochen. Wo haben Sie sich von ihr verabschiedet?«
»Am Swimming-pool! Aber sie ist nicht gleich gegangen, sie hat noch ein paar Worte mit Horace gewechselt.«
»Horace ist der Butler?«
»Ja, sie kannte ihn noch aus unseren Ehetagen. Mein Gott, daß sie so enden mußte...«
Milo und ich schauten uns um. Die Begrenzung zum Nachbargrundstück bestand aus einer fast mannshohen Buchsbaumhecke. Für einen Schützen gab es mehr als ein Dutzend fabelhafter Versteckmöglichkeiten: die Hecke, Büsche, Bäume...
»Der ist längst über alle Berge«, sagte Hamilton Turner, der meinen suchenden Blick bemerkte. »Was nun?«
»Wir müssen die Mordkommission benachrichtigen«, sagte ich.
»Mann, Mann«, murmelte er. »Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Erst Phyllis und jetzt Miriam. Ich habe dafür keine Erklärung. Es bringt mich um...« Er schaute mir in die Augen. »Die Entführer werden davon Wind bekommen. So etwas läßt sich doch nicht geheimhalten. Welche Auswirkungen wird es auf Phyllis’ Schicksal haben, wenn es im Haus vor Polizisten wimmelt?«
»Die Entführer werden sich bald wieder melden«, sagte ich. »Denen geht es nur um die Million. Vergessen Sie das nicht.«
»Arme Miriam«, meinte er seufzend und musterte die Tote. »Sie hat mir und vielen anderen das Leben sauer gemacht. Sie war kein guter Mensch. Aber dieses Ende hat sie nicht verdient.«
»Kennen Sie ihren Mann?« fragte ich.
»Nicht persönlich«, meinte er.
»Wir müssen ihn benachrichtigen.«
»Bitte, übernehmen Sie das«, sagte Hamilton Turner. »Ich bin dazu nicht imstande. Nicht jetzt. Nicht heute.«
Wir hörten ein Klingelsignal.
»Das Telefon«, sagte Hamilton Turner. »Zum Teufel damit!«
»Das hört sich an wie eine Außenklingel«, meinte Milo.
»Ganz? recht«, sagte Hamilton Turner. »Da wir oft im Garten sind und das Telefon nicht hören können, habe ich diese Extraglocke anbringen lassen.«
»Es könnten die Entführer sein«, sagte ich. »Kommen Sie.«
Wir eilten durch die offenen Terrassentüren in das große, elegant möblierte Wohnzimmer. Der Hausherr nahm den Hörer ab und meldete sich. Ich beobachtete, wie sein Gesicht buchstäblich auseinanderfiel. Ich fragte mich, was ihn mehr als der Tod seiner Exfrau zu erregen vermochte, und kam zu dem Schluß, daß es seine Tochter betreffen mußte. Aber ich täuschte mich.
»Rühren Sie nichts an«, meinte Hamilton Turner mit belegt klingender Stimme. »Ich rufe zurück.«
Er warf den Hörer auf die Gabel und starrte ins Leere.
»Das ist wie ein Kesseltreiben«, sagte er. »Der Safe in meinem Office ist aufgebrochen worden.«
»Wer hat den Einbruch bemerkt?«
»Mein Prokurist. Er wollte sich eine Akte besorgen und stutzte, als er ein paar offene Türen sah...«
»Was ist gestohlen worden?« fragte ich.
»Der Safe enthielt eine Schmuckkassette und rund hunderttausend Dollar in bar.«
»Ist die Polizei schon benachrichtigt worden?«
»Ich weiß es nicht — aber ich bin sicher, daß Jim das erledigt hat«, meinte Hamilton Turner. »Jim ist mein Prokurist«, fügte er erklärend hinzu. »Jim Bradley.«
»Sind Sie versichert?«
»Ja.«
»Warum entsetzt Sie der Einbruch dann so sehr?«
Er schaute mich an. »Es ist nicht der Einbruch«, sagte er schwer atmend. »Es ist die Fülle der Ereignisse. Sie kommen auf einmal wie Hammerschläge.«
»Ich muß die Mordkommission anrufen«, sagte ich und trat an den Apparat. Während ich am Telefon sagte, was zu sagen war, beobachtete ich Hamilton Turner. Er stand mitten im Raum und starrte in den Garten. Er wirkte völlig selbstvergessen. Ich legte auf. »Vielleicht sollten wir uns um Ihren Butler kümmern, Mr. Turner!«
»Da kommt er ja schon«, meinte Hamilton Turner und holte tief Luft. »Der arme Horace! Ihm ist anzusehen, wie sehr ihn das Ganze mitgenommen hat. Er wirkt um Jahre gealtert.«
»Wir müssen noch Miriams Mann informieren«, sagte ich. »Aber das hat Zeit. Ich möchte erst ein paar Worte mit Ihrem Butler wechseln.«
»Darf ich mich setzen, Sir?« fragte Horace, als er die Terrasse erreicht hatte. »Meine Knie sind puddingweich.«
»Sicher, Horace«, meinte Hamilton Turner und schob dem Butler einen Gartenstuhl zurecht. »Haben Sie gesehen, wie das Schreckliche passierte?«
»Nicht alles, Sir«, erwiderte der Butler und ließ sich auf den Stuhl fallen. »Ich hörte nur einen Schrei, eilte um das Haus herum und sah gerade noch, wie die gnädige Frau kopfüber in das Rosenbeet stürzte. Als ich den Pfeil aus ihrem Rücken ragen sah, wußte ich sofort, daß sie tot war.«
Milo kam um die Ecke. Er hatte die letzten Worte mitgehört. »Sind Sie medizinisch vorbelastet?« fragte er.
Der Butler hob die Augenbrauen und warf einen verdutzten Blick auf seinen Brötchengeber.
»Das sind FBI-Agenten, Horace«, sagte Hamilton Turner und räusperte sich. »Ich mußte sie bitten, als Gärtner verkleidet herzukommen. Phyllis ist entführt worden.«
Der Butler öffnete den Mund und klappte ihn wieder zu. Er schien am Rande einer zweiten Ohnmacht zu stehen.
»Haben Sie den Mörder gesehen?« fragte ich ihn.
»Nein, Sir.«
»Haben Sie gehört, in welche Richtung er davonlief?« erkundigte sich Milo.
»Nein, Sir. Ich bin ja selber sofort losgerannt, um Mr. Turner zu benachrichtigen.«
»Worüber haben Sie sich mit Mr. Turners Exgattin unterhalten?«
»Mit Mrs. Cavello, meinen Sie. Es war nichts von Bedeutung. Sie fragte mich nach dem Garten, nach meinem Rheuma... und nach Miß Phyllis.«
»Worauf bezogen sich ihre Fragen, soweit sie Miß Phyllis betrafen?«
»Sie wollte den Namen von Miß Phyllis’ Freund wissen.«
»Haben Sie ihn genannt?«
»Nein, Sir. Ich kenne ihn nicht. Miß Phyllis hat so viele gute Freunde...«
»Wie ist sie hergekommen?« fragte ich.
»Mrs. Cavello? Mit ihrem Wagen. Er parkt vor dem Grundstück auf der Straße, Sir.«
Milo machte kehrt und trabte davon. Es war klar, daß er vorhatte, sich um den Wagen zu kümmern. »Erholen Sie sich von dem Schreck«, sagte ich zu dem Butler und ging zum Telefon.
Hamilton Turner folgte mir und setzte sich im Wohnzimmer auf die Couch.
»Haben Sie Cavellos Nummer?« fragte ich ihn.
»Nein, Sie müssen im Telefonbuch nachsehen.«
Eine Minute später hatte ich Louis Cavello an der Strippe. Ich nannte meinen Namen und sagte: »Ich habe eine sehr tragische Nachricht für Sie und bedauere, Sie Ihnen nur per Telefon übermitteln zu können.«
»Es betrifft meine Frau, nicht wahr?« fragte er. Seine Stimme klang gelassen. »Ja. Sie wurde ermordet.«
Am anderen Leitungsende entstand eine kurze Pause, dann fragte Cavello: »Wann und wo?« Seine Stimme hatte sich kaum verändert. Es gab keinen Zweifel, daß die Nachricht vom Tode seiner Frau ihn kaum erschütterte.
Ich nannte ihm die Einzelheiten, verzichtete jedoch darauf, die Entführung von Miriam Cavellos Tochter zu erwähnen.
»Danke«, sagte er und schien auflegen zu wollen.
»Moment, bitte«, sagte ich rasch. »Haben Sie einen Tatverdacht?«
»Nein.«
»Ich stehe unter dem Eindruck, daß der Tod Ihrer Frau Sie weder überrascht noch erschüttert«, sagte ich.
»Überrascht bin ich schon«, meinte er, »aber nicht erschüttert. Sie hat mich betrogen. Wiederholt betrogen. Ich kann dieser Frau nicht nachtrauern.« Es knackte in der Leitung. Cavello hatte aufgelegt. Ich warf den Hörer aus der Hand.
»Wie hat er reagiert?« fragte Hamilton Turner. »Es hat ihm nichts ausgemacht, nicht wahr?«
»Er sagt, daß sie ihn betrogen habe.«
»Das kann ich mir denken«, meinte Hamilton Turner. »Das war ihr Stil, ihre Art. Sie konnte nicht treu sein. Ich wundere mich nicht, daß dieser Cavello froh ist, Miriam endlich los zu sein. Steht er jetzt unter Mordverdacht?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Diese Frage muß das Morddezernat entscheiden. Wenn Sie nichts dagegen haben, schließen wir jetzt das Tonbandgerät an.«
»Cavello hatte ein Motiv, nicht wahr?« murmelte Hamilton Turner. »Der eifersüchtige Ehemann.«
»Er hätte sich scheiden lassen können.«
»Scheidung ist kein Trostpflaster für verletzten Stolz«, entgegnete Hamilton Turner.
Ich musterte ihn aufmerksam. »Haben Sie etwas gegen ihn in der Hand, oder äußern Sie nur Vermutungen?«
»Ich weiß von Miriam, daß er krankhaft eifersüchtig war. Und rachsüchtig. Leute dieses Kalibers sind zu allem fähig«, sagte Hamilton Turner.
Ich zog ein Formular aus meinem Overall. »Das müssen Sie unterschreiben, bitte. Es ist die Einverständniserklärung für Ihre Telefonüberwachung. Sie erlischt, sobald Phyllis’ Entführung geklärt ist.«
»Werden Sie auch das Telefon in meiner Firma überwachen lassen?« fragte er.
»Das ist vorgesehen.«
Er überflog stirnrunzelnd den Inhalt der Erklärung und setzte dann schwungvoll seinen Namen darunter. Ich steckte den Zettel ein und gab telefonisch durch, daß unsere Abhörexperten tätig werden durften. Dann trat ich auf die Terrasse. Hamilton folgte mir. Der Butler saß wie gebrochen auf seinem Stuhl. Milo tauchte auf. Er hatte die schwere Tasche mit dem Tonbandgerät bei sich.
»Ich habe mir den Wagen der Toten angesehen«, meinte er. »Er enthält keine Hinweise auf das Verbrechen. Darf ich jetzt das Gerät anschließen?«
»Hoffentlich führt das nicht zu weiterem Ärger«, sagte Hamilton Turner.
»In einer Viertelstunde werden hier ein Dutzend Beamte herumschwirren«, sagte ich. »Wenn die Entführer tatsächlich Ihr Haus überwachen, kann ihnen das nicht entgehen.«
»Was können wir nur tun, um Phyllis zu finden?« murmelte er. »Ich fange an, um ihr Leben zu zittern.«
»Erst jetzt?«
»Ja, erst jetzt. Ich war eigentlich ganz sicher, daß ich sie zurückerhalten würde. Miriams Tod und der Einbruch in mein Office haben meine Sicherheit erschüttert.«
Ich ging zur Schmalseite des Hauses und blickte an dessen Fassade empor. Alle Fenster waren geschlossen.
»Woran denken Sie?« fragte mich Hamilton Turner.
»Ich versuche den Tathergang zu rekonstruieren. Miriam Cavello befand sich auf dem Wege zur Straße. Der Pfeil traf sie etwa in Höhe des Hauses. Von hinten. Demnach müßte der Schütze hinter ihr gestanden haben... Aber das halte ich für ausgeschlossen. Sehen Sie sich um. Hinter der Ermordeten gab es für den Bogenschützen kein Versteck.«
»Die Hecke des Nachbarn«, wandte Turner ein.
»Stimmt — aber wenn Miriam Cavello von dort beschossen worden wäre, hätte der Pfeil sie schräg treffen müssen. Das trifft nicht zu. Er ist genau von hinteh in ihren Rücken gedrungen.«
»Das ist richtig«, stimmte Hamilton Turner stirnrunzelnd zu. »Sie kann sich umgedreht haben...«
»Richtig«, sagte ich. »Schließlich hat sie einmal hier gewohnt, das Haus und der Garten waren ihr vertraut, sie bildeten ein Stück ihrer Erinnerung. Vielleicht ist Miriam Cavello stehengeblieben, um an der Seitenfassade hochzublicken. In diesem Moment wandte sie dem Heckenschützen auf dem Nachbargrundstück voll ihren Rücken zu.«
»Das ist die Erklärung«, sagte Hamilton Turner.
»Es kann auch genau umgekehrt gewesen sein«, sagte ich.
»Was soll das heißen?«
»Der Schütze stand im Erdgeschoß Ihres Hauses und handelte in dem Augenblick, als Miriam Cavello stehenblieb, um das Rosenbeet zu bewundern. Sie torkelte einige Schritte weiter, ohne zu wissen, was sie tat, dann brach sie tot zusammen.«
»Wenn Sie das vermuten, müssen Sie noch eine dritte Möglichkeit einbeziehen«, bemerkte Hamilton Turner grimmig.
»Ich weiß. Der Butler könnte es getan haben. Aber wie wir wissen«, fügte ich mit mattem Lächeln hinzu, »scheiden Butler in Kriminalfällen fast immer als Täter aus. Sie dienen lediglich dem Zweck, die Ermittlungen zu erschweren.«
»Ich finde das gar nicht witzig«, knurrte Hamilton Turner. Er starrte auf die Tote und schüttelte sich. »Das ist mir zuviel. Ich brauche einen Kognak. Halten Sie mit?«
»Nein, danke«, sagte ich kopfschüttelnd. Hamilton Turner trabte davon.
Ich ging über den kurzgeschorenen Rasen zur Hecke und schaute mich nach Fußspuren um. Ich fand eine Stelle, wo ich mich durch die Hecke zwängen konnte, und setzte die Spurensuche auf dem Nachbargrundstück fort.
»He, Sie«, rief jemand hinter mir. »Was treiben Sie denn da?«
Ich wandte mich um. Ein rothaariges, knapp sechzehnjähriges Mädchen kam auf mich zu. Es trug einen Tennnisdreß. Das schulterlange Haar wurde von einem grünen Stirnband zurückgehalten.
»Trevellian, FBI«, stellte ich mich vor und präsentierte ihr meinen Ausweis.
»Mann, ist das spannend«, sagte sie lächelnd. »Das ist eine Verkleidung, was? Ich wette, die Turners haben ein krummes Ding gedreht. Stimmt’s?«
»Langsam, langsam. Sie wohnen hier?«
»Ja, das ist unser Grundstück. Und unser Bungalow. Ich bin Veronika Langston.«
Ich warf einen Blick auf den L-förmig angelegten Luxusbungalow. Es stand außer Zweifel, daß er mitsamt Grundstück ein Millionenobjekt verkörperte.
»Warum wollen Sie wetten, daß die Turners ein krummes Ding gedreht haben?« fragte ich.
»Weil Papa seit langem damit rechnet.«
»Das ist interessant. Darf man den Grund erfahren?«
Veronika Langston warf einen interessierten Blick durch die Hecke. Der weiße Fleck auf Hamilton Turners Rosenbeet — Miriams Kostüm — wirkte wie ein Magnet.
»Mein Gott«, stieß das Mädchen erschrocken hervor. »Ist sie tot?«
»Ja«, sagte ich. »Mrs. Cavello, Mr. Turners geschiedene Frau. Kannten Sie sie?«
»Nein, wir sind erst vor einem Jahr hergezogen, da war Mr. Turner schon geschieden. Sie hat ja einen Pfeil im Rücken — wie entsetzlich!«
»Kennen Sie jemand in der Nähe, der mit Pfeil und Bogen schießt?« fragte ich. »Benny, mein Bruder.«
»Wo ist er?«
Das Mädchen starrte mir blaß und empört in die Augen. »Sie glauben doch nicht etwa...?«
»Ich glaube noch gar nichts«, fiel ich ihr ins Wort, »aber Sie werden verstehen, daß ich sehr gründlich vorgehen muß.«
»Benny ist doch kein Mörder!«
»Es könnte ein Unfall gewesen sein.«
»Benny kommt für die Tat nicht in Frage«, sagte sie. »Er ist gar nicht zu Hause.«
»Wo ist er?«
»In die City gefahren. Schon vor zwei Stunden. Fragen Sie meinen Vater, der kann es Ihnen bestätigen.«
Wir trafen Veronikas Vater, Mr. Hugh Langston, im Schatten der Terrassenmarkise. Er saß in einem bequemen Liegestuhl und las die Sonntagszeitung. Bei unserem Näherkommen faltete er sie zusammen und legte sie aus der Hand.
»Das ist Mr. Trevellian vom FBI, Papa«, sagte das Mädchen aufgeregt. »Stell dir vor — bei den Turners ist ein Mord passiert.«
»Ach«, sagte Langston nur und schaute mich an. »Können Sie sich ausweisen, junger Mann?«
Ich tat, was er verlangte. Er wies auf einen Stuhl.
»Setzen Sie sich. Wer ist ermordet worden?«
»Turners geschiedene Frau«, sagte das Mädchen eifrig. »Mit einem Pfeil.«
»Du hältst jetzt den Mund«, meinte Langston. Er schaute mich an. »Stimmt es, was sie sagt?«
»Ja.«
»Mit einem Pfeil«, meinte er kopfschüttelnd. »Nicht zu glauben.«
»Wie ich hörte, ist Ihr Sohn ein guter Bogenschütze.«
»Ja«, sagte Langston, »aber kein Mörder. Wenn er übt, dann nur hinten im Garten — alles andere habe ich ihm verboten.«
»Wo bewahrt er das Sportgerät auf?«
»In der Garage. Sie verdächtigen doch nicht etwa Benny?«
»Ich möchte mich nur davon überzeugen, ob der Bogen noch an seinem Platz hängt.«
»Zeige ihm die Garage, Veronika«, sagte Langston. »Mich entschuldigen Sie bitte.« Er hob den rechten Fuß etwas an. »Ich bin gerade dabei, eine Sehnenzerrung auszukurieren.«
Veronika führte mich zu der Doppelgarage, die in Höhe des Bungalows auf der anderen Grundstücksseite lag. Beide Boxen waren offen. An der Rückwand der leeren Garage hingen Pfeil und Bogen, daneben stand eine popfarbig bemalte Zielscheibe.
»Hier kann sich jeder bedienen, dem danach zumute ist«, stellte ich fest.
»Mit so einem Ding muß man erst einmal umgehen können«, sagte das Mädchen. »Man braucht viel Kraft, um den Bogen zu spannen — und treffen tut man nur dann, wenn man stundenlang trainiert hat. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht.«
Hinter uns, auf dem betonierten Vorplatz, stoppte ein Wagen. Ich machte kehrt. Aus einem abenteuerlich aufgemachten Ford-T-Modell kletterte ein sommersprossiger junger Mann. Ich schätzte ihn auf neunzehn.
»Das ist Benny«, sagte das Mädchen und erklärte ihm mit wenigen Worten, was geschehen war.
»Das muß ich mir ansehen«, murmelte Benny Langston. »Darf ich?«
Drei Minuten später standen wir neben der Leiche. Benny Langston beugte sich über sie.
»Das ist ein Hurricane«, erläuterte er fachmännisch. »Der beste und teuerste Pfeil auf dem Markt. Ich besitze nur solche der Marke Johnson.«
»Das habe ich inzwischen bemerkt«, sagte ich.
Benny Langston richtete sich auf. »Die Dinger haben eine ungeheure Durchschlagskraft«, meinte er, »aber nach Lage der Dinge würde ich meinen, daß der Täter nicht sehr weit von hier entfernt gestanden haben kann.«
»Genau«, sagte ich.
»Er hat sich entweder hinter unserer Hecke verborgen, oder er stand an einem der Fenster von Turners Haus...«
»Es gibt noch eine dritte Möglichkeit«, sagte ich. »Der Täter kann ungeschützt neben dem Swimming-pool gestanden haben. Im Augenblick des Verbrechens bewegte sich Mrs. Cavello, die sich von dem Butler verabschiedet hatte, vermutlich auf die Straße zu.«
»Ein tolles Ding«, murmelte der junge Mann kopfschüttelnd und schob seine Schwester beiseite. »Geh zurück, Veronika. Das ist kein Anblick für junge Mädchen.« Das Girl nickte und verschwand hinter der Hecke.
»Wo gibt es Pfeile der Marke Hurricane zu kaufen?« fragte ich Benny Langston.
Er trug einen hellblauen Nicki und verwaschene Jeans. Sein Gesicht und die muskulösen Arme waren stark gebräunt. Er hatte die Hände flach in die Gesäßtaschen seiner Hosen geschoben.
»In jedem besseren Sportartikelgeschäft«, meinte er. »Wie gesagt, nur in den besseren. Die Biester sind verdammt teuer.«
»Kann man sie von jedem Sportbogen abfeuern?«
»Ja — vorausgesetzt, daß die Spannweite ausreicht, aber das trifft für die meisten Sportbogen zu.«
»Wie viele Leute betreiben diesen Sport?«
»In New York? Tausende. Es ist ein großes Hobby geworden. Ich schätze, daß es mindestens dreißig Klubs gibt, die sich damit befassen. Die Gesamtmitgliederzahl dürfte weit über fünftausend liegen. Das ist natürlich nur eine vorsichtige Schätzung.«
»Unser Schütze war ein Meister seines Fachs«, sagte ich. »Wie steht es mit denen?«
»Auch davon gibt es Dutzende«, meinte Benny Langston.
»Ich vermute, daß wir den Täter in einem der Klubs suchen müssen«, sagte ich. »Wer so genau schießt, hat den Wunsch, sich mit anderen zu messen. Er will sein Können zeigen.«
»Das leuchtet mir ein«, meinte Benny Langston, »aber es bringt Sie nicht weiter. Sie können doch nicht die Alibis von hundert oder zweihundert Bogenschützen überprüfen.«
»Wenn es sein muß, können wir auch das.«
»Na, dann viel Vergnügen.«
»Sind Sie in einem Klub?«
»Als Sportbogenschütze? Nein«, erwiderte er. »Sehen Sie, das müssen Sie in Rechnung stellen. Ich bin ein guter, treffsicherer Bogenschütze, ganz bestimmt. Aber ich hasse Vereinsmeierei. Ihre Theorie, die Sie vom mutmaßlichen Verhalten des Killers entwickelten, muß also durchaus nicht zutreffen. Nicht jeder, der etwas leistet, fühlt den Drang, sich mit anderen zu messen.«
Ich kehrte mit ihm auf das Nachbargrundstück zurück. Hugh Langston blickte uns neugierig entgegen. Während Benny berichtete, was er gesehen hatte, warf ich einen Blick über meine Schulter. Von hier aus war der Teil der Hecke, wo der Mörder vermutlich gestanden hatte, nicht zu sehen.
»Setzen Sie sich doch«, bat mich Langston.
Ich nahm auf einem Stuhl Platz. »Ihre Tochter ließ erkennen, daß Sie die Turners nicht sonderlich schätzen.«
»Das stimmt«, sagte er.
»Leben Sie mit Ihrem Nachbarn im Streit?«
»O nein — aber ich... Wir sprechen kaum miteinander. Ich schätze diesen Typ nicht.«
»Was meinen Sie damit?«
»Darf ich -offen sein? Ich halte Turner für einen Parvenü, für einen typischen Neureichen. Er hat sein Geld vor allem mit der Kraft seiner Ellenbogen erworben. Ich mache ihm das nicht zum Vorwurf. Aber ich kann auch nicht sagen, daß ich Menschen schätze, die mit dieser Methode arbeiten. Wissen Sie, ich kenne zufällig ein paar Leute, die von ihm geschädigt worden sind. Sogar ruiniert. Er spielt im Baugewerbe eine große Rolle. Dort operiert man nicht mit Samthandschuhen, ich weiß, aber Turners Geschäftspolitik ist doch bedeutend hemdsärmeliger, als das die Branche gewohnt ist. Ich könnte Ihnen Dinge berichten, die sich haarsträubend anhören — aber ich verzichte lieber darauf, denn erstens kann ich diese Sachen nicht beweisen, und zweitens habe ich keine Lust, mir von Turner einen Verleumdungsprozeß anhängen zu lassen.«
»Hat er eine Freundin?« fragte ich.
»Ja, eine sehr attraktive geschiedene Frau. Ich weiß nur, daß sie mit Vornamen Tina heißt.«
»Woher wissen Sie, daß sie geschieden ist?«
»Wenn man auf der Terrasse oder im Garten in der Sonne liegt, hört man zwangsläufig hin und wieder etwas von dem, was nebenan geschieht. Daher kenne ich den Namen der Frau. Sie rief Turner einmal spöttisch zu: ›Du schwimmst wie mein geschiedener Mann — mit viel Kraft, aber ohne Eleganz.‹«
»Was ist mit Phyllis, Turners Tochter?« fragte ich.
»Oh, sie ist ein außergewöhnlich hübsches Mädchen, glaube ich«, meinte Hugh Langston. »Das ist doch richtig, Benny?«
Benny wandte mürrisch den Kopf. »Warum fragst du gerade mich?« knurrte er.
Hugh Langston lachte. »Sie ist ungefähr dein Jahrgang, nicht wahr? Dein Urteil dürfte in diesem Fall kompetenter sein als meines.«
»Ich habe keinen Kontakt mit ihr«, sagte Benny. »Die meisten ihrer Freunde sind weit über zwanzig.«
»Veronika sagte vorhin ganz impulsiv: ›Ich wette, die Turners haben ein krummes Ding gedreht.‹ Was brachte sie zu dieser spontanen Äußerung?«
»Das ist wohl meine Schuld«, sagte Hugh Langston. »Ich ziehe schon gewohnheitsmäßig über meinen Nachbarn her. Sie kennen den Grund. Ich habe zuviel Schlechtes über ihn gehört.«
»Können Sie mir ein Beispiel nennen?«
»Lieber nicht«, meinte er. »Ich möchte keinen Ärger bekommen.«
»Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt«, sagte ich.
»Es kann ja auch Klatsch sein...«
»Schießen Sie schon los«, sagte ich.
»Es heißt, er würde auch vor Versicherungsbetrug nicht zurückschrecken. Angeblich läßt er ›Tips‹ an die Unterwelt gehen, die dem Zweck dienen, Gangster und Safeknacker anzulocken. Er will, daß man ihn beraubt. Natürlich hat er vor, der Versicherung gegenüber ganz andere Beträge zu nennen, als ihm gestohlen wurden.«
»Diese Vermutung steht auf schwachen Füßen«, sagte ich. »Hamilton Turner müßte in einem solchen Fall befürchten, von den hereingefallenen Einbrechern erpreßt zu werden.«
»Diese Leute können ihn nicht gut anzeigen«, sagte Hugh Langston. »Sie würden sich damit selbst belasten — und am Ende würde man natürlich Turner glauben. Er ist auf seine Weise sehr geschickt. Soviel ich weiß, hat er in den letzten Jahren eine Menge Arbeit, Geld und Mühe darauf verwandt, seinen Ruf zu verbessern. Er hat es sogar geschafft, Vorsitzender in mehreren obskuren Wohlfahrtsverbänden zu werden.«
»Hm«, machte ich. »Es wird Sie in diesem Zusammenhang interessieren, daß in der vergangenen Nacht der Safe seines Privatoffice geknackt wurde.« Langston hob die Augenbrauen. »Tatsächlich? Na, bitte, das bestätigt doch meine Theorie!«
»Keineswegs«, sagte ich. »Es paßt nur zu ihr. Zu einer Bestätigung gehört bedeutend mehr.«
»Was ist ihm gestohlen worden?«
»Er spricht von hunderttausend Dollar und einer Schmuckkassette«, sagte ich.
»Hm — die hunderttausend Dollar dienen ihm nur als Tarnung. Ich möchte wetten, daß es um den Inhalt der Schmuckkassette geht. Damit wird er sein Geschäft machen wollen. Lassen Sie mich schätzen. Ich tippe auf achthundertfünfzigtausend Dollar. Zusammen mit dem angeblich gestohlenen Bargeld macht das fast eine Million. Nicht ganz, wohlgemerkt. Wegen der Optik.«
»Das klingt gehässig, Papa«, beschwerte sich Veronika. »Was hast du nur gegen ihn?«
»Das weißt du doch.«
Ich blickte auf meine Uhr. »Entschuldigen Sie mich jetzt bitte. Ich muß drüben nach dem Rechten sehen. Die Mordkommission muß jeden Augenblick eintreff en.«
Ich kehrte auf Hamilton Turners Grundstück zurück. Der Butler war von der Terrasse verschwunden. Auch Milo und Turner waren nicht zu sehen. Ich trat auf die Wohnzimmerschwelle. Turner saß am Telefon. Er hatte die Ellenbogen auf die Knie gestützt und sein Gesicht in die Hände gelegt. Er wirkte im Moment erschöpft, gramgebeugt und abgeschlafft, keineswegs so, wie Hugh Langston ihn geschildert hatte.
»Wie fühlen Sie sich?« fragte ich ihn.
Er zuckte hoch. »Miserabel. Wo haben Sie gesteckt?«
»Bei Ihrem Nachbarn.«
»Ach, bei dem Scheißkerl!«
»Wieso?«
»Der bildet sich was auf seine Herkunft ein. Angeblich sind seine Vorfahren mit der ›Mayflower‹ angekommen. Amerikanischer Landadel! Da kann ich nur lachen. Ich hasse diese Angeber. Sie leben von dem Geld, das sie geerbt haben, und wissen nicht, was Arbeit heißt.«
»Das klingt nicht sehr freundlich«, sagte ich amüsiert.
»Ich habe nicht vor, meine Ansicht über ihn zu korrigieren«, meinte er.
»Darf man fragen, welche Werte die in Ihrem Office gestohlene Schmuckkassette enthielt?« fragte ich.
»Smaragde und Rohbrillanten im Wert von achthundertfünfzigtausend Dollar«, erwiderte er.
Mir blieb fast die Luft weg. Hugh Langston hatte den Kassetteninhalt auf den Dollar genau geschätzt. Zufall, Kalkulation oder Wissen?
»Dann sind Sie, zusammen mit dem gestohlenen Bargeld, um rund eine Million geschädigt worden«, stellte ich fest.
»Ich bin versichert«, meinte er. »Ärgerlich bleibt das Verbrechen trotzdem. Sie wissen, wie sich die Versicherungsgesellschaften anstellen, wenn sie einen hohen Schaden decken müssen. Ich darf gar nicht an die damit verbundenen Fragen, Zweifel und Ermittlungen denken. Ach, zum Teufel damit! Jetzt geht es um Phyllis. Warum rufen die Kerle nicht an?«
»Wo ist mein Kollege?« fragte ich.
»Mr. Tucker? Irgendwo im Haus.«
»Gestatten Sie, daß ich ihn suche?«
»Bitte«, meinte er.
Ich verließ das Zimmer und betrat die hohe, kühle Halle. Eine repräsentative, geschwungene Holztreppe mit geschnitztem Geländer führte in das obere Stockwerk. An ihr vorbei führte ein Korridor in die Wirtschaftsräume. Die Tür zur Küche stand offen. Ich warf einen Blick ins Innere des Raumes und sah, daß der Butler damit beschäftigt war, die elektrische Fruchtpresse mit geschälten Orangen zu füllen.
»Wo ist mein Kollege?« fragte ich ihn.
Er zuckte erschrocken herum. »Pardon«, sagte er zitternd. »Ich habe mich erschrocken. Ich habe Sie nicht kommen hören. Ihr Kollege? Ich weiß es nicht.«
Auf der anderen Seite der Halle zweigten von einem kurzen Korridor mehrere Türen ab. Sie führten zu den Zimmern, deren Fenster zum Tatort wiesen.
Ich betrat einen kleinen grüntapezierten Salon, durchquerte ihn und öffnete die Tür zum Nebenzimmer.
Ich stoppte auf der Schwelle.
Mir war zumute, als sei ich im Hundertmeilentempo gegen eine Betonwand gefahren.
Vor dem antiken Schreibsekretär lag ein Mann auf dem Boden und rührte sich nicht. Ein Mann im grünen Overall.
Mein Freund Milo.
***
Ich war mit drei Schritten bei ihm.
»Milo!« stieß ich hervor und drehte ihn herum.
Er blutete stark aus einer Kopfwunde und war bewußtlos. Ich überzeugte mich davon, daß sein Puls in Ordnung war, dann rannte ich ins Wohnzimmer zurück.
»Rasch, einen Arzt!« rief ich Turner zu. »Es ist dringend. Mein Kollege ist niedergeschlagen worden.«
»Wie konnte das...?« begann er verblüfft.
»Ich weiß es nicht«, sagte ich. »Ihre Fragen haben Zeit bis später. Rufen Sie den Arzt!«
Ich kehrte zu Milo zurück, hob ihn auf und bettete ihn auf ein Sofa. Er stöhnte leise. Ich schob ein Kissen unter seinen Kopf und stellte fest, daß die Wunde an der Schläfe nicht sehr groß war. Das hatte freilich nicht viel zu bedeuten; möglicherweise hatte die Härte des Schlages innere Schäden ausgelöst.
Ich trat an das Fenster und blickte hinaus. Das Fenster lag dem Rosenbeet genau gegenüber. Milo murmelte etwas. Ich wandte mich ihm zu. Er hob die Lider, schloß sie aber sofort wieder.
»Mann, mein Kopf!« flüsterte er.
»Bleib ruhig liegen«, sagte ich. »Der Arzt ist benachrichtigt.«
»Ich brauche keinen Arzt«, knurrte Milo. Er öffnete diesmal seine Augen bedeutend langsamer und vorsichtiger. »Ich brauche den Kerl, der mich auf Tauchstation geschickt hat.«
»Hier im Zimmer?«
»Ja. Noch ehe ich wußte, wie mir geschah, knallte er mir etwas auf den Kopf.«
»Hast du den Mann erkannt?«
»Nein«, erwiderte Milo. »Der Bursche hatte eine Maske vor dem Gesicht.«
»Glaubst du, daß es Miriam Cavellos Mörder war?«
»Keine Ahnung.«
»Hatte er einen Bogen bei sich?«
»Nicht, als er auf mich losging.«
»Wie war er gekleidet?«
»Nicht sehr auffallend. Ganz durchschnittlich, würde ich sagen«, meinte Milo und betastete vorsichtig die blutende Wunde. »Er trug eine Sportkombination. Brauner Sakko, dunkle Hose, dazu so ’n Robin-Hood-Sporthütchen. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Ach ja, die Augen. Sie waren dunkel.«
»Wo passierte es genau?«
»Er muß hinter dem Schrank gestanden haben«, sagte Milo. »Ich betrat das Zimmer und ging geradewegs auf das Fenster zu, um festzustellen, ob der Mörder dort gestanden haben kann. Als ich ein Geräusch hinter mir hörte, drehte ich mich um. Ich sah nur noch den zum Schlag erhobenen Arm des Maskierten und riß instinktiv meinen Ellenbogen hoch, aber die Reaktion kam zu spät. Ich kann nicht einmal genau sagen, womit der Kerl zugeschlagen hat.«
Ich blickte zum Fenster. »Es ist geschlossen.«
»Das war es bereits, als ich hereinkam.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, daß das der Mörder von Miriam Cavello war«, sagte ich nachdenklich. »Was sollte ihn dazu bewogen haben, nach der Tat so lange im Haus zu bleiben? Fast zwanzig Minuten! Das mutet nach Lage der Dinge selbstmörderisch an. Ihm muß doch klar gewesen sein, daß er sich damit der Gefahr des Gefaßtwerdens durch die Polizei aussetzte.«
»Nicht unbedingt.«
»Wieso?«
»Nach einem Mord setzt man automatisch voraus, daß der Killer sofort flieht. Ein kühler Kopf kann das in sein Kalkül einbeziehen und das genaue Gegenteil von dem tun, was man von ihm erwartet«, sagte Milo. »Noch eins. Seit dem Mord ist bestenfalls eine Viertelstunde vergangen. Mehr nicht. Vielleicht besitzt der Bursche tatsächlich ein tadelloses Nervenkostüm. Er kann sich kaltschnäuzig ausgerechnet haben, daß gut eine halbe Stunde vergehen dürfte, ehe die Mordkommission hier draußen aufkreuzt. Er wollte feststellen, was sich inzwischen hier tut.«
»Das ist nicht sehr wahrscheinlich, oder?«
»Der Mann war maskiert«, sagte Milo.
»Demzufolge hatte er verdammt gute Gründe, sein Gesicht nicht zu zeigen. Mit anderen Worten: Er hielt sich ohne Wissen und Billigung Turners hier im Haus auf.«
»Das muß nicht unbedingt zutreffen.«
»Wieso nicht?«
»Nehmen wir einmal an, Turner hatte den Wunsch, sich aus Gründen, die wir nicht kennen, für immer von seiner geschiedenen Frau zu lösen. Möglicherweise wußte er, daß Miriam heute hier aufkreuzen wollte. Er bestellte den Mörder her und arrangierte alles so, daß er für die Tatzeit ein Alibi hat. Turner, meine ich. Er war bei uns, als seine Exfrau ermordet wurde.«
»Erstens war Turner bereits von seiner Frau getrennt, und zweitens würde deine Theorie voraussetzen, daß der Butler mit von der Partie war«, sagte Milo. »Ich hatte jedoch nicht den Eindruck, daß er schauspielerte. Er war echt schockiert.«
»Übrigens hat Turners Nachbar keine gute Meinung von unserem Gastgeber.«
»Der übliche Klatsch?«
»Er beruht offenbar auf Gegenseitigkeit«, sagte ich, »aber ich muß dir erzählen, was Langston...« Ich unterbrach mich, da ich Schritte hörte.
Die Tür öffnete sich. Hamilton Turner betrat das Zimmer.
»Wie geht es Ihnen, mein Freund?« fragte er Milo. »Lieber Himmel, Sie sehen ja gräßlich aus. Dieses Blut. Überall Blut, Blut, Blut! Mich macht das fertig.« Er ließ sich schwer auf einen Stuhl fallen. »Was ist geschehen?«
Milo sagte es ihm. Hamilton Turner schüttelte den Kopf.
»Diesen Tag vergesse ich nie«, meinte er.
Milo setzte sich behutsam auf. »Ich gehe nur rasch mal ins Badezimmer. — Au, mein Schädel!«
»Der Arzt ist informiert«, sagte Turner.
Milo ging hinaus und schloß die Tür hinter sich.
»Was sagen Sie zu alledem?« erkundigte sich Hamilton Turner bei mir. »Erst die Entführung. Dann der Einbruch, schließlich Miriams Tod — und nun der Überfall auf Ihren Kollegen. Es will nicht in meinen Kopf.«
»Ich nehme an, daß es da gewisse Zusammenhänge gibt«, sagte ich. »Wie kann der Mann ins Haus gekommen sein?«
»Was weiß ich«, meinte Hamilton Turner achselzuckend. »Im Sommer ist das kein Problem. Vielleicht war’s ein harmloser Einschleichdieb. Bei offenen Terrassentüren haben es die Burschen leicht. Im vergangenen Jahr ist mir auf diese Weise ein wertvolles Briefmarkenalbum abhanden gekommen.«
Im Wohnzimmer klingelte das Telefon. Hamilton Turner schoß von seinem Stuhl hoch.
»Das sind die Entführer«, sagte er schwer atmend. »Ich habe es im Gefühl. Kommen Sie mit, bitte. Ich weiß nicht, wie das Tonbandgerät zu bedienen ist.«
***
Eddie Floyd erhob sich langsam, als es an der Wohnungstür klingelte. Er betrat die Diele und ließ Joe Marks herein.
Joe Marks grinste breit. »Dir ist niemand gefolgt, alter Junge«, sagte er und ging in das kleine unaufgeräumte Wohnzimmer. »Na, wie war’s?«
»Sensationell«, meinte Eddie Floyd und schloß die Wohnzimmertür hinter sich.
Marks setzte sich. »Was soll das heißen?«
»Es hat noch einen Mord gegeben.«
»Waaas?«
»Ja. Turners Exehefrau ist umgelegt worden. Mit Pfeil und Bogen. Ich war Augenzeuge.«
»Nimmst du mich auf den Arm?«
Eddie Floyd setzte sich. »Ich wäre dazu in der Stimmung«, sagte er. »Ich bin nämlich prächtig gelaunt. Einfach fabelhaft. Aber ich sage die Wahrheit.«
»Du beobachtest einen Mord und bist gut gelaunt?«
»Aber sicher«, meinte Eddie Floyd, »ich traue mir nämlich zu, den Killer zu schnappen.«
»Willst du den Bullen die Arbeit abnehmen?« fragte Joe Marks verständnislos.
»Apropos Bullen«, meinte Eddie Floyd. »Zwei davon hielten sich in Turners Haus auf. FBI-Männer. Als Gärtner getarnt. Und ich ahnungsloser Engel wäre ihnen um ein Haar in die Arme gelaufen! Einen von ihnen mußte ich zusammenschlagen, als er mich in meinem Versteck überraschte.«
»Ich verstehe kein Wort. Du hattest doch vor...«
Eddie Floyd verdrehte die Augen und fiel seinem Komplizen ungeduldig ins Wort. »Ich habe getan, was ich vorhatte«, sagte er. »Ich schlich mich in Turners Bude ein, um ihn zu belauschen und gegebenenf alls zur Rede zu stellen. Ich suchte mir ein kleines Zimmer aus, von dem ich glaubte, daß es nicht betreten oder benutzt werden würde, und verbarg mich hinter der Gardine, um zu sehen, was draußen so vor sich ging.«
»Und da sahst du den Mörder...?«
»Genau«, nickte Eddie Floyd, »nur hatte ich anfangs keine Ahnung, was der Bursche plante. Ich dachte, es sei ein neugieriger Nachbar — ausgerüstet mit Pfeil und Bogen.«
»Mit Pfeil und Bogen?« staunte Joe Marks.
»Mann, kannst du mich nicht ausreden lassen?« knurrte Eddie Floyd.
»Ich bin ganz aufgeregt. Hast du einen Gin da?«
»Du weißt, wo er steht. Bedien dich«, sagte Eddie Floyd und sah zu, wie sein Komplize eine Flasche und zwei Gläser aus dem Sideboard holte.
»Nimmst du auch einen?« fragte ihn Marks und nahm wieder Platz.
»Nein, ich möchte nüchtern bleiben. Wir stehen schließlich vor dem größten Fischzug unseres Lebens.«
»Ach, das glaubten wir gestern auch«, meinte Joe Marks bitter. »Und was haben wir nach stundenlanger, harter Arbeit gefunden? Dreihundert Dollar und eine Mädchenleiche.«
»Immerhin weiß ich jetzt, wer sie ist.« Joe Marks riß die Augen auf. »Tatsächlich?«
»Wenn du mich nicht immerzu unterbrechen würdest, hätte ich dir die Fakten längst geliefert«, sagte Eddie Floyd. »Es ist seine Tochter.«
»Nein!«
»Ich sagte dir doch, daß es sensationell ist. Ich sah, wie die Frau von dem Bogenschützen umgelegt wurde. Sie schrie, stolperte ein paar Schritte zur Seite und fiel in ein Rosenbeet. Dort blieb sie liegen, ohne sich zu rühren. Tot.«
»Mann — und du hast zugesehen«, murmelte Joe Marks.
»Ich sah, wie der Killer anlegte und abzog«, sagte Eddie Floyd. »Mir fielen fast die Augen in die Tüte. Es ist keine Kleinigkeit, Augenzeuge eines Mordes zu sein, weißt du.«
»Wer war der Killer?«
»Ein junger Mann, so um die fünfundzwanzig herum. Er trug einen Blazer, eine Klubkrawatte und helle Hose. Nach dem Schuß spurtete er zur Straße. Ich sah, wie er in seinen dort parkenden Sportwagen sprang und losbrauste. Kurz danach tauchten Turner und zwei Männer im Overall neben der Toten auf. Ich konnte jedes Wort verstehen, das sie miteinander wechselten. Stell dir vor: Phyllis, die Tochter Turners, ist entführt worden. Die beiden Gärtner waren G-men, die mit den Ermittlungen beauftragt worden waren.«
»Das ist wirklich sensationell«, meinte Joe Marks und kippte schon den zweiten Gin hinab.
»Laß jetzt das Trinken«, sagte Eddie Floyd. »Wir brauchen starke Nerven.«
»Die hab’ ich«, behauptete Joe Marks, aber er schob die Flasche gehorsam beiseite.
»Wir müssen den Killer finden«, sagte Eddie Floyd. »Um jeden Preis.«
»Du willst ihn erpressen?«
»So ist es, Partner.«
»Hast du dir die Wagennummer gemerkt?«
»Die,konnte ich nicht erkennen.«
Joe Marks runzelte die Augenbrauen. »Wie, zum Henker, willst du ihn dann finden? Ein junger Mann in Blazer und Klubkrawatte! Von dieser Sorte laufen in der Stadt mindestens hunderttausend herum.«
»Ich weiß.«
»Woher, zum Teufel, nimmst du dann deinen Optimismus?«
Eddie Floyd schaute grinsend auf seine Uhr. »Ich hoffe, den Burschen in drei, vier Stunden zu kennen. Namentlich.«
»Ich verstehe. Du kennst ihn. Vom Ansehen. Du weißt, wo er wohnt oder arbeitet.«
»Nein, das ist mir nicht bekannt.«
»Spanne mich nicht auf die Folter, Mann.«
»Seine Krawatte wird mich ans Ziel bringen.«
»Seine Krawatte?«
»Seine Klubkrawatte«, stellte Eddie Floyd richtig. »Erinnerst du dich an den Bruch, den wir vor zwei Jahren im New Addington Golf Club gemacht haben?«
»Lausige zweihundertzehn Dollar Beute«, sagte Joe Marks verächtlich. »Erinnere mich bloß nicht daran.«
»Ich denke nicht an das Geld. Ich denke an die Krawatten des Klubs. Sie wurden nur an Mitglieder verkauft. Ich habe eine davon mitgenommen, aus Jux. Weil mir die Farben und Streifen gefielen. Deshalb kenne ich sie so genau. Unser Mörder trug eine solche Krawatte.«
Joe Marks stieß einen Pfiff aus. »Jetzt kapiere ich. Du glaubst, er sei Klubmitglied.«
»Das ist er ganz sicher«, meinte Eddie Floyd und stand auf. »Ich fahre jetzt hin.«
»Zum New Addington Golf Club?«
»Sicher, wohin denn sonst? Das Wetter ist ausgezeichnet. Auf dem Rasen werden sich eine Menge Leute tummeln. Ich mische mich als Gast zwischen sie.«
»Wer sagt dir, daß der Mörder ausgerechnet heute, nur wenige Stunden nach dem Verbrechen, dort Golf spielen wird?«
Eddie Floyd lachte leise. »Dir fehlt es wirklich an Phantasie, alter Junge. Du kennst doch unsere Klubs. Und ihre Mitglieder. In den Klubräumen sind die Wände bepflastert mit Diplomen und Gruppenfotos...«
»Ich verstehe«, sagte Joe Marks grinsend. »Du hoffst den Burschen auf einem der Bilder zu erkennen.«
»Du machst Fortschritte«, meinte Eddie Floyd spöttisch. »Du hast ganz recht. Das habe ich vor. Der Junge hatte ein sehr ausdrucksvolles Gesicht. Ich würde es sofort wiedererkennen, auf einem Foto oder in Natur.«
»Soll ich mitkommen?« fragte Joe Marks eifrig.
»Lieber nicht«, meinte Eddie Floyd und stand auf. »Du bist nicht der Typ, der auf einen Golfplatz paßt.«
»Du siehst auch nicht gerade aus wie eine Neuauflage von Errol Flynn«, giftete Joe Marks.
Eddie Floyd lachte. »Immerhin habe ich gelernt, mich auszudrücken. Und meine Sommerkombination stammt aus einem guten Laden. Ich werde dort kein unliebsames Aufsehen erregen, ich werde mich sicher zwischen diesen Geldsäcken bewegen.«
»Und dann?«
»Dann kommt der Clou, dann quetschen wir den Killer aus wie eine Zitrone.«
»Hm«, machte Joe Marks beeindruckt. »Er kann es sich nicht leisten, unter Mordanklage gestellt zu werden. Das wird er sich eine Kleinigkeit kosten lassen.«
»So ist es.« '
»Aber was ist, wenn er kein Geld hat — wenn er vielleicht sogar im Auftrag eines anderen handelte?«
»Daran habe ich schon gedacht«, sagte Eddie Floyd. »Es ist ohnehin wenig wahrscheinlich, daß er persönliche Gründe hatte, die Frau abzuservieren. Schließlich waren die beiden mindestens zwanzig Jahre auseinander. Nein, er hatte einen Auftraggeber, das ist ziemlich sicher. Wenn der Killer kein eigenes Geld hat, wird er uns diesen Auftraggeber nennen müssen. Wenn auch dort nichts zu holen ist, müssen wir erwägen, uns mit der noch auszusetzenden Belohnung zufriedenzugeben. Vielleicht ist auch bei dem Ehemann der Ermordeten etwas zu holen.«
»Das hört sich gut an«, sagte Joe Marks, »aber es löst noch nicht das Problem Hamilton Turner. Bei dem ist doch viel mehr zu holen!«
»Das will ich hoffen.«
»Warum hältst du die Reihenfolge nicht ein? Erst Turner — dann die anderen.«
»An Turner komme ich im Augenblick nicht heran.«
»Du brauchst ihn nur anzurufen!«
»Offenbar hast du mir nicht gut zugehört«, sagte Eddie Floyd ungeduldig. »Das FBI ist in seinem Haus. Angeblich ist seine Tochter entführt worden. Sie überwachen selbstverständlich das Telefon. Meinst du, ich hätte Lust, meine Stimme im Radio wiederzuhören?«
»Du denkst an alles«, lobte Joe Marks. »Trotzdem weiß ich nicht, was ich von dieser Geschichte halten soll. Von der Entführung, meine ich. Warum sollte Turner die eigene Tochter entführt und umgebracht haben?«
»Darüber zerbreche ich mir nicht den Kopf. Er wird schon Gründe gehabt haben.«
»Zum Beispiel?«
»Ich weiß es nicht, verdammt noch mal«, sagte Eddie Floyd nervös. »Vielleicht hat er irgendein krummes Ding gedreht, und sie ist ihm hinter die Schliche gekommen. Wenn man sich Mühe gibt, kann man ein Dutzend Gründe finden.«
»Ein Vater, der seine Tochter töten läßt und das Ganze als Entführung tarnt — nicht zu glauben!«
»Wir lassen ihn erst einmal in seinem eigenen Saft schmoren«, meinte Eddie Floyd. »Ich fahre jetzt zum Klub.«
»Was machen wir bloß mit der Mädchenleiche?« fragte Joe Marks besorgt.
»Die bleibt im Keller. In der alten Tiefkühltruhe.«
»Wenn man sie findet, werden sie versuchen, uns die Entführung anzuhängen.«
»Warum sollte man sie finden? Der Keller ist abgeschlossen — und niemand hat gesehen, wie wir die in zwei Decken gewickelte Leiche nach unten getragen haben.«
»Du bist lustig!« knurrte Joe Marks. »Ich gebe ja zu, daß du von uns beiden mehr Grips hast, aber manchmal frage ich mich, wo deine Gedanken sind. Du fragst, warum man sie finden sollte. Na, warum wohl? Weil bloß irgend jemand in dieser verdammten Stadt einen Bruch zu machen braucht, der nach Ansicht der Polizei unsere Handschrift trägt — und schon werden sie deine und meine Bude mitsamt den Kellerräumen und Garagen auf den Kopf stellen.«
»Der Keller, den wir benutzen, gehört nicht zu dieser Wohnung«, sagte Eddie Floyd.
»Aber der Hausmeister weiß, daß du ihn gemietet hast — angeblich zur Benutzung als Dunkelkammer.«
»Der Hausmeister ist unser Freund. Er haßt die Bullen. Von dem haben wir nichts zu befürchten.«
»Na, hoffentlich.«
»Ich fahre jetzt los. Wo erreiche ich dich?«
»Bei mir zu Hause.«
***
Zwei Stunden nach diesem Gespräch hatte Eddie Floyd einige Mühe, auf dem großen asphaltierten Parkplatz des New Addington Golf Club für seinen Wagen eine Lücke zu finden. Das schöne Wetter sorgte für Hochbetrieb. Eddie Floyd war das nur recht. Viele Mitglieder hatten Gäste mitgebracht; ein fremdes Gesicht fiel an diesem Tag niemand auf.
Eddie Floyd stieg aus und bummelte an Dutzenden von abgestellten Fahrzeugen vorbei zum Klubhaus. Der Sportwagen, den der Mörder benutzt hatte, befand sich nicht auf dem Parkplatz.
Eddie Floyd setzte sich in die Bar an einen Zweiertisch, da am Tresen alles besetzt war. Er steckte sich eine Zigarette an und bestellte bei dem Ober einen Orangensaft. Er genoß das Stimmengeschwirr, lächelte einem knapp fünfjährigen Mädchen zu, das ihn großäugig musterte, und hob dann den Blick zu den gerahmten Fotos empor, die über ihm an der Wand hingen.
Das kleine Mädchen klatschte in die Hände, um seine Aufmerksamkeit zu wecken, und lief enttäuscht davon, als er nicht darauf reagierte.
Er hatte den Mörder gefunden, praktisch auf den ersten Blick. Er lag in einem Gruppenfoto vor einer Reihe sitzender Kameraden, lächelnd, selbstsicher — der Prototyp eines wohlerzogenen jungen Mannes aus gutem Hause.
Eddie Floyd inhalierte tief. Seltsam, wie oft sich scheinbare Pannen zum Positiven wandten. Die vergangene Nacht war eine herbe Enttäuschung gewesen, ein bitterer Schock — aber jetzt sah es so aus, als bildete sie den Auftakt zu einer echten Glückssträhne. Turner, der Mörder im Blazer und sein möglicher Auftraggeber — sie alle würden zahlen müssen. Und nicht zu knapp!
Der Ober brachte den Orangensaft. Eddie Floyd erhob sich und tippte auf den Mörder auf dem Foto. »Ist das nicht Johnny Sperber?« fragte er.
Der Ober beugte sich nach vorn. »Sperber?« murmelte er. »Sperber? Kenne ich nicht!«
»Er sieht genauso aus«, meinte Eddie Floyd.
»Nein, das ist Percy Burkland, Sir.«
»Hm«, sagte Eddie Floyd kopfschüttelnd. »Wirklich verblüffend, diese Ähnlichkeit.«
Er zahlte und gab dem dankbar lächelnden Ober großzügig einen Dollar Trinkgeld. Schließlich war die Information, die er gerade bekommen hatte, das Tausendfache wert. Mindestens.
Percy Burkland! Der Name sagte Eddie Floyd nichts. Er ließ sich nicht mit dem eines Prominenten in Zusammenhang bringen. Aber das störte Eddie Floyd nicht. Es gab eine Menge Millionäre in dieser Stadt — zum Beispiel Hamilton Turner —, die der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt waren.
Genüßlich leerte er seinen Orangensaft. Als er das Glas abstellte, zuckte er heftig zusammen. Percy Burkland' betrat den Raum, lächelnd, braun gebrannt, ein großer, gut aussehender Bursche, der sicherlich keine Mühe hatte, Mädchenherzen zu brechen.
Burkland war nicht allein. Er befand sich in der Gesellschaft eines schlanken weißblonden Burschen von knapp zwanzig Jahren. Die jungen Männer waren ganz ähnlich bekleidet; sie trugen zu ihren Shorts weiße Polohemden.
»Das übliche, Tim«, rief Burkhard dem Ober zu und schaute sich nach einem freien Platz um. Sein Blick kreuzte den von Eddie Floyd und hielt ihn flüchtig fest, dann wanderte er weiter. Eddie Floyd drückte seine Zigarette im Ascher aus. Sein Herz klopfte heftig. Warum eigentlich? Er hatte keinen Grund, nervös zu werden. Burkland kannte ihn nicht. Der Mörder hatte keine Ahnung, welche Gefahr ihn erwartete.
Eddie Floyd ferhob sich: »Ah, da wird frei«, rief Burkland und beeilte sich, um noch vor anderen Interessenten an den Tisch zu kommen. Er stieß leicht mit der Schulter gegen Eddie Floyd und entschuldigte sich lächelnd.
»Es ist nichts geschehen«, meinte Eddie Floyd und lächelte zurück. Er verließ die Bar, bummelte durch die ausgedehnten Grün- und Gartenanlagen des Klubs und schaute sich dann erneut die parkenden Wagen an. Der Sportwagen von Percy Burkland befand sich nicht darunter. Möglicherweise hatte er für die Tat einen geliehenen oder gestohlenen Flitzer verwendet.
Eddie Floyd setzte sich in seinen Wagen. Er entdeckte, daß er das Klubhaus nicht im Blickfeld hatte, und wartete, bis eine Parklücke frei wurde, die es ihm ermöglichte, den Eingang im Auge zu behalten. Es dauerte fast eine Stunde, ehe Percy Burkland mit seinem blonden Begleiter auf tauchte. Die jungen Leute verabschiedeten sich vor dem Klubhaus, und Percy Burkland bummelte auf einen gelben Porsche älteren Datums zu. Er setzte sich hinein und fuhr los. Eddie Floyd folgte ihm in gebührendem Abstand.
Es fiel ihm nicht schwer, den knallgelben Wagen im Auge zu behalten. Zwanzig Minuten später stoppte der Porsche vor einem Schnellrestaurant. Percy Burkland ging hinein und setzte sich an den Tresen.
Eddie Floyd parkte seinen Wagen hinter dem Porsche und sah zu, wie Percy Burkland, der ihm hinter spiegelndem Glas den Rücken zukehrte, aufmerksam die Speisekarte studierte. Eddie Floyd betrat das Lokal und setzte sich direkt neben Burkland. Der wandte den Kopf und runzelte die Augenbrauen.
»Kennen wir uns nicht?« fragte er.
»Stimmt«, sagte Eddie Floyd.
»Ah, ich erinnere mich. Wir haben uns vorhin im Klubhaus gesehen«, sagte Burkland. Er hatte eine ziemlich helle, aber durchaus angenehme Stimme.
»Das trifft zu. Ißt man hier gut?«
»Mäßig«, sagte Percy Burkland und legte die Karte aus der Hand. »Aber können Sie mir ein Lokal nennen, das über dem Durchschnitt liegt? Wir leben im Zeitalter der Nivellierung. Leider. Ich bin schon wiederholt hier gewesen. Sie haben eine gute Pizza.«
»Ich mache mir nichts aus Pizza«, sagte Eddie Floyd. »Ich esse das Porterhouse-Steak.«
»Guten Appetit«, meinte Percy Burkland. »Ein Bier und eine Pizza Napolitane«, sagte er dann zu dem lächelnden Mädchen, das sich nach seinen Wünschen erkundigte.
Floyd bestellte sich ein Steak und eine Tasse Kaffee.
»Sind Sie Klubmitglied?« fragte Percy Burkland.
»Sehe ich so aus?«
Percy Burkland lächelte dünn. »Offen gestanden, nein.«
»Wie sehe ich denn aus?« wollte Eddie Floyd wissen.
»Schauen Sie doch in den Spiegel.«
»Ich wüßte gern, wie ich auf andere Leute wirke.«
»Das kann man nicht verallgemeinern.«
»Na schön, werden wir präzise. Wie würden Sie mich denn einstufen?« fragte Eddie Floyd.
»Aber, aber«, sagte Percy Burkland spöttisch. »Wir wollen doch Freunde bleiben.«
»Die sind wir nie gewesen.«
»Das macht es mir leichter. Sie sehen aus wie jemand, der hochzustapeln versucht. Fein in Schale, alle Achtung. Aber der Schlips paßt nicht zum Sakko, und der Hemdenschnitt ist seit drei Jahren aus der Mode. Von den Schuhen ganz zu schweigen. Genügt Ihnen das?«
»Sie haben noch nichts von meinem Gesicht gesagt.«
»Lassen Sie des Sängers Höflichkeit darüber schweigen.«
»Das war deutlich«, meinte Eddie Floyd.
Percy Burkland lächelte. »Ich kann Ihnen auch Schmus liefern — falls Sie das vorziehen. Aber es ist sehr anstrengend. Ich schwindle nicht gern.«
»Um so besser«, sagte Eddie Floyd. Percy Burkland lachte. »Jetzt sehen Sie ganz verbiestert aus. Habe ich Sie beleidigt? Das wollte ich nicht. Sie können sich revanchieren. Los, fangen Sie an! Sagen Sie mir, was Sie von mir halten. Ich werde es akzeptieren und nicht gleich vom Stuhl fallen.«
»Wirklich nicht?« fragte Eddie Floyd. »Sie sehen aus wie ein Mörder.«
Das Lächeln auf Percy Burklands Gesicht fiel jäh in sich zusammen. »Im Ernst?«
»Ja.«
»Ich muß Sie sehr verletzt haben«, sagte Percy Burkland. »Sonst würden Sie schwerlich so hart zurückschießen.«
»Ich schieße nicht zurück. Ich treffe nur Feststellungen«, sagte Eddie Floyd.
»Was kennzeichnet denn einen Mörder?« fragte Percy Burkland, dessen Stimme um eine Nuance heller und gespannter klang als vorher. Seine Augen waren hart und schmal geworden.
»Die Lust am Töten, was denn sonst?«
»Nicht jeder, der tötet, findet Spaß daran.«
»Sie müssen’s ja wissen.«
»Wer sind Sie?«
Eddie Floyd lachte leise. »Ein guter Beobachter, wie ich hoffe«, sagte er. »Ich heiße Burkland. Und Sie?«
»Spielt keine Rolle, junger Mann. Warum haben Sie die...?« Er unterbrach sich, da das Mädchen zurückkehrte und den Kaffee und das Bier brachte.
»Das Essen kommt gleich«, meinte sie lächelnd und ging wieder davon.
»Eine hübsche Puppe«, sagte Eddie Floyd. »Ist sie käuflich?«
»Versuchen Sie’s doch mal«, meinte Percy Burkland. »Sie sind unterbrochen worden.«
»Ach ja, richtig. Warum haben Sie die Frau ermordet?«
Percy Burkland nahm einen Schluck aus dem Bierglas und fuhr sich mit dem Handrücken über den Mund. »Ihre Scherze fangen an, mir zu mißfallen«, sagte er.
»Miriam Cavello«, murmelte Eddie Floyd. »Kommt Ihnen der Name nicht bekannt vor?«
»Wer sind Sie?«
»Ich stelle hier die Fragen«, meinte Eddie Floyd.
Er fühlte sich sicher. Percy Burkland war offenbar ein Mann, der nicht einmal ein Schießeisen besaß. Er hätte sonst kaum mit Pfeil und Bogen gemordet. Nein, es gab keinen Grund, sich vor Percy Burkland zu fürchten — auch wenn er ein Mörder war.
Burkland war kein Profi, kein Killer von Format. Er gehörte zur schäbigsten Gattung der Gewaltverbrecher. Er war ein Meuchelmörder.
»Sie fühlen sich wohl sehr stark, was?« fragte Percy Burkland leise. »Stimmt genau.«
»Ich weiß, worauf Sie hinauswollen«, meinte Percy Burkland und warf einen Blick über seine Schulter, um festzustellen, daß ihnen niemand zuhörte, »aber Sie haben Pech. Ich habe für die Tatzeit ein Alibi.«
»Es kann nur gekauft sein.«
»Vor Gericht wird man gezwungen sein, es zu akzeptieren«, sagte Percy Burkland.
»Was würden Sie wohl sagen, wenn ich Sie bei Ausführung der Tat fotografiert hätte?«
»Das gibt es nicht«, murmelte Percy Burkland.
»Warum denn nicht? Ich bin ein Fotofan.«
»Sie sind ein Erpresser.«
»Wir kommen uns näher. Diese Sache kostet Sie'eine Kleinigkeit, junger Freund.«
»Was verlangen Sie?«
»Hunderttausend Dollar.«
Percy Burkland schloß kurz die Augen. »Sie gehen ganz schön ran«, stellte er fest.
»Warum haben Sie’s getan?« fragte Eddie Floyd.
»Witzbold!«
»He, was soll das heißen?«
»Sie stellen die falschen Fragen«, meinte Percy Burkland. »Beschränken Sie sich darauf, über Geld zu reden.«
»Sie kennen meine Forderung.«
»Schlagen Sie sich das aus dem Kopf. Ich bin kein Krösus«, sagte Percy Burkland.
»Das glaube ich Ihnen gern. Aber Sie werden schon Leute finden, die Ihnen das Geld pumpen.«
»Machen Sie Witze? Geld leiht man nur jemand, der Kredit hat, der es zurückzahlen kann. Das trifft auf mich nicht zu. Ich habe reiche Eltern, mag sein — aber mein Vater hält mich verdammt kurz. Er meint, das fördere meine Erziehung.«
»Halten Sie sich an Ihren Vater«, schlug Eddie Floyd vor. »Wenn er hört, worum es geht, wird er das Geld lockermachen. Wer will sich schon nachsagen lassen, einen Mörder in der Familie zu haben?«
»Sie haben einen Riß in der Leitung«, sagte Percy Burkland scharf. »Er würde mich rausschmeißen, er würde sich von mir abwenden. Mann, Sie kennen meinen Vater nicht. Er war im Krieg Stabsoffizier. Der leidet immer noch an einem Ehrenkomplex. Für den gibt’s keine krummen Dinger.«
»Schlimm für Sie«, sagte Eddie Floyd. »Warum wollen Sie mich aufs Kreuz legen?« fragte Percy Burkland. »Sie haben die Frau nicht gekannt, nehme ich an. Sie war ein Miststück.«
»Wenn man dazu übergehen wollte, jedes Miststück umzubringen, müßte man die Menschheit um die Hälfte reduzieren«, höhnte Eddie Floyd.
»Ich wüßte gern, wo Sie gewesen sein wollen, als die Frau starb«, sagte der junge Mann.
»Im Haus.«
»In Turners Haus?«
»So ist es.«
»Als Gast?«
»Als ungebetener Gast«, sagte Eddie Floyd. »Ich stand in dem kleinen grünen Salon hinter der Gardine. Ich habe jede Phase der Tat beobachtet.«
»Warum haben Sie die Frau nicht gewarnt?«
»In meiner Lage? Unmöglich!«
»Was, zum Teufel, hat Ihre Lage mit der Sache zu tun? Hier ging es darum, ein Menschenleben zu retten.«
»Wollen Sie mich auf den Arm nehmen?«
»Nein«, sagte Percy Burkland. »Ich will damit nur feststellen, daß Sie an Miriam Cavellos Tod mitschuldig sind.«
»Diese Tour zieht nicht bei mir. Ich bin kein Ankläger, und Sie sind kein Verteidiger. Wir stehen nicht vor einem Geschworenengericht, wir brauchen uns nicht damit abzustrampeln, die Schuldfrage zu beleuchten. Sie ist eindeutig geklärt. Sie haben die Frau ermordet. Ich möchte...« Er unterbrach sich, als das Mädchen das Essen brachte.
»Guten Appetit«, sagte es.
»Danke«, meinte Percy Burkland. »Noch ein Bier, bitte.«
Das Mädchen ging davon. Die Männer begannen zu essen.
»Und da ist noch ein Punkt«, sagte Eddie Floyd kauend. »Sie wissen nicht, wer ich bin. Aber ich kann Sie jederzeit in die Pfanne hauen. Wollen Sie wirklich als Mörder verurteilt werden? Das wäre Ihr Ende, junger Mann. Sie würden bis ans Ende Ihrer Tage gesiebte Luft atmen müssen.«
»Ich kann keine hunderttausend Dollar auftreiben, damit müssen Sie sieh abfinden.«
»Keineswegs. Ich gehe von meiner Forderung nicht herunter«, sagte Eddie Floyd. »Sie haben keine Wahl. Sie müssen sich das Geld beschaffen. Was haben Sie denn für den Mord gekriegt?«
»Kein Kommentar.«
»Ihr Bier, Sir«, sagte das Mädchen und lächelte Percy Burkland ins Gesicht. Eddie Floyd war Luft für sie. Percy Burkland schaute dem Mädchen hinterher. Er kaute langsamer, dann schob er seinen Teller zurück.
»Ich habe keinen Appetit.«
»Das kann ich mir denken«, meinte Eddie Floyd, der fortfuhr, sein Steak zu verzehren. »Leisten Sie statt dessen ein bißchen Generalstabsarbeit. Überlegen Sie, woher Sie das Geld nehmen. Ich brauche es innerhalb von drei Tagen.«
»Ausgeschlossen!«
»Sie werden schon einen Weg finden.«
Percy Burkland nahm einen Schluck aus dem Glas und blickte Floyd dann an. »Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie bekommen fünftausend Dollar. Noch heute. Auf den Rest müssen Sie drei Wochen warten.«
»Woher wollen Sie den Rest nehmen?«
»Das ist meine Sache — aber in drei Wochen habe ich das Geld«, sagte Percy Burkland.
»Das fällt Ihnen ziemlich plötzlich ein«, meinte Eddie Floyd.
Percy Burkland schüttelte den Kopf. »Nein, nein, daran habe ich sofort gedacht. Es ist mein Geld. Aber natürlich verspürte ich wenig Lust, sofort auf Ihre Forderung einzugehen.«
Eddie Floyd griff nach einem Zahnstocher und bohrte damit in seinem Gebiß herum. Er holte ein winziges Stück Fleisch aus seinem Mund, betrachtete es tiefsinnig und warf es dann mitsamt dem Zahnstocher in einen Ascher. »Okay«, sagte er. »Sie zahlen. Ich betrachte mich als eirlgeladen.«
Fünf Minuten später verließen sie das Lokal.
»Ich folge Ihnen mit meinem Wagen«, sagte Eddie Floyd. »Aber ehe wir starten, möchte ich Sie noch einmal impfen, junger Freund. Versuchen Sie bitte nicht, mich aufs Kreuz zu legen. Erstens würde Ihnen das bestimmt mißlingen, und zweitens wäre die logische Folge davon ein Hochschrauben meiner Ansprüche. Ich hoffe, wir haben uns verstanden.«
»An Deutlichkeit haben Sie es bislang keineswegs fehlen lassen«, erwiderte Percy Burkland spöttisch und kletterte in seinen Porsche.
Eddie Floyd stieg in seinen Wagen und ordnete sich hinter Burkland in den fließenden Verkehr ein. Burkland wendete und fuhr zurück. Eddie Floyd ärgerte sich, daß er mit Burkland nicht das Ziel des Trips abgesprochen hatte.
Der Porsche hielt zwanzig Minuten später am Rande eines Kiefernwäldchens, das eine Bungalowsiedlung begrenzte. Die Männer stiegen aus.
»Ist es hier?« fragte Eddie Floyd.
»Kommen Sie«, meinte Percy Burkland und betrat einen schmalen sandigen Pfad, der sich durch das Wäldchen schlängelte.
»Sehen Sie mal, was ich hier habe«, sagte Eddie Floyd.
Percy Burkland blieb stehen und drehte sich um. Er nickte, als er die Umrisse einer Pistole in Floyds Jackentasche erkannte. Floyd hielt die Waffenmündung auf ihn gerichtet.
»Kann ich weitergehen?« fragte er.
»Ja, sicher. Haben Sie das Geld im Wald vergraben?«
Percy Burkland antwortete nicht. Er ging leicht gebückt und hatte beide Hände in die Hosentaschen geschoben.
»He, ich habe Sie etwas gefragt!« knurrte Eddie Floyd.
»Nur Geduld«, sagte Percy Burkland.
Sie schritten weiter. In einer von Büschen überwucherten Waldsenke stoppte Burkland. Er suchte den Boden ab, musterte die Bäume, maß Fuß für Fuß eine Strecke von knapp zwei Yard aus und bückte sich dann, um die Bodenbeschaffenheit zu prüfen.
»Das ist es«, sagte er. »Sehen Sie mal.«
Eddie Floyd trat näher. Er war absolut arglos. Verdammt, er hatte den Finger am Drücker, und dieser Junge war gewarnt. Er konnte einfach nicht...
Der Schuß war hart und klar. Er riß nicht nur an Eddie Floyds Gehör und an seinen Nerven, er löste gleichzeitig ein seltsames Gefühl der Schwäche in ihm aus, ein Empfinden, das frei von Schmerzen war und ihm trotzdem angst machte.
Percy Burkland schoß noch einmal.
Eddie Floyd schaute fassungslos auf die Waffe in Percy Burklands Hand. Woher kam das Ding? Hatte er es aus einem der Büsche, aus einem Versteck also, geholt, oder hatte er es während der ganzen Zeit bei sich getragen?
Vor Eddie Floyds Augen begann sich die Welt in Wellenlinien aufzulösen. Er brach in die Knie. Schieß doch, dachte er. Knall ihn ab...
Aber er konnte nicht. In seinen Fingern war keine Kraft. Er sank langsam vornüber. Sein Kopf rollte zur Seite. Eddie Floyd war tot.
***
Montag morgen, neun Uhr zwanzig.
Ich telefonierte mit Hamilton Turner. Milo befand sich nicht im Office. Er organisierte ein Fahrzeug. Meinen Jaguar hatte ich zur Inspektion in die Werkstatt gebracht.
»Nein«, sagte Hamilton Turner. »Sie haben sich noch nicht wieder gemeldet. Ich habe heute nacht kein Auge schließen können. Ich muß immerzu an Phyllis denken.«
»Immerhin haben Sie die Kraft gefunden, ins Büro zu gehen«, stellte ich fest.
»Das klingt wie ein Vorwurf«, protestierte er. »Was hätte ich denn tun sollen? Die Arbeit lenkt mich ab. Ich darf nur nicht auf den gesprengten Safe blicken, dann geht die Misere von vorn los.« Er seufzte laut. »Noch keine Spur von Miriams Mörder! Ich habe einen interessanten Tip für Sie.«
»Schießen Sie los.«
»Cavello wollte sich von Miriam scheiden lassen.«
»Woher wissen Sie das?«
»Von ihm. Ich habe ihn gestern abend angerufen.«
»Warum?«
»Er tat mir irgendwie leid. Ich hielt es für meine Pflicht, ihm ein paar Worte meiner Anteilnahme zu sagen. Dabei kam er damit heraus. Mit den Scheidungsabsichten, die er gehabt hatte, meine ich.«
»Wie hatte Miriam darauf reagiert?«
»Cavello zufolge wollte sie nur dann mitmachen, wenn er sie entsprechend abfand. Mit fünftausend pro Monat.«
»Danke«, sagte ich und legte auf.
Milo betrat das Office. »Der Schlitten steht fahrbereit vor der Tür.«
Ein Officebote brachte eine Kopie des Polizeiberichtes herein. Ich überflog die Meldungen und stutzte.
»Was gibt’s?« fragte mich Milo.
»Hör dir das mal an. In- Pinewoods ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Sie war mit einem braunen Sakko, dunkler Hose und einem Robin-Hood-Sporthütchen bekleidet.«
»Der Mann von gestern!« staunte Milo.
»Langsam, langsam — wirf erst mal einen Blick auf den Toten«, sagte ich. »Braune Sportkombinationen und dazu passende Hütchen gibt’s wie Sand am Meer.«
»Ist der Tote identifiziert worden?«
»Nein, nicht bis zur Drucklegung des Berichtes«, erwiderte ich. »Er hatte übrigens nichts bei sich, keinen Ausweis, keine Brieftasche, keine Schlüssel, keine Waffe — absolut nichts. Offenbar wurde er von seinem Mörder bestohlen.«
»Fahren wir zum Gerichtsmedizinischen Institut«, schlug Milo vor. »Ich muß unbedingt feststellen, ob es sich um den Burschen handelt, der mich in Turners Haus zu Boden geschickt hat.« Er griff sich dabei unwillkürlich an das große Heftpflaster, das seine Schläfe verunzierte.
»Ich habe übrigens mit Hamilton Turner telefoniert«, sagte ich, als wir losfuhren. »Noch kein neues Lebenszeichen von den Entführern.«
»Die haben inzwischen erfahren, was sich ereignet hat«, meinte Milo.
»Turner hat mit Cavello gesprochen. Cavello hatte die Absicht, sich von Miriam zu trennen. Jedenfalls hat er das Turner mitgeteilt. Aber sie wollte nicht. Nur unter gewissen Voraussetzungen. Sie forderte fünftausend Dollar pro Monat.«
Milo stieß einen Pfiff aus. »Ein hübsches Tatmotiv«, sagte er. »Cavello haßt seine Frau. Er will sie loswerden. Aber sie lehnt es ab, sich von ihm scheiden zu lassen. Es sei denn, er blecht. Er rechnet sich aus, was es ihm kosten würde, wenn er auf ihre Bedingungen einginge. Sechzigtausend Dollar im Jahr. Cavello zögert nicht, eine Gegenrechnung aufzumachen. Er chartert sich einen Killer. Der kostete ihn schlimmstenfalls fünftausend Dollar. Ersparnis für Cavello im ersten Jahr: fundundfünfzigtausend Bucks.«
Ich schüttelte zweifelnd den Kopf. »Dieser Mann ist doch kein Narr«, sagte ich. »Meinst du, er hätte die beabsichtigte Scheidung erwähnt, wenn er den Mord tatsächlich inszeniert hätte? Ihm muß doch klar sein, daß er sich damit belastet.«
»Auf den ersten Blick scheint seine Bereitschaft, die geplante Scheidung zu erwähnen, für seine Unschuld zu sprechen«, meinte Milo. »Andererseits mußte er in Rechnung stellen, daß Miriam bereits darüber gesprochen hatte. Darauf hat er sich eingestellt.«
»Wir müssen mit ihm sprechen.«
»Ist das Einbruchsdezernat schon zu einem greifbaren Erfolg gekommen?«
»Bis jetzt steht lediglich fest, daß Turners Officesafe von Experten geknackt wurde. Man untersucht nöch, wer dafür in Frage kommen könnte.« Zwanzig Minuten später warfen wir einen Blick auf den Toten und seine Kleidung.
»Das ist er«, sagte Milo.
»Kein Zweifel möglich?«
»Kein Zweifel möglich«, sagte Milo. »Das ist der Mann, der mich, mit einem Tuch vor dem Gesicht, in Turners Salon zu Boden streckte.«
»Er ist inzwischen identifiziert worden«, informierte uns der Beamte, der uns in den Kühlraum begleitet hatte. »Sein Name ist Edward Floyd alias Eddie Floyd. Sie können die Latte seiner Vorstrafen draußen einsehen...«
»Ein Safeknacker«, meinte Milo, als wir wieder in dem Wagen saßen. »Vielleicht ist es der Bursche, der Turners Safe aufgebrochen hat. Aber was kann er in Turners Haus gewollt haben?«
»Möglicherweise wollte er mit Turner verhandeln«, sagte ich. »Vielleicht wollte er ihm den Schmuck zum Rückkauf anbieten.«
»Oder«, sagte Milo, »er hat in Turners Auftrag gehandelt und wollte sich seinen Lohn abholen.«
»Hm«, machte ich, »auch diese Möglichkeit ist nicht auszuschließen. Turner wollte die Versicherung betrügen. Das konnte er nur, wenn sein Safe von Profis geöffnet wurde. Eddie Floyd erledigte den Auftrag für ihn.«
»Dann«, spann Milo den Faden weiter, »wollte Eddie Floyd mehr Geld haben. Wahrscheinlich erfuhr er, um welche Summen es bei dem geplanten Versicherungsbetrug ging. Logisch, daß er davon sein Seherflein kassieren wollte. Vielleicht hat er versucht, Hamilton Turner zu erpressen. Dem blieb daraufhin nichts anderes übrig, als Eddie aus dem Verkehr zu ziehen.«
»Eine hübsche, glatte Theorie«, sagte ich. »Zu glatt, wenn du mich fragst. Von diesen Hypothesen können wir leicht noch ein halbes Dutzend entwickeln.«
»Ich finde die Sache nahtlos.«
»Ich entdeckte zwei Nahtstellen, die absolut nicht dazu passen wollen«, erklärte ich. »Phyllis’ Entführung und die Ermordung von Miriam Cavello.«
»Wer sagt uns, daß alle Verbrechen des Wochenendes zu einem Komplex gehören?« fragte Milo. »Es ist leicht denkbar, daß sich hier einige voneinander völlig unabhängige Verbrechen gekreuzt haben. Es wäre falsch, wenn wir versuchten, sie alle unter einen Hut zu bringen.«
»Sprechen wir mit Cavello«, sagte ich.
Wir trafen ihn in seinem an der Fifth Avenue gelegenen Office an. Er war ein hochgewachsener, eleganter und sehr selbstsicher wirkender Mann, ein Staranwalt, der sich in vielen großen Prozessen einen Namen gemacht hatte. Er war auf Patent- und Betriebsrecht spezialisiert und vertrat einige namhafte Konzerne, aber hin und wieder testete er sein Können auch in großen Strafprozessen, die weniger für Geld, als für Schlagzeilen und Imagewerbung sorgten.
»Natürlich wußte ich, daß Miriam kein Engel war«, berichtete er, als wir uns in der ledernen Klubgarnitur seines mit Mahagoni getäfelten Privatbüros gegenübersaßen. »Aber gerade das faszinierte mich. Ich hatte niemals den Ehrgeiz, ein Heimchen am Herd für mich zu gewinnen. Ich wollte die Faszination des Ewigweiblichen, ich suchte die Herausforderung. Beides bekam ich — leider in Verbindung mit einem Nebenprodukt, das ich rasch hassen lernte. Miriam hielt nichts von ehelicher Treue. Ich hätte ihr gewiß einen Seitensprung verziehen, aber sie benahm sich, als sei sie eine Nymphomanin. Sie war unersättlich. Es kam zum Streit, zur Entfremdung, zu meinem Wunsch nach Scheidung. Miriams betrübliches Ende hat mich mit einem Schlag von allen Sorgen befreit.« Er lächelte dünn. »Ich bin Anwalt«, fuhr er fort. »Ich weiß jetzt, was in Ihren Köpfen vorgeht. Sie fragen sich, ob ich der Täter gewesen sein könnte... oder ob ich für gutes Geld meine Frau umbringen ließ. Die Antwort lautet: nein.«
»Diese Antwort«, sagte Milo lächelnd, »würde uns auch der wahre Mörder geben.«
Cavello erhob sich. Er ging zu seinem Safe, holte einen etwa fingerdicken Schnellhefter daraus hervor und legte ihn vor uns auf den Tisch.
»Ein Zehntel des von mir gesammelten Materials hätte ausgereicht, um jedes Gericht dieser Welt von Miriams Schuld an der Ehezerrüttung zu überzeugen«, sagte er. »Schauen Sie ruhig hinein.«
»Dürfen wir das Material mitnehmen?« fragte ich.
Er schob die Unterlippe nach vorn. »Warum nicht? Vielleicht enthält der Schnellhefter sogar den Namen des Mörders. Fest steht, daß Sie mehr als zwanzig Männernamen darin finden werden — und mit jedem davon hatte Miriam ein Verhältnis, das eine kürzer, das andere länger. Das Material wurde übrigens von einem Privatdetektiv zusammengetragen. Es ist mit Fotos und eidesstattlichen Aussagen belegt, absolut hieb- und stichfest...«
»Damit ist meine Mordtheorie geplatzt«, seufzte Milo, als wir zurück zum Office fuhren. »Er hätte jederzeit die Scheidung bekommen, ohne einen Cent an Miriam zahlen zu müssen.«
»Sehen wir uns erst einmal die Namen von Miriams Verehrern an«, schlug ich vor.
Milo übernahm es, eine Liste von Miriam Cavellos Freunden aufzustellen. Eine Kopie davon leitete er an die Zentralkartei weiter, um herauszufinden, wer von diesen Männern vorbestraft war.
Ich telefonierte mit Lieutenant Harper, der den Einbruch in Hamilton Turners Office bearbeitete.
»Ich kenne Eddie Floyd«, sagte er. »Es ist nicht auszuschließen, daß er Turners Safe geknackt hat. Stil und Methode passen dazu. Floyd arbeitete allerdings selten allein. In letzter Zeit war ein Mann namens Joe Marks sein Komplize. Wir versuchen schon seit Stunden, ihn zu finden, aber er ist nicht aufzutreiben.«
»Halten Sie es für möglich, daß Joe Marks seinen Komplizen getötet hat, um die gesamte Beute aus dem Einbruch für sich behalten zu können?« fragte ich.
»Es liegt nahe, diesen Verdacht zu hegen«, meinte der Lieutenant, »aber ich kann nicht glauben, daß er zutrifft. Joe Marks ist kein Mann der Initiative, er ordnet sich unter, er kann allein kaum arbeiten.« Er machte eine kurze Pause, dann sagte er': »Moment, ein dringendes Gespräch auf der anderen Leitung...« Wenige Minuten später meldete er sich wieder. »Wir haben einen interessanten Hinweis bekommen. Er betrifft Floyd. Eddie Floyd ist kurz vor seinem Tod in einem Lokal an der Scarsdale Road gesehen worden. Zusammen mit einem jungen Mann. Die Bedienung hat sich gemeldet, nachdem sie die Beschreibung des Ermordeten im Radio hörte...«
»Was konnte sie über Floyds Begleitung sagen?«
»Die Beschreibung ist recht präzise — aber sie paßt leider auf fast jeden hübschen dunkelhaarigen Jungen. Ich lasse Ihnen die Unterlagen zukommen und halte Sie über die weitere Entwicklung auf dem laufenden.«
Ich legte auf und informierte Milo über das, was ich gehört hatte. Er tippte auf die Liste. »Sollte mich gar nicht wundern, wenn der Wunderknabe hier verzeichnet ist.«
Ich starrte aus dem Fenster. »Mir kommt da eine Idee.«
»Soll ich die Glocken läuten lassen?« fragte Milo.
Ich schaute ihn an. »Hör mir lieber zu«, sagte ich. »Cavello scheint als Mörder seiner Frau auszuscheiden. Denken wir einmal nach. Versetzen wir uns in Miriams Lage. Sie war nicht mehr ganz jung, sie konnte noch Verehrer fesseln — aber sicherlich wäre es ihr schwergefallen, einen Mann zu heiraten, der ihr nicht den gewohnten Lebensstandard bieten konnte. Klar?«
»Klar«, sagte Milo.
»Sie sträubte sich deshalb gegen die Scheidung und stellte Bedingungen — aber die waren angesichts der Lage völlig unrealistisch. Cavellos Material hätte Miriam vernichtet.«
»Ebenfalls klar«, meinte Milo.
»Sie mußte sich nach einer neuen Geldquelle umsehen«, sagte ich. »Und zwar rechtzeitig. Logisch, daß sie dabei an ihren ersten Mann dachte, an Hamilton Turner. Schließlich wußte sie, wie reich der Bursche war.«
»Nur immer weiter«, sagte Milo. »Jetzt wird die Sache schon ein wenig komplizierter«, erklärte ich. »Wir wissen, daß Phyllis und Miriam sich oft trafen, daß sie sich gut miteinander verstanden. Mutter und Tochter. Vielleicht hat Miriam es geschafft, Phyllis auf ihre Seite zu ziehen. Vielleicht haben die beiden versucht, einen großen Coup zu landen, indem sie eine Entführung inszenierten, die es in Wahrheit gar nicht gibt.«
»Du meinst, Phyllis hätte sich freiwillig abgesetzt, um ihrer Mutter die Eintreibung eines Lösegeldes zu ermöglichen?«
»Daran dachte ich.«
»Das würde voraussetzen, daß Phyllis ihren Vater haßt«, meinte Milo. »Soweit will ich nicht gehen, aber sicherlich wäre damit klar, daß Phyllis zur Mutter steht und versucht, ihr auf diese kriminelle Weise zu helfen.«
»Klingt logisch — aber wenig glaubwürdig«, sagte Milo. »Phyllis setzt sich schließlich damit der Gefahr des Entdecktwerdens aus.«
»Wer denkt schon ans Entdecktwerden, wenn er einen Coup plant?« fragte ich. »Wenn das zuträfe, gäbe es keine großen Verbrechen mehr.«
»Du unterstellst, daß Phyllis zu einem Coup bereit war, der ihrer Mutter eine Million Lösegeld einbringen soll. Ist dir eigentlich klar, daß Phyllis damit nicht nur ihren reichen Vater, sondern auch sich schädigen würde? Schließlich würde sie damit ihr Erbteil um einen beträchtlichen Batzen schmälern.«
»Phyllis ist noch zu jung, um soweit zu denken.«
»Wir wissen von Turner, daß er mit einem männlichen Entführer verhandelte«, sagte Milo.
»Natürlich konnten weder Phyllis noch Miriam die Verhandlungen mit ihm führen«, sagte ich. »Sie mußten jemand einweihen — möglicherweise einen der Burschen, die auf deiner Liste stehen. Ich vermute, daß sie ihm einen gewissen Anteil boten.«
»Aber«, mutmaßte Milo, der Geschmack an meiner Theorie bekam, »dieser Kerl kam auf die Idee, das Ganze an sich zu reißen. Er setzte Phyllis fest und legte Miriam um. Das gibt ihm die Möglichkeit, die Million für sich zu kassieren.«
»So könnte es gewesen sein«, sagte ich.
»Hm«, machte Milo, »aber wie bringen wir den geknackten Safe in unserer Rechnung unter?«
»Ich muß dich an deine Worte erinnern. Es steht keineswegs fest, daß es sich bei den Ereignissen des Wochenendes um einen zusammenhängenden Komplex handelt. Vielleicht wollte Turner tatsächlich einen Versicherungsbetrug inszenieren.«
»Bleiben wir noch ein wenig bei deiner Theorie«, sagte Milo. »Ich wüßte gern, warum Miriam ihren Exgatten am Sonntag besuchte.«
»Natürlich interessierte es sie, zu erfahren, wie er auf die ›Entführung‹ reagierte. Sie hatte sicherlich gehofft, daß er sich ihr anvertrauen würde — aber in dieser Hoffnung wurde sie getäuscht. Hamilton Turner versuchte ihr statt dessen weiszumachen, daß Phyllis weggefahren sei.«
»Wenn es so ist, wie du vermutest, geht es nur noch darum, den jungen Mann zu finden, den Miriam und Phyllis zu ihrem Vertrauten machten.«
»Ja«, sagte ich. »Und das muß rasch gehen. Sehr rasch sogar. Sonst ist Phyllis’ Leben keinen Pfifferling mehr wert.«
»Stimmt«, nickte Milo. »Denn er hat keine Wahl. Er muß jetzt auch Phyllis töten. Wenn sie erfährt, was ihrer Mutter zugestoßen ist, wird es ihr wie Schuppen von den Augen fallen. Ihr wird klar sein, daß nur ihr Komplize als Mörder in Frage kommt.«
»Aber auch der Killer ist gefährdet«, sagte ich. »Unsere Theorie setzt voraus, daß Phyllis sich freiwillig in irgendein Versteck begeben hat. Wir können unterstellen, daß es ein komfortables Versteck ist — eine Wohnung mit allem Luxus. Sie wird dort Radio oder Fernsehen genießen, sie hat vollen Kontakt zu allem, was geschieht. Setze nur einmal den Fall, sie hat erfahren, was ihrer Mutter zugestoßen ist. Könnte sie das nicht veranlassen, ihren Verstand zu benutzen und den jungen Mann, den sie für den Mörder ihrer Mutter halten muß, entsprechend zu bestrafen? Für Phyllis wäre das nicht nur ein Racheakt, sondern eine Notwehrhandlung...«
***
Percy Burkland zuckte zusammen, als es klingelte.
Verdammt, er mußte jetzt seine Nerven behalten, sonst war alles verloren.
Er trat vor den venezianischen Wohnzimmerspiegel und schaute hinein, um seine Gesichtsmuskeln zu kontrollieren.
Er ging in die Diele und öffnete die Tür.
Er zuckte erneut zusammen.
Der Mann, der draußen stand, hielt einen Revolver in der Hand.
»Hände hoch!« befahl er.
Percy Burkland gehorchte. Er hatte sofort einen bestimmten Verdacht, hütete sich jedoch, ihn zu äußern. Fest stand, daß es sich bei dem Besucher nicht um Polizei handelte.
»Geh voran«, sagte Joe Marks scharf. »Ins Wohnzimmer. Und laß die Greifer oben.«
Percy Burkland machte kehrt und gehorchte. Joe Marks betrat die Diele und schob die Tür mit dem Fuß hinter sich zu. Er folgte dem Wohnungsinhaber in das große, komfortabel ausgestattete Zimmer und sagte: »Stell dich mit dem Gesicht zur Wand. Hände flach dagegen pressen. Höher. So ist’s gut. Spreiz die Beine. Noch weiter. Gut.« Er klopfte den jungen Mann gründlich ab, bis hinunter zu den Fußgelenken. »Setz dich«, befahl er dann. »Moment!« Er jumpte zu dem Sessel, in den Burkland sich fallen lassen wollte, und griff hinter die losen Kissen, um sich davon zu überzeugen, daß sie keine Waffe verdeckten.
»Wollen Sie mir nicht endlich sagen, was dieser Zirkus zu bedeuten hat?« fragte Percy Burkland.
Joe Marks trat zwei Schritte zurück. Der junge Mann nahm Platz. Er legte ein Bein über das andere und lehnte sich zurück, bemüht, eine gewisse äußere Gelassenheit zu demonstrieren.
»Du hast Eddie umgelegt, du großes Schwein«, stieß Joe Marks hervor.
Percy Burkland heuchelte Überraschung. »Eddie?« murmelte er. »Kenne ich nicht. Offenbar haben Sie sich in der Tür geirrt. Ich bin kein Mann, der Leute umlegt. Egal ob sie nun Eddy, Freddy oder Teddy heißen. Merken Sie sich das!«
»Du hast Pech gehabt«, sagte Joe Marks. »Eddie hat mir genau erklärt, was er vorhatte. Du bist zuletzt mit ihm zusammen gewesen. Ohne den Ober im Klubhaus wäre ich gar nicht auf dich gekommen. Ich zeigte ihm Eddies. Bild — und er erinnerte sich an das Gespräch, das er mit ihm geführt hatte. Und an den Namen, den er Eddie nannte.«
»Was hat das mit mir zu tun?«
»Eine ganze Menge. Ich lege dich jetzt um.«
»Reden Sie keinen Quatsch, ich weiß immer noch nicht, worum es eigentlich geht«, sagte Percy Burkland.
Er sah und fühlte, daß sein Besucher über keinen sonderlich hohen Intelligenzgrad verfügte. Das gab ihm, Percy Burkland, einerseits die Hoffnung, die Situation in den Griff zu bekommen — andererseits erhöhte es die Gefahr, Opfer einer unberechenbaren Reflektion zu werden.
»Sie haben die Frau umgelegt«, sagte Joe Marks, »Verdammt noch mal, wen soll ich denn noch umgelegt haben?« fragte Percy Burkland. »Sie machen aus mir ja einen mehrfachen Mörder!«
»Genau das sind Sie auch.«
»Warum holen Sie nicht die Polizei?« fragte Percy Burkland und wies auf das Telefon. »Los, rufen Sie an. Ich habe nichts zu befürchten.«
»Nein, nein, mein Junge — dieses Problem lösen wir unter vier Augen«, sagte Joe Marks schwer atmend. »Zwei davon werden sich bald schließen. Für immer. Rate mal, wen es treffen wird?«
»Machen Sie endlich Schluß mit Ihren albernen Drohungen, und erzählen Sie mir, worum es geht. Solange Sie sich nur in Andeutungen gefallen, kann ich mich nicht verteidigen. Erst quasseln Sie von einem Eddie, und dann ist plötzlich von einer Frau die Rede.«
»Nicht von einer Frau, sondern von Miriam«, sagte Joe Marks. »Von Miriam Cavello.«
»Oooh«, meinte Percy Burkland gedehnt. »Diese Geschichte. Natürlich habe ich erfahren, was ihr zugestoßen ist.«
»Wir machen Fortschritte.«
»Sie werden sich wundern. Ich kannte die Frau.«
»Was Sie nicht sagen!« höhnte Joe Marks.
»Aber ich habe sie nicht umgebracht.«
»Wie steht es mit Ihrem Alibi?«
»Es ist lupenrein.«
»Gekauft, was?«
»Hören Sie, Mister...«
»Mein Name tut nichts zur Sache.«
»Okay. Ich bin rund zwanzig Jahre jünger, als es Miriam war. Ich kannte sie, aber ich unterhielt zu ihr keine besonderen Beziehungen. Ich hatte keinen Grund, sie zu töten. Oder wüßten Sie ein Motiv zu nennen?«
»Geld«, sagte Joe Marks. »Das Geld, das Ihnen Ihr Auftraggeber dafür geboten hat.«
»Mann — sehe ich aus wie ein Profikiller?« fragte Percy Burkland und schickte einen verzweifelt wirkenden Blick an die Zimmerdecke. »Ich bin ein junger Mann aus gutem Hause. Ich erhalte kein übertrieben hohes, aber doch durchaus akzeptables Taschengeld. Mir geht es gut. Ich gehöre zur Gesellschaft. Niemand, aber auch gar niemand, würde jemals auf die Idee kommen, mich als Mörder zu chartern. Aus vielerlei Gründen. Erstens bin ich kein Krimineller, und zweitens fehlt mir die Erfahrung für so etwas. Und außerdem würde ich mich aus moralischen Erwägungen niemals für dergleichen Dinge hergeben. Nicht einmal für eine Million.«
»Mir kommen gleich die Tränen«, sagte Joe Marks.
»Es ist die Wahrheit, verdammt noch mal!«
»Sind Sie Mitglied des New Addington Golf Club?«
»Ja, warum?«
»Waren Sie gestern draußen?«
»Ja.«
»Haben Sie dort mit Eddie Floyd gesprochen?«
»Ich sagte Ihnen bereits, daß ich keinen Mann dieses Namens kenne«, sagte Joe Marks.
»Der Name wurde heute wiederholt im Radio erwähnt. Außerdem steht er in den Zeitungen.«
»Sorry, ich habe heute lange geschlafen.«
»Konnten Sie überhaupt schlafen?«
»Das sehen Sie doch! Oder wirke ich nicht ausgeruht?« fragte Percy Burkland.
»Ich verschaffe Ihnen noch mehr Ruhe«, erklärte Joe Marks grimmig. »Die ewige Ruhe!«
»Hören Sie endlich auf mit diesem Quatsch.«
»Sie wissen das Neueste noch nicht«, sagte Joe Marks. »Sie sind mit Eddie gesehen worden.«
»Das kann nicht sein, weil es nicht stimmt.«
»Welchen Wagen fahren Sie?«
»Einen Porsche.«
»Er ist gelb, nicht wahr?«
»Ja.«
»Auf dem Wege nach hier hatte ich mein Radio eingeschaltet«, sagte Joe Marks. »Es gibt bereits eine Beschreibung von Ihnen. Eine Kellnerin erinnert sich daran, daß Sie und Eddie bei ihr gegessen haben. Sie hat beobachtet, wie Sie mit einem gelben Porsche davonfuhren, gefolgt von Eddie...«
»Ein Mann, dem ich vielleicht ähnlich war«, sagte Percy Burkland wütend, aber er merkte, wie er zu schwitzen begann. Die verdammte Kellnerin! Er hätte an sie denken müssen.
»Sehr ähnlich sogar«, höhnte Joe Marks. »Die Beschreibung paßt fabelhaft auf Sie.«
»Nur weiß das Mädchen nicht meinen Namen«, entfuhr es Percy Burkland.
Joe Marks grinste düster. »Sie werden nervös«, sagte er. »Danke für die Auskunft.«
Percy Burkland holte tief Luft. Er entschloß sich, die Taktik zu ändern. Der Mann, der ihm gegenüberstand, war Eddie Floyds Komplize, vermutlich ein kleiner Gangster. Diese Leute waren nur mit Geld zu beeindrucken, alles andere ließ sie kalt.
»Was hätte ich denn tun sollen, zum Teufel?« brach es aus Percy Burkland hervor. »Ihr Freund hat mich erpreßt.«
»Wieviel wollte er haben?«
»Eine halbe Million«, behauptete Percy Burkland.
»Das glaube ich Ihnen nicht«, sagte Joe Marks. »Eddie war doch kein Idiot! Er hätte niemals eine unerfüllbare Forderung gestellt.«
»Aber ich schwöre Ihnen, daß er soviel haben wollte! Das hat mich durchdrehen lassen. Ich wollte ihn nicht töten, ehrlich nicht. Es war ein Reflex, nichts weiter...«
»Ein Reflex im Wald«, höhnte Joe Marks. »Nun bleiben Sie mal auf dem Teppich. Sie wußten genau, wie Sie ihn kriegen konnten. Sie boten ihm Geld an, lockten ihn in den Wald und legten ihn dort um.«
»Was verlangen Sie?« fragte Percy Burkland.
»Ihr Leben.«
»Sie sind völlig durcheinander«, sagte Percy Burkland. »Das geht schon daraus hervor, daß Sie mich wahllos duzen oder siezen.«
»Eddie war mein Freund. Der einzige, den ich hatte. Ich bin hergekommen, um seinen Tod zu rächen.«
»Das klingt sehr hübsch und eindrucksvoll — aber erstens würde es Sie zum Mörder machen, und zweitens würde es Sie um keinen Cent bereichern. Ich habe Geld in der Wohnung. Sie können es haben, ohne Tricks, ohne doppelten Boden.«
»Wieviel ist es?«
Percy Burkland grinste. »Ich sehe, daß sich unsere Standpunkte zu nähern beginnen. Es sind dreitausend Dollar. In bar, versteht sich.«
»Hast du die Bucks für den Mord bekommen?«
»Geld stinkt nicht«, sagte Percy Burkland. »Nehmen Sie es, und verschwinden Sie damit.«
»Wo ist es?«
»Im Schlafzimmer.«
»Steh auf und hole es«, sagte Joe Marks. Er trat hinter den sich erhebenden Percy Burkland und rammte ihm die Waffenmündung in den Rücken. »Ich nehme an, du bist dir darüber klar, daß du deinen Trick nicht wiederholen kannst. Ich bin gewarnt. Bei der ersten verdächtigen Bewegung schieße ich.«
»Keine Angst, ich habe nicht vor, verrückt zu spielen«, sagte Percy Burkland und ging vor Joe Marks in das angrenzende Schlafzimmer.
»Stop«, sagte Joe Marks. Percy Burkland gehorchte. »Wo liegt es?« fragte Joe Marks.
»In einem Schuhkarton. Rechts unten im Kleiderschrank«, sagte Percy Burkland.
Joe Marks trat einen halben Schritt zurück. Dann wirbelte er die Waffe in seiner Hand herum und ließ den Schaft krachend auf Burklands Schädel landen. Der junge Mann fiel bewußtlos zu Boden.
Joe Marks öffnete den Kleiderschrank. Er bückte sich und holte den Schuhkarton hervor. Staunend stellte er fest, daß die Schachtel randvoll mit gebündelten Zehner- und Zwanzigernoten gefüllt war. Er schloß sie und setzte sich auf das Bett.
Percy Burkland brauchte fast eine volle Minute, um wieder zu sich zu kommen. Stöhnend quälte er sich auf die Beine. »Mir ist übel«, würgte er hervor und torkelte ins Bad. Joe Marks folgte ihm mit gezogener Waffe und beobachtete, wie Burkland sich übergab.
Joe Marks hatte sich den Karton unter den linken Arm geklemmt, in seiner Rechten hielt er den Revolver. Percy Burkland spülte sich den Mund, dann wusch er sich. Er sah unter seiner Gesichtsbräun? sehr fahl aus.
»Gehen wir zurück ins Wohnzimmer«, sagte Joe Marks.
»Ich brauche einen Kognak«, murmelte Percy Burkland.
»Ich auch«, sagte Joe Marks.
Joe Marks bestand im Wohnzimmer darauf, die Flasche selbst aus dem Barfach des Schrankes zu holen. Zu diesem Zweck legte er vorübergehend den Karton aus der Hand. Er füllte zwei Gläser, ohne Burkland aus den Augen zu lassen. Der junge Mann hatte sich gesetzt. Er machte nicht den Eindruck, als sei er imstande, das Ruder herumzureißen.
»Da, bedienen Sie sich«, sagte Joe Marks.
»Schon wieder höflich?« fragte Percy Burkland. »Seltsam, wie sehr ein paar Bucks die Menschen zu ändern vermögen.«
»Dich haben sie doch auch verändert«, höhnte Joe Marks. »Sie haben dich zum Mörder werden lassen.«
Percy Burkland kippte den Inhalt des Glases mit einem Schluck hinunter und schloß die Augen, um das scharfe Brennen in seinem Hals abklingen zu lassen.
»Wo ist Phyllis umgelegt worden — und warum?« fragte Joe Marks.
Percy Burkland riß die Augen auf. »Was?«
»Du hast sehr gut verstanden, was ich sagte.«
»Wer hätte Phyllis umlegen sollen?«
»Sie ist tot — und du weißt es!«
»Nein!« schrie Percy Burkland.
Die Heftigkeit seiner Äußerung bewirkte einen scharfen Schmerz an der Stelle, wo sich als Folge von Marks’ Treffer eine Beule zu bilden begann.
»He, nicht so laut«, höhnte Joe Marks. »Sie haben das Geld, mehr besitze ich nicht — warum hauen Sie nicht endlich ab?«
»So einfach ist das nicht, mein Junge. Du legst einen um und bildest dir ein, das Ganze mit ein paar tausend Bucks bereinigen zu können. Jetzt gehen die Schwierigkeiten für dich erst los.«
»Was soll das heißen?«
»Ich habe mir ein paar Fragen zurechtgelegt, und du wirst sie sehr präzise beantworten.«
»Was ist, wenn ich die Antworten nicht kenne?«
»Dann denke ich an Eddie. Wie er enden mußte. Wie du Schwein ihn fertiggemacht hast. Und dann wird mein Finger sehr nervös werden«, sagte Joe Marks.
»Also, los, was wollen Sie wissen?«
»Alles«, sagte Joe Marks. »Die Geschichte der Toten aus dem Safe, die Gründe für Miriam Cavellos Ermordung — einfach alles.«
»Geben Sie mir noch einen Kognak.«
»Die Flasche steht in deiner Reichweite. Bedien dich selbst«, sagte Joe Marks.
Percy Burkland erhob sich. »Ich muß Sie warnen«, sagte er. »Sie wissen nicht, was auf Sie zukommt. Ich bin nur ein Rädchen im Getriebe. Wenn Sie in dieses Getriebe geraten, wird es Sie mitleidlos zermalmen.«
»Ich verzichte auf deine blöden Drohungen«, meinte Joe Marks. »Ich will endlich wissen, was gespielt wird.«
»Gespielt wird mit dem Tod, das haben Sie ja inzwischen bemerkt«, sagte Percy Burkland. Er trat an den Tis,ch und entkorkte die Kognakflasche. »Nur eines begreife ich nicht.« Er blickte hoch. »Was Sie von Phyllis sagen. Wieso soll sie tot sein?«
»Wir haben sie gefunden.«
»Wir?«
»Eddie und ich.«
»Wo?«
»In Turners Officesafe.«
»Phyllis?«
»Ein nacktes junges Mädchen«, sagte Joe Marks ungeduldig. »Stell dich nicht so blöd an!«
»Ach so«, murmelte Percy Burkland, zwischen dessen Augen sich eine steile Falte bildete. Er sah verdutzt aus. Ihm war anzumerken, daß er angestrengt überlegte.
»Wo ist die Tote jetzt?«
»Das geht dich nichts an.«
»Es ist nicht Phyllis«, sagte Percy Burkland. »Sie kann es gar nicht sein.«
»Sondern?«
»Das weiß ich nicht. Ich müßte das Mädchen mal sehen.«
»Das könnte dir so passen, wie?« höhnte Joe Marks. »Du willst nur feststellen, wo ich zu Hause bin.«
Das kriege ich auch so heraus, dachte Percy Burkland. Ich brauche nur nachzuforschen, mit wem Floyd zusammenarbeitete — aber natürlich hütete er sich, diese Gedanken laut werden zu lassen.
»Es ist nicht Phyllis«, wiederholte Percy Burkland.
»Hast du ein Bild von ihr da?«
»Nein.«
»Warum bist du so sicher, daß Phyllis noch lebt?«
»Ich habe sie gestern noch gesehen. Am Sonntag. Also nach dem Einbruch in Turners Office.«
»Dann bist du einer der Entführer.«
»Nein.«
»Aber du kennst sie.«
»Es gibt keine Entführer«, sagte Percy Burkland ungeduldig.
Joe Marks trat an die andere Seite des Tisches heran. »Jetzt wird es fesselnd«, sagte er. »Richtig spannend. Wir gehen in Einzelheiten. Nur immer weiter, junger Freund.«
»Das Ganze richtet sich gegen Turner, er soll um eine Million erleichtert werden«, sagte Percy Burkland, »aber-Phyllis ist mit von der Partie.«
»Das soll ich glauben?«
»Mir ist es piepe, ob Sie’s glauben oder nicht. Es ist die Wahrheit.«
»Wo ist das Mädchen jetzt?«
»Keine Ahnung«, sagte Percy Burkland. »In dieser Aktion hat jeder eine Rolle übernommen. Mein Auftrag bestand darin, die Frau aus dem Verkehr zu ziehen.«
»Mit Pfeil und Bogen! Warum eigentlich? Du besitzt doch eine Pistole. Schließlich hast du Eddie damit niedergeschossen.«
»Stimmt«, sagte Percy Burkland, »aber ich habe die Waffe erst kürzlich von einem kleinen Gangster gekauft und wollte mich nicht der Gefahr aussetzen, durch sie der Tat überführt zu werden. Man weiß ja, welche Kunststücke die Ballistiker heutzutage zuwege bringen.«
Joe Marks biß sich auf die Unterlippe. Er senkte den Blick, ganz kurz nur, aber Percy, der auf etwas Ähnliches gehofft hatte, nutzte sofort seine Chance.
Er schleuderte die Flasche gegen Joe Marks’ Kopf.
Sie traf ihn hart und genau, mitten zwischen die Augen.
Der Treffer hatte einen für Percy Burkland höchst fatalen Nebeneffekt. Joe Marks’ Zusammenzucken bewirkte, daß sein Finger den Abzug des Revolvers durchriß.
Der Knall weckte in dem Zimmer ein dröhnendes Echo.
Percy Burkland, der zum Sprung über den Tisch angesetzt hatte, fühlte sich wie von einem knallharten Faustschlag gestoppt. Er brach zusammen. Terror und plötzliche Todesangst schnürten ihm buchstäblich die Kehle zu.
Joe Marks torkelte zur Seite und hatte Mühe, nicht zu fallen. Er griff nach einer Sessellehne und hielt sich daran fest. Er schüttelte benommen den Kopf, dann gab er sich einen Ruck, weil er sehen wollte, was mit Burkland passiert war.
Percy Burkland lag reglos auf dem Rücken. Sein starrer Blick war zur Decke gerichtet.
»Dieser Idiot«, keuchte Joe Marks und wischte sich mit dem Ellenbogen den Schweiß vom Gesicht. »Dieser verdammte Idiot! Ach was, es geschieht ihm ganz recht...«
Er schob den Revolver in seinen Hosenbund, holte sein Taschentuch aus der Hose und wischte damit die beiden Gläser und die Flasche ab. Dann schnappte er sich den Geldkarton und ging zur Tür. In der Diele fiel ihm ein, daß er vergessen hatte, die Türgriffe und die Schlüssel zum Kleiderschrank und zum Barfach abzuwischen. Er machte kehrt, um das Versäumte nachzuholen, dann verließ er auf Zehenspitzen das Apartment.
***
»Das ist das Haus«, sagte Milo und trat auf die Bremse.
»Halteverbotszone«, sagte ich.
»Schon gesehen«, meinte er und rollte mit unserem Dienstwagen, einem dunkelblauen Fairlane, die Einfahrt zur Tiefgarage hinab.
Wir stiegen aus und musterten die geparkten Fahrzeuge. Ein gelber Porsche befand sich nicht darunter.
Wir hatten binnen kurzer Zeit rasche und gute Arbeit geleistet. Ein Gespräch mit der weiblichen Bedienung des Schnellrestaurants hatte klarwerden lassen, daß der junge Mann, der dort am Sonntagnachmittag in Eddie Floyds Begleitung gespeist hatte, Golfspieler sein mußte.
»Er hat manchmal hier gegessen«, hatte uns die Bedienung erklärt. »Er hatte seine Golfschläger meistens im Wagen liegen.«
Es war nicht schwer gewesen, sich auszurechnen, zu welchem Golfklub der junge Mann gehörte. Der New Addington Golf Club war der einzige weit und breit. Wir hatten mit den Obern des Klubhauses gesprochen. Die Beschreibung, die das Mädchen aus dem Schnellrestaurant uns geliefert hatte, paßte auf verschiedene Mitglieder — aber nur einer von ihnen besaß einen älteren Porsche.
Percy Burkland.
»Er scheint unterwegs zu sein«, sagte Milo.
Wir fuhren mit dem Lift nach oben und klingelten an seiner Tür. Niemand öffnete.
»Okay«, sagte ich. »Wir kommen heute abend noch einmal vorbei. Mal sehen, ob Joe Marks zu Hause ist.«
Marks wohnte, wie wir inzwischen herausgefunden hatten, in Brooklyn. Das Haus Bay Ridge Avenue machte keinen sehr erhebenden Eindruck. Der Lift funktionierte nicht. Wir kletterten bis in die fünfte Etage und klingelten an Marks’ Apartmenttür. Niemand öffnete. Wir wiederholten das Klingeln. Ohne Ergebnis.
Ich zwinkerte Milo zu. Wir klingelten nochmals, dann gingen wir geräuschvoll davon. Hinter dem Liftschacht nahmen wir Deckung. Was ich erwartet hatte, trat prompt ein. Marks’ Tür öffnete sich einen Spaltbreit.
Ich jumpte aus der Deckung hervor. »Na, endlich, Mann — haben wir Sie aus der Badewanne geholt?«
Joe Marks trat über die Schwelle. Er sah mürrisch aus. »Was gibt’s denn?« Er trug Kordhosen und ein kariertes Sporthemd.
»FBI«, sagte ich und präsentierte ihm meine ID-Card. »Das ist mein Kollege Milo Tucker.«
»FBI?« murmelte Joe Marks. »Mit dem habe ich noch nie was zu tun gehabt.«
»Man lernt nicht aus, was?« fragte ich. »Wir hätten gern ein paar Worte mit Ihnen gewechselt. Sie wissen ja, worum es geht.«
»Ich weiß gar nichts«, knurrte er und machte kehrt.
Wir folgten ihm in das kleine, schäbige Wohnzimmer seines Apartments. Er räumte ein paar Zeitungen und Socken von den wackligen Stühlen, um uns Platz zu schaffen. Wir setzten uns.
»Ich weiß gar nichts«, wiederholte er und versuchte schwach zu grinsen. »Aber Sie werden mir schon sagen, worum es geht.«
»Sie haben Turners Safe geknackt«, sagte ich. »Zusammen mit Eddie Floyd.« Er starrte mich an. »Nein«, sagte er. »Sollen wir es Ihnen beweisen?«
»Ich bitte darum.«
»Wann haben Sie Eddie das letztemal gesehen?«
»Lassen Sie mich nachdenken. Am Freitag. Wir haben ein Bier zusammen getrunken.«
»Seitdem haben Sie nichts mehr von ihm gehört?«
»So ist es.«
»Sie wissen nicht einmal, daß er tot ist?«
Joe Marks gab sich Mühe, verdutzt und erschrocken auszusehen, aber er war ein miserabler Schauspieler, und deshalb ging sein Täuschungsmanöver gründlich daneben.
»Tot?« echote er. »Eddie? Sie machen Witze!«
»Es ist inzwischen über alle Sender gegangen«, sagte Milo.
»Ich höre niemals Radio.«
»Die Polizei hat versucht, Sie zu erreichen«, sagte Milo, »aber Sie waren nicht zu Hause.«
»Bin ich verpflichtet, den ganzen Tag zu Hause zuzubringen?« fragte Joe Marks.
»Nein — aber Sie sind verpflichtet, Ihr Alibi für die Nacht vom Sonnabend zum Sonntag nachzuweisen«, sagte ich.
»Ich lag im Bett. Ich habe geschlafen«, behauptete er.
»Ab wieviel Uhr?«
»Das muß so gegen Mitternacht gewesen sein. Fragen Sie mich bitte nicht nach Zeugen. Wer steigt schon vor Zeugen ins Bett? Ich jedenfalls nicht. Ich bin Junggeselle. Eddie tot. Nicht zu fassen. War es ein Unfall?«
»Nicht ganz«, sagte ich. »Es war Mord.«
»Mord?« staunte Joe Marks.
»Geben Sie’s auf«, sagte ich. »Sie haben nicht mal das Zeug, auf einer Schmierenbühne zu bestehen.«
»Ich muß Sie etwas fragen«, meinte er. »Ich wette, Sie kennen meine Vorstrafen. Bestimmt wissen Sie auch, was mit Eddie los war. Wir haben hin und wieder einen Bruch gemacht, zugegeben — aber was hat das mit dem FBI zu tun?«
»Wir ermitteln in einer Entführungsangelegenheit«, machte ich ihm klar. »Wer ist denn entführt worden?«
»Phyllis Turner«, sagte ich geduldig. »Die Tochter des Mannes, dessen Safe Sie geknackt haben.«
»Ich habe keinen Safe geknackt.«
»Wir wüßten gern, wer Ihnen den Tip lieferte.«
»Ich habe keinen Safe geknackt«, wiederholte er.
»Versteht sich«, meinte Milo. »Die Hauptarbeit hat Eddie geliefert. Er ist dann am Sonntag zu Turner gegangen, nicht wahr? Dort wurde er zufällig Zeuge eines Mordes. Er sah, wer Miriam Cavello tötete. Eddie Floyd versuchte daraus Kapital zu schlagen. Er setzte den Killer unter Druck, aber das wurde zum Bumerang.«
»Sie reden, als wären Sie dabeigewesen«, knurrte Joe Marks und steckte sich eine Zigarette an. Seine Hände zitterten stark.
»Das bin ich auch«, sagte Milo. »Ich traf Eddie in dem Zimmer, durch dessen Fenster er den Mord beobachtet hatte. Er zog mir eins über den Schädel und türmte.«
»Ich kann dazu nichts sagen«, behauptete Joe Marks. »Was Sie mir da erzählen, ergibt für mich keinen Sinn.«
»Wir würden uns gern ein wenig in Ihrer Wohnung umsehen«, sagte Milo.
»Haben Sie einen Haussuchungsbefehl?«
»Nein — aber er wird bereits ausgestellt.«
»Dann warten wir am besten, bis er unterschrieben und gestempelt vorliegt«, sagte Joe Marks giftig.
»Wir glauben zu wissen, wer Eddie ' erschoß«, sagte ich.
»Wenn das zutrifft, verstehe ich nicht, weshalb Sie hier herumsitzen. Warum verhaften Sie den Kerl nicht?«
»Zerbrechen Sie sich nicht für uns den Kopf«, meinte Milo. »Jetzt reden wir erst einmal mit Ihnen. Hat Turner Ihnen den Auftrag erteilt, den Safe zu knacken?«
»Turner? Jetzt begreife ich gar nichts mehr. Wieso sollte uns der Safebesitzer dazu auf fordern, ihn zu bestehlen?«
»Dreimal dürfen Sie raten«, sagte Milo.
»Ach so«, meinte Joe Marks gedehnt. »Jetzt kapiere ich. Sie glauben, es könnte sich um einen Versicherungsschwindel handeln. Vielleicht war’s tatsächlich einer. Aber weder Eddie noch ich haben etwas damit zu tun.«
»Wie können Sie für Eddie sprechen, wenn Sie ihn angeblich seit Freitag nicht mehr gesehen haben?« fragte Milo.
»Eddie ist mein Freund gewesen«, erklärte Joe Marks heftig. »Wenn der ’n Ding auf der Pfanne gehabt hätte, hätte er mich eingeweiht.«
»Was wollte er denn am Wochenende anstellen?«
»Er wollte eine Mieze besuchen«, behauptete Joe Marks.
»Kennen Sie das Mädchen?«
»Nein.«
»Nun machen Sie mal ’n Punkt«, sagte Milo. »Wir wissen, daß Eddie und Sie fast täglich zusammen waren. Und jetzt wollen Sie nicht mal den Namen seines Mädchens kennen. Es ist Ihr gutes Recht, den Versuch zu unternehmen, Ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen — aber damit kommen Sie nicht durch.«
»Ich habe nichts verbrochen.«
Das Telefon klingelte.
Ich stand auf. »Sie bleiben sitzen«, sagte ich scharf und nahm den Hörer ab, noch ehe Joe Marks zu protestieren vermochte.
»Ja?« fragte ich.
»Bist du’s, Joe Marks?« erkundigte sich eine ziemlich helle Männerstimme.
»Ja, was gibt’s?«
»Ich lebe noch«, höhnte die Stimme. »Das überrascht dich, was? Ich habe mich tot gestellt. Du Idiot bist darauf hereingefallen. Jetzt drehe ich den Spieß um, Joe Marks. Ich gebe dir noch vierundzwanzig Stunden, dann bist du ein toter Mann.«
Es knackte in der Leitung. Der Anrufer hatte aufgelegt.
Ich wandte mich langsam um, blickte Joe Marks an und sagte: »Er lebt noch.«
Joe Marks blinzelte unsicher. »Wer lebt noch?« fragte er. »Mein Freund Eddie?«
»Nein, der ist tot. Vermutlich habe ich mit Percy Burkland gesprochen.«
Joe Marks stand auf und ballte die Fäuste, aber er setzte sich sofort wieder. »Warum, zum Teufel, haben Sie mich nicht an den Apparat gelassen?« fragte er wütend.
»Die Sache ist ziemlich klar«, erklärte ich. »Sie gingen zu Percy Burkland, um den Tod Ihres Freundes Eddie zu rächen, aber Burkland überlebte die Attacke. Er hat sich tot gestellt.«
»Blödsinn«, murmelte Joe Marks. »Das saugen Sie sich aus den Fingern.«
»Der Anrufer gibt Ihnen noch vierundzwanzig Stunden«, sagte ich.
»Was?« stieß Joe Marks hervor. Seine Nervosität wuchs. Er hatte sichtlich Mühe, sie zu meistern. »Zeit wofür?«
»Nach Ablauf der vierundzwanzig Stunden, meinte er, seien Sie ein toter Mann.«
»Wollen Sie mir angst machen?«
»Ich wiederhole nur seine Worte.«
»Da hat sich jemand einen Witz mit mir erlaubt. Burkland, Burkland! Ich kenne ihn nicht.«
Es klingelte an der Wohnungstür, gleich dreimal hintereinander. Joe Marks fuhr heftig zusammen.
»Sehen Sie nach, wer es ist«, sagte ich. »Gehen Sie doch raus«, meinte er. »Sie spielen doch hier den Boß!«
Ich lächelte matt. Es war zu erkennen, daß Joe Marks Angst hatte. Der Anruf war ihm unter die Haut gegangen.
Ich ging in die Diele und öffnete die Tür. Draußen standen zwei Männer, die ich gut kannte. Lieutenant Webley und Sergeant Hopkins. Beide waren Mitglieder der Mordkommission. Wir begrüßten uns und betraten das Wohnzimmer. Milo schüttelte den beiden Männern die Hand.
Lieutenant Webley zog einen Briefumschlag aus der Tasche seines großkarierten Sportsakkos. Er entnahm dem Umschlag ein postkartengroßes Foto und legte es vor Joe Marks auf den Tisch. »Sehen Sie sich das einmal an.« Ich beugte mich nach vorn. Das Bild zeigte das Gesicht eines hübschen jungen Mädchens. Die Augen waren geschlossen. Es war zu erkennen, daß es sich um eine Tote handelte.
Joe Marks bekam schmale Augen und zog die Schultern hoch, als ob ihm kalt sei.
»Wer ist das?« fragte er.
»Das möchte ich von Ihnen wissen«, meinte Lieutenant Webley.
»Ist sie tot?«
»Ja, sie ist tot.«
Joe Marks befeuchtete sich die trocken gewordenen Lippen mit der Zungenspitze. »Tut mir leid«, sagte er, »aber ich kann Ihnen nicht helfen. Ich kenne sie nicht.«
»Wir haben sie in Floyds Keller gefunden, in einer ausrangierten Tiefkühltruhe«, sagte Lieutenant Webley. »Also, los, packen Sie endlich aus.«
»Warum wenden Sie sich an mich? Sie können mich doch nicht für Eddies Taten verantwortlich machen.«
»Ist das Mädchen schon identifiziert worden?« fragte ich.
»Nein«, meinte Lieutenant Webley. »Es war völlig nackt. Die Prints sind in keiner Kartei enthalten. Der Tod des Mädchens dürfte am Sonnabendmittag eingetreten sein. Uns liegen keine Vermißtenmeldungen vor, die auf das Mädchen passen.«
»Ein Mordopfer?«
»Einwandfrei«, sagte der Lieutenant. »Es wurde erdrosselt. Auf dem Foto ist das nicht zu erkennen — aber der Hals trägt deutliche Würgemale.«
»Eddie war kein Würger — und ich bin es auch nicht«, sagte Joe Marks mit hochrotem Kopf.
»Hm«, meinte Lieutenant Webley. »In gewisser Weise trifft das zu. Ich habe die Akten studiert. Mord gehörte bislang nicht zu Ihrem Programm. Ich wüßte gern, wieso sich das geändert hat.«
»Fragen Sie Eddie«, höhnte Joe Marks.
»Sie wissen, daß er tot ist.«
»Ich habe es gerade erst erfahren«, meinte Joe Marks.
»Wollen Sie uns für dumm verkaufen?«
Joe Marks lehnte sich zurück. Er hathatte keine Angst vor seinen Besuchern. Solange sie ihm nur mit Fragen und Vermutungen zusetzten, fühlte er sich nicht gefährdet. Sie wußten ziemlich genau Bescheid, das war beängstigend — aber ihnen fehlten die Mittel, daraus Kapital zu schlagen.
Schlimmer war schon die Geschichte mit Burkland. Er war von dem Geschoß getroffen worden, das unterlag keinem Zweifel, aber offenbar hatte er keine ernsthafte Verletzung davongetragen. Burkland sann jetzt auf Rache. Er war der Typ, der sie auch ausführen würde.
Ich muß raus aus der Stadt, dachte Joe Marks. Und zwar schnell. Aber hatte er überhaupt eine Chance? Er besaß zwar genügend Geld, um über die Runden zu kommen, aber sein Verschwinden mußte den Verdacht nähren, daß er geflohen war, daß er versucht hatte, sich einer Verhaftung zu entziehen.
Daß sie die Tote gefunden hatten, beruhigte ihn. Der Gedanke, daß die Leiche unentdeckt in der Kühltruhe liegenbleiben sollte, hatte ihn gequält. Das war jetzt ausgestanden. Sollten sie doch den Mörder suchen und stellen. Ihm, Joe Marks, konnte das nur recht sein. Er haßte den Mörder, ohne ihn zu kennen. Der Kerl hatte ihnen mehr als genug Ärger und Arbeit verursacht.
Seltsam war nur, daß die Polizei das Girl noch nicht identifiziert hatte. Wie lange würde sie noch brauchen, um festzustellen, daß es sich bei der Toten um Phyllis Turner handelte?
Er hätte seinen Besuchern am liebsten ins Gesicht geschrien, was er zu wissen glaubte, aber eine solche Reaktion schied selbstverständlich aus.
»Ich habe Sie etwas gefragt«, knurrte Webley.
»Was soll ich darauf antworten?« meinte Joe Marks. »Ich kenne das Mädchen nicht.«
»Sie sieht aus, als sei sie in Phyllis Turners Alter«, stellte ich fest.
»Ja, aber sie ist es nicht«, sagte der Lieutenant.
Joe Marks’ Kinn klappte nach unten. Er schloß seinen Mund sofort wieder. Wenn die Tote nicht Phyllis Turner war — wer, zum Teufel, war es dann?
»Ich warte«, sagte der Lieutenant und blickte ihm in die Augen.
»Und wenn Sie bis zum Jüngsten Tag warteten«, meinte Joe Marks. »Ich könnte Ihnen nicht sagen, wer es ist.«
»Dann sagen Sie mir, wie das Mädchen in die Tiefkühltruhe kam«, forderte Lieutenant Webley.
»Ich weiß es nicht.«
»Wir haben Ihre Prints an dem Truhendeckel gefunden«, sagte der Lieutenant. »Brandneu. Wirklich frisch.«
»Ich behaupte nicht, niemals in dem Keiler gewesen zu sein«, murmelte Joe Marks, »aber ich habe die Tote nicht hineingelegt.«
»Wir haben eine seltsame Entdeckung gemacht«, sagte der Lieutenant. »In einer Ecke des Kellers lagen mehrere Wolldecken. Es ist zweifelsfrei erwiesen, daß sie zum Transport der Leiche gedient haben. Die Decken stammen aus Hamilton Turners Office — wo, wie Sie und wir wissen, in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag ein Einbruch verübt wurde.«
»Was schließen Sie daraus?« fragte Joe Marks, dessen Puls sich beschleunigte.
»Daß Sie und Floyd die Tote dort gefunden und mitgenommen haben«, sagte Lieutenant Webley. »Ich neige sogar zu der Ansicht, daß das Mädchen sich in dem Safe befand — tot, versteht sich.«
»Eine Tote im Safe«, murmelte Joe Marks kopfschüttelnd. »Jetzt machen Sie Witze.«
»An den Schultern, Armen und Beinen der Toten fanden wir einige Schürfstellen«, sagte der Lieutenant. »Wir sind dabei, zu untersuchen, ob sie entstanden sein können, als man die Leiche mit Gewalt in den Safe zwängte.«
»Wollen Sie mir bitte verraten, was jemand dazu gebracht haben könnte, eine Tote in den Safe zu legen?« fragte Joe Marks.
»Das ist eine gute, sehr naheliegende Frage«, meinte der Lieutenant. »Es gibt darauf nur eine Antwort. Die Leute, die einen Schlüssel zum Safe besitzen, wollten sich eine Atempause verschaffen. Sie setzten voraus, daß der Safe bis zum Montagmorgen nicht geöffnet werden würde. Vielleicht hatten sie vor, die Tote am Sonntag oder in der Nacht zum Montag abzuholen und für immer verschwinden zu lassen.«
»Schön, das klingt ja ganz plausibel«, meinte Joe Marks, »aber warum hätten wir, mein Freund Eddie und ich, uns mit einer Leiche belasten sollen, mit einer Toten, die wir nicht kannten?«
»Wissen Sie darauf eine Antwort?« fragte mich Webley.
Ich nickte. »Floyd und Marks setzten voraus, daß nur der Safebesitzer die Tote in dem Tresor versteckt haben konnte. Sie wollten daraus Kapital schlagen. Jetzt wissen wir auch, warum Eddie Floyd in Turners Haus eindrang.«
»Wie viele Leute besitzen einen Schlüssel zu dem Safe?« fragte Milo.
»Zwei«, antwortete der Lieutenant. »Turner und sein Prokurist. Wir haben mit dem Prokuristen gesprochen und sein Alibi überprüft. Es handelt sich um einen älteren, seriösen Mann. Er ist nicht vorbestraft. Nach menschlichem Ermessen scheidet er als Täter oder Komplize aus.«
»Und Hamilton Turner?« fragte ich. »Es ist klar, daß sich der Hauptverdacht jetzt gegen ihn richtet«, sagte Webley. »Ich fahre anschließend mit dem Sergeant zu ihm. Wollen Sie uns begleiten?«
»Ich komme mit«, sagte ich. »Milo bleibt bei Marks.«
»Verdammt noch mal, ich möchte endlich allein sein«,- erklärte Joe Marks. »Ich kann Ihnen beim besten Willen nicht mehr sagen, als Sie schon wissen.«
»Denken Sie an Burkland«, sagte ich. »Von nun an werden Sie nicht mehr unbeschattet sein.«
»Ich kann mich ganz gut allein verteidigen.«
»Zerbrechen Sie sich darüber nicht den Kopf«, spottete Webley. »Der Haftbefehl für Sie ist bereits in Arbeit.«
***
Percy Burkland stellte die beiden schweren Tüten in den Fond des Leihwagens und setzte sich ans Steuer. Ihm war klar, daß er nicht mehr viel Zeit hatte. Es kam darauf an, die Million zu kassieren und schnellstens damit zu verschwinden.
Das Atmen machte ihm Schwierigkeiten, und der Verband, den ihm ein Medizinstudent angelegt hatte, drückte bei jeder Bewegung, aber jetzt war keine Zeit, sich mit Nebensächlichkeiten aufzuhalten.
Er war noch einmal davongekommen. Und er würde es auch schaffen, mit der Million davonzukommen. Er hatte keine Wahl. Es war der letzte Ausweg.
Er lenkte den Leihwagen an den Rand des Bürgersteigs, stieg aus und betrat eine Telefonzelle. Er warf eine Münze in den Automaten und wählte Turners Officenummer. Sekunden später hatte er Turner an der Strippe.
»Haben Sie das Geld?« fragte Percy Burkland.
Pause.
Percy Burkland spürte förmlich, wie Turner darauf bedacht war, Zeit zu schinden.
»Antworten Sie rasch, dder ich lege wieder auf«, sagte Percy Burkland wütend.
»Das Geld wird beschafft, das habe ich Ihnen bereits versprochen«, erwiderte Hamilton Turner. »Aber ehe Sie es kriegen, muß ich mit Phyllis sprechen.«
»Erst das Geld, dann die Puppe.«
»Sie bekommen von mir keinen Cent, ehe ich nicht die Stimme meiner Tochter am Telefon höre. Ich muß sicher sein, daß sie noch lebt und daß es ihr gutgeht«, sagte Hamilton Turner.
»Okay, ich veranlasse das«, meinte Percy Burkland und legte auf. Er verließ die Telefonzelle und blickte auf seine Uhr. Das Gespräch hatte keine zwei Minuten gedauert. Vielleicht gelang es der Telefonfahndung, die Zelle zu ermitteln — aber bis die Polypen hier eintrafen, würde er längst über alle Berge sein. Im übrigen trug er seine Autofahrerhandschuhe, so daß keine Gefahr bestand, durch Fingerabdrücke auf dem Hörer verraten zu werden.
Gegen Abend stoppte Percy Burkland vor einer Blockhütte am Rande einer Lichtung unweit des Green-Pond-Sees. Wenn man bedachte, daß New York nur vierzig Meilen entfernt war, mußte man sich über die Einsamkeit dieser Gegend wundern. Es gab in der Nähe noch ein paar Jagdhütten, aber Menschen sah man hier eigentlich nur an den Wochenenden. Heute, am Montag, war ihm auf den letzten drei Meilen durch den Wald kein einziges Fahrzeug begegnet.
Die Tür der Blockhütte öffnete sich.
Ein Mädchen trat auf den Stepwalk. Es trug modisch geschnittene Hosen aus gelbem Gazellenleder und eine dazu passende, sehr knapp sitzende Polobluse.
»Endlich!« sagte sie. »Ich sterbe vor Langeweile.«
»Jetzt bin ich ja da«, meinte Percy Burkland lächelnd und dachte: Mit deiner Langeweile ist es bald vorbei, Schätzchen. Tote langweilen sich nicht.
Er hob die Tüten aus dem Wagen und schleppte sie in die Blockhütte.
»Was ist denn mit deinem Porsche?« fragte ihn das Mädchen.
»Er ist in der Werkstatt«, log Percy Burkland. Er konnte Phyllis nicht gut sagen, daß man hinter ihm und dem Wagen her war.
»Was hast du denn Schönes mitgebracht?« wollte Phyllis wissen.
Percy Burkland stellte die Tüten auf den Tisch und packte aus. Whisky, Zigaretten, Lebensmittel. »Ich bleibe über Nacht hier«, sagte er.
»He, was hast du vor?« spottete Phyllis. »Wenn Miriam das erfährt, gibt es Ärger. Wie stehen die Aktien?«
»Dein Vater will deine Stimme hören. Vorher ist er nicht bereit zu blechen.«
»Okay, dann rufe ich ihn an.«
»Wir erledigen das morgen früh, aber nicht von hier«, sagte Percy Burkland. »Nicht aus dem Ort, meine ich.«
»Was ist dagegen einzuwenden?«
»In diesen Kaffs fällt ein Mädchen wie du auf. Man würde sich an dich erinnern. Vielleicht haben sie schon dein Foto in den Zeitungen.«
»Aber du hattest doch gesagt...« begann sie erschrocken.
Er öffnete eine Bourbonflasche. »Gläser«, unterbrach er sie. »Ich weiß, was ich gesagt habe. Was kann ich dafür, wenn dein Alter sich nicht an die Spielregeln hält?«
»Ich fange an, Angst zu bekommen, Percy.«
»Angst vor wem? Los, die Gläser!«
Das Mädchen setzte zwei Gläser auf den Tisch. Burkland füllte sie bis zur Hälfte und drehte den Verschluß auf die Flasche.
»Angst vor Papa, Angst vor der Polizei.«
»Kidnapping wird vom FBI bearbeitet«, sagte er.
»Noch schlimmer!« meinte sie.
Er verdrehte seufzend die Augen. »Wir haben doch alles genau durchgesprochen. Du bleibst dabei, daß du von maskierten Leuten gezwungen wurdest, in einen Wagen zu steigen. Du mußtest dich im Fond auf den Boden kauern und dort fast, drei Stunden unter einer übelriechenden Wolldecke zubringen. Du kannst nicht sagen, wohin man dich brachte, denn ehe du aussteigen durftest, wurden dir die Augen verbunden. Man sperrte dich in einen fensterlosen Keller... und ließ dich erst frei, nachdem dein Vater das Lösegeld bezahlt hatte.«
»Das klingt ja ganz hübsch, aber sie werden ins Detail gehen, sie werden wissen wollen, welchen Akzent die Männer hatten, wie viele es waren, was sie unterwegs sagten und so weiter und so weiter. Die Beamten werden ihre Fragen wiederholen, pausenlos. Was geschieht, wenn ich mir widerspreche? Oder wenn ich mich verquatsche?«
»Niemand verdächtigt dich.«
»Bis jetzt nicht — aber könnte das nicht leicht passieren, wenn ich einen Fehler mache?«
»Es ist am besten, du mimst einen Schock. Darauf müssen sie Rücksicht nehmen.«
»Die werden mir was husten!«
»Bloß keine Panikmache«, meinte er und drückte ihr ein Glas in die Hand. »Das paßt nicht zu dir.«
»Als wir anfingen, fand ich das Ganze prickelnd, einfach köstlich«, sagte sie, »aber das einsame Wochenende hat mir den Rest gegeben. Hier draußen beginnt man zu grübeln, weißt du. Im Grunde ist es eine Schweinerei, was wir mit meinem Vater machen.«
»Muß ich dich an deine eigenen Worte erinnern? Du hast gesagt, daß er einen Dämpfer verdient hat.«
»Er ist bereit zu zahlen«, meinte das Mädchen und setzte sich. »Das beweist, daß er mich liebt. Es ist nicht fair, wie ich ihm diese Liebe vergelte.«
»Dein Vater liebt nur sich selbst.«
»Warum ist er dann bereit, das Lösegeld aufzutreiben?«
»Das hat andere Motive«, meinte Percy Burkland und setzte sich an die andere Seite des Tisches. »Das ist er seinem Stolz schuldig. Und der öffentlichen Meinung, versteht sich. Gib dich keinen Illusionen hin. Er blecht nur, weil er meint, das Geld zurückzukriegen.«
»Du hättest meine Mutter mitbringen sollen.«
»Ausgeschlossen«, sagte Percy Burkland. »Es könnte sein, daß das FBI sie beschattet.«
»Du meinst, sie gehört zum Kreis der Tatverdächtigen?«
»Auszuschließen ist das nicht«, sagte Percy Burkland. »Sie hat damals um dich gekämpft — aber ihre Position war so miserabel, daß deinem Vater das Sorgerecht für dich übertragen wurde. Das FBI wird sich fragen, ob sie das jemals verwunden hat... und ob sie versucht haben könnte, das Urteil auf eigene Faust zu revidieren.«
»Wer sein Kind zurückerobern will, fordert doch kein Lösegeld«, meinte Phyllis.
»Stimmt — aber das FBI muß in Rechnung stellen, daß es sich bei der Lösegeldforderung um einen Trick deiner Mutter handeln kann«, sagte Percy Burkland.
»Woran du so denkst!« meinte sie bewundernd.
»Ich fühle mich für das Unternehmen verantwortlich«, sagte er.
»Mit Recht. Das Ganze war schließlich deine Idee.«
»Ja — aber deine Mutter und du nahmen sie begeistert auf«, sagte Percy Burkland. »Prost!«
Sie tranken.
»Hast du kein Radio mitgebracht? Es ist so still in dieser Bude. Einfach enervierend«, meinte Phyllis.
»Wieso? Da steht ein Plattenspieler mit einer hübschen Plattenkollektion.«
»Ach, diese blöden, alten Schlager! Die kann doch keiner mehr hören. Außerdem sind sie total verkratzt. Ich fühle mich wie ausgesetzt.«
»Noch zwei, drei Tage, dann ist alles vorüber.«
»Was geschieht, wenn es schief geht?«
»Es geht nicht schief.«
»Ein Glück, daß du so selbstsicher bist«, seufzte sie und lächelte. »Ich kann verstehen, daß meine Mutter einen Narren an dir gefressen hat, obwohl...« Sie führte den Satz nicht zu Ende. »Obwohl?« fragte er lächelnd.
»Hast du schon immer für ältere Frauen geschwärmt?«
»So alt ist deine Mutter nun auch wieder nicht.«
»Du weißt genau, was ich meine.«
»Junge Dinger interessieren mich nicht. Ihnen fehlt der Pfiff, die Erfahrung, eine gewisse Routine, weißt du.«
»Nun ja, Mama ist schon faszinierend«, gab Phyllis zu.
»Könntest du dir nicht vorstellen, in einen älteren Mann verliebt zu sein?«
»Ausgeschlossen«, sagte sie.
Er grinste ihr voll ins Gesicht. »Könntest du dir vorstellen, in mich verliebt zu sein?«
»Schon eher«, sagte sie, »aber du hast Pech. Im Moment stehe ich auf Lincoln Montano.«
»Diese Flasche«, sagte er.
Sie lachte. »Eifersüchtig?«
»Er ist mir zu weich, zu verträumt, zu versponnen. Das ist doch kein Mann für dich.«
»Ich liebe die Romantik«, sagte Phyllis. »Ohne diese Neigung hätte ich mich vermutlich niemals auf dieses Abenteuer eingelassen. Es regt meine Phantasie an. Ich sorge damit für eine gerechte Vermögensumschichtung. Mein Vater kann die Million verschmerzen. Für Mama bedeutet sie einen neuen Start.«
»Manchmal glaube ich, daß du ungerecht bist«, sagte er. »Du verteufelst deinen Vater und vergötterst deine Mutter. Es mag ja stimmen, daß dein Alter ein knallharter, schräger Geschäftsmann ist, der nur ans Geldverdienen denkt — aber Miriam ist auch kein Engel.«
»Das sagst du, ihr Freund?«
»Ja, weil ich sie am besten kannte.«
»Kannte?« echote sie erstaunt. »Kenne«, korrigierte er sich rasch. Verdammt, er durfte sich keine Schnitzer erlauben! Noch war das Rennen für ihn nicht gelaufen. »Ich weiß, wie sie ist. Ein männermordender Vamp.«
»Wie kannst du so etwas sagen!«
»Es ist die Wahrheit.«
»Du kennst sie nicht«, protestierte Phyllis wütend. »Versetze dich doch einmal in ihre Lage. Erst war sie mit meinem Vater verheiratet, dann mit Cavello. Was sind das für Männer? Sie denken nur an sich, an ihr Geschäft, an die Vermehrung ihres Vermögens. Das Herz einer Frau muß in einer solchen Bindung verkümmern. Es trocknet aus, wenn man nichts tut, um es am Leben zu erhalten. Mama flirtet nur deshalb so gern, weil sie zu Hause nicht auf ihre Kosten kommt. Wenn du das nicht begreifst, tust du mir leid.«
»Schon gut, Liebste«, sagte er und nahm einen Schluck aus dem Glas. »Wechseln wir das Thema.«
Phyllis musterte ihn prüfend. »Hast du dich mit Miriam gestritten?« fragte sie.
»Nein, wieso?«
»Früher hast du nie so über sie gesprochen, da hast du buchstäblich von ihr geschwärmt.«
»Das geschah aus Gründen des Taktes«, meinte Percy Burkland. »Ich wollte dir nicht weh tun. Schließlich bist du Miriams Tochter.«
Phyllis erhob sich, trat ans Fenster und blickte hinaus. Es dunkelte stark, aber das Mädchen sah trotzdem die Antenne an dem vor der Hütte stehenden Wagen.
»Mal hören, was in der Welt los ist«, meinte sie und ging zur Tür.
Percy Burkland sprang auf. »Das Autoradio ist kaputt«, stieß er hervor.
Phyllis blieb stehen. Sie musterte ihn erstaunt. »Was ist denn mit dir los?«
Er zwang sich zu einem Lächeln und setzte sich wieder. »Ich will dir einen unnützen Weg ersparen.«
»Zwanzig Schritte sind kein Weg für mich«, sagte sie. »Du verheimlichst mir etwas...«
»Was bringt dich denn darauf?«
»Deine Nervosität. Du warst maßlos erschrocken, als ich das Autoradio anstellen wollte.«
»Das redest du dir ein.«
»Ich hatte dich schon am Sonnabend gebeten, mir ein Kofferradio zu besorgen — aber ich habe keins bekommen«, erinnerte sie sich.
»Ich habe es einfach vergessen«, behauptete er. »Ist das so schlimm?«
Phyllis machte kehrt und verließ entschlossen die Hütte. Sie setzte sich in den Wagen und stellte das Radio an. Die Skala leuchtete auf. Im nächsten Moment klang Tanzmusik aus dem Lautsprecher. Percy Burkland tauchte neben ihr auf. Er legte einen Arm auf den geöffneten Wagenschlag und beugte sich zu ihr hinab.
»Was soll der Quatsch?« fragte er. »Du tust gerade so, als hättest du noch nie Musik gehört.«
»Warum hast du mich belogen? Das Radio funktioniert!«
»Vorhin hat es gestreikt.«
»Du willst nur vermeiden, daß ich mir die Nachrichten anhöre«, sagte Phyllis. »Warum?«
»Weil es besser für dich ist. So etwas regt einen nur auf«, meinte er.
»Vielleicht hast du recht«, sagte sie nachdenklich.
»Ganz sicher sogar«, meinte er und warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Verdammt, in fünf Minuten kamen die Abendnachrichten durch! Er mußte unter allen Umständen vermeiden, daß Phyllis sie anhörte. Schließlich brauchte er sie noch, wenn auch nur, um sie mit ihrem Vater telefonieren zu lassen...
Sie musterte ihn zweifelnd. »Aber so schwach sind meine Nerven nun auch wieder nicht...«
»Du brauchst deine Kräfte, um den Vernehmungen gewachsen zu sein«, meinte er und versuchte, sie aus dem Wagen zu zerren. »Warum willst du dich vorher kaputtmachen?«
Widerstrebend stieg Phyllis aus. Percy Burkland beugte sich zu dem Radio hinab und betätigte die Austaste. Aufatmend kehrte er mit Phyllis in die Blockhütte zurück.
»Ich habe Hunger«, sagte er. »Ich hoffe doch, daß du kochen kannst?«
»Kochen! Wofür hältst du mich? Ich kann Kaffee zubereiten oder ein Steak braten — mehr nicht.«
»Na, großartig«, sagte er. »In diesem Paket sind zwei Steaks. Ich habe auch an Gewürze gedacht. Ketchup und so. Fangen wir also an. Du kümmerst dich um das Fleisch, ich übernehme den Kaffee.«
»Wie die Pfadfinder«, seufzte Phyllis und brachte das Fleisch in die kleine Kochnische.
»Ich schließe die Fensterläden«, sagte Percy Burkland. »Ich will nicht, daß man das Licht sieht.«
»Hör zu, Percy«, meinte sie und schaute ihn an. »Ich möchte allein schlafen. Ist das klar?«
Er lächelte. »Die Hütte besteht praktisch nur aus einem Raum«, erwiderte er. »Soll ich mich vor die Tür legen?«
»Ich nehme die Couch, und du legst dich auf das Sofa«, entschied sie.
Er nickte und ging hinaus. Nachdem er die Läden geschlossen hatte, überlegte er, ob es ratsam war, das Autoradio zu zerstören, aber ein Hilferuf von Phyllis ließ ihn rasch in die Hütte zurückkehren.
»Was gibt’s?« fragte er.
Phyllis zitterte am ganzen Leib. »Da, die gräßliche Spinne«, sagte sie. »Es ist eine Vogelspinne, nicht wahr? Nimm dich in acht vor dem Biest!«
»Quatsch«, meinte er, »in dieser Gegend gibt es keine Vogelspinnen.« Aber er war sich seiner Sache keineswegs sicher. Er wartete, bis die Spinne über den Boden zu laufen versuchte, und trat sie dann tot.
»Brr!« meinte Phyllis und schüttelte sich. »Jetzt ist mir der Appetit vergangen.« Sie trat an den Tisch und kippte den Inhalt ihres Glases hinab. »Feg das Ding in den Mülleimer, bitte«, sagte sie und wandte der zertretenen Spinne dabei ostentativ ihren Rücken zu.
Percy Burkland tat, was sie von ihm verlangte, und setzte den Kessel mit dem Kaffeewasser auf den kleinen Herd.
»Ich muß mir noch einen genehmigen«, meinte Phyllis und füllte ihr Glas nach.
»Nur immer ran«, meinte er zufrieden. »Das wird dir helfen.«
Wenn Phyllis so weitertrank, erwartete ihn eine heitere Nacht. Er war seit langem auf das Mädchen scharf. Seine Liaison mit Miriam hatte es jedoch bisher unmöglich gemacht, diese Gefühle zu zeigen.
Erst die Mutter, jetzt die Tochter, überlegte er amüsiert. Mal sehen, ob Phyllis das Temperament, die Leidenschaft und die Phantasie ihrer Mutter geerbt hat.
Eine Viertelstunde später aßen sie. Phyllis stocherte unlustig an ihrem Steak herum, dann überließ sie die Hälfte davon Percy Burkland. Dafür trank sie viel Kaffee.
»Hast du Decken mitgebracht?« fragte sie ihn.
»Nein, warum?«
»Nachts wird es ziemlich kühl«, sagte sie. »Es sind nur zwei Decken da.«
»Von einer wirst du dich trennen müssen — oder wir schlafen zusammen«, meinte er.
»Du weißt, wie ich darüber denke.«
»Ich bin überrascht, wie spießig du dich gibst.«
»Ich schlafe nicht mit jedem.«
»Ich bin dein Vertrauter«, sagte er. »Wir sitzen in einem Boot. Wir drehen gemeinsam ein Millionending. Ich finde, das solltest du honorieren.«
»Wenn du nicht der Freund meiner Mutter wärst, könnten wir darüber reden«, sagte sie.
Er tupifte sich den Mund mit einer Papierserviette ab und schob den Teller zurück. Dann stand er auf und suchte ein paar Platten heraus, um Musik zu machen. Phyllis trug das schmutzige Geschirr in die Kochnische.
»Tanzen wir?« fragte er. Er brannte darauf, die hinreißend gewachsene Phyllis in seinen Armen zu fühlen.
»Zu dieser Schnulze?« fragte sie spöttisch.
»Ich liebe langsame Sachen.«
»Ich nicht.«
»Na, komm schon!«
»Ich muß das Geschirr säubern.«
»Laß den Krempel doch einfach stehen.«
»Ich bin hier Gast. Jedenfalls fühle ich mich so«, sagte Phyllis. »Ich möchte nicht, daß dein Freund plötzlich hier aufkreuzt und das Gefühl bekommt, hier hätten die Räuber gehaust.«
»Jack ist in England, den kriegen wir nicht zu sehen«, meinte Percy Burkland.
»Was ist das für ein Jack?«
»Du kennst ihn nicht«, sagte er.
»Wie bist du an den Schlüssel für die Hütte gekommen?« wollte sie wissen.
»Ich wußte, wo er den Zweitschlüssel versteckt hält — unter einem Stein am Seeufer.«
»Mit anderen Worten: Wir halten uns ohne Erlaubnis des Besitzers in dieser Hütte auf«, sagte sie.
»Jack hat mir gestattet, die Hütte zu benutzen«, er klärte, er und grinste matt. »Für amouröse Abenteuer, versteht sich.«
»Daraus wird leider nichts.«
»Der Abend ist noch jung.«
»Diese Musik ist gräßlich. Lege eine andere Platte auf, bitte«, sagte sie.
Percy Burkland tat, was sie von ihm verlangte, und musterte ihren schlanken, biegsamen Rücken. Er bemerkte, daß das Mädchen keinen BH trug, und stellte sich vor, wie es sein würde, wenn seine Finger ihre nackte Haut berührten.
»Schon wieder Schmalz!« protestierte das Mädchen.
»Laß uns tanzen«, bat er.
»Okay, aber nur dieses eine Mal«, sagte sie.
Er zog sie an sich und spürte den leisen Widerstand in ihrem schlanken Körper. Er forcierte nichts und überließ es seinem tänzerischen Geschick, das Mädchen aufzulockern. Schon nach wenigen Minuten merkte er, wie Phyllis sich seiner Führung ganz entspannt überließ. Behutsam faßte er sie enger. Phyllis wehrte sich nicht. Als die Platte zu Ende war, küßte er das Mädchen.
Phyllis ließ es geschehen, aber dann machte sie sich von ihm frei. »Schluß damit.«
Er half ihr, das Geschirr zu säubern, dann setzten sie sich wieder an den Tisch.
»Was nun?« fragte er.
»Ich bin müde.«
»Okay, gehen wir schlafen. Wir können uns im Dunkeln ja noch ein wenig unterhalten. Wie wär’s mit einem letzten Schlaftrunk?« fragte er und öffnete die Flasche.
»Danke, ich habe genug.«
»Nur noch einen.«
»Meinetwegen... Mann, nicht soviel!«
»Danach wirst du besser schlafen.«
»Willst du mich betrunken machen?« Er grinste. »Ich will dich erobern.«
»Schlag dir das aus dem Kopf«, meinte Phyllis, aber sie lächelte dabei.
»Du fühlst dich prima an, das habe ich beim Tanzen gemerkt«, sagte er. »Richtig aufregend.«
»Reg dich wieder ab«, riet sie ihm. »Ausgerechnet hier und heute, mit dir unter einem Dach?« fragte er. »Ausgeschlossen.«
»Du mußt mir versprechen, nicht frech zu werden«, meinte Phyllis und wurde ernst.
»Das ist doch Kinderkram«, meinte er.
»Nicht für mich.«
»Solche Versprechen gebe ich nicht.«
»Dann mußt du draußen schlafen oder im Wagen.«
»Du spinnst.«
»Okay, dann schlafe ich im Freien.«
»Schon gut, schon gut«, lenkte Percy Burkland ein. »Es wird nichts passieren.«
Phyllis holte zwei Wolldecken aus einer Holzkiste und warf eine davon auf das Sofa.
»Ziehst du dich aus?« fragte er.
»Sicher«, erwiderte sie. »Du wirst so lange hinausgehen.«
Er trat mit dem Whiskyglas auf den hölzernen Stepwalk und rauchte eine Zigarette. Der Alkohol hatte ihn entspannt, er hatte aber auch seine Sinnlichkeit angeheizt. Diese Phyllis war hinreißend. Ein Jammer, daß sie sich so spröde gab.
Er nahm sich vor, sie zu besitzen, und grinste düster, als ihm einfiel, daß er der letzte Mann sein würde, der seine Arme um ihren Körper zu legen beabsichtigte — ihr letztes Abenteuer.
»Du kannst wieder reinkommen!« rief Phyllis.
Er befolgte die Aufforderung und verriegelte die Tür von innen. Dann zog er sich im Licht der kleinen Deckenlampe ungeniert aus. Phyllis schaute ihm zu. Das war ihm nur recht. Er war stolz auf seinen muskulösen, schlanken Körper, auf seine schmale Taille und die breiten Schultern. Als er seinen Slip abstreifte, drehte Phyllis sich rasch der Wand zu.
»Du hast Nerven!« meinte sie.
Er sah, daß sie ihr Glas am Kopfende der Couch stehen hatte. Es war fast schon leer.
»Hast du noch keinen nackten Mann gesehen?« fragte er.
Das Mädchen antwortete ihm nicht. Er trat mit der geöffneten Flasche an Phyllis’ Glas heran und füllte es nach.
»Ich habe genug«, sagte sie protestierend. »Mach das Licht bitte aus.«
Er gehorchte und legte sich hin. Die Flasche ließ er in Reichweite stehen.
»Woran denkst du?« fragte er in das Dunkel hinein.
»An nichts.«
»Du lügst. Du denkst, wie es wohl sein würde, wenn ich zu dir unter die Decke schlüpfte.«
»Hör auf damit.«
»Ich bin richtig scharf auf dich, das weißt du doch.«
»Werde nicht geschmacklos. Muß ich dich daran erinnern, was du mir versprochen hast?«
Sie redeten noch ein paar Minuten hin und her, dann merkte Percy Burkland plötzlich, daß er müde wurde. Im nächsten Moment war er eingeschlafen.
***
Er erwachte von einer harten, metallisch klingenden Stimme. »Steh auf, Killer«, sagte die Stimme. »Ich will, daß du im Stehen stirbst.«
Ihm war zumute, als ob er träumte.
Phyllis’ Stimme wirkte total verändert. Auch sonst machte das Mädchen einen erschreckend verwandelten Eindruck. Sie war mit ihrer Lederhose und der Polobluse bekleidet.
Mehr als alles andere schockierte ihn die Pistole, die sie in der Hand hielt. Wie war sie in den Besitz der Waffe gelangt, und was hatte das Ganze zu bedeuten?
Er schob den nackten Oberkörper im Bett hoch und schaute auf seine Armbanduhr. Null Uhr zwanzig. Er war überrascht. Er hatte angenommen, es sei schon viel später.
»Spinnst du?« fragte er.
»Steh auf!« wiederholte das Mädchen mit dieser fremden, metallisch klingenden Stimme. - »Du wirst nicht im Bett sterben, Killer. Dafür sorge ich.«
Ihm fiel es wie Schuppen von den Augen. Phyllis hatte vermutlich nicht einschlafen können. Sie hatte an ihren Vater gedacht, an ihre Mutter, an die Million — und an die möglichen Folgen der vorgetäuschten Entführung.
Phyllis war offenbar aufgestanden. Sie hatte sich in den Wagen gesetzt, um die Nachrichten zu hören. Phyllis wußte jetzt, was gespielt wurde. Sie hatte sicherlich gehört, daß man ihn als Mörder ihrer Mutter suchte.
»Ich verstehe gar nichts mehr«, murmelte er und überlegte, wie er an die Pistole herankommen konnte. »Was redest du da?«
Phyllis’ Lippen begannen zu zittern. »Du hast meine Mutter getötet«, sagte sie.
»Waaas?«
»Ich habe die Nachrichten gehört.«
»Warum hätte ich Miriam töten sollen — warum?«
»Weil du das Geld für dich kassieren möchtest, weil du mit keinem teilen willst.«
»Eine Teilung war nie vorgesehen.«
»Eben! Du konntest der Verlockung nicht widerstehen, das Geld in deine Tasche zu lenken. Um das zu schaffen, mußtest du deine Komplizen aus dem Weg räumen. Mit meiner Mutter hast du begonnen — mich sollte es vermutlich nach dem Anruf erwischen.«
»Nach welchem Anruf?« fragte er, darauf bedacht, Zeit zu gewinnen.
»Du weißt genau, wovon ich rede. Mein Vater zahlt dir keinen Cent, ehe er nicht meine Stimme am Telefon gehört hat. Er wird sie hören — aber zu diesem Zeitpunkt wirst du bereits tot sein.«
»Damit würdest du dich zur Mörderin machen.«
»Mir ist alles egal. Ich weiß nur, daß du Schwein nicht am Leben bleiben darfst.«
»Leg die Kanone aus der Hand!« knurrte er.
»Wenn ich das tue, kann dir kein Arzt mehr helfen.«
Er warf die Wolldecke beiseite und setzte sich auf den Bettrand. Er hoffte, daß seine provozierende Nacktheit sie schockieren oder irritieren würde, aber das Mädchen blickte ihm nur kalt und haßerfüllt in die Augen. Er schaute in die auf ihn gerichtete Waffenmündung.
»Woher hast du das Ding?«
»Ich habe es in der Hütte gefunden, unter den Wolldecken«, antwortete sie.
»Wie kommt es, daß du mir nichts davon erzählt hast?« fragte er.
»Ich fühlte, daß du mich haben wolltest. Ich wollte für den Ernstfall gerüstet sein.«
»Ich kann verstehen, wie dir jetzt zumute ist«, meinte er und holte tief Luft, »aber ich schwöre dir, daß deine Mutter kein anderes Schicksal verdient hat. Weißt du eigentlich, wie oft sie sich mir gegenüber über dich lustig machte — wie oft sie deine Naivität verspottete und deine Bereitschaft, in ihr eine arme, vom Schicksal geprüfte Frau zu sehen? Miriarn hat immer nur an sich gedacht, andere Menschen waren für sie nur Werkzeuge. Das schließt dich und mich mit ein. Ich hatte keine Skrupel, mit ihr Schluß zu machen.«
»Für Mord gibt es keine Entschuldigung.«
»Ich entschuldige mich nicht, ich gebe mir nur Mühe, dir klarzumachen, wer und was sie war.«
»Sie war meine Mutter!« stieß Phyllis hervor.
»Sie war eine Kriminelle«, sagte er.
»Du hast es nötig, so über sie zu sprechen!« höhnte das Mädchen. »Los, steh auf.«
»Ich wüßte gern, was du vorhast«, sagte er und verengte lauernd seine Augen zu schmalen Schlitzen.
»Das habe ich dir erklärt.«
»Du willst mich einfach abknallen? Das nehme ich dir nicht ab«, sagte er.
»Ich kann gar nicht anders«, meinte das Mädchen, dessen Finger am Druckpunkt des Pistolenabzugs lag. »Ich würde ersticken, wenn ich es nicht täte.« Percy Burkland erhob sich langsam. Er war bemüht, die Angst zu unterdrücken, die in diesem Moment an seiner Kehle zerrte. Phyllis hatte gedroht, ihn im Stehen zu erschießen. Wenn sie jetzt abdrückte, war alles verloren:
»Wie ich sehe, hast du einen großen Verband auf der Brust«, sagte Phyllis. »Ich weiß, woher er stammt. Vermutlich gibt er dir das Gefühl, unverwundbar zu sein. Aber ich bin kein Joe Marks, ich falle auf deine Tricks nicht herein. Ich werde dich treffen — tödlich treffen!«
»Die Nachrichten müssen unerhört informativ für dich gewesen sein«, spottete er mit trockenem Mund.
»Ich erwarte, daß du hinausgehst und dich in den Wagenfond setzt«, sagte sie.
»Ich verstehe. Dort willst du mich abservieren. Das erspart dir die lästige Mühe, meine Leiche zum Wagen zu tragen«, sagte er und wandte dem Mädchen den Rücken zu. Er beugte sich nach der Decke und tat so, als wollte er sie Zusammenlegen.
»Laß den Quatsch«, sagte sie heftig.
Er wirbelte auf den Fersen herum, die Decke in der Hand.
Phyllis stolperte zurück. Die scharf durch die Luft pfeifende Wolldecke traf sie am Arm, verwickelte sich in Hand und Pistole und drohte sie kampfunfähig zu machen.
Als Percy Burkland, nur Sekundenbruchteile später, sich auf das Mädchen stürzte, drückte Phyllis ab.
Das Geschoß verfehlte sein Ziel.
Percy Burkland ging mit dem aufschreienden Mädchen zu Boden. Er schaffte es, ihr die Pistole zu entwinden. Schwer atmend kam er wieder auf die Beine. Er spürte, daß seine Wunde erneut aufgerissen war. Das Blut sickerte warm in den dicken Verband.
Auch Phyllis erhob sich. Sie mußte sich setzen, so schwach fühlte sie sich auf den Beinen.
»Jetzt ist alles viel leichter«, sagte er. »Du kannst mich gar nicht töten«, stieß sie hervor. »Du brauchst mich, um das Geld zu bekommen.«
»Ja, das ist richtig«, sagte er. »Ich brauche dich.«
»Wie ich dich hasse! O Gott, warum habe ich nicht gleich abgedrückt?«
»Weil du eine Frau bist. Du mußtest erst dein Maul aufreißen, du wolltest mich zittern sehen, nicht wahr?«
»Sie werden dich schnappen, ich weiß es.«
»Frauen wissen nie etwas. Du schon gar nicht!«
»Ich war dumm«, gab sie mit tonloser Stimme zu.
»Und naiv«, höhnte er. »Deine Mutter hatte schon recht, wenn sie sich über dich lustig machte.«
»Das hat sie nie getan!«
»Du bist eine dumme Gans«, sagte er. »Du hast Miriam nicht gekannt. Du bist auf ihren Schmus hereingefallen, auf ihren brüchigen Charme, auf ihre Komplimente.«
»Gib dir keine Mühe. Es wird dir nicht gelingen, in mir ihr Andenken zu zerstören. — Ich werde mit meinem Vater sprechen, aber nur, um ihn vor dir zu warnen«, sagte das Mädchen. »Ich werde ihm klarmachen, daß er unter keinen Umständen zahlen darf.«
»Mit einer Pistole im Rücken wirst du anders darüber denken«, meinte er.
»Warum sollte ich?« fragte sie. »Sobald du das Geld hast — oder auch nur die Aussicht, es zu bekommen —, ist mein Leben keinen Pfifferling mehr wert.«
»Wie stellst du dir das vor?« fragte er. »Du warnst also deinen Vater. Du sagst ihm die Wahrheit. Was, meinst du wohl, würde er dann tun?«
»Dir keinen- Cent geben — nur das zählt!«
»Er würde dich auf die Straße setzen. Er würde dich den Hunden zum Fraß vorwerfen«, höhnte Percy Burkland. »Du hast ihn betrogen und belogen, zusammen mit der Frau, die ihn jahrelang mit anderen Männern hinterging. Glaubst du im Ernst, das könnte er dir jemals verzeihen?«
»Ich kann ihm erklären, was ich mir dabei dachte«, sagte sie leise. »Außerdem habe ich ihn in der Hand.«
»Was hast du?«
»Wenn ich will, kann ich ihn fertigmachen.«
»Im Ernst?«
»Er hat einen Versicherungsbetrug geplant.«
»Geplant oder schon ausgeführt?«
»Das weiß ich nicht.«
»Sein Officesafe ist am Sonnabend aufgebrochen worden«, berichtete Percy Burkland.
»Was wurde dabei gestohlen?«
»Hunderttausend Piepen und eine Schmuckkassette«, sagte Percy Burkland.
»Also doch«, meinte Phyllis bitter. »Was weißt du darüber?«
»Das geht dich nichts an.«
»Er hat den Schmuck und das Geld schon vor dem Bruch aus dem Safe geholt, stimmt’s?«
Phyllis schwieg.
»Ich ahnte es«, sagte Percy Burkland. »Eine feine Familie. Warum sollte ich irgendwelche Skrupel haben, sie zu vernichten?«
»Ich werde dir dabei nicht behilflich sein«, sagte das Mädchen. »Im Gegenteil. Ich kenne nur ein Ziel. Ich will dich vernichten. Es wird mir gelingen, das schwöre ich dir.«
Er grinste höhnisch. »Welch ein Jammer für dich, daß du am kürzeren Hebel sitzt!«
***
Milo legte den Hörer aus der Hand. »Man hat das tote Mädchen identifiziert«, sagte er. »Man ist jetzt auch völlig sicher, daß sie in Turners Safe gelegen hat. Ihr Name ist Amy Kersh, einundzwanzig Jahre alt. Sie war mit Percy Burkland befreundet — aber das liegt schon ein paar Wochen zurück. Wir wissen, daß er in der Zwischenzeit mit Miriam Cavello verkehrte, und zwar intim verkehrte. Man hat auch Burklands Wagen gefunden, den gelben Porsche. Er parkte in einer Seitenstraße, ganz in der Nähe von Burklands Wohnung.«
»Und Burkland, was ist mit ihm?«
»Verschwunden«, sagte Milo. »Das letzte Lebenszeichen von ihm ist sein Anruf bei Turner.«
Ich nickte. Ich hatte mir das Band angehört.
»Was sagt Turner dazu?« wollte ich wissen. »Zu der Toten in seinem Safe, meine ich.«
»Lieutenant Webley hat Hamilton Turner lange durch die Mangel gedreht. Turner behauptet steif und fest, mit der Geschichte nichts zu tun zu haben.«
»Glaubt Webley dem Mann?«
»Ich habe ihn nicht danach gefragt.«
»Glaubst du Turner?«
Milo zuckte mit den Schultern. »Das ist schwer zu sagen. Er ist zweifellos ein harter Bursche mit guten Nerven. Ihm fällt es nicht schwer, ohne Bandagen zu boxen. Wenn er ein Ding drehen würde — was ich ihm durchaus zutraue —, ist nicht anzunehmen, daß er es eingestehen oder durch Nervosität verraten würde.«
Ich massierte mir das Kinn mit der Hand. »Der Komplex wird allmählich klarer, die Zusammenhänge nehmen Gestalt an. Es gibt freilich noch ein paar Lücken. Sie betreffen den Safe. Wie konnte Percy Burkland an den Schlüssel kommen?«
»Durch Phyllis, nehme ich an«, meinte Milo.
»Richtig — sie kann ihm schon vor längerer Zeit einen Abdruck des Originals verschafft haben«, sagte ich.
»Sie brauchte das Original ihrem Vater nur in einem unbeobachteten Moment wegzustibitzen. Aber warum sollte Burkland das tote Mädchen in den Safe gelegt haben?«
»Um Zeit zu gewinnen. Ich wette, daß er es war, der sie tötete. Er mußte und wollte sich etwas einfallen lassen, um Amy Kersh für immer von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Inzwischen lag die Tote in Turners Safe, gegen jede Entdeckung gefeit.«
»Diese Rechnung ging nicht auf, wie wir wissen.«
»Wir müssen ihn finden — sonst führt er seinen vierten Mord aus«, sägte ich.
»Wir wissen inzwischen eine ganze Menge über ihn«, meinte Milo, »aber wir wissen nicht, wo wir ihn suchen sollen.«
Ich blickte auf die Uhr. Es war ein Uhr morgens. Weder Milo noch ich dachten an Schlaf. Wir wußten, daß es in diesen Stunden für Phyllis Turner um Tod oder Leben ging — falls die Würfel nicht schon gefallen waren. Wir mußten das Mädchen finden, um jeden Preis.
»Ruf Webley an«, sagte ich. »Ich brauche noch ein paar Informationen über Amy Kersh.«
Zehn Minuten später verließen Milo und ich das Office. Wir fuhren mit dem Dienstwagen zur Tenth Avenue. Dort stoppten wir vor dem Haus 157.
»Ein Uhr dreißig«, sagte Milo. »Nicht gerade die übliche Besuchszeit...«
»Wenn das Mädchen zu Hause ist, wird es dafür Verständnis auf bringen«, sagte ich.
Die Haustür war verschlossen. Wir drückten auf den Klingelknopf neben dem Namen »Sheila Power«.
»Wer ist da?« tönte es Sekunden später aus der Gegensprechanlage.
»FBI«, sagte ich. »Erschrecken Sie nicht, bitte. Wir haben einige Fragen, die Ihre Freundin Amy Kersh betreffen.«
Der Türsummer ertönte. Wir betraten die Halle und fuhren mit dem Lift in die dritte Etage. Als wir den Fahrstuhl verließen, lehnte Sheila Power im Rahmen ihrer geöffneten Wohnungstür. Sie trug einen popfarbig bedruckten Hausmantel, unter dem ihre Goldlacksandaletten hervorschauten. Sheila Power war ziemlich groß; sie hatte brünettes schulterlanges Haar und große hübsche Augen von durchsichtigem Bernsteingelb.
Milo und ich wiesen uns aus. Das Mädchen führte uns in sein Wohnzimmer und stellte uns den jungen Mann vor, der dort in einem bequemen Ohrensessel saß. »Mike Tenner, mein Verlobter. Ich habe vor ihm keine Geheimnisse.«
»Das will ich hoffen«, meinte Tenner und lächelte dünn.
Wir setzten uns. »Wann haben Sie zuletzt mit Amy -gesprochen?« fragte ich.
Das Mädchen runzelte die Augenbrauen. »Ist ihr etwas zugestoßen?« murmelte sie besorgt.
»Ja«, erwiderte ich. »Sie wurde ermordet.«
Das Mädchen zuckte nicht zusammen, äußerte keinen Laut, es wurde nicht einmal blaß. Es starrte mich nur an, schweigend, beinahe düster. »Ermordet«, sagte es dann.
»Erwürgt, um genau zu sein. Ihr Mörder sperrte sie in einen Officesafe. Dort wurde das Mädchen von einem Einbrecherduo entdeckt. Die beiden Männer glaubten, damit den Safebesitzer erpressen zu können, und nahmen die Tote mit nach Hause. Die Geschichte hat noch eine Pointe — aber die wollen wir nicht vorwegnehmen.«
»Wann hat man Amy getötet?«
»Das Gerichtsmedizinische Institut vermutet, daß es am Sonnabend zwischen zwölf und halb zwei Uhr geschehen sein dürfte.«
»Percy!« sagte das Mädchen.
»Percy Burkland?«
»Sie wollte zu ihm gehen, mit ihm sprechen. Sie war so siegesgewiß, so glücklich...«
»Glücklich?«
»Ich kann Ihnen nicht sagen, warum«, meinte Sheila Power. »Ich habe versucht, ihr diesen Mann auszureden. Ich mag ihn nicht. Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich ihn nur sehe. Oh, er ist hübsch, ich weiß — aber hinter dieser schillernden Fassade verbirgt sich ein eiskalter Halunke. So sehe ich es jedenfalls. Für Amy war er der Größte. Sie konnte es nicht verwinden, daß er sich an eine ältere Frau herangemacht hatte...«
»An Miriam Cavello«, sagte ich.
»Sie ist tot, ich weiß«, meinte das Mädchen. »Ich kannte sie nicht. Mir lag nur Amy am Herzen. Schließlich war sie meine beste Freundin. Wie gesagt, sie hatte sich vorgenommen, ihn dieser Frau wieder abspenstig zu machen. Amy erzählte mir, daß sie genau wüßte, was sie tun müßte, um ihr Ziel zu erreichen. Es schien mir fast so, als hätte sie das Gefühl, Percy in der Hand zu haben. Aber fragen Sie mich bitte nicht, womit. Ich weiß es nicht.«
»Wir suchen Percy Burkland«, sagte ich. »Er steht im Verdacht, ein dreifacher Mörder zu sein. Wir wollen vermeiden, daß es durch ihn zu einem vierten Mord kommt, und hoffen, daß Sie uns helfen können, ihn zu finden.«
»Ich?« echote das Mädchen ratlos. »Aber ich kenne ihn doch kaum! Ich war einigemal mit den beiden zusammen, das stimmt — aber das reichte gerade aus, um eine tiefe Antipathie gegen Percy Burkland zu entwickeln. Ansonsten weiß ich nichts von ihm. Ich bin noch nicht einmal in seiner Wohnung gewesen.«
»Uns genügt es, wenn Sie sich an das erinnern, was Amy Ihnen über ihre Beziehungen zu Burkland erzählte. Wo pflegten sich die beiden zu treffen?«
»Meistens in seiner Wohnung...«
»Fuhren sie manchmal übers Wochenende weg?« wollte ich wissen.
»Nein — oder doch«, sagte sie rasch. »Zwei- oder dreimal. Zu irgendeiner Hütte am See.«
»An welchem See?«
»Ich weiß es nicht.«
»Hat Amy nie darüber gesprochen? Denken Sie nach, bitte. Es ist sehr wichtig.«
»Darf ich mir eine Zigarette anstecken?« fragte das Mädchen. »Dann fällt mir das Überlegen leichter.« Ich gab ihr Feuer. Sie inhalierte tief und starrte ins Leere, dann schüttelte sie den Kopf. »Ich geb’s auf«, sagte sie. »Ich weiß es einfach nicht.«
»Vielleicht kommen wir auf Umwegen zum Ziel«, sagte ich. »Amy war doch möglicherweise nach diesen Wochenenden sehr aufgekratzt, sie hat Ihnen gewiß erzählt, was sie mit Percy getrieben hat. Haben die beiden Waldspaziergänge gemacht, fuhren sie Motorboot, jagten sie, angelten sie — oder aßen sie in einem bestimmten Lokal?«
Das Mädchen sah verdutzt aus. »Das bringt Sie doch nicht weiter«, meinte sie.
»Es könnte uns helfen, Gegend und Ort zu bestimmen«, erwiderte ich.
»Ich weiß nur, daß die Hütte in der Nähe eines kleinen Sees liegt«, sagte das Mädchen. »Amy erwähnte einmal, daß sie einem Freund von Percy gehört.«
»Erinnern Sie sich an den Namen des Besitzers?«
»Warten Sie... Er hieß Jack, glaube ich. Sein Familienname ist mir nicht bekannt, den wird auch Amy nicht gewußt haben, oder sie hat ihn nicht erwähnt. Jack lebt in England, glaube ich. Er hat Percy Burkland die Benutzung der Hütte erlaubt.«
Ich erhob mich. »Darf ich Ihr Telefon benutzen?« fragte ich und wählte die Nummer des New Addington Golf Club. Nach einiger Zeit meldete sich mit mürrischer Stimme der Platzmeister.
»Das Klubhaus ist geschlossen«, informierte er mich. »Die Angestellten sind nach Hause gegangen.«
Ich ließ mir die Telefonnummer eines Obers geben. Kurz darauf hatte ich ihn an der Strippe. Ich berichtete ihm, worum es ging und was mich interessierte.
»Jack, Jack?« murmelte er. »Ja, da war ein Mann dieses Namens, der noch vor wenigen Monaten viel mit Mr. Burkland zusammen war. Lassen Sie mich nachdenken, wie er mit vollem Namen hieß. Ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Danoff. Jack Danoff. Er ging später nach London, das ist richtig.«
»Er besitzt irgendwo in der Umgebung eine Hütte, ein Wochenendhäuschen. Können Sie mir sagen, wo es liegt?«
»Tut mir leid, Sir, das weiß ich nicht.«
»Leben Danoffs Eltern in New York?«
»Keine Ahnung, Sir.«
Ich bedankte mich und legte auf. Dann rief ich der Reihe nach alle Danoffs an, die in der Stadt wohnten. Ich versuchte zu erklären, worum es ging, aber die meisten waren über die nächtliche Störung wütend und meinten, ich versuchte sie auf den Arm zu nehmen.
Sie legten einfach wieder auf, andere fluchten laut und demonstrierten, welches Vokabular an Schimpfworten sie besaßen.
Erst beim sechsten Anruf hatte ich Glück. Ich sprach mit Danoffs Vater, einem ruhigen, sachlichen Mann. Er erklärte mir, wo die Hütte seines Sohnes lag, und fügte hinzu: »Allein werden Sie kaum hinfinden. Wenn die Sache so wichtig ist, wie Sie sagen, würde ich Ihnen empfehlen, den Sheriff des Ortes aufzusuchen. Der kann Ihnen den Weg weisen.«
Ich warf den Hörer aus der Hand, legte ein paar Münzen auf den Tisch, um dem Mädchen die Telefonunkosten zu erstatten, und sagte: »Es hat geklappt. Wir müssen sofort los.«
Morgens gegen drei Uhr zehn stoppten Milo und ich vor dem Hause des Sheriffs von Green Pond. Wir klingelten ihn heraus und erklärten ihm, worum es ging. Nachdem er sich rasch angezogen hatte, schnappte er sich sein Gewehr und sagte: »Steigen Sie in meinen Jeep, bitte. Der bringt uns rascher zum Ziel.«
Um vier Uhr stoppten wir am Rande einer Lichtung und stiegen aus.
»Von hier sind’s noch zehn Minuten zu Fuß«, meinte der Sheriff. »Es ist besser, wir lassen den Wagen hier stehen. Motor und Scheinwerfer könnten uns verraten.«
Er führte uns ohne Taschenlampe durch einen Wald. Endlich erreichten wir die Hütte.
»Seltsam«, sagte der Sheriff. »Sie wirkt ganz verlassen.«
Milo ging zur anderen Hüttenseite, um die zum See weisenden Fenster im Auge behalten zu können, der Sheriff und ich sprangen auf den Stepwalk und versuchten die Tür aufzureißen. Sie war verschlossen. Wir rüttelten daran und hämmerten mit unseren Fäusten dagegen.
»Aufmachen!« brüllte der Sheriff. »Polizei!«
Niemand antwortete.
Der Sheriff, ein großer, breitschultriger Bursche, warf sich mit voller Wucht gegen die Tür. Beim dritten Anlauf splitterte das Schloß aus dem Rahmen. Der Sheriff öffnete die Tür mit dem Fuß und machte in der Hütte Licht.
»Verdammter Mist«, sagte er schwer atmend und ließ sein Gewehr sinken. »Die sind verschwunden.«
***
Phyllis bemühte sich verzweifelt darum, im Fond des Wagens wach zu bleiben, aber es gelang ihr nicht, sie nickte ein. Als sie erwachte, weil die Stricke an ihren Händen und Füßen einen schmerzhaften Stau ihres Blutes bewirkten, stand der Wagen immer noch hinter der alten Scheune in der Nähe der Bundesstraße. Percy Burkland saß am Steuer und rauchte.
»Wenn du mir nicht die verdammten Fesseln abnimmst, krepiere ich«, sagte das Mädchen.
Percy Burkland warf einen Blick über seine Schulter. »Erst mußt du mir versprechen, ein braves Mädchen zu sein.«
»Wie ich dich hasse! Warum sind wir nicht in der Hütte geblieben?« fragte sie.
»Weil wir telefonieren müssen«, sagte er. »Und zwar sehr früh, noch ehe viele Menschen unterwegs sind.«
»Jetzt stehen wir schon fast eine Stunde hier«, sagte Phyllis. »Was bezweckst du damit?«
»Ich muß überlegen«, sagte er.
»Das hättest du auch in der Hütte machen können.«
»In der Hütte lockten ein Sofa, eine Couch und wärmende Decken«, sagte er. »Vermutlich hätte ich mich wieder hingelegt und wäre eingeschlafen.«
»Nimm mir die Fesseln ab, bitte«, sagte sie. »Meine Blutzirkulation geht allmählich zum Teufel.«
Er stieg aus und setzte sich neben sie in den Fond. »Vielleicht können wir uns einigen.«
»Worauf?«
»Das weißt du doch.«
Phyllis schwieg.
»Wirst du tun, was ich dir auftrage?« Die Schmerzen in Phyllis’ Beinen nahmen zu, sie wurden einfach unerträglich. »Ja«, sagte sie matt.
»Braves Mädchen«, lobte er spöttisch und nahm ihr die Fesseln ab.
Phyllis' massierte sich die Gelenke, dann bat sie um eine Zigarette. Er gab sie ihr. Es war fast schon hell, der heraufziehende Morgen zeigte sich trist, grau und regnerisch.
»Mir ist eine Idee gekommen, die wird auch dir gefallen«, sagte er.
Phyllis lehnte sich erschöpft zurück. Burklands Ideen! Sie hatte guten Grund, sich vor ihnen zu fürchten.
»Du hast da gestern was von einem Versicherungsbetrug erwähnt«, meinte er.
Phyllis schwieg.
Er gab ihr einen Stoß. »He, ich rede mit dir!«
»Das war eine Vermutung von mir, nichts weiter.«
»Willst du mich verschaukeln? Du sagtest, du hättest deinen Vater fest in der Hand. Das ist nicht mit Vermutungen zu schaffen.«
»Worauf willst du hinaus?«
»Ich habe zwei und zwei zusammengezählt und glaube zu wissen, was los ist. Der Einbruch war von deinem Alten bestellt. Er hat sich die Schmuckkassette unter den Nagel gerissen, um die Versicherung zu prellen.«
Phyllis schwieg.
»Ich nehme ihm die Kassette ab«, sagte er. »Das ist ungefährlicher als eine vom FBI überwachte Geldübergabe.«
»Warum sagst du mir das?«
»Weil du ihn kennst. Seine Gewohnheiten, meine ich. Wo hat er die Kassette versteckt?«
»Glaubst du im Ernst, er würde mir das gesagt haben, wenn deine Vermutung zuträfe?«
»Sicher nicht«, meinte Percy Burkland, »aber das ist auch gar nicht notwendig. Denke nach! Wo hat er den Schmuck versteckt?«
»Ich weiß es nicht.«
»Du sollst nachdenken!«
»Was hätte ich davon, wenn ich dir ein paar Versteckmöglichkeiten verriete? Du hast keinen Zweifel daran gelassen, was mit mir geschehen wird.«
»Das beruht auf Gegenseitigkeit, nicht wahr?«
Phyllis schloß die Augen. Sie war unendlich müde. Die Haßausbrüche der Nacht waren nur noch eine vage Erinnerung, von ihrer Kraft und Tiefe war kaum ein Schatten zurückgeblieben.
»Versprichst du mir, mich am Leben zu lassen, wenn ich dir das Versteck nenne?« murmelte sie.
»Du hast mein Wort!« versicherte er. Um neun Uhr fünfzehn überquerte Percy Burkland einige Grundstücke, wobei er sich mit äußerster Vorsicht bewegte und Hamilton Turners Haus nur ganz allmählich näher kam. Er fieberte vor Ungeduld, wußte jedoch, daß es jetzt darauf ankam, die Nerven zu behalten und ruhig zu bleiben.
Er gratulierte sich zu seinem Einfall und zu seinem Mut. Er tat genau das, was keiner von ihm erwartete: Er wagte sich in die Sohle des Löwen.
Es mochte sein, daß sich im Haus ein FBI-Beamter befand, der das Telefon überwachte, aber Percy Burkland stellte das in Rechnung und fürchtete sich nicht vor einer möglichen Konfrontation. Er hatte den Überraschungsmoment auf seiner Seite und baute darauf, daß seine Gegner nicht einmal im Traum daran dachten, daß er es riskieren könnte, hier aufzutauchen.
Er sprintete zur nächsten Buschgruppe und blieb geduckt dahinter stehen. Die Terrassentüren von Turners Haus waren weit geöffnet, um frische Luft hereinzulassen. Weit und breit war kein Mensch zu sehen. Es hatte zu nieseln begonnen. Percy Burkland hörte, daß im Haus mit einem Staubsauger gearbeitet wurde.
Soweit er es erkennen konnte, befand sich im Wohnzimmer niemand. Er gab sich einen Ruck, rannte los und tauchte Sekunden später in dem menschenleeren Wohnzimmer in die Deckung eines großen Ohrensessels.
Sein Herz klopfte hoch oben im Hals. Er wartete einige Minuten, dann richtete er sich auf und schlich zur Tür. Er hatte die schußbereite Pistole in der Hand und fühlte ein seltsames Kribbeln der Spannung auf seiner Haut.
Er öffnete die Tür einen Spaltbreit, blickte in die leere Halle und huschte kurz darauf die Treppe hoch. Er betrat aufatmend ein mittelgroßes Zimmer, die Bibliothek, und zog die Tür hinter sich ins Schloß. Er ging zu dem Buchregal links vom Kamin und begann damit, die Bücher herauszuheben. Er stapelte sie auf den Boden, den Kopf halb zur Tür gewandt und ganz darauf konzentriert, jedes verdächtige Geräusch zu erfassen. Die Pistole hatte er griffbereit auf den Kaminsims gelegt.
Sein Herz machte einen heftigen Sprung, als er ein weiteres Paket Bücher aus dem Regal hob und plötzlich dahinter die flache schwarze Lederkassete entdeckte.
Der Schmuck!
Seine Hände zitterten leicht, als er die Kassette an sich nahm und den Deckel öffnete. Wilder Triumph stieg in ihm hoch. Er hatte es geschafft!
Die funkelnden, ungefaßten, auf schwarzem Samt ruhenden Steine verkörperten einen Millionenwert. Jeder namhafte Hehler würde bereit sein, dafür rund zweihunderttausend Dollar zu bieten — aber es gab natürlich auch andere, sehr viel reizvollere Möglichkeiten, den Schmuck zu Geld zu machen.
Damit hatte er Hamilton Turner fest im Griff. Jetzt konnte er Phyllis’ Vater auspressen wie eine Zitrone.
In seinem Rücken entstand ein Geräusch. Percy Burkland wirbelte entsetzt herum und riß die Augen auf.
***
»Danke«, sagte ich und richtete die Mündung meines Smith and Wesson auf ihn. »Sie haben uns mit der Entdeckung der Kassette geholfen, die Hintergründe des Einbruchs aufzuklären.«
Percy Burkland schielte nach seiner auf dem Kamin liegenden Pistole. Da er die Schmuckkassette mit beiden Händen festhielt, hatte er sich mehr oder weniger handlungsunfähig gemacht.
Milo schlüpfte an mir vorbei ins Zimmer und nahm Burklands Pistole an sich.
Percy Burkland schluckte. Er stellte die Kassette hinter sich in das Regal. »Wie — wie kommen Sie hierher?« fragte er heiser.
»Das war einfach«, sagte ich. »Nachdem wir festgestellt hatten, daß Sie nicht mehr in der Hütte waren, taten wir zwei Dinge. Wir beauftragten den Sheriff, sämtliche einsam liegenden Telefonzellen seiner Umgebung zu überwachen — und wir fuhren schnurstracks hierher, weil wir glaubten, daß Sie diesem Haus einen Besuch abstatten würden.«
»Was brachte Sie darauf?« erkundigte er sich fassungslos.
»Wir haben uns darum bemüht, Ihre Gedankengänge nachzuvollziehen«, sagte ich. »Sie wollten an Turners Geld heran. Sie wußten, daß sein Telefon überwacht wird und daß praktisch kaum eine Möglichkeit besteht, eine narrensichere Lösegeldübergabe zu arrangieren. Daraus zogen Sie Ihre Konsequenzen. Wir ahnten, daß Sie versuchen würden, sich persönlich mit ihm auseinanderzusetzen, unter vier Augen. Sie wären der Meinung, daß niemand von uns auf die Idee kommen würde, Sie könnten sich in die Höhle des Löwen wagen. Wie Sie sehen, war das ein Irrtum. Wir sahen Sie kommen, wir folgten jedem Ihrer Schritte...«
Percy Burkland zuckte mit den Schultern. Er war sehr blaß geworden.
»Wo ist Phyllis?« fragte ich ihn.
»Der arme unschuldige Engel, nicht wahr?« fragte Burkland mit höhnischer Wut. »Sie sitzt mit drin. Sie und ihre Mutter haben das Ganze erst angezettelt...«
»Das wissen wir«, fiel ich ihm ins Wort. »Ich fragte, wo Phyllis jetzt ist.«
Im Korridor ertönten Schritte. Im nächsten Moment betrat Hamilton Turner das Zimmer. Er sah Burkland, dann entdeckte er die Schmuckkassette. Er bekam einen hochroten Kopf.
»Wo — wo ist meine Tochter?« fragte er unsicher.
»Im Kofferraum meines Leihwagens«, erwiderte Percy Burkland. Er hatte begriffen, daß das Spiel aus war. »Sie ist gefesselt und geknebelt, aber ansonsten gesund.« Er schaute Hamilton Turner an. »Wenn Sie erfahren, was Ihre feine Tochter sich ausgedacht und mit Ihnen angestellt hat, werden Sie sich wünschen, sie niemals gesehen zu haben.« Hamilton Turner ballte die Fäuste. »Muß ich mir das anhören?« fragte er.
»Ja«, sagte ich: »Das und noch vieles mehr. Versicherungsbetrug ist kein Kavaliersdelikt, Mr. Turner.«
ENDE