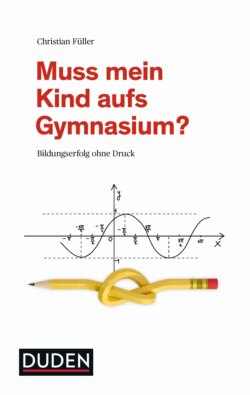Читать книгу Muss mein Kind aufs Gymnasium? - Christian Füller - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2 STERBENDE HAUPTSCHULE
Der Anfang vom Ende der Hauptschule hat ein konkretes Datum. Es ist der 30. März 2006. Damals erscheint im Berliner Tagesspiegel der Brief einer Neuköllner Hauptschule.1 Es ist ein einziger Hilferuf. Die Lehrer schreiben, »dass die Hauptschule in dieser Zusammensetzung aufgelöst werden muss«.2 Das klingt wie ein pädagogischer Offenbarungseid. Wir können nicht mehr, so die Botschaft: Schließt den Laden bitte! Der Brief löst ein kleines politisches Erdbeben aus. Die Rede ist von der inzwischen berühmten Rütli-Schule.
Nur einen Tag später, am 31. März, meldet sich zunächst die Bundeskanzlerin, die sonst nicht viel über Bildung sagt, und kritisiert den Berliner Senat für seine Schulpolitik. Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber und CDU-Fraktionschef Volker Kauder mischen sich ein – auch sie schimpfen über den Umgang mit den Schulen in der Hauptstadt. Wenige Tage später diskutiert sogar der Deutsche Bundestag in einer Aktuellen Stunde die Situation an einer einzelnen Schule. Und mit einem Mal entdecken die Medien die Krise der Hauptschulen – gerade so, als wäre es vorher ein nationales Geheimnis gewesen, wie es um die unterste deutsche Schulform bestellt ist.
Der Fall der Rütli-Schule war ein Lehrstück deutscher Schulpolitik. Jeder konnte wissen, dass es am unteren Ende des Bildungssystems nicht gut läuft. Aber auf eine mirakulöse Art wurde die Hauptschule dennoch immer irgendwie verteidigt und am Leben erhalten. Dabei waren die Hauptschulen schon seit Jahrzehnten vom Siechtum befallen. Im Jahr 1960 besuchten 60 Prozent der 13-Jährigen diese Schulform, im Jahr 2000 waren es nur noch 20 Prozent.3 Seit ihre Schüleranteile immer kleiner wurden, herrschte in den Hauptschulen Nordrhein-Westfalens, Saarlands oder Hessens eine angespannte Lage. Trostlos war sie in Städten wie Berlin, Hamburg oder Dortmund. Aber selbst in den Metropolen des Südens, in München, Nürnberg und Stuttgart, wo sonst bildungspolitisch alles irgendwie besser zu sein schien, waren Hauptschulen zu Krisenzonen geworden.
Studien hatten diese Lage illustriert, auf den hinteren Seiten der Zeitungen kam das Thema immer wieder mal vor, und nicht zuletzt berichteten die Hauptschüler, wie es bei ihnen zugeht. Man wusste also, was los war. Aber nur die Lehrer-Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft und einige zähe Kämpfer für Chancengleichheit brandmarkten beständig das, was die Hauptschule in der Realität ausmachte: eine ungute Konzentration von Bildungsverlierern und die Chancenlosigkeit dieser Klientel. Jahrelang wurde nichts dagegen unternommen. Und dann brachten plötzlich zwei DIN-A4-Seiten, von der kommissarischen Rektorin der Rütli-Schule, Petra Eggebrecht, hastig zusammengetippt und von der Lehrerkonferenz einstimmig beschlossen, die Wende.
»Unsere Bemühungen, die Einhaltung der Regeln durchzusetzen, treffen auf starken Widerstand der Schüler/innen«, hatte die Ersatzrektorin notiert.4 »In vielen Klassen ist das Verhalten im Unterricht geprägt durch totale Ablehnung des Unterrichtsstoffes und menschenverachtendes Auftreten.« Lehrkräfte würden nicht geachtet oder sogar gezielt mit Gegenständen beworfen. »Einige Kollegen/innen gehen nur noch mit dem Handy in bestimmte Klassen, damit sie über Funk Hilfe holen können.«
Welchen Sinn habe es, in einer Schule alle Schüler zu konzentrieren, die weder von den Eltern noch von der Wirtschaft Perspektiven aufgezeigt bekommen, wollten die verzweifelten Lehrer wissen. »In den meisten Familien sind unsere Schüler/-innen die einzigen, die morgens aufstehen.« Die Kritik der Pädagogen bezog sich auf den hohen Anteil arabischer Schüler – vor allem aber auf die Schulform selbst. »Die Hauptschule ist am Ende der Sackgasse angekommen – und es gibt keine Wendemöglichkeit mehr.«
Das Lehrstück hat eine interessante Vorgeschichte. Der Brief des aufgeriebenen Rütli-Kollegiums hatte bereits vier Wochen in den Postablagen aller möglichen Verantwortlichen herumgelegen. Schulleiterin Eggebrecht hatte ihren Notruf an ein Dutzend Adressaten in der Stadt abgesetzt. Aber weder Bildungssenator Klaus Böger (SPD) noch die Gewaltbeauftragte noch die Schulpsychologen hatten reagiert. Das Neuköllner Bezirksparlament, das Berliner Abgeordnetenhaus und sogar der meinungsstarke Bezirksbürgermeister Heinz Buschkoswky (SPD) hatten das SOS-Signal erhalten. Doch nichts war passiert. Erst als die Zeitung und damit die Öffentlichkeit von den unhaltbaren Zuständen erfuhr, tat sich etwas.
Marienthal-Schulen
Dabei war die Hauptschule als Schulform zu diesem Zeitpunkt bereits klinisch tot. Die Studien »Pisa 2000« und »Pisa 2003« hatten eindrucksvoll gezeigt, wie unendlich weit abgehängt die Hauptschulen im Vergleich zu den anderen Schularten waren. Die Öffentlichkeit hatte das beinahe schulterzuckend zur Kenntnis genommen. Dass die Hauptschulen das Ende der Kolonne bildeten, war wahrlich keine Neuigkeit. Dafür war sie ja da – für die langsamen und die weniger begabten Schüler. Das ganze Ausmaß des pädagogischen Skandals enthüllte gut ein Jahr später Jürgen Baumert vom renommierten Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Er illustrierte, was geschieht, wenn man alle Langsamen und Beladenen unter den Jugendlichen in einer Schulform konzentriert: Es entstehen, wie er es nannte, »kritische Schulmilieus«. Damit meinte Baumert eine soziale Zusammensetzung, »die außerordentlich schädliche Auswirkungen auf die Leistungsentwicklung von Jugendlichen hat«.5 In diesen Lernmilieus ist die Hälfte der Schüler schon einmal sitzen geblieben, 40 Prozent machen regelmäßig die Erfahrung von Gewalt. Ein Drittel der Eltern dieser Schüler ist arbeitslos, ein Drittel der Väter und Mütter hat nie einen Beruf erlernt. Eine solche soziale Mischung wirkt wie ein pädagogischer Giftcocktail. Laut Baumert habe sie »dramatische Rückwirkungen auf die Arbeitsbedingungen von Hauptschulen«. Als Max-Planck-Direktor war Baumert nie jemand, der zu drastischen Formulierungen neigte. Lehrer, so schrieb er diesmal jedoch, könnten in solchen Schulen praktisch nichts mehr ausrichten. Schüler seien dort nicht mehr beschulbar.
Der Zustand, den Baumert bei den Hauptschulen entdeckte, war freilich nicht nur in Berlin bedrohlich. In der Hauptstadt zählte er 60 Prozent der Hauptschulen zu den »kritischen Schulmilieus«, in Bremen sogar 95 Prozent, in Hamburg war die Lage bei zwei Drittel der Hauptschulen besorgniserregend, in Hessen litt über die Hälfte und in Nordrhein-Westfalen waren es 44 Prozent. Die Rütli-Schule war also kein bedauerlicher Einzelfall, sondern – in bestimmten Bundesländern – die Regel. Der Mann vom Max-Planck-Institut fand auch einen originellen Namen für diese Schulen. Er nannte sie »Marienthal-Schulen«.6
Der Begriff stammt aus der soziologischen Studie »Die Arbeitslosen von Marienthal«. Paul Lazarsfeld und andere Soziologen hatten im Jahr 1933 das Örtchen Marienthal nahe Wien untersucht, das von hoher Arbeitslosigkeit gekennzeichnet war. Sie fanden dort vier Typen von Bewohnern, von denen drei eine negative Haltung zum Leben einnahmen: die Resignierten, die Verzweifelten und die verwahrlost Apathischen. Gemeinsam war den dreien laut der Studie, dass für sie Zukunft »nicht einmal mehr in der Phantasie als Plan eine Rolle spielt«.
Und nun benutzte ein renommierter Bildungsforscher den Begriff »Marienthal«, um die Atmosphäre in deutschen Hauptschulen zu Beginn des 21. Jahrhunderts zu beschreiben. Er verglich heutige Hauptschüler mit den apathischen und verzweifelten Bewohnern eines erbarmungswürdigen Ortes inmitten einer der größten Wirtschaftskrisen in der Geschichte Europas. Baumert war mittels Sozialdaten und penibler Berechnungen zu demselben Ergebnis wie die Lehrer der Rütli-Schule gekommen. Wie sie forderte er die Behörden indirekt auf, solche Schulen zu schließen. Denn ihre Mischung führe »zu einer schwer zu rechtfertigenden strukturellen Benachteiligung« der betroffenen Schüler.7 Ursache dafür sei, dass der Staat ein System organisiere, das pädagogische Nachteile künstlich herstelle, indem es die schlechtesten Schüler in einer Schulform konzentriere. Mit dem im Grundgesetz verbrieften Anspruch auf Gleichheit sei das nicht zu vereinen.
Was die Rektorin aus Neukölln und der Pisa-Forscher damals auf den Punkt brachten, war die Bankrotterklärung für eine ganze Schulform – und ein Offenbarungseid für die Schulpolitik.
Die zuständigen Schulminister reagierten trotzig und unternahmen – nichts. Sie hatten schließlich nach dem ersten Pisa-Test verabredet, die Schulformen gar nicht erst anzufassen, und so de facto ein Tabu über die Hauptschule verhängt. Wieso wurde nun nicht umgehend ein Notfallplan für die deutschen Hauptschulen beschlossen? Darüber geben die Reaktionen von damals Aufschluss.
Die Hertie-Stiftung zum Beispiel, die seit Ende der 1990er-Jahre einen »Hauptschulpreis« vergeben hatte, nahm flugs eine Umbenennung vor. Sie verzichtete ab 2008 auf das verbrannte Kürzel »Hauptschule« und betitelte ihren Preis plötzlich mit »Starke Schulen. Deutschlands beste Schulen, die zur Ausbildungsreife führen!«. Dabei war es doch erklärtes Ziel der Stifter des Hauptschulpreises – darunter der Deutsche Lehrerverband, die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände und die Bundesanstalt für Arbeit –, das Ansehen der Hauptschulen in der Öffentlichkeit zu verbessern.
Der bekannte Autor Harald Martenstein erklärte den katastrophalen Zustand der Hauptschulen damals in einem seiner Texte. Das Chaos sei dort der Normalfall, der nun mal nicht zu ändern sei. »Bildung ist für zehn oder fünfzehn Prozent der Bevölkerung objektiv wertlos geworden«, schrieb er und führte so einen Teil der Bürger als chancenlosen Bodensatz der Gesellschaft vor.8 Dauerarbeitslose verhielten sich rational, wenn sie »ihre Lebensfreude im Alkohol oder auch in der Kriminalität suchen. Haben sie eine Alternative? Würde ihnen ein Hauptschulabschluss etwas bringen?« Das Proletariat werde eben nicht mehr gebraucht.
Damit hatte Martenstein offen dafür geworben, Schulen für Abgehängte zu betreiben. Tatsächlich gab es die schon in der Realität. Der Leiter der Wattenscheider Fröbelschule, Christoph Graffweg, hatte irgendwann beschlossen, seine Schüler nicht mehr fit für den Arbeitsmarkt zu machen. »Ich sehe als einzig authentische und glaubwürdige Perspektive, die für sie im Augenblick bereitsteht: Arbeitslosigkeit, Hartz IV.«9 Also richtete Graffweg an der Förderschule für sogenannte Lernbehinderte Kurse für seine Zöglinge ein, in denen sie lernten, wie man Sozialhilfe beantragt. Seine Schüler kamen dadurch zwar an keinen Job, aber der Schulleiter ins Fernsehen.
Kampf um die Volksschule
Die Hauptschulen sterben den Bundesländern derweil unter den Händen weg. Es ist aber nicht etwa die Politik, die eine Entscheidung über die Hauptschulen herbeiführt, sondern es sind die Eltern. Sie nehmen ihre Kinder und laufen dieser Schulform in Scharen davon. Seit dem ersten Pisa-Schock im Jahr 2001 hat sich diese Bewegung zu einer kleinen Völkerwanderung verstärkt. In Nordrhein-Westfalen etwa musste die Landesregierung zwischen 2008 und 2016 insgesamt 400 von 700 Hauptschulen zusperren. Baden-Württemberg, das viel weniger Einwohner hat, verlor in der gleichen Zeit sogar 500 Hauptschulen – ein Minus von 40 Prozent. In Bayern schlossen fast 700 ihrer Art die Tore, nur dass dort der Schwund bereits 1992 einsetzte. Bundesweit schrumpfte die Zahl der Hauptschüler – wie beschrieben – nach der ersten Pisa-Studie von 1,1 Millionen Schüler auf nur 427 000 im Jahr 2016.
Die Hauptschulen sind historisch aus den Volksschulen entstanden. König Friedrich II. hatte einst in Preußen mit dem systematischen Aufbau der Schulen für das Volk begonnen. Er drängte darauf, dass jedes Kind die Schule besuchte, und führte 1763 eine allgemeine Schulpflicht ein. Freilich sollte das Lernen dort seine Grenzen haben. Auf dem platten Land sei es für die Bauernkinder genug, »wenn sie ein bisgen lesen und schreiben lernen«. Friedrich hatte seine Gründe: »wissen sie aber zu viel, laufen sie in die Städte und wollen Secretairs und so was werden«.10 Das schrieb er 1779, also vor gut 250 Jahren. Die Volksschulen auf dem Lande platzten damals aus allen Nähten, teilweise wurden achtzig Kinder in einer Klasse unterrichtet. Seitdem haben sich alle anderen Schulformen weiterentwickelt: Die Gymnasien zellteilten sich in humanistische Gymnasien, Realgymnasien und so weiter. Die Realschule spaltete sich aus den Volksschulen ab und wurde professionalisiert, das heißt, ihre Lehrer wurden anders ausgebildet und besser bezahlt. Nur der Stumpf des Schulsystems, die Volksschule, ist geblieben, wie er war.
Man muss diese Entwicklung der Reihe nach erzählen, damit man versteht, warum das Bemühen, aus der Hauptschule eine bessere Schule zu machen, so vergeblich sein musste. Und wie historisch die Chance heute ist, diese Schule zu Grabe zu tragen.
Die Geschichte der Hauptschule ist ein ewiges Hin und Her zwischen den Polen »Schule für Arme!« und »Mehr Anspruch!«. Es scheint, als wäre nicht viel passiert seit der Einführung der Schulpflicht 1763 und ihrer lange dauernden Durchsetzung. Natürlich haben sich beim Wandel von der Volks- zur Hauptschule viele Details verändert. Die Grundanlage blieb aber stets die gleiche: Die Volksschule wurde ganz überwiegend von Arbeiter- und Bauernkindern besucht, denn die wurden als besonders erziehungsbedürftig angesehen. Solche Kinder sollten lernen zu gehorchen und zu beten, aber nicht lernen, um etwas aus sich zu machen. Solange die Hauptschule von der Mehrheit der Schüler besucht wurde, funktionierte das halbwegs. Mit der Zeit aber entwickelte sie sich zu einem Sammelbecken für die langsamen, benachteiligten und schwachen Schüler. Das lag daran, dass die Mittelschicht ihre Kinder zusehends aus dieser Schulform herausholte.11 Eine Entwicklung, die auch heute gilt, egal, ob die Hauptschule inzwischen Werkreal-, Mittel- oder gar Oberschule heißt.
Einer der frühesten Streiter für eine Volksschulreform war Adolph Diesterweg (1790–1866). Der Pädagoge leitete eines der ersten Lehrerseminare, die so etwas wie eine wissenschaftliche Ausbildung der Volksschullehrer praktizierten. Diesterweg hatte ein klares Ziel: Jedes Kind sollte eine achtjährige Schule besuchen – und zwar ohne Rücksicht auf soziale Herkunft und wirtschaftliche Lage. »Die Kinder der Nation sollen zusammen erzogen werden, in den selben Anstalten […] Kein Unterschied mehr zwischen vornehm und gering, arm und reich.«12 So schrieb er in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die zwischen Revolution und Restauration schwankte. Diesterweg dachte die Schule schon zu dieser Zeit pädagogisch, also als Lerneinrichtung und nicht als eine Anstalt, die aus Bauernkindern fromme Menschen machen sollte. Den Unterricht sollte folglich nicht ein Geistlicher geben, sondern ein richtiger, das heißt ausgebildeter Lehrer. »In dem geistanregenden, geistesweckenden, die Selbsttätigkeit des Schülers belebenden Unterricht liegt die Kraft des Lehrers und der Schule«, schrieb Diesterweg 1846.13 Das war für seine Zeit etwas Ungeheuerliches. Die Selbstständigkeit des Schülers war zuvor noch nie das Ziel irgendeiner Volksschule gewesen.
Preußens Kultusministerium reagierte erbost auf Diesterweg. Dass der Berliner Seminarleiter es wagte, die Emanzipation der Schule von der Kirche und die Entwicklung der Schüler zu Staatsbürgern zu fordern, zog jahrelange Rügen und Kleinkriege mit der Schulbürokratie nach sich. Kultusminister Friedrich Eichhorn ließ ihm schließlich mitteilen, dass seine aufrührerische Parole »sich nicht länger mit der Würde seiner amtlichen Stellung vertrage, vielmehr dem Lehrerstande, zu dessen Herausbildung er berufen sei, ein höchst nachteiliges Beispiel gewähre«.14 Kurz vor der Revolution von 1848 wurde Diesterweg in den Ruhestand entlassen. Er war, wenn man so will, das erste politische Opfer des Kampfes um die Hauptschule.
In fast allen Staaten der Erde gilt das Prinzip, dass eine Schule eine Schule ist, in die grundsätzlich alle gehen. Eine demokratische Schule. Das wurde in der Regel in Revolutionen erstritten. Auch für das preußische Parlament lag während der Revolution von 1848 ein Gesetzentwurf vor, der das Bürgerrecht auf Bildung formulierte: »Der Staat gewährt dem Kinde jedes Preußen den zur allgemeinen Menschen-, Bürger- und Nationalbildung erforderlichen Unterricht.«15 Ähnlich lautete Paragraf 155 der Paulskirchenverfassung. Da in Deutschland die politische Revolution aber scheiterte, fiel auch die Gründung einer demokratischen Schule aus. Weil eine Schule für alle Landeskinder nie eingeführt wurde, schuf sich das Bürgertum de facto eine eigene Schule – und reservierte sie für ihre Schicht: das Gymnasium. Wenn man aber eine Spezialschule für die vermeintlich oder tatsächlich besseren Schüler zulässt, dann muss es zwingend auch Schulen für den Rest geben. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Grund dafür, dass Hauptschulen in Deutschland entstanden sind – und es sie immer noch gibt.
Von Natur aus ungleich
Die eine Seite des Diskurses über die Volksschule lautete stets: Demokratisiert sie endlich! Auf der anderen Seite gab es immer das Argument, dass für einen bestimmten Teil der Schülerschaft so etwas wie eine volkstümliche Bildung ausreichend sei. Gemeint ist, dass es eine Bildungsstätte »für die Jugend der handarbeitenden Schichten« geben müsse. So argumentierte etwa der Pfarrer Franz Georg Ferdinand Schläger, der Mitte des 19. Jahrhunderts die Zeitschrift Hannoverscher Schulfreund herausbrachte. Schläger wollte Schulmänner – so nannte man Pädagogen damals – dahingehend beraten, dass sie mehr Bildung unters Volk bringen, aber ausdrücklich nicht zu viel. Überlade man die Köpfe mit zu viel Wissen, dann wollen die Schüler später nicht mehr aufs Feld. »Wie kann man das Zudrängen zum Studieren am besten hemmen?«, lautete daher schon damals Schlägers wichtigste Frage. Mancher stellt sie heute genau so wieder.
Diese Haltung hielt sich lange. Karl Stöcker, der führende Theoretiker der Volksschule und später der Hauptschule in den 1950er- und 1960er-Jahren, schrieb: »Auch dem einfachen Menschen dürfen und wollen wir deshalb das Recht auf Bildung und die Möglichkeit des ›Gebildetseins‹ nicht abstreiten.«16 Und dann forderte er im selben Atemzug, dem Lerntrieb des – wie er es ausdrückte – einfachen Menschen eine deutliche Grenze zu setzen, weil dieser »an hoher Geistigkeit nicht teilnehmen kann und will«. Mit anderen Worten: Das Gesetz des Kolumnisten Martenstein, wonach für bestimmte Schichten Schnaps statt Schule vollkommen ausreichend sei, ist nicht singulär. Genau diese Denkhaltung hat der Hauptschule über Jahrhunderte das Überleben gesichert.
Der Streit darüber, ob Kinder von vornherein fixe Begabungsmuster aufweisen, wurde besonders durch die Französische Revolution und ihre Ideale angeheizt. Die Schule galt dort als Garant dafür, allen Bürgern gleichermaßen ihre Rechte und Pflichten beizubringen. In Preußen wurde dieser demokratische Ansatz von dem Schulreformer und Beamten Wilhelm von Humboldt in Form einer neuhumanistischen Bildungstheorie aufgegriffen. Humboldt formulierte einen Bildungsbegriff, der auf die freie und offene Entwicklungsfähigkeit jedes Menschen angelegt war. So lehnte er in seinen Königsberger und Litauischen Schulplänen 1809 eine gegliederte Schule ab, bei der Gleichaltrige auf verschiedene Schulformen geschickt werden.17 In der Praxis wurde Humboldt jedoch von ebenjenen preußischen Schulbehörden ausgebremst, deren Vorgesetzter er eine Zeitlang gewesen war. »Daß die Menschen von Natur ungleich sind, dieser Satz steht fest«, schrieb etwa der im Ministerium für Volksschulen zuständige Beamte Ludolph von Beckedorff, einer der härtesten Gegner liberaler Schulreformer, wie Humboldt oder später Diesterweg es waren.18 Wer diese Ungleichheit anzweifle, gefährde die natürliche Ordnung. Nicht auf eine allgemeine und gleichartige Volksbildung oder auf »ein Abrichten für alle Fälle« komme es an, so Beckedorff. »Sondern darauf, daß ein jeder zu dem Stande oder Berufe, wozu er durch Geburt oder elterlichen Willen oder eigene Entschließung bestimmt worden ist, auch mit allem Ernste von früher Kindheit auf gründlich und vollständig auferzogen und vorgebildet werde.« Es herrsche eine natürliche Verschiedenheit der Menschen – in Geschlecht, Alter, Kräften, Neigungen, Talenten und vor allen Dingen in ungleich ausgeteiltem Besitz. Und es sei wichtig, diese Zuteilung so früh wie möglich im Bildungswesen vorzunehmen.
Beckedorff ging schon Anfang des 19. Jahrhunderts von unterschiedlichen »Gaben der Natur« aus. Die Formel von der »begabungsgerechten« Schule findet sich aber noch 200 Jahre später standardmäßig in Parteiprogrammen und amtlichen Mitteilungen. »Bayern setzt auf ein differenziertes, durchlässiges Schulsystem, auf ein begabungsgerechtes, breit gefächertes Bildungsangebot«, antwortete etwa ein Sprecher des bayerischen Kultusministers auf eine Anfrage zur Hauptschule im Jahr 2018.19
Die Begabungslehre
In Deutschland wurde für das korrekte Einsortieren der Schüler ein eigenes ideologisches Konstrukt gebildet: die Begabungslehre. Nach diesem Konzept gibt es zwei Grundtypen von Begabung: die manuell-praktische und die geistig-theoretische. Man muss das jeweilige Talentmuster nur identifizieren und kann die Schüler dann zielsicher in die richtige Schulschublade einsortieren, so die Idee. Empirisch ist das alles nicht haltbar, da es den Hauptschüler als definierbares und determiniertes Begabungsprofil nicht gibt. Studien etwa zeigen, dass die Zuteilung von Schülern auf Schulformen zum Teil willkürlich erfolgt. Ein Viertel der Schüler von Realschulen lagen zum Beispiel im Jahr 2009 in ihren Lesekompetenzen über denen von Gymnasiasten, und selbst zehn Prozent der Hauptschüler lasen auf Gymnasialniveau.20 Das heißt, es landen Schüler in Hauptschulen, deren Kompetenzen genauso hoch sind wie die von Gymnasiasten oder Realschülern. Dennoch hat sich die Begabungslehre lange als pädagogische Doktrin gehalten.
Bis in die 1950er-Jahre wurde in der Wissenschaft beharrlich die Auffassung vertreten, dass Begabung ausschließlich angeboren sei. Diese biologistische Sichtweise wich erst in den 1960er- und 1970er-Jahren einem dynamischen Begabungsbegriff. Nun rückten auch die Umwelteinflüsse in den Fokus. Die Leistungsfähigkeit der Schüler sollte in neuartigen Schulen gesteigert werden. Im Mittelpunkt des Diskurses stand damals das, was die Politik gerne das Mobilisieren der Begabungsreserven und das Verbessern der Bildungschancen nennt. Parallelen zur heutigen Pisa-Diskussion sind unübersehbar – auch in den 1960er-Jahren wurde die Debatte durch katastrophale deutsche Ergebnisse bei einer OECD-Studie angestoßen. Heute geht man eine Art Mittelweg: Die Auffassung, die menschlichen Fähigkeiten seien qua Geburt festgezurrt, gilt als unhaltbar; aber auch das Konzept, dass der menschliche Geist ein unbeschriebenes Blatt sei, das man durch Bildung frei gestalten könne, wird als unrealistisch zurückgewiesen. In populären gesellschaftlichen Debatten wird natürliche Begabung nach wie vor als entscheidender Faktor von Lernerfolg angesehen.
Die Begabungslehre gibt es allerdings nicht nur in den Köpfen, sie wird auch in der Praxis angewandt. In Bayern zum Beispiel, dem Land, das die Hauptschule so lange als erfolgreiche Schule pflegte. Schauen wir uns also eine bayerische Hauptschule, die mittlerweile in Mittelschule umbenannt ist, einmal vor Ort an.
Bayerische Verhältnisse
Die Fahrt in die bayerische Provinz ist ohne Auto nicht denkbar. Das Navi zeigt jedoch nur das Gymnasium und die Realschule des Schulzentrums an, die Mittelschule existiert auf der digitalen Landkarte nicht. Vor Ort steht sie dann doch da, genauso unansehnlich wie die anderen beiden Schulen.
Die Mittelschule und die Realschule waren an dem Kooperationsprojekt beteiligt, in dem Bayerns Länderregierung die Zusammenarbeit der beiden Schulformen erstmals offiziell erlaubte. Die Zusammenarbeit sei gut gewesen, berichtet der Schulleiter. Sie ging nicht wahnsinnig tief, aber es war ein Anfang. Dachte er. Inzwischen ist das jedoch schon wieder Geschichte. Das Ministerium in München hat den Schulversuch zwei Jahre laufen lassen, dann wurde er sang- und klanglos wieder beendet. »Wir kooperieren jetzt trotzdem noch«, erzählt der Mann. »Aber nicht mehr offiziell. Kooperation war ohnehin nur am Nachmittag und in Sport und Musik möglich.« Ist das denn erlaubt? »Ich bin weit weg von der Obrigkeit in München. Ich mache gerne Sachen, die noch nicht erlaubt sind.«21
Das gehört zu den speziellen bayerischen Verhältnissen. Dort sind die Gräben zwischen den Schulformen so tief, dass selbst das bayerische Kooperationsprojekt irgendwie ein Fortschritt war – auch wenn sich Lehrer in anderen Bundesländern die Haare raufen würden, wenn sie hörten, wie so etwas in Bayern abläuft. Etwa, dass jedem Schüler bei dieser Art der Kooperation zwischen Realschulen und Mittelschulen jederzeit klargemacht werden musste, von welcher Schule er eigentlich kam. Es sollte kein Mittelschüler denken, er sei jetzt plötzlich ein Realschüler, nur weil er zum Beispiel mit den anderen Musik machte oder auf dem gleichen Sportfeld stand.
Was von der Kooperation übrig blieb, ist eine gemeinsame Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag. Dort treffen sich 62 Schüler sogar aller drei Schulen des Ortes. »Wir arbeiten hier eng zusammen«, sagt Dorothée Spatz22, die den offenen Ganztagsbereich des Schulzentrums mit den drei Schulen leitet. »Das bietet sich ja auch pädagogisch an«, ergänzt sie. »Es ist wichtig für die Schüler, denn ab der fünften Klasse trennt sich das ganz stark.« Sie macht eine Pause. »Das wissen Sie ja.« Sie hält es für nötig, den Besucher über die bayerischen Verhältnisse aufzuklären. Damit er nicht erschrickt. Sie berichtet also, dass die Schüler ab der fünften Klasse »nicht mehr so viel miteinander zu tun haben«. Die Gymnasiasten rümpften die Nase, und auch die Realschüler ignorierten die Hauptschüler. »Bei uns hier ist das ganz anders«, meint sie fröhlich. Die 62 Kinder machten am Nachmittag alles zusammen, ganz gleich, welcher Schulform sie am Vormittag zugerechnet würden.
Wenn man nun allerdings durch die Reihen der Schüler im Nachmittagsprogramm geht, stellt man fest: Die Gymnasiasten erledigen ihr Pensum oben im ersten Stock. Die Haupt- und Realschüler das ihre ein Stockwerk tiefer. Es wird weiter getrennt. Hier ist man offenbar schon froh, wenn die Schüler der drei verschiedenen Schülerspezies sich in einem gemeinsamen Gebäude aufhalten. Aber zusammenarbeiten? Nein, das tun sie nicht. Nun gesteht auch die Betreuerin des Kooperationsprojektes: »Ich bin eine Anhängerin des dreigliedrigen Schulsystems.« Sie, die gerade ein Loblied auf die gemeinsame Nachmittagsarbeit gesungen hat, argumentiert jetzt, das sei eben eine sehr geordnete Art, mit schulischen Dingen umzugehen. Jeder an seinem Platz, das habe sich bewährt. Bayern fahre damit sehr gut. So plätschert ihre Rede dahin – bis Frau Spatz aufschreckt. Es gebe etwas, das ihr in letzter Zeit Kopfschmerzen bereite. Was nicht mehr so gut hinhaue, sei nämlich die fehlende Passgenauigkeit in der Zuteilung der Schüler. Eigentlich verteile das Auslesesystem die Schüler korrekt und zielgenau. Nun aber komme ein Störfaktor hinzu – die Eltern. »Sie setzen ab der dritten Klasse die Kinder unter Druck. Und was dabei herauskommt – das merke ich immer wieder –, sind Schüler, denen es nicht gut geht.« Sie meint die Schüler, die im Unterricht nicht mehr mitkommen – weil die Eltern mit ihrem falsch verstandenen Ehrgeiz ihre Kinder zu hoch einstuften und gewissermaßen in die Falle der falschen Schulform lockten.
In der Turnhalle des Schulzentrums, die alle drei Schulen nutzen, haben heute die Mittelschüler Sport. Zwei sind mit Attest befreit und schauen von einer Bank aus zu: Marc und Lennart23 aus der siebten Klasse. Lennart will einmal Forstwirt werden. Er möchte Bäume und Bepflanzungen so planen, dass der Wald überleben kann. Auch das Schießen auf Tiere störe ihn nicht, zwinkert er dem Gast zu. Ja, Förster sei ein toller Beruf, entfährt es dem Besucher. Doch Lennart legt Wert auf diese Korrektur: Er meine »Forstwirt«, nicht »Förster«. Denn Förster, das könne er nicht mehr werden, dieser Zug sei abgefahren. »Das ist schwierig«, sagt er, »da müsste ich ja Abitur machen. Und das geht nicht mehr.«24
Lennart ist 13 Jahre alt, er hat sowohl den Sprung in die Realschule verpasst als auch den in den M-Zweig seiner Schule. Dieser M-Zweig ist eine der bayerischen Besonderheiten. Der M-Zweig war an der Hauptschule eine Sonderklasse, die zum mittleren Schulabschluss führte. Diesen M-Zweig gibt es immer noch – obwohl doch die ganze Schule inzwischen eine Mittel-, also M- Schule ist. Diesen letzten engen Seitenweg zum Abitur aber hat Lennart verpasst. »Ich hätte auch gern die Chance, einen besseren Schulabschluss zu erreichen«, sagt Lennart, der, wenn er die Sporthalle verlässt, keine fünfzig Schritte gehen müsste, um Gymnasium oder Realschule zu betreten. So nah und doch so fern.
IM LABYRINTH DER SCHULFORMEN
Eltern und Schüler brauchen inzwischen eine Gebrauchsanweisung, um sich im babylonischen Wirrwarr von Regel-, Sekundar- und Gemeinschaftsschulen zurechtfinden zu können.
1 Sekundarschule: Das ist ganz allgemein der Oberbegriff für weiterführende Schulen, also Schulen, die sich an die Grundschule anschließen. (Übrigens: Auch Grundschulen unterscheiden sich schon. In Berlin und Brandenburg dauert die Grundschule sechs Jahre, im Rest der Republik nur vier Jahre.)
Zugleich heißt ein ganz konkreter Schultyp Sekundarschule, etwa die »Integrierte Sekundarschule« (ISS) in Berlin oder die »Sekundarschule« in Sachsen-Anhalt. In Berlin können Schüler auf der ISS das Abitur erwerben. In Sachsen-Anhalt gibt’s nur den Haupt- und Realschulabschluss.
2 Hauptschule, Realschule, Gymnasium: Auch wenn jeder diese Schulformen kennt, gibt es selbst hier Mischformen und Umetikettierungen. Bayern etwa wollte den verhassten Schultyp Hauptschule nicht mehr und benannte ihn deshalb in Mittelschule um. Die Werkrealschule wiederum existiert nur in Baden-Württemberg. Dabei handelt es sich um eine Hauptschule, die auch einen Realschulabschluss anbietet. In Rheinland-Pfalz heißt diese Schule Realschule plus.
3 Gesamtschule und Gemeinschaftsschule: Die beiden Schultypen sind sich ziemlich ähnlich und integrieren verschiedene Schülertypen. Das heißt, hier finden sich nach gängigem Sprachgebrauch »Hauptschüler«, »Realschüler« und »Gymnasiasten« im selben Klassenzimmer wieder.
Es gibt jedoch einen maßgeblichen Unterschied: In der Gesamtschule werden Schüler weiter getrennt, in der Gemeinschaftsschule nicht. Was heißt das konkret? Die integrierte Gesamtschule schickt ihre Schüler ab der siebten Klasse in den Hauptfächern in verschiedene Leistungsgruppen: die Gymnasiasten in eine andere als die Realschüler und die Hauptschüler. Man nennt das »äußere Leistungsdifferenzierung«. Und, Achtung, Besonderheit: Die kooperative Gesamtschule hat nur ein gemeinsames Dach, darunter befinden sich die drei getrennten Einrichtungen Hauptschule, Realschule und Gymnasium.
Die Gemeinschaftsschule trennt Schüler also nicht mehr, sie lernen wie in der Grundschule in derselben Klasse weiter. Viele Schulen praktizieren das seit vielen Jahren erfolgreich (siehe dazu Kapitel 3). Auch die Stadtteilschule in Hamburg, die Sekundarschule in Berlin und Nordrhein-Westfalen sowie die Oberschule in Bremen sind integrierte Schulen, die den Weg zum Abitur ermöglichen.
4 Regelschule, Oberschule, Sekundarschule etc.: Das sind Namen für »Schulen mit mehreren Bildungsgängen«. Das heißt, in der fünften und sechsten Klasse lernen die Kinder zusammen in einem Klassenzimmer. Ab der siebten Klasse werden sie dann getrennt. Achten Sie bei diesen Schulen stets darauf, dass dort auch Schüler mit Realschulempfehlung sind. Das ist wichtig für die Mischung!
5 Doppeldeutige Schularten: Manche Schultypen haben denselben Namen, bedeuten aber etwas anderes. So sind Oberschulen in Sachsen nur rhetorisch aufgewertete Mittelschulen. Das Abi gibt’s dort nicht. Bremen und Niedersachsen hingegen vergeben an ihren Oberschulen auch das Abi.
Gemeinschaftsschulen gibt es in mehreren Bundesländern – fast überall sind sie ein bisschen anders. In Berlin hat eine Gemeinschaftsschule in der Regel eine Oberstufe, in Schleswig-Holstein, SachsenAnhalt, Baden-Württemberg und im Saarland nur manchmal. In Berlin beginnt die Gemeinschaftsschule bereits in der ersten Klasse, in anderen Ländern nicht.
Marc, auch er 13 Jahre alt, möchte am liebsten Schauspieler werden. Er besucht oft das einige Kilometer entfernte frühere Landestheater. Zu Hause probt er kleine Rollen und versetzt sich in andere Charaktere hinein. Der Besucher will wissen, ob er denn schon in einer Theatergruppe mitmache.
»Was ist das?«, fragt er.
»Schüler, die Theater spielen.«
»Nein, bei uns in der Mittelschule gibt es das nicht«, sagt er.
»Aber drüben am Gymnasium haben die doch ganz sicher eine Theatergruppe«, hakt der Reporter nach.
»Aber da kann ich ja nicht hin, da ist doch das Gymnasium!«, sagt Marc.
»Die Theatergruppe ist bestimmt eine freiwillige AG, die am Nachmittag probt. Warum solltest du da nicht teilnehmen können?«
»Echt wahr! Sie meinen also, ich könnte mit denen zusammen proben?«, strahlt er. Marc ist einer der Jugendlichen, denen man die Begabungslehre mit Beckedorff’schen Argumenten noch im 21. Jahrhundert eingehämmert hat.
Termin beim Rektor der Mittelschule. Er wirkt engagiert, zugleich müde und abgekämpft. »Wir haben große Hoffnungen in diese Kooperation gesetzt«, sagt er. »Ich bin überzeugt davon, dass man meine Mittelschüler hier mitreißen, begeistern könnte. Das würde uns guttun.« Allein die Tatsache, dass die Schüler beim gemeinsamen Unterricht mit der Realschule von dem Kastenwesen befreit wären, das man ihnen täglich vorlebe – das würde vieles besser machen. Aber so sei die Situation nicht einfach, die soziale Mischung nicht gut. »Die Schüler, die nach der Grundschule in der fünften Klasse hier bei uns ankommen, sind oft schwer beschädigt. Die haben wenig Selbstwertgefühl«, erzählt der Schulleiter. Der Leistungsdruck und das Aussieben gingen schon sehr früh in den Grundschulen los. Tatsächlich wird das Bestehen der vierten Klasse in Bayern mittlerweile von vielen »Grundschulabitur« genannt. Von Weihnachten bis Anfang Mai büffeln Viertklässler durch, um die magische Schallgrenze eines Durchschnitts von 2,33 (Gymnasium) oder 2,66 (Realschule) zu erreichen.
Der Schulleiter redet sich unterdessen in Rage. »Die Umbenennung in Mittelschule war nur ein neuer Mantel. Alles äußerlich. Das merken die Schüler schnell, dass da nur ein Türschild ausgewechselt wurde«, sagt er. Und kommt dann darauf zu sprechen, was der eigentliche, der heimliche Plan bayerischer Schulpolitik gewesen sein könnte: dass man die Hauptschule in Mittelschule umbenannt habe, um sie dann leichter mit der Realschule fusionieren zu können. »Ja, kann sein«, sagt er, »dass das der Plan war. Die Fusion mit der Realschule kann aber nicht klappen, weil mit der großen Flucht von 2015 plötzlich Tausende von zusätzlichen Schülern kamen. Da waren wir plötzlich wieder gefragt als Mittelschule. Auch wenn unter den Geflüchteten viele Gymnasiasten sind – die lernen alle bei uns an der Mittelschule.«
Niemand will Hauptschule sein
Woher kommt dieser tiefe Graben zwischen Schulformen, die sich doch so nah sind? Das hat mit der Vergangenheit zu tun. Die Historie der Hauptschule ist eine der verpassten und verhinderten Gelegenheiten. Das gilt auch für die jüngere Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Jahr 1953 wurde der »Deutsche Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen« eingesetzt, ein Gremium, das Bund und Länder beraten sollte. Der Ausschuss bezeichnete die Volksschule als rückständig. Die volkstümliche Bildung dieser Schule genüge den Qualifikationserfordernissen einer boomenden Wirtschaft nicht mehr. Die schichtenspezifische Auslese – so warnte der Ausschuss schon damals – verfestige die alte Ständegesellschaft.25 Der Deutsche Ausschuss setzte daher auf eine Reform der Volksschule, die aus Grundschule und Hauptschule bestand. Aber es gab auch Bedenken. Eine Öffnung der höheren Schulen für Hauptschüler führe zu deren Überschwemmung durch eine Schülerschaft, die in Wahrheit gar nicht für sie geeignet sei. Ein Abwandern der stärkeren Schüler werde wiederum die Hauptschule zu einer Restschule von Jugendlichen degradieren, deren Lebenschancen sich auf ungelernte Arbeit beschränken – gemeint war das untere Drittel ihrer damaligen Schüler.26 Schon im Jahr 1957 warnte der Ausschuss vor der »Auspowerung« der Hauptschule.
Man lernt hier zweierlei: Erstens hat der Deutsche Ausschuss damit in den 1950er-Jahren ziemlich hellsichtig jenes Szenario vorhergesagt, das fünfzig Jahre später in der Rütli-Schule eintreten sollte – die Entstehung »kritischer Lernmilieus« und die Erschöpfung der Hauptschule. Zweitens wird hier die Dialektik von Reformen innerhalb eines gegliederten Schulsystems deutlich. Sobald man die höheren Schulformen öffnet, gehen der unteren Schule die (guten) Schüler aus, und sie sackt buchstäblich in sich zusammen. Sie wird schnell zu einer Restschule – aber sogleich durch allerlei Notfallmaßnahmen reanimiert. Andernfalls müssten die Realschulen ja deren verbliebene Schüler aufnehmen – und das ist das Letzte, was der Realschullehrerverband will.
Aber die beste Politur des Türschilds hilft nichts. So gut die Hauptschule auch immer werden mag, sie bleibt, solange es höhere Schulen gibt, stets die unterste Schulform. Das setzt ein Perpetuum mobile von Aufstieg und Niedergang in Bewegung, das man aktuell in einigen Bundesländern beobachten kann. In Bayern etwa wurden die Hauptschulen 2011 / 12 in »Mittelschulen« umbenannt. Das half am Anfang, aber inzwischen wissen alle: Jetzt ist halt die Mittelschule die neue Restschule. In Sachsen ist man schon eine Namensetage höher, dort benannte man die untere Schulform, die Mittelschule, 2013 in »Oberschule« um. Auch mit dem neuen Türschild fällt es ihr schwer, Lehrer zu finden. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass es bereits wieder bergab geht.
Der an den Deutschen Ausschuss anschließende »Deutsche Bildungsrat« – auch er ein Beratergremium, das für Bund und Länder Konzepte entwarf – versuchte ab Mitte der 1960er-Jahre den einzig denkbaren Ausweg aus diesem Dilemma zu finden: Man müsse die Hauptschule abschaffen – und damit logisch zwingend das dreigliedrige Schulsystem. Der Rat schlug daher so etwas wie eine Restlaufzeit für Hauptschulen vor. Die Schulform sollte erst aufgemotzt und dann mit anderen Schulformen fusioniert werden, sprich: beendet werden. Zunächst wurde die Hauptschule 1964 ganz offiziell unter diesem Namen eingeführt. Sie »schließt an die Grundschule an und endet mit der 9. Klasse. Eine 10. Klasse ist möglich«, legte die Kultusministerkonferenz (KMK) im sogenannten Hamburger Abkommen fest, das für alle Länder galt.27 Im Jahr 1969 wurde die Hauptschule dann als »weiterführende Schule« anerkannt. Der Bildungsgesamtplan von 1973 sah schließlich die verschiedenen Schulformen nur noch als historisch überkommene Durchlaufstationen auf dem Weg hin zu einem integrativen Schulsystem an. Das heißt: keine Trennung der Schüler nach Leistung mehr. Der Plan ging allerdings nicht auf, denn der Bildungsrat kann in einem föderalen System den Ländern mit ihrer Kulturhoheit allenfalls Empfehlungen geben. Das wird auch bei jenem Bildungsrat nicht anders sein, der 2018 gegründet werden sollte. Und selbstverständlich haben unermüdliche Bildungsreformer sofort eine Petition gestartet, dass auch der neue Bildungsrat als Erstes über Bildungsgerechtigkeit verhandeln solle. Geschichte wiederholt sich eben doch.
Die Reiz-Reaktions-Muster sind stets dieselben, wenn es um die Abschaffung der Hauptschule geht. Denn ihre Auflösung bedeutet, dass sie dann in den anderen Schulformen aufgehen müsste. Ein solches Szenario ruft die immer gleichen Interessengruppen auf den Plan. In Deutschland fordert stets als Erstes der Deutsche Lehrerverband, die Hauptschulen zu erhalten, und das, obwohl der Verband gar keine Hauptschullehrer vertritt. Der Lehrerverband ist ein Dachverband, der Pädagogen aller Schulformen organisiert, Gymnasial-, Realschul-, Berufsschullehrer und so weiter – nur Hauptschullehrer findet man dort nicht. Warum engagiert sich der Verband dennoch für die Hauptschulen? Damit die Hauptschüler schön in ihren »Marienthal-Schulen« bleiben und sich nicht etwa Richtung Realschule oder Gymnasium aufmachen.
Das Sterben der Hauptschule sollte die Bildungsrepublik nicht in Trauer stürzen. Es ist ein überfälliger Schritt hin zu einer neuen Schulstruktur, heraus aus dem 19. und hinein ins 21. Jahrhundert. Mit dem Zusperren der Hauptschulen allein ist es aber nicht getan. Das beste Beispiel dafür ist die Rütli-Schule.
Dort hat die Transformation geklappt. Für die Neugeburt der Rütli-Schule scheuten Staat und Gesellschaft allerdings keine Kosten und Mühen. Die Stadt Berlin legte sogar eine Straße still, um einen eigenen »Campus Rütli« möglich zu machen. Dort ist eine Reihe von Stiftungen aktiv, welche die Schüler und die Schule unterstützt. Am modernen Märchen von Aschenputtel wollen eben viele teilhaben. Es müssen aber auch viele mitmachen, sonst klappt es nicht. Keine zehn Jahre nachdem die Lehrer die weiße Fahne der Kapitulation gehisst hatten, legten die ersten Rütli-Schüler das Abitur ab – an der Oberstufe ihrer eigenen Schule.