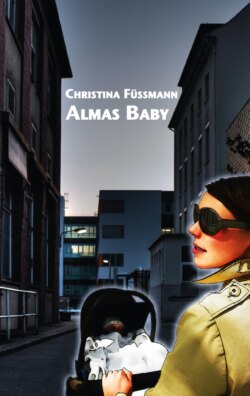Читать книгу Almas Baby - Christina Füssmann - Страница 5
Prolog
ОглавлениеDas Letzte, an das sie sich erinnern konnte, war das gleißende Licht um sie herum. Es riss sie heraus aus ihrem schützenden Kokon. Sie war aufgespürt worden, weil sie nicht hierher gehörte. So wie sie nirgendwo hingehörte. Weil sie anders war. Anders als alle anderen. Immer schon. Dabei hatte sie doch wirklich versucht, sich anzupassen. Und nun ergab es keinen Sinn mehr. Nichts hatte noch Sinn. Endstation. Ausgerechnet hier in dieser muffigen Hütte.
Diese entsetzliche Müdigkeit! Aber wie hätte sie auch schlafen können mit einem Baby an ihrer Seite, das vor Hunger nicht zur Ruhe kam? Sanft wiegte sie den kleinen Körper hin und her. Ein winziges Wesen. Erst ein paar Tage alt und schon der harten Realität ausgesetzt. Kein Wunder, dass es weint, dieses hungrige Baby, das zu nähren sie nicht in der Lage ist. Aber es muss still sein, denn hier im Gartenverein haben die Wände Ohren.
Man achtet aufeinander, seit gleich nebenan ein Bandenkrieg getobt und zwei Todesopfer gefordert habe. So versicherten es sich die Laubenpieper immer wieder gegenseitig. Aber dieser angebliche Bandenkrieg war so lange her, dass die Geschichte eher wie eine Legende erschien.
Allerdings hatte sie sich tatsächlich abgespielt: Pfingstsamstag – im Morgengrauen des 13. Mai 1989. Sie war damals fast selbst noch ein Baby. Eine blutige Familienfehde unter Italienern, die sich an Nichtigkeiten entzündet hatte. Verschwundene Lebensmittel aus einer Pizzeria, Verdächtigungen des Inhabers gegenüber mitarbeitenden Verwandten. Und dann der Showdown im Fredenbaumpark, wo man die Sache bereinigen wollte. Am Ende gab es zwei Tote – wegen ein paar Pfund verschwundenem Käse. Die Laubenpieper verkauften die Geschichte ungeachtet der Realität immer noch gerne als Bandenkrieg der Mafia.
Sie hatte diese Räuberpistole bereits als Kind gehört und sie schon damals für eine Ausrede gehalten. Eine beschönigende Begründung für jene unbändige Neugier, mit der die Gartenfreunde Anteil am Leben und Treiben ihrer Nachbarn nahmen. Hier hatte sie schon früher immer mal wieder Unterschlupf gefunden und darum gebetet, um Gottes Willen nicht aufzufallen. Ein Anliegen, das sie ihr ganzes Leben begleitet hat.
Schon als Kind wäre sie liebend gern so gewesen wie alle anderen Kinder auch. Aber es war ihr nicht vergönnt. Das wurde ihr spätestens klar, als sie eingeschult wurde. Während alle in ihrer Klasse in legeren Jeans durch ihre Jugend schlendern durften, musste sie niedliche Kleider tragen und ihre langen blonden Haare zu Zöpfen flechten. Sie sollte halt aussehen wie ein richtiges Mädchen. So hatte es ihr Vater bestimmt. Ein Vater, der seine Wohlanständigkeit nach außen trug wie einen protzigen Pelzmantel, den er zu Hause dann allerdings ganz schnell ablegte. Was er sagte, wurde gemacht. Alle in der Familie hielten sich daran, denn sonst setzte es Prügel. Und wenn sie als Einzige trotzdem hin und wieder aus der Reihe tanzte, fielen die besonders brutal aus. Vor allem wenn er betrunken war. Kinder hatten zu folgen. Töchter in erster Linie.
Zu Vaters Vorstellungen gehörte auch, dass Mädchen – egal wie gute ihre Noten auch sein mochten – keine höhere Schulbildung anzustreben hatten. Das lohne sich nicht, weil sie ja ohnedies heiraten würden und sich ihre Selbstverwirklichung dann in dem geordneten Dasein einer Hausfrau und Mutter zu erfüllen habe.
Immerhin – einen Beruf sollten sie vor der Ehe schon ergreifen. Etwas Praktisches, mit dessen materiellem Erfolg sie dann auch zur elterlichen Haushaltskasse beisteuern konnten. Das hieß in ihrem Fall, dass ihre Mutter sie als Friseur-Azubi in jenem Salon unterbrachte, in dem sie sich selbst seit 20 Jahren einmal im Monat stets dieselbe Frisur verpassen ließ. Ob der Tochter eine Zukunft recht sei, deren Bemühungen sich ausschließlich darin erschöpfen würden, unattraktiven Hausfrauen dabei zu helfen, am Ende der Prozedur noch unattraktiver zu erscheinen – danach hatte die Mutter nie gefragt. Übrigens auch die Lehrherrin nicht, als sie ihrem neuen Azubi aus Image-Gründen kurzerhand die ursprüngliche Langhaar-Frisur durch einen dauergewellten Kurzhaar-Schopf ersetzte.
„Du siehst aus wie meine Oma“, kommentierten die Mädchen in der Berufsschule ihre uncoole Verwandlung und wandten sich kichernd ab.
Und dann kam – viel später – jene Zeit, in der sie wiederum ganz anders aussah, als sie es sich jemals zuvor hätte vorstellen können. Genauso wie es ihre Kunden schätzten. Nein, nicht die im Friseur-Salon. Die Freier auf dem Straßenstrich an der Ravensberger Straße. Ja, den gab’s damals noch mit seinen schmuddeligen „Verrichtungsboxen“, die einen Tag nach der Meisterschaftsfeier für den glorreichen BVB im Mai 2011 bei Nacht und Nebel abgerissen wurden. Dem Bürgerwillen einiger Großstadtsaubermänner opfert ein Oberbürgermeister doch gern jene 80 000 Euro Sexsteuer aus der ohnedies karg bemessenen Stadtkasse. Dabei sollte die doch nur ein Jahr zuvor noch gerade durch die Arbeit emsiger Huren wieder aufgefüllt werden. Erst im Sommer 2010 hatte der Rat eine neue Satzung verabschiedet, die der Stadt das Kassieren von Steuern „für die Einräumung der Gelegenheit von sexuellen Vergnügungen und das Angebot sexueller Handlungen“ ermöglichte. Diese Möglichkeiten wurden dann 2011 durch das generelle Verbot der Straßenprostitution erheblich eingeschränkt.
Ein untauglicher Versuch zur Eindämmung der Zuwanderung von Roma ins Dortmunder Stadtgebiet. Ein ungleicher lokaler Kampf gegen die eher globale Idee der Osterweiterung. Die wollte man plötzlich nicht mehr, wie so vieles andere auch nicht: das Grillen im öffentlichen Grün und das Betteln in der City. Und selbst die Methadon-Ausgabe des Gesundheitsamtes wurde verlegt, weil sie zu nahe am Konsum-Dorado des neuen Einkaufsparadieses der Thier-Galerie lag. Wer will schon die Elendsgestalten der Drogenabhängigen sehen, wenn er auf Shopping-Tour geht? All das sollte geändert werden zugunsten einer klinisch reinen Stadt mit lauter ordentlichen Bürgern, die höchstens noch mal heimlich mit dem Kleinkalibergewehr auf Fußball spielende Kinder im Innenhof ihres Wohnblocks schießen. Aber wen interessiert das schon, wenn ansonsten alles wohlgeordnet und sauber ist. Eine Stadt, die man vorzeigen kann – fast ununterbrochen beleuchtet. Und in der man viel kaufen kann. Nicht alles zwar, und nicht alle können das. Aber auf die, die nicht kaufen können und auf das, was man nicht kaufen kann, kommt es doch ohnedies nicht an.
Ein Wandel, der sich allerdings erst lange nach Almas Zeit auf dem Nordstadtstrich vollzog. Damals war das Projekt „Unsere Stadt soll schöner werden“ noch nicht angelaufen und das Wort Ekelhäuser total unbekannt. Für Alma war die Ravensberger Straße mit den gammeligen Verrichtungsboxen noch altbekanntes Terrain. Schließlich hatte sie damals dort für den schönen Mirko angeschafft, denn der gewährte ihr dafür Unterkunft. Wo hätte sie denn sonst bleiben sollen, nachdem sie ihre Lehre geschmissen und ihr Vater sie deswegen aus dem Haus geprügelt hatte? Das Heroin half ihr, den Ekel vor dem zu überwinden, was sie zu tun hatte, um Freier und Zuhälter zufriedenzustellen. Alles lief gut – dachte sie wenigstens. Bis zu jener Nacht, in der Mirko sie an den inzwischen wieder lang gewachsenen Haaren auf den Parkplatz hinter den Baumarkt schleifte.
Dort warteten drei seiner Kumpel, die er aufgefordert hatte, das Pferdchen mal richtig zuzureiten, „damit die taube Nuss endlich begreift, wie der Laden hier zu laufen hat. Ein Huhn, das keine goldenen Eier legt, kann ich nicht brauchen.“
Die Jungs sahen das ein und ließen sich nicht lumpen. Als sie fertig waren, urinierten sie noch auf ihr blutendes Opfer, das zusammengekrümmt vor ihnen auf dem Boden lag. In jener Nacht hatte sie sich geschworen, ihr Leben zu ändern – koste es, was es wolle.
Sie hatte es versucht und sich verdammt viel Mühe gegeben. Zuviel Mühe, als dass alles hier in der muffigen Laube einer Nordstadt-Kleingartenanlage enden sollte. Es musste einfach irgendwie weiter gehen.
Das Baby war endlich eingeschlafen. Sie nahm es vorsichtig hoch, ging auf die Tür zu und dann plötzlich wie im Kino: Spot an!!! Das Innere der Laube präsentierte sich in seiner ganzen Schäbigkeit im gleißenden Scheinwerferlicht. Und eine Megafon-Stimme versuchte ihr von draußen Anweisungen zu geben. So, wie jeder bisher versucht hatte ihr zu sagen, was sie zu tun und zu lassen habe. Selbst Berthold. Aber damit musste nun endgültig Schluss sein. Sie nahm das Messer vom Tisch, das sie aus Mirkos Wohnung heimlich mitgenommen hatte und tat, was sie tun musste. Dann stolperte sie mit letzter Kraft vor die Tür ins gleißende Licht und streckte dem auf sie zu stürzenden Polizisten die Arme mit dem blutbesudelten Bündel entgegen – Sekunden, bevor ihre Knie unter ihr einknickten.