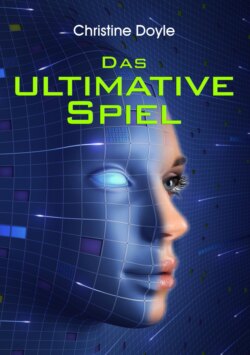Читать книгу Das ultimative Spiel - Christine Doyle - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2
ОглавлениеJuni 2095
Rio Negro kam mehrmals in der Woche. Immer spät abends. Seinen richtigen Namen kannte sie nicht und wollte ihn auch nicht wissen. Da er aber einen Namen brauchte, hatte sie ihm diesen verpasst.
Rio Negro trug schwarz, nur schwarz. Wenn sich die dunkle bärtige Gestalt mit dem tief ins Gesicht gezogenen Hut näherte, schloss sie stets ihre Augenlider bis zur Hälfte. Automatisch lief ihr ein eisiger Schauer durch den Körper; eine Mischung aus Furcht, Erregung und Neugier. Erst wenn seine warmen Hände sie langsam und sanft massierten, löste sich diese Anspannung. Selbst beim ersten Zusammentreffen konnte sie sich nicht überwinden, ihn genauer anzusehen. Sie wollte ihre Illusion um jeden Preis behalten. Es war die Illusion von Daniels Berührung. Von ihm wollte sie massiert werden. Nur von ihm. Doch leider tat er es nicht.
Tini schob ihre Sehnsucht zur Seite und genoss Rio Negros Hände. Nur ein wahrer Künstler konnte so den Rücken entlang gleiten. Auch wenn es richtig wehtat, war es äußerst wichtig, schließlich litt sie unter der Glasknochenkrankheit. Die ständige Veränderung der Wirbelsäule verspannte die Muskeln immer wieder aufs Neue. Ihr Geist konnte aber nur frei arbeiten, wenn ihr Körper im Gleichgewicht war. Wie kein anderer stellte Rio Negro dieses Gleichgewicht her.
Sie war völlig in Gedanken versunken, als es klingelte. Unwillkürlich zuckte sie zusammen. Wer kam so spät? Schließlich war es fast Mitternacht. Während Cleabo - der gute Geist des Hauses und das, obwohl ein Roboter - sie vom Massagetisch hob, in eine Decke hüllte und in den Rollstuhl setzte, ging Rio Negro zügig zur Tür und öffnete. Kaum hatte er das getan, wurde er beinahe von Professor Asbury Park umgerissen. Während der, wie von der Tarantel gestochen, in die Wohnung stürmte, schloss der Physiotherapeut die Tür leise hinter sich.
Das Tempo des Professors war durchaus sportlich für sein Alter. Erst als er direkt vor ihr stand, stoppte er.
Immer wenn Tini ihn traf, musste sie automatisch daran denken, dass er nur so hieß, weil er am gleichnamigen Ort gezeugt wurde. Natürlich war sie nicht die einzige, die diese Assoziation herstellte. Deshalb nannte der Professor seinen vollen Namen nur, wenn es keine andere Möglichkeit gab.
Sie kannte ihn seit vielen Jahren und mochte seine fachliche Kompetenz. Im Laufe seines langen Arbeitslebens hatte er es bis zum Leiter des Transplantationszentrums des örtlichen staatlichen Krankenhauses geschafft. Das war nicht selbstverständlich, denn neben seiner fachlichen Kompetenz besaß er eine äußerst chaotische Art.
Professor Asbury Park war verheiratet, lebte aber, den Gerüchten nach, seit Jahren getrennt. Die Ehe war kinderlos geblieben. Da aber jeder so viel Nachwuchs haben konnte, wie er wollte, vermutete sie, dass Professor A. Park, wie er sich selbst gern nannte, Kinder schlichtweg nicht leiden konnte.
Wenn sie ihn traf, war sie jedes Mal von seiner Größe beeindruckt. Er überragte durchschnittlich gewachsene Menschen um mindestens zwei Kopflängen. Sein grauer Bart, meistens von ihm sträflich vernachlässigt, verkleinerte sein Gesicht auf eine komische Art. Dazu war er Brillenträger. Einer von wenigen altmodischen Menschen, die nicht zum Kreis der Fundamentalisten gehörten. Tini vermutete, dass er durch die Brille intellektueller wirken wollte, denn er war durchaus eitel.
Den Beweis, dass er altmodisch war, konnte jeder an seinem graumelierten Haar erkennen. Es sah immer gleich aus. Egal wie das Wetter war, klebte es an seinem Kopf wie ein schlecht sitzendes Toupée. Allerdings konnte es keins dieser Teile sein, die gab es schließlich seit Jahrzehnten nicht mehr. Heutzutage pflanzte man an den kahlen Stellen neue Haare ein, die dann in einer schönen Farbe leuchteten.
Der Professor musste das ablehnen, denn sein Oberhaupt besaß dieses mysteriöse Aussehen, das früher alternde Schlagerstars kennzeichnete.
Die Detektivin wurde das Gefühl nicht los, dass der Professor in die falsche Zeit hinein geboren worden war. Sie bezeichnete ihn gern als komischen Kauz. Durchaus liebenswert, aber eigen. Jeden Morgen ließ er sich seine Chocolate con churros und einen frisch gebrühten Chai Latte mit Karamell durch einen Onlineservice ins Haus liefern. Er aß jeden Tag Fisch mit Salat zum Mittag und liebte die Farben schwarz und weiß. Sie hatte ihn noch nie eine andere Farbe tragen sehen. Seinen Charakter beschrieb sie gern mit den Worten: aufrichtig und jähzornig. Meistens wirkte er gedankenverloren, denn er nahm seine Umwelt selten war.
Völlig außer Atem schnaufte er: „Du glaubst nicht, was passiert ist?“
Tini konnte tatsächlich nicht glauben, wie aufgelöst er war. Sie hatte ihn noch nie so erlebt. Immerhin kannte sie ihn bereits seit frühester Kindheit. Damals arbeitete er als Neurochirurg und fand das Aneurysma in ihrem Schädel.
Dr. Asbury Park, damals kein Professor, operierte selbst. Er hatte große Probleme an die Stelle heranzukommen. Mit viel Mühe gelang es ihm, das Gewebe bis auf 0,2 Millimeter genau zu bearbeiten. Eine falsche Bewegung während der Operation hätte genügt, um die Ader nebenan platzten zu lassen. Damals gehörte er eindeutig zu den wenigen Neurochirurgen der Extraklasse, die fast an jede Stelle im Schädel kamen. Seine Perfektion erreichte er durch Visualisierung. Jahre später ging er in die Forschung. In der Zeit veröffentlichte er beeindruckende Ergebnisse im Bereich des vierten Hirnnervs. Sie hatte seine Arbeiten gelesen und war sehr beeindruckt gewesen.
Vor einigen Tagen stöberte sie in einem Fachmagazin. Dort wurde die Frage aufgeworfen, was der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Neurochirurgen ist? Die Antwort: Die schlechten glauben, sie machen alles richtig. Die guten glauben, sie machen alles falsch. Asbury Park gehörte in die Kategorie: megafalsch.
Sie erinnerte sich gut daran, dass sie während der Operation wach war und es ulkig fand, wie jemand in ihrem Kopf herumstocherte. Das Ganze war ohne irgendwelche Schmerzen über die Bühne gegangen. Aber warum sollte sie Schmerzen haben? Im Kopf gibt es schließlich keine Rezeptoren.
„Die Natur hat das Rumpopeln im Gehirn nicht eingeplant“, lautete einer seiner Lieblingssätze.
Seit der Operation besaßen ihre Eltern, Bernard und Eleonore Tucker, ein gutes Verhältnis zum Professor. Was kein Wunder war, denn immerhin hatte der Professor ihr Leben gerettet. Dazu kam, dass ihre Eltern selbst hoch angesehene Hirnforscher waren.
Als ihr Vater vor zehn Jahren starb, machte Asbury den Vorschlag, einen Teil seiner Hirnsubstanz auf Cassandras Leiterplatten zu transferieren. Tini stimmte sofort zu. Sie mochte die Idee. Die Beziehung zu ihm war seit jeher wesentlich enger gewesen, als die zu ihrer Mutter. Bernie war sanft, zielorientiert, ausdauernd und er besaß eine gute Portion Humor. Ihr Vater war zu seinen Lebzeiten das Pflaster auf ihrer Seele gewesen und blieb es über seinen Tod hinaus. Er gehörte zu den intelligentesten und kreativsten Menschen seiner Zeit. Da sie ihn auf gar keinen Fall verlieren wollte, ließ sie den Mind-Upload auf ihren Rechner Cassandra durchführen
„Du glaubst nicht, was passiert ist?“, wiederholte Asbury, dabei rang er immer noch nach Luft.
„Auf jeden Fall, scheint das Passierte ziemlich außergewöhnlich zu sein. Ich würde vorschlagen, wir gehen in meinen abhörsicheren Raum.“
Die Detektivin hatte sich den Raum noch vor ihrem Einzug einrichten lassen. Der Grund dafür waren ihre sehr öffentlichkeitsscheuen Kunden.
Tini sah den Professor verschwörerisch an, doch dem gefiel diese Ankündigung keineswegs.
„Muss ich mich wieder komplett entkleiden?“, maulte er genervt.
„Du weißt doch wie gut Wanzen heutzutage funktionieren. Nicht nur, dass man sie überall verschwinden lassen kann. Selbst in einer Zwischenschicht von einem Stück Papier hatte ich schon eine. Letzte Woche hat einer versucht, mich mittels Laser auszuspionieren.“
Der Professor schüttelte ungläubig den Kopf.
„Asbury, es gibt die verrücktesten Sachen. Kaum spürbare Schwingungen von Fensterscheiben können in Sprachsignale zurückgewandelt werden. Selbst bei verglasten Bildern funktioniert das.“
„Woher weißt du das?“
„Ich bin Detektivin. Es wäre tragisch, das nicht zu wissen!“ Tinis Grinsen zeigte einen leichten Anflug von Boshaftigkeit. Mit ernstem Ton setzte sie hinzu: „Wanzen senden heutzutage nicht mehr permanent und wenn sie senden, dann nur auf den gängigen Frequenzen. Man braucht sie nicht zu suchen, man hat sowieso keine Chance sie zu entdecken. Runter mit den Klamotten!“
Der letzte Satz kam auffällig genüsslich. Eigentlich hatte sie einen Witz gemacht. Bevor jemand den abhörsicheren Raum betrat, musste er einen Scanner passieren, der sehr wohl die Wanzen finden und automatisch zerstören konnte. Dieser war halt beim letzten Besuch des Professors defekt gewesen, und deswegen hatte sie zu der radikalen Maßnahme des Entkleidens greifen müssen. Inzwischen war er wieder in Ordnung.
Ständig vor sich hin brabbelnd ließ der Professor die Hüllen fallen. Dann schlich er im Adamskostüm in den spärlich eingerichteten Raum, wo ihm Tini, süffisant lächelnd, eine Decke reichte. Asbury Park stand da und wusste nicht, was er tun sollte. Er war völlig verunsichert. Dabei gab es zwei schöne Sessel, die man in eine bequeme Liegeposition bringen konnte.
„Und du bist absolut sicher, dass uns hier niemand hören kann?“, hakte er nach.
Vorsichtig setzte sich der Professor auf den vorderen Teil der Sitzfläche. Tini dagegen genoss es offensichtlich, einen fast nackten Mann gegenüber zu haben. Warum auch nicht, das kam schließlich selten genug vor.
In aller Ruhe erklärte sie ihm, dass er sich im Gebäudekern des Bo-Buildings befand. Der Raum besaß eine Schirmdämpfung von 30dB, schützte vor elektromagnetischen Feldern, war staubdicht und sein Feuerwiderstand lag bei einhundertzwanzig Minuten.
„Aber genug dazu. Was kann in einem öffentlichen Krankenhaus so ungewöhnliches passieren, dass du um diese Zeit auftauchst?“
„Hmch, hmch“, schnaufte der Professor nach Luft ringend. Die Aufregung führte bei ihm eindeutig zur Atemnot.
„Du wirst es nicht glauben. Aus unseren Behältern wurden eine rechte und zwei linke Hände gestohlen. Komischerweise waren sie in den gestrigen frühen Morgenstunden wieder da.“
Unwillkürlich grinste Tini. „Vielleicht konnte der Dieb sie nicht gebrauchen, vielleicht war er in Wirklichkeit auf der Suche nach einem Fuß.“
Der Professor, der eigentlich immer für einen Scherz zu haben war, ächzte wie eine alte Holzdiele. Sein Gesicht nahm schmerzverzerrte Züge an.
„Heute Morgen habe ich die Behälter erneut überprüft und musste feststellen, dass zwei rechte Hände fehlen.“
Tini stutzte. „Sind alle Hände gleich groß?“
Er hastete ins Wohnzimmer und holte sein Smartphone hervor. Dabei hatte er einige Mühe, seine Decke zu behalten.
„Sie sind nahezu gleich groß“, rief er erstaunt.
„Sind die Daten der Hände für jeden Mitarbeiter frei zugänglich?“
Tinis Frage entrüstete Asbury. Er erklärte umständlich, dass die wichtigen Daten selbstverständlich in einer gesperrten Datei abgelegt seien und ausschließlich von ihm einzusehen waren. Selbst die Zuordnung in dem umfangreichen Lagerbereich kannte nur er.
„Was um alles in der Welt, will einer mit linken und mit rechten Händen?“, jammerte er verzweifelt.
Das war eine berechtigte Frage, die sich leider nicht so ohne weiteres beantworten ließ.
„Hast du die Diebstähle zufällig entdeckt?“, fragte Tini.
„Vor zwei Tagen wollte ich eine rechte Hand transplantieren. Ich stehe da, starre auf den leeren Behälter und mir bleibt fast das Herz stehen. Da hat man mal einen Privatpatienten und dann so was.“ Ein Seufzer kam aus seinem tiefsten Inneren. „Ich habe keinen Ersatz. Schließlich will jeder seine eigene Hand haben, nicht irgendeine. Na ja, zum Glück tauchte sie gestern wieder auf und ich konnte operieren.“
Der Professor schüttelte den Kopf.
In den letzten Jahren war es modern geworden, seine Gliedmaßen nachzüchten und auf Vorrat lagern zu lassen. Ein Grund war der Einzug ultrascharfer, japanischer Messer in die Küche. Die Leute schnitten sich schnell mal einen Finger ab. Etliche spülten ihn dann auch noch den Abfluss hinunter, so dass er nicht wieder angenäht werden konnte. Viele Menschen wollten auf Nummer sicher gehen und ließen sich deshalb Gliedmaßen und Organe aus eigenen Stammzellen nachzüchten.
Die Kliniken reagierten darauf, indem sie große, meist unterirdische Lagerbereiche einrichteten. Bei den privaten Krankenhäusern lagerten die Körperteile der Reichen. In den öffentlichen Krankenhäusern die Körperteile der Mittelschicht und der geizigen Reichen. Auf der Rangliste der Einlagerungen kamen nach den Gliedmaßen die Herzen.
„Aber es kommt noch besser. Vor einer halben Stunde habe ich die Behälter erneut überprüft. Und was sehe ich? Die beiden rechten Hände sind zurück, dafür fehlt jetzt eine linke Hand. Kannst du mir mal erklären, was das soll? Sind unsere Behälter Selbstbedienungsläden?“
Tini ignorierte die Frage. Sie hing ihren Gedanken nach. „Wenn ich dich richtig verstehe, verschwanden in den letzten Tagen insgesamt zwei linke und drei rechte Hände, die von selbst zurückkamen. Dafür fehlt jetzt eine linke Hand. Hm.“ Die Detektivin überlegte. „Gehören die Hände Männern oder Frauen?
„Ausschließlich Männern.“
„Gibt es irgendeine Besonderheit?“
„Nein, keine. Ich habe die Transplantate genau untersucht. Der Dieb wusste genau, wie er damit umgehen musste.“ Der Professor war völlig in seinen Gedanken versunken. „Sie müssen in einer semifluorierten Alkanverbindung, mit mindestens einem flüssigen Siloxan, konserviert werden, wenn sie nicht gleich transplantiert werden können“, fügte er erklärend hinzu.
Tini empfand den letzten Satz als blödsinnig. Nicht mal der Dümmste käme auf die Idee, Transplantate ohne Konservierungsstoffe ins Regal zu legen. Trotzdem hielt sie sich zurück, stattdessen fragte sie: „Für wen wären die Hände interessant?“
„Natürlich benötigen die Privatkliniken ab und zu Transplantate von uns, besonders bei den Organen. In meinen Behältern liegen zum Beispiel genug Nieren von Armen, die ihre Organe aus notorischem Geldmangel an uns verkauft haben. Vergiss nicht, dass die Nachzucht aus induzierten pluripotenten Stammzellen seine Zeit braucht. Reiche sind selten bereit zu warten. Bei den Gliedmaßen ist das natürlich anders, da achten Arme wie Reiche auf eigenes Material.“ Der Professor seufzte. „Verstehst du, warum ein Transplantat verschwindet und wieder auftaucht? Ist das ein Spiel?“
Tini strich sich nachdenklich übers Haar. Sie machte eine ausgedehnte Pause.
„Was soll das für ein Spiel sein? Wir spielen doch nur noch online und nicht mehr im richtigen Leben. Vielleicht ist es ein übler Streich eines Angestellten?“
„Nein. Auf gar keinen Fall“, protestierte Asbury. „Wenn einer erwischt wird, ist der Job weg.“
„Ist es eigentlich schwer bei euch einzubrechen?“
Der Professor sah die Detektivin erstaunt an. Ihre Frage war ganz offensichtlich blöd. Nein, es war nicht schwer. Öffentliche Krankenhäuser leben nun mal vom freien Zugang fremder Menschen.
„Hm, Hände verschwinden und tauchen wieder auf“, dachte Tini laut nach.
„Vielleicht will uns einer ruinieren?“, spekulierte der Professor. Er sprang auf, dabei rutschte ihm seine Decke weg. Als er es bemerkte, lief er augenblicklich hochrot an.
Die Detektivin tat, als ob sie nichts bemerkt hätte.
„Unsinn, As. Wozu? Öffentliche Krankenhäuser sind viel zu wichtig. Ihr macht doch alles das, was die anderen nicht tun.“
„Vielleicht will einer die Hände illegal verkaufen? Wer weiß schon auf welche Ideen diese Leute kommen?“
Die Augen des Professors begannen vor Aufregung fiebrig zu glänzen. Tini drehte sich zu ihrem Computer. „Cassandra, gingen in den letzten Tagen irgendwo auf dieser schönen Erde mehrere Hände flöten?“
Eine Frage, die sie sich eigentlich hätte schenken können.
„Wenn jemand mehrere Hände benötigt, behält er sie. In diesem Fall aber wurden die Gliedmaßen zurückgebracht, schon vergessen?“, krächzte Cassandra.
Sie klang wie ein altes Grammophon beim Abspielen einer Schelllackplatte. Das tat sie immer, wenn sie Tinis Fragen unsinnig fand.
„Oh, da hat mal wieder jemand mitgedacht“, konterte die Detektivin gekränkt.
Im Gegensatz zu ihrem Rechner war sie ein Mensch und selbst die Schlauesten erzählten manchmal unsinniges Zeug. Die Detektivin mochte es durchaus, sich mit ihrem Rechner zu kabbeln. Umgekehrt war es genau so. Die Vorliebe der Maschine zur Streiterei war - wenig überraschend - mit der Biomasse ihres Vaters gekommen.
„Es gab keinen Massenunfall. Nur der schwerreiche Albert von Beeren hatte letzte Woche einen Unfall mit seinem Learjet“, leierte der Computer.
„Für einen Tycoon sind sämtliche Organe und Gliedmaßen in vielfacher Ausführung vorhanden“, winkte der Professor ab. “Und falls es für Albert von Beeren tatsächlich einen Engpass bei seinen Organen geben sollte, dann kauft er sie eben über uns bei den Armen.“
Es war für Menschen ohne große berufliche Qualifikation durchaus attraktiv, ihre Organe zu verkaufen. Allerdings blieb das Ganze sehr begrenzt, denn jeder Mensch benötigt nun mal eine gewisse Mindestanzahl, um selbst existieren zu können.
Der eigentliche Grund hinter dem Verkauf von Organen lag bei den Robotern. Sie übernahmen inzwischen einen Großteil der einfachen Arbeiten. Dadurch war die Zahl der Armen in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen.
Während die Detektivin nachdachte, hatte der Professor ganz offenkundig sein Interesse an Cassandra entdeckt. Wieder war er von seinem Sitz gesprungen. Dieses Mal behielt er die Decke fest in der Hand. Asbury beschäftigte sich intensiv mit dem Computer. Er drückte auf verschiedene Leuchtfelder. Als erstes wählte er ein grünes Feld, was die Maschine zum Kichern brachte. Danach entschied er sich für ein blaues. Cassandra schnarchte unerwartet laut auf.
„Lass das lieber!“, warnte sie ihn eindringlich.
Doch es war zu spät. Er hatte bereits auf ein rosa Leuchtfeld gedrückt. Der braune Inhalt einer Colaflasche traf ihn mitten ins Gesicht. Entrüstet sah er sie an.
„Tut mir leid. Wenn man weiß, dass man nur den Mund aufzumachen braucht, ist es lustig, so an seine Cola zu kommen“, verteidigte sie sich, erntete jedoch reines Unverständnis.
„Hat Albert von Beeren überhaupt eine Hand bei dem Unfall verloren?“, fragte sie ablenkend.
Der Professor hörte nicht zu. Aufgelöst stürzte er aus dem Raum und verschwand im Bad. Als er zurückkam, sah er völlig verändert aus. Cleabo, der für die Reinigung der Wohnung und für Tinis Aussehen, Sauberkeit und Fitness zuständig war, – also für ihre Selbstständigkeit - hatte ganze Arbeit geleistet. Die Professorenhaare lagen zwar glatt und ordentlich, allerdings in fluoreszierendem Lila. Ihre absolute Lieblingsfarbe. Zudem glänzte sein Gesicht grün durch die fette Nachtcreme, die sie für ihre trockene Haut benutzte. Es glich stark einer Maske aus dem venezianischen Karneval.
„Hat Albert von Beeren überhaupt eine Hand bei dem Unfall verloren?“, wiederholte sie störrisch.
Doch auch diese Frage kam beim Professor nicht an. Völlig in sich gekehrt sagte er: “Ich habe keine Ahnung, was hier vorgeht. Das einzige was ich weiß, ist, dass mir eine linke Hand fehlt.“ Im Gesicht des Professors zeichnete sich ein großer Schmerz ab.
Die Detektivin dachte nach: Es gab keinen vernünftigen Grund, Hände aus einem öffentlichen Krankenhaus zu stehlen. Man bekam das Ersatzteil problemlos, in dem man es aus eigenen induzierten pluripotenten Stammzellen, kurz ips-Stammzellen genannt, erst züchten und dann lagern ließ.
„Cassandra braucht Zugang zu deinem Rechner.“ Der Professor schluckte laut hörbar. Dass dieser Gedanke bei ihm Unwohlsein auslöste, war ihr klar. „Ich löse meine Fälle schneller, als andere“, fügte sie unmissverständlich hinzu.
Um tatsächlich schnell die Lösung finden zu können, musste sie ihre vier Mitarbeiter mit einspannen. Drei davon konnte der Professor nicht ausstehen. Der erste war ihr absoluter Liebling. Es war der außergewöhnlich hübsche Daniel Miles. Asbury hielt ihn für einen Playboy. Als Beweis führte er gern Videos an, die im Internet kursierten. Dort war in schärfster Bildqualität zu bewundern, wie Daniel in anstößigen Szenen mit beiderlei Geschlecht unterwegs war. Trotz seiner negativen Meinung benutzte der Professor ihn durchaus selbst, wenn er es für notwendig hielt. Manchmal flohen Patienten aus seinem Krankenhaus, ohne ihre gerade eingesetzten Organe oder Gliedmaßen zu bezahlen. Der Schönling durfte dann die entflohenen Patienten wieder einfangen.
Nervös stellte sie eine Verbindung über das Bildtelefon zu Daniel her. Automatisch kribbelte es in ihr, denn er spielte eine ganz besondere Rolle in ihrem Leben. Er war ihre große Liebe. Eine, die genauso unerfüllt, wie erfüllt war. In der körperlichen Welt war er für sie unerreichbar, in der geistigen dagegen fühlte sie sich eins mit ihm. Sie waren Seelenverwandte; zwei Wesen die sich gegenseitig intensiv spüren konnten. Ihre Gedanken verbanden sich immer wieder energetisch miteinander. Es spielte keine Rolle, wie weit ihre materiellen Körper voneinander entfernt waren. Ob sich Daniel gerade in Asien, Afrika oder Europa aufhielt, war bedeutungslos. Sie fanden sich überall. Wenn sich die geistige Verbindung aufbaute, durchdrang er sie von der Haarspitze bis zur Sohle. Das machte sie zutiefst glücklich. Es bedeutete nicht nur die Erlösung von den täglichen Schmerzen, sondern auch die Erlösung von der Einsamkeit. Es gab kaum schönere Momente in ihrem Leben.
Stand er dagegen persönlich vor ihr, blieb er meistens auf Abstand. Nur wenn er sicher war, dass sie nicht beobachtet wurden, starrte er sie minutenlang an. Dabei zog er sie tief in sich hinein.
Dass es diese geistige Verschmelzung überhaupt gab, wunderte sie immer wieder. Eigentlich konnte sie vieles an ihm nicht ausstehen. Daniel war ein notorischer Spieler und ein machtbesessener Mensch. Wenn sie mit ihm verabredet war, wusste sie nie, ob er erschien und wenn ja wann. Seine Ausreden waren unglaublich. Er besaß eine überbordende Fantasie. Zum Beispiel behauptete er einmal, eine herumstreunende Katze wäre in sein Cabrio gesprungen, hätte ihn von der Straße abgedrängt und einen Auffahrunfall verursacht. Auf die Frage, wie das möglich sei - sämtliche Autos waren inzwischen mit Sensoren ausgestattet, die Unfälle automatisch verhinderten - antwortete er, dass sie vom Dach eines stehenden Autos direkt auf ihn gesprungen wäre. Die kurze Flugzeit der Katze hätte die Sensoren völlig überfordert und zu deren unvermeidlichem Ausfall geführt.
Tini gab Daniel den Auftrag, sämtliche Informationen über Albert von Beeren zu sammeln. Zusätzlich benötigte sie eine Liste der Kliniken, die Transplantationen von Gliedmaßen durchführten. Als Belohnung versprach sie ihm einen erlesenen Cognac. Es gab wohl niemanden in New York, der eine exzellentere Bar sein eigen nennen konnte als Tini Tucker. Das freute Daniel sichtlich.
Bevor die Detektivin den nächsten anrief, gab sie Cassandra den Auftrag, sich mit dem Rechner Sherlock Holmes in Verbindung zu setzen. Tini brauchte eine Liste der Verbrechen, in denen Transplantate eine Rolle gespielt hatten.
Den nächsten Unbeliebten benötigte sie, um einen Überblick über die Ärzte zu bekommen, die unrühmlich aus der Ärztekammer entfernt worden waren. Transplantationen konnten schließlich selbst heute nur mit Hilfe eines Fachmanns durchgeführt werden. Gemeint war ihr guter Freund Kommissar Henry Berthod, der bereits in einem anderen, sehr ungeliebten Fall für sie arbeitete.
Professor Asbury Park rutschte ein gequälter Ausruf heraus: „Oh, dieser Lahme!“
Es stimmte, Berthod war tatsächlich lahm. Doch Tini störte das nicht. Im Gegenteil, es entspannte sie. Dachte sie an ihn, kam ihr die unberührte Natur in den Sinn. Bilder von Kanus, die sich durch einen Wildwasserfluss kämpften. Boote, die auf den Wellen tanzten. An der stärksten Stromschnelle flogen sie über das Wasser. Und Berthod? Der sitzt am Ufer, das Gesicht zur Sonne gedreht. Er döst. Nichts stört ihn. Kein tosendes Wasser, keine jauchzenden Kanuten, keine kreischende Kinder. Das einzige, was ihn bewegt, ist sein leerer Bauch. Worauf das Bild eines typischen französischen Restaurants vor ihrem geistigen Auge auftaucht. Das Haus hat Löcher im Putz und eine hinter Büschen versteckte Terrasse. Natürlich gehört der freundlich lächelnde Kellner dazu, der gerade den Tisch mit Käse, Brot und Rotwein deckt.
Die ausgeprägte südfranzösische Entspanntheit des Kommissars war kein Nachteil. Sie führte eher zu einem nicht zu unterschätzenden Vorteil. Es gab keinen Polizisten, der besser informiert war als er. Wenn Tini es nicht ganz genau wüsste, hätte sie nie geglaubt, dass er mächtige intelligente Netzwerke bauen konnte. Seine Tarnung war einfach genial. Die Detektivin hatte sich schon oft gefragt, was sie an ihm mochte. Wahrscheinlich war es die Gemeinsamkeit, trotz hoher Intelligenz, am Rande der Gesellschaft zu leben.
„Würde es eigentlich auffallen, wenn eine, zum Beispiel bei einem Einbruch, verloren gegangene Hand transplantiert werden soll?“ Tini sah auf die dicken Speckrollen des fülligen Polizisten.
„Hm, nur wenn dich einer anzeigt.“ Pause. „Kriminelle kaufen nur Hände, bei denen keine Fragen gestellt werden. Die bekommen sie am einfachsten in der Pathologie von den Hinterbliebenen. Der beste Zeitpunkt ist direkt vor der Verlegung des Toten ins Krematorium.“ Er machte eine Pause, als müsste er über seine eigenen Worte nachdenken. „Die Brut verkauft dir alles.“
Tini überhörte bewusst seine abschätzige Bemerkung. Es lohnte sich im Moment nicht, sich mit ihm anzulegen. So wie es aussah, bekam man relativ problemlos ein Transplantat.
Als letztes rief sie ihre Nachbarin Lisa Schlück an, um sie auf die Jagd nach den neusten Gerüchten zu schicken. Sie war Altersrentnerin und das locker seit sechzig Jahren. Zudem war sie reich und keineswegs Demenz. Ihre Lieblingsbeschäftigung war das Gehirnjogging. Wenn Tini unterbeschäftigt war, spielten sie manchmal gegeneinander. Dabei musste sie höllisch aufpassen. Lisa war durchaus skrupellos, wenn es ums Gewinnen ging. Bevor sie sich versah, hatte ihre Nachbarin sie erst abgelenkt und dann überrumpelt.
Lisa war nicht nur im Kopf aktiv, sondern auch sonst in jeder erdenklichen Weise. Sie ging regelmäßig ins Fitnessstudio, wanderte viel und unternahm ausgedehnte Radtouren.
Wenn das Wetter schlechter wurde, nutzte sie die Zeit und tauschte Teile ihres Körpers aus. Ihre Nachbarin wollte auf gar keinen Fall alt wirken. Sie ließ sich neue Haare implantieren, die Brüste vergrößern und die Beine verlängern. Das Letzte tat sie nur, da sie – genauso wie alle anderen Menschen auf diesem Planeten - mit zunehmendem Alter schrumpfte. Wenn sie nicht unterm Messer lag, vertrieb sie sich ihre Zeit mit der Jagd nach Neuigkeiten. So war sie immer ausgezeichnet über Wissenswertes und weniger Wissenswertes informiert.
Die Detektivin fand ihre Nachbarin noch aus einem anderen Grund interessant. Sie hatte erfolgreich drei Männer begraben. Wobei Tini vermutete, dass der dritte Gatte das Zeitliche durch ihr kräftiges Zutun gesegnet hatte. Seine relativ große materielle Hinterlassenschaft ermöglichte ihr, ins Bo-Building einzuziehen. Das Haus gehörte schließlich zu den teuersten Hochhäusern in New York City.
Tini lernte Lisa am Anfang ihrer Karriere als Detektivin kennen. Damals überprüfte sie ihre heutige Nachbarin im Auftrag einer Versicherungsgesellschaft. Kurz nach dem Verschwinden ihres dritten Gatten, kam der Verdacht auf, dass er beseitigt worden sein könnte. Zuerst vermutete die Polizei, dass er seine Ehefrau heimlich verlassen wollte. Doch er war ein bodenständiger Typ. Diese Gruppe von Menschen, verlässt statistisch gesehen, äußerst selten freiwillig ihre Umgebung. Anders gesagt, er war einfach zu langweilig, um abzuhauen. Da der Gatte scheinbar allein in seinem Segelboot auf hoher See verlorengegangen war, ließ sich keine direkte Verbindung zu Lisa herstellen. Außerdem hatte die für ein lückenloses Alibi gesorgt. Sie war zum Zeitpunkt seines Verschwindens von den Kameras eines Shoppingcenters erfasst worden. Ein sicheres Zeichen für die Detektivin, dass sie gesehen werden wollte, offiziell und nachweisbar.
Lisas Mann änderte nie seine Routine. Nach der Arbeit fuhr er immer sofort nach Hause. Nur an diesem Nachmittag nicht. Er fuhr direkt zum Hafen, obwohl starker Wind vorhergesagt worden war. Natürlich wusste ihre Nachbarin, dass er sich, kaum auf dem Boot angekommen, einen Kaffee kochen würde. Zwei Stück Würfelzucker gehörten dazu, da gab es keine Ausnahme. Nun ist es nicht schwierig, Würfelzucker Stunden vorher mit LSD zu präparieren. Die Droge hat den Vorteil, dass sie bereits in sehr niedrigen Dosierungen wirkt.
Wahrscheinlich geriet der Ehegatte in einen manisch, hyperaktiven Zustand. LSD löst oft ein Gefühl der Unverletzlichkeit aus. Dazu kommen Halluzinationen, bei denen reale Gegenstände scheinbar in Bewegung geraten.
Die Polizei konnte nicht feststellen, warum er allein aufs Meer hinausgefahren war, sondern nur, dass er es getan hatte. Dort musste das Boot durch zu starken Wind in die Schieflage geraten sein. Höchstwahrscheinlich hatte er den Kurs des Bootes zu scharf geändert. Im polizeilichen Abschlussbericht wurde lapidar festgestellt, dass er von Bord gespült wurde. Sie fanden keine Leiche. Für die ermittelnden Beamten war es ein Unfall. Für Tini nicht. Sie blieb bei ihrer Meinung, konnte aber nichts beweisen.
Der Mord blieb unaufgeklärt. Einer der wenigen Fälle, der ihre Erfolgsquote nach unten drückte. Was sie allerdings wenig kratzte, denn für sie persönlich war der Fall gelöst. Sie war von ihrer Version des Geschehenen fest überzeugt.
Dass Lisa nicht gefasst worden war, entlockte ihr sogar eine gewisse Anerkennung. Einen Mord in dieser modernen Welt zu verüben, war ungleich schwerer geworden. Einerseits durch die technischen Fortschritte bei der Spurensuche und andererseits durch die vielen Kameras. Nur das Innere der Wohnung war noch überwachungsfrei. Noch.
Tini mochte ihre Nachbarin. Sie war eine Köchin alten Stils. Sozusagen eine übrig gebliebene. Sie war in der Lage, schmackhaftes Essen per Hand zuzubereiten. Der Kochautomat stand bei ihr ungenutzt in der Ecke. Die leckersten Speisen kamen bei ihr auf den Tisch. Lisa liebte es große Mengen zu kochen, die sie anschließend im ganzen Haus verteilte. Für sie gab es keinen besseren Weg, so ganz gezielt seine Mitmenschen kennenzulernen.
„Lisa ist eine Schwatztante per se, das stimmt, aber sie weiß genau was in dieser Stadt läuft. Legal wie illegal“, kommentierte Tini, nachdem sie aufgelegt hatte.
„Oh, es gibt wohl keinen einzigen Menschen mit dem sie nicht ins Gespräch kommt", stöhnte der Professor laut. „Besucht sie nicht jeden Abend die Arrowhead- Bar?“
Die Arrowhead-Bar des Bo-Buildings war legendär. Jeder halbwegs wichtige Hampelmann – Hampelmann war Tinis Lieblingsbezeichnung für Aufschneider – ließ sich hier blicken. Natürlich kamen auch tatsächlich wichtige Leute, denn statistisch gesehen lag das geschäftliche Verhandlungsvolumen bei jedem zweiten Umtrunk im Millionenbereich.
„Ein enorm wichtiger Ort“, verteidigte Tini ihre Nachbarin.
„Sie will nur sehen, ob sich ein reicher, klappriger Mann mit Alzheimer in die Bar verirrt hat. Wenn sie ihn erst einmal in ihre Wohnung gelockt hat, kann sie ihn in aller Ruhe erledigen“, konterte Asbury bösartig.
„Lass ihr doch den Spaß!“
„Dir ist hoffentlich klar, dass sie nur so genau weiß, was im Haus vor sich geht, weil sie stundenlang Fahrstuhl fährt“, maulte er.
„Ja, ja, und sie kennt sämtliche Angestellte im Haus mit Vornamen. Was willst du eigentlich, As?“
Tini benutzte die Abkürzung As meistens, wenn sie genervt war. Ein Zeitpunkt, an dem er sie besser verließ.
Mary Clark Johnson saß im Dunkeln und das seit Stunden. Sie starrte vor sich hin; fühlte sich paralysiert. Das war aber nur rein äußerlich, denn ihr Inneres arbeitete auf Hochtouren. Dieses mörderische Onlinespiel raubte ihr den letzten Nerv. Am liebsten würde sie einfach aussteigen. Leider war das unmöglich. Es gehörte nun einmal zu ihrer Pflicht, dabei zu sein.
Das ultimative Spiel war von Anfang an in der Öffentlichkeit äußerst umstritten gewesen. Politiker aller Parteien hatten sich monatelang über die Frage gefetzt, ob man es überhaupt zulassen darf. Anleitung zum Mord titelten die Boulevardblätter. Andere sprachen von der Anleitung zur Verrohung der Jugend. Während die eine Seite Stimmung machte, zog die andere Seite statistische Untersuchungen heran, um ihre Argumente zu unterstreichen. Das Ergebnis; seit über hundert Jahren gab es virtuelle Gewaltspiele, laut Statistik folgten daraus kaum Morde.
Letztendlich beinhaltete die Zulassung des ultimativen Spiels einen Kompromiss. Politiker und Polizei wurden verpflichtet mitzuspielen. Dadurch behielten sie die aktuellen Entwicklungen im Auge und konnten so die vom Spiel ausgehende Gefahr zu jedem Zeitpunkt beurteilen. Die Beamten überwachten hauptsächlich die Jäger. Ihre Hauptaufgabe war es, Menschen mit psychopathischen Neigungen zu erkennen und zu entfernen, bevor sie in der realen Welt Schaden anrichteten. Bisher war es ihnen gelungen, was allerdings nicht an ihrer Genialität, sondern am Unvermögen der Täter lag. Nun jedoch war alles anders. Noch nie zuvor wurde eine so hohe virtuelle Persönlichkeit wie der Bürgermeister ermordet. Geschweige denn die reale dazu. Und jetzt war sie, die Polizeichefin von New York, diesen Verrückten ins Visier gelaufen. Das war ja nicht auszuhalten.
Sie sprang auf. Unruhig lief sie hin und her. Sie musste handeln. Was sollte sie tun? Sie stoppte. Natürlich. Wie lautete ein alter Spruch? Angriff ist die beste Verteidigung. Dazu brauchte sie Verbündete. An der Wand veränderte die Tapete ihre Farbe. Ein Bildschirm wurde sichtbar. Die Onlineverbindung stand sofort. Langsam wurden die Konturen des Mannes schärfer. Sie hatte sein Bild in letzter Zeit häufig angestarrt. Jetzt saß er ihr im Original gegenüber.
Die durchtrainierten Männer liefen den Strand entlang. Tini konnte das Spiel der straffen Muskeln sehen. Die rhythmischen Bewegungen der Läufer waren so gleichmäßig, so ästhetisch, dass es ihr die Tränen in die Augen trieb. Hinter der Gruppe stieg die Sonne aus dem Meer. Mit jeder Minute, die verging, veränderte sich ihre blutrote Farbe in einen weicheren Goldton. Das sorgte dafür, dass die Gesichter klarer wurden. Daniel. Er lief in der ersten Reihe rechts außen. Sie konnte ihm tief in die Augen blicken, konnte sein Innerstes berühren. In diesem Moment war sie kein Krüppel, kein von der Glasknochenkrankheit verunstaltetes Wesen, kein von Stromschlägen im Mund gebeutelter Mensch, kein bewegungsunfähiges Etwas in einem Rollstuhl.
Tini genoss es, sich fallen zu lassen. Ihr Glück wuchs, als ihr Daniel etwas zurief. Sie konnte es nicht verstehen. Es war undeutlich. Es war schrill. Warum war es schrill? Es war ein altmodisches Geräusch, dessen Klang ihr unbarmherzig und dauerhaft ins Gehirn schallte. Sie schlug die Augen auf.
„Ich hasse Bildtelefone! Besonders welche mit altmodischen Klingeltönen“, schimpfte sie. Dabei hatte sie Monate gebraucht, um genau diesen unverwechselbaren Ton zu finden.
„Schläfst du noch?“, brüllte der Professor. „Es ist schon elf.“
„Nur Langweiler müssen arbeiten, Künstler dürfen schlafen“, brummte sie. Tini war wirklich sauer, dass er sie aus ihrem schönen Traum gerissen hatte.
„Stell dir vor, eine meiner Mitarbeiterinnen ist heute nicht zum Dienst erschienen. Ihr automatischer Abholservice kam ohne sie zum Krankenhaus. Ihr Name ist Bowers, Janina Bowers. Eigentlich eine zuverlässige junge Frau.“
Tini lächelte hintergründig und schüttelte gleichzeitig ihren lockigen Kopf.
„Meinst du, sie hat was mit den verschwundenen Händen zu tun?“ Der Professor klang völlig überrascht, als ob er sich im Leben nicht vorstellen konnte, das Janina Bowers eine Diebin war. „Glaubst du, sie wollte die Hände verkaufen?“
„Asbury, ich habe dir schon gesagt, dass sie dann die Hände kaum zurückgebracht hätte.“
„Vielleicht wurde sie die Hände nicht los!?“
„Ja, vielleicht?“, maulte die Detektivin. „Hat dir schon mal jemand gesagt, dass die Chance unentdeckt zu bleiben, wesentlich größer ist, wenn einer etwas, was er nicht braucht, zurückbringt.“ Tini rieb sich die müden Augen. Sie verspürte keinerlei Lust auf Spekulationen. Kurzerhand stellte die Detektivin die Leitung auf hold. Das Bild des Professors fror ein.
„Die Diebin hat die Hände zurückgebracht, weil es einen Fehler gab“, schaltete sich Cassandra ein.
Die Detektivin verzog das Gesicht, als ob sie in eine saure Zitrone gebissen hätte.
„Was für einen Fehler? Meinst du, sie hat die falschen gestohlen? Unsinn. Die Dame kann doch bestimmt lesen. Aber…“ Einen Moment lang wollte sie weiterreden, stattdessen hielt sie inne und horchte.
Daniel hatte eine spezielle Art, die Türglocke zu läuten. Er entlockte dem Teil einen unverkennbaren Sound, der sie an die Kindheit im Rocky-Mountain-Nationalpark erinnerte. Es waren die Geräusche des Waldes. Eine Mischung aus dem Summen der Bienen, dem Klopfen des Spechts und dem nächtlichen Ruf des Käuzchens.
Unruhe stieg in ihr auf. Gab es eigentlich einen vernünftigen Grund, warum sie überhaupt diese merkwürdige Beziehung zu ihm hatte? Nein, sie musste die Frage anders stellen. Warum hatte Daniel diese merkwürdige Beziehung zu ihr? Junge, gesunde, außergewöhnlich hübsche Männer fühlen sich normalerweise nicht verkrüppelten Frauen nah. Vielleicht lag es daran, dass ungefähr fünfzig Prozent ihres Charakters mit seinem übereinstimmte. Sie waren genau gleich. Würde man es in einer Sinuskurve darstellen, könnte man keine Abweichung feststellen. Bei den anderen fünfzig Prozent sah das anders aus. Ihre Charaktere liefen komplett gegeneinander. Die Kurven waren 180° phasengedreht. Sie löschten sich sozusagen gegenseitig aus.
Inzwischen hatte ihr Hausroboter Cleabo die Tür geöffnet. Daniel stürmte auf sie zu und drückte sie fest an sich. Wie immer genoss sie es.
„Meine Fresse, siehst du wieder gut aus! Na ja, ein bisschen zermatscht vielleicht“, scherzte er strahlend.
„Was hast du herausgefunden?“, versuchte sie sein Geplänkel zu verdrängen.
Er setzte sich zu ihr und erklärte, dass in diesen Tagen keine einzige Transplantation von Händen in der Stadt geplant war. Zwar hatte Albert van Beeren tatsächlich letzte Woche zwei neue Arme, mit Händen, und einen neuen Fuß bekommen, aber die Züchtungen kamen aus seinen eigenen umprogrammierten Stammzellen. Sie hatten die Gliedmaßen auf dem Rücken von Schweinen wachsen lassen. Daniel verzog, um seine Aussage zu unterstützen, angeekelt das Gesicht.
„Zum Glück waren es keine Nachkommen von abgehauenen Schlachtschweinen. Diese Viecher werden riesig. Seine neuen Arme hätten sonst die doppelte Länge im Vergleich zu den alten." Daniel kickste wie ein kleines Schulmädchen, das seinen ersten Witz erzählt.
Die Detektivin schickte Albert von Beeren ins Reich des Vergessens und dachte über etwas anderes nach. „Wie lange dauert es eigentlich, eine Operation für eine fremde Hand vorzubereiten?“
„Keine Ahnung. Frag mal das Professörchen!“
„Nenn ihn bloß nicht so, wenn er dabei ist“, warnte Tini und aktivierte die Bildleitung erneut.
Asbury saß glücklicherweise nach wie vor an seinem Schreibtisch. Ausgiebig erklärte er die Operationsvorbereitung, die für eine erfolgreiche Transplantation notwendig war. Zuerst benötigte man die Stammzellen aus dem Knochenmark des Patienten und die fremde Hand. Danach wurden die Stammzellen in die Blutzellen gepackt und in das Immunmuster der Hand eingeschleust. Das wunderbarste für ihn war, dass es dabei keinerlei Abstoßungsreaktion des Transplantats gab. Früher musste der Patient schließlich sein restliches Leben lang Immunsuppressiva mit unkalkulierbaren Nebenwirkungen einnehmen. Als er sich ausgiebig darüber freute, dass die Kliniken Transplantate so lange lagern konnten, wie sie wollten, riss Tini der Geduldsfaden.
„Schweif nicht ab, Asbury!“, rief sie ihn zur Ordnung.
Der Professor erklärte, dass die Transplantation nach dem Einschleusen jederzeit stattfinden konnte. Direkt nach der Operation übergab man dann den Patienten einer Leitstelle, die ihn bis zur Ausheilung mobil überwachte.
„Das heißt, der Arzt benutzt den Operationssaal für eine sehr kurze Zeit. Wie viele Leute braucht er?“, hakte die Detektivin nach.
Der Professor rieb sich seinen Bart. „Das Transplantationsteam besteht aus sieben Leuten. Das können natürlich auch Roboter sein“
Gedankenverloren beendete sie die Bildleitung und wendete sich an Daniel. „Gibt es in New York überhaupt einen passende Chirurgen, einen Patienten und eine Klinik? Und wenn nicht, warum wurden dann die Hände gestohlen? Nein, anders. Warum wurden die falschen Hände gestohlen?“
„Keine Ahnung. Ich habe keine Zeit mehr darüber nachzudenken. Ich muss weiter fliegen. Adieu, geliebtes Haus.“
Daniel breitete die Arme aus und segelte, ohne sich noch einmal umzudrehen, davon.
Am Abend schnarrte Cassandra unaufhörlich. „Informationen, Informationen, Informationen.“
Fast hätte man glauben können, Tini wäre nicht nur verkrüppelt, sondern auch noch schwerhörig. Sie hatte tatsächlich viele Probleme, die Ohren gehörten nicht dazu. Sie arbeiteten ausgezeichnet.
„Ich bin so voll mit Informationen. Ich platze gleich!“, ächzte die Maschine.
Das war ein typischer Bernie Tucker Scherz. Der Rechner hatte mehr als genug freien Speicherplatz.
„Ich rufe alles ab, wenn ich zurück bin“, sagte die Detektivin abweisend. Sie verließ das Arbeitszimmer, fuhr ins Bad und ließ sich von Cleabo ausgehfertig machen. „Rot“, rief sie.
Rot nahm sie eigentlich nur zu besonderen Anlässen. Das war zwar heute nicht der Fall, trotzdem wollte sie auffallen. Es war durchaus wichtig, sich bei gut betuchten Menschen ins Gespräch zu bringen.
Cleabo verpasste ihren Haaren einen weinroten Ton, der von silbernen Strähnchen unterbrochen wurde. Hemd und Anzug – sie trug stets einen Anzug, denn sonst hätte man zu viel von den verkrüppelten Beinen gesehen – waren dunkelblau.
„Einen wunderschönen guten Abend, Miss Tucker.“ Tipsi verbeugte sich so tief, dass sie seinen Poansatz sehen konnte.
Seine mit Goldschnüren verzierte Jacke rutschte nach oben, seine Hose nach unten.
Das erzeugte jedes Mal ein Lächeln bei ihr. Natürlich wusste sie nur zu genau, dass seine weiblichen Fahrgäste mehr als bereit waren, für diesen Anblick das Trinkgeld des Liftboys anzuheben. Es stieg überproportional mit der Länge des Ansatzes.
„Auf zur Arrowhead-Bar!“, rief Tipsi, der eigentlich Tipsarevic hieß. Niemand machte sich mehr die Mühe, lange oder komplizierte Namen auszusprechen.
„Wollen Sie den wunderschönen Sonnenuntergang genießen, Miss Tucker? Heute wird er geradezu fantastisch sein.“
„Was interessiert mich der Sonnenuntergang? Das ist etwas für Verliebte. In dieser Bar muss man etwas für sein Image tun, dass wissen Sie doch wohl am Allerbesten.“
Tini grinste und Tipsi grinste zurück.
Die Arrowhead-Bar lag im 99. Stock des Bo-Buildings. Sie lebte seit fünfzehn Jahren in diesem Haus und seit dieser Zeit war die Bar der Inbegriff des New Yorker Nachtlebens. Wollte man die neuesten Gerüchte hören, die heißesten Stars aus Show oder Politik sehen, oder einfach milliardenschwere Leute treffen, hier war der Ort.
Tipsi riss die altmodische Fahrstuhltür, die man eingesetzt hatte, um die Extravaganz der Bar zu unterstreichen, krachend auf. Langsam rollte sie auf die Bar zu.
Plötzlich stoppten die Räder. Im ersten Moment glaubte sie es wäre ein technischer Defekt. Doch jemand, der sich hinter ihr befand, hielt den Rollstuhl fest. Der Mann trat vor. Man konnte ihn getrost als Muskelpaket beschreiben. Ohne ein Wort zu verlieren, zeigte er auf einen Tisch am Fenster. Es dauerte einen Augenblick, bis es ihr dämmerte.
Ronan Sommers winkte sie heran. Das hieß nichts Gutes. Bestimmt kam er mit dem dämlichen Bürgermeistermord, mit dem sie aber auch gar nichts zu tun haben wollte. Natürlich hörte sie ihm brav zu, schließlich war er ein sehr mächtiger Mann und sie freiberuflich tätig.
In jedem zweiten Satz versicherte er, dass seine Tochter Maya keine Mörderin sei. Weder im virtuellen Spiel noch in der Realität. Sie sei schüchtern und zurückhaltend, und das sei es an Besonderheiten. Natürlich hatte er einen Auftrag für sie. Tini sollte beweisen, dass seine Tochter nicht die Mörderin des Bürgermeisters Zeleny war und ihre Erkenntnisse der Polizeichefin von New York Mary Clark Johnson mitteilen, um auch sie davon zu überzeugen.
Tini lehnte ab und erklärte, dass sie bereits für einen Kunden an dem Fall arbeiten würde. Außerdem sei sie sich keineswegs sicher, ob das Ergebnis der Aufklärung im Sinne der Familie Sommers wäre.
Sie verließ den Sonnengott und rollte auf die Bar zu. Dabei stieg ein Verdacht in ihr auf. War es möglich, dass Johnson den Solarzellentycoon bedroht hatte? Das würde ihr durchaus ähnlich sehen. Eine gefährliche Entwicklung, wenn man sie fragte. Dass die Polizeichefin vor nichts zurückschreckte, durfte sie während ihrer Ausbildungszeit ausgiebig erleben. Es waren zwei harte Jahre. Johnson erkannte ihr analytisches Talent sofort und brachte sie bei jedem kleinen Fehler in Misskredit. Um ihre eigene Position nicht zu gefährden, sammelte die Polizeichefin lieber unfähige Leute für ihr Team. Der Rest flog raus.
Tini wollte bereits als kleines Mädchen Polizistin werden. Während ihrer Kindheit dachte sie an nichts anderes. Ein Wunsch, den ihre Eltern komplett ablehnten. Für sie - wie wohl für die meisten Menschen - gehören körperlich Behinderte nicht an einen Ort, der tatkräftigen Einsatz abverlangt. Aber Tini war egal, was ihre Eltern dachten. Sie wollte analytisch im Hintergrund arbeiten und bewarb sich. Nicht einmal. sondern immer wieder.
Die Mühlen des öffentlichen Dienstes mahlten langsam, aber sie mahlten. Nach fünf Jahren hartnäckiger Bewerbung hörte man sie endlich an. Nicht, weil man ein Einsehen hatte, sondern weil die Politik eine Quote für Behinderte durchdrückte.
Vier Jahre später konnte sie ihren Abschluss am College als Ermittlerin vorweisen. Sogar mit Bestnote. Dieser Abschluss berechtigte sie, im Bereich der Strafverfolgung zu arbeiten. Dafür belegte sie Kurse für Strafvollzug, in der Kriminalistik, im Strafrecht, in Methodik für Recherche, im Bereich Verbrechensstatistik und für Kriminologie. Die Absolventen des Colleges arbeiteten zwei Jahre lang als Streifenpolizist. Für sie galt das natürlich nicht, sonst hätte sie im Rollstuhl auf Streife gehen müssen. Sie wurde direkt Mary Clark Johnson zugeteilt, die sie weiter ausbildete.
Leider hatte die Polizeichefin dafür gesorgt, dass Tini direkt nach der Ausbildung rausgeworfen wurde. So blieb ihr nichts weiter übrig, als Privatdetektivin zu werden. Durch ihren Wohnort blieb sie allerdings in den Fängen ihrer alten Ausbilderin. Und die Beamtin nutzte ihre Macht aus. Wann immer Mary Clark Johnson Hilfe brauchte, kam sie zu ihr. Natürlich stellte sie die Ergebnisse der Detektivin als eigene Erfolge dar. Warum auch nicht? Es konnte ja nichts schief gehen. Schließlich bekam Tini Tucker ihre Lizenz von Mary Clark. Wenn jemand abhängig ist, wird er gnadenlos ausgenutzt. Daran hatte sich selbst in dieser modernen Zeit nichts geändert.
Tom, der Barkeeper, stand neben dem Barhocker. Kraftvoll hob er sie hoch und setzte sie drauf. Es bereitete ihm keinerlei Schwierigkeiten, da er ein muskulöser Mann war. Anschließend ging er hinter den Tresen.
Leider blieb sie manchmal bedingt durch ihre Krankheit nicht sitzen, sondern rutschte einfach seitlich weg. Selbst wenn sie sich an die Theke klammerte, brauchte sie ihre ganze Konzentration, um nicht auf dem Fußboden der Arrowhead-Bar zu landen.
„Das ist ja wunderbar, dass ich dich hier treffe“, trällerte Lisa Schlück mit ihrer unvergleichlich hohen, beinahe singenden, Stimme vom Aufzug herüber.
In diesem Moment geschah das, was nicht geschehen sollte. Die Detektivin verlor ihr Gleichgewicht und rutschte in die Arme eines älteren Herren, der scheinbar länger keinen weiblichen Kontakt gehabt hatte. Er behielt sie fest an sich gedrückt, selbst als er es längst nicht mehr musste. Tom war so nett, kam nach vorn und rettete sie, denn Tini hatte keine Chance, sich selbst aus den Fängen ihres Hockernachbarn zu befreien.
„Finchs Old Reserve, aber ein großes Glas“, hauchte die Detektivin, deren Stimme gerade vor Schreck versagte.
Lisa Schlück nutzte die Gelegenheit und zog den klammernden Hockernachbarn resolut von seinem Sitz. Erstaunlicherweise wehrte er sich nicht. Wahrscheinlich, weil er direkt mit seinem Gesicht an Lisas künstlich gestylten Ballonbusen landete. Für eine über hundertjährige Frau war er gut gefüllt. Gott, segne die Technik pflegte Lisa diesen Umstand zu kommentieren. Erst letzten Monat hatte sie rigoros die neuesten Entwicklungen der Brustvergrößerung in Anspruch genommen. Deshalb waren die beiden Ballons an ihrer Vorderfront prall gefüllt. Lisa setzte sich neben Tini.
„Ich dachte mir, dass du den Sonnenuntergang genießen willst.“ Pause. „Auch so einen für mich!“, schnaufte sie in Toms Richtung. „Wusstest du, dass die New York University ihren Operationssaal in den nächsten Tagen sperren wird?“
„Warum?“, fragte die Detektivin erstaunt. Der Operationssaal war vor zwei Monaten in Betrieb genommen worden. „Stürzt dieses architektonisch, geniale Superbauwerk etwa ein?“ Tini konnte ihre Verachtung nicht zurückhalten.
Ein Architekt, der extravagante Bauten liebte, hatte die internationale Ausschreibung gewonnen, zum Stolz der Stadt und zum Ärger der Bürger. Über achtzig Prozent der New Yorker hatten dem Bau das Attribut megahässlich verpasst.
„Quatsch, angeblich wollen sie eine neue Alarmanlage einbauen. Die alte wäre zu unsicher gewesen, heißt es.“ Lisa schnaufte wie ein Walross.
„Woher weißt du das wieder?“
„Wegen dieser blöden Schnödel wird meine Entrunzelung verschoben. Jetzt muss ich noch eine Woche länger mit dieser Mülltüte von Gesicht herumlaufen.“ Erneut kam ein ärgerliches Schnaufen.
Für Tinis Geschmack brauchte ihre Nachbarin keine Operation, denn nur wenige schmale Falten durchzogen das Gesicht. Außerdem hielt sie grundsätzlich nichts von Verschönerungen an über Hundertjährigen.
„Hallo, meine süßen Zuckertäubchen“, ertönte eine Stimme aus dem Hintergrund.
Es war Daniel. Er sah aus, als wäre er gerade einem Männermagazin entstiegen. Er trug einen Smoking. Was vermuten ließ, dass er direkt von einem Fotoshooting für Abendgarderobe kam. Vor Jahren rissen sich die Werbefotografen um ihn. Die Kamera liebte ihn seit seinen frühesten Kindertagen. Daniel war das ideale Männermodel. Er besaß die Idealmaße von 100, 85 zu 90. Wer ihm begegnete, nahm ihn automatisch wahr. Sein Haar war etwas länger, mittelblond und ordentlich nach hinten gekämmt. Die Nase machte einen angenehmen Schwung. Seine Gesichtskonturen waren symmetrisch. Fett war undenkbar. In seiner Kinderzeit, war seine Mutter auf der Straße von Toni Lang, einem seit Jahrzehnten angesagten Fotografen, angesprochen worden. Leider führte seine unzuverlässige Art dazu, dass seine Auftragslage eher instabil blieb. Er hatte durchaus das Potential, als verkrachte Existenz zu enden. Aber höchst wahrscheinlich kam es nicht dazu, denn er besaß genug Persönlichkeit, die seine Mängel ausglich.
Wie eine Ballerina drehte er sich im Kreis. „Gefalle ich euch?“
Tini zog unwillkürlich die Augenbrauen hoch. Sie konnte sich nicht daran erinnern, ihn jemals so schick gesehen zu haben. Selbst der Schwatztante Lisa hatte es die Sprache verschlagen.
„Einen Bushmills für den Herrn, Tom“, krächzte die Detektivin.
Der lächelte hintergründig und schenkte kommentarlos das Getränk ein.
„Übrigens komme ich gerade von einer Vernissage. Die Juwelen der Sarah Do. Sie sind im Christies zu bewundern.“
Davon hatte sie gehört, was kein Wunder war, denn sämtliche Nachrichtenkanäle berichteten darüber. Die Schauspielerin war eine der letzten menschlichen Ikonen in Hollywood. Sie war vor wenigen Tagen verstorben. Sarah Do hatte ihr Leben mit der Jagd nach Klunkern zugebracht. Wie erfolgreich, hatte niemand geahnt. In den Vorberichten zur Ausstellung waren die Journalisten vollkommen aus dem Häuschen geraten. Das Ausmaß des riesigen Nachlasses hatte alle total überrascht. Die wertvollen Schmuckstücke sollten in den nächsten Monaten versteigert werden. Doch zuerst wollten die Vermögensverwalter den Appetit der Reichen ankurbeln, in dem sie die Juwelen rund um den Globus in den Christies Filialen ausstellten. New York war allerdings erst als sechste Station an der Reihe. Die anderen Städte davor lagen in Asien. Und warum? Der Grund lag in der reinen Quantität reicher Bürger. Der Plan funktionierte. Die Reichen und Schönen kamen tatsächlich in Scharen. Seit Jahrzehnten waren Christies Auktionshäuser nicht so gut besucht wie im Moment.
„Da ich nun einmal schick angezogen bin“, sagte Daniel grinsend, „dachte ich mir, dass es auch für die Arrowhead-Bar reichen müsste."
Es reichte. Daniel wurde von der Damenwelt in der Bar geradezu angehimmelt und das nicht mal heimlich. Tini fühlte sich bis ins Mark getroffen. Sie konnte es nicht ertragen. Ein kurzer Blickaustausch mit Tom genügte. Er hob sie vom Hocker und setzte sie in den Rollstuhl. Zügig fuhr sie zum Aufzug und ließ Daniel und Lisa verwundert zurück.
Wenige Minuten später klingelte es an der Wohnungstür. Sogleich entspannte sie sich. Sie wusste, dass Daniel, neben ihrer eigenen Person, ihr Alkoholangebot schätzte. Bester Whisky, erlesener Cognac und edle Weine aus aller Welt. Wer konnte da schon nein sagen. Zwar war es nach wie vor ungewöhnlich, dass eine Frau einen erlesenen Getränkevorrat besaß, doch Tini Tucker war eben etwas ganz Besonderes. Aber selbst Daniel wusste, dass der Alkohol nicht unbedingt mit Genuss zu tun hatte, sondern etwas mit Betäubung. Natürlich kannte er die Schmerzattacken, die sie regelmäßig heimsuchten. Einmal hatte er sich unter Laborbedingungen einen Stromstoß in den Mund verpassen lassen. Einmal und nie wieder.
Nach der dritten Runde, rief Daniel leicht lallend: „Was für eine verrückte Welt ist das jetzt. Hundertjährige bekommen Ballonbusen verpasst, damit sie sich dem Kasten nicht so nah fühlen und im Christies gibt es den wertvollsten Schmuck der Welt ohne Bewachung. Klar, auf der Straße gibt es genug Kameras.“ Daniel jauchzte, als ob er den besten Witz der Welt gemacht hätte. „Und du, liebe Tini, bist am verrücktesten“, lallend sprang er auf und kam dicht an sie heran. „Du siehst affenstark aus.“
Seine wasserblauen Augen stoppten direkt vor ihrem Gesicht.
Der Alkohol wirkte auch bei der Detektivin. Sie lächelte geschmeichelt und genoss jede Sekunde, die er in ihrer Nähe war. Es blieben zu wenige, denn Cassandra schepperte wie eine alte Blechdose dazwischen: „Dürfte ich diese äußerst intelligente Konversation kurzzeitig unterbrechen?“
„Ist das unbedingt notwendig?“ Aus Tinis Stimme war eine gewisse Verärgerung herauszuhören.
„Bestimmt ist das unbedingt notwendig“, schleimte Daniel. „Unser Maschinchen hat in den letzten Stunden viel gearbeitet und will nicht länger warten. Komm Cassandra, spuck es aus!“
Die Maschine war froh, ihre Informationen loszuwerden. Leider versuchte sie alles auf einmal loszuwerden. Heraus kam ein totales Kauderwelsch. „Bnn-zrrrr-Kobbbb-waaaaa-tttttaaaa.“
„Stopp! Stopp! Stopp!“, rief die Detektivin. „Ganz ruhig. Erzähle es uns doch bitte im abhörsicheren Raum! Dort können wir in Ruhe reden.“
Natürlich hätte sie Daniel sagen können, dass der Scanner wieder funktionierte. Sie unterließ es. Im Gegensatz zum Professor hatte der Schönling kein Problem damit, sämtliche Hüllen fallen zu lassen und sich in voller Pracht zu zeigen.
Während Tini eine gewisse Erregung verspürte, schnarrte Cassandra emotionslos: „Die Zuordnung ist falsch.“
„Kannst duuu dich bitte geeeenauer ausdrücken?“, lallte Daniel. „Glaubbbbst du, einer willll seine rechte Hand verliiiieren? Und gleich danach üüberlegt er es sich andersss und entscheidet sich für seine liiiinke?“
"Und alles in einer äääähnlichen Grrrröße", gab Tini zu bedenken. Auch ihr war ihre normalerweise saubere Aussprache abhanden gekommen.
"Dann wiiirft er die linke über den Jordan und nimmt wie beim Schlussverkauf zwei reeeechte Hände." Daniel schüttelte sich vor Lachen. Er hatte eindeutig zu viel getrunken. Urplötzlich brach sein Lachen ab. „Na ja, vielleicht wollen die Diebe einen Hännehannel … eh… Händehannel ….eh einen Hännehändel aufmachen?“
Daniel prustete erneut los, denn er konnte das Wort Händehandel auch mit größter Mühe nicht über seine Lippen bringen. Sein Lachanfall war so heftig, dass er die Kontrolle verlor. Er lachte und lachte, bis ihm die Tränen übers Gesicht liefen.