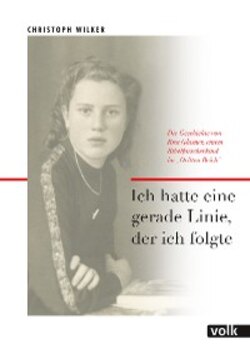Читать книгу Ich hatte eine gerade Linie, der ich folgte - Christoph Wilker - Страница 7
KAPITEL 1 Frühes Verbot der Glaubensgemeinschaft – Erste Auswirkungen auf Ritas Familie
ОглавлениеRita Glasner erlebte als Angehörige einer verfolgten Minderheit zwölf Jahre NS-Terrorherrschaft. Wie empfand sie, als Einzige in der Schule den Hitlergruß abzulehnen und wie reagierten ihre Lehrer? Wie ist sie damit umgegangen, nach der zweiten Inhaftierung ihrer Mutter im Jahre 1943 mehrere Monate völlig auf sich allein gestellt zu sein? Welche Erinnerungen hat sie an den dramatischen Gerichtsprozess in Berlin, als ihre Mutter zunächst zum Tode verurteilt werden sollte, schließlich aber sieben Jahre Zuchthaus erhielt? Warum sah das Gericht für ihre Mutter diese hohe Strafe vor? Wie ging alles letztendlich aus und wie beurteilt Rita diese schwere Zeit heute, im Alter von 85 Jahren? Bevor Rita als Zeitzeugin auf diese und viele weitere Fragen und Szenen ihres Lebens eingeht, nehmen wir den Beginn des NS-Regimes und die ersten Auswirkungen auf ihre Familie in den Blick.
Nachdem Adolf Hitler Ende Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde, überstürzten sich die Ereignisse. Zug um Zug und in schneller Reihenfolge wurden Freiheits- und Menschenrechte immer mehr beschnitten, um den Handlungsspielraum für Hitlers politische Ziele zu erweitern. Er wurde zum Diktator über Gut und Böse; und wer sich widersetzte, musste mit den schlimmsten Konsequenzen rechnen.
Rita Glasner war zu dieser Zeit ein Kleinkind, 1933 gerade einmal drei Jahre alt. Ihre Eltern waren im selben Jahr Bibelforscher geworden, wie die Anhänger der Religionsgemeinschaft, die 1931 den Namen Jehovas Zeugen angenommen hatten, in der Öffentlichkeit weiter genannt wurden.[1] Die Bibelforscher gehörten zu den wenigen, die sich nicht vom NS-Überwachungsstaat dessen „Werte“ diktieren ließen. Sie folgten weiter biblischen Maßstäben für Gut und Böse. Daher waren sie überzeugte Kriegsgegner. Und sie verweigerten den Hitlergruß, weil sie den Führerkult ablehnten. Die Konsequenz ihrer Haltung und Überzeugung führte zu zahlreichen Konflikten mit dem NS-Staat.
Doch das frühe Verbot der Glaubensgemeinschaft in den Ländern des Deutschen Reiches bereits wenige Monate nach der Machtergreifung Hitlers (10. April in Mecklenburg, 13. April 1933 in Bayern usw.) hatte andere Ursachen. Zum einen störten sich die Nationalsozialisten an dem internationalen Charakter der Bibelforscher-Bewegung („Internationale Bibelforscher-Vereinigung“). Hinzu kam die Propaganda national gesinnter Personen, die die Bibelforscher beispielsweise als „eine pazifistische, unkontrollierbaren ausländischen Einflüssen unterliegende und dem Judentum Schrittmacherdienste leistende Organisation“ oder als „amerikanische Sekte mit starkem kommunistischen Einschlag“ bezeichneten und damit Vorurteile gegen die Gemeinschaft schürten.[2] In der vom nationalsozialistischen Politiker Julius Streicher herausgegebenen antisemitischen Wochenzeitung „Der Stürmer“ wurde bereits im Dezember 1924 unter dem Titel „Entlarvung der ‚Ernsten Bibelforscher‘“ die angeblich „intime Verbindung mit dem internationalen Judentum“ betont und behauptet, „daß die sogen[annten] ‚Ernsten Bibelforscher‘ eine mit Judengeld aufgezogene Unternehmung zur Irreführung der christlichen Menschheit“ sei. In dem Artikel wird erwähnt, dass die „Enthüllungen“ einem Bericht der katholischen Kirchenzeitung der Erzdiözese Bamberg vom 14. Dezember 1924 entnommen worden seien.
Abb. 2: Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministers des Innern vom 13. April 1933 über das Verbot der Ernsten Bibelforscher
Abb. 3: Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat vom 28. Februar 1933
Ohnehin bestanden angesichts des Einflusses der beiden großen Kirchen Ressentiments in der Gesellschaft. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diejenigen, die sich den Zeugen Jehovas angeschlossen hatten, in den weitaus meisten Fällen vorher aus der Kirche ausgetreten waren. Das traf auch auf die Eltern von Rita zu, die vorher der katholischen Kirche angehört hatten. Die Haltung der katholischen Kirche wird auch deutlich durch das Agieren des damaligen Münchner Kardinals Michael von Faulhaber (1869–1952). Der Theologe war ab 1917 Erzbischof von München und Freising, ab 1921 Kardinal und Professor für „Alttestamentliche Exegese und biblische Theologie“. Faulhaber bedankte sich mit Schreiben vom 5. Mai 1933 bei den bayerischen Staatsministern für die gegen die Zeugen Jehovas getroffenen Maßnahmen, die in Bayern drei Wochen zuvor, am 13. April 1933, verboten worden waren. Der Kardinal erkannte in dem Schreiben dankbar an, „daß sich im öffentlichen Leben unter der neuen Regierung manches verbessert hat: Die Gottlosenbewegung ist eingedämmt, die Freidenker können nicht mehr offen gegen Christentum und Kirche toben, die Bibelforscher können nicht mehr ihre amerikanisch-kommunistische Tätigkeit entfalten.“[3]
Abb. 4: Straßenschild „Kardinal-Faulhaber-Straße“, Münchener Innenstadt
Die Ablehnung des Hitlergrußes löste zwar auch Verfolgungsmaßnahmen aus, sie war aber nicht die originäre Ursache des frühen Verbots. Und die kompromisslose Verweigerung des Wehrdienstes wurde erst mehr als zwei Jahre nach Beginn der NS-Herrschaft zu einem Problem der Zeugen Jehovas, nachdem mit Erlass des Wehrgesetzes vom 21. Mai 1935 die Wehrpflicht wieder eingeführt worden war.
Ein bedeutendes Konfliktpotenzial entstand durch das Verbot der Glaubensgemeinschaft im April 1933 an sich. Die Zeugen Jehovas vertraten den Standpunkt „göttliches Recht bricht weltliches Recht“ und missachteten daher das Verbot, indem sie sich weiter zu Bibelkreisen trafen und ihr christliches Gedankengut verbreiteten. Bereits das gemeinsame Lesen in der Bibel löste Verhaftungen und Gefängnisstrafen aus, weil dadurch der organisatorische Zusammenhalt der verbotenen Vereinigung gefördert wurde.
Abb. 5: Ludwig und Katharina Glasner mit der zweijährigen Rita (Bildmitte, 1932)
Die meisten der 1933 bekannten 500 Münchner Zeugen Jehovas setzten mit ihren Kindern ihre Aktivitäten ungeachtet des Verbots fort. Auch Ludwig und Katharina Glasner besuchten mit ihrer kleinen Tochter Rita weiter die Zusammenkünfte der Zeugen Jehovas, die nun in kleineren Kreisen, im Untergrund „Zellen“ genannt, stattfanden.
Text der etwa 20.000 Protesttelegramme aus aller Welt:
„IHRE SCHLECHTE BEHANDLUNG DER ZEUGEN JEHOVAS EMPÖRT GUTE MENSCHEN UND ENTEHRT GOTTES NAMEN. HÖREN SIE AUF JEHOVAS ZEUGEN WEITER ZU VERFOLGEN, SONST WIRD GOTT SIE UND IHRE NATIONALE PARTEI VERNICHTEN …“
1934 reagierten die Zeugen Jehovas erstmals mit einer Kampagne auf das Verbot und die gegen ihre Gemeinschaft geführten Verfolgungsmaßnahmen. Am 7. Oktober 1934 wurde von allen Ortsgruppen der Zeugen Jehovas in Deutschland ein an die Reichsregierung gerichteter Protestbrief verschickt. Außerdem wurden tausende Protesttelegramme aus dem Ausland versandt, weil auch das Informationsnetz in andere Länder weiter intakt war.
Für München organisierte der damalige Leiter der Ortsgruppe, Johann Kölbl, den Versand der Protestnote. Der Historiker Henrik Eberle stellte fest, dass der an Hitler gerichtete Protest massive Folgen hatte. Mindestens tausend dieser Schreiben wurden an die Gestapo[4] „zur weiteren Bearbeitung“ weitergeleitet. Es folgte eine reichsweite Verhaftungswelle. Eberle bewertete diese Aktion der Zeugen Jehovas als „Akt kollektiver und kompromissloser Selbstbehauptung, der Achtung abringt.“[5] Rita war zu dieser Zeit etwa fünf Jahre alt.
RITAS ERZIEHUNG
Rita wurde von klein auf im christlichen Glauben nach dem Verständnis der Zeugen Jehovas erzogen. In ihren Schilderungen betont sie, dass sie bereits mit drei Jahren grundlegende Aussagen der Bibel verstehen und schätzen lernte. Schon früh trat sie fest für diese Werte ein. Rita berichtet, dass sich ihr Vater auch Zeit nahm, um ihr zu erklären, was es mit Hitler und seinem Staat auf sich hatte. Obwohl sie erst drei Jahre alt war, so Rita rückblickend, gelang es ihrem Vater, ihr verständlich zu machen, warum Hitler und sein Regime böse waren.
Abb. 6: Rita im Alter von vier Jahren (links im Bild, 1934)
Aus naheliegenden Gründen widersprach eine Erziehung durch Zeugen Jehovas den Wertvorstellungen des neuen Regimes. Wie unter dem NS-Regime mit Kindern von Zeugen Jehovas mitunter umgegangen wurde, zeigt die folgende Bemerkung in einer Veröffentlichung der Zeugen Jehovas aus dem Jahre 1937, die mit einem ironischen „Heil Hitler“ schließt:
Das goldene Zeitalter, September 1937
Das goldene Zeitalter – 1936/37 „Personalien der Eltern gefährdeter Kinder
Neulich kamen Polizeibeamte, […] um bei den Zeugen Jehovas, welche Kinder haben, festzustellen, wie ihre Personalien seien, dabei führten sie Formulare mit, die folgenden Kopf hatten: ‚Personalien der Eltern von gefährdeten Kindern‘. Das satanische Tier [das NS-Regime] betrachtet also die Kinder, welche streng christlich erzogen werden, als erzieherisch ‚gefährdet‘, beabsichtigt also einen Kinderraub. Was schert sich das Raubtier um das Naturgesetz, daß ein Kind seiner Mutter gehört […] ‚Heil Hitler‘.“[6]
Mehr als 500 Fälle sind dokumentiert, in denen Kinder aus den Reihen der Zeugen Jehovas ihren Eltern durch den NS-Staat entrissen wurden. Aus heutiger Sicht erscheint diese Zahl klein, auch wenn man sie in Relation setzt zu der Zahl der Kinder der damals 25.000 Zeugen Jehovas im Deutschen Reich, die im fünfstelligen Bereich gelegen haben wird. Die Zahl zeigt aber andererseits, dass es sich dabei um ein reales Risiko handelte, mit möglicherweise tragischen Folgen. Berichte über derartige Maßnahmen mussten bei Familien von Zeugen Jehovas mit Kindern große Ängste ausgelöst haben.
Auch Rita stand durchaus in der Gefahr, Opfer eines Kinderraubes durch die Nationalsozialisten zu werden, um eine NS-konforme Erziehung, zum Beispiel in einem NS-Erziehungsheim, zu erhalten.
Wie ist heute, aus der zeitlichen Distanz, eine Erziehung durch Zeugen Jehovas während der NS-Diktatur zu beurteilen?
Abb. 7: Bericht der Gestapo München Wohnungsdurchsuchung
Sie war ein Schutz vor dem Gedankengut, welches von den Nationalsozialisten verbreitet – und von weiten Teilen der Bevölkerung auch angenommen wurde. Über die Bedeutung der Erziehung im Elternhaus äußerte sich der SPD-Politiker Klaus von Dohnanyi 1999: „Sie [die Zeugen Jehovas unter dem NS-Regime] haben uns gezeigt, dass Glaube und Anstand, humanistische Werte und überzeugte Menschlichkeit wenig mit Parteipositionen rechts oder links zu tun haben, wohl aber mit einer Erziehung zu und Einübung von religiösen und ethischen Werten.“[7]
BETEILIGUNG VON RITAS ELTERN AN GEFÄHRLICHER FLUGBLATT-KAMPAGNE
Die Beobachtungen und Erfahrungen, die Rita in den Folgejahren machen musste, passten nur zu gut zu dem, was ihre Eltern ihr über die Hitler-Regierung vermittelt hatten. Sie erinnert sich an einen Tag im Jahre 1936, als die Gestapo bei ihnen eine Wohnungsdurchsuchung machte.
„Die Gestapo brachte die ganze Wohnung durcheinander. Die Polizei fand aber nichts.“
Ende 1936 herrschte Hitler bereits seit knapp vier Jahren im Deutschen Reich und viele Zeugen Jehovas befanden sich inzwischen in Gefängnissen und Konzentrationslagern. Um die Öffentlichkeit auf die Verfolgung durch das NS-Regime aufmerksam zu machen und dagegen zu protestieren, organisierten die Zeugen Jehovas eine zweite Kampagne.[8] Am 12. Dezember 1936 verbreiteten sie in einer Blitzaktion im ganzen Deutschen Reich Flugblätter mit dem Titel „Resolution“. Die Resolution war eine öffentliche Erklärung, dass sich die Glaubensgemeinschaft nicht an die Einschränkungen ihrer Religionsfreiheit durch das NS-Regime halten werde und enthielt Informationen zur Verfolgung der Gemeinschaft.
Auch der Werkmeister Ludwig Glasner verteilte am 12. Dezember 1936 diese Flugblätter. Seine Frau Katharina unterstützte ihn bei den Vorbereitungen. Die Aktion fand wenige Wochen vor dem siebten Geburtstag von Rita statt. Ritas Eltern hielten die sehr gut vorbereitete und im ganzen Deutschen Reich zu einer fest vereinbarten Zeit durchgeführte Verteilung streng vor ihrer Tochter geheim. Es galt, jedes Risiko zu vermeiden und Rita nicht unnötig zu belasten.
VERBREITUNG DES PROTESTFLUGBLATTES LÖST VERFOLGUNGSWELLE AUS
Die Verbreitung der Protestflugblätter löste eine heftige Verfolgungswelle gegen die Zeugen Jehovas im ganzen Deutschen Reich aus. Durch ihr öffentliches Wirken vor dem Verbot waren die Mitglieder der Religionsgemeinschaft in ihrer Umgebung meistens namentlich bekannt. Bei vielen folgten kurz nach der Flugblattaktion Hausdurchsuchungen. Am 3. Februar 1937 erschienen Gestapo-Beamte bei Familie Glasner und durchsuchten deren Wohnung. Eine unmittelbare Verbindung zur acht Wochen zurückliegenden Flugblattverteilung ist allerdings unwahrscheinlich. Erst bei dieser zweiten Wohnungsdurchsuchung am 3. Februar 1937 wurde die Gestapo fündig: „Gefunden und beschlagnahmt wurde ein Liederbuch ‚Gesänge zum Preise Jehovas‘“ (vergleiche Abbildung 7, hier).
In den Augen der Gestapo-Beamten galt die Verbindung zur verbotenen Internationalen Bibelforscher-Vereinigung damit als bewiesen. Ritas Eltern wurden einen Tag später zur Gestapo vorgeladen. Die Vorführungsnote von Ludwig Glasner vom 4. Februar 1937 trägt den Stempelaufdruck „Haft“. Noch am selben Tag wurde Ludwig Glasner in das Polizeigefängnis München-Neudeck verbracht.
Es folgten Verhöre durch Gestapo-Beamte, die vermuteten, dass Ludwig und Katharina Glasner an der Flugblatt-Kampagne vom 12. Dezember 1936 beteiligt gewesen waren. Doch Ludwig Glasner bestätigte keine illegale Betätigung für die Internationalen Bibelforscher. Am 11. Februar 1937 wurde er erneut verhört. Jetzt äußerte sich Ludwig Glasner zur Verteilung der Flugblätter, nachdem er eine Woche in Haft und sehr wahrscheinlich durch brutale Misshandlungen unter Druck gesetzt worden war.
Auszug aus dem Gestapo-Protokoll vom 11. Februar 1937: „Am 11.2.37 Glasner aus Polizeihaft vorgeführt und nochmals zur Sache vernommen, erklärte nach längerem Leugnen, daß er nun die volle Wahrheit sagen wolle, worauf er folgende Erklärung abgab: Daß ich anfangs nicht sofort die Wahrheit sagen wollte, hat seinen Grund darin, daß ich nicht zum Verräter werden wollte. Ich gebe nun zu, daß ich Resolutionen verteilt habe…“[9]
Bei einem weiteren Verhör am selben Tage nannte Ludwig Glasner unter dem Druck der Gestapo-Beamten weitere Details zur Verbreitung der Flugblätter. Nach drei Monaten Haft folgte am 13. Mai 1937 seine Verhandlung vor dem Münchner Sondergericht. Dabei drehte es sich um die Verbreitung des von den Nationalsozialisten als „Hetzschrift“ bezeichneten Protestflugblattes „Resolution“. Im Urteil des NS-Sondergerichts München vom 13. Mai 1937 gegen Ludwig Glasner wird der Inhalt des Flugblattes wie folgt kommentiert:
„In der [Resolution wird] in scharfer und staatsfeindlicher Weise für die Lehre [der Bibelforscher] eingetreten und gegen das staatliche Verbot der Sekte und die in Durchführung des Verbots getroffenen staatlichen Maßnahmen Stellung genommen. Diese ‚Resolution‘ wurde am 12.12.1936 von den Anhängern der Bewegung schlagartig in Tausenden von Exemplaren in ganz Deutschland verbreitet.“[10] Zur Beteiligung von Ludwig Glasner an der Verbreitung wird Folgendes festgestellt: „Am Donnerstag, den 10.12.1936, übergab [Lorenz] Hofstetter dem Angeklagten Ludwig Glasner am Max-Weber-Platz in München, wohin er ihn 2 Tage vorher bestellt hatte, 8 Päckchen mit je 50 Stck. der ‚Resolution‘. Am Abend desselben Tages kam Hofstetter zu Glasner in die Wohnung, erklärte ihm den Inhalt der Päckchen und beauftragte ihn, die Resolutionen durch die Eheleute Sedlmaier und Frau Friedl verteilen zu lassen und sich selbst an der Verteilung zu beteiligen. 3 Päckchen nahm Hofstetter an dem Abend wieder mit. Dem Angeklagten verblieben also 5 Päckchen mit je 50 Stück der ‚Resolution‘. Er steckte, teilweise mit Hilfe seiner Ehefrau, sämtliche Resolutionen in Briefumschläge. Später übergab er in seiner Wohnung der Mitangeklagten Katharina Sedlmaier 100 Stück und der Frau Friedl 50 Stück der ‚Resolutionen‘ zur Verteilung. Jedem Päckchen lag ein Zettel mit einem Verzeichnis der Straßen, in dem die Flugblätter verteilt werden sollten, bei. Von den übriggebliebenen 100 Stück der ‚Resolution‘ verteilte der Angeklagte Ludwig Glasner selbst etwas über die Hälfte zwischen dem Max-Weber-Platz [München] und Oberföhring durch Einwerfen in die Briefkästen. Den Rest sollte seine Frau, die Mitangeklagte Katharina Glasner verteilen. Diese will jedoch die Flugblätter verbrannt haben.“[11]
Abb. 8: Die Luzerner Resolution, ein Protesflugblatt, das während eines Kongresses in Luzern im September 1936 verabschiedet und am 12. Dezember 1936 und am 10. Februar 1937 im ganzen Deutschen Reich von Jehovas Zeugen verbreitet wurde
Über die Bedeutung der Flugblattaktionen der Zeugen Jehovas im Dritten Reich wird in einer Veröffentlichung des Instituts für Zeitgeschichte, München/Berlin, Folgendes bemerkt: „Zweimal, am 12. Dezember 1936 und am 20. Juni 1937, gelangen ihnen [den Zeugen Jehovas] mit der schlagartig im ganzen Reichsgebiet durchgeführten Verteilung von Protestflugblättern Propagandacoups, wie sie in diesem Umfang keine andere illegale Gruppe zustande brachte.“[12]
Ludwig Glasner wurde zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Er kam in das Münchner Strafgefängnis Stadelheim. Katharina Glasner erhielt eine Gefängnisstrafe von drei Wochen, die sie nach Ende der Haftzeit ihres Mannes antreten musste. Das Sondergericht nahm damit Rücksicht auf die siebenjährige Rita, eine für NS-Maßstäbe bemerkenswerte Entscheidung, die in München auch eine andere Familie aus den Reihen der Zeugen Jehovas erfahren durfte.
Die inzwischen eingeschulte siebenjährige Rita musste mit ansehen, wie zuerst ihr Vater und dann ihre Mutter wie Verbrecher inhaftiert wurden. Ritas Vater war vom 2. Februar bis 13. August 1937 im Gefängnis. Sie vermisste ihren Vater sehr, auf den sie sechs Monate verzichten musste – für eine Siebenjährige eine lange Zeit.
„Ich habe sehnsüchtig auf meinen Vater gewartet. Ich hing an meinem Vater. Er war mein Halt, weil er so ruhig und gelassen war.“
Auch für Ritas Mutter war diese Zeit sehr belastend. Sie tat sich schwer, alles zu verarbeiten. Hinzu kamen wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wie sollte sie die Wohnungsmiete zahlen, nachdem ihr Mann im Gefängnis nichts verdiente? Katharina Glasner begab sich auf die Suche nach Arbeit, die sie schließlich in der Münchner Großmarkthalle fand. Sie verdiente fünf Reichsmark am Tag, was sie wieder in die Lage versetzte, die Miete zu zahlen.
IN GEGENWART VON RITA UNTER FOLTER ERZWUNGENE UNTERSCHRIFT
Am Ende der Haftzeit im August 1937 wurde Ludwig Glasner – wie vielen anderen Zeugen Jehovas – eine Erklärung vorgelegt, die er unterschreiben sollte. Die meisten Zeugen Jehovas lehnten es ab, mit der Unterschrift ihre religiöse Auffassung als Irrlehre zu bezeichnen. Auch Ludwig Glasner war fest entschlossen, nicht zu unterschreiben. Doch die Gestapo fand einen perfiden, aber wirksamen Weg, seine Haltung zu brechen. Sie luden seine Frau Katharina mit der siebenjährigen Tochter Rita vor. In dem großen, länglichen Raum befanden sich fünf Personen: Auf der einen Seite nahe dem Fenster die kleine Rita mit ihrer Mutter, auf der anderen Seite Ritas Vater und zwei Gestapo-Beamte. Auf diese Weise hatte Ludwig Glasner gegen zwei Fronten zu kämpfen: Auf der einen Seite musste er psychische und körperliche Folter der Gestapo-Beamten ertragen und auf der anderen Seite ansehen, wie seine Frau und besonders seine kleine Tochter darunter litten. Letzteres machte ihm noch mehr zu schaffen. Die Vorgehensweise der Gestapo verfehlte nicht ihre Wirkung.
Rita erinnert sich:
„Mein Vater wurde furchtbar geschlagen – vor meinen Augen und den Augen meiner Mutter. Sie haben ihn regelrecht zugerichtet.Er wollte nicht unterschreiben. Als ich sah, wie mein Vater schwer geschlagen wurde, fing ich jedoch an zu weinen und zu schreien.Diesem Druck hielt meine Mutter nicht stand.Schließlich forderte sie meinen Vater auf, dem Ganzen doch ein Ende zu machen und zu unterschreiben. Mein Vater erlag dem enormen Druck und unterschrieb.“
Zwei Gestapo-Beamte schlugen Ludwig Glasner blutig, dazu das schreiende Kind. Ludwig und Katharina Glasner hatten eine sehr herzliche Beziehung zueinander und zu ihrer Tochter. Die Emotionen seiner Frau und die der kleinen Rita übertrugen sich auf Ludwig Glasner, der so unter physischen Schmerzen und psychischem Druck zur Unterschrift gezwungen wurde. Besonders Ludwig, aber auch Katharina Glasner hat dieser Vorfall noch lange belastet. Die Erfahrung mit den Gestapo-Beamten hatte auch Einfluss auf spätere Entscheidungen von Ritas Vater, denn seine Moral war nun gebrochen.
Ritas Lehre daraus:
„Besser Folter in Kauf nehmen als nachgeben. Schläge und Schmerzen hören auf. Ein schlechtes Gewissen kann einen dagegen jahrelang belasten.“
Und über ihre eigene Rolle als damals Siebenjährige urteilt sie:
„Wäre ich nicht dabei gewesen, wäre das Ganze wahrscheinlich anders ausgegangen.“
Ludwig Glasner hatte die Erklärung zwar unterschrieben, aber nicht freiwillig. Er war schwach geworden, doch seine Einstellung hatte sich nicht verändert und so betätigte er sich nach seiner Freilassung weiter als Zeuge Jehovas.
RITAS MUTTER IM GEFÄNGNIS
Katharina Glasner war nicht zur Unterzeichnung einer derartigen Erklärung gezwungen worden. Sie wurde ohne weiteres nach Ablauf ihrer dreiwöchigen Haft im September 1937 wieder freigelassen. Rita erinnert sich wie fürsorglich sich ihr Vater um sie gekümmert hatte, während ihre Mutter inhaftiert war – in einer Zeit, als Haushalt und Erziehung noch eine Domäne der Mütter war.
„Das war eine wunderbare Zeit für mich.Mein Vater tat alles für mich.Die Zeit hat mich mit meinem Vater sehr verbunden.“
Diese Erfahrung stand auch unter dem Eindruck der langen vorherigen Trennung vom inhaftierten Vater und seiner schrecklichen Behandlung, die Rita beim Gestapo-Verhör miterleben musste. So hatte die schmerzliche Trennung von der Mutter aus Sicht der kleinen Rita auch eine gute Seite. Es entstand ein noch engeres und herzlicheres Verhältnis zum Vater, wovon sie noch lange profitieren sollte.