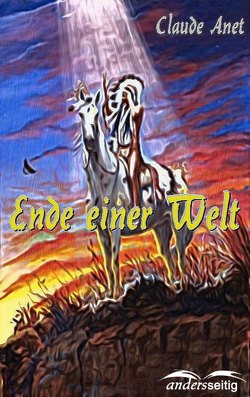Читать книгу Ende einer Welt - Claude Anet, mehrbuch - Страница 5
II
ОглавлениеUnd trotz alledem vermochten die Leute vom Fluß eine dunkle Ahnung nicht zu bannen, daß ihr Leben, die Existenz des Stammes in jedem Augenblick bedroht sei. Der Mensch sah sich allein im Mittelpunkt einer feindlichen Welt. Unter den Tieren zählte er nicht eines als Freund. Er kannte sie nur, um sie zu töten. Zwischen ihnen und ihm war ewiger Krieg, ein Kampf, der bald mit offener Kraft, bald mit Heimtücke und List geführt wurde. Sobald er seine Behausung verließ, setzte der Mensch sich tausend Gefahren aus. Hinter den Bäumen und den Felsen lauerten stumme Feinde auf ihn, und der Gedanke, daß es immer so bleiben werde, solange es Menschen und Tiere geben würde, bedrückte ihn an manchen Tagen.
Und was gab es außerdem noch für schwer zu ertragende Leiden und Plagen!
Krankheiten kamen über den Stamm, von unsichtbaren Feinden gesandt, über die man ganz im unklaren war. Sie dezimierten die Söhne des Bären. Wohl vermehrten die Weisen ihre versöhnenden Riten, doch die Widersacher waren geschickt genug, sich auch dem mächtigsten Zauber zu entziehen. Wie die Fliegen beim ersten Frost, so starben die Leute vom Fluß.
Eine noch gefährlichere Plage kam über sie. Die Furcht zog in das Tal ein und nahm von ihren Seelen Besitz. Eine Katastrophe, die man herannahen fühlte, ohne zu wissen, von welcher Art sie sein werde, würde in naher Zeit den ganzen Stamm vollkommen vernichten. Angstbeklommen zitterte man in den Hütten, man wagte sich nicht vor die Türen, ja, man litt lieber Hunger, als den Gefahren entgegenzutreten, die draußen warteten. Und wieder bemühten sich die Weisen, die unseligen Ursachen dieses Zaubers zu entdecken. Dieser Zustand währte manchmal einen ganzen Monat, manchmal auch zwei. Erst allmählich kehrte die Ruhe zurück, grundlos, wie Sonnenschein nach Regenwetter, und die Leute vom Fluß verloren selbst die Erinnerung an den Schrecken, der sie in ihre Wohnstätten gebannt hatte.
Einige blieben aber ständig durch Gesichte und Angst geplagt. Sie sahen Dinge, die alle anderen nicht wahrnehmen konnten; sie hörten Worte und Geräusche, die allen rings um sie entgingen. Untätig blieben sie die ganzen Tage, aber trotzdem behandelte man sie mit Güte, und sie nahmen an der Nahrung ihrer Stammesbrüder teil, ohne bei deren Erwerb mitgeholfen zu haben.
Manchmal packte einen dieser Besessenen ein Anfall. Er sank wie hingemäht zu Boden; rötlicher Schaum entquoll seinen Lippen. Mit Armen und Beinen stieß er im Krampf um sich. Lange Zeit blieb er wie leblos. Die Weisen begannen den Unglücklichen zu behandeln. Sie berührten ihn mit einem Renntierhuf und gaben ihm einen Trank, aus Pflanzen bereitet, deren Mischung nur ihnen bekannt war. Dann versuchten sie durch Beschwörungsformeln den Geist zu verjagen, der ihn quälte. In ernsten Fällen, wenn alles vergeblich war, wurde zur Operation geschritten. Es blieb nichts übrig, als eine Öffnung in den Schädel des Besessenen zu bohren, durch die der böse Geist zu entweichen vermochte. Man verfuhr dabei auf folgende Weise:
Die drei Weisen ließen zuerst die vorgeschriebene Beschwörung ergehen. Wenn die Wirkung nicht so war, wie man erhoffte, nahm einer von ihnen einen hierfür besonders zugespitzten Stein und setzte ihn, während die beiden anderen den Kranken festhielten, mit aller Kraft auf den Schädel des Unglücklichen, wo er ihn dann zwischen seinen Händen so rasch als möglich drehte, während ein anderer Tropfen auf Tropfen heißen aromatischen Wassers auf die Haut fallen ließ, nachdem auch darüber die notwendigen Formeln gesprochen waren. Diese heikle Operation wurde mit der äußersten Langsamkeit durchgeführt. Sobald sich das Loch in der Schädeldecke zu formen begann, hielt der Weise inne, um erst am nächsten Tage fortzufahren. Er stillte das Blut mit Hilfe gewisser Kräuter, mit denen die Jäger ihre Wunden verbanden. Es brauchte oft sechs bis acht Tage, bevor die Schädeldecke durchbohrt war.
Es kam vor, daß der Kranke gesundete. Es kam häufiger vor, daß er starb. In diesem zweiten Falle war es den Leuten vom Fluß klar – selbst die Schwerfälligsten und Stumpfesten begriffen es – daß die Zaubersprüche nicht in vorgeschriebener Weise gesprochen worden waren.
So verliefen durch Jahrhunderte die Tage für die Menschen am Flusse, rauhe Tage voll Mühsal und Kampf, an denen die Jäger des Stammes immer wieder unter Gefährdung ihres Lebens und unter unsäglichen Anstrengungen und Opfern Nahrung für Frauen, Kinder und Greise erbeuten mußten.
Seit einigen Generationen aber zeigten sich kaum wahrnehmbare Änderungen in der Temperatur, die dennoch so aufmerksamen, geduldigen und geübten Beobachtern, wie es die Söhne des Bären waren, nicht entgehen konnten. Die Winter verloren immer mehr an Kälte, und die Sommer wurden heißer.
Einst – so lauteten die Berichte der Greise, in deren schwachem Gedächtnis sich allerdings die eigenen Erinnerungen unentwirrbar mit den mündlichen Überlieferungen des Stammes vermengten, so daß es nachgerade unmöglich war, die Erlebnisse ihrer eigenen Jugend von der unbewußten Wiederholung dessen zu unterscheiden, was ihnen von ihren Vorfahren erzählt worden war – einst sollte das Land fast während der Hälfte des Jahres von einer schimmernden Schicht Schnee bedeckt gewesen sein. Damals in diesem für sie günstigen Klima wimmelte es von Renntieren. Vier bis fünf große Herden hielten sich ständig im Tale auf. Die Jäger verfolgten sie mit Schneereifen an den Füßen. Überfluß herrschte in den Wohnstätten. Aber jetzt war Regen an Stelle des Schnees getreten. Der Winter verlief in eisiger Feuchtigkeit, unter der die Renntiere furchtbar leiden mußten.
So klagten die alten Männer, während sie ihre erstarrten Glieder am Feuer wärmten. Ungeduldig hörten die jungen Leute zu. Die Greise faselten; glaubten sie denn, daß die Welt mit ihnen zu Ende sei?
Die Weisen jedoch schüttelten den Kopf. Wie konnte man leugnen, daß das Leben ringsum sich änderte. Die Tiere merkten es ebenso wie die Menschen; sie waren ständig in Unruhe. Das Wild mit schönem Pelz wurde immer seltener. Wie viele Zobel wurden jetzt noch während eines Jahres vom ganzen Stamm erlegt? Silberfüchse und Blaufüchse gab es nur noch in verschwindender Menge. Warum verließen die einen und die anderen das Land? Neue Arten tauchten auf. Man jagte jetzt den Hirsch, der früher unbekannt gewesen war. Doch, war der Hirsch ein Ersatz für die gewohnte Beute? Seine Haut war unverwendbar und sein Geweih zu weich, um bearbeitet zu werden.
Und das Renntier verschwand. Das war eine Tatsache. Schon seit langem erbeutete man so wenige, daß sich nur mehr die Jäger in ihr vorzügliches Fell kleiden konnten. Ohne Zweifel wechselten die Renntiere oft, aber sie waren noch nie, wie diesmal, ein ganzes Jahr fortgeblieben. Man begann schon zu glauben, daß man sie niemals wiedersehen würde.
Dieser Gedanke verursachte eine wahre Panik im Stamme. Die bei erbitterten Frauen natürliche Ungerechtigkeit führte sie dahin, ihren Männern vorzuwerfen, daß sie sich nicht mehr auf die Jagd verstünden. Man sollte es nur wissen, ohne die Felle der Renntiere konnten sie sich nicht behelfen! Die Männer ihrerseits wandten sich an Rahi, den Häuptling, und an die Weisen. Ihnen oblag der Schutz des Wildes. Ihre Pflicht war es, die feindlichen Geister zu hindern, es zu entführen. Besaßen sie denn nicht Mittel genug, um die Tiere, die zu flüchten versuchten, an eine Stelle zu bannen und jene, die geflüchtet waren, zurückzurufen? Wenn ihre Zauberkräfte nicht mehr ausreichten, wie konnten sie es dann wagen zu behaupten, daß sie das geistige und körperliche Wohl des Stammes zu sichern vermochten? Der Häuptling wurde jeden Tag unbeliebter. Nur noch die Furcht, die er um sich verbreitete, weil er viele Geheimnisse der unsichtbaren Welt kannte, hinderte die Männer, sich offen gegen ihn zu erheben.
Die Weisen bemühten sich, in der Öffentlichkeit ihre kaltblütige Ruhe zu bewahren. Sie suchten stets nur zu beruhigen, die Aufgeregtesten zu beschwichtigen. Ihre ganze Politik hieß: Zeit gewinnen. So predigten sie Geduld und erhofften zugleich von ihrem geheimen Wissen wie von der Zeit eine günstige Wendung. yy
Die jungen Leute und die Mädchen nahmen an diesen ernsten Dingen wenig Anteil. Sie hatten Besseres zu tun, als in die Klagen der Alten einzustimmen.
No mit seinen Gefährten bereitete sich auf die Prüfungen vor, die ihn erwarteten. Bald mußte er die Seinen verlassen. Die Gesetze gestatteten es nicht, daß ein Sohn, der zum Manne geweiht war, in der gleichen Hütte wohnte, in der seine Mutter und seine Schwester schliefen. Er mußte seine eigene Wohnstätte bauen, bei den Hochzeitsspielen ein Mädchen rauben und mit ihr als seiner Gefährtin leben. Ungeduldig sah er der Zeit entgegen, die ihm das schöne, freie Leben eines erwachsenen Mannes sicherte, der im Rate des Stammes seine Stimme hatte, sein eigenes Herdfeuer besaß und eine Gefährtin und Kinder, für die er sorgte. Doch um diesen ersehnten Zustand zu erreichen, mußte er alle Schrecken und Leiden der Einweihungsfeierlichkeiten über sich ergehen lassen.
Er zwang sich, nicht weiter daran zu denken. Das Verlangen, in den Kampfspielen auf der Wiese, am Flusse, zu siegen, verdunkelte alles andere. Trotz der widrigen Jahreszeit hatten sich die jungen Leute ihrer Kleidung entledigt. Sie maßen im Durchschnitt mehr als sechs Fuß. Verächtlich lächelte man im Stamme, wenn man sich an ein Volk erinnerte, das eine gelbe Haut und geschlitzte Augen gehabt hatte, und dessen Männer nicht einmal fünf Fuß hoch gewesen waren. Während eines langen, strengen Winters war es einmal, kaum zwanzig Familien stark, aufgetaucht. Sie sprachen fremde, unbekannte Worte, waren von Nordost gekommen und – man wußte kaum in welcher Richtung – wieder verschwunden, ohne daß man jemals noch etwas von ihnen hörte. Die Leute vom Fluß hatten manchmal solche Überraschungen, die die Eintönigkeit der Tage unterbrachen.
Die Körper mit Fett eingerieben, übten No und seine Freunde sich im Ringen. Geschmeidig wie Lachse, stark wie Bären belauerten sie einander zunächst, um geschickt einem gestellten Bein oder Untergriff des Gegners auszuweichen. Wenn sie sich dann umschlangen, krachten ihre Knochen; endlich rollten beide Kämpfer im Gras, bis es schließlich einem von ihnen gelang, den Gegner unter sich festzuhalten.
Mädchen und Frauen sahen den Spielen nicht zu, aber die Alten waren da, gaben den Kämpfern ihre Ratschläge und feuerten sie durch ihre Schreie an.
Das Wettlaufen begann. Durch Generationen dauernde ständige Übungen hatten nach und nach den Knochenbau dieses Jägervolkes verändert – die Unterschenkel verlängert, den Brustkorb entwickelt, die Beinmuskeln geschmeidiger und ausdauernder gemacht – so sehr, daß jetzt die besten Läufer unter günstigen Umständen imstande waren, selbst einen flüchtigen Rehbock einzuholen. So hatte jeder einzelne jene Geschwindigkeit erreicht, die ihm und seinem Stamme zur Existenz unerläßlich war. Übrigens unterwarfen sich die Läufer einer streng geregelten Lebensweise. Sie aßen nur die Schenkel von Renntieren und Pferden, um sich auf diese Weise das Wesentlichste der Schnelligkeit dieser Tiere, von denen sie sich nährten, einzuverleiben. Die übrigen Teile der Tiere wurden den anderen überlassen.
Bei ihren Übungen liefen sie immer zu zweit. Zehnmal mußte eine Strecke von etwa zweihundert Schritt, die zwischen zwei Bäumen abgemessen worden war, durcheilt werden. Die harmonische Kraftentfaltung bildete einen prächtigen Anblick: wie gespannt von der Anstrengung war jeder Muskel der ganzen sehnigen Gestalten, der Kopf lag zurückgebogen, das Kinn weit vorgestreckt, breit wölbte sich die Brust gleich jener des Bisons; wie bei den Wölfen war der Unterleib gekrümmt und eingezogen, und die Füße am Ende der schmalen Beine, die viel länger als der Oberkörper waren, schienen den Boden kaum zu streifen. Manchmal fuhren Platzregen peitschend auf sie nieder, dann stiegen Dampfwolken von ihren glänzenden Körpern auf.
No war im Laufen einer der Besten. Wenn ihm für die größeren Entfernungen auch noch der Atem mangelte, so war er doch auf hundertfünfzig Schritte von keinem zu überholen, und der Sieg über diese Strecke war der begehrteste.
Sie übten sich auch im Bogenschießen und Speerwerfen. Die Spitzen der Speere wie die der Pfeile waren aus den Geweihen der Renntiere geschnitzt. Ein guter Jäger traf mit seinem Speer auf fünfzig Schritt. Pfeifend durchschnitt er die Luft und zitterte und schwankte, als wolle er jeden Augenblick aus seiner Bahn ausbrechen. Aber eine Kraft in ihm hinderte ihn daran. Er rammte sich in den Stamm einer jungen Birke. Dann vernahm man einen dumpfen Ton. Die Birke klagte über die erhaltene Wunde. Nichts Schöneres gab es als die Bewegung der jungen Leute, die, ihre Waffe schwingend, losstürmten. Plötzlich blieben sie wie angewurzelt stehen, mit dem linken Bein sich vorwärts gegen den Boden stemmend, und der Speer, der ihren rechten Arm machtvoll verließ, schien in der Luft den rasenden Lauf des Jünglings fortzusetzen.
Wenn die Spiele beendet waren, tauchten sie ihre dampfenden Körper in die kalten Fluten des Stromes. Dann legten sie wieder ihre Kleider an und kehrten zu den Wohnstätten zurück, wo sie von den vollbrachten Taten und künftigen Jagden sprachen.
No liebte es, sich des Abends mit den erfahrenen Männern und den Weisen des Stammes zu unterhalten. Er stellte ihnen Fragen über Dinge, die ihn beschäftigten. Die Erde war doch wohl drei bis vier Tagemärsche weit vom Lager noch nicht zu Ende? Was lag dort weiter rückwärts, wo er nicht mehr hinzusehen vermochte? Die Berichte besagten, daß gegen Norden unendliche Eisfelder die Erde bis tief in den Sommer hinein bedeckten. Dort gäbe es nur weiße Bären. Weit hinten im Osten sei eine Grenze hoher Berge, deren schneebedeckte Gipfel bis in den Himmel reichten. Im Süden aber, zehn Tagemärsche weit, sollte ein großes Wasser liegen, und jenseits des Wassers vermutete man auch Länder, die von Tieren und Menschen bewohnt waren. Die Händler allein konnten diese Gegenden durchqueren, denn nur sie standen im freundschaftlichen Verkehr mit jenen Geistern, die anderen den Zutritt verwehrten. In diesen entfernten Ländern war es immer Sommer, und die Menschen nährten sich dort von dem, was auf Bäumen wuchs.
Zu diesem Punkt versicherten die Weisen, daß nach sehr alten Berichten in einer Epoche, von der kaum noch eine ganz dunkle Erinnerung übriggeblieben war, die Eintracht auf der Erde herrschte. Damals töteten die Menschen nicht, um zu leben; sie nährten sich nicht von blutigem Fleisch, sondern von Pflanzen und Früchten. Glücklich lebten sie in Frieden mit unseren Brüdern, den Tieren. Ach! seither war Zwietracht entstanden und trennte Menschen und Tiere in zwei für ewig feindliche Lager. Ströme von Blut waren vergossen worden, die eine Versöhnung unmöglich machten ...
Über die Welt der Geister aber schwiegen die Weisen, denn es war nicht geziemend, darüber vor der Einweihung zu sprechen.
No besaß auch Freunde, die älter waren als er selbst, und die er gern aufsuchte. Zweien von ihnen, die besondere Handfertigkeit besaßen, oblag es an den Wänden der Hütten und Grotten, in Renntiergeweih und Mammutzähne die Tiere nachzubilden, die das Land bevölkerten. No sah andächtig ihrer Arbeit zu. Dank ihrer Kunst waren es fast wirkliche Tiere, die man vor sich hatte, so wunderbar waren sie in ihren Stellungen und Bewegungen erfaßt. Das eine ihrer Leben blieb frei da draußen in Wäldern und auf Wiesen, doch das zweite war durch zauberhafte Macht in ein Stück Elfenbein oder an die Felswand gefesselt, aus der die begabte Hand des Künstlers es herausgegraben hatte. No mühte sich, dem Beispiel seiner Freunde zu folgen. Er verstand, warum es so notwendig sei, in Naturtreue das Tier nachzubilden, das man festhalten wollte. Der Geist des Tieres mußte durch die Ähnlichkeit so weit getäuscht werden, daß er das Bild zu seinem Wohnsitz wählte. Der geringste Fehler genügte, ihn die Täuschung erkennen zu lassen und er kam nicht. Dann bleibt nichts als ein totes Stück Horn und ein lebloser Stein in deinen Händen ...
So dachte auch No, während er arbeitete, an das, was er auf seinen Jagden gesehen hatte, an das Rind auf der Weide, wie es plötzlich, durch ein Geräusch beunruhigt, den Kopf hebt, den Schweif zur Hälfte aufrichtet, den Rücken streckt. Wird es den Feind anspringen? Oder wird es fliehen? Es zögert ... Dieser Augenblick war es, den No festhalten wollte. – Oder das Bild eines verwundeten Bisons, das sich am Boden wälzt; es leidet; es brüllt dumpf; es dreht mit großer Mühe den Kopf nach rückwärts, um die klaffende Wunde mitten im Rücken zu erreichen und sie schmerzlindernd zu lecken ...
No wußte, daß man mit einer vollendeten Darstellung des Wildes, das man jagen will, Macht über diese Beute gewinnt, vorausgesetzt natürlich, daß man auch die Zauberformel kennt, die vor dem Bilde auszusprechen sind. Doch diese Worte bilden einen Teil des vom Stamme als heilig gehüteten Schatzes und werden den Männern erst bei der Einweihungsfeier enthüllt.
Bei dem Gedanken, daß auch er sie bald im geheimnisvollen Innern der heiligen Grotten erfahren werde, bebte No vor Ungeduld.
Trotz der vorgeschrittenen Jahreszeit war die Witterung noch rauh. Zweimal fiel sogar noch Schnee. Doch die Sonne ließ ihn bald zergehen, und er tränkte nur das Moos mit seinem Wasser.
Ganz plötzlich, über Nacht, kam der Wetterumsturz. Der Wind, der jetzt von Süden wehte, brachte mit einem fast warmen Regen so lauen Dunst, daß selbst die Greise ihre dürren Knochen reckten und davon durchdrungen wurden. Die jungen Leute hielten, verwirrt von unklaren Wünschen, die ihnen alle Kraft raubten, in ihren Arbeiten ein. Die Hänge der Hügel bedeckten sich mit Anemonen, Glockenblumen und Veilchen. Die geschwellten Sprößlinge an den Zweigen von Birke und Buche erzitterten vor Wollust, als die ersten Sonnenstrahlen zärtlich über sie hintasteten. In wenigen Tagen holte die Natur alles nach, was sie in den letzten sechs Wochen versäumt hatte. Der brausende Strom all der Kräfte, die viel zu lange in ihrem Schlummer zurückgehalten worden waren, brach sich kraftvoll seinen Weg zum Licht. Menschen, Tiere, Bäume und Pflanzen, die der gleiche Quell des Weltalls beseelt, fühlten betäubt und zitternd die entfesselte Gewalt. Seine Gewässer vermochte der Fluß nicht mehr zu bändigen, und schäumend brachen sie über die Ufer. Die Erde selbst öffnete breit ihre Poren, um Licht und Wärme in gierigen Zügen zu atmen.
Auf der Asche vor der Hütte ruhend, träumte Mah. Der warme Wind erschlaffte sie. Wohl war sie erst knapp fünfzehn Jahre, doch ihre Züge waren die eines gereiften Mädchens. Klein und rund war der Kopf, klein das Antlitz, die Nase lang und schmal, ganz gerade Brauen standen über Augen, deren Iris an die Farbe welker Blätter gemahnte. Die Wangen, oben ein wenig voll hervortretend, verschmälerten sich bis zu dem zart geformten Kinn. Die sorgfältig mit kleinen Fasern gebundenen Flechten fielen auf die noch schmächtigen Schultern. Mah verstand schon ihre schön geschwungenen frischen Lippen mit ein wenig Ocker zu färben. Ihr Hals war geschmeidig wie der eines Schwans und glich, vom Atem geschwellt, dem einer Taube. In ihren Schritten lag träumendes Sehnen, das die Männer verwirrte.
Überwältigt von den milden Lüften ringsum vernachlässigte sie ihre Arbeit, und doch gab es so viel zu tun, Felle zu putzen und geschmeidig zu machen, das Feuer zu unterhalten, die Mahlzeit zu bereiten, Kleidungsstücke zu richten ... Ihre Mutter begann zu schelten. Manchmal versetzte sie der jungen Mah sogar einen derben Klaps, den diese als eine zwar schmerzliche, aber doch so natürliche Sache empfand, daß kein Groll in ihr zurückblieb.
Übrigens war Bahili auch mit Zärtlichkeiten nicht geizig. Dieses starke Weib, das kaum mehr sein sicheres Obdach verließ, war in seiner Häuslichkeit sehr tätig. So schweigsam Timaki, ihr Mann, war, so geschwätzig war sie selbst. Solange der Tag dauerte, stand ihr Mundwerk nicht still. Wenn es an Zuhörern fehlte, kam sie nicht in Verlegenheit und zögerte nicht, sich selbst mit lauter Stimme Belehrungen zu erteilen. Zu ihren beliebten Aussprüchen gehörte: »Feuchtes Moos wärmt schlecht« oder »Die Zunge reicht weiter als der Speer«. Und zu Mah, wenn sie träge war, sprach sie: »Frauen schwitzen, Mädchen sitzen.« Wenn Timaki zur Jagd aufbrach, sprach sie, um ihn zur rascheren Heimkehr zu ermuntern: »Was man draußen ißt, bekommt einem nicht.« Solchen Schwätzerinnen ist es zu verdanken, wenn die Sprache in ihrer Reinheit erhalten bleibt.
Trotz der Vorstellungen ihrer Mutter konnte Mah mit ihrer Arbeit nicht recht vorwärtskommen. Wohl war sie gezwungen, vor der Hütte zu hocken, doch ihr Geist wanderte in weite Ferne. Aus ihren Gesprächen mit No hatte sie viele Dinge erfahren. Sie sehnte sich danach, in die wundervollen südlichen Länder zu gelangen, von denen er erzählt hatte.
Und ein Teil ihrer selbst war wirklich schon dort gewesen. Ja, wenn sie schlief, löste sie sich von dem Orte, auf dem ihr Körper lag, und fand sich in jene fernen Gegenden versetzt, in denen die Sonne heiß brannte und man nur die Hand auszustrecken brauchte, um die köstlichsten Früchte von den Bäumen zu pflücken, die sie im Übermaß darboten. Dort fühlte sie sich wohl, als wäre es ihre wirkliche Heimat. Nicht einmal die Menschen blickten erstaunt auf sie, die ihnen gar keine Fremde zu sein schien. Manchmal sah sie einen jungen Mann, der sich ihr näherte, sie fühlte seinen heißen Atem, er nahm sie in seine Arme ...
Erschöpft und müde nach einer so langen Reise erwachte sie und fand sich wieder auf der alten Terrasse in der Hütte, in der die Ihren schliefen. Der schwere Atem der Mutter klang in der Stille der Nacht noch mühsamer. No lag neben Timaki, und der jüngere Bruder wälzte sich, in einem Traum befangen – was mag so ein Kind im Traum erleben! – unruhig in seinem Sack. Würde sie jemals in jene schönen Länder zurückkehren können? Gab es keine Möglichkeit, den sehnsüchtigen Traum zu verwirklichen? Wer vermöchte sie aus ihrem eintönigen Leben zu entführen?
Sie wußte, es gab Männer, die die Länder bereisten, die Händler, die am Ufer des ganz großen Wassers lebten. Das Meer! Nach den Erzählungen jener, die es gesehen hatten, bemühte sie sich, eine Vorstellung mit dem Wort zu verbinden. Es mußte ein Fluß sein, der nur ein einziges Ufer hatte, und während das Wasser in einem gewöhnlichen Flusse ohne Unterlaß vorbeiströmte, blieb das Wasser im Meer stets das gleiche. Nur manchmal erregte es sich, wurde wütend und ließ ein dumpfes Brausen hören, mit dem es die Menschen erschreckte. Würde sie jemals das Meer sehen?
So träumte sie auch vor sich hin, während sie das Fell eines frisch getöteten Fohlens schabte.
Wenn sie während Nos Abwesenheit entschlüpfen konnte, zog sie mit den anderen Mädchen des Stammes hinaus, um Blumen und duftige Kräuter auf den Hügeln zu sammeln. Die Blumen, die schmückten das Haar und Kränze wurden daraus geflochten, die so schön um den Hals zu tragen waren. Die Kräuter wurden in den Hütten während des Winters getrocknet. Manche verwendete man dazu, um dem Fett, mit dem man seinen Körper einrieb, den süßen Geruch zu geben, von anderen erzählte man, daß junge Frauen, die sich Kinder wünschten, sie auf ihr Lager legen mußten. Doch die Mädchen hatten noch andere Wünsche und pflückten ganz im geheimen eine seltene Pflanze, die nur an feuchten, schattigen Stellen der Täler wuchs, um sie in den Nächten, in denen kein Mond schien, unter ihren Kopf zu legen. Dann waren sie sicher, einen starken und tüchtigen Mann zu finden, bei dem es ihnen niemals an Nahrung mangeln würde, der niemals unter dem Vorwande der Jagd Tage und Nächte fern dem häuslichen Herd verbringen, der nie den kinderlosen Frauen, diesen Hyänen, nachstellen wird, und von dem keine Roheiten zu befürchten waren.
Obwohl Mah noch ein Jahr warten mußte, ehe sie an den Hochzeitsspielen teilnehmen durfte, suchte sie den Verkehr mit älteren Gefährtinnen, teilte ihre Beschäftigung, ihre Freuden und ihr erwartungsvolles Fieber. Das Fest, das zu Mitten des Sommers stattfand, und bei dem sich alle drei benachbarten und befreundeten Stämme, die am Ufer des Flusses wohnten, zusammenfanden, entschied über das Los der Mädchen. Dann mußten sie die Gegend, in der sie geboren waren, verlassen. Die alten, ewigen Gesetze, auf deren Einhaltung strenge gesehen wurde, verboten die Heirat innerhalb des Stammes.
Man beging die Hochzeitsspiele mit größter Feierlichkeit, und die Weisen wachten strenge darüber, daß die alten Gebräuche in allen ihren Vorschriften genau erfüllt wurden, denn die Zukunft des Stammes hing davon ab. Die Ehen waren nicht mehr so kinderreich wie ehemals. Damals zählte ein Haushalt noch zehn und mehr Kinder, und die Hälfte davon blieb am Leben. Jetzt aber sah man kaum mehr als fünf oder sechs, von denen drei oder vier im frühesten Alter starben. Und überdies lag über manchen Frauen der Fluch, kinderlos zu bleiben. Sie brachten Unglück allen denen, die sich ihnen näherten und verursachten Unfrieden in den Ehen. Vergeblich suchten die Weisen die Gründe dieses Übels, und verschiedene Mittel wandten sie an, um den bösen Bann, der auf diesen Frauen lag, zu brechen. In Elfenbein und Horn wurden weibliche Formen als Sinnbild der Mütterlichkeit geschnitzt. Es waren mächtige Frauengestalten mit breiten Hüften, deren Unterleib sich vorwölbte, um ein kräftiges Kind zu tragen, und deren geschwellte Brüste unerschöpfliches Quellen gesunder Nahrung verhießen. An den Wänden der heiligen Grotten fanden sich diese Bilder, von Farben belebt, und die Kinderlosen verweilten dort angsterfüllt und in Tränen während der drei Vollmondnächte des Sommers. Die Männer erwarteten sie am Ausgang. Die Paare formten sich und entschwanden in der Nacht den Fluren zu.
Doch all diese Mittel, die einstmals geholfen hatten, blieben – auch dies war ein Zeichen dafür, daß die Zeiten sich geändert hatten – vergeblich. Und schon gab es Schwarzseher, die dem herrlichen Volke, das sich von seinem Stammvater, dem großen Bären, herleitete, ein baldiges Ende voraussagten. So war man mehr denn je darauf bedacht, an den festgesetzten Riten des Hochzeitsfestes nichts zu vernachlässigen und an den überlieferten Gebräuchen, die das Alter der Mädchen, die zugelassen werden durften, mit sechzehn Jahren festsetzten, nichts zu verändern.
Wohl manchen schien dieses Alter zu hoch, und sie wiesen auf die Schwierigkeit hin, die Mädchen so lange zu hüten. Hatte es sich doch schon ereignet, daß Mädchen, ohne die Hochzeit abzuwarten, Kinder bekamen. Zu anderen Zeiten, als das Volk noch stark war, hatte es dafür nur eine Strafe gegeben: den Tod für Mutter und Kind. Doch dann hatten zwei Mädchen in der vorhergehenden Generation prächtige Knaben zur Welt gebracht. Nach langen Beratungen, in denen alles erwogen wurde, beschloß man, sie leben zu lassen.
Jene, die an den alten Gebräuchen hingen, sahen in dieser Nachgiebigkeit den Grund zahllosen, neuen Unglücks. Die Furcht war nicht unbegründet, daß andere Mädchen dem Beispiele folgen würden, die Töchter des ganzen Stammes in schlechten Ruf geraten müßten, und daß im Sommer beim Hochzeitsfest die Jünglinge der anderen Stämme kein Mädchen aus dem Volke des Bären zum Weibe nehmen würden.
Die Mütter bemühten sich strenge, über ihre Töchter zu wachen. Aber die Frauen verließen ja kaum den nächsten Umkreis der Hütten, und die Arbeiten der Töchter, das Sammeln der Kräuter und Beeren, der Fischfang, das Einbringen der Tannenzapfen riefen diese oft hinaus. So wurde angeordnet, daß die Mädchen niemals einzeln, sondern stets nur in größeren Gruppen weggehen durften.
Mah und ihre Freundinnen ruhten an der Lehne eines Hügels. Während des Nachmittags hatten sie Blumen für ein Fest gesammelt, das in jedem Frühjahr zur Feier des Wiedererwachens der Natur nach langem Winter begangen wurde.
Ermüdet wanden ihre Hände Girlanden, in denen Waldrebe und Efeu einander umrankten. Eine einzelstehende Eiche auf dem Gipfel eines Hügels, ein heiliger Baum, sollte damit geschmückt werden. Alljährlich, wenn frisches Grün an ihm sprießte, kamen die Mädchen, um ihn in der Dämmerung zu bekränzen. Und während sie arbeiteten, sangen sie halblaut, als summten Bienen auf blumiger Wiese, althergebrachte Worte zu vorgeschriebenem Takt, wie der überlieferte Brauch es verlangte. Denn nur auf diese Weise schlang man mit den duftenden Fesseln geheimnisvolle Bande um all die Geister, die in Wäldern und Tälern hausten, und machte sie sich freundlich gesinnt. Es war ein Vers, der sich in wenig Takten zur Melodie entfaltete, um immer wieder zu einem eintönigen Beginn zurückzukehren. Hohe und tiefe Stimmen wechselten miteinander ab, als verfolgten sie einander, ohne ihren sehnsüchtigen Wunsch, einander zu erreichen, jemals erfüllen zu können. Dann und wann kam in unregelmäßigen Zwischenräumen und unbegründet ein rascher Übergang der Melodie und stieg wie ein Pfeil zum Himmel.
Auch in diesem Jahre zogen die Mädchen, als der Abend sank, auf den Hügel, den die heilige Eiche krönte. Es war ein uralter Baum, dessen Stamm zwar nicht allzustark, doch knotig und hart wie Stein war. Mehrfach hatte der Blitz ihn schon getroffen. Jedes Mädchen trug in seiner linken Hand einen Eichenzweig, der vom vorigen Jahr in den Hütten aufbewahrt worden war. Auf der Höhe angelangt, schichteten sie die Zweige zu einem Stoß, den sie weinend und wehklagend anzündeten. Als die Flammen erloschen waren, schritten sie zweimal im Kreise um den Baum und sangen langsam und in klagender Art ihre Verse. Dann wurden die Girlanden, die sie vorbereitet hatten, an den Zweigen befestigt, und sobald dies geschehen war, umstellten die Mädchen wieder im Kreise den Baum und machten ihm mit vor der Brust gekreuzten Armen eine Reihe tiefer Verbeugungen. Sie neigten wiederholt den Oberkörper nach rückwärts und senkten ihn wieder vor, womit die Bewegungen des Baumes nachgeahmt wurden, der vom Winde geschüttelt wird. Im Augenblick, da die Sonne sank, pflückten sie grüne Zweige vom Baume, die sie, laute Freudenschreie ausstoßend, heftig durch die Luft schwenkten. Noch zweimal, jetzt aber in fröhlichem und raschem Takt, tanzten sie, einander an den Händen fassend, um den Baum, dann verließen sie, noch immer ihre Hände festhaltend, eine fröhlich bewegte, lichte Kette, den Hügel, um in das dunkelnde Tal hinabzusteigen.
Mah, als die Jüngste, führte den Reigen. Efeu und Blumen zierten ihr Haar, um ihren schlanken Hals waren Narzissen und Veilchen geschlungen. Durch ihr halb geöffnetes Wams schimmerte die jugendliche Brust, so schwebte sie mit den geschmeidigen Beinen eines jungen Rehs, das bei jedem Schritt zu zögern scheint, ehe es das gebogene Bein auf den Boden setzt, wie die Verkörperung der grünenden Jahreszeit selbst, mit allen ihren frisch erblühten Reizen verführerisch über die Wiese.
Als sie zum Flusse kam, erblickte sie unweit vor sich den alten Häuptling Rahi, der, auf einem umgestürzten Stamme sitzend, mit einem der Weisen sprach.
Rahi blickte auf und der Schar der jungen Mädchen entgegen, die, immer noch singend, blumengeschmückt herankamen. Mah erschien ihm wie das Abbild der Jugend, die seine Sinne schon so lange vergessen hatten. Er sah sich wieder stark und geschmeidig mit behendem Fuß die Wälder durcheilend. »Ach,« seufzte er zu sich selbst, »wenn es jemand vermag, mir für kurze Zeit noch meine einstigen Kräfte zurückzugeben, so ist es nur dieses schöne, junge Mädchen.« Ein frischer Strom pochenden Blutes brauste jetzt fröhlich durch seine Adern.
Die lichten Gestalten waren entschwunden, ihr fröhliches Lied verklang in der Ferne, und Rahi dachte immer noch an Mah, an ihren zögernden Schritt, an den kleinen Kopf, der auf dem schlanken Hals sich wiegte, an die Blumen in ihrem Haar ... Langsam, schwer auf seinen Stock gestützt, schritt er seiner Hütte zu.