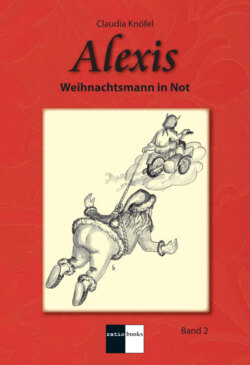Читать книгу Alexis Band 2 - Claudia Knöfel - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Geschichte von Alexis, jeder Menge Kuhmist, den Freuden und Leiden des Spielens und gaaaanz schweren Jungs
ОглавлениеMes amis, Ihre Neugier soll gestillt werden. Ich will Ihnen verraten, was ich erlebte, nachdem man im Jahre 2004 vergessen hatte, mich wieder in den Himmel zu befördern.
Knüpfen wir also just an der Stelle an, an der Sie mich auf einem Südtiroler Berghang in der Sonne sitzend verlassen haben. Wie gesagt, ich war ausgesprochen hungrig. In der Nähe erklang ein mehrstimmiges Glockengeläut. Ich folgerte daraus, wenn hier oben Kühe weideten, dann war bestimmt ein Bergbauernhof in der Nähe. Also machte ich mich auf die Suche, und schon bald hatte ich die friedlich grasende Herde gefunden. Ich erwog kurz, eine Kuh zu melken, unterließ dieses Vorhaben aber in meinem und im Interesse des Rindviehs.
Der alpine Stützpunkt des hiesigen Bergbauern erwies sich als eine etwas größere Holzhütte mit angrenzendem Stall. „Hallo, jemand daheim?“, rief ich. Aber außer dem Knurren meines Magens erhielt ich keine Antwort. Ich ging um das Haus herum und warf einen Blick in den Stall. Doch hier gackerten nur ein paar Hühner, sonst hieß mich niemand willkommen. Ich marschierte wieder zurück und stellte fest, dass die Eingangstür zur Wohnhütte nur angelehnt war. Also praktisch eine Aufforderung zum Eintreten. Die Anzahl der Räume war begrenzt. Neben einer großen Küche und zwei Schlafräumen gab es nur noch die Speisekammer. Halleluja! Endlich konnte ich mir den Bauch vollschlagen. Und welche Wonnen erwarteten mich hier! Geräucherte Schinken, die von der Decke baumelten, eine Kette aus Würsten, ein Fässchen mit frischer Rahmbutter, ein dicker Laib Käse und wunderbares Brot. Die Speisen verströmten einen allzu verlockenden Duft. Das war wahrlich der Himmel auf Erden! Bald saß ich in der Stube und pries die Südtiroler Gastfreundschaft. Köstlich, vor allem der Wein, mit dem ich die Bissen hinunterspülte. Ich wollte mir gerade noch ein Schlückchen aus der bouteille genehmigen, als ich hörte, dass ein Wagen vor der Hütte hielt. Stimmen näherten sich und die Tür ging auf. Eine junge Frau mit Kopftuch und Schürze kam herein, gefolgt von zwei Schäferhunden. Ich stand auf. „Darf ich mich vorstellen? Ich bin Alexis der Große und eigentlich ein Weihnachtsengel, den man vergessen hat, in den Himmel zurückzuschicken. Und Sie sind bestimmt die Bäuerin?“ Die Frau starrte mich an. Ihr Blick wanderte von den Brotkrümeln auf dem Tisch zu der Weinflasche und dann zu mir. Dann wandte sie sich zur Tür und rief laut: „Luuudwig, kummst ‘nauf?“
Jetzt, wo ich Mensch war, konnte ich es so oft und so laut sagen, wie ich wollte, ohne dass mir der Nikolaus die Flügel stutzte: „Merde, merde, merde!“ Das passte hundertprozentig. Denn nachdem die Dame ihren Gatten gerufen hatte, ein stämmiger Herr übrigens, mit dem ich ungern meine Kräfte gemessen hätte, forderte dieser umgehend die Bezahlung des üppigen Mahls, das ich genossen hatte. Ich war nicht gewillt, meinen bescheidenen Bestand an Bargeld herauszurücken, und so beschloss die Familie einstimmig – mittlerweile waren noch zwei Schulbuben und ein greiser Herr ohne Zähne angerückt – dass ich mir mein Essen verdienen sollte.
So kam es, dass ich eine Betätigung verrichten durfte, deren Arbeitsablauf ich nur zu gut kannte: Stallausmisten. Nur, dass es sich hier nicht um himmlische Rentierexkremente handelte, sondern um weitaus intensiver duftenden Kuhmist. Und das unter der scharfen Bewachung des zahnlosen Alten, der auf einer Bank vor dem Kuhstall saß und eine Mistgabel im Anschlag hielt. Da ich nicht die geringste Lust hatte, den schönen Tag in dieser stinkenden Umgebung zu vergeuden, griff ich zu einer List. Ich ließ die Forke fallen und legte in einer dramatischen Geste die Hand auf mein Herz. Dann sank ich röchelnd zu Boden. Der Greis kam in den Stall, besah sich die Lage – und ging zur Stallwand, wo Eimer standen. Alsdann goss er mir einen Kübel eiskalten Wassers ins Gesicht. Das reichte! Ich sprang auf, packte den Greis und hob ihn über die Absperrung in die Futterrinne. Dann gab ich Fersengeld und rannte, von den bellenden Hunden gefolgt, davon. Als ich endlich im Tal angekommen war, sah ich reichlich lädiert aus. Die Kleidung war zerrissen und schmutzig. Überall an meinem Körper fühlte ich Stacheln. Denn die einzige Möglichkeit, die ich gesehen hatte, den geifernden Bestien zu entkommen, war die, in ein Brombeergestrüpp zu hechten. Ich war völlig fertig.
Soviel sportlichen Ehrgeiz hatte ich nicht mehr entwickelt, seitdem der Graf d‘Anjou mich im Jahre 1640 in flagranti bei seiner Gattin entdeckt hatte. Damals flüchtete ich über den Balkon der Pariser Stadtvilla, der vier Stockwerke über der Rue de Bourbon lag. Ein nervenaufreibendes Unterfangen, wie ich Ihnen versichere. Denn während ich mich zur winterlichen Mittagsstunde völlig bar jeder Kleidung an den Vorsprüngen des Gebäudes entlanghangelte und die Schwindel erregende Aussicht genoss, sann über mir der gekränkte Graf mit einer Muskete ballernd auf Rache. Wie durch ein Wunder erreichte ich den Boden zwar körperlich einigermaßen intakt, aber mittlerweile hatte sich eine Menschenmenge gebildet, die sich in zwei Fraktionen spaltete: einmal in die, die mich bei meiner Klettertour anfeuerte, und eine andere, die den düpierten Graf lauthals unterstützte. Und, wie gesagt, ich war völlig nackt. Ich erinnere mich, dass ich mir von einem Karren eine überaus schmutzige Decke griff, die ich hastig um mich schlang, bevor ich mich eilenden Schrittes entfernte, verfolgt von rohem Gelächter.
Doch zurück zu meinem heutigen Abenteuer. Mehr tot als lebendig erreichte ich schließlich ein kleines Dorf. Zu meiner Freude bemerkte ich, dass an den Straßen Säcke mit Altkleidern standen. Schnell waren eine passable Jeans und ein Pullover gewählt und dann ging ich in eine kleine Kirche, in der ich meine neuen Kleidungsstücke anprobierte. Sie passten perfekt. Anschließend marschierte ich zur Hauptstraße, wo ich nach Sitte der Tramper den Daumen ausstreckte und so auf einen gütigen Autofahrer hoffte, der mich mitnahm.
Sechs Monate später saß ich im traditionsreichen Spielkasino von Monaco, vor mir lag ein ansehnliches Häuflein Jetons. „Rien ne va plus!“, rief der Croupier. Die Kugel rollte. Dann ein Klackern. „Neuf!“ Mein amerikanischer Tischnachbar atmete zischend aus. Mit zitternden Händen holte er seine Geldbörse aus der Hosentasche und warf dem Croupier mit vorgetäuschter Lässigkeit ein paar Dollarscheine über den Tisch. Viel war es nicht, was er gegen das bunte Plastikgeld eintauschte. Der Mann hatte wirklich eine ausgesprochene Pechsträhne. Ich dagegen hatte Glück. Nein, das war es eigentlich nicht. Es war Können. Ich beherrschte ein bestimmtes System für das Roulette bis zur Perfektion, jedenfalls schien das so. Max, der hinter mir stand, flüsterte mir diskret ins Ohr: „Monsieur le Baron, Sie sollten das Spiel beenden. Die Direktion ist ausgesprochen misstrauisch!“ Das stimmte. Zwei unauffällige Männer in dunklen Anzügen, wahrscheinlich Security-Leute, hatten sich auf die mir gegenüberliegende Seite gestellt und beobachteten die Vorgänge am Tisch. Die Situation wurde langsam brenzlig. Ich beschloss, die „Glückssträhne“ zu unterbrechen, und setzte fünfhundert Euro auf die Dreißig. Der Croupier warf die Kugel in den Kessel. „Rien ne va plus!“ Und dann : „Zero!“ Der Amerikaner neben mir stöhnte, schnappte sich den verbliebenen Jeton und stand auf. Sofort war der Platz wieder besetzt. „Sie sollten noch drei, vier Mal setzen und dann versuchen zu verschwinden. Ich lenke von Ihnen ab!“ Wenn Max das sagte, dann konnte ich mich darauf verlassen, dass es so die beste Lösung war. Auch wenn mir die Entscheidung nicht leicht fiel, ich beschloss, in den nächsten Minuten achtzig Prozent meines Plastikgeldes zu verlieren.
Ich vertraute Max bedingungslos. Er war mein Ratgeber, mein Kammerdiener, Finanzminister und Privatsekretär. Nebenbei war er auch Mathematik-Professor und hatte sich dieses geniale Roulette-System ausgerechnet, mit dem es möglich war, jede Spielbank zu knacken.
Damals, an jenem Frühlingstag in den Südtiroler Alpen, hatte ich ihn kennengelernt. Nachdem ich mich neu eingekleidet hatte, war ich nach Meran getrampt. Zunächst nährte ich noch die Hoffnung, ich würde meine himmlischen compagnons unterwegs treffen. Doch je weiter sich der Tag seinem Ende zuneigte, desto mehr wuchs in mir die Gewissheit, dass ich meine Freunde so schnell nicht wiedersehen würde. Mein Magen war mittlerweile wieder ziemlich leer. Also beschloss ich, das mir verbliebene Startkapital von 1,20 EUR gewinnbringend einzusetzen, organisierte mir in einer Eisdiele drei Pappbecher und eine Kaffeebohne und verschwand zum Training in einen Hinterhof.
Als meine Finger wieder die Geschmeidigkeit früherer Jahrhunderte erreicht hatten, setzte ich mich in die Fußgängerzone, um die Passanten zum „Hütchen-Spiel“ einzuladen. Damit hatte ich bereits zu Richelieus Zeiten neben einigen anderen „Fingerfertigkeiten“ meinen Lebensunterhalt finanziert. Und auch diesmal merkte ich: Die Idioten sterben nicht aus. In kürzester Zeit hatte sich ein ansehnliches Häuflein Münzen vor mir angesammelt. Sie kennen sicher das Spiel: Unter einem der „Hütchen“, also in diesem Fall einem Becher, liegt die Kaffeebohne, der „Bankhalter“ vertauscht sehr rasch die Behältnisse, und der Herausforderer muss raten, unter welchem die Bohne liegt. Das sieht alles sehr einfach und einleuchtend aus, aber es ist ein Trick dabei, den ich natürlich nicht verraten werde, denn der Bankhalter gewinnt zu 99,99%, weshalb das Spiel auch in einigen Ländern verboten ist. Aber wie gesagt, das Interesse der Passanten war groß. Während ich gekonnt mit den Pappbechern jonglierte, beobachtete ich aus den Augenwinkeln einen heruntergekommenen Herrn mittleren Alters, der seinerseits meine Darbietung interessiert verfolgte. Ich war leicht beunruhigt. Was wollte der Typ von mir?
Mittlerweile war es Abend geworden, und so packte ich mein Zeug zusammen. Ich beschloss, mir endlich von meinem Gewinn eine Pizza und eine Flasche Chianti zu gönnen. „Ein Spiel noch?“, hörte ich plötzlich neben mir eine Stimme. Ich blickte auf und erkannte den Mann, der mich seit Stunden beobachtet hatte. Ein Polizist in Zivil? „Okay. Fünfzig Cent ist der Einsatz“, hörte ich mich sagen. Der Mann nickte. „Ich weiß.“ Also packte ich die Becher wieder aus. Um es kurz zu machen: In der nächsten halben Stunde verlor ich meine gesamte Tageseinnahme an den Fremden. Die Pizza entschwand in weiter Ferne. „Was halten Sie von einem guten Abendessen?“, fragte mein Herausforderer. „Scherzkeks!“, schnaubte ich verächtlich. Der Mann grinste. „Sie sind natürlich mein Gast!“
Und so kam es, dass ich im „Palace Merano“ Hühnchen mit Morcheln, frische Austern, eine Trüffelpastete und eine wunderbare Himbeercreme verdrückte. Zwar saßen wir nicht im eleganten Speisesaal, sondern im Mitarbeiterraum, was den Gaumengenuss aber nicht im Geringsten beeinträchtigte. Als ein Kellner, der ein Freund meines Gastgebers zu sein schien, eine Flasche Calvados vor uns hinstellte (vorzüglich übrigens!), erzählte mein Gastgeber seine Geschichte.
Er hieß Max Bauchleitner und kam aus Nürnberg. Schon in der Schule zeichnete sich sein mathematisches Genie ab und so wunderte es niemanden, dass er später Mathematik studierte, promovierte – und schließlich habilitierte. Er hätte das ordentliche und geachtete Leben eines Wissenschaftlers von Bedeutung führen können – er hatte bereits einige Auszeichnungen erhalten – aber er verspürte eine unbestimmte Lust nach Freiheit und Abenteuer. Das Leben, das er führte, erschien ihm trotz seiner beruflichen Anerkennung langweilig. Der Wendepunkt kam eines Tages, als er mit seiner Frau das Spielcasino in Baden-Baden besuchte. Er spielte nicht – er beobachtete nur. Sein Interesse galt dem Roulette. Nach welcher Gesetzmäßigkeit fiel die Kugel? Gab es ein System, mit dem man den Kessel überlisten konnte? Der Gedanke ließ ihn nicht mehr los. Und so kam es, dass er von diesem Tag an regelmäßig ins Casino ging, sich Notizen machte und die Szenerie auf das Genaueste beobachtete.
Mit der Zeit entwickelte er ein System, mit dem er beim Roulette todsicher jedes Spiel gewann. Da seine Frau wenig Verständnis für sein Hobby aufbrachte, verließ er schließlich seine Familie und zog durch die Lande. Endlich Freiheit und Abenteuer.
Der Professor und ich verstanden uns auf Anhieb und so war es kein Wunder, dass wir beschlossen, zunächst gemeinsam ein wenig von der Welt zu sehen. Ich erklärte ihm aber, dass für mich ein Leben auf der Straße nicht in Frage kam. Ein wenig Luxus sollte schon sein, schließlich hatte ich mir das nach all den arbeitsreichen Jahrhunderten im Weihnachtshimmel schon verdient. Übrigens hatte ich dem Professor die Wahrheit über mich erzählt, gewann aber den Eindruck, dass er mir nicht so recht glaubte. Ich denke, er stufte mich als entsprungenen Insassen einer Nervenklinik ein: vielleicht ein wenig seltsam, aber sonst okay.
Da Max Bauchleitner bereits mehrere Casinos in Europa um ihren wohlverdienten Gewinn gebracht hatte und in diesen Häusern deshalb gesperrt war, beschlossen wir, dass er mich als mein Kammerdiener begleiten sollte. Natürlich hatte ich neue Papiere bei meinem alten Kumpel Salvatore Rossi für ihn besorgt. Ich nahm den Namen „Eric de Rothschild“ an, den Professor nannte ich schlicht „Max“. Und so trampten wir zunächst nach Lugano, wo wir uns im Spielcasino ein wenig einarbeiteten. Ich saß am Roulettetisch, Max stand hinter mir und gab mir diskrete Anweisungen. Es klappte vorzüglich. Innerhalb eines Abend hatten wir dreißigtausend Fränklis erspielt und mieteten uns in der „Villa Castagnola“ ein, einer recht feudalen Herberge. Endlich konnte ich das Leben in vollen Zügen genießen! Tagsüber faulenzten wir, badeten im Pool, mieteten uns eine Yacht und ließen uns von hübschen Damen massieren. Das war überhaupt ein nicht zu unterschätzender Vorteil des Mensch-Seins, den ich im Himmel schon fast vergessen hatte: Ich konnte wieder unverbindliche, aber dafür durchaus befriedigende Kontakte zur Damenwelt pflegen. Abends erleichterten wir die Spielbank in der Regel um zehn- bis zwanzigtausend Franken. Immer nur kleine Gewinne einstreichen und das auch nicht jeden Abend, sonst würde die Spielleitung auf uns aufmerksam, verriet mir Max. Wir teilten die Gewinne. Das, was von meinem Anteil übrig blieb, spendete ich an Schulen, Kindergärten und Altenheime. Einmal Weihnachtsengel – immer Weihnachtsengel. Max schickte regelmäßig Geld nach Hause, schließlich wartete seine Ex-Frau auf ihren Unterhalt.
Nach drei Wochen hatten wir genug von der Schweiz. Also fuhren wir zunächst in meine Heimatstadt Paris und dann an die französische Riviera. In Monaco quartierten wir uns im „Hotel de Paris“ ein. Nach einem vorzüglichen Abendessen in der Altstadt begaben wir uns ins Casino, wo dann die oben erwähnte Situation eintrat: Wir fühlten uns beobachtet. Während Max rief: „Man hat mich bestohlen! Hilfe, Diebe!“, und eine leichte Panik ausbrach, verschwand ich im Gedränge, allerdings nicht ohne vorher meine Chips an der Kasse in Bargeld umgetauscht zu haben. Zum Glück war die Security nun anderweitig beschäftigt und man ließ mich in Ruhe ziehen. Max kam zwei Stunden später ins Hotel. Gespannt zählten wir unseren Reichtum: fast einhundertfünfzigtausend Euro! Wir teilten redlich und am nächsten Morgen machte ich mich auf, um einen Großteil des Geldes zu spenden. Nur – wir waren in Monaco, dem Staat, der die Super-Hyper-Milliardäre aus aller Welt geradezu magisch anzog. Und den paar eingeborenen Monegassen schien es auch nicht allzu schlecht zu gehen. Wem wollte ich da finanzielle Unterstützung angedeihen lassen? Ich entschloss mich also, das Geld in Frankreich zu verteilen und bestieg zu diesem Zweck den Autobus, der mich ins französische Hinterland bringen sollte.
In einem kleinen Kaff verließ ich den Bus. Ich wollte die Straße überqueren und übersah leider den mit Karacho von links ankommenden Ferrari. Ein Missgeschick mit Folgen. Und dann durchlebte ich auf der staubigen Straße in Saint-André-de-la-Roche ein déjà-vu: Meine Seele schwebte über meinem leblosen Körper. Ich sah den Notarzt inmitten einer Menschenmenge, der sich vergeblich bemühte, mich wieder ins Leben zurückzuholen.
Tja, so endete also mein zweites kurzes Leben auf Erden. Also würde ich wieder als Weihnachtsengel arbeiten und mich mit dem Chef rumschlagen, dachte ich, als ich von einem Sog erfasst wurde. „Jungs, ich bin gleich wieder bei Euch!“, rief ich nach oben. Aber noch während ich meinen Kumpels im Himmel diese Mitteilung machte, saugte mich eine geheimnisvolle Kraft unter die Erde.
Ich fiel und fiel. Nachtschwärze um mich herum. Im Fallen drehte ich mich um meine eigene Achse. Und obwohl ich meinen Magen auf der Straße in Saint-André-de-la-Roche zurückgelassen hatte, wurde mir so schlecht, als hätte ich vergammelte Austern gegessen. „Hiiiiilfeeee!!!!!“ Nur das Echo meiner Stimme war zu hören, weit, weit unter mir. Ich fiel weiter. Adieu, Welt, adieu, mes amis, dachte ich nur und schloss die Augen.
RRRRUMMMMS. Ich war gelandet, und zwar ziemlich unsanft. Es war heiß. Ich öffnete zögerlich die Augen, und sah einzelne Feuer in einer Steinwüste lodern. Ein fauliger Geruch lag in der Luft. War das etwa die Hölle? Ich stand auf. Obwohl ich natürlich auch meine Knochen auf dem Asphalt zurückgelassen hatte, schmerzte mich mein Skelett. Ich rieb mir das Hinterteil und humpelte vorwärts.
Eine Ewigkeit, so schien es, war ich unterwegs. Ab und zu rief ich laut in die Wüste hinein, erhielt jedoch keine Antwort. Ich war erschöpft und der beißende Rauch nahm mir zunehmend die Sicht. Nur einen Moment ausruhen, dachte ich und legte mich auf einen Fels. Schon war ich eingeschlafen.
„Hey, guy, come on!“ Irgendjemand rüttelte unsanft an mir. Was für ein kurioser Traum, dachte ich – und sprang im nächsten Moment vom Fels. Mes amis, ich bin gewiss nicht schreckhaft, aber dem Kerl, der mich geweckt hatte, hatte man anscheinend glatt das rechte Auge herausgeschossen. Ich sah durch das Loch im Kopf die Feuer in der Wüste lodern. Der Typ sah aus wie ein Monster aus einem Horrorfilm. Auf seinem Kopf blinkten rote Hörner. War es da ein Wunder, dass ich Fersengeld gab? Aber ich kam nicht weit. Ein älterer Mann hatte sich mir in den Weg gestellt. „Wohin so eilig, mein Kleiner?“ – „Was wollen Sie von mir und wer sind Sie überhaupt?“ – „Ich will deine Seele!“, sagte der Mann. „Darf ich mich vorstellen, ich bin Meyer Lansky und der da“, er deutete auf den Einäugigen, „ist Benjamin Siegel. Vielleicht hast du schon von uns gehört?“, und blickte mich fragend an. Klar hatte ich von den Jungs gehört. Auch auf Meyer Lanskys Kopf blinkten Hörner und das konnte nur eines bedeuten: Ich war nicht im Himmel gelandet. Ich sah den Hohläugigen an. Der war mir bekannt, allerdings nicht unter seinem Taufnamen Benjamin. „Bugsy1, wie?“, bemerkte ich – und schon krachte seine Faust in mein Gesicht. „Nenn mich nicht Bugsy, kapiert?“ – „Schon gut, schon gut. Wo geht ihr mit mir hin?“ Ich raffte mich mühsam auf und die beiden zerrten mich durch die Steinwüste. „Wir sind da!“, sagte Lansky und wies auf ein riesiges massives Eisentor, das vor uns im Rauchnebel aufragte. Vorsichtig tastete er an der Oberfläche herum, und das Portal öffnete sich langsam mit einem abscheulichen Quietschen. „Willkommen in der Hölle!“, sagte Siegel, und stieß mich vorwärts. Das, was ich sah, war unglaublich. Ich befand mich in einem waschechten Casino! Spielautomaten über Spielautomaten standen hier in einem lichterlohen Feuer, und diese waren wiederum umringt von Seelen. Die meisten von ihnen befanden sich allerdings kurz vor ihrer Auflösung und waren kaum noch zu erkennen. Wahrscheinlich litten sie an Seelenrheuma. Ein grauenvolles, qualvolles Stöhnen überlagerte die Atmosphäre und es stank nach Schwefel. „Das ist die Spielhölle, quasi das Foyer zum Fegefeuer“, klärte mich Meyer Lansky auf. „Eine relativ neue Erfindung, erst fünfzig Jahre alt. Hier stehen die Einarmigen Banditen, weiter hinten die Roulette-, Black-Jack- und Poker-Tische.“ – „Um welchen Einsatz wird gespielt?“, wollte ich wissen. „Um was wohl? Um die Seele natürlich!“ Und Siegel schob mich durch die Massen der Seelen vorwärts. „Wie funktioniert das genau?“ – „Jeder, der hierhin gelangt, erhält einen Gegenwert an Jetons für seine Seele. Der schwankt, es kommt drauf an, ob man ein Mensch mit geringen Verfehlungen oder ein großer Gangster war. Je mehr Verbrechen, desto weniger Jetons. Die Guten sollen schließlich in den Himmel kommen und deshalb mehr Chancen auf einen Gewinn haben.“ Was Lansky mir da erzählte, klang doch eigentlich ganz fair. Warum hatte der Krummziebel Josef immer vor den listigen Teufeln gewarnt? „Und wie oft passiert es, dass eine Seele in den Himmel kommt?“ – „Nie, das ist ja der Witz an der Sache. Die Bank gewinnt immer. Aber mit jedem Chip geben wir auch ein Stück Hoffnung mit, ist das nicht wunderbar?“ Bugsy brüllte vor Lachen, und schlug sich auf die Schenkel. „Ein einziges Mal hat hier einer beim Poker gewonnen. So ein Österreicher“, widersprach ihm Lansky. Klar, der Krummziebel Josef hatte dieses Kunststück vollbracht. „Und was passiert, wenn man verliert?“, wollte ich wissen. Lansky kratzte sich an den Hörnern. „Naja, das ist unterschiedlich. Manche Seelen lösen sich ganz auf, von manchen bleibt ein Rest übrig, der dann ins Fegefeuer geschickt wird. Das sind dann meistens die mit einer besonders kriminellen Vergangenheit, oder auch totalitäre Herrscherseelen. Im Fegefeuer wird dann der Rest der Psyche bearbeitet und die Ausbildung zum Teufel beginnt.“
Von hinten drängelte sich eine Seele an uns heran. „Ben, es gibt Ärger. Hinten, an Tisch 87009 sitzt doch tatsächlich ein Typ mit einer Glückssträhne!“ Sofort machte sich Siegel auf, um den Ruf des Casinos zu retten. Meyer Lansky führte mich weiter durch die Spielhölle.
Die beiden Herren, die mich aus der Wüste in das höllische Spielerparadies geführt hatten, waren waschechte Mafiosi. Sicherlich haben Sie auch schon von ihnen gehört.
Benjamin Siegel war zu Lebzeiten ein extrovertierter Gangster und Playboy gewesen. Stets mit Pomade im Haar und maßgefertigten Anzügen hatte er viele Menschen auf dem Gewissen, die sich nicht den starren kriminellen Prinzipien der amerikanischen Mafia unterordnen wollten. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg schickte ihn sein Oberboss nach Las Vegas, wo die organisierte Kriminalität ein Spielcasino nach dem anderen eröffnete. Hier, mitten in der Wüste, sollte das genialste Spielerparadies aller Zeiten entstehen und die Mafia sich eine goldene Nase verdienen. Die Chefetage beauftragte Siegel damit, den Bau des legendären Clubs „Flamingo“ zu beaufsichtigen, was er mit Unterstützung seiner damaligen Geliebten Virginia Hill auch tat. Am 26. Dezember 1946 fand die Einweihung des Casinos statt. Ein grandioser Flop. Denn das „Flamingo“ hatte am Tag seiner Eröffnung das Pech, dass die meisten seiner Spieler mit dicken Gewinnen in der Tasche viel zu früh nach Hause gingen. Das Hotel, das dem Club angeschlossen werden sollte, befand sich zu diesem Zeitpunkt noch im Bau, was den finanziellen Erfolg der Unternehmung stark beeinträchtigte. Denn die männlichen Gäste pflegten damals ihre Gattinnen zu einer geziemenden Uhrzeit ins Bett zu schicken, während sie selbst noch ein Ründchen zu spielen pflegten, um so ihre Gewinne in der Regel wieder der Spielbank zu überlassen. Hätten genügend Betten zur Verfügung gestanden, wer weiß, vielleicht wäre alles anders gekommen. Aber erst mal schloss der Club im Januar 1947 seine Pforten. Mit diesem geschäftlichen Misserfolg wurde quasi auch „Bugsy“ Siegels Schicksal besiegelt: Im Juni 1947 entdeckte man ihn blutüberströmt und mausetot auf dem Sofa seiner Freundin. Sein rechtes Auge lag fünf Meter entfernt auf dem Fußboden. Das Foto des toten Gangsters war damals um die Welt gegangen. Ich hatte die Vorgänge von meiner Wolke aus ein wenig verfolgt. Der spektakuläre Mord hatte auch bei uns im Himmel für reichlich Gesprächsstoff gesorgt.
Meyer Lansky war ein anderer Typ. Der schmächtige ältere Mann im abgetragenen Anzug war der Oberbuchhalter und Chefbankier der Mafia gewesen, ein wahres Finanzgenie, das die Millionen nur so scheffelte. Äußerlich unauffällig, aber unglaublich intelligent. Soweit ich mich erinnere, war es niemals gelungen, ihm einen Mord nachzuweisen. Wenngleich ihm der amerikanische Staat Anfang der Fünfziger Jahre einige Monate freie Kost und Logis in einem Staatsgefängnis gewährt hatte, dieses allerdings aufgrund einer Anklage wegen konspirativer Geschäfte und illegalen Glücksspiels. Weiter wusste ich nur, dass der kleine Jude irgendwann nach Israel ausgewandert war, wo er 1983 starb.
Im Gefolge Lanskys schob ich mich weiter durch die Ansammlung von Seelen. Es war ein furchtbarer Anblick, diese gequälten Gesichter, die jedes Mal ein Stöhnen von sich gaben, wenn die Bank mal wieder gewonnen hatte, die Hoffnung schwand und das Antlitz wieder ein Stück verblasste. Alles Negative der Welt schien sich in diesen Seelen zu spiegeln, nirgends war ein Lachen zu hören. Wie herrlich war dagegen doch der Weihnachtshimmel! Gut, der Chef war stets ein unkalkulierbarer Stressfaktor gewesen, aber sonst …
Und ich beschloss, dass ich der zweite Teufelsanwärter sein würde, der in den Himmel gelangen sollte. Ich wollte wieder Alexis, der Weihnachtsengel sein und mit meinem Freund Josef Krummziebel in der gemütlichen Backstube bei Marillenknödeln philosophieren. Ich wollte Bescherungslisten aufstellen, Weihnachtsgeschenke verteilen und die Rentierställe ausmisten. Ich wollte sogar freiwillig die Himmelstreppe putzen und dem Nikolaus nie mehr Probleme bereiten. Ich wollte ein Schleimer werden und jede Anweisung des Chefs auf das Penibelste befolgen. Das Heimweh packte mich. Ich wollte hier raus!!! Ich hatte den Höllenkoller!!!!!!!!
Lansky blicke sich um. „Kleiner, hast Du den Höllenkoller? Das vergeht. Spätestens dann, wenn man dich im Fegefeuer aufnimmt und du ein echter Teufel wirst.“ Er wies auf einen Glaskasten inmitten des Casinos, in dem harte Jungs mit gebrochenen Nasenbeinen und Teufelshörnern um einen Tisch saßen und dicke Zigarren rauchten. „Das sind die Bosse der Bosse. Lucky Luciano, Sam Giancana und Al Capone, ein älteres Semester. Ich gehöre, in aller Bescheidenheit, auch dazu. Ich bin der Finanzchef. Wir Amis haben Glück, dass die Leitung derzeit in unserer Hand ist. Das war nicht immer so. Vor zehn Jahren waren es die Russen, später die Rumänen, die sich die Chefetage erkämpft hatten. Aber wir haben sie schließlich zurückerobert!“ Mit welchen Mitteln, danach wagte ich nicht zu fragen.
Mittlerweile waren wir bei dem Roulettetisch 87009 angelangt. Da saß, Moment, den kannte ich doch, richtig: „The Voice“, Frank Sinatra höchstpersönlich, und beriet einen Spieler. „Das haben wir damals auch schon so gemacht: Wenn ein Spieler in Vegas in einem Club kräftig gewonnen hatte, holten wir Frank. Der schmeichelte dem Gewinner so sehr, dass er erneut ein paar Runden spielte, allerdings mit weniger Konzentration. Der Gewinn fiel dann wieder an die Bank“, erklärte Lansky. Dass Sinatra und andere Hollywood-Größen damals im Showgeschäft kriminelle Verbindungen pflegten, davon hatte ich schon gehört.
Plötzlich stand Benjamin Siegel wieder neben mir. „Come on, boy, versuch es. Macht doch Spaß!” Und er schlug mir auf die Schulter. Seufzend folgte ich seinem Rat und ging mit ihm und Lansky zur Kasse. Zu meiner Überraschung bekam ich ein ganz ansehnliches Häuflein Jetons.
„Was wirst du spielen?“ – „Roulette, denke ich.“ Lansky nickte und führte mich durch das Gedränge an einen Tisch. Ich war, zugegebenermaßen, wahnsinnig nervös. Max hatte mir zwar einige Tricks beigebracht, aber würde das reichen? Ich packte einen grünen Jeton und setzte ihn auf die 34.
Stunden später. Ich hatte mich wacker geschlagen und nur wenig verloren. Ich fühlte mich aber ein wenig müde. Die Stimmen um mich herum drangen wie durch Watte an mein Ohr, meine Konzentration ließ merklich nach. Nach dem System meines Freundes Max hätte ich jetzt die 22 setzen müssen, oder war es die 26? Ich setzte auf die 26 und die Kugel blieb auf der 22 liegen. Vier Jetons fielen an die Bank, und ich war auf einmal soooo müüüde …
Laßt mich schlafen, bitte, bitte, lasst mich schlafen …
„Alexis, reiß dich zusammen. Spiele jetzt zwei Mal hintereinander Rot, dann die Neun!“ Ich träumte, Max stünde hinter mir und gäbe mir Anweisungen. Ach ja, Lugano war schön … Ich seufzte.
Jemand boxte mich in den Rücken. „Aufwachen, Alexis, spiele Rot!“ Also gut. Mit letzter Kraft schob ich drei Jetons auf das rote Feld. Sie gewannen und mein Einsatz wurde verdoppelt. Sofort fühlte ich mich ein wenig besser. Ich spielte noch einmal Rot, und dann die Neun. Mit jedem Gewinn stieg meine Konzentration. „Setze auf die 12!“ Ich drehte mich kurz um. Hinter mir stand – Max. „Was tust du hier?“ – „Später. Wir haben jetzt keine Zeit. Spiele um deine Seele.“
Ich spielte – und gewann. Und gewann. Und gewann. Mittlerweile hatten sich die Mafiosi aus dem Glaskasten um unseren Tisch versammelt. Frank Sinatra stellte sich neben mich und sang „My way!“ Ich fand diese musikalische Untermalung ganz nett, ließ mich aber nicht ablenken. Dass ich endgültig gewonnen hatte, merkte ich, als Bugsy einen seiner berüchtigten Wutanfälle bekam und in die Tischplatte biss. Die teuflischen Gangster heulten wie die Wölfe. Zum zweiten Mal hatte jemand seine Seele in den Himmel gerettet.
Man ließ mich ungehindert ziehen. Damit hatte ich eigentlich nicht gerechnet, aber wahrscheinlich versprachen sich die Teufel von meiner weiteren Anwesenheit in der Hölle nichts als Komplikationen. Mit dieser Annahme hätten sie durchaus richtig gelegen.
Auf meinem Weg nach draußen gelang es mir, einige Worte mit Max zu wechseln. „Ich bin schwimmen gegangen, habe einen Herzinfarkt bekommen und das war’s dann“, erzählte er mir. Ich war gerührt. „Max, du bist ein echter Freund. Ich hatte solches Heimweh! Ich wünsche mir, dass du auch zu uns kommst. Im Prinzip ist der Weihnachtshimmel nämlich eine prima Erfindung.“ Endlich waren wir vor dem großen Eisentor angelangt, das sich langsam öffnete. Ich drückte dem Professor beide Hände. „Komm bald nach, hörst du? Wenn du mich nicht gleich findest, geh in die Backstube zum Krummziebel Josef und warte dort auf mich. Ich schaue regelmäßig da vorbei.“ Max nickte, ebenfalls sichtlich gerührt. „Nun hau schon ab. Ehe sie sich es wieder anders überlegen.“ Er klopfte mir kurz auf die Schulter – und dann stand ich wieder in der Steinwüste, während sich das Tor hinter mir schloss. In der Ferne ragte die Treppe zum Himmel auf. Abermillionen Stufen – und kein Aufzug. Na ja, ein wenig Fitness konnte schließlich nicht schaden.
Und so marschierte ich tapfer Stufe für Stufe meinem Ziel entgegen. Ich war tagelang unterwegs, aber froh, dem Abenteuer in der Spielhölle entronnen zu sein. In der Gaststätte „Zum Fegefeuer“ traf ich Klaus-Dieter, einen Bekannten von mir. „Gottchen, was haben die einen Aufstand um dich gemacht, als du plötzlich verschwunden warst“, berichtete er mir. „Und wer ist dafür verantwortlich, dass der Sog mich nicht nach oben gezogen hat?“, wollte ich wissen. Klaus-Dieter war so ziemlich die größte Klatschbase im Weihnachtshimmel, aber sonst ganz nett und hilfsbereit. „Wie man hört, wohl dein Busenfreund Richard. Aber das weiß ich auch nur inoffiziell. Stell dir vor, der Nikolaus will Richard in die Hölle verbannen! Dabei hat er so ein knackiges Popöchen! Richard, meine ich, nicht der Chef!“ Sieh an, Richard, die alte canaille. Ich hätte es mir denken können. „Bist du mit deiner Wolke hier?“, fragte ich ihn. Er nickte. „Ja. Soll ich dich mitnehmen?“
Ich streckte mich lang auf der watteweichen rosafarbenen Wolke aus, auf der Klaus-Dieter zu reisen pflegte. Welche Labsal nach all den Strapazen! Ich war völlig zerschlagen, aber glücklich, wieder zu Hause zu sein. „Den wievielten haben wir heute eigentlich?“, fragte ich Klaus-Dieter. „Den 22. Dezember“, entgegnete dieser. Himmel, Weihnachten stand vor der Tür! Ich musste die Bescherungslisten holen und meinen Schlitten laden! Aber das hatte noch fünf Minuten Zeit. „Wo soll ich dich hinfliegen?“ – „In die Backstube.“
Zimtgeruch lag in der Luft. Und Vanille. Und Rumaroma. Welch eine Wohltat nach dem Schwefelgestank, den ich immer noch in der Nase hatte! Hier oben herrschte geschäftiges Treiben. Der Krummziebel Josef stach sorgfältig Plätzchen aus.
„Hallo, Josef!“ Der Backstubenchef sah kurz auf. „I hab scho g´moant, du kimmst nimma!“ – „Ich auch, mon ami, ich auch.“, seufzte ich, während ich meinen Finger in eine riesige Schüssel mit Makronenteig tauchte und genussvoll abschleckte. „Magst a Kuch’n?“ – „Welche Frage! Wie wär´s mit einer Sachertorte?“ In der nächsten halben Stunde verdrückte ich drei Torten und einen Hektoliter Kakao mit Schlagsahne, während ich dem Krummziebel Josef mein Abenteuer schilderte. Der nickte ab und zu und kommentierte mit knappen Worten meine Erzählung, während er im Akkord präzise geformte Kekse auf die Backbleche legte. Von all den Mafia-Größen war ihm nur Al Capone persönlich bekannt, hatte er doch einst mit ihm am Pokertisch gespielt.
Langsam erholte sich meine geschundene Seele und es wurde Zeit aufzubrechen. „Josef, die Arbeit wartet. Man sieht sich!“ Der Chefpâtissier gab mir noch ein paar Zimtsterne mit auf den Weg, dann machte ich mich auf die Socken in die Weihnachtsgeschenkeverteilungshauptstelle (WGVHS).
Ich fühlte, wie mir langsam wieder Flügel wuchsen. Engelsflügel sind äußerst hitzeempfindliche Körperteile. Bei meinem Besuch in der Hölle waren sie geschmolzen. Das tat zwar nicht weiter weh, aber im Moment konnte ich natürlich nicht fliegen. Das würde wohl noch einige Zeit dauern. Zunächst war ich noch auf ein anderes Transportmittel angewiesen. Ich sprang also auf eine kleine Kumuluswolke und flog ins Geschenkeverteilungszentrum. Diese Geschäftigkeit überall! Und lauter friedliche Engel mit Flügeln! Und diese Harfenmusik, wie hatte ich sie vermisst!
Man nahm kaum Notiz von mir, während ich mir meinen Weg vorbei an Paketbergen, Schlitten und ungeduldig mit den Hufen scharrenden Rentieren bahnte. Auf riesigen Lebkuchentafeln standen in Zuckergussschrift die Namen der Weihnachtsengel und ihrer Distrikte. „Bruxelles – George“, „Liége – Albert“, „Aachen Zentrum – Kaiser Karl“, und dann, endlich „Rheinland – Giuseppe“. Giuseppe? Wieso Giuseppe? Das war mein Zustellbezirk. Überhaupt – dieser Italiener hatte mir die Suppe eingebrockt. Wäre er nicht gewesen, die ganzen Strapazen in der Hölle wären mir erspart geblieben! Und jetzt nahm er mir auch noch den Job weg! Der Winzer, der mein Kommen nicht bemerkt hatte, lud sorgfältig die Pakete auf den Schlitten. Ich ging auf ihn zu und packte ihn an der Kehle. „Zieh Leine, Freundchen. Das ist mein Bezirk!!“ Der Italiener war sichtlich überrascht mich zu sehen. „Alexis!“, krächzte er, „aber das ist doch ein Missverständnis. Ich helfe dir doch nur! Sieh, was auf der Tafel steht!“ Ich besah mir die Lebkuchenplatte näher. Richtig, hinter „Giuseppe“, stand ein kleines „i.V.“ Aber so klein geschrieben! Da brauchte man glatt eine Brille. „Na, mein Sohn? Wieder im Himmel?“ Ohne, dass ich ihn bemerkt hatte, war der Nikolaus herangeflogen. Nachdenklich wanderte sein Blick zwischen dem immer noch geröteten Gesicht des Winzers und meinem hin und her. „Oh, hallo Chef. Ja, bin eben angekommen.“ – „Das ist gut. Denn in diesem Jahr haben wir die Gebiete ein wenig vergrößert. Aus Kostengründen. Du wirst auch im Ruhrgebiet bescheren. Giuseppe wird dich dabei unterstützen. Also: An die Arbeit! Übermorgen ist Heiligabend!“ Und der Nikolaus wollte davonfliegen. Am Zipfel seines roten Samtanzuges hielt ich ihn jedoch zurück. „Chef, warum hat mich der Sog nicht erfasst?“ Die kleinen Knopfaugen blickten mich nachdenklich an. „Hmmm. Nennen wir es – Sabotage?“ Mehr bekam ich aus ihm nicht heraus. Dann drehte er sich endgültig um und flog davon.
Ich war zerknirscht. „Entschuldige, Giuseppe. Aber ich habe gedacht …“ – „Schon klar. Aber keine Sorge. Ich helfe nur aus. Danke übrigens, dass du deinen Urlaub geopfert hast, um meinen Wunsch zu erfüllen. Die Gratis-Eis-Aktion war eine tolle Idee!“, sagte Giuseppe. „Hat mir viel Spaß gemacht“, entgegnete ich. „Aber sag’ mal – sind das nicht zu wenig Pakete für so viele Menschen?“ Der Winzer stimmte mir zu. „Finde ich auch. Aber der Chef meinte, das läge daran, dass so viele Menschen arbeitslos seien. Sie hätten einfach kein Geld für Weihnachtsgeschenke übrig.“
Ich dachte nach. „Ich wüsste schon, wie man das Paketvolumen vergrößern kann. Such den Chef und lenke ihn ab.“ – „Wie denn?“, wollte der Winzer wissen. „Ich weiß nicht. Meinetwegen mache ihm weis, du hättest Pakete zerdeppert. Etwas wird dir schon einfallen. Und vor allem: Schaffe ihn aus der WGVHS!“ Giuseppe flog davon. Ich machte mich ebenfalls auf den Weg: In Richtung Zustellbezirk Côte d’Azur, Distrikt Monaco. Zum Glück war der monegassische Weihnachtsengel eine träge Type. Er merkte nicht, wie ich die Pakete, die er auf den Schlitten lud, von der anderen Seite wieder herunterklaubte und in meiner Wolke versteckte. Da kam hübsch etwas zusammen, schließlich sind viele Einwohner des Zwergenstaates reiche Leute. Mit den so gebunkerten Paketen flog ich wieder zurück und lud sie auf meinen Schlitten. Die Bescherung konnte beginnen.
Bis Max Bauchleitner zu uns kam, das sollte noch eine Weile dauern. Aber die Umstände, die seinen Einzug begleiteten, waren denkbar ungünstig. Dem Himmel stand eine aufregende Zeit bevor: Das Weihnachtsfest war in Gefahr.
Aber das ist eine andere Geschichte.