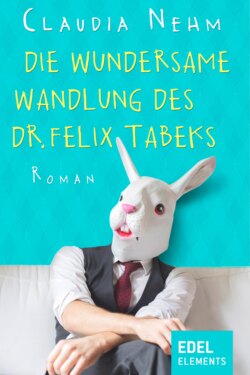Читать книгу Die wundersame Wandlung des Dr. Felix Tabeks - Claudia Nehm - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеAls Dr. Felix Tabeks noch ein Kind war, zur Schule ging und weder Doktor noch Tabeks genannt wurde, sondern einfach Felix oder Corega, nahm er an einer Foto-AG teil. Anders als den anderen sechs männlichen Teilnehmern ging es Felix nicht darum, in der Foto-AG das Fotografieren zu lernen, um Brust und Hinterteil der Mitschülerinnen aufs Papier zu zoomen. Felix’ Interesse galt einzig und allein den Fragen, aus welchen Lösungen und Inhaltsstoffen sich die Entwicklerflüssigkeit zusammensetze und wie der Vorgang der Belichtung eines Films und der Entstehung eines Bildes funktioniere.
Damals wurde der spätere Dr. Tabeks in der ersten Stunde der Foto-AG gefragt, was er unter einer Fotografie verstehe. Felix antwortete: Ein Foto ist die naturgetreue Nachbildung einer realen Situation.
Würde man Dr. Felix Tabeks am heutigen Dienstagnachmittag danach fragen, was er unter einer Fotografie verstehe und welche Bedeutung ein Foto für ihn habe, würde er ebenfalls mit oben stehendem Satz antworten. Vielleicht würde er fünf Minuten länger nachdenken, als es der kleine Felix an einem Freitagvormittag 30 Jahre zuvor getan hatte. Würde aber der Fotograf oder Kollege oder Bekannte mit seiner Frage nach der Bedeutung der Fotografie 66 Tage warten, würde er eine andere Antwort bekommen.
In 66 Tagen kann viel passieren.
Vor 66 Tagen war Dr. Felix Tabeks ein zufriedener, berufstätiger, verheirateter Mann.
Tabeks war zufrieden, weil alles seinen gewohnten Gang ging. Die Dinge waren genau so, wie sie seit 15 Jahren waren, und es war gut, dass sie so waren, weil er an sie gewöhnt war und mit ihnen zurechtkam.
Tabeks war berufstätig (er arbeitete als Statistikreferent), weil er vor 15 Jahren in einem Bewerbungsgespräch bei der Wirtschaftlichen Interessenvertretung einer Nicht-ganz-Großstadt im Südwesten Deutschlands den Personalchef mit seiner präzisen Analyse der volkswirtschaftlichen Situation beeindruckt hatte. Vielleicht hatte er den Personalchef auch mit der nicht minder präzisen, aber unterdurchschnittlich niedrigen Gehaltsvorstellung beeindruckt. Das lässt sich nach 15 Jahren nicht mehr einwandfrei klären.
Tabeks war mit Gisela verheiratet, die er bei den regelmäßigen Besuchen seiner Großtante in einem hessischen Altersheim kennen gelernt hatte; er kaufte ihr von seinem ersten Gehalt einen Verlobungsring. Den Ring hatte sich Gisela noch am selben Tag an den Finger gesteckt, zum Zeichen des Einverständnisses. Aufgrund der beim Einstellungsgespräch geäußerten unterdurchschnittlich niedrigen Gehaltsvorstellung reichte es allerdings nur zu einem schmalen Ring in 333er Gold.
Gisela störte das nicht. Sie wusste, von einem angehenden Doktor der Volkswirtschaft war im Laufe der Zeit mehr zu erwarten.
Gisela war Pflegerin der Tabeks’schen Großtante gewesen, die als Einzige in der nicht ganz kleinen Familie Tabeks immer daran geglaubt hatte, dass aus dem letztgeborenen Felix einmal etwas Besonderes werden würde. Ehe die Großtante im Altersheim bei Pflegerin Gisela angekommen war, hatte sie im Laufe ihres Lebens sieben Therapien wegen regelmäßig auftretender Bewusstseinsstörungen erfolglos hinter sich gebracht.
Vor zehn Jahren war Tabeks’ Großtante gestorben. Ihren Glauben an Felix hatte sie niemals aufgegeben. Auch wenn sie ihn später mit seinem Bruder Bernd verwechselte, dem Vorstandsvorsitzenden der international operierenden Ferendum AG. Wenn Felix im Jahr ihres Todes am Bett seiner Großtante saß, pflegte sie seine Hand zu streicheln, ihm mit der ihr verbliebenen Kraft in die Wangen zu zwicken und ihn nach dem Stand der Ferendum-Aktien zu fragen.
Seiner Großtante zu Ehren hatte Tabeks den Sohn, den ihm Gisela vor nunmehr beinahe 15 Jahren geschenkt hatte, mit zweitem Namen Maria genannt. Tabeks hatte im Deutschunterricht von einem Dichter gehört, der Rainer Maria hieß. Im Musikunterricht hatte er das Leben eines Carl Maria studieren müssen und im Feuilletonteil der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«, die er wegen der präzisen Auflistung der Aktienkurse abonniert hatte, war regelmäßig etwas über einen Schauspieler namens Klaus Maria zu lesen. Es schien also zu allen Zeiten üblich gewesen zu sein, einen Mann mit zweitem Namen Maria zu nennen. Jetzt gab es einen Schüler, der Andreas Maria hieß.
Auch mit Andreas Maria, der von seiner Familie Andreas genannt wurde und von seinen Klassenkameraden, die regelmäßig sein Pausenbrot im Goldfischaquarium versenkten, Maria, war Tabeks sehr zufrieden. Andreas war ein braver Junge. Ein interessierter, braver Junge, der zu Hause beim Abwasch half, seine Schulaufgaben zügig erledigte und im Anschluss daran leise am Computer spielte oder naturwissenschaftliche Bücher las, statt laute Musik zu hören. In die Disco ging Andreas niemals. Freunde brachte er nur selten mit nach Hause.
In vielen Dingen erinnerte er Tabeks an den kleinen Felix, der er einmal gewesen war, bevor er Dr. Tabeks wurde. Das gefiel ihm. Andreas Marias Verhalten war so, wie er das Verhalten eines Jungen gewohnt war. Neben Alter, Größe und unterschiedlichen Vornamen gab es nur einen auf den ersten Blick sichtbaren Unterschied zwischen Vater und Sohn. Tabeks trug einen Schnurrbart. Diesen Schnurrbart hatte er getragen, seit er einen Schnurrbart tragen konnte. Er konnte sich auch nicht vorstellen, den Schnurrbart irgendwann einmal nicht mehr zu tragen. Selbst als sich Gisela in ihrer zweiten gemeinsamen Nacht über das Kratzen des Schnurrbarts beschwert hatte, war Tabeks standhaft geblieben und hatte sich trotz Trennungsdrohungen nicht von seinem Schnurrbart getrennt. Zu Recht, wie sich herausstellte. Gisela war auch mit Schnurrbart bei ihm geblieben.
Gisela liebte Tabeks. Obwohl sie in vielen oder vielleicht sogar in allen Dingen anders war als ihr Mann. Sie hatte sich beispielsweise von ihrem Schnurrbart getrennt, als die erste brauchbare Enthaarungscreme auf den Markt kam. Sie war fröhlicher als ihr Mann, spontaner als ihr Mann, witziger, lebhafter und weniger schüchtern als ihr Mann. Hübscher als ihr Mann war sie nicht. Aber das störte weder sie noch ihn. Sie arbeitete immer noch als Altenpflegerin und sah anderen Großmüttern und Großtanten dabei zu, wie sie ihren Enkeln und Großneffen die Hände streichelten und ihnen eine große Zukunft voraussagten.
Wenn sie manchmal von einer Freundin danach gefragt wurde, was sie an ihrem Mann so liebe, überlegte sie nicht lange und sagte: »Ich liebe die Treue, mit der er an seinem Schnurrbart festhält, in einer Zeit, in der selbst Polizisten angefangen haben, sich ihre Schnurrbärte abzurasieren. Das zeugt von einer erstaunlichen Standhaftigkeit. Wer seinen Schnurrbart nicht abrasiert, wird auch seine Familie nicht im Stich lassen.«
Gisela hatte eine schwere Kindheit, in der sie von einer Verwandten zur nächsten gereicht wurde. Ihren Eltern hatte sie nie verziehen, den Wagen, in dem sie ihr Leben beendet hatten, als Gisela sieben Jahre alt war, nicht in das von ihr gewünschte Wohnmobil umgetauscht zu haben. Ein Wohnmobil hat hinten eine größere Pufferzone.
Seither war es Giselas größter Wunsch gewesen, dauerhafte Geborgenheit zu spüren. Diesen größten Wunsch erfüllte ihr Tabeks. Er war der richtige Mann für sie. Das Kratzen des Schnurrbarts, die über den Bauch hochgezogenen Hosen, die Einsilbigkeit, die immer gleichen grauen Krawatten mit roten oder grünen Punkten, den Seitenscheitel, die Urlaube in Oberbayern, über all diese Unzulänglichkeiten konnte sie hinwegsehen, solange sie wusste, dass Tabeks sie niemals zu einem anderen Mann und einer anderen Familie abschieben würde.
Auch Tabeks liebte Gisela. In erster Linie liebte er sie, weil er sie immer geliebt hatte. Er war es gewohnt, sie zu lieben. Es gefiel ihm, mit ihr am Frühstückstisch zu sitzen und seine Zeitung zu lesen. Es gefiel ihm, neben ihr im Bett zu liegen und einzuschlafen. Es gefiel ihm, beim Studium von Geschichtsbüchern oder Bildbänden das Klappern ihrer Stricknadeln zu hören, mit denen sie ihm Pullunder strickte. Es gefiel ihm auch, morgens in den Dienst zu gehen und zu wissen, wenn er abends nach Hause kam, würde Gisela mit dem Essen auf ihn warten. Gisela arbeitete nur noch halbtags, um sich besser um Tabeks, seine Pullunder, seine Mahlzeiten und seinen Sohn kümmern zu können.
Tabeks konnte sich nicht vorstellen, halbtags zu arbeiten. Seine Arbeit war sein Leben. Die Wirtschaftliche Interessenvertretung in der südwestdeutschen Nicht-ganz-Großstadt war sein Lebensmittelpunkt. Er liebte es, Statistiken in Form von Exceltabellen aufzubereiten, Umfragen bei Mitgliedsunternehmen durchzuführen, amtliche Statistiken auszuwerten und eigene Erhebungen für Anfragen der Mitglieder und Fachabteilungen zu erstellen, das Faltblatt »Die Wirtschaftsregion in Zahlen« vorzubereiten, statistische Grunddaten für die Mitgliederzeitung in Form zu bringen, Entwicklungen der Preisindizes für die Lebenshaltung, gewerbliche Erzeugerpreise oder Baupreise zu untersuchen, Wirtschaftslageberichte zu verfassen, Grafiken auszuwerten und sich auf diesem oder jenem anderen Gebiet für seinen Arbeitgeber einzusetzen.
Was er nicht liebte, war Verantwortung zu tragen, zur Rücksprache zum Hauptgeschäftsführer gerufen zu werden und private Schwätzchen mit Kollegen zu halten. Trotzdem liebte er seine Kollegen. Jeden einzelnen von ihnen. Aber er liebte sie auf nüchterne Weise, ohne spürbare Emotionen.
Anders als viele heißblütige junge Kollegen hatte Tabeks keine Probleme damit, den Anordnungen des Chefs Folge zu leisten. Im Gegenteil. Wenn der Chef etwas anordnete, musste Tabeks sich keine Gedanken über den Sinn oder die Fehlerhaftigkeit dieser Anordnung machen. Es gefiel ihm, wenn ein Chef eine klare Linie vertrat. Zu viel Eigenverantwortung konnte seiner Ansicht nach nur schaden. Bevor Tabeks seinen jetzigen jungen und aufstrebenden Chef zugeordnet bekam, hatte er jahrelang unter einem cholerischen Chef der alten Schule gedient. Auch damit hatte Tabeks keine Probleme gehabt.
Mittags liebte es Tabeks, sowohl zu Zeiten des alten als auch zu Zeiten des jungen Chefs, mit einem portablen Radio, das ihm Gisela zum ersten Hochzeitstag geschenkt hatte, und einem Brot, das ihm Gisela beim Frühstück zurechtgemacht hatte, durch den Schlossgarten zu spazieren und Nachrichten zu hören. Tabeks interessierte sich sehr für das Geschehen in dieser Welt, sowohl für das gegenwärtige Geschehen als auch für das schon geschehene Geschehen. Geschichte war nicht veränderbar. Das gefiel ihm.
Von einer jungen Kollegin hatte Tabeks einmal gehört, dass sie den Traum habe, Malerin zu werden. Mit Träumen konnte Tabeks nichts anfangen.
Berufstätig und verheiratet war Tabeks auch 66 Tage nach jenem Dienstagnachmittag. Zufrieden war er vielleicht weniger.
Der Dienstag begann, wie jeder Tag im Leben von Dr. Felix Tabeks beginnt. Vielleicht hätte es Tabeks jedoch zu denken geben sollen, dass er heute erst eine Minute vor dem Klingeln des Weckers aufwachte. Für gewöhnlich waren es sieben Minuten. Aber Tabeks weigerte sich, Sorgen über die sechsminütige Verspätung aufkommen zu lassen. Abergläubisch war er nicht. Auf das Bett folgte das Bad, auf das Bad die Auswahl des Pullunders, der für die Fahrradfahrt zum Dienst angezogen wurde, auf die Pullunderauswahl das Frühstück und auf das Frühstück die Fahrradfahrt in den Dienst, mit graublauer Windjacke über dem Pullunder und Fahrradhelm auf dem Kopf.
Im Dienstzimmer angekommen, wurden blaue Sportunterwäsche, Jeans, T-Shirt und Pullunder gegen weiße Dienstunterwäsche, weißes Oberhemd, blaugraues Sakko und graue Hose getauscht. Im Gegensatz zu sonst hatte Tabeks an jenem Dienstag vergessen, seine Zimmertür während des Umziehvorgangs abzuschließen. Dieses Versäumnis führte dazu, dass Sekretärin Regina Zyps an diesem Dienstag neben den diktierten Versatzstücken des Wirtschaftslageberichts für das dritte Quartal den ungewohnten Anblick eines Feinripphinterteils zu verarbeiten hatte.
Tabeks war peinlich berührt, was dazu führte, dass er bis zum Mittag versuchte, alle wichtigen Schriftstücke eigenhändig in den Computer zu tippen. Wozu hatte er vor anderthalb Jahren einen Schreibmaschinenkurs belegt? Regina Zyps war ebenfalls peinlich berührt, was dazu führte, dass sie vergaß, Tabeks rechtzeitig auf ein anstehendes Gespräch mit dem Hauptgeschäftsführer vorzubereiten. Als der Anruf kam, Dr. Tabeks möge sich bereithalten für eine Rücksprache mit Herrn Willerbeck, rutschte Tabeks aus Nervosität der Telefonhörer aus der Hand. Hoffentlich würde die Sekretärin des Hauptgeschäftsführers den ohne Grußformel beendeten Anruf nicht für allzu unhöflich halten.
Bevor Tabeks die drei Treppen zur höchsten Etage der Interessenvertretung hinaufstieg, erlaubte er sich einen Blick in den an der Innenseite des Büroschranks aufgehängten Spiegel. Schnurrbart, Scheitel und Schlips saßen korrekt. Tabeks konnte sich beruhigt auf den Weg machen. Konnte er sich beruhigt auf den Weg machen? Während er die Klinke seiner Tür in die Hand nahm, überlegte er sich, was der Hauptgeschäftsführer auszusetzen haben könnte, ob die zuletzt von ihm an die Mitgliederzeitung weitergegebenen Zahlen unkorrekt waren, ob das Faltblatt »Die Wirtschaftsregion in Zahlen« falsch gefaltet war oder die Preisindizes für die Lebenshaltung nicht mit den anderswo ermittelten Preisindizes für die Lebenshaltung übereinstimmten. Ähnliches konnte auch für die gewerblichen Erzeugerpreise oder die Baupreise gelten. Auf der zweiten Treppe hörte Tabeks auf zu denken. Auch zum Denken musste man eine gewisse Ruhe aufbringen, die er mit Beginn der zweiten Treppe nicht mehr aufzubringen imstande war.
Den Hereinruf der Hauptgeschäftsführersekretärin hörte Tabeks nicht. Wenn das Herz zu laut schlägt, kann es den Hörvorgang beeinflussen. Das hatte Tabeks in seiner den Naturwissenschaften gewidmeten Jugend herausgefunden. Tabeks hatte in der Zeit, in der er noch Corega oder Felix genannt wurde, sogar Untersuchungen angestellt zu der Lautstärke, in der das Herz klopfen muss, um die Ohren zum Vibrieren zu bringen. Das erstaunlichste Ergebnis dieser Untersuchung war die Erkenntnis, dass sein rechtes Ohr stärker vibrierte als das linke. Das schien Felix angesichts der Tatsache, dass das Herz sich auf der linken Seite befand, Besorgnis erregend. Der Arzt hatte allerdings keinen ernst zu nehmenden Ohrenschaden bei Felix feststellen können. Weder an dem rechten noch an dem linken Ohr.
Aufgrund des Ergebnisses seiner jugendlichen Untersuchungen war sich Tabeks heute, 30 Jahre später, im Klaren darüber, dass der Hereinruf der Hauptgeschäftsführersekretärin, die Frau Kröner hieß, aller Wahrscheinlichkeit nach von seinen Herzschlägen übertönt worden war. Er nahm seinen Mut in die feuchten Hände und öffnete die Tür.
Frau Kröners Anblick trieb den Schweißfluss weiter voran. Schon der blutrote Rand auf dem Wasserglas in der Mitte des Schreibtisches, unter dem Frau Kröners Beine versteckt waren, gab eine Vorahnung auf das, was dieser Mund andernorts hinterlassen konnte. Selbst Tabeks nahm die Reize der Vorzimmerdame zur Kenntnis. Unbewusst selbstverständlich. Sein Bewusstsein war mit dem Hörproblem beschäftigt, das ihn daran hindern könnte, die Anweisungen des Hauptgeschäftsführers nicht in der zur Speicherung des Gesagten notwendigen Lautstärke zur Kenntnis nehmen zu können.
Kaum stand Tabeks im Zimmer, zog Frau Kröner ihre langen, von zarten Strumpfhosen umhüllten Beine unter dem Schreibtisch hervor, stellte sich auf sie und machte zwei Schritte in Richtung Tür des Chefzimmers. Die Tür öffnete sich, bevor sie klopfte, was Tabeks erstaunte. Der Hauptgeschäftsführer trat heraus und streckte seine trockene Hand Tabeks’ nasser Hand entgegen. »Guten Tag, Herr Tabeks.«
Tabeks selbst nannte Menschen niemals bei ihren Namen. Abgesehen von den Mitgliedern seiner Familie konnte er nicht sicher sein, in dem aufregenden Moment des Äußerns den richtigen Namen auszuwählen. Er hatte darum vor 18 Jahren beschlossen, Begrüßungen und Abschiede auf ein allgemein gültiges, fehlerfreies »Guten Tag« und »Auf Wiedersehen« zu beschränken.
»Guten Tag«, sagte Tabeks zum Hauptgeschäftsführer und ließ das von anderen Untergebenen in diesem Zusammenhang angefügte »Herr Willerbeck« weg. Herr Willerbeck schenkte Tabeks ein unnatürlich freundliches Lächeln. Herr Willerbeck schenkte allen Menschen in allen Situationen ein unnatürlich freundliches Lächeln, selbst wenn er erregt, verärgert oder verängstigt war. Es war also nicht leicht, seiner Freundlichkeit Glauben zu schenken.
Zunächst wurde Tabeks aufgefordert, Platz zu nehmen. Dann setzte sich Tabeks an den runden Tisch, der in der Mitte des Zimmers stand, unter einem Wandteppich an der einen Seite und dem Fenster zum frisch begrünten Innenhof auf der anderen Seite. Da es bei einem runden Tisch keine Stirnseiten gibt, setzte sich Herr Willerbeck auf den Stuhl, der von Tabeks’ am weitesten entfernt war. Tabeks hatte weder Zeit noch Hörfähigkeit, sich seinen Gedanken zu widmen. Er musste sich vielmehr um Herrn Willerbecks Gedanken kümmern, die Herr Willerbeck in diesem Augenblick anfing zu äußern. Es waren Gedanken, die vermutlich eine Weile unter den kleinen braunen Locken, die recht weit hinten am Kopf erst die Kopfhaut zu bedecken begannen, geschlummert hatten. Herr Willerbeck war ein bedächtiger Mensch, der sich Gedanken genau überlegte, ehe er sie äußerte, den aber, wenn er sie äußerte, mit ihnen bereits eine derart enge und lange Beziehung verband, dass er sich durch kein Argument seines Untergebenen von ihnen entfernen ließ. Allerdings kam es Tabeks auch gar nicht in den Sinn, Herrn Willerbeck von seinen Gedanken abzubringen. Selbst wenn sie sein gesamtes Leben verändern würden, wie es bei den im Folgenden geäußerten Gedanken der Fall war.
Bei Herrn Willerbecks Gedanken zum Thema Tabeks ging es weder um Faltblätter noch um Preisindizes oder übersichtlich oder unübersichtlich aufbereitete Statistiken.
Vielmehr ging es um ein Thema, mit dem sich Tabeks in seiner Jugend, wie Herr Willerbeck aus wohl unterrichteter Quelle erfahren hatte, schon einmal intensiv beschäftigt hatte: die Fotografie.
»Mein lieber Herr Tabeks, Sie wissen, dass ich mit Ihrer Arbeit außerordentlich zufrieden bin. Sie haben bisher alle Aufträge zügig und zuverlässig erledigt. Sie haben mir noch niemals Grund zur Klage gegeben. Aber ist es Ihnen nicht auf Dauer etwas zu eintönig, Ihre Arbeitstage ausschließlich mit der trockenen Materie der Statistik zuzubringen? Ich habe nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, Sie mit einer zusätzlichen, kreativeren Aufgabe zu betrauen.« Bei dem letzten von Herrn Willerbeck geäußerten Satz war Tabeks’ Hörfähigkeit auf ein Minimum geschrumpft. Es dauerte rund 60 Sekunden, bis die Aussage durch das durch das Herzklopfen verursachte Rauschen in den Ohren bis in seinen Kopf gedrungen war. Aber selbst dann fiel es Tabeks schwer, den Sinn des Satzes zu erfassen.
Fotografieren? Was fotografieren?. Wen fotografieren? Bilder tauchten vor seinen Augen auf, von den Lösungen und Inhaltsstoffen, aus denen sich die Entwicklerflüssigkeit zusammensetzte, und vom Vorgang der Belichtung eines Films und der Entstehung eines Bildes. Von der Foto-AG, die der kleine Felix vor 30 Jahren besucht hatte, um sich mit den naturgetreuen Abbildungen des realen Lebens auseinander zu setzen. Aber was hatten Entwicklerflüssigkeit und Belichtungszeit mit seiner Tätigkeit bei der Wirtschaftlichen Interessenvertretung in einer südwestdeutschen Nicht-ganz-Großstadt zu tun? Was hatte ein Statistikreferent mit Fotos zu tun? War nicht der Fotograf Ben Fährmann, der in der dritten Etage ein kleines Fotostudio besaß, mit dem Abfotografieren von Interessenvertretungsveranstaltungen betraut?
»Wissen Sie, Herr Tabeks, zum einen scheinen Sie mir aufgrund Ihrer fotografischen Vorbildung der geeignete Mann für diese Aufgabe zu sein, zum anderen gehören Sie der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit an, der Abteilung, in der die Mitgliederzeitung hergestellt wird, in der die Fäden für alle Veranstaltungen zusammenlaufen. Kurz, als Mitglied dieser Abteilung befinden Sie sich direkt im Zentrum des Geschehens. Im Übrigen haben Sie vielleicht auch Freude daran, beruflich etwas stärker ausgelastet zu sein? Was sagen Sie zu meinem Vorschlag?«
Tabeks sagte zunächst nichts. Dann wagte er es, Herrn Willerbeck an den Fotografen Ben Fährmann zu erinnern, der ein weit höheres Maß an Kompetenz für diese Aufgabe mitbringe.
»Ja, sehen Sie, Herr Tabeks, Herr Fährmann hat uns mit Sicherheit immer gute Dienste geleistet. Aber ist es nicht befriedigender, in den eigenen Reihen einen Mann zu haben, der das Geschehen dokumentiert? Hat nicht ein Mitarbeiter einen ganz anderen Zugang zu Interessenvertretungsveranstaltungen? Haben Sie nicht gewissermaßen ein Gefühl für den richtigen Blickwinkel? Sehen Sie, Herr Tabeks, mit den modernen, leicht bedienbaren Digitalkameras geht es doch weniger um das Beherrschen der Technik als um das Finden des richtigen Motivs. Machen Sie sich doch bitte mit dieser Kamera vertraut, lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung durch und versuchen Sie, unsere heutige Vollversammlung zu dokumentieren.«
Herr Willerbeck reichte Tabeks eine kleine Schachtel, in der sich laut Umschlagbild ein digitaler Fotoapparat befand. Tabeks griff nach der Schachtel, ängstlich, irgendetwas an dem präzise ausgearbeiteten Gerät durch einen falschen Griff zu zerstören, und fühlte sich dabei wie bei der ersten Berührung seines Sohnes Andreas Maria, den ihm Gisela vom Krankenhausbett entgegengestreckt hatte.
»Auf Wiedersehen, Herr Tabeks. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit Ihrer neuen Aufgabe. Ich bin mir sicher, das Fotografieren wird für Sie bald eine unverzichtbare Bereicherung Ihres Arbeitsalltags sein.«
Das Hörproblem war beseitigt, als Tabeks an Frau Kröners versteckten Beinen vorbei durch die Tür ging, danach die drei Treppen hinab, direkt zu Frau Zyps, die noch immer ihre erste Begegnung mit dem Chef am heutigen Tag vor Augen hatte und mit gefärbten Wangen durch den Anzug das Feinripp schimmern sah. Angesichts der neuesten Entwicklungen hatte Tabeks die peinliche Situation jedoch vollständig vergessen.
»Können Sie mit einer digitalen Kamera umgehen?« Frau Zyps fand diese Frage seltsam, nickte aber. Ihr Mann hatte ihr zum vergangenen Nikolaustag eine scheckkartengroße Kamera in den Schuh gesteckt. Frau Zyps liebte Dinge, die unterdurchschnittlich klein waren. Ihren zwei Meter großen Mann liebte sie aber am meisten. Sie blickte auf die Schachtel, die Tabeks noch immer in den schweißnassen Händen hielt. »Lassen Sie mal sehen.« Frau Zyps packte den Apparat aus. Da Frau Zyps eine außerordentlich kluge Sekretärin war, konnte sie sich den Zusammenhang zwischen Tabeks’ Besuch bei Herrn Willerbeck und dem Besitz einer Digitalkamera rasch erklären. Er hatte zu tun mit der Entlassung des Fotografen Ben Fährmann aus dem langjährigen Arbeitsverhältnis und der ernst zu nehmenden finanziellen Situation, in der sich die Wirtschaftliche Interessenvertretung in der südwestdeutschen Nicht-ganz-Großstadt befand.
»Sie sollen nun also das Fotografieren übernehmen. Das ist doch eigentlich gar keine schlechte Aufgabe. Sie werden sicher kein Problem haben, mit der Digitalkamera vernünftige Bilder zu machen. Es ist wirklich ganz einfach. Sehen Sie, hier ist ein kleines Display, in dem Sie genau erkennen können, was später auf Ihrem Foto zu sehen sein wird. Dann müssen Sie nur auf diesen kleinen schwarzen Knopf drücken, und schon ist das Bild gespeichert. Wenn Ihnen das Foto nicht gefällt, können Sie es löschen. Die Digitalkameras haben das Risiko von missratenen Fotos aus der Welt geschafft.«
Für Tabeks hatte der kleine Apparat mit dem Display wenig gemeinsam mit der Leica Spiegelreflexkamera, die er vor 30 Jahren in der Foto-AG verwendet hatte. All die Dinge, die ihm Vergnügen bereitet hatten, wie die Einstellung der Belichtung, der Schärfentiefe und das Anschrauben des passenden Objektivs, schienen im Laufe der Jahre verloren gegangen zu sein. Mit diesem kleinen silbernen Apparat, den er mit einer Hand umfasste, konnte er sich nicht anfreunden.
Im Gegensatz zu Frau Zyps liebte Tabeks große Gegenstände. Große Gegenstände wirkten Vertrauen erweckender und solider als kleine Gegenstände. Zwei ernst zu nehmende Krisen hatte Tabeks im Laufe der vergangenen 15 Jahre bewältigen müssen: das Aufkommen von CDs und die Verbreitung des mobilen Telefons. Die Tatsache, dass Tabeks seit drei Jahren einen CD-Spieler und seit fünf Monaten ein Handy besaß, zeigte allerdings, dass er sich von seinen Vorurteilen nicht dauerhaft beherrschen ließ. Vielleicht zeigte sie aber auch nur den nicht unbeträchtlichen Einfluss Giselas auf ihren Ehemann.
Tabeks hatte keine zehn Jahre Zeit, sich an die handgroße Digitalkamera zu gewöhnen. Er musste Fotos von der Vollversammlung machen, die in zwei Stunden beginnen sollte.
Es gab eine ganze Reihe von Angstfaktoren, die mit diesem Auftrag verbunden waren. Noch niemals hatte Tabeks einer Vollversammlung beigewohnt. Zu ihr waren nur die wichtigen Menschen zugelassen, zu denen sich Tabeks nicht zählte. Geschäftsführer der Interessenvertretung waren dort, Geschäftsführer großer Unternehmen, Vorstandsvorsitzende und der Präsident der Interessenvertretung, der einen weltweit operierenden Konzern leitete und dessen imposante Glatze Tabeks bislang nur aus dem sicheren Abstand von 50 Metern beim Neujahrsempfang hatte glänzen sehen.
Der zweite Angstfaktor war die Aufgabe, die ihm als Fotograf gestellt wurde. Ein Fotograf, zumindest ein Fotograf, der Menschen fotografierte, musste den Menschen, die er fotografieren sollte, nahe kommen. Er musste durch den Mittelgang oder die Seitengänge des Saals marschieren, wo er von allen Anwesenden gesehen wurde, und musste seine Arbeit vor den Augen der Öffentlichkeit erledigen. Zudem noch mit einer Kamera, die nicht die geeignete Größe hatte, um sie schützend vor Augen und Nase zu halten.
Der dritte Angstfaktor war die Befürchtung, dass die Fotos trotz Frau Zyps’ beruhigenden Aussagen über die Unfehlbarkeit der Digitalkamera misslingen könnten.
Tabeks nutzte also die verbleibenden zwei Stunden, um sich mit seinem neuen Arbeitskollegen anzufreunden. Erst einmal fotografierte er die Tür seines Büros. Die Bürotür war der Gegenstand, der direkt im Fokus der Kamera lag. Zumindest, wenn Tabeks an seinem Schreibtisch saß. Er brauchte nur die Ellbogen auf die Papierunterlage zu stützen, auf der er sich für gewöhnlich Dinge notierte, die er zu vergessen befürchtete, die Kamera in die rechte Hand nehmen und die Bürotür betrachten, die im Display erschien, sobald er das Rädchen der Digitalkamera auf »Auto« drehte. Dann sah Tabeks die Bürotür zweimal. Einmal im von ihm bevorzugten Großformat, wenn er die Augen hob, und im Miniaturformat, wenn er die Augen senkte. Trotz der eigentlich naturgetreuen Nachbildung der realen Tür konnte Tabeks einige Unterschiede ausmachen. Im Display sah die Tür wärmer aus, rötlicher, dunkler. Die Farben waren anders. Vielleicht war sogar ein Blitz erforderlich, um sie in ihren eigentlichen Zustand zurückzuversetzen.
Es war dunkel in Tabeks’ Büro. Aus Sparsamkeit hatte Tabeks das Licht ausgeschaltet, als er zum Hauptgeschäftsführer gerufen worden war. Es war ein Reflex gewesen, den er sich in 15 Jahren antrainiert hatte. Der Reflex, das Licht beim Wiedereintritt anzuschalten, hatte heute dagegen ausgesetzt. Als jetzt noch ein aufziehendes Gewitter die Dunkelheit außerhalb seines Büros verstärkte, war es auch innerhalb des Büros dämmerig geworden.
Zu dämmerig wohl für eine blitzfreie Aufnahme.
Tabeks studierte das Gerät und bemerkte, dass er aus Versehen die Funktion »Porträt« gewählt hatte, bei der sich der sonst automatisch funktionierende Blitz automatisch ausschaltete. Er drehte das Rädchen auf »off«, wartete, bis sich das Objektiv eingefahren hatte, drehte wieder auf »Auto« und wartete, bis sich das Objektiv ausgefahren hatte. Zeitersparnis war wohl keine der herausragenden Eigenschaften der neuen handgroßen digitalen Kameras. Auch wenn er auf den Auslöser drückte, musste Tabeks eine Wartezeit von zirka drei Sekunden einkalkulieren, bis das Gerät tatsächlich bereit war, eine reale Situation abzubilden, die, wie Tabeks so langsam zu erkennen begann, auch dann noch nicht unbedingt real war und die vor allem anders real war als in dem Zustand drei Sekunden zuvor, in dem er sie eigentlich hatte abbilden wollen.
Zumindest gelang es Tabeks nach vier Versuchen, seine Bürotür in einem dem realen Zustand ähnlichen Zustand festzuhalten. Tabeks versuchte dasselbe mit seinem Schreibtisch, dem Bürofenster, dem Montblanc-Kugelschreiber, den ihm Gisela zum ersten Hochzeitstag geschenkt hatte, und dem Wimpel, der ihm vor sieben Jahren auf einer Konferenz überreicht worden war und der jetzt die Wand schmückte, die sich links von seinem Schreibtisch befand. Es funktionierte. Mühsam zwar, aber es funktionierte.
Spaß hatte Tabeks nicht am Fotografieren mit der handgroßen digitalen Kamera. Spaß hatte ihm aber auch das Fotografieren mit der Spiegelreflexkamera nicht gemacht. Zumindest nicht mehr, nachdem er die technischen Feinheiten der Kamera durchschaut hatte und es nur noch darum ging, naturgetreue Abbildungen von realen Gegenständen anzufertigen, die ihm in ihrer natürlichen Größe ohnehin besser gefielen.
»Fotos sind Kunstwerke«, hatte ein Mitschüler des 14-jährigen Felix zu Beginn der Foto-AG gesagt. Aber mit diesem Satz hatten weder der damalige Felix noch der heutige Dr. Tabeks etwas anfangen können. Kunstwerke sind Werke, die mit künstlerischen Mitteln erzeugt werden. Von Malern wie Picasso oder Monet, die mit ihnen Museen gefüllt haben. Museen, die Tabeks auf Giselas Wunsch bereits drei- oder viermal im Laufe ihrer Ehe besucht hatte. Fotos sind keine Kunstwerke. Sie sind mit technischen Mitteln erzeugte Abbildungen.
Davon war Tabeks jetzt, wo er in seinem Büro saß und die handgroße digitale Kamera in den Händen hielt, mehr denn je überzeugt. Niemals hätte ihm der Hauptgeschäftsführer ein Mittel zur Erzeugung von Kunstwerken überreicht.
Die zwei Stunden bis zum Beginn der Vollversammlung gingen vorüber. Als sie vorüber waren, war die Speicherkarte von Tabeks neuer digitaler Kamera mit Fotos von Wimpeln, Bürotüren, Montblanc-Kugelschreibern und Bürofenstern gefüllt. Für Fotos von der Vollversammlung war kein Platz mehr.
Ein dritter Angstfaktor gesellte sich zu den übrigen zweien. Wenn nicht Frau Zyps pünktlich zur Stelle gewesen wäre und ihr morgendliches Trauma überwunden hätte, hätte Tabeks zum ersten Mal in den 15 Jahren, die er für die Interessenvertretung in der südwestdeutschen Nicht-ganz-Großstadt tätig war, einen Auftrag nicht ordnungsgemäß erfüllen können. Ein Umstand, der Tabeks auch im Nachhinein noch bedenklich stimmte. Frau Zyps brauchte nur drei Minuten, um die Löschfunktion ausfindig zu machen. Weitere drei Minuten brauchte sie, um die 32 Bilder von Tabeks Büroeinrichtung zu löschen, ihm die Kamera in die Hand zu drücken und viel Glück für seinen ersten Fotoauftrag zu wünschen.
Die handgroße digitale Kamera mit den 32 freien Speicherplätzen in der einen Hand und die Türklinke in der anderen Hand, betrat Dr. Felix Tabeks den Sitzungssaal, in dem er seinen ersten Fotoauftrag erledigen sollte. Bereits in diesem Eintrittsaugenblick wandten sich Tabeks rund die Hälfte der würdigen Herrengesichter zu. Es ist nichts als ein Reflex, sagte sich Tabeks. Die Tür geht auf und ein aus der Neugierde geborener Reflex bringt den Menschen dazu, den Kopf zu wenden, um festzustellen, ob nicht Herr F. oder Herr S., den man eigentlich erwartet hatte, doch noch erscheine. Oder ob Herr M., der bisher noch fehlte, trotz jüngster Verlustgeschäfte zu kommen wage und ob er sich tatsächlich die Haare rötlich braun gefärbt habe, wie Herr Z. kürzlich beim gemeinsamen Festdinner behauptet hatte.
Aber herein kam nur ein nahezu allen Anwesenden unbekannter Mann mit Schnurrbart und einer handgroßen digitalen Kamera in der Hand. Hatte nicht Herr Fährmann mit den langen Haaren sonst für die Interessenvertretung fotografiert? Einen kurzen Moment lang war die Aufmerksamkeit der würdigen Herren vom Tagesordnungspunkt Nummer eins abgelenkt, und sie bedauerten es, sich nicht länger über Herrn Fährmanns Zopf aufregen zu können, den sie seit jeher für nicht ganz altersgemäß gehalten hatten. Hatte ihn der Zopf den Kopf gekostet? Oder ging es der Interessenvertretung ähnlich wie ihren eigenen Unternehmen? Musste auch die Interessenvertretung sparen? Sollte einem diese Tatsache Anlass zur Freude geben oder sollte man insgesamt für die Zukunft schwarz sehen?
Da die Interessenvertretung sich durch die Beträge der Unternehmen all der anwesenden Herren und vieler nicht anwesender Damen und Herren finanzierte, war es eigentlich nicht weiter verwunderlich, dass sie sparsamer mit den weniger werdenden Beiträgen umzugehen hatte. Wie auch immer. Ein Profifotograf war der zopflose Herr mit dem Schnurrbart und der digitalen Kamera, die er in der rechten Hand hielt, gewiss nicht. Fotografen hatten große Kameras, Stative und lange Haare. Dieser Herr sah aus wie ein Statistikreferent, der dazu abgestellt war, in der Interessenvertretung stattfindende Veranstaltungen zu fotografieren.
Soweit der Gedankengang einiger der anwesenden wichtigen Herren, zumindest derer, für die der Tagesordnungspunkt eins von nicht allzu großem Interesse war.
Tabeks war froh, nicht zu wissen, was die anwesenden wichtigen Herren über ihn dachten. Er hatte auch gar keine Zeit, sich über die Gedanken anderer Menschen Gedanken zu machen. Er war vielmehr mit seinen eigenen Gedanken bezüglich eines geeigneten Standorts, von dem aus er einen einigermaßen passablen Überblick über den Saal haben würde, ohne von allen anwesenden wichtigen Herren gesehen zu werden, beschäftigt. Sein Blick fiel auf die Empore. Die Empore war ein perfekter Platz für einen Fotografen, der einen Überblick über das Geschehen haben wollte, ohne dabei gesehen zu werden. Wichtige Menschen neigen selten dazu, in die Höhe zu blicken. Sie ziehen es in der Regel vor, aus einer höheren Warte nach unten zu schauen.
Als Tabeks den Saal wieder verließ, um über das Treppenhaus und die gläserne Brücke auf die Empore zu gelangen, drehten sich nur noch drei oder vier Augenpaare nach ihm um. Oben wurde Tabeks ruhig. Unbeobachtet fiel es ihm auch leichter, die handgroße digitale Kamera in die Höhe zu heben, auf »Autofokus« zu stellen, zu warten und im Display den Saal mit den vielen wichtigen Menschen einzufangen. In Miniaturgröße sah Tabeks jetzt die Vollversammlung der Interessenvertretung einer südwestdeutschen Nicht-ganz-Großstadt auf seinem Display erscheinen. War es nicht erstaunlich, dass sich all die wichtigen Menschen auf so kleinem Raum einsperren ließen? Wenn es sich tatsächlich um eine naturgetreue Abbildung einer realen Situation handelte, müsste eigentlich ein einziger der wichtigen Menschen ausreichen, um das ganze Display auszufüllen. Wider Willen war Tabeks beeindruckt von der handgroßen digitalen Kamera.
Tabeks wanderte auf der Empore von rechts nach links und drückte von Zeit zu Zeit auf den Auslöser. Als er sich aber, auf der linken Seite angekommen, die ausgelösten Fotos noch einmal anschaute, waren die wichtigen Menschen plötzlich sehr dunkle wichtige Menschen geworden. Der Blitz war zu schwach auf die Entfernung. Was war zu tun? Tabeks traute sich nicht ein zweites Mal in den Saal hinunter. Er drückte den Schalter, an dem man die Einstellungen verändern konnte, von »Person« auf »Landschaft«, von »Landschaft« auf »Sonnenuntergang« und von »Sonnenuntergang« auf »Blume«. »Blume« war die schlechteste Wahl. Sofort wählte sich die Kamera einen beliebigen Punkt in ihrer und Tabeks’ Umgebung aus und fixierte ihn. Sie tat das mit einem leichten Summen, das verriet, dass sich der Zoom dem von der Kamera ausgewählten Punkt näherte. Ein Summen, das Tabeks so laut vorkam, dass er glaubte, all die wichtigen Menschen müssten sich nach dem Herkunftsort des Summtons umdrehen. Außerdem machte die Kamera tutende Geräusche, wenn man ein Bild löschte. Tabeks durfte sich davon aber nicht beeinflussen lassen. Er musste die schwarzen wichtigen Herren löschen, um graue wichtige Herren an ihre Stelle setzen zu können.
Tabeks wählte schließlich die Landschaftseinstellung, bei der ihm der Blitz am hellsten vorkam. Trotzdem waren die wichtigen Herren noch immer schwarzgraue wichtige Herren. Tabeks fing an zu schwitzen. Er fühlte, wie sich der Schweiß seinen Weg bahnte, durch das weiße Hemd bis an die Ärmelausschnitte des blauen Pullunders und weiter durch das blaugraue Sakko. Er wusste, dass es keinen Ausweg gab. Er musste über die gläserne Brücke die Empore verlassen, die Treppe hinuntergehen und noch ein zweites Mal die Tür zum großen Saal öffnen, um von 30 bis 40 wichtigen Herrengesichtern gemustert zu werden. Er hatte keine Wahl. Herr Willerbeck erwartete Fotos von der Vollversammlung, und noch niemals hatte Dr. Felix Tabeks einen Vorgesetzten enttäuscht.
Außerdem fiel ihm ein, dass Ben Fährmann nicht nur Vollversammlungsfotos von der gesamten Vollversammlung abgeliefert hatte, sondern auch ausgewählte Teile der Vollversammlung, wie beispielsweise den Präsidenten oder den einen oder anderen Vizepräsidenten, in Großaufnahme eingefangen hatte. Trotz des erstaunlich tatkräftigen und laut summenden Zooms war die Entfernung von der Empore aus zu diesem Zweck eindeutig zu weit. Selbst wenn die Blitzproblematik nicht bestanden hätte.
Beim zweiten Türöffnen drehten sich sogar mehr Gesichter zu dem eintretenden Tabeks und seiner handgroßen digitalen Kamera um als beim ersten Mal. Die Zeit war fortgeschritten und mit ihr die Müdigkeit der wichtigen Herren. Umso dankbarer waren sie über die kleine Unterbrechung der Eintönigkeit. Ein Kopfwenden konnte den Einschlafprozess verzögern.
Tabeks ging nun tatsächlich den Seitengang hindurch, bis er auf der Höhe der ersten Reihe angelangt war. Vielleicht würden von dieser Position aus Zoom und Blitz ausreichen, und er konnte sich den Gang an den Füßen der wichtigsten der wichtigen Herren vorbei ersparen. An Herrn Willerbecks Füßen vorbei, an den Füßen von Präsident Kemperer, an den Füßen der Vizepräsidenten Ritzer bis Pfeffermann vorbei. Er hob die Kamera in Brusthöhe, bis Herrn Kemperers Glatze im Display schimmerte. Tabeks drückte ab. Er sah sich das Bild an. Die Entfernung war in Ordnung, aber man sah Glatze, Knollennase und Vollbart nur im Profil. Außerdem wölbte sich die eine, sichtbare, der beiden Backen, weil Herr Kemperer im Moment des Auslösens an einem Stück Brezel zu kauen begonnen hatte.
Das war wieder ein Problem der Auslöseverzögerung bei digitalen Kameras. Als Tabeks Herrn Kemperer mit seinem Display fixiert hatte, war die Backe noch leer gewesen. Um mit handgroßen oder anderen digitalen Kameras die gewünschte Situation real abbilden zu können, musste man in die Zukunft blicken. Wahrscheinlich musste man im Moment des Endkauens abdrücken, um die leeren Präsidentenbacken auf dem Bild zu haben. Die ganze Fotografiererei begann Tabeks über den Kopf zu wachsen. Er stellte sich still in eine Ecke und wartete, bis der Präsident seine Brezel aufgegessen hatte.
Wenn Tabeks gewollt hätte, hätte er jetzt zuhören können, was in dem wichtigsten Gremium der Interessenvertretung diskutiert wurde. Aber Tabeks wollte nichts hören, was eigentlich nicht für seine Ohren bestimmt war. Er wollte viel lieber ein brauchbares Präsidentenbild machen und die gesamte Vollversammlung von einem geeigneten Standpunkt aus mit der nötigen Helligkeit fotografieren. Als das letzte Stück Brezel im Mund von Herrn Kemperer verschwunden war, machte sich Tabeks auf den Weg zum Ende des Mittelgangs. Die Kamera hatte er schon vorher ausfahren lassen, damit das Geräusch nicht direkt in Herrn Kemperers und Herrn Willerbecks Ohren dringen konnte. Wie ein Torwart, der in Sekundenschnelle aufspringt und die Arme hebt, um den Ball, der auf den Weg ins Netz ist, einzufangen, hob Tabeks im Vorübergehen die handgroße digitale Kamera in Brusthöhe, schaute eine Sekunde lang, ob Herr Kemperer auch im Display zu sehen war, drückte dann ab, fast noch oder schon wieder im Gehen, und verschwand aus dem Mittelgang.
An der Seite stellte er sich auf, um das Ergebnis des Fotografiermanövers zu begutachten. Herr Kemperer war auf dem Bild zu sehen, von vorne, ohne Brezel in der Backe, dafür aber ein wenig unscharf, weil die torwartähnliche Bewegung verhindert hatte, dass Tabeks’ Hand sich in einer ruhenden Stellung befand.
Er wiederholte den Vorgang, dieses Mal ein wenig bedächtiger, und hatte schließlich seinen ersten Erfolg zu verzeichnen. Ein gelungenes Foto des Interessenvertretungspräsidenten. Nun fehlte noch ein gelungenes Foto von der gesamten Vollversammlung. Dazu musste sich Tabeks idealerweise wieder auf die Empore begeben. Von unten konnte er nur entweder die wichtigsten der wichtigen Herren aufnehmen, die dem Präsidium angehörten, oder die restlichen wichtigen, die dem Präsidium gegenübersaßen.
Von oben reichte aber, wie Tabeks ja bereits bemerkt hatte, der Blitz nicht aus. Tabeks erinnerte sich an seine frühen Foto-AG-Zeiten. Dabei kam ihm ein für das Fotografieren an dämmrigen oder dunklen Orten äußerst nützliches Zubehörteil in den Sinn: das Stativ. Mit einem Stativ hatte ihn Herr Willerbeck zwar nicht ausgestattet, dafür gab es aber eine Balustrade, durch die die Besucher der Empore vor einem möglichen Sturz in den Saal geschützt wurden.
Tabeks verließ also den Saal zum zweiten Mal und hoffte beim Schließen der Tür, diese nicht in Kürze wieder öffnen zu müssen, weil die Balustrade als Stativ doch nicht taugte und ein Teil der Vollversammlung auf einem Foto besser war als gar keine oder eine verwackelte oder zu dunkel geratene Vollversammlung.
Tabeks’ Sorgen waren unbegründet, die Balustradenidee funktionierte, und Tabeks konnte ruhigen Gewissens in sein Arbeitszimmer zurückkehren.
Der aufregende Nachmittag hatte Tabeks erschöpft. Außerdem wusste er nicht, was er nun mit den Fotos anstellen sollte, die in der handgroßen digitalen Kamera gefangen waren. Aber dieses Problem verschob er auf den nächsten Tag. Tabeks wechselte seine Hosen, seinen Pullunder und seine Unterwäsche, dieses Mal ohne von Frau Zyps gestört zu werden, schloss die Schreibtischschublade ab, in der sich die handgroße digitale Kamera mit den Fotos von der Vollversammlung befand, und machte sich mit hochgekrempelten Cordhosen und dem Schutzhelm auf dem Kopf auf den Weg in die Tiefgarage. Es war ein befreiendes Gefühl, in den Händen runde Fahrradgriffe zu spüren, bei denen man bedenkenlos zupacken konnte. Es war schön, die handgroße digitale Kamera hinter sich lassen zu können.