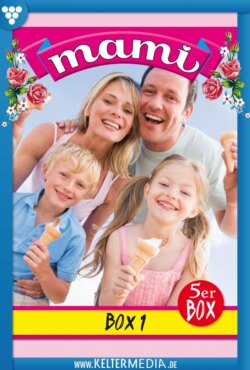Читать книгу Mami Box 1 – Familienroman - Claudia Torwegge - Страница 6
Оглавление»Da ist die Kleine ja wieder«, bemerkte Edgar Gerstner und ließ die Zeitung sinken.
Seine Frau Vera folgte seinem Blick. Das Kind im kurzen Hängekleidchen stand bei den Blumenbeeten im Vorgarten und machte sich da zu schaffen. Immer wieder bückte es sich und zupfte daran herum. Wenn es sich aufrichtete, sah es zu den beiden hin, die da auf der ebenerdigen Terrasse in bequemen Korbstühlen saßen und es beobachteten. Das Kind schien es nicht zu stören, im Gegenteil, es schien, als warte es auf etwas.
»Komm mal her, was tust du denn da?« sagte Vera endlich mit erhobener Stimme.
Das kleine Mädchen gehorchte sofort.
»Ich mach’ nur weg, was da so dazwischen wächst«, erklärte es eifrig. »Hier, das schlingt sich da rum, und dann kriegen die Blumen keine Luft mehr.« Zum Beweis hielt es das kleinwüchsige Unkraut in seinem Händchen empor.
»So so, du nimmst uns die Gartenarbeit ab«, lächelte Vera.
»Ja, das hab ich auch getan, wie Sie weg waren. Aber eine Blume hab ich nie weggenommen, das wär ja gestohlen«, versicherte es ernsthaft. Nach einer kleinen, unschlüssigen Pause fügte es schüchtern hinzu: »Sie waren lange weg, nicht?«
»Wir waren verreist«, sagte Vera.
Das Kind nickte. »Darum sind Sie auch so braun. Das waren Sie vorher nicht. Da war wohl viel Sonne?«
»Wir haben dich schon öfter hier gesehen«, mischte sich der Hausherr ein. »Wie heißt du denn?«
»Ich heiße Isabella. Das ist der schönste Name, den es überhaupt gibt.«
»Dann hast du ja Glück gehabt, daß deine Eltern dich so getauft haben«, äußerte Edgar Gerstner mit einem leisen Schmunzeln. »Schimpfen die denn nicht mit dir, wenn du in fremde Gärten gehst?«
Isabella schüttelte den Kopf. »Meine Mama schimpft nie mit mir, die ist ganz lieb, und mein Papa auch. Ich hab noch eine Schwester und einen Bruder, die sind auch lieb. Mein Bruder wird mich beschützen, wenn ich jetzt bald in die Schule komme und einer frech zu mir ist.«
Während sie redete, ging ihr Blick über den runden Gartentisch, auf dem, zwischen geleerten Tassen, noch zwei Erdbeertörtchen auf einer Kuchenplatte lagen. Vera kam es vor, als läge etwas Begehrliches darin.
»Möchtest du gern so ein Törtchen?« fragte sie gutmütig. »Dann setz dich da auf den Hocker und nimm dir eins. Oder warte, ich gebe es dir auf den Teller.«
Wie die braunen Augen aufleuchteten, als es der Aufforderung folgte. »Das habe ich mir immer gewünscht«, sagte Isabella.
»Was, Erdbeerkuchen? Den bekommst du doch zu Hause sicher auch mal«, warf Vera hin.
»Nein, hier bei Ihnen zu sein!«
Das kam so inbrünstig heraus, daß es Vera verwunderte. Was fand sie so Besonderes daran, sie waren doch Fremde für sie. Nun, Kinder hatten sicher manchmal seltsame Ideen.
Ihr Mann hatte wieder nach der Zeitung gegriffen. Vera betrachtete ihren kleinen Gast, der sich auch das zweite Törtchen noch nehmen durfte. Es war kein besonders hübsches Kind, dafür war das Gesichtchen zu blaß und zu spitz. Das braune, etwas strähnige Haar war bestimmt nicht von einem Fachmann geschnitten, es hing unordentlich um den schmalen Kopf und in die Stirn. Trotzdem hatte diese Isabella etwas Liebes, irgendwie Rührendes an sich. Eigentlich sah sie noch gar nicht aus wie sechs Jahre, so klein und dünn, wie sie war.
»Kommst du denn dieses Jahr schon in die Schule?« erkundigte sich Vera.
»Ja.« Das Kind tupfte mit dem Zeigefinger die letzten Krümel auf. »Weil ich im Mai doch schon sechs geworden bin. Darum bin ich auch schon zu alt…« Es stockte.
»Zu alt?« wiederholte Vera verblüfft. »Was soll denn das heißen?«
»Och, nur so…« Isabella wurde rot und sah beiseite. Eigentlich müßte sie wohl jetzt gehen, statt dessen fragte sie: »Darf ich noch ein bißchen bleiben?« Ihr Blick ging zu dem Haus.
»Ja, ich weiß nicht – wirst du denn nicht zu Hause erwartet? Wo wohnst du denn?«
»Dort hinten.« Es folgte eine Armbewegung in eine unbestimmte Richtung. »Das ist so ein wunderschönes Haus«, redete das Kind mit einem verträumten Ausdruck weiter, »und so groß. Wohnen Sie da allein drin?«
»Ja. Aber so groß ist es gar nicht. Oben sind die Schlafzimmer und unten der Wohnraum. Sonst noch etwas, du kleine Neugier?« Es klang scherzhaft aus Veras Mund.
»Drinnen ist es sicher auch schön, so mit Bilder und Teppichen, ja?«
»Nun ist es aber genug.« Das war Edgar, dem das Frage- und Antwortspiel langsam zuviel wurde. »Du machst dich jetzt besser auf den Heimweg, Kind. Nicht, daß deine Mutter dich noch sucht.«
Das Mädchen erwachte aus seiner träumenden Bewunderung des Hauses und stand auf. »Auf Wiedersehen«, sagte es und streckte zuerst Vera, dann dem Mann das schmale Händchen entgegen. »Und vielen Dank auch.«
»Auf Wiedersehen, Isabella.«
Sie sahen der kleinen Gestalt nach, die sich zögernd entfernte. Vorn, an der Straße drehte sie sich noch einmal um und winkte. Vera winkte lächelnd zurück.
»Ein komisches kleines Ding«, bemerkte Edgar.
»So komisch fand ich sie eigentlich nicht«, meinte seine Frau etwas nachdenklich und begann, die Tassen zusammenzustellen.
»Na, hör mal! Wenn ich sie nicht weggeschickt hätte, wären wir sie wohl nicht mehr losgeworden. Geht einfach zu irgendwelchen fremden Leuten…« Er schüttelte den Kopf.
Vera trug das Geschirr auf einem Tablett hinein. Freilich hatten sie es schön in ihrem schmucken Haus. Die Kleine hätte sich nur zu gern darin umgesehen, das hatte sie gemerkt. Aber das führte zu weit.
Sie selber genoß es auch, nach der weiten Reise wieder daheim zu sein. Sie waren dieses Jahr in die Karibik geflogen, doch das war nicht ihre Welt. Laute Disco-Musik über den »Traumstränden«, im Riesenhotel viel Stillosigkeit. Man sollte eben nicht dem allgemeinen Trend folgen. Oder sie hatten einfach Pech gehabt. Zum Glück hatte Edgar noch eine Woche Ferien, um sich davon zu erholen. Der Sommer lag auch noch vor ihnen, denn es war erst Mitte Juni. Sie würden noch viele schöne Wochenenden haben, mit dem Boot draußen auf dem See, das ihnen gehörte.
Am Abend kam ihre Schwester Jenny, um sich von ihrem Urlaub erzählen zu lassen. Da sie bereits etwas Abstand hatten, berichteten Vera und Edgar eher amüsiert von ihrem Abenteuer. Sie vermochten jetzt schon über manches zu lachen, was sie geärgert hatte.
»Trotzdem«, seufzte Jenny, »ihr kommt wenigstens mal raus und seht ein Stück von der Welt. Ihr könnt doch planen, wie ihr wollt. Wenn ich denke, wie angebunden ich dagegen bin: der Haushalt, die Kinder und das Geschäft, mit dem Dieter verheiratet ist.«
»Mach nicht so eine verdrossene Miene, Jenny, das steht dir nicht«, sagte Edgar mit einem leichten Lächeln zu seiner Schwägerin.
»Ja, du hast gut reden.« Düster sah Jenny ihn an. »Wenn du aus der Bank kommst, ist Feierabend für dich. Bei Dieter gibt’s so was nicht. Er hat sich auch heute wieder einen Stapel Kataloge von Auktionshäusern mitgebracht, da brütet er nun bis Mitternacht drüber.«
»Dafür paßt er auf die Kinder auf, und wir haben einen gemütlichen Abend für uns«, versuchte Vera zu besänftigen und stand auf, um eine Flasche Sekt aus dem Kühlschrank zu holen. Daß sie nur immer so unzufrieden war, ihre Schwester! Jenny war vierzig, acht Jahre älter als sie, und sie war eine schöne, aparte Frau. Das würde sie nicht mehr lange sein, wenn sie sich weiter in eine gewisse Verbitterung hineinsteigerte. Warum denn nur? Sie hatte zwei gesunde Kinder, war das nicht schon Glück genug? Statt dessen ging sie oftmals nervös und zänkisch mit ihnen um. Da war es kein Wunder, daß die beiden hin und wieder trotzig aufmuckten.
Sicher, Dieter kümmerte sich zu wenig um seine Familie, das stimmte schon. Er lebte für seine Kunsthandlung, war ein passionierter Sammler und Förderer junger Talente. Der Kunstsalon Sasse war seit Generationen in der Familie und hatte weithin in Fachkreisen einen guten Ruf.
Auch Vera entfloh nun ein Seufzer. Es war eben nichts vollkommen auf der Welt.
»Wir haben Claus und Katrin etwas mitgebracht«, sagte sie, als Edgar den Sekt eingeschenkt hatte. »Es gibt da ganz originelle Sachen. Hoffentlich können sie mit dem Spiel etwas anfangen. Ich gebe es dir nachher für sie mit.«
»Könntest du es ihnen nicht selber geben, Vera? Ich wollte sie euch nämlich morgen herschicken, wenn es euch nichts ausmacht. Sie würden nach der Schule kommen und bis abends bleiben. Dieter braucht mich im Geschäft. Er plant doch wieder eine Ausstellung.«
»Natürlich können sie kommen. Wir freuen uns doch immer, wenn wir die beiden um uns haben, nicht wahr, Edgar?«
»Und ich bin froh, wenn ihr sie mir mal abnehmt.«
»Das sagst du in einem Ton, als liebtest du deine Kinder nicht«, hielt Vera ihrer Schwester mit leichtem Vorwurf entgegen.
»Natürlich liebe ich sie«, erwiderte Jenny ungeduldig. »Aber manchmal wächst mir eben alles über den Kopf.«
Als sie fort war, sagte Vera zu ihrem Mann: »Kannst du das verstehen, daß Jenny so unfroh ist? Sie war doch früher nicht so.«
Edgar zuckte die Achseln. »Bei Männern redet man von einer »Midlifecrisis«. Vielleicht gibt es das bei Frauen auch, so eine Krise in der Mitte des Lebens, und deine Schwester hat sie erwischt.« Er lächelte ein wenig. »Wir werden damit nichts zu tun haben, denke ich, wenn wir mal in die Jahre kommen. Oder, was meinst du?«
»Das will ich doch nicht hoffen.« Auch Vera lächelte nun, aber es war eher ein ernstes Lächeln. Sie trat auf ihn zu und legte ihm den Arm um den Nacken. »Dafür sind wir zu eng miteinander verbunden, Edgar.«
Er nickte nachdrücklich und umfaßte sie ganz, legte seinen Kopf gegen ihr leichtgelocktes, volles Haar, das die Farbe reifer Kastanien hatte. Sie war schon eine wunderbare Frau, seine Vera. Sie trugen es zusammen, daß sie keine Kinder hatten. Nach achtjähriger Ehe hatten sie die Hoffnung darauf aufgegeben. Aber sie klagte und jammerte nicht, und wenn sie manchmal traurig darüber gewesen war, hatte sie sich ihm nur inniger zugewandt. »Wir haben uns, das ist sehr viel«, pflegte sie zu sagen.
Da waren ja auch noch die Kinder ihrer Schwester, die nur zu gern zu ihrer Tante Vera kamen. Dann war doch einmal Kinderlachen im sonst so stillen Haus, und Vera hatte etwas zum Verwöhnen.
Sie bereitete auch am nächsten Tag deren Lieblingsspeise, Dampfnudeln mit Vanillesoße. »Wer soll denn die alle essen?« lachte Edgar, als sie sie auf den Tisch brachte.
»Die verdrücken wir schon«, behauptete der neunjährige Claus und rutschte erwartungsvoll auf seinem Stuhl hin und her.
»Ja, du«, seine zwei Jahre ältere Schwester knuffte ihn leicht in die Seite, »du wirst sowieso zu dick. Sagt Mama immer.«
»Sagt sie nur, wenn sie schlechte Laune hat. Hat sie leider öfter.« Claus wandte sein rundes Gesicht der Tante zu. »Wieso bist du eigentlich immer gutgelaunt, Tante Vera?«
»Tante Vera hat ja auch nicht soviel um die Ohren wie unsere Mama«, hielt ihm Katrin altklug entgegen. »Sie hat kein Geschäft am Hals und keine Kinder, die sie nerven. Ich schaffe mir bestimmt auch mal keine an. Ich mach’s wie du, Tante Vera. Du hast es doch ganz toll. Immer Zeit.«
»Ja, ja«, sagte Vera. »Jetzt debattiert mal nicht länger, sondern greift zu.« Das ließ sich Claus nicht zweimal sagen, es gab ein fröhliches Schmausen, und die Dampfnudeln wurden bald weniger.
»Wieso mußt du fort, Onkel Edgar?« fragte Claus nach dem Essen ganz enttäuscht. »Ich denke, du hast noch Urlaub und mußt nicht in deine Bank.«
»Es ist nicht ›meine‹ Bank«, stellte Edgar richtig, »ich leite nur die Filiale. Und ich muß meinen Wagen in der Werkstatt nachsehen lassen, das ist auch wichtig.«
»Och, wo wir doch gerade da sind… Du könntest doch das neue Spiel mit uns spielen. Das verstehen wir sonst überhaupt nicht. Wie sollen wir denn damit klarkommen?«
»Tante Vera wird euch helfen. Ich bleibe ja auch nicht lange weg.«
»Ihr werdet doch auch Schularbeiten machen müssen«, meinte Vera. Die beiden Kinder wechselten einen Blick. »Das ist ja gerade das Fürchterliche!« stöhnte Claus.
»Och«, seine Schwester machte eine wegwerfende Handbewegung, »die können wir auch heute abend noch machen. Oder, bei uns fällt morgen die erste Stunde aus, dann mach ich sie morgen früh.«
»Und ich hab gar nicht viel auf«, fiel Claus eifrig ein. Schmeichelnd griff er nach der Hand seiner Tante. »Laß uns lieber spielen, ja?«
Weil das Wetter immer noch schön war, setzten sie sich damit auf die Terrasse, dort verteilten sie auf der Vorlage die drolligen Figürchen, die nach bestimmten Regeln in ein Ziel gebracht werden mußten. Das mußten sie erst studieren, und sie waren noch eifrig dabei, als Katrin plötzlich sagte: »Wer schleicht’n da vorne rum? Gehört die hier in die Straße? Die guckt immer her.«
Vera sah auf. Isabella! Da war sie tatsächlich schon wieder. Und jetzt näherte sie sich zögernd, als ihre Blicke sich trafen. »Guten Tag«, sagte sie, sichtlich eingeschüchtert von den Kindern, die sie wie einen Störenfried betrachteten. Sie wandte sich an Vera. »Sind das Ihre Kinder? Ich dachte, Sie hätten keine.«
»Wir sind hier nur zu Besuch«, erklärte Claus, »bei unserer Tante.«
Vera nahm die kleine Hand, die sich ihr scheu und irgendwie bittend entgegenstreckte. »Guten Tag, Isabella. Bist du denn schon wieder allein unterwegs?« Das Kind nickte, es sah auf den Tisch. »Darf ich da mitspielen?« fragte es.
»Nee«, antwortete Claus unumwunden, »das verstehst du doch nicht. Wir haben es auch gerade erst kapiert.«
»Ja, und wir wollten gerade anfangen«, vollendete Katrin nachdrücklich und kehrte dem ungebetenen Gast den Rücken zu.
Das kleine Mädchen fühlte sich deutlich abgewiesen, es wurde rot. Einen Moment wartete es noch, den Blick auf Vera gerichtet. Als auch diese es nicht zum Bleiben aufforderte, drehte es sich um und lief rasch und beschämt davon.
»Was die für ausgelatschte Schuhe anhat«, bemerkte Katrin verächtlich.
»Jetzt komm aber, du fängst an«, drängte Claus, und der kurze Zwischenfall war vergessen. Nur Vera mußte noch daran denken, wie das Kind sie angeschaut hatte…
*
Es verging ungefähr eine Woche, bis das Mädchen wiederkam. Vera war im Garten und schnitt ein paar Blumen für die Vase auf dem Wohnzimmertisch. Ihr Mann war nun wieder im Büro, für ihn waren die Ferien vorbei.
»Hallo, Isabella«, sagte Vera mit freundlichen Lächeln. »Komm ruhig näher. Sieh mal, wird das nicht ein schöner Strauß?«
Das Kind nickte. »Kann ich denn heute ’n bißchen bleiben?«
»Ja, du kannst auch nachher mit reinkommen, da kriegst du ein Eis. Das magst du doch sicher.«
Es schien die Erfüllung eines Traumes für Isabella zu sein, mit ins Haus genommen zu werden. Jedenfalls sah sie sich fast andächtig um, und ihre Augen glänzten. »Da hab’ ich jeden Tag dran gedacht. Ich meine, an Sie hab’ ich gedacht, jeden Tag«, bekannte sie.
»Ich habe auch mal an dich gedacht, Isabella.« Vera ordnete die Blumen in die Vase. »Weißt du, was mich wundert? Daß du immer allein herumläufst. Du hast doch Geschwister. Kümmern die sich denn gar nicht um dich?«
»Die sind doch schon groß. So groß wie die Kinder, die neulich bei Ihnen waren. Ja, genauso. Die mich nicht haben wollten. Ich dachte, die wären vielleicht immer noch da. Darum bin ich so lange nicht gekommen.«
»Na, so lange war das nicht«, warf Vera ein.
»Doch, ganz lange«, widersprach das Kind mit einem Nicken.
»Hast du denn deinen Eltern erzählt, wo du manchmal hingehst?« wollte Vera wissen. Ein unsicherer Ausdruck erschien in dem kleinen, spitzen Gesicht. »Ja – nein, nicht so richtig –«, und schnell fuhr das Kind fort: »Mein Papa fährt auch so ein schönes Auto wie das, was draußen manchmal vor Ihrer Tür steht. Das gehört doch Ihnen?«
Vera bejahte. »Und macht ihr da manchmal auch Ausflüge damit, so die ganze Familie?«
»O ja, ganz schöne Ausflüge. Meine Mama packt dann einen Korb mit lauter feinen Sachen, die essen wir dann auf einer Wiese. Und Papa angelt und fängt Fische, das ist ganz toll.«
»Hm, das kann ich mir schon vorstellen.« Vera holte Eis aus dem Gefrierschrank und gab Isabella eine Portion zu schlecken.
Als sie ihrem Mann am Abend davon erzählte, sagte er: »Verwöhne sie nicht noch, sonst wirst du sie am Ende überhaupt nicht mehr los.«
»Ach, Edgar, wenn sie doch so gern hier ist. Ich schicke sie schon rechtzeitig nach Hause. Es liegt etwas in ihren Augen, dem ich nicht widerstehen kann.«
Als Isabella zwei-, dreimal wieder dagewesen war, sprach sie doch erneut mit ihrem Mann darüber. »Weißt du, was ich merkwürdig finde? Sie trägt immer dasselbe verwaschene Hängerchen, und wenn es kühl ist, hat sie ein Strickjäckchen drüber, das ihr zu klein und an den Ärmeln geflickt ist. Ich verstehe eigentlich nicht, daß ihre Mutter sie so herumlaufen läßt. Ob das denn nur alles stimmt, was sie von ihrem Zuhause erzählt?«
»Du weißt ja gar nicht, wo ihr Zuhause ist«, hielt Edgar ihr vor. »Kümmere dich doch mal darum, und frage sie ganz energisch danach.«
Aber dazu sollte es nicht mehr kommen.
Es war an einem Donnerstag nachmittag, Claus und Katrin waren bei Vera, weil ihre Mutter im Geschäft gebraucht wurde. Diesmal machten die beiden brav ihre Schularbeiten.
Vera war dabei, einen Geburtstagsbrief an ihre Freundin in Amerika zu schreiben, als ein Geräusch von draußen sie aufmerken ließ. Wer war denn da im Vorgarten? Sie erhob sich und trat in die offenstehende Terrassentür. Verblüfft sah sie auf das Bild, das sich ihr bot: Eine fremde Frau hielt Isabella bei den Schultern gepackt und schüttelte sie wie ein Bündel hin und her. »Hier finde ich dich endlich, du ungezogenes Kind«, keifte sie los, »was denkst du dir denn eigentlich, einsperren sollte man dich.«
»Lassen Sie das Kind los«, befahl Vera, die mit ein paar Schritten bei ihnen war. »Sie tun ihm ja weh.«
»Hat sie was Besseres verdient?« rief die robuste Frau erbost, mit hochrotem Kopf. »Immer wegzulaufen, und wir können sie immer wieder suchen. Marsch, ab jetzt!« Mit diesen Worten gab sie dem Mädchen einen kräftigen Klaps auf den Rücken.
»Moment mal!« gebot Vera Einhalt. »Wer sind Sie überhaupt? Sind Sie Isabellas Mutter?«
»Isabella, wieso Isabella?« fragte die Frau unwirsch. »Die hier heißt Laura, und eine Mutter gibt’s da nicht. Wir im Waisenhaus sorgen für das undankbare Geschöpf. Aber jetzt gibt’s Stubenarrest, das wirst du schon sehen!« Und sie zerrte das Kind mit sich fort. Es weinte nicht, das kleine Gesicht war verkrampft, ohne einen Hauch von Farbe, aber den Blick, den es zurückwarf, würde Vera nie vergessen.
Sehr langsam ging sie zurück. Waisenhaus… Es war also alles gelogen, was Isabella, nein, Laura, ihr erzählt hatte.
»Was war’n da los?« fragte Claus neugierig.
»Nichts weiter, mach deine Schularbeiten«, antwortete Vera.
Jenny holte ihre Kinder am Abend ab, und Ruhe kehrte im Haus ein.
»Du bist ja so still heute, Vera«, sagte Edgar, dem seine Frau ungewohnt einsilbig vorkam. »War irgendwas?«
»Gibt es hier in der Nähe eigentlich ein Waisenhaus?« fragte Vera so unvermittelt, daß er erstaunt aufblickte.
»Nicht, daß ich wüßte. Oder doch, warte mal, am Stübeweg, dort, wo die alten Mietshäuser stehen, habe ich im Vorbeifahren schon manchmal eine Kinderschar gesehen, die da auf dem Hof spielte. Das könnte so etwas sein.«
»Aber das ist doch ziemlich weit«, bemerkte Vera nachdenklich.
»Ja, ein ganzes Stück. Wie kommst du darauf?«
»Das Kind ist dort, Isabella, die eigentlich Laura heißt.« Und sie erzählte ihm, was am Nachmittag vorgefallen war.
»Da hat sie uns ja eine schöne Lügengeschichte aufgetischt. Daß irgend etwas daran nicht stimmte, hatte ich mir schon fast gedacht.« Edgar lachte kurz auf. »Aber Phantasie hat sie, das muß man ihr lassen. Na, in Zukunft werden sie wohl besser auf sie aufpassen.«
Vera saß mit gesenkten Lidern. »Wie sie mich nur angesehen hat, als sie sich nach mir umdrehte«, sprach sie leise vor sich hin.
»Nun laß dir das nicht so unter die Haut gehen«, sagte ihr Mann, und damit war die Sache für ihn erledigt.
Aber für Vera war sie es nicht. Sie mußte oft an das kleine Mädchen denken, sie konnte ihm auch nicht wirklich böse sein, daß es sie so angelogen hatte. Dieses Kind war nicht schlecht, das glaubte sie zu wissen. Es hatte sich ein Märchen zurechtgesponnen, darin eine liebe Mama und Geschwister und ein Papa vorkamen, der in einem schönen Auto mit ihnen ausfuhr. Manchmal mochten sich Traum und Wirklichkeit bei ihm verwischt haben. Hier, bei ihnen, hatte Isabella ein Stück von ihrer Märchenwelt gefunden, deshalb hatte es sie immer wieder hergezogen.
Woher sie wohl kam? Ob sie niemanden mehr auf der Welt hatte?
Da es ihr nicht aus dem Kopf gehen wollte, machte sie sich eines Tages auf in diese andere Gegend, wo die hübschen, von Gärten umgebenen Einfamilienhäuser großen grauen Häusern billiger Bauweise wichen. An einem davon, im Stübeweg, war ein Schild angebracht: Karolinen Haus! stand darauf, weiter nichts. Einige Kinder spielten im Hof mit leeren Büchsen, daß es nur so schepperte. Sie unterbrachen kurz ihr Spiel und sahen ihr neugierig nach. »Wo wollen Sie denn hin?« rief ein Junge. »Sie haben sich wohl verlaufen.« Denn wenn schon mal Besuch für jemand von ihnen kam, sah er bestimmt nicht so aus.
Vera achtete nicht darauf, sie ging in das Haus. Dort lief sie ausgerechnet der Frau in die Arme, die so unsanft mit Isabella umgegangen war. Diese erkannte sie wieder. »Was wollen Sie hier?« fragte sie barsch.
»Ich wollte das Kind gern mal sehen, das manchmal bei mir war«, antwortete Vera fest und sah der anderen gerade in die Augen.
»Das können Sie nicht, die ist noch eingesperrt«, kam es wie vorher zurück.
Vera straffte sich.
»Hören Sie, so können Sie mich nicht abfertigen. Ich kann mir nicht vorstellen, daß es verboten sein soll, hier ein Heimkind zu besuchen.«
Bei dem bestimmten Ton schien die andere etwas kleiner zu werden. Sie zuckte die Achseln. »Sie können ja mal mit Frau Behrend sprechen. Da hinten links, die letzte Tür ist es.«
Als sie ihr gegenübertrat, erkannte Vera sofort, daß sich mit dieser Frau anders würde reden lassen. Das Gesicht war nicht unsympathisch unter dem leicht ergrauten Haar, ihr Blick war aufmerksam und freundlich auf die Besucherin gerichtet.
»Mein Name ist Vera Gerstner. Ich komme wegen Laura, die ich allerdings unter dem Namen Isabella kannte.«
»Ach, Sie sind das, bei Ihnen wurde die Ausreißerin aufgefunden. Ja, wie war das nun eigentlich? Wieso konnte sie so oft bei Ihnen sein?«
»Ich hatte doch keine Ahnung, daß sie aus diesem Haus weggelaufen war und Sie das Kind suchten. Mir hat sie etwas von einer Familie erzählt, und ich nahm an, daß sie in der Nähe wohnte. Sie war ja auch nie lange bei mir, eine Stunde oder anderthalb, mehr nicht.«
»Und eine Stunde brauchte sie für den Weg hin und zurück, und wir haben uns den Kopf zerbrochen, wo sie steckte«, sagte Frau Behrend unmutig.
»Es tut mir leid«, sagte Vera.
»Sie trifft ja keine Schuld«, lenkte die Heimleiterin ein. »Aber wie ist sie denn nur gerade auf Sie gekommen?«
»Ich weiß es nicht. Sie war immer ganz glücklich, wenn sie bei mir war. Ich brachte es nicht übers Herz, sie fortzuschicken. Kann ich Laura denn noch einmal sehen? Die Frau, die ich draußen auf dem Gang traf, wollte es mir verwehren. Die war es auch, die das Kind bei mir aufgespürt und wie ein Bündel hinter sich her gezogen hat.«
»Das ist Frau Kunze, die hier die Aufsicht hat. Sie hat sich immer maßlos über Lauras Verschwinden und ihr Verstocktsein geärgert.«
»Aber so grob brauchte sie deshalb nicht mit ihr umzugehen«, behauptete Vera mit leichtem Vorwurf.
»Mit Güte und Nachsicht ist es hier nicht immer getan, Frau Gerstner«, wies Adele Behrend diesen zurück. »Manchmal muß man schon hart durchgreifen, sonst tanzen sie einem auf dem Kopf herum. Aber wenn Sie Laura sehen wollen, bitte. Sie ist im Schlafsaal im 1. Stock. Sie können hinaufgehen.«
»Darf sie nicht raus?«
»Nein! Strafe muß sein«, erwiderte Frau Behrend.
Was für ein düsteren, häßliches Haus das doch war, mußte Vera denken, als sie die ausgetretenen Stufen emporstieg. Ob es in allen Waisenhäusern so aussah, fragte sie sich beklommen. Von irgendwoher hörte sie heftig streitende Kinderstimmen, sie beschimpften sich gegenseitig mit den übelsten Worten.
Sie fand Laura in dem großen leeren Schlafsaal auf einem der vielen schmalen Betten liegend, den Kopf in eine graue Wolldecke gebohrt. Schlief sie? Vera berührte sie an der Schulter. »Hallo, Isabella«, redete sie sie an, so wie sie sie immer genannt hatte. Das Kind zuckte sofort empor und sah sie ungläubig an. »Aber jetzt muß ich ja Laura zu dir sagen«, fuhr Vera in leichtem Ton fort. »Warum hast du mir denn nicht deinen richtigen Namen genannt, hm? Laura ist doch auch ein hübscher Name.«
Die Kleine wurde glühendrot, sie warf sich zurück und versteckte ihr Gesicht in der Decke. Vera wartete einige Sekunden, dann sagte sie: »Nun komm schon, ich habe den Weg hierher nicht gemacht, damit du dich jetzt vor mir versteckst.«
»Sind Sie mir denn nicht böse?« kam es halberstickt zurück.
»Sonst wäre ich ja nicht hier. Aber daß du mich so sehr angeschwindelt hast, das war natürlich nicht richtig von dir.«
»Sie hätten mich doch sonst gleich zurückgeschickt, weil man hier nicht fortlaufen darf.«
»Aber lügen darf man auch nicht«, hielt Vera ihr vor.
»So gelogen war das doch nicht.« Laura richtete sich auf und sah Vera mit einem dunklen, unkindlichen Blick an. »Ganz oft hab ich lange und fest die Augen zugemacht, und dann war es wahr. Wirklich wahr.«
»Aber doch nur in deiner Vorstellung«, sagte Vera sanft. »Wieso hast du denn eigentlich zu mir gefunden? Es ist doch weit. Setz dich mal richtig hin, und ich setz mich neben dich, und du erzählst es mir.«
Laura gehorchte. Sie strich über ihr zerknittertes Kleidchen, es war dasselbe, das sie immer trug, und sie begann: »Wie ich mal wieder weggelaufen und so rumgegangen war, da bin ich immer weitergegangen, bis zu den schönen Häusern, da, wo alles ganz anders ist, so Gärten und Blumen und Bäume, und da hab ich Sie mehrmals gesehen, und da bin ich immer wieder hin, bis Sie mich mal gerufen haben und mit mir gesprochen haben. Das war so schön. Ich hab mir gewünscht, das würde nie aufhören.«
»Ach, Laura, du bist mir eine rechte Träumerin.« Wieder war Vera seltsam gerührt über dieses Kind.
»Wenn ich nicht träumen würde, wollte ich lieber nicht mehr am Leben sein«, sagte Laura und sah zu Boden.
Vera erschrak über diese Worte einer Sechsjährigen. »Ist es so schlimm hier?« fragte sie leise. Es war eine überflüssige Frage, hatte sich die Atmosphäre dieses Hauses ihr selber schon beklemmend auf die Brust gelegt.
Laura zuckte die Achseln und schwieg. »Bist du schon lange hier?« forschte Vera weiter.
»Schon immer. Ja, ich glaube, schon immer«, sagte das Kind und bewegte die Zehen an den kleinen bloßen Füßen.
»Und da ist niemand, der manchmal zu dir kommt und sich um dich kümmert?«
»Nein, wer soll denn kommen?« Es klang verwundert. Vera, die neben ihr auf dem schmalen Bett saß, strich ihr mitleidig über das Ärmchen. Da hob Laura den Kopf, ein scheues Lächeln flog über ihr blasses Gesicht. »Aber jetzt sind Sie gekommen, wo ich nicht mehr zu Ihnen darf!«
»Das werden wir sehen, Laura.« Vera erhob sich, im gleichen Moment sprang das Kind auf. »Müssen Sie jetzt schon wieder gehen?« fragte es angstvoll.
»Ich komme wieder«, versprach Vera.
Sie begab sich wieder zu Frau Behrend, die mit sorgenvoller Miene an ihrem Schreibtisch über Akten saß.
»Ich würde gerne Näheres über Lauras Schicksal wissen«, sagte Vera. »Das Kind wollte ich nicht ausfragen. Es scheint sich selber nicht sicher über seine Herkunft zu sein. Sie werden mir etwas darüber sagen können.«
»Leider nicht viel, Frau Gerstner.« Mit einer Handbewegung bot sie Vera Platz an, schob die Akten ein wenig beiseite und legte die Fingerspitzen zusammen. »Laura Pavel, wie sie mit vollem Namen heißt, war knapp zwei, als sie aus einem Kinderheim zu uns überwiesen wurde, weil dort keine Zahlungen mehr eingingen. Hier leben die, für die der Staat sorgen muß, die Fürsorge, das Sozialamt, und die Zuschüsse sind knapp. Deshalb sieht es hier auch so aus.« Ihr Blick ging durch den Raum, dessen nackte Wände dringend eines Anstrichs bedurften.
Der Zustand des Hauses interessierte Vera im Moment weniger. »Demnach hat sie keine Eltern mehr, auch keine Angehörigen?« kam sie auf das Thema Laura zurück. »Wer hatte sie denn in jenes andere Heim gebracht?«
»Das müssen Pflegeeltern gewesen sein, die aber dann auch nichts mehr von sich hören ließen. Offiziell ist da weiter nichts bekannt. Laura kam und blieb. Wo sollte sie denn auch hin?«
»Wo ist sie denn geboren, wissen Sie das?«
»Nein. Es liegen ja keinerlei Papiere vor. Nur das Geburtsdatum wurde seinerzeit angegeben. Am 16. Mai ist sie sechs geworden.«
»Das ist ja seltsam. So ein verlorenes Kind…« Vera schüttelte den Kopf.
»So seltsam ist das gar nicht, Frau Gerstner«, sagte die Heimleiterin. »Es gibt viele Kinder, die verlassen und vergessen sind. Und es werden täglich mehr. Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, Scheidungen und Drogen zwingen Eltern, ihre Kinder wegzugeben. Deshalb sind die Heime bis oben hin voll. Ja, das ist eine sehr traurige Entwicklung.«
»Das verstehe ich nicht. Ich denke, es gibt so viele adoptionswillige Paare«, warf Vera ein.
»Davon scheitert ein großer Teil an den strengen Adoptionsgesetzen, manche scheuen auch den Weg durch sämtliche bürokratische Instanzen, der ziemlich mühevoll ist. Ein anderer Grund ist, daß sich immer weniger Familien finden, die bereit sind, Kinder aufzunehmen. Die meisten sagen: Eins reicht, wir sind froh, den Rücken frei zu haben, reisen zu können… Die Welt ist kalt geworden, Frau Gerstner.«
Ein Anruf unterbrach ihr Gespräch. Vera sah zum Fenster hin. Sie dachte über das nach, was die Heimleiterin ihr gesagt hatte. Dennoch vernahm sie deren Protest: »Aber man hatte den Leuten doch angeboten, ihnen mit pädagogischen Hilfen zur Seite zu stehen! Da sollten sie doch nicht jetzt schon nach wenigen Wochen die Flinte ins Korn werden. Für den Jürgen bedeutet das eine Katastrophe, wenn er wiederum abgeschoben wird.«
So ging das noch eine Weile hin und her, bis Frau Behrend mit einem schweren Seufzer den Hörer zurücklegte und sich mit der Hand über die Stirn fuhr. »Das kommt auch noch dazu«, murmelte sie. »Die meisten Kinder aus unseren Häusern sind doch irgendwie gestört, was dann erst im alltäglichen Zusammenleben spürbar wird, und dann zucken auch gutwillige Pflege- oder Adoptionseltern zurück.«
»Aber Laura ist nicht gestört«, sagte Vera schnell.
»Laura? Nein, das kann man so nicht nennen. Sie flüchtet sich nur zu oft in eine Traumwelt. Dann erzählt sie das Blaue vom Himmel herunter, wie das ja auch bei Ihnen geschah.«
»Damit schützt sie sich wohl nur vor der harten Wirklichkeit«, bemerkte Vera verhalten. »Wie lange wird sie noch in diesem Haus bleiben müssen, wenn nicht ein Wunder geschieht?«
»Sie wird ein Fall für die Fürsorge bleiben, wie die meisten anderen hier auch. Einmal hat sich jemand für Laura interessiert, es gab auch schon eine gewisse Zuwendung, aber die wollten dann doch lieber ein Kleinkind. Laura war ihnen schon zu groß. Zwei- bis Dreijährige sind eher gefragt, ältere Kinder weniger.«
Vera fiel Lauras Ausspruch ein, sie sei schon »zu alt«. Jetzt fand sie ihn nicht mehr so wunderlich. Wieder läutete das Telefon. Diesmal war es nur ein kurzes Gespräch. Vera stand auf.
»Ich will Sie nun nicht länger aufhalten, Frau Behrend. Haben Sie Dank, daß Sie sich Zeit für mich genommen haben. Die Unterredung war für mich sehr aufschlußreich. Aber eine Bitte habe ich: Erlassen Sie Laura die Strafen. Lassen Sie sie doch zu den anderen Kindern im Hof. Sie ist da oben so allein.«
»Damit Sie mir bei nächster Gelegenheit wieder ausreißt?« Die Heimleiterin schüttelte den Kopf. »Nein, da muß ich konsequent bleiben. Diesen dritten Tag muß sie noch durchhalten.« Streng und unnachgiebig klang es. Sie stand ebenfalls auf und reichte der Besucherin die Hand. »Auf Wiedersehen, Frau Gerstner.«
»Auf Wiedersehen.« Vera zögerte kurz, bevor sie entschlossen sagte: »Ich werde Laura manchmal zu mir holen. Das werden Sie doch erlauben?«
Die andere schien überrascht. »Ja, gewiß. Das ist kein Gefängnis hier.« Ihr Blick wurde prüfend. »Sie interessieren sich für Laura, nicht wahr?«
»Ich habe Mitleid mit ihr. Ich möchte ihr wenigstens ab und zu eine Freude bereiten.«
»Haben Sie Kinder, Frau Gerstner?«
»Nein«, antwortete Vera, »aber ich kann damit umgehen. Mein Mann ist tagsüber nicht da, er kommt nur zum Mittagessen, so habe ich nachmittags öfter mal Zeit. Ich werde es Laura sagen, daß Sie es erlauben. Dann hat sie schon etwas zum Freuen.«
Laura saß mit gefalteten Händen gerade und stocksteif auf dem Bettende, das zur Tür gewandt war. Sie hatte sich gekämmt, sie hatte ihre Schuhe und das Strickjäckchen angezogen. Sie empfing Vera mit den Worten: »Ich habe immer da hingeguckt«, sie deutete auf die Tür, »und ich habe ganz fest geglaubt, daß Sie wiederkommen.«
»Das hatte ich dir doch versprochen«, sagte Vera.
»Darf ich raus?« fragte Laura schnell. »Mit Ihnen?«
»Nein. Die kleine Ausreißerin hat noch Heimarrest bis morgen.«
»Ach, doch.« Enttäuscht ließ das Kind die Schultern hängen. »Ich dachte, Sie wären vielleicht bei Frau Behrend gewesen wegen mir.«
»Das war ich auch, Laura, und ich habe auch ein gutes Wort für dich eingelegt. Aber sie läßt sich nicht erweichen. Man muß sie auch verstehen, weißt du. Bei den vielen Kindern hier muß sie schon streng sein.«
»Ja«, sagte Laura kleinlaut, und der Kopf sank ihr auf die Brust. »Manche sind schlimm, die raufen und klauen und sind furchtbar frech. Aber so schlimm bin ich doch nicht.« Die letzten Worte kamen nur wie ein Flüstern.
»Nein, das bist du nicht. Und weil ich das weiß, sage ich dir jetzt etwas.« Vera legte ihr die Hand unter das Kinn und hob das Gesichtchen zu sich empor. »Du darfst auch weiterhin manchmal zu mir kommen, von nun an mit Erlaubnis. Ich hole dich dann ab, damit du nicht immer den weiten Weg machen mußt. Ich habe nämlich auch ein Auto, nur benutze ich es seltener.«
Während sie sprach, waren Lauras Züge immer heller geworden. »Danke«, stammelte sie, »oh, danke. Dann werde ich jetzt immer auf Sie warten.«
»Aber nie mehr fortlaufen, hörst du? Das mußt du mir versprechen, damit es hier nicht wieder Ärger gibt.«
Laura nickte nachdrücklich und versprach es ihr in die Hand. Als Vera fortging, blieb sie noch lange auf der Bettkante sitzen, kniff fest die Augen zu und sah viele wunderschöne Bilder vor sich.
*
»Sei doch nicht so hektisch, Jenny«, sagte Vera, »eine Viertelstunde wirst du doch wohl mit hereinkommen können.«
»Ausgeschlossen! Ich will nur die Kinder hier abliefern, dann muß ich gleich ins Geschäft. Übernächste Woche ist die Vernissage, und die Frau Steegen ist ausgefallen. Ausgerechnet jetzt muß sie krank werden! Ich weiß bald nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Du mußt entschuldigen, daß ich dir nicht vorher Bescheid gesagt habe.«
»Macht doch nichts«, sagte Vera gelassen, die neben dem Wagen stand.
»Nun steigt schon aus«, herrschte Jenny ihre Kinder an. »Was trödelt ihr so, ihr wißt doch, daß ich es eilig habe. Hach, die beiden sind wirklich unleidlich zur Zeit!«
»Du schimpfst ja auch immer nur mit uns rum.« Betont langsam kletterte Claus aus dem Auto.
»Hättest mich ja mit Stefanie fahren lassen können.« Katrin folgte ihrem Bruder. Ihr hübsches Gesicht war ein einziger Vorwurf. »Die ist jetzt schon mit ihren Eltern in Italien, und sie hätten mich mitgenommen.«
»Hör jetzt endlich damit auf!« sagte ihre Mutter gereizt. »Und daß ihr mir Tante Vera nicht auch noch auf die Nerven geht!«
»Das werden sie bestimmt nicht tun«, beruhigte Vera ihre Schwester, die ziemlich aufgelöst aussah. Die augenblicklich herrschende Hitze schien ihre Nervosität noch zu steigern. »Wir werden uns schon vertragen, hm?« Sie legte rechts und links einen Arm um die beiden.
»Also dann, Tschüs, bis heute abend, es kann aber etwas später werden.« Mit aufheulendem Motor brauste sie davon.
»Ist doch wahr, Tante Vera!« Katrin sah zu ihr auf. »Alle Kinder verreisen jetzt in den Schulferien, manche fliegen auch mit ihren Eltern ganz weit fort, dahin, wo ihr neulich wart, nur wir müssen wegen dem blöden Geschäft zu Hause bleiben.«
»Ja, und Mama packt uns einfach ins Auto, dabei hätte ich mit Micha schwimmen gehen können«, stimmte das Brüderchen in ihr Klagelied ein.
»Wißt ihr was? Wir gehen auch schwimmen. Ihr habt doch noch Badezeug bei mir, vom vorigen Jahr.«
Vera machte die Haustür hinter ihnen zu, damit die Hitze nicht so hereindrang. Sie hielt die Räume nach Möglichkeit kühl, über der Terrasse war die große Jalousie herabgelassen.
Im Flur blieben die beiden stehen.
»Was macht denn die hier?« fragte Claus verdutzt und blickte durch die offenstehende Küchentür auf das Kind, das da auf der gepolsterten Sitzbank saß und Buchstaben in ein Heft malte.
»Ja, ich habe Besuch.« Veras Stimme klang munter. »Das ist Laura, und das sind Katrin und Claus.«
Das kleine Mädchen schob sich von der Bank. »Guten Tag.« Es wagte aber nicht, näher zu kommen.
»Hallo.« Claus wußte nicht recht, wie er sich verhalten sollte.
»Ich denke, du heißt Isabella. Du warst doch neulich schon mal da.« Dabei sah Katrin das fremde Kind von oben bis unten an. Sie bemerkte sofort, daß es jetzt anders aussah als neulich, das Haar war nicht mehr so strubbelig, zur kurzen Hose trug es ein blau-weiß gestreiftes T-Shirt.
Laura wurde rot unter diesem kritischen Blick. Jetzt bin ich nicht mehr allein mit Tante Vera, dachte sie traurig, denn so durfte sie sie jetzt nennen. Aber vielleicht wollten die beiden größeren Kinder das gar nicht. Sie würde einfach nichts sagen.
Vera überhörte die Worte ihrer Nichte. »Ich mache uns jetzt einen schönen kühlen Trunk«, schlug sie vor, »und dann fahren wir ins Waldfreibad. Laura, du kommst mit! Du wirst sehen, das wird dir gefallen. Da sind große schattige Liegewiesen.«
»Aber du kannst sicher noch nicht schwimmen«, warf Katrin etwas von oben herab ein.
Laura schüttelte den Kopf, sie sah immer noch vor sich nieder.
»Das macht nichts.« Vera ging an den Kühlschrank, sie füllte Fruchtsaft mit Mineralwasser gemischt in hohe Gläser. »Das große Becken ist ja nicht überall tief, da kannst du plantschen, Laura. Wir kaufen dir unterwegs ein Badehöschen. Einen Ball nehmen wir auch mit.«
»Ich renn aber nicht rum bei der Knallhitze«, sagte Claus.
»Brauchst du ja auch nicht.« Heiter lächelte Vera in die Runde und stellte die Gläser auf den Tisch. Laura rührte ihres nicht an.
»Ich möchte jetzt lieber gehen«, flüsterte sie.
»Von mir aus kannst du gehen«, sagte Katrin patzig. So linkisch, wie die da stand, die rechte Schulter vorgeschoben, war es sicher nicht lustig mit der, die auf einmal wieder Laura hießt. Komischer Name, sowieso.
»Och«, machte Claus. So brauchte man ja auch nicht zu ihr zu sein, sie war doch noch klein und so dünn.
Vera überlegte. Sie spürte die Spannung, die in der Luft lag. Katrin war heute eine Kratzbürste, Claus saß über sein Glas gebeugt, das er mit beiden Händen umfaßt hielt, und sog daran. Sie würde erst einmal mit den beiden reden müssen, aber ohne Laura. Die Kleine, sie fühlte sich unbehaglich und überflüssig, und Vera verstand sie. Laura fand hier, in diesem Haus und bei ihr, die einzige wirkliche Geborgenheit ihres kleinen Lebens. Jetzt war plötzlich etwas Fremdes da, das sich gegen sie richtete und sie ängstigte. Sie fühlte sich unterlegen und abgewiesen.
»Es ist gut«, sagte Vera sehr ruhig, »du mußt nicht mitkommen, Laura. Ich bringe dich zurück. Morgen kannst du weiterschreiben.«
»Wieso morgen?« fragte Katrin. »Ist sie denn jetzt jeden Tag da?«
»Nein, du brauchst mich nicht zu fahren«, wisperte Laura. »Ich kann laufen. Das habe ich doch früher auch getan.«
Sie fuhr mit den Füßen in die hübschen roten Sandalen, die unter der Bank standen. Die waren auch neu, stellte Katrin bei sich fest.
»Es ist aber doch so heiß«, wandte Vera ein, doch da sagte Laura schon, und das kam ein bißchen erstickt heraus. »Wiedersehen«, und fort war sie.
Stille breitete sich aus. Unsicher sah Claus auf seine Tante. Katrin tat unschuldig und guckte in die Luft.
»Wenn ihr ausgetrunken habt, könnt ihr schon rausgehen«, sagte Vera. »Ich hole nur die Badesachen.«
»Sie ist sauer«, raunte Claus seiner Schwester mit einem bedeutungsvollen Blick zu. »Du warst aber auch frech zu der Laura.«
Katrin warf den Kopf zurück. »Ach, ich kann sie nicht leiden. Neulich sah sie doch aus wie ein Bettelkind.«
»Heute aber nicht«, sagte Claus, der einen Sinn für Gerechtigkeit hatte. Katrin zuckte die Schultern und schwieg verbissen.
»So, wir können!« Vera kam mit einer großen Badetasche und einer Liegematte. Beides verstaute sie im Gepäckraum ihres Wagens. Die Kinder stiegen ein, und sie fuhren los. Vera mußte an Laura denken, die jetzt in entgegengesetzter Richtung zu ihrem Waisenhaus zurücktrabte. Sie hatte ihre Nichte und ihren Neffen von Herzen gern, aber sie durften nicht glauben, daß sich alles nur um sie drehen mußte.
Nachdem sie ein paar Runden geschwommen hatten, ließen sie sich im Baumschatten nieder. »War doch super«, meinte Claus und biß in einen der knackigen Äpfel, die sich auch in der Badetasche befanden. Tante Vera dachte eben an alles.
»Hm«, meinte Katrin, »im Meer zu schwimmen ist bestimmt noch was ganz anderes.« Dabei dachte sie neidisch an Steffi, die jetzt an der Riviera war, direkt an der Küste. Es war schon eine himmelschreiende Ungerechtigkeit auf der Welt.
»Hör endlich auf zu maulen.« Claus knuffte sie leicht. »Hier, nimm auch einen Apfel.«
»Nein, danke«, sagte Katrin hoheitsvoll. »Ich hole mir nachher lieber ein Eis.«
»Haste denn Geld?« fragte Claus kauend.
»Klar. Ich geb ja nicht mein ganzes Taschengeld für doofe Comic-Hefte aus. Das machen nur dumme Jungs.«
»Mensch, Katrin, du bist aber heute echt verbiestert«, fuhr Claus auf.
»Hab auch allen Grund dazu«, murrte Katrin.
»So, findest du?« mischte Vera sich ein, die sich bis dahin die Kabbelei der Geschwister stillschweigend angehört hatte. »Dann hört mir jetzt mal gut zu, ich habe euch etwas zu sagen.« Sie wandte sich den beiden zu und sah sie mit einem ernsten Blick an.
Katrins Lider zuckten. »Kann mir’s schon denken, Tante Vera. Du bist sauer auf uns, weil die wegen uns weggelaufen ist, nicht? Weil die nämlich gemerkt hat, daß wir sie nicht dabeihaben wollten.«
»Die heißt Laura, Katrin, und ich verbiete dir, so abfällig über dieses kleine Mädchen zu reden. Laura ist ein Waisenkind, sie hat keinen Menschen mehr auf der Welt und lebt, solange sie denken kann, in einem großen düsteren Haus unter lauter Kindern, die auf diese oder jene Weise ebenso arm dran sind wie sie.«
»Echt?« fragte Claus erschrocken.
Vera nickte. »Mit Laura kann man nur Mitleid haben, deshalb hole ich sie manchmal nachmittags zu mir, und – das müßt ihr euch mal vorstellen, das ist das erste Mal in ihrem Leben, daß sie in einem wohnlichen Haus ist und daß jemand nett zu ihr ist.«
»Uij…« Claus zog die Unterlippe zwischen die Zähne. »Wir waren nicht nett zu ihr«, murmelte er kleinlaut und reuig.
»Das haben wir ja auch nicht gewußt, daß sie ein Waisenkind ist«, verteidigte sich Katrin. »Sie hat sich nur so komisch benommen. Gar nicht wie andere Kinder, die ich so kenne.«
»Sie fühlt sich eingeschüchtert von euch, ist das ein Wunder? Woher soll sie denn das Selbstbewußtsein haben, das schon kleine Kinder heutzutage zeigen, die in geordneten Verhältnissen und in einer Familie aufwachsen?«
»Ist ja wahr«, nickte Claus einsichtig. »Sie ist auch so dünn. Kriegt sie da nichts zu essen?«
»Doch, natürlich. Nur ist das nicht gerade üppig, denn es stehen nicht viele Mittel zur Verfügung für dieses Haus. Und Laura ist sowieso zart, sie ißt nur wie ein Spatz.«
»Vielleicht ißt sie auch nicht, weil sie viel traurig ist«, meinte Claus. »Ich mag auch nicht essen, wenn ich traurig bin, weil Mama mal wieder schlechte Laune hat.«
»Das sieht man dir aber nicht an«, bemerkte Katrin spottlustig.
Diesmal verzichtete Claus auf eine Erwiderung, zu sehr beschäftigte ihn doch das Schicksal des fremden Mädchens. »Sind die Eltern von Laura gestorben?« wollte er wissen.
»Was denn sonst, wenn sie doch ein Waisenkind ist«, fuhr Katrin dem jüngeren Bruder über den Mund.
»Über ihre Eltern ist nichts bekannt«, sagte Vera.
»Nichts? Gibt’s das auch?« Katrin zeigte sich nun doch beeindruckt.
»Laura ist wirklich total verloren auf der Welt«, bestätigte Vera.
Ringsumher war ein fröhliches Treiben, Lachen und Zurufe. Für die Frau und die beiden Kinder, die da im Schatten saßen, schien das alles im Moment seltsam ferngerückt. Nach einigem Schweigen sagte der Junge, der die Beine angezogen, die Arme darum und das Kinn auf die Knie gelegt hatte, ungewohnt nachdenklich: »Was haben wir’s da doch gut!«
»Ja, Claus, wenn ihr es nur einseht«, sagte seine Tante mit großem Ernst. »Ihr begehrt schon auf, wenn euch mal nicht jeder Wunsch erfüllt wird. Dabei gibt es andere, die überhaupt keine Wünsche haben dürfen, weil sie zu arm sind, in jeder Beziehung.«
»Aber das sind doch nur wenige«, behauptete Katrin. Sie dachte an ihre Schulfreundinnen, die auch alles bekamen, was sie nur wollten. Zumindest fast alles!
»Mehr als man denkt«, sagte Vera. »Wir wissen das nur nicht.«
Katrin stand auf, sie streckte sich in ihrem roten Badeanzug. »Ich geh noch mal ins Wasser«, verkündete sie. »Kommst du mit, Claus?«
»Nö. Ich bleib bei Tante Vera.« Er rückte näher an sie heran, als seine Schwester zum Becken lief, und er ergriff ihre Hand, in einer scheuen Geste der Zärtlichkeit. Er sagte nichts, aber Vera wußte, was ihn bewegte.
Katrin sprach es aus, als sie nach einer Weile wiederkam und sich das kurze blonde Haar zurückstrich, das dunkel vor Nässe war.
»Wenn Laura wieder mal da ist, werden wir netter zu ihr sein, Tante Vera«, sagte sie.
*
Es kam aber nicht so bald dazu, daß sie es unter Beweis stellen konnten, weil die Großeltern Sasse bei ihnen »einfielen«, wie Jenny, nicht eben erbaut von dem unvermuteten Besuch, das bei sich nannte.
Dieters Eltern waren erst kürzlich von einer Kreuzfahrt in südlichen Meeren zurückgekommen und befanden sich nun auf dem Weg in ihr Ferienhaus im Tessin, wo sie bis zum Herbst bleiben wollten. Sie konnten es sich leisten, ihren Lebensabend zu genießen, und da sie beide, obwohl über Siebzig, gesund und vital waren, taten sie es aus vollem Herzen.
Sie wohnten in Hamburg, man sah sich nicht allzu häufig, doch nun, auf der Durchreise, wollten sie doch mal sehen, wie es bei den Kindern so ging, eventuell ein paar Tage bleiben.
Aber sie erkannten bald, daß sie nicht gerade hochwillkommen waren. Der Sohn war vollauf mit der bevorstehenden Ausstellung beschäftigt, deren Eröffnung in acht Tagen vor geladenen Gästen stattfinden sollte, die Schwiegertochter widmete sich nur mit einem gezwungenen Lächeln dem Besuch und schaute verstohlen mehrmals auf die Uhr.
»Ich muß ins Geschäft, entschuldigt mich bitte«, sagte sie schließlich. »Bei uns geht es zur Zeit drunter und drüber. Frau Müller wird euch das Zimmer richten.« Das war ihre Haushaltshilfe.
»Wir können ins Hotel gehen«, sagte Philip Sasse ernüchtert. Etwas anders hatte er sich den Empfang doch vorgestellt.
»Das wäre Dieter sicher nicht recht. Wo stecken denn nur wieder Claus und Katrin? Die kommen noch vor lauter Langeweile auf dumme Gedanken, weil ihre Freunde alle verreist sind.« Sie brachte es gereizt in einem Atemzug hervor, suchte dabei ihre Autoschlüssel mit fahrigen Bewegungen.
Als sie sie gefunden hatte und mit langen Schritten zu ihrem Wagen eilte, bemerkte der alte Herr: »Ich glaube, wir brauchen gar nicht erst etwas auszupacken, Ingeborg. Von Dieter werden wir doch nicht viel haben. Aber voriges Jahr war es eigentlich nicht viel anders«, überlegte er, und er fügte hinzu: »Der Junge arbeitet zuviel.«
»Der Junge ist immerhin achtundvierzig Jahre«, erwiderte seine Frau. »Ein bißchen Privatleben sollte er sich schon gönnen, auch seiner Frau und den Kindern zuliebe. Jenny ist ja ein Nervenbündel geworden.«
Dann kamen die Enkel, auch sie nicht gerade strahlende Ferienkinder. Sie hatten keine besonders enge Beziehung zu diesen Großeltern, die sie nur selten sahen. Außerdem waren sie schon sehr alt. Aber Katrin klagte ihnen dennoch ihr Leid.
»Schulferien, ja«, sagte sie verdrossen, als der Großvater eine Bemerkung dazu machte. »Da hat man auch nichts von, wenn man immer nur zu Hause bleiben muß.«
Daß es Kinder gab, denen es viel, viel schlechter ging, hatte sie schon wieder vergessen. Davon wollte sie im Grunde auch gar nichts wissen.
»Das ist natürlich dumm«, mußte Opa Sasse zugeben. Er wechselte einen raschen Blick mit seiner Frau. Wenn man fünfzig Jahre verheiratet war, verstand man sich auch ohne Worte.
»Wie wäre es, wenn wir euch mitnehmen würden?« fragte er.
»Wohin?« kam es wie aus einem Mund zurück.
»Ins Tessin, wo wir unser Ferienhaus haben.«
»Wo ist denn das, Tessin?« wollte Claus wissen.
»Im südlichsten Teil der Schweiz«, erklärte ihnen der Opa, »dort gibt es schon Palmen und Zypressen, und die Amtssprache ist Italienisch. Da wirst du es nicht so vermissen, Katrin, daß du nicht mit deiner Freundin fahren durftest, und einen großen See zum Schwimmen gibt es auch.«
Katrin klatschte in die Hände, und Claus fragte mit glänzenden Augen: »Da wollt ihr uns mitnehmen, echt, und für länger? Wir haben nämlich noch vier Wochen Ferien.«
»Na, wenn schon, denn schon, da lohnt es sich wenigstens«, meinte Philip Sasse angeregt. Er fand, daß es eine gute Idee war. Sie hatten doch eigentlich viel zu wenig von ihren netten Enkelkindern.
Als Jenny und Dieter nach Hause kamen, waren ihre Kinder dabei, alles mögliche in zwei Reisetaschen zu verstauen.
»Was soll denn das jetzt wieder?« fragte Jenny.
»Wir fahren mit Opa und Oma ins Tessin!« triumphierten die beiden.
»Wir hoffen, daß es euch recht ist«, sagte ihre Schwiegermutter. »Wir haben uns ganz spontan dazu entschlossen. Ihr seid doch so eingespannt, und die Kinder wissen nichts mit sich anzufangen.«
Und ob es den Vielbeschäftigten recht war! »Aber, wollt ihr euch das wirklich antun?« wandte Dieter halbherzig ein. »Ich denke, da unten ist euch eure Ruhe heilig, und damit wird es dann nicht viel sein.«
»Mit uns tun sie sich doch nichts an, Papa«, sagte seine Tochter gekränkt. »Wir werden ganz lieb sein. Ich jedenfalls. Bei Claus weiß man das ja nie.«
»Och du!« ging der Junge auf seine naseweise Schwester zu. »Wer gibt denn immer freche Antworten, du oder ich?«
»Da habt ihr schon einen Vorgeschmack«, sagte Dieter zu seinen Eltern, aber die lachten nur. Der Opa klopfte Claus die runde Wange. »Ihr werdet euch schon vertragen, was?«
»Immer!« behauptete Katrin und hob sogar den Schwurfinger dabei.
Am nächsten Morgen schon brachen die Großeltern mit ihren Enkeln in schönster Eintracht auf. Kurz vorher nahm Philip Sasse seinen Sohn noch beiseite. »Deine Frau gefällt mir nicht«, sagte er ernst, »sie macht einen nervösen und abgehetzten Eindruck.«
»Findest du?« kam es verwundert zurück. »Mir ist das noch nicht aufgefallen.«
»Weil du anscheinend gar keinen Blick mehr dafür hast. Mußt du sie im Geschäft denn so in Anspruch nehmen?«
»Aber das macht ihr doch Spaß, Vater!« Dieter konnte es sich nicht vorstellen, daß es einem Menschen keinen Spaß machen sollte, mit schönen Dingen umzugehen.
»So? Na ja, wenn du meinst…« Es klang trocken. Er wandte sich noch einmal zu seinem Sohn um. »Bring ihr wenigstens mal einen Blumenstrauß oder ein hübsches Geschenk, damit sie merkt, daß sie auch noch einen liebenden Ehemann hat.«
Dieter mußte lächeln. Mein Gott, sie waren seit dreizehn Jahren verheiratet, und Blumen hatten sie genug im Garten. Aber er nickte. »Kann ich ja machen«, sagte er friedlich.
Doch in der nächsten Stunde hatte er es vergessen.
*
»Sie würden es uns übelnehmen, wenn wir nicht kämen«, sagte Vera und legte sich die Perlenkette um den Hals. Sie trug ein schmalgeschnittenes weißes Kostüm mit kurzem Rock und langer Jacke, dazu hochhackige Pumps. Sehr elegant wirkte dieser Anzug, aber eine Vernissage bei Sasse war auch eine offizielle Angelegenheit, bei der die Presse nicht fehlen durfte.
»Ich mache mir doch absolut nichts aus moderner Kunst«, seufzte Edgar und band sich wohl oder übel eine Krawatte um. Eine solche mußte er den ganzen Tag in der Bank tragen. Viel lieber hätte er es sich an diesem warmen Sommerabend in Shorts und losem Hemd auf der Terrasse zu Hause bequem gemacht. Aber dann lächelte er schon wieder. »Ich bin eben ein Banause«, fügte er hinzu.
»Das bist du nicht. Ich kann doch auch nicht viel damit anfangen. Aber selbst Jenny sagt, es wären Bilder dabei, wie sie ihr Sohn gemalt hätte, als er fünf war und noch Cläuschen genannt wurde.«
Sie lachten beide.
»Wer ist denn dieser Marian, der da im Mittelpunkt der Ausstellung stehen soll? Ist das ein bekannter Maler?« fragte Edgar und fuhr sich noch einmal über das dunkelblonde Haar.
»Keine Ahnung«, gestand Vera. »Ich habe jedenfalls noch nichts von ihm gehört. Vielleicht ist das wieder so ein junges Talent, dem Dieter zu Ruhm verhelfen will.«
»Na, wir werden es überstehen«, sagte ihr Mann humorvoll, während er nach seinem Autoschlüssel griff.
In den Ausstellungsräumen des Kunstsalons Sasse war schon ein interessiertes Publikum versammelt, als das Ehepaar Gerstner eintraf. Jenny löste sich aus einer Gruppe, in deren Mitte sie angeregt plaudernd stand, und kam auf sie zu. »Da seid ihr ja! Nun, wie findet ihr es?« fragte sie mit einer ausholenden Armbewegung.
»Ihr habt wirklich ganze Arbeit geleistet«, mußte ihr Schwager anerkennen. Dabei ließ er seinen Blick über die zahlreichen, gut placierten Gemälde schweifen, die an den langen Wänden hingen.
»Und dir sieht man heute gar nichts mehr von der Überlastung an, Jenny«, sagte Vera. »Du siehst großartig aus.« Tatsächlich staunte sie, wie verändert ihre Schwester ihr plötzlich erschien. Das lag nicht nur an einem perfekten Make-up, nicht an der schicken Frisur und auch nicht an dem glatten, ärmellosen, milchig-rosafarbenen Kleid, so schlicht, wie es nur ein sehr bekannter Couturier schaffen konnte – nein, das alles war es nicht. Damit war zu rechnen gewesen, daß Jenny sich heute schön machen würde, da sie an der Seite ihres Gatten repräsentieren mußte. Doch es ging etwas Strahlendes von ihr aus, als sei sie über Nacht aufgeblüht und zu neuem Leben erweckt.
Zwei Mädchen reichten Sektschalen auf silbernen Tabletts herum, man plauderte, traf Bekannte oder machte sich miteinander bekannt. Dieter Sasse war in seinem Element, er redete und erklärte seinen Gästen die Herkunft und Feinheiten dieser und jener Gemälde, vor denen sie bewundernd standen. Es waren die Werke des Vincent Marian, eines jungen Malers, der in Paris lebte, auf die er besonders hinwies.
Auch Edgar und Vera betrachteten sie eingehend. »Verstehst du, was er damit ausdrücken will?« fragte Edgar einigermaßen ratlos.
»Nein«, bekannte Vera. »Aber sie reden hier alle so gescheit darüber, daß wir das nicht laut werden lassen dürfen.« Und mit einem Verschwörerblick sahen sie sich an.
»Sind sie nicht unheimlich beeindruckend?«
Jenny war zu ihnen getreten, sie legte den Arm leicht um die Hüfte ihrer Schwester. Vera sah sie an, der Hauch eines spitzbübischen Lächelns glitt über ihr Gesicht.
»Wer hat denn vor ein paar Tagen gesagt, sie wären wie von Cläuschen gemalt?« fragte sie neckend.
»Das war natürlich Unsinn«, erwiderte Jenny überlegen. »Man muß sich hineindenken. Sie lassen der Phantasie freien Spielraum.«
»Anscheinend mangelt es mir an Phantasie«, bemerkte ihr Schwager. »Ich versuche jedenfalls schon seit einer ganzen Weile, mich hineinzudenken, aber es gelingt mir beim besten Willen nicht, in dieser Wirrnis einen Sinn zu finden. Dafür bedarf es wohl einer ganz besonderen Fähigkeit.«
»Du bist eben ein trockener Bankmensch.« Aber Jenny lachte dabei. »Wartet, ich werde euch den Maler schnell mal vorstellen. Er steht dahinten mit einem Journalisten. Seht euch derweil nur weiter um.«
Kurze Zeit später kam sie mit einem großen blonden jungen Mann an. Es war Vincent Marian.
»Meine Schwester bewundert Ihre Bilder sehr«, sagte Jenny nach der Vorstellung, was freilich nicht ganz der Wahrheit entsprach.
»Danke.« Der Maler neigte seinen Kopf vor Vera. »Ich würde mich sehr freuen, wenn ich auch in Deutschland Anklang fände. In Frankreich bin ich nicht ganz so unbekannt wie hier.«
»Nun, Sie haben auf alle Fälle einen guten Start, Herr Marian«, äußerte Edgar freundlich. »Die Kunstwelt wird auf Sie aufmerksam. Vielleicht werden Sie berühmt.« Er lächelte. »Der Vorname stimmt ja schon. Es ist Ihnen nur ein glücklicheres Leben zu wünschen als Ihrem großen Kollegen.«
Er spielte damit auf Vincent van Gogh an, der in größter Armut gestorben war und dessen Bilder jetzt einen unschätzbaren Wert besaßen.
Es entspann sich noch eine leichte Konversation. Ja, er lebte in Paris, Vincent Marian, er war zum ersten Mal hier in dieser Stadt, die aber doch auch ihr eigenes Flair hatte, wie er feststellen konnte.
»Ich habe Herrn Marian schon einiges davon gezeigt«, sagte Jenny. »Wir wollten ihn doch nicht allein im Hotel sitzen lassen, und Dieter hatte hier noch letzte Hand anzulegen.«
»Ja, ich hatte eine bezaubernde Fremdenführerin«, sagte der Maler, und er lächelte Jenny dabei in einer Weise zu, die Vera zu denken gab. Und ihre Schwester, sie lächelte tief in sich hinein…
»Die beiden flirten miteinander«, behauptete Vera lachend, als sie mit ihrem Mann weiter in den anderen Raum ging, wo die Aquarelle hingen. »Jenny hat heute aber auch direkt etwas Verführerisches an sich. So habe ich sie seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen.«
»Vielleicht will sie Dieter ein bißchen eifersüchtig machen«, meinte Edgar. »Das würde ihm gar nichts schaden.«
Da wußten sie noch nicht, daß sie schon bald nicht mehr darüber lachen würden.
*
Jenny rief zwei Tage später an.
»Warum seid ihr denn vorgestern auf einmal verschwunden?« fragte sie.
»Wir fanden, wir hätten genug für unsere Bildung getan«, scherzte Vera. »Aber es war doch sehr interessant und ein gelungener Abend, nicht wahr?«
»Das kann man wohl sagen. Die Kunstkritiker haben sich auch sehr wohlwollend über die Exposition geäußert. Einiges ist auch verkauft worden, unter anderem das Gemälde ›Rotes Haus‹ von Vincent Marian. Du erinnerst dich sicher an das große Bild, es hing links an der Wand.«
»War da ein rotes Haus?«
»Nicht direkt ein Haus, und rot war es auch nicht, er hat es nur so genannt. Es war sehr symbolisch, mit versetzten Linien auf kubisch-geometrischen Grundformen.«
»Aha. Da wird er sich ja freuen, daß es einen Käufer gefunden hat. Das bringt doch Geld in die Kasse.«
»Ja, schon. Aber darauf ist Vincent weniger angewiesen. Er gehört nicht zu den Malern, die am Hungertuch nagen.« Jennys Ton wurde vertraulich. »Weißt du, sein Vater hat eine Fabrik, aus der ihm Gelder zufließen.«
»Vincent! – Du weißt ja recht gut Bescheid über ihn«, sagte Vera mit einem Lächeln in der Stimme. »Ist er denn noch da?«
»Ja. Und Dieter hat mich gebeten, mich ihm zu widmen, weil er noch zu tun hat.«
»Was du nicht ungern getan hast, hm?« bemerkte Vera mit einem gewissen Unterton.
»Das stimmt. Er ist ein reizender Mensch.« Sie machte eine winzige Pause. »Übrigens fahre ich morgen mit ihm nach Paris.«
»Nanu?« wunderte sich Vera.
»Vincent ist nicht mit dem Wagen hier. Ich soll für die verkauften ein paar andere Stücke aus seinem Atelier herschaffen. Dieter ist der Meinung, daß es sich lohnen würde und er hat ja eine Nase dafür.«
»So, so.« Vera hatte kein gutes Gefühl dabei. »Jenny?«
»Ja?«
»Du hast dich doch nicht etwa in Vincent Marian verliebt?«
Wieder schwieg Jenny einen Augenblick. Dann sagte sie plötzlich. »Und wenn es so wäre?«
»Jenny!« Vera holte Atem. »Mach keine Dummheiten. Ich muß dich wohl nicht daran erinnern, daß du…« Weiter kam sie nicht.
»Daß ich verheiratet bin und zwei Kinder habe und Mitverantwortung für das Geschäft trage. Ja, ja, ja, das weiß ich alles«, sagte Jenny in plötzlich aufsteigender Erregung. »Aber deshalb kann man mir doch wohl mal eine kleine Abwechslung gönnen, oder?« Es klang aggressiv.
»Wenn du mit der Abwechslung nichts weiter als eine Stippvisite nach Paris meinst, noch dazu aus geschäftlichen Gründen, natürlich, Jenny. Nur, es könnte ja auch mehr daraus werden…«
Jenny lachte, es klang gekünstelt. »Was soll denn mehr werden? Es wird doch alles weitergehen wie bisher.«
Vera hielt es für richtig, nicht weiter auf dem Thema zu beharren. »Was hörst du von Katrin und Claus?« erkundigte sie sich ablenkend.
»Oh, denen geht es bestens. Der Opa kutschiert sie umher, sie haben anscheinend viel Freude miteinander. Sie wollten dir eine Karte schreiben, hast du sie noch nicht bekommen?«
Noch ein paar Sätze hin und her, Vera wünschte ihrer Schwester eine gute Fahrt nach Paris und legte dann mit nicht ganz leichtem Herzen auf.
Jenny war aber doch keine leichtfertige Frau, die sich in ein Abenteuer stürzte! Damit versuchte sie sich zu beruhigen.
Sie luden Dieter, den Strohwitwer, am Donnerstag zum Mittagessen ein.
»Wann kommt deine Frau denn zurück?« erkundigte sich Edgar.
»Das wird noch ein paar Tage dauern«, antwortete er. »Marian will erst noch ein Bild vollenden, das Jenny mitnehmen soll. Er ist sehr produktiv. Ich kann nur froh sein, daß ich auf ihn aufmerksam geworden bin. Es ist ja auch mein Erfolg, wenn er sich hier durchsetzt. Dazu ist er auf dem besten Wege.«
Er nahm einen Schluck Wein und sah sehr selbstzufrieden aus.
Vera senkte den Kopf über ihren Teller. »Und Jenny wird sich freuen, einen unverhofften Kurzurlaub in Paris verbringen zu können.«
»Ja, es paßt ja auch ganz gut, wo die Kinder nicht da sind. Marian wird wohl nicht nur arbeiten. Er hat Gelegenheit, sich dafür zu revanchieren, daß Jenny sich hier für ihn Zeit genommen hat.«
»Vera und ich hatten den Eindruck«, warf Edgar lächelnd hin, »daß Jenny ganz angetan von dem jungen Mann war.«
»Er ist ja auch ein angenehmer Mensch«, gab Dieter Sasse unbefangen zurück. »Ohne die Allüren, die manche andere aufstrebende Künstler haben.«
Vera sah auf ihren Schwager, der ein kluger Mann war, hochgeschätzt in Fachkreisen. Nichts schien ihm ferner zu liegen, als seiner Frau auch nur im geringsten zu mißtrauen. Wolle Gott, daß er recht hatte!
Als er nach beendeter Mahlzeit ging, auch für Edgar wurde es wieder Zeit, sah er in der Diele einen hübschen leuchtendgelben Schultornister stehen. »Wozu braucht ihr den denn?« fragte er amüsiert und deutete darauf.
»Für unser Pflegekind«, sagte Vera heiter.
»Ihr habt ein Pflegekind? Davon weiß ich gar nichts.«
»Nicht direkt. Ich hole nur ab und zu ein kleines Mädchen aus einem Waisenhaus zu mir. Es kommt bald in die Schule, und dafür habe ich den gestern gekauft.«
»Du bist ein guter Mensch«, lächelte Dieter und drückte der Schwägerin verabschiedend die Hand.
*
Der Abendhimmel verdämmerte über den Dächern von Paris. Durch die hohe, zur Terrasse hin geöffnete Tür, kam ein Windhauch und strich über ihre bloße Haut. In der Wohnung, hoch droben auf dem Montmatre, war nichts weiter zu hören als die Atemzüge der beiden Menschen, die sich wie in einem Taumel gefunden hatten.
»Ich habe es gewußt«, sagte Vincent Marian nach einer Weile, die ihnen eine Ewigkeit dünkte, mit dunkler Stimme in die Stille hinein, »schon als wir uns beim ersten Mal begegneten, wußte ich, daß ich nicht an dir vorübergehen könnte.«
»Sprich nicht«, flüsterte Jenny. Sie bewegte sich ein wenig. »Hole mich nicht in die Wirklichkeit zurück.«
»Die Wirklichkeit sind wir beide, Geliebte, du und ich und nichts sonst.« Er beugte sich über sie, sah in ihr schönes Gesicht mit dem rotgeküßten Mund, den Augen, die tief und glänzend waren. Welcher Leidenschaft, welcher Hingabe war diese Frau fähig! »Ich möchte dich nie mehr verlieren, Jenny.«
Mit einem rätselhaften Ausdruck blickte sie an ihm vorbei, lange und schweigend. Da löste er sich von ihr und sprang auf.
»Jetzt gibt es Champagner!« verkündete er mit veränderter fröhlicher Stimme. »Heute bringe ich dich nicht mehr ins Hotel zurück.«
Es war ein Traum, draußen auf der Dachterrasse zu sitzen. Über das Gewirr der alten Häuser zu blicken und weiter, weithin über die Stadt zu ihren Füßen, mit den angestrahlten Gebäuden, Kathedralen und Palästen, den breiten Boulevards, über die in nicht enden wollenden Reihen die Autos rollten, Lichterketten gleich.
»Wird dir kühl, soll ich dir einen Schal holen?« fragte Vincent, denn Jenny hatte nur ein tief ausgeschnittenes Chiffonkleid an.
»Nein, danke, es ist ja noch Sommer.«
»Es wird immer Sommer sein, wenn wir zusammen sind.« Und er schenkte nochmals ein.
Später tanzten sie, tanzten im Mondenschein nach der Musik aus dem Kassettenrecorder, den Vincent auf den Tisch gestellt hatte.
»Da unten küssen sich auch zwei Verliebte«, lächelte Jenny und sah auf ein erleuchtetes Fenster im tiefer gelegenen Nachbarhaus, dahinter sich derer Silhouette abhob.
»Das ist eben so in meiner Stadt«, sagte Vincent.
»Du bist doch kein Franzose, darum ist es nicht ›deine‹ Stadt«, widersprach Jenny, um ihn zu necken.
»Sie ist es aber geworden, seit ich vor fünf Jahren hergezogen bin und mich zum Bleiben entschloß. Sonst hätte ich mir das Dachgeschoß nicht ausbauen lassen.«
Dies war auch ein altes Haus, Jenny hatte gestaunt, als sie mit dem knarrenden Aufzug nach oben gefahren waren und sie hineingingen. Da gab es zwei modern und großzügig gestaltete Wohnräume, die übrige Fläche war Atelier, ringsum verglast und mit einem Schiebedach, das den Blick zum Himmel freigab. Eine idealere Arbeitsstätte konnte es für einen Maler nicht geben. Nicht zuletzt entzückte sie die Freiterrasse über den Dächern.
Jenny legte den dunklen Kopf zurück und neigte ihn etwas schräg. »Und wie viele süße junge Mädchen haben im Laufe dieser fünf Jahre schon hier gewohnt?«
»Gewohnt? Keine. Ich bin nicht für Zusammenwohnen und auch nicht für süße junge Mädchen. Schau mich nicht so an, es ist wahr. Weißt du, daß du hinreißend aussiehst? Schön und geheimnisvoll wie eine Mondgöttin. Ich liebe dich…«
Vincent Marian sagte es Jenny noch hundertmal in diesen Tagen, sie konnte es nicht oft genug hören.
Wie sollte das denn ein Ende finden?
Aber die Tage, die Stunden waren nicht aufzuhalten. Sie mußte zurück.
»Das ist doch nicht das Ende«, sagte Vincent beschwörend in ihr bleiches Gesicht hinein, nachdem sie die Bilder in ihrem Wagen verstaut hatten und sie nun reisefertig war. »Wir werden uns wiedersehen, so oft du es nur ermöglichen kannst. Ich brauche dich. Mit dem Flugzeug bist du im Nu in Paris. Das ist leicht an einem Wochenende zu schaffen.«
»Ja«, sagte Jenny tonlos. »Adieu, Vincent.«
Ihr kam’s vor, als sei das eine andere, die da in den Wagen stieg und davonfuhr. Die wirkliche Jenny blieb bei dem Mann, der ihr ein neues Glück geschenkt hatte.
Dieter merkte nicht, was mit ihr geschehen war. Er freute sich nur, daß sie wieder da war und stellte fest: »Die paar Tage haben dir aber gutgetan, du siehst direkt verjüngt aus. Vielleicht solltest du öfter mal verreisen.« Das war nicht ernst gemeint. Er sagte es nur so dahin, leicht und mit einem kleinen Lächeln.
»Vielleicht werde ich das auch tun«, sagte Jenny.
Ihr Mann hörte das schon nicht mehr. Er begutachtete Marians Bilder und überlegte, wie er sie am besten placieren würde zwischen den anderen Gemälden. Nichts war ihm im Moment wichtiger als dies.
Vierzehn Tage später war es soweit, daß die Schulferien der Kinder sich dem Ende zuneigten. Philip Sasse telefonierte mit seinem Sohn.
»Dieter, könnte nicht einer von euch Katrin und Claus abholen? Ich möchte sie nicht gern allein auf den Weg schicken. Sie müssen immerhin zweimal umsteigen. Die Verantwortung will ich nicht übernehmen.«
»Jenny könnte das tun«, meinte Dieter. »Sie unternimmt doch gern mal etwas. Seit sie für mich in Paris war, um ein paar neue Bilder für die Ausstellung abzuholen, scheint sie Geschmack am Reisen gewonnen zu haben.«
»Sie kommt ja auch selten genug fort«, fand der alte Herr. »Ihr gönnt euch keine Erholungspause vom Alltag. Du hättest das sicher ebenso nötig wie deine Frau.«
»Dieses Jahr ist da nichts mehr drin, Vater. Zwei Monate läuft die Ausstellung noch, und dann muß ich schon wieder an das Weihnachtsgeschäft denken. Aber, um aufs Thema zurückzukommen, ich schicke euch Jenny.«
»Gut. Sie kann ja zwei, drei Tage früher kommen, dann hat sie auch noch was davon. Hier ist jetzt schönster Spätsommer.«
Zu seiner Frau sagte Dieter: »Tanke den Wagen auf, du sollst ins Tessin fahren, die KInder abholen. Der Opa scheint doch nicht geneigt zu sein, sie zurückzubringen. Kann man eigentlich auch nicht von ihm verlangen.« Etwas gerührt fügte er hinzu: »Du wirst ja ganz rot, Jenny. Freust du dich so darauf?« Bei sich dachte er: Sie braucht anscheinend tatsächlich ab und zu eine hübsche Abwechslung. Ich muß mir das merken.
Jenny erinnerte sich nicht, wann sie jemals von einem öffentlichen Fernsprecher aus angerufen hätte. Jetzt tat sie es, von der Tankstelle aus.
»Vincent, können wir uns in Zürich treffen? Paris – Zürich, das ist direkte Fluglinie. Ich muß von da aus weiter ins Tessin, nächste Woche beginnt die Schule für die Kinder wieder. So etwa anderthalb Tage könnten uns gehören. Kommst du?«
»Ich komme. Ich denke Tag und Nacht an dich. Liebst du mich?«
Als sie aus der Zelle kam und zu ihrem Wagen gehen wollte, lief sie fast an ihrer Schwester vorbei. »Hallo, Jenny«, sagte Vera, »du bist ja ganz geistesabwesend und glühst förmlich. Was ist denn mit dir los?«
»Vera – wo kommst du denn auf einmal her?« fragte Jenny verwirrt.
»Ich war auf dem Weg zu dir, da sah ich dein Auto hier stehen und bin ausgestiegen. Wieso telefonierst du neuerdings vom Münzfernsprecher aus?«
Jenny schwieg, sie strich sich über die Stirn, schob das dunkellockige Haar zurück. Wie zärtlich seine Stimme geklungen hatte.
»Du wolltest zu mir«, brachte sie endlich mechanisch hervor.
Vera hatte ihre Schwester mit einem langen Blick angesehen. »Ja«, sagte sie, »du kommst ja nicht zu mir, und am Telefon bist du merkwürdig einsilbig. Hast du denn jetzt etwas Zeit für mich?«
»Ja, ich – ich wollte eigentlich noch zur Bank, Geld umtauschen.«
»Französische Francs?« fragte Vera. Plötzlich glaubte sie zu wissen, und es ließ ihr den Atem stocken: Jenny war in Paris gewesen, und sie wollte wieder hin. Sie hatte mit Marian telefoniert!
»Nein, Schweizer Franken. Ich will doch die Kinder holen.«
Vera atmete auf. »Auf die Bank kannst du auch nachher noch. Laß uns eine Tasse Kaffee drüben im Café Wenz trinken. Ja, magst du?«
Zögernd nickte Jenny, sie wäre viel lieber jetzt allein gewesen, mit ihren Gedanken, mit ihrer fieberhaften Freude auf Vincent. Aber sie wollte ihre Schwester nicht kränken.
Als sie sich wenig später an einem kleinen runden Tisch gegenübersaßen, begann Vera: »Ich will ja nicht in dich drängen, Jenny, aber ganz so harmlos scheint das in Paris doch nicht gewesen zu sein, sonst hättest du mir sicher viel mehr und unbefangen davon erzählt.«
Jenny hatte sich inzwischen gefaßt. Warum eigentlich sollte sie lügen? Vera würde sie nicht verstehen, aber sie würde sie auch nicht verraten. Und schließlich: Es war ihr Leben.
»Ja, Vera«, sagte sie langsam, »wir lieben uns, Vincent und ich, und wir werden uns immer lieben, ganz gleich, was daraus werden soll.«
Vera wurde blaß. Also doch! Aber wie ruhig, wie sicher Jenny das Ungeheuerliche aussprach. Sie ließ wohl eine Minute vergehen, um jetzt nichts Falsches zu sagen. Ihr Vorwürfe zu machen und moralische Entrüstung zu zeigen, würde wenig Sinn haben.
»Ist das Wort Liebe nicht etwas zu stark dafür, Jenny?« meinte sie vorsichtig und suchte ihren Blick.
Ihre Schwester schüttelte den Kopf, mit einem verträumten, glücklichen Lächeln. »Es war so wundervoll, Vera. Ich bin eine neue Frau geworden. Morgen abend sehe ich ihn wieder. Wir treffen uns in Zürich.«
»Das hast du wohl soeben mit ihm besprochen?«
»Ja. Du siehst, ich bin ganz offen zu dir.«
»Hm.« Vera nickte vor sich hin. Nach einer kurzen Pause fragte sie: »Und was ist das für ein Gefühl, wenn du aus den Armen eines anderen Mannes kommend vor deine Kinder trittst?«
»Diese beiden Dinge haben nichts miteinander zu tun. Auf Katrin und Claus freue ich mich dann auch wieder. Das ist doch selbstverständlich.«
»Und Dieter?« fragte Vera etwas mühsam. »Kannst du ihm noch in die Augen sehen?«
»Dieter wäre nicht der erste Mann, der überhaupt nicht merkt, daß seine Frau ihm nicht mehr allein gehört«, gab ihr die Schwester mit schmalen Lippen zurück.
»Jetzt ist er vielleicht noch ahnungslos. Aber er wird es nicht bleiben. Für so dumm darfst du ihn nicht halten. Eines Tages wird er merken, daß du eigene Wege gehst. Und dann?«
»Er wird es nicht merken«, behauptete Jenny herb. »Ich werde es schon so einrichten, daß ich Vincent nur sehe, wenn Dieter keinen Verdacht schöpfen kann. Irgendwie wird sich immer ein Weg finden.«
»Ist dir klar, daß damit eine Kette von Lügen in dein Leben kommt, an der du schwer tragen wirst?« hielt Vera ihr ernst und bedrückt vor. »Denn in unserer Art liegt das nicht, Jenny.«
»Wenn es doch sein muß…« Jenny sah vor sich nieder. Mechanisch rückte sie an ihrer Kaffeetasse. Plötzlich hob sie den Kopf. »Ich weiß, daß du das nicht nachvollziehen kannst, Vera. Du bist glücklich in deiner Ehe. Ich bin es schon lange nicht mehr. Ich wußte doch gar nicht mehr, was Glück ist. Für Dieter bin ich – ja, wie soll ich sagen – etwas sehr Nützliches. Ich sorge für den Haushalt, ich erziehe die Kinder, auch das überläßt er ja weitgehend mir, im Geschäft ersetze ich eine Arbeitskraft, wenn es nötig ist, und ich bin an seiner Seite bei offiziellen Anlässen. Daß ich als Frau dabei verkümmere, danach fragt niemand.«
»Aber Jenny, übertreibst du jetzt nicht? Du hast dich seit einiger Zeit in eine Unzufriedenheit hineingesteigert, siehst alles negativ. So ist es doch gar nicht.«
»Was meinst du, wie das für mich war«, brach es weiter aus Jenny heraus, als seien die Einwände ihrer Schwester an ihrem Ohr vorübergegangen, »als Vincent schon bei der Vorstellung spontan und wie überrascht zu mir sagte: Wie schön Sie sind! Wo ich mich doch schon alt und häßlich fand, weil ich seit Jahren kein Kompliment mehr gehört hatte. Und als ich dann, weil Dieter es so wollte, den Abend mit ihm verbrachte, wir durch die Stadt bummelten, irgendwo etwas tranken, da fühlte ich mich so jung an seiner Seite, so unsagbar beschwingt. Der Funke ist sofort übergesprungen. Es war von Anbeginn mehr als ein Flirt.«
»Und dann schickt Dieter dich auch noch nach Paris!« stöhnte Vera und legte die Hand gegen die Stirn.
»Und es kam alles so, wie es kommen mußte«, vollendete Jenny. »Auch Vincent ist glücklich.« Jetzt lächelte sie wieder nach innen im Gedanken an seine zärtliche Stimme.
»Kann er denn glücklich sein, so, wie die Dinge liegen?« murmelte Vera vor sich hin. Sie blickte auf. »Ist er nicht wesentlich jünger als du?«
»Zwölf Jahre, ungefähr«, sagte Jenny leichthin. »Aber das spielt zwischen uns überhaupt keine Rolle.« Sie warf einen Blick auf die Uhr. »Ja, ich muß weiter, Vera, ich habe noch einiges zu besorgen. Mach bitte nicht so ein tragisches Gesicht. Dies ist keine Tragödie, sondern eine wundervolle Liebesgeschichte.«
Wenige Stunden später sagte Vera zu ihrem Mann: »Jenny hat vollkommen den Verstand verloren. Sie glaubt doch tatsächlich, in dem Maler die große Liebe gefunden zu haben!«
»Vierzig scheint ein gefährliches Alter zu sein«, meinte Edgar, beinahe amüsiert. »Setzt sie dem armen Dieter denn wirklich Hörner auf?«
»Ja, und darüber kann man nicht lächeln, Edgar. Damit rennt sie doch in ihr Unglück.«
»So düstere Prophezeiungen muß man nicht gleich aussprechen. Sie wird schon schnell genug wieder zur Besinnung kommen und sich reuig in Dieters Arme flüchten.«
»Wenn du sie gesehen hättest, würdest du nicht so reden. Da ist eine Leidenschaft in ihr, die einem Angst machen kann.«
»Hast du ihr denn nicht ins Gewissen reden können?«
»Ich habe es versucht. Aber es sieht so aus, als könnte kein Mensch sie aufhalten.«
»Und wohin soll das führen?«
»Danach fragt Jenny nicht. Das ist ja das Schlimme. Sie setzt alles aufs Spiel. Und dieser Mann, der sie im Sturm erobert hat, scheint überhaupt kein Gewissen zu haben.«
»Reg dich nicht auf, Vera. Jenny muß wissen, was sie tut«, sagte Edgar entschieden.
»Aber sie ist meine Schwester!« rief Vera aus. »Wie soll ich mich da nicht aufregen.«
Eine erneute Aufregung, wenn auch ganz anderer Art, gab es für Vera am nächsten Tag. Frau Behrend vom Karolinen-Haus bat sie um ein Gespräch unter vier Augen.
Was mag sie von mir wollen, überlegte Vera, als sie hinfuhr.
Freundlich begrüßte die Heimleiterin ihre Besucherin, dann kam sie gleich zur Sache.
»Es ist natürlich sehr dankenswert, daß Sie sich der kleinen Laura Pavel so annehmen, aber ich muß Ihnen leider sagen, daß es deswegen manch böses Blut hier gibt.«
»Böses Blut?« erschrak Vera. »Wie meinen Sie das?«
»Laura kommt immer wieder mit etwas Neuem an, und das sind hübsche, nicht eben billige Sachen. Das macht die anderen Kinder neidisch, und dieser Neid äußert sich auf ungute Art. Viele neigen hier zur Aggression. Sie hänseln Laura, verhöhnen sie geradezu und nennen sie eine Zierpuppe. Sie kann sich nicht wehren, sie weint dann nur und zieht sich, eingeschüchtert, mehr denn je in sich selbst zurück.«
Veras Blick hatte sich verdunkelt. »Daran habe ich nicht gedacht«, sagte sie. »Ich habe ihr dieses und jenes gekauft, weil sie doch nichts hatte. Woher denn auch. Und es sind ja keine übertriebenen Sachen dabei, Frau Behrend. Eine Latzhose, Röckchen und T-Shirts und Schuhe, ein neues Strickjäckchen brauchte sie auch dringend. Es ist doch alles nur gutgemeint.«
»Ich bin die letzte, die Ihnen daraus einen Vorwurf machen könnte, Frau Gerstner. Ich würde mir nur wünschen, daß es noch mehr Wohltäter für unsere verlassenen Kinder gäbe. Aber, eben, da ist diese andere Seite. Und es gibt noch etwas…« Sie schob ein Aktenbündel auf ihrem Schreibtisch zurecht, bevor sie fortfuhr: »Laura steht mehr unten an der Tür und hält nach Ihnen Ausschau, als daß sie mit den anderen mal spielt oder sich sonstwie beschäftigt. Manchmal sieht es so aus, als wollte sie jeden Augenblick zu Ihnen laufen. Aber das tut sie ja nun nicht mehr. Sie wartet nur, mit einer Ausdauer, die unglaublich ist.«
Vera senkte die Lider, sie nickte. Ja, sie konnte sich das vorstellen. Bei ihr war es auch schon soweit, daß sie dachte: Jetzt hofft Laura, daß ich sie wieder holen würde. Aber sie hatte natürlich auch noch etwas anderes zu tun, als sich täglich ihrem kleinen Gast zu widmen.
»Nun«, seufzte die Heimleiterin leicht auf, »das wird sich hoffentlich ändern, wenn sie jetzt in die Schule kommt. Dann muß sie zwangsweise noch etwas anderes im Kopf haben als ihre heißgeliebte Tante Vera.« Ein flüchtiges Lächeln glitt dabei über ihr Gesicht.
»Ich fürchte, das wird sie nicht«, sprach Vera leise. »Sie merkt, wie gern auch ich sie inzwischen habe, das berührt sie tief. Daß ein Mensch sich ihr herzlich zuwendet und auf sie eingeht, das hat sie doch bisher nicht gekannt.«
»Und daß Sie eine Pflegschaft für Laura Pavel übernehmen, daran ist wohl nicht zu denken?«
Adele Behrend sagte es eher wie nebenbei. Aber sehr genau beobachtete sie die Reaktion der jungen Frau, der ein Hauch von Röte ins Gesicht stieg. Sie schien mit ihrer Bemerkung ins Schwarze getroffen zu haben.
»Ich meine«, sprach sie schnell weiter, »wenn Sie so einen außerordentlich guten Kontakt zueinander haben, wäre das doch eine wundervolle Lösung. Das Jugendamt sucht dringend Ehepaare, die bereit sind, ein Kind in Pflege zu nehmen. Ich habe Ihnen ja schon erzählt, wie übervoll die Heime sind.«
»Ich – müßte mit meinem Mann darüber sprechen«, sagte Vera stockend. »Wir haben uns an den Gedanken gewöhnt, nur zu zweit zu bleiben. Es wäre doch eine große Umstellung.«
»Gewiß. Mag Ihr Gatte denn Kinder?«
»Ja, schon. Wir haben uns immer ein Kind gewünscht. Aber wir sind nicht die einzigen, denen dieses Glück nicht zuteil wird. Aber ein fremdes Kind anzunehmen, daran haben wir nie gedacht.«
»Nun, überlegen Sie es sich, Frau Gerstner. Und vergessen Sie bitte nicht, was ich Ihnen gesagt habe. Kleiden Sie Laura nicht so ein, daß sie zu sehr von den anderen absticht.«
Damit war ihre Unterredung beendet. Vera wollte gerade das Haus verlassen, als hinter ihr eine überkippende Kinderstimme rief: »Tante Vera! Tante Vera!« Außer Atem kam Laura angerannt. »Kommst du mich holen?«
Vera hatte gehofft, ihr nicht zu begegnen, sie hatte extra ihren Wagen etwas abseits geparkt.
»Heute nicht, Laura, ich habe am Nachmittag eine Verabredung, und morgen geht es auch nicht. Aber übermorgen kannst du wiederkommen.«
Das kleine Gesicht schien noch kleiner zu werden. »Ja, Tante Vera«, flüsterte Laura und nickte gehorsam dazu. Sie stand wie festgebannt und sah zu Boden.
Vera strich ihr über das Haar und ging schnell davon. Sie fühlte sich ganz zerrissen. Diese maßlose, schmerzliche Enttäuschung in Lauras Miene!
Ich bin zu weich, um das auf die Dauer durchzustehen, erkannte sie. Oder habe ich Laura einfach schon zu lieb, um ihr nur im mindesten weh tun zu können?
Beim Mittagessen erzählte sie ihrem Mann, daß sie im Karolinen-Haus gewesen war, weil die Heimleiterin sie um ein Gespräch gebeten hatte.
»Was wollte sie denn von dir?« fragte Edgar etwas zerstreut.
»Ich sollte Laura keine hübschen Kleidungsstücke mehr kaufen, das erwecke nur den Neid der anderen, und sie müßte darunter leiden.«
»Ach Gott«, sagte Edgar nur. Seine Gedanken waren noch halb bei der Arbeit. In den Bankgeschäften war irgendwo ein ärgerlicher Fehler unterlaufen. Lag es am Computer, oder hatte ein Mitarbeiter falsche Zahlen eingegeben? Er mußte das herausfinden.
Vera schwieg. Was sie seit zwei Stunden unablässig in ihrem Herzen bewegte, das konnte sie ihm ohnehin nicht zwischen Suppe und gefüllten Paprikaschoten offenbaren.
Aber am Abend mußte es sein, weil es ihr anders keine Ruhe mehr ließ. Edgar hatte sich entspannt, das Mißverständnis war aufgeklärt und hatte korrigiert werden können, ohne daß Schaden entstand.
»Frau Behrend hat mich gefragt, ob wir Laura nicht ganz zu uns nehmen könnten, Edgar«, begann sie mit etwas enger Stimme. »Ich könnte es mir schon vorstellen, sie immer um mich zu haben. Aber wie würdest du dich dazu stellen?«
Ihr Mann hatte sich aus seiner bequemen Haltung im Sessel aufgerichtet. »Denkst du an eine Adoption?« fragte er, leicht vorgeneigt.
»So weit denke ich nicht. Wir übernehmen eine Pflegschaft, so nennt man das. Es bindet uns nicht endgültig.«
»Du glaubst doch nicht, daß man ein Waisenkind aufnehmen und es zu irgendeiner Zeit wieder zurückschicken kann. Du wärest die letzte, die das fertigbrächte, Vera«, hielt Edgar ihr ernst entgegen.
Vera wußte, daß er recht hatte. »Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll«, gestand sie grübelnd. »Vielleicht hätte ich damit gar nicht anfangen sollen. Jetzt ist ein Band zwischen uns geworden, das wieder zu zerreißen für Laura eine Katastrophe bedeuten würde.«
»Und was würde es für dich bedeuten, wenn du Lauras übergroßen Anhänglichkeit ein Ende setztest?«
»Sie würde mir fehlen«, sagte sie. »Sie ist so lieb, so dankbar. Du kennst sie nicht so gut wie ich. Es würde dich auch rühren.«
»Doch, freilich kenne ich sie. Sie war doch manchmal noch da, wenn ich vom Dienst kam. Dann wollte sie lostraben, weil sie nicht stören wollte, und wenn ich sagte, sie könne ruhig noch bleiben, hat sie sich still gefreut.« Edgar lächelte ein wenig, als er daran dachte, aber dann wurde er gleich wieder ernst. »Vera, ich hätte grundsätzlich nichts dagegen, sie bei uns zu haben. Aber wir wissen doch rein gar nichts von diesem Kind, nicht, wo es herkommt, wer seine Eltern sind. Wie, wenn eines Tages doch noch jemand auftaucht und einen Anspruch darauf erhebt? Es ist mir sowieso unbegreiflich, wie die Herkunft eines Menschenkindes so völlig unbekannt sein kann.«
»Ja, das ist schon sehr seltsam«, stimmte Vera ihm zu. »Aber dafür kann Laura doch nichts. Und wenn wirklich noch ein Blutsverwandter auftauchte, die Mutter gar, oder der Vater, dann soll es auch gut sein. Dann hätten wir sie wenigstens für eine Zeit aus dem Haus genommen, in dem sie nicht froh sein kann.«
Skeptisch sah ihr Mann sie an. Er überlegte.
»Wie war das damals, was war das für ein Heim, in das sie als Kleinkind gebracht wurde?« fragte er nach einer Pause. »Da müßte sich doch eine Spur zurückverfolgen lassen.«
»Darüber weiß ich auch nichts Näheres«, gab Vera zurück. »Frau Behrend könnte uns bestimmt den Namen dieses Kinderheimes nennen. Ich kann mich darum kümmern, wenn es dir wichtig ist, Edgar.«
Er nickte ihr zu. »Ich hielte es schon für richtig, bevor wir eine Entscheidung treffen, Vera. Man hat die Dinge möglicherweise zu sehr schleifen lassen und keinerlei weitere Nachforschungen mehr angestellt. Es fühlte sich wahrscheinlich niemand zuständig dafür.«
Doch darin sollte Edgar Gerstner sich irren.
*
Das Kinderheim Maria Barein, nach seiner Stifterin benannt, war ein gepflegtes Haus mit ausgebildeten Säuglings- und Kinderschwestern. Die Atmosphäre, die Vera hier umfing, war hell und freundlich. Eine junge Schwester führte die Besucherin zu ihrer Chefin, Frau Dr. Schwendt.
»Selbstverständlich haben wir nach diesem Ehepaar Matthau geforscht, das Laura Pavel seinerzeit in unsere Obhut gab«, sagte diese, nachdem Vera ihr Anliegen vorgebracht und sie sich eine Akte, diesen Fall betreffend, hatte kommen lassen. »Dem Vernehmen nach wollten sie eine größere Reise antreten. Sie leisteten eine Vorauszahlung für drei Monate. Danach kam nichts mehr. Mahnungen blieben erfolglos. Wir hörten uns um, die Wohnung war verschlossen, niemand wußte etwas über den Verbleib der Inhaber. Anscheinend hat das Paar sehr zurückgezogen gelebt. In ihrem Umfeld gab es nur Achselzucken, die Matthaus seien für länger verreist, weiter war nichts in Erfahrung zu bringen.«
Mit angespannter Miene hatte Vera zugehört. »Und von dieser Reise sind sie nicht zurückgekommen?« stellte sie beklommen fest.
Frau Dr. Schwendt hob die Hände und ließ sie mit einer resignierten Bewegung wieder sinken. »Nein, offenbar nicht. Jedenfalls haben wir nichts mehr davon gehört. Vielleicht sind sie tödlich verunglückt, oder sie sind untergetaucht, vielleicht war ihnen das Pflegekind lästig geworden, es gab da viele Vermutungen. Die Wohnung ist schließlich geräumt und weitervermietet worden. Niemand erhob einen Anspruch auf irgend etwas. Was sich an Werten darin befand, hat der Vermieter für die ihm entgangene Miete für sich einbehalten.«
»Da blieb für Laura nichts übrig«, warf Vera ein.
Frau Dr. Schwendt schüttelte den Kopf. »Es bestand auch kein rechtlicher Anspruch darauf. Wieso und auf welche Weise das Kind zu ihnen kam, weiß man nicht. Für mich bestand keine Veranlassung, danach zu fragen oder mir irgendwelche Papiere vorlegen zu lassen. Es sollte ein vorübergehendes Arrangement sein, wie hier in fast allen Fällen, und die finanzielle Seite war geregelt.«
Vera senkte die Lider. Wie sachlich das klang. Aber freilich, man mußte das auch verstehen. In diesem Kinderheim waren die Plätze sicher hochbezahlt, sonst wäre dieser Standard nicht zu halten. »Dann mußte Laura ins Waisenhaus«, sagte sie leise, wie zu sich selbst.
»Es gab keine andere Möglichkeit, leider. Wir behielten sie noch zwei, drei Monate, solange wir immer noch auf ein Lebenszeichen der Matthaus hofften. Aber dann mußten wir sie abgeben.« Mit einer endgültigen Bewegung schloß Dr. Schwendt die Akte Pavel.
»Haben Sie Dank für Ihre Ausführungen«, sagte Vera, sich erhebend.
»Bitte sehr. Sie werden nicht ohne Grund danach gefragt haben.« Aber was für Gründe das waren, interessierte die Dame nicht weiter. Hier kamen und gingen so viele Kinder, und dieser Fall lag Jahre zurück. Es gab ihn nur noch in einem Ordner, der wieder zurückgestellt werden würde in eine lange Reihe von anderen.
*
»Nehmen wir die Kleine also zu uns«, entschied Edgar. »Du siehst dich ja eh schon überlegend in unserem Gästezimmer um…« Sein lächelnder Blick ruhte auf seiner errötenden Frau.
»Ja, das könnte gut Lauras Zimmer werden. So oft bekommen wir ja nicht Logierbesuch, und wenn, dann kann sie unten auf der Couch schlafen. O Edgar!« Vera trat auf ihren Mann zu, und als er sie umfing, legte sie die Hände vor seiner Brust zusammen und sah ihm in die Augen. »Willst du es wirklich? Bist du auch aus vollem Herzen bereit?«
Er nickte. »Ja, Vera. Ich tue doch nichts Unüberlegtes. Es wird schon gutgehen«, sagte er fest.
Das sprengte Vera fast das Herz, dem Kind sagen zu dürfen, daß es fortan bei ihnen wohnen könnte. Es geschah im Karolinen-Haus, nach Rücksprache mit Frau Behrend.
»Das träume ich doch wieder nur«, flüsterte Laura. Sie kniff die Augen fest zusammen, um aus diesem Traum nicht zu erwachen.
»Du träumst nicht«, versicherte Vera. »Sieh mich an. Hier bin ich, und wir bleiben jetzt zusammen.«
»In dem schönen Haus?«
»Da wirst du dein Zimmer haben, ja!«
»Und ich bin euer Kind? Ihr seid meine Eltern?«
»Deine Pflegeeltern, ja.«
Es machte für Laura keinen Unterschied. »Dann darf ich Mama und Papa zu euch sagen?« Wie atemlos kam eine Frage nach der anderen.
Nur einen winzigen Augenblick zögerte Vera. »Wenn du das gern möchtest… Aber jetzt wollen wir deine Sachen zusammenpacken. Wo hast du sie denn?« Suchend sah sie sich in dem Saal um, wo die vielen schmalen Betten standen. Das Kind deutete auf eine Ecke, die durch einen Vorhang abgetrennt war.
»Dahinter sind auch die von mir. Aber mein schöner bunter Rock – da hat jemand reingeschnitten.« Sie zeigte ihn Vera.
»Da sind ja richtige Löcher drin, wer hat denn das getan?«
»Niemand will das gewesen sein. Manche sind so gemein. Entschuldige bitte, Tante Vera. Der war sicher sehr teuer.«
»Ach wo, das war er nicht, und du brauchst dich nicht für diese Untat zu entschuldigen.« Vera packte Lauras bescheidenen Bestand in die mitgebrachte Reisetasche. War das ein Segen, daß sie von diesem frechen Volk hier wegkam, die ihr jedes bißchen geneidet hatten.
Aber dann kamen einige der Kinder herbei, sie schauten stumm. Verschlossene Gesichter, ausdruckslos, und doch mit so einem hungrigen Ausdruck in den Augen, daß es Vera erschütterte. Sie wußten: Da durfte eines von ihnen gehen. Ach, diese Verlassenen waren nicht schlecht oder gemein von Natur aus, da waren sie Kinder wie alle anderen, nur ihre armen, verkümmerten Seelen wehrten sich und taten die falschen Dinge, um ihre Aggressionen abzubauen. Es war ihnen, auf welche Weise auch immer, schon zuviel angetan worden in ihrem kleinen Leben.
Vera war froh, als sie, an der einen Hand Laura, in der anderen die Reisetasche, das Karolinen-Haus hinter sich lassen konnte.
»Na, du Spatz«, begrüßte Edgar, als er kam, die neue kleine Hausgenossin, »gefällt dir dein Zimmer?«
Stumm und überwältigt nickte Laura. Sie mußte das erst begreifen, daß sie ein Zimmer für sich hatte und für immer hier sein durfte. Aber es dauerte lange, bis sie es wagte, Papa zu ihm zu sagen. Bei ihrer Tante Vera war das anders, da kam es ihr gedehnt und beinahe andächtig über die Lippen, dieses »Ma – ma«, als koste sie es aus. Galt es doch der Frau, der ihr kleines Herz schon zugeflogen war, als sie sie nur von fern sah.
Vera merkte bald, daß die Anwesenheit des Kindes ihr Leben bereicherte. Laura ging nun in die Schule, und sie tat es gern. Vera hatte sie darauf vorbereitet, in den vergangenen Wochen schon mit ihr geübt, was manche andere in einer Vorschule gelernt hatten. Dabei hatte sie entdeckt, daß Laura rasch begriff, was um so erstaunlicher war, als doch früher niemand sich jemals mit ihr beschäftigt und ihren Geist geweckt hatte. Nun holte sie auf, überwand ihre anfängliche Scheu und Schüchternheit mit Veras Hilfe.
Ein kleines Mädchen aus dieser Straße namens Bärbel war auch eingeschult worden. Vera fand Kontakt zu Bärbels Mutter, sie trafen sich auf dem Schulweg, den sie die Kinder zunächst nicht allein gehen ließen und sie tauschten ihre Erfahrungen aus. Es war ein neues Gefühl für Vera, sich nun als Mutter zu fühlen und mitreden zu können.
Dann fanden Laura und Bärbel den Weg allein, der für sie ohne Gefahren war, und da sie sich angefreundet hatten, blieb auch Vera mit Frau Schuler in freundlicher Verbindung. Man stand mehr im Leben, wenn ein Kind da war.
Ihre Schwester Jenny hatte zu der Veränderung im Haus nicht viel gesagt. »Es muß jeder selber wissen, was er tut«, war ihre einzige Äußerung gewesen. Wußte sie es?
Vera fragte sich das manchmal in banger Sorge. Jenny zog sie nicht mehr ins Vertrauen. Sie hielt sich fern von ihr, was nichts Gutes ahnen ließ.
Katrin und Claus waren mit der Schule beschäftigt und mit ihren Freundinnen und Freunden, die sie reichlich hatten. Manchmal kamen sie aber doch, um ihre Tante Vera zu besuchen. Inzwischen hatten sie es akzeptiert, daß Laura nun dazugehörte.
»Aber wieso darf sie Mama zu dir sagen?« hatte Katrin fast entrüstet gefragt, als sie es zum ersten Mal aus Lauras Mund hörte. »Tante reichte doch auch, wo sie nur ein fremdes Waisenkind ist.«
»Wir sind ihre Pflegeeltern geworden, Katrin«, erklärte Vera dem Mädchen ernst, »und für Laura ist das etwas ganz Großes, Schönes, mich so nennen zu dürfen, weil sie doch nie eine Mutter gehabt hat.«
»Dann lassen wir sie doch«, meinte Claus, der immer der Friedlichere und Gutmütigere von ihnen war.
Katrin, die auf Äußerlichkeiten Wert legte, fand, daß Laura allmählich auch netter aussah. Sie war nicht mehr so spindeldünn, ihr Gesicht zeigte etwas Farbe und hatte sich sanft gerundet. Immer hübsch angezogen, war sie weit entfernt von dem »Bettelkind«, als das Katrin sie früher betrachtet hatte.
Eines Tages im Spätherbst rief Katrin bei ihrer Tante an.
»Könnten Claus und ich wohl übers Wochenende bei euch sein, Tante Vera? Mama ist nämlich nicht da, und Papa müßte ganz dringend zu einer Kunstauktion nach London fliegen. Das wußte er vorher nicht, es geht aber um was sehr Wichtiges.« Sie holte Atem, weil sie das nur so hervorgesprudelt hatte.
»Wo ist eure Mutter denn?« fragte Vera, bei der eine Alarmglocke anschlug.
»Sie ist zur Hochzeit bei einer Freundin eingeladen«, antwortete Katrin. »Geht das, daß wir kommen, weil Papa nicht möchte, daß wir allein im Haus bleiben. Fänden wir auch nicht so schön.«
»Warum ruft euer Papa mich denn nicht selber an?«
»Ach, der rauft sich die Haare, weil das jetzt so blöd zusammentrifft, und er meint, ihr hättet doch jetzt die Laura und auch nicht mehr soviel Platz.«
»Für euch habe ich immer Platz, Katrinchen. Richte das dem Papa aus.«
Sie kamen schon am Freitag abend, brachten ihr Nachtzeug mit und berichteten wortreich, wie es bei ihnen zu Hause derzeit zuging. Die Mutter nicht da, der Vater überlastet, und Frau Müller konnte auch nicht kommen, weil sie den Fuß in Gips hatte. »Wir sind total gestreßt«, behauptete Katrin.
»Na, dann ruht euch hier mal aus«, sagte Vera, trotz allem ein wenig erheitert über die dramatische Schilderung der Zustände.
Am Sonnabend schlug Edgar vor, daß sie alle zusammen in den Zirkus gehen sollten. Das Zelt würde geheizt sein, da konnte ihnen das ungemütliche Wetter mit Regen- und Graupelschauern nichts anhaben.
»Ich mag aber keine wilden Tiere sehen«, sagte Katrin. »Die brüllen und stinken nur.« Daraufhin machte auch Laura ein ängstliches Gesicht. Sie hatte keine Ahnung, wie es in einem Zirkus war. Aber wenn Katrin, die doch schon groß war und immer überlegen tat, davor zurückschreckte, wollte sie da auch nicht hin.
»Pah, was sind Mädchen doch für Angsthasen«, spottete Claus. »Die Löwen sind doch hinter Gittern und können einem gar nichts tun.«
»Meinste, das wüßt’ ich nicht?« fuhr seine Schwester ihn an. »Ihr könnt ja gehen, hab ich doch gar nichts gegen.«
Bevor die beiden sich wieder in die Haare gerieten, griff die Tante vermittelnd ein. »Dann geht Onkel Edgar eben nur mit Claus. Aber du, Laura, möchtest du das nicht auch mal erleben? Das ist schon schön, du wirst es sehen. Da sind auch Clowns und Tänzerinnen, und vieles ist ganz lustig.«
»Weiß nicht«, wisperte die Kleine unentschlossen.
»Klar kommst du mit!« rief Claus. »Wir nehmen dich in die Mitte, da kann dir überhaupt nichts passieren.« Bei Laura fühlte er sich immer ein wenig in der Beschützerrolle.
So blieb Vera mit ihrer Nichte zu Hause.
»Ich wollte das gern, Tante Vera, mal mit dir allein sein«, gestand die Zwölfjährige und zupfte an den Ärmeln ihres Pullovers.
Aufmerksam sah Vera sie an. Sie erschien ihr irgendwie bedrückt. »Was hast du denn auf dem Herzen?« fragte sie sanft.
Katrin druckste noch ein bißchen herum, bevor sie herausplatzte: »Ich glaub, die Mama hat Geheimnisse vor uns.«
Veras Herz tat einen rascheren Schlag. »Hast du denn einen Grund, das anzunehmen?« fragte sie vorsichtig.
Katrin hob die Schultern und nickte gleichzeitig unsicher. »Manchmal telefoniert sie, auch schon mal von der Telefonzelle, da hat meine Freundin Stefanie sie mal gesehen und fand das auch komisch. Und zu Hause, wenn ich da unvermutet dazukomme, legte sie ganz schnell auf und ist rot im Gesicht. Und wenn ich sie frage, wer das denn war, lügt sie. Doch, Tante Vera«, ihre braunen Augen blickten ernst, »ich weiß genau, daß sie lügt.«
»Das kann ich mir aber gar nicht vorstellen«, murmelte Vera. Und sie dachte: Jetzt fange ich auch schon damit an. Mit wem sonst als mit Marian würde sie telefonieren? Aber das konnte sie Jennys Tochter nicht sagen.
»Und daß sie jetzt weggefahren ist«, fuhr Katrin fort, »zu einer Freundin Franziska, weil die heiratet. Von der haben wir früher nie was gehört. Hast du da schon mal was von gehört, Tante Vera?«
»Doch, ja, ich erinnere mich…« Eine Franziska hatte es tatsächlich irgendwann einmal gegeben.
»Mama war ja neulich schon mal dort, aber nur kurz. Dann hatte sie den Zug verpaßt und mußte über Nacht bleiben. Sie hätten sich ganz lange nicht gesehen, darum wüßten wir nichts von der. Ist doch auch komisch.«
»Ach, das gibt es schon, Katrin. Man kommt mit Jugendfreunden auseinander, und irgendwann hört einer wieder vom anderen, und dann ist die Freude groß.«
»Ja, wenn du meinst.« Das Mädchen sah auf seine Finger und bewegte sie. »Papa glaubt Mama ja auch alles. Aber ich…« Katrin zögerte, »ich hör so viel in der Schule. Bei der Gaby hat der Vater eine Freundin und will sich deswegen von ihrer Mutter scheiden lassen. Gaby hat schon geweint, und bei einer anderen Mitschülerin ist es umgekehrt, da ist die Mutter zu einem Freund gezogen, dann ist die Oma gekommen und versorgt jetzt sie und ihre kleine Schwester. Und in den Fernsehspielen sieht man auch oft so was.« Sie biß sich auf die Unterlippe und ließ den Kopf hängen.
Vera schwieg etwas ratlos. Wie gern hätte sie ihrer Nichte jetzt überzeugend klargemacht, daß bei ihren Eltern an dergleichen doch nicht zu denken war. Aber Katrin war kein Kind mehr, wie sich zeigte. Die Mädchen wurden heutzutage früh reif, mit zwölf wußten sie mehr als ihre Mütter mit siebzehn, von früheren Generationen gar nicht zu reden.
»Ich hab’ echt Angst, daß Mama auch so jemand hat«, murmelte Katrin gepreßt. »Aber wer sollte das bloß sein?«
»Ja, eben«, murmelte Vera. Sie straffte sich. »Ich werde mal mit deiner Mutter reden, wenn sie zurück ist, Katrin. Sicherlich wird sich alles, was dir jetzt seltsam vorkommt, auf harmlose Weise erklären lassen.« Dabei versuchte sie, wider besseren Wissens, Festigkeit in ihre Stimme zu legen.
Katrin hob den Blick und sah sie hoffnungsvoll an. »Ja. Du bist doch Mamas Schwester, Tante Vera. Du machst das schon.«
Damit beendeten sie das heikle Thema. Zur Ablenkung sahen sie sich ein heiteres Ratespiel im Fernsehen an, und dann kam auch Edgar mit den beiden aus der Nachmittagsvorstellung zurück. Da gab es nun viel zu erzählen. Für die kleine Laura war der Blick in diese bunte, glitzernde Welt ein wahres Erlebnis gewesen.
Vera nickte und lächelte zu allem und tat interessiert. Aber sie mußte doch immer wieder an Jenny denken. Das waren sorgenvolle Gedanken, auch nicht ganz frei von Groll, mit denen sie sie suchte.
*
»Ich bin ein bißchen traurig, daß unser gutes schwesterliches Verhältnis sich so gelockert hat«, sagte Vera, nachdem sie Platz genommen hatte. »Ich denke, wir sollten uns einmal aussprechen. Oder hast du kein Vertrauen mehr zu mir?«
Jenny setzte sich in den anderen breiten Sessel ihr gegenüber. »Zuerst möchte ich dir danken, daß ihr Katrin und Claus ein schönes Wochenende bereitet habt. Hoffentlich ist es euch nicht zuviel geworden. Ich konnte wirklich nicht ahnen, daß Dieter plötzlich nach London fliegen wollte.«
»Und wo warst du, wenn man fragen darf?«
»Ich war bei Vincent«, antwortete Jenny.
Vera zuckte zusammen. Sie hatte es geahnt, ja eigentlich beinahe schon gewußt, aber nun traf es sie doch, ihre Schwester das so unumwunden aussprechen zu hören.
»O Jenny…«, flüsterte sie.
Aber Jenny sah sie nur kühl und wie von fern an.
Im Haus lief der Staubsauger, in einem eintönigen leisen Summen. Frau Müller war da. Vera hatte die Vormittagsstunde gewählt, um Jenny aufzusuchen, weil die Kinder dann in der Schule waren.
»Weißt du, daß Katrin schon Verdacht schöpft?« sagte Vera mit enger Stimme, nachdem sie sich geräuspert hatte.
»Ach ja?« Jenny hob die feingezeichneten dunklen Brauen. »Hat sie etwas zu dir gesagt?«
Vera nickte. »Sie ist nicht mehr so kindlich, wie es manchmal scheinen mag. Sie bekommt schon dieses und jenes mit. Jenny!« Beschwörend streckte sie die Hand nach der Schwester aus. »Wohin soll das denn bloß führen? Du kannst doch nicht immer weiter lügen und betrügen.«
»Das ist wahr. Das kann ich nicht.« Jenny stand auf. Sie trat an die Hausbar und schenkte Sherry in zwei kleine Gläser. Vera folgte ihren Bewegungen aufmerksam. Hatte sie am Ende doch Schluß gemacht, war es die letzte Begegnung gewesen am Wochenende mit ihrem Geliebten?
Aber da sagte Jenny, während sie die Gläser auf den niedrigen Tisch stellte: »Es ist auch für Vincent kaum noch zu ertragen, dieses Abschiednehmen immer wieder nach viel zu kurzem Beisammensein. Ich will nur noch Weihnachten vorübergehen lassen.« Sie setzte sich wieder.
»Und dann?« fragte Vera in banger Ahnung.
»Dann werde ich mich von Dieter trennen und zu Vincent gehen. Ich sehe keine andere Lösung, Vera, als mich zu unserer Liebe zu bekennen.«
»Das ist doch Wahnsinn, Jenny!« Vera war das Blut in die Wangen gestiegen vor innerer Erregung. »Das würde nicht nur für Dieter ein furchtbarer Schlag sein, sondern auch für eure Kinder. Denkst du denn nicht an Katrin und Claus? Was sollte denn aus ihnen werden?«
»Es wird sich schon eine gütliche Regelung finden. Sie können wählen, bei wem sie bleiben wollen. Ich stelle mir vor, Claus bei seinem Vater, und Katrin bei mir. Sie wird es verlockend finden, in Paris zu leben. Aber das alles wird man sehen…«
Vera schüttelte heftig den Kopf. »Da bist du bereit, alles in Scherben zu schlagen, nur um einer blinden Leidenschaft zu folgen?« hielt sie ihrer Schwester erregt vor.
»Um mir mein Glück zu erkämpfen«, verbesserte Jenny.
»Weißt du denn, ob das ein Glück wird?« sagte Vera mit flammenden Augen. »Was man auf dem Unglück anderer aufbaut, hat noch nie gutgetan. Muß sich das nicht auch Vincent Marian sagen?«
»Er liebt mich«, sagte Jenny, als gelte daneben nichts, aber auch gar nichts anderes.
»Du bist zwölf Jahre älter als er«, fuhr Vera fort, »wenn…« Aber Jenny ließ sie nicht aussprechen. »Vincent fühlte sich immer mehr zu reifen Frauen hingezogen als zu kleinen Mädchen«, behauptete sie mit großer Sicherheit.
Vera sprang auf, es hielt sie nichts mehr auf ihrem Platz. Diese Hilflosigkeit angesichts Jennys Beharren! War es doch mit allem, was sie ihr entgegenhielt, als renne sie gegen eine Mauer. »O Jenny, Jenny, bist du denn nicht mehr zu retten?« murmelte sie unglücklich.
»Was mir jetzt geschieht«, sagte Jenny ernst, »und was ich noch vor mir habe – das wird nicht einfach sein, ich weiß es, aber es geschieht hundert- und tausendfach auf der Welt, weil Gefühle eine größere Kraft besitzen als aller Verstand.«
»Dann sollten sich hundert- und tausendfach die Frauen und die Männer schämen, die kaltblütig ihre Familien verlassen«, sagte Vera bitter. »Und jetzt gehe ich, da ich doch nichts ausrichten kann. Ich kann nur hoffen, daß meine Schwester im letzten Moment noch zur Besinnung kommt.«
Aber sie wußte, daß es in den Wind gesprochen war.
Tiefbedrückt sprach Vera mit ihrem Mann darüber, denn sie verbargen nichts voreinander. Auch Edgar runzelte betroffen die Stirn.
»Das ist ja nicht zu fassen! Ob ich mal mit Dieter rede, von Mann zu Mann, damit er zumindest vorgewarnt ist?« überlegte er laut.
»Das würde Jenny sicher als schweren Vertrauensbruch empfinden, denn sie will ja damit noch warten. Weihnachten soll noch als Familienfest gefeiert werden.« Wieder war ein bitterer Unterton in ihrer Stimme.
»Kann sie das denn?« verwunderte sich Dieter. »Kann sie das tun in dem Wissen, daß sie kurz darauf alles zerstören will?«
Vera zuckte die Achseln. »Jenny bringt offenbar neuerdings alles fertig. Ihr sind alle Grundsätze und Maßstäbe durcheinander geraten.« Sie seufzte schwer. »Dieter würde sie auch nicht mehr von dem Abgrund zurückreißen können, in den sie sich stürzen wird. Ich kann das nicht anders nennen, und ich glaube nicht, daß ich da zu schwarz sehe.«
Sie kamen so bald nicht los von diesem Thema. »Mit diesem Marian sollte man reden«, grollte Edgar. »Er scheint sich der Tragweite dessen gar nicht bewußt zu sein, was er da anrichtet.«
»Sie sind es beide nicht«, sagte Vera resigniert.
Schließlich gelangten sie zu der Ansicht, daß es wohl besser wäre, sich da nicht einzumischen. Die Angelegenheit war zu heikel. In drei Wochen konnte noch manches geschehen. Aber die Sorge um die Verwandten blieb wie ein Schatten über ihnen.
Für Laura war dieses erste Weihnachten in der Liebe und Geborgenheit ihrer Pflegeeltern ein großes, wunderbares Erlebnis. Der Papa hatte Urlaub genommen, am Ersten Feiertag wollten sie verreisen, dorthin, wo der Winter schon richtig Einzug gehalten hatte.
»Und unseren schönen Baum mit den richtigen Kerzen, den können wir nicht mitnehmen«, sinnierte die Kleine.
»Wir werden dort noch viele geschmückte Tannen sehen, mein Liebes«, versicherte Vera. »Und die Berge im Schnee, da wirst du staunen! Mit der Kabinenbahn werden wir hoch auf die Gipfel fahren, und im Tal warm eingepackt mit dem Pferdeschlitten durch wunderhübsche Dörfer und eine herrliche Landschaft…«
So malte sie Laura aus, was sie erwartete, und das Kind hörte mit staunenden Augen zu.
»Daß ihr ausgerechnet jetzt wegfahren wollt«, sagte Jenny irritiert am Telefon. »Wir sind doch sonst immer zusammengekommen an diesen Tagen.«
»Kannst du dir den Grund nicht denken?« erwiderte Vera herb.
»Nein.« Und dann, sehr leise: »Du, Vera, weißt doch, daß es so nicht wieder sein wird. Da könnten wir doch noch einmal…«
»Heile Welt spielen, meinst du?« unterbrach Vera ihre Schwester. »Ich kann das nicht, Jenny. Ich könnte Dieter nicht in die Augen sehen, nicht mit den Kindern lachen, denen diese Welt bald in Stücke brechen wird. Und Edgar macht da auch nicht mit.«
»Du verachtest mich, nicht wahr?« hauchte Jenny.
»Ich verstehe dich nicht mehr. Das ist es. Adieu, Jenny.« Mit einem Zucken um den Mund hängte Vera ein.
In den folgenden Tagen schob sie nach Möglichkeit die schweren Gedanken beiseite an das Drama, das sich im Hause Sasse nun ereignen würde. Edgar hatte ein stilvolles und urgemütliches Hotel für sie ausgewählt, darin man sich sehr wohl fühlen konnte. Laura wurde richtig übermütig, wie sie sie noch nicht kannten. Sie tollte im Schnee herum und sah reizend aus in ihrem bunten wattierten Anzug und mit den roten Bäckchen. Ja, sie war ordentlich hübsch geworden. Wer hätte das von der kleinen Spitzmaus von ehedem gedacht! Vera ertappte sich dabei, daß sie stolze Muttergefühle hatte. Es machte sie immer wieder glücklich, Lauras zärtliches Mama zu hören.
Am Jahresanfang kehrten sie heim. Auf Edgar wartete um diese Zeit viel Arbeit in der Bank. Für Vera, die kurzzeitig zu vergessen gesucht hatte, war die Sorge um ihre Schwester nun wieder ganz nahegerückt. Sie wagte es nicht, dort anzurufen, aus Angst, Schlimmes zu erfahren.
Aber sehr bald kam ein Anruf von Dieter. Sie ahnte, was es bedeutete, daß e r anrief. Ihr Herz sank.
»Seid ihr schon zurück?« sagte er mit schleppender Stimme. »Dann wünsche ich euch ein gutes Neues Jahr, Vera.«
»Danke, Dieter…« Vera stockte. Würde es nicht wie Hohn klingen, wenn sie seinen Wunsch erwiderte. Bangen Herzens wartete sie ab. Es verstrichen einige Sekunden, die ihr endlos erschienen.
»Jenny hat uns gestern verlassen«, kam seine Stimme nach dieser Pause wieder an ihr Ohr. »Sie ist zu ihrem Geliebten nach Paris gefahren. Sie wirft unsere Ehe weg wie ein altes Kleid, das ihr nicht mehr paßt.«
Es war also wirklich soweit gekommen. Vera biß sich auf die Lippen. »Willst du mir die Kinder schicken?« fragte sie dann. »Ich werde euch helfen, wie ich kann.«
Wieder trat ein kurzes Schweigen ein.
»Das klingt ja gerade, als überraschte es dich nicht sehr«, sagte ihr Schwager rauh. Und als Vera nichts darauf erwiderte: »Du hast es also gewußt…«
»Ja«, versetzte Vera tonlos. »Ich habe nur bis zum letzten Moment gehofft, daß sie noch zur Besinnung käme.«
»Warum hast du deine Schwester nicht zurückgehalten, Vera?«
»Niemand hätte sie zurückhalten können, Dieter. Was glaubst du, wie ich auf sie eingeredet habe, aber es ging an ihrem Ohr vorbei. Wie mich das bedrückt hat, die ganze Zeit. Geschämt habe ich mich für sie.«
»Niemand konnte sie zurückhalten«, wiederholte Dieter Sasse dumpf. »Auch ich nicht. Ist das nicht seltsam? Da fördert man einen jungen Künstler, und er nimmt einem die Frau.«
Vera schluckte schwer. Er tat ihr unsagbar leid. »Und den Kindern die Mutter«, vollendete sie. »Was ist jetzt mit Katrin und Claus?«
»Frag mich nicht. Claus ist noch verstörter als Katrin. Der Junge versteht überhaupt nichts mehr. Wir sind ein armes Häuflein hier, Vera.« Bittere Ironie klang aus seinen Worten.
»Wenn ihr mich braucht, bin ich für euch da«, sagte Vera. »Du wirst ja auch wieder ins Geschäft müssen.«
»Das kann jetzt warten. Ich muß jetzt bei den Kindern bleiben.«
»Und wer versorgt euch?« fragte Vera erregt. Ein heiliger Zorn auf ihre verantwortungslose Schwester packte sie.
»Frau Müller, unsere Haushaltshilfe, wird jetzt täglich kommen und bis zum frühen Nachmittag bleiben. So hat das Jenny noch mit ihr geregelt. Man muß jetzt eben sehen, wie es weitergeht.« Es klang sehr müde.
»Ja, Dieter. Sag Katrin und Claus, daß sie noch eine Tante haben, die sie von Herzen liebt und immer für sie dasein wird.«
Es würde ihnen nur ein sehr geringer Trost sein, dachte Vera voller Erbarmen, als dieses Gespräch beendet war. Es hatte um zehn Uhr morgens stattgefunden. Sie ahnte nicht, was an diesem Vormittag noch auf sie zukommen würde.
*
Dieter fuhr sich mit der Hand über das Gesicht, dann ging er zu den Kindern und richtete ihnen aus, was ihre Tante gesagt hatte. Sie nickten stumm. Sie waren in Katrins Zimmer, und sie hielten sich bei den Händen. So manches Mal hatten sie sich gezankt und waren aufeinander losgegangen, spielerisch eher, in einem kindlichen Kräftemessen, jetzt rückten sie eng zusammen. Der Vater setzte sich zu ihnen. Sie sahen sich an.
»Ich muß immer daran denken, wie Mama gestern die Koffer rausgetragen hat«, wisperte Katrin. »Sie hat gesagt, wir würden uns immer wiedersehen, und wenn ich wollte, könnte ich ganz zu ihr kommen. Aber ich bleibe bei dir, Papa.«
»Ja, Katrin.« Das Sprechen fiel Dieter schwer.
Auch Claus brachte kaum ein Wort hervor. Seine Augen waren weit aufgerissen in dem runden Bubengesicht, wie verständnislos fragend. Hatte er nicht lange gedacht, daß das nur ein schlimmer Traum wäre, aus dem er erwachen müßte. Aber das war es nicht, nein. Wieso denn nur? Wieso war sie weg? Ein fremder Mann? Sie konnte doch nicht einfach zu einem fremden Mann gehen. Sie war doch seine und Katrins Mutter.
»Mußt du nicht ins Geschäft, Papa?« fragte Katrin nach einer Weile.
Ihr Vater schüttelte nur den Kopf. Er schwieg weiter. Unten klappte die Haustür. Frau Müller ging wohl zum Einkaufen.
»Ich – ich geh auch nicht mehr in die Schule, wenn die übermorgen wieder anfängt«, stammelte Claus.
»Das werden wir wohl müssen«, sagte seine Schwester.
Dann läutete das Telefon. Dieter stand auf. Das Geschäft, vermutete er. Er hatte Frau Steegen gesagt, daß er zu Hause zu erreichen sei, wenn etwas wäre. Aber es war nicht seine Mitarbeiterin, sondern eine Männerstimme, die da deutsch mit starkem französischen Akzent sprach, nachdem er sich nur kurz mit einem »Hallo« gemeldet hatte.
»Sind Sie verwandt mit einer Dame Jenny Katarina Sasse, geborene Droste?«
»Das ist meine Frau. Wer spricht denn da?«
»Hier ist das Sulpice-Hospital in Reims, Oberarzt Dr. Morgan. Ihre Frau ist heute nacht hier eingeliefert worden.«
Dieter merkte, wie ihm kalter Schweiß ausbrach. Plötzlich war alles Angst, Schwindel, Schrecken. »Was ist mit ihr?« Hatte er es geschrien oder geflüstert? Er wußte es nicht.
»Madame Sasse hatte einen Autounfall. Sie hat Glück im Unglück gehabt, ihre Verletzungen sind nicht lebensbedrohend. Aber sie steht unter Schock, ist zu keiner Aussage fähig. Die Personalien haben wir ihrem Paß entnommen, der sich in ihrer Handtasche befand.«
Sie lebt! Dieter entrang sich ein tiefer, zitternder Atemzug.
»Ich komme«, sagte er mit rauher Kehle. »Ich fahre sofort los.«
»Das wäre gut.« Der Arzt nannte nochmals den Namen und beschrieb kurz die Lage des Hospitals, bevor er auflegte.
Dieter hielt den Hörer noch in der Hand, sekundenlang stand er reglos, mit geschlossenen Augen. Sulpice-Hospital in Reims, klang es in ihm nach. Dann setzte sein logisches Denken wieder ein. Was hatte Jenny in Reims gewollt, weit fort von Paris? Wie auch immer – er mußte zu ihr. Seine Aufregung wich einer klaren, kalten Entschlossenheit.
Katrin und Claus hockten immer noch so beieinander, wie er sie vor wenigen Minuten verlassen hatte.
»Ich muß weg, Kinder, ich fahre nach Frankreich. Eure Mutter ist mit dem Wagen verunglückt und liegt dort im Krankenhaus. Katrin, suche du schon zusammen, was ihr so brauchen werdet für ein paar Tage. Ich bringe euch zu Tante Vera.«
Er rief seine Schwägerin an. »Vera, ich muß deine Hilfe jetzt sofort schon in Anspruch nehmen. Bitte, nimm Katrin und Claus auf.«
»Was ist denn passiert?« fragte Vera alarmiert.
Dieter erklärte es ihr mit wenigen Worten.
Ihre Stimme klang belegt, als sie zurückgab: »Ja, Dieter. Ja, fahr nur zu ihr.«
Er sagte Frau Müller Bescheid, die im Wohnzimmer die Pflanzen begoß, daß sie nach Hause gehen könnte, weil sie vorübergehend nicht gebraucht wurde. Diese nickte nur ergeben. In diesem Haus mußte man zur Zeit auf alles gefaßt sein. Dieter packte ein paar Sachen in seinen Koffer. Auch Katrin, blaß und stumm, hatte seiner Aufforderung Folge geleistet.
»Mama wird bestimmt nicht sterben, Papa?« flüsterte Claus, der mit sich nicht mehr wußte, wohin, so durcheinander war er.
»Wenn der Arzt es doch gesagt hat«, beruhigte ihn sein Vater.
Eine halbe Stunde später waren sie bei Vera. Er gab ihr den Hausschlüssel, falls es den Kindern noch an irgend etwas fehlen würde. Im Geschäft wollte er noch vorbeischauen. Frau Steegen würde die Stellung halten, solange er fortblieb.
Vera drückte ihm fest die Hand. »Fahr vorsichtig, Dieter, paß auf dich auf.« Mehr zu sagen gab es jetzt nicht.
Als er fort war, kam Laura mit einer Tafel Schokolade aus ihrem Zimmer, die sie mit einer scheuen Gebärde Katrin hinreichte. »Für dich und Claus!« Die beiden hatten jetzt großen Kummer, und wie das war, oh, das wußte sie noch ganz genau.
Und Dieter Sasse fuhr westwärts, weiter und weiter, Stunde um Stunde, die Hände fest um das Lenkrad gelegt, den Blick geradeaus gerichtet, seinem Ziel entgegen. Und sein Ziel hieß Jenny!
*
Es war später Abend, als Dieter ankam. Man wollte ihn zu dieser nächtlichen Stunde nicht mehr einlassen. Bis ein Arzt auftauchte und der Diskussion ein Ende bereitete. Er war von Dr. Morgan informiert worden.
»Kommen Sie, Monsieur Sasse«, sagte er ernst. »Vielleicht wird Ihre Frau spüren, daß Sie da sind.«
Erschüttert stand Dieter dann an ihrem Bett, darin sie, bleich bis in die Lippen, im Dämmerschlaf lag. Nur manchmal zuckte es in ihrem Gesicht, wie von unsagbarer Qual.
»Jenny, ich bin bei dir… Jenny, hörst du mich…«
Aber sie war nicht herauszuholen aus diesem Nirgendwo, in dem sie dahintrieb. Eine Weile saß er auf dem Stuhl neben ihrem Bett. In einer Ecke standen die Koffer, die sie gestern aus seinem Haus herausgetragen hatte. Gestern…
Als er ging, begegnete ihm niemand in den langen Fluren. Der Nachtportier ließ ihn hinaus. Er mußte sich nun noch ein Zimmer suchen, fand es in einem Hotel im Zentrum. Von dort aus rief er Vincent Marian an. Es war halb zwei. Das Klingelzeichen ging lange ab. Es schien Dieters überreizte Nerven zu zerhacken. Endlich wurde der Hörer abgenommen.
»Was haben Sie mit meiner Frau gemacht?« fragte Dieter unbeherrscht, beinahe drohend.
»Wissen Sie, wie spät es ist?« kam die verschlafene Stimme Marians an sein Ohr, mit einem kaum unterdrückten Gähnen, und dann: »Ist sie schon wieder bei Ihnen?«
»Sie liegt in einem Krankenhaus in Reims, ich komme eben von ihr.«
»O Gott! Hat sie sich etwas angetan?« Das klang mit einem Schlag hellwach und sehr erschrocken.
»Jenny ist mit dem Auto verunglückt. Was haben Sie mit ihr gemacht?« wiederholte Dieter. »Sie war doch bei Ihnen?«
»Ja. Ich war völlig ahnungslos. Ich hätte doch nicht damit gerechnet, daß sie alle Brücken hinter sich abbrechen würde. Ich hatte eine Affäre mit Ihrer Frau, Herr Sasse. Von einem Zusammenleben war nie die Rede. Ich bedauere es sehr, daß es so gekommen ist. In welchem Krankenhaus liegt sie denn, ist es…«
Aber da hatte sein Gesprächspartner schon eingehängt. Dieter wußte genug. Arme Jenny, war sein letzter Gedanke, bevor er erschöpft in sein Bett fiel.
Als er aus bleiernem Schlaf erwachte, mußte er sich erst besinnen, wo er war. Um ihn war es dunkel. Von draußen tönte Straßenlärm, Autos hupten, Straßenbahnen fuhren vorbei. Halb acht… Dieter sprang auf und machte sich fertig. Im Frühstücksraum nahm er nur eine Tasse Kaffee zu sich, das andere ließ er stehen. Er fuhr ins Krankenhaus. Draußen dämmerte ein grauer Januartag herauf.
Um diese Zeit herrschte ein geschäftiges Treiben in den Gängen, Schwestern eilten hin und her. Dieter fragte nach Dr. Morgan. Es war der hochgewachsene Mann, der gerade aus einem Patientenzimmer kam.
»Sasse«, stellte Dieter sich vor, »wir haben gestern morgen miteinander telefoniert.«
»Sie sind schnell gekommen«, sagte der Arzt, und er bat ihn in sein Zimmer. Dort klärte er den Besucher über den Grad der Verletzungen seiner Frau auf. »Es ist ein Wunder, daß nicht mehr passiert ist. Sie hätte tot sein können. Auf regennasser Landstraße ist sie gefunden worden, dort ist sie in anscheinend viel zu hohem Tempo gegen einen Brückenpfeiler gefahren. Der Wagen ist abgeschleppt worden, er steht in einer Werkstatt. Sie werden sich schnell darum kümmern müssen.«
Dieter nickte abwesend. Wie ein eiserner Ring lag es ihm um die Brust. Hatte sie es gewollt? Hatte Jenny den Tod gesucht?
»Kann ich jetzt zu meiner Frau?« fragte er heiser.
»Ja.« Dr. Morgan erhob sich. »Sie muß endlich zum Reden gebracht werden. Da ist eine psychische Sperre, die sich hoffentlich lösen wird, wenn sie Ihrer ansichtig wird, Herr Sasse.«
Jenny war frisch gebettet und frisch verbunden worden, sie hatte die Augen offen, als Dieter eintrat. Ihr Blick wurde groß, verdunkelte sich jäh.
»Guten Morgen, Jenny.« Behutsam nahm er ihre Hand.
»Dieter.« Wie von sehr weither kam es über ihre blassen Lippen.
Er zog den Stuhl heran und setzte sich. »Man hat mich gestern benachrichtigt. Da bin ich gleich losgefahren. Ich war in der Nacht schon einmal da, aber da hast du geschlafen. Wie fühlst du dich? Hast du Schmerzen?«
Jenny antwortete nicht. Sie sah ihn nur an, lange, und ebenso lange hielt Dieter ihren Blick fest.
»Er hat mich gar nicht gewollt«, sagte sie endlich langsam. Sie schien diesen Worten nachzulauschen, wie mit großer Verwunderung.
»Du hattest dann die falsche Richtung eingeschlagen, Jenny«, sagte Dieter bedeutsam. »Reims liegt nicht auf dem Weg zurück nach Hause.«
»Reims?« fragte sie mit dünner Stimme, als habe sie nie etwas von einer Stadt dieses Namens gehört.
»Dies ist ein Hospital in Reims, Jenny. Wohin wolltest du denn?« Er mußte sie doch zum Reden bringen, hatte Dr. Morgan gesagt. Nur mit Behutsamkeit ging das nicht.
»Ja, wohin?« flüsterte sie nach einer langen Pause. Angestrengt versuchte sie sich zu besinnen. »Plötzlich war da ein Stoß und ein Schlag…«
»Du bist gegen einen Brückenpfeiler gefahren, weit draußen auf einer Landstraße. Jenny!« Seine Stimme wurde lauter, zupackender. »Sag mir, hast du das Ende gesucht? Hast du nicht mehr gewußt, daß du noch ein Zuhause hast? Sieh mich an und antworte mir!«
Sie tat es, nachdem einige Sekunden vergangen waren. »Ich wußte nur, daß alles Lüge war…«
»Es muß nicht alles Lüge gewesen sein, Jenny«, hielt Dieter ihr entgegen. »Nur hat dieser Mann nie daran gedacht, daß du ernst machen würdest.«
Um ihre Lippen zuckte es, ihre Lider sanken herab. Dieter blieb noch eine Weile bei ihr, schweigend jetzt. Für diese Morgenstunde war es wohl genug. Die Visite kam, zu fünft waren sie.
Dieter stand auf. »Ich komme heute nachmittag wieder, Jenny. Es gibt hier einiges zu regeln.«
»Mußt du nicht ins Geschäft?« murmelte Jenny sinnlos.
Im Hinausgehen fiel es Dieter ein, daß das jedermanns erste Frage gewesen war. Dieter Sasse und das Geschäft, es schien für alle eins zu sein. Irgend etwas war doch daran falsch.
Als er nach einigen Stunden wiederkam, fand er Jenny wacher und klarer vor als am Morgen. Lächelnd gab er seiner Freude darüber Ausdruck. Sie fand freilich kein Lächeln. Ein grübelnder Ausdruck war in ihrem Gesicht.
»Daß du gleich kamst, Dieter. Du konntest doch nicht wissen, was in Paris geschehen war.«
»Ich konnte es mir zusammenreimen, Jenny«, sagte Dieter, nun auch wieder sehr ernst. »Du wärst sonst nicht allein in der Nacht unterwegs gewesen. Für mich war zunächst nur wichtig, daß du am Leben geblieben warst.«
»Trotz allem – war dir das so wichtig?« fragte sie stockend.
»Wie kannst du fragen? Du bist doch meine Frau. Auch wenn du einen anderen liebtest und zu ihm gehen wolltest.«
Jenny drehte den Kopf beiseite.
»Ich war wahnsinnig«, sagte sie. Und, nach einer langen Minute schweren Schweigens: »Hast du Claus und Katrin zu Vera gebracht?«
»Ja. Wenn wir sie nicht hätten!«
Jenny nickte schwach. »Vera hat von Anfang an mit aller Eindringlichkeit versucht, es mir auszureden. Hätte ich nur auf sie gehört. Dann läge ich jetzt nicht hier und wüßte nicht, wie es weitergehen soll, das alles.«
»Du wirst gesund werden und wieder bei uns sein«, sagte Dieter fest.
Sie starrte gegen die Decke. »Wie soll ich denn nur vor unsere Kinder hintreten?« fragte sie leise.
»Du konntest es doch immer, wenn du von ihm kamst«, hielt Dieter ihr mit einer gewissen Härte entgegen. »Also mußt du jetzt auch da durch.«
Als sie nichts darauf sagte, ihr nur die Schamröte ins Gesicht gestiegen war, beugte er sich etwas näher zu ihr.
»Jenny, dir wie mir war die Welt aus den Fugen geraten, und es hat furchtbar weh getan. Was uns noch an Kraft geblieben ist, müssen wir darauf verwenden, die Bruchstücke wieder zusammenzufügen. Es wird Zeit brauchen. Aber vielleicht wird es uns gelingen.«
*
Vera trug das Mittagessen auf, als Edgar mit Katrin und Claus kam. Er hatte sie von der Schule abgeholt, denn der Weg war doch ziemlich weit.
»Sagst du es ihnen jetzt, Mama?« wisperte Laura. Bei ihr war die letzte Stunde ausgefallen, sie war schon eine Weile zu Hause, und sie war dabeigewesen, als der Anruf kam. Seitdem war die Kleine auch ganz aufgeregt.
»Euer Papa hat angerufen«, sagte Vera. »Er ist mit eurer Mutti unterwegs nach hier.«
Reglos verharrten die beiden. Sie starrten die Tante nur mit großen Augen an. Dann fragte Claus atemlos, mit rotem Kopf: »Kommt die Mama denn zu uns zurück?«
»Ja«, antwortete Vera, »sie kommt zurück. Sie wird mit dem Krankenwagen gebracht, der Papa fährt hinterher und bringt sie hier in ein Krankenhaus, denn es wird noch eine Weile dauern, bis sie wieder ganz gesund ist.«
»Und dann?« stieß Katrin hervor.
»Dann wird hoffentlich alles wieder gut werden«, sagte Vera mit einem ernsten Blick. Sie setzten sich um den Tisch.
»Ich hab immer gedacht, daß das doch gar nicht wirklich sein könnte, daß Mama für immer von uns fort wollte«, murmelte der Junge vor sich hin.
»Aber sie wollte es!« begehrte Katrin auf. »Vergessen kann ich das nicht, daß sie uns wegen einem anderen Mann alleinlassen wollte. Und unser Papa? Kann er sie denn wieder liebhaben?«
»Katrin«, Edgar legte sein Besteck hin, »eure Mutter hat einen Fehler begangen, den sie sehr bereut. Jeder Mensch, auch der liebste und beste, kann einmal in die Irre gehen. Dann muß man auch verzeihen können. Seid doch froh, daß sie am Leben geblieben ist. Dieser Unfall hätte auch anders ausgehen können.«
»Dann hättet ihr keine Mama mehr gehabt«, flüsterte Laura, tief beeindruckt von dem Geschehen, das sie hautnah miterlebte.
»Ich«, sagte Claus, und er holte tief Atem dabei, »ich geh gleich zu Mama, wenn sie da ist, und ich sag ihr, daß es ganz fürchterlich war, das alles, aber daß ich es echt richtig nie geglaubt habe.«
»Ja, du!« Katrin streifte ihren Bruder mit einem kurzen Blick. »Aber ich wohl. Weil sie uns ja schon aufteilen wollte.«
Mit Katrin wird es Jenny nicht einfach haben, ging es Vera durch den Sinn. Aber nichts würde einfach sein. Dafür war zuviel zerschlagen worden.
Am späten Abend, als die Kinder schon schliefen, tauchte Dieter noch überraschend auf. »Entschuldigt, daß ich euch so spät noch störe, aber da ich noch Licht im Wohnzimmer sah…«
»Du störst uns nicht. Komm herein«, sagte Edgar.
Vera ging ihrem Schwager entgegen. »Wie geht es Jenny?« war ihre erste Frage. »Es war doch eine lange Fahrt.«
»Ja.« Dieter sah erschöpft und zugleich erleichtert aus. »Sie hat sie aber ganz gut überstanden und wurde vorhin in der Klinik noch ärztlich versorgt. Wir alle müssen ihr jetzt beistehen.«
Mit einem langen Blick sah Edgar Jennys Mann an. »Ich kann dich nur bewundern, Dieter«, sagte er langsam. »Nicht jeder würde soviel Haltung zeigen.« Es klang achtungsvoll und sehr aufrichtig.
»Bewundern, o Gott.« Dieter fuhr sich mit der Hand über seine brennenden Augen. »Jenny ist aus ihrem Taumel sehr tief gestürzt. Einer mußte sie doch auffangen.«
Vera hatte aus der Küche Brot, Butter und Käse geholt. Sie baute alles auf dem Tisch auf, stellte eine Flasche Bier dazu. »Du hast bestimmt heute kaum etwas gegessen, Dieter«, sagte sie.
Ihr Schwager lächelte schwach. »Wenn ich sehe, was du da bringst, dann fällt mir ein, daß ich tatsächlich Hunger habe.«
Sie saßen noch ungefähr eine halbe Stunde beisammen. Dieter wollte wissen, ob er Katrin und Claus morgen noch bei ihnen lassen könnte.
»Morgen und übermorgen und solange es nötig ist«, gab Vera zurück. »Wir haben uns darauf eingerichtet und kommen schon zurecht.«
Er trank den letzten Schluck aus seinem Glas. »Wie haben sie es aufgenommen?« fragte er unsicher. »Ihr habt es ihnen doch sicher schon gesagt.«
Vera nickte. »Zum Jubeln ist es für sie noch zu früh«, meinte Vera ernst. »Sie müssen es doch auch erst verwinden.«
»Claus wird es eher schaffen«, meinte Edgar. »Bei Katrin sitzt es tiefer. Mit ihr werdet ihr Geduld haben müssen.«
Dieter sah auf seine Hände. »Geduld und viel guten Willen werden wir alle nötig haben, um wieder zu einem normalen Leben zurückzufinden«, sagte er schwer. Dann stand er auf. »Habt Dank für alles. Es hat mir gutgetan, noch mit euch reden zu können.«
»Das ist doch selbstverständlich«, sagte Vera herzlich.
*
Am nächsten Tag fuhr Vera mit Claus ins Krankenhaus. Katrin hatte nachmittags Schule, Laura war bei Bärbel. Vera erschrak darüber, wie gealtert Jenny ihr vorkam. Sie hatte eigentlich kein Mitleid mit ihr haben wollen. Aber da lag sie nun, die so hochgemut ausgezogen war, um mit ihrem Geliebten ein neues Leben zu beginnen, geschlagen, gestraft.
Claus war, eingeschüchtert von dieser Umgebung, an der Tür stehengeblieben. Erst als seine Mutter einen Arm nach ihm ausstreckte, näherte er sich ihr auf Zehenspitzen. Stumm sahen sie sich an. Jenny traten die Tränen in die Augen, auch im Gesicht ihres Sohnes zuckte es.
»Es war alles nicht wahr, nicht, Mama?« stammelte der Junge.
»Nein, es war alles nicht wahr«, brachte Jenny über die Lippen. Sie begegnete Veras Blick, und diese verstand. Sie hatte an eine große Liebe geglaubt, und es war doch nur ein Strohfeuer gewesen.
Katrin fuhr einen Tag später zu ihrer Mutter, allein. Das hatte sie so gewollt, und Vera ließ sie. Sie war ja schon ein großes Mädchen, mit ihren fast dreizehn Jahren.
Als sie wiederkam, war es, als sei sie nun kein Kind mehr. Wortlos zog sie sich zurück und ging an ihre Schularbeiten. Vera fragte sie auch nichts. Erst als es Zeit zum Abendessen wurde und Katrin sich immer noch nicht rührte, ging sie zu ihr. Da saß ihre Nichte, das Kinn in die Hand gestützt, und sah vor sich nieder. Vera trat auf sie zu und legte ihr die Hände auf die Schultern. »Hast du denn heute soviel auf, Katrin?«
Katrin hob den Kopf. Ihr Gesicht trug immer noch einen nach innen gekehrten Ausdruck, und die blaugrauen Augen blickten ernst.
»Meine Mutter hat mit mir geredet, als wäre ich schon erwachsen, Tante Vera«, sagte sie unvermittelt. »Ich kann sie jetzt besser verstehen. Der Papa hat ihr nie mehr so richtig gezeigt, daß er sie liebhat, und wir eigentlich auch nicht. Sie war eben da, und das war selbstverständlich. Dann hat sie sich in einen Mann verliebt, und er sich in sie, und Mama hat gedacht, sie könnte noch mal so glücklich sein wie früher, als sie mit Papa jung war und wir noch klein waren. Aber das war ganz falsch, was sie sich da gedacht hat…«
»Ja, Katrin, das war es«, bestätigte Vera.
»Onkel Edgar hat ja auch gesagt, daß jeder mal was falsch machen kann«, fuhr Katrin fort, »und wo sie nun wieder da ist, und dazu noch ziemlich krank, und auch der Papa sie wieder liebhaben will, da will ich meiner Mutter auch nicht mehr böse sein.«
»Das ist sehr schön von dir, Katrin.« Gerührt und erleichtert streichelte Vera ihr über das blonde Haar. Hatte Jenny doch die richtigen Worte gefunden in einer äußerst schwierigen und heiklen Situation! »Und jetzt komm, dein Bruder und Laura fragen schon immer nach dir. Ich habe aber gesagt, sie sollten dich nicht stören. Onkel Edgar wird auch bald da sein.«
Dann holte Dieter Sasse seine Kinder heim. Zehn Tage später konnte Jenny die Klinik verlassen.
Damit ließ sie nicht nur das schmale Krankenbett und körperliches Leiden hinter sich, sondern auch die Erinnerung an einen Abend in Paris, an dem sie erkennen mußte, daß sie einer Illusion nachgejagt war.
Freudig überrascht hatte Vincent Marian sie empfangen, aber dann – dieses Unbehagen in seiner Miene, das sich in tiefe Bestürzung, ja förmlich in Entsetzen verwandelte, als sie ihm sagte, daß sie nun frei sei für ein Leben mit ihm. Das hatte er nicht gewollt – so nicht!
Er setzte dazu an, ihr klarzumachen, warum das undenkbar sei: Als Künstler brauche er seine Freiheit – Liebe und Leidenschaft, ja, aber doch keine Bindung. Da hastete sie schon davon, blindlings, in der brennendsten Demütigung, die eine Frau nur erfahren konnte.
Ihr Auto stand vor der Tür, ihr Auto mit den Koffern darin. Sie warf den Motor an und raste davon, irgendwohin, egal, es gab so viele Straßen, und die Nacht nahm sie auf…
Jenny hatte viel zu bewältigen gehabt in den langen Stunden im Krankenhaus. Sie hatte es geschafft. Noch fühlte sie sich schwach, wie Genesende sich eben schwach fühlten. Aber sie hatte nun eine große Aufgabe, die ihr Kraft geben würde. Diese Aufgabe bestand darin, gutzumachen, was sie ihrer Familie angetan hatte.
*
Die Wochen und Monate vergingen. Schon hatte der Wonnemonat Mai begonnen, der seinem Namen in diesem Jahr freilich wenig Ehre machte. Kühl und regnerisch zeigte er sich, die Menschen kamen aus dem Frösteln nicht heraus. »Wenn das so bleibt«, sagte Laura betrübt, »dann können wir meinen Geburtstag aber nicht draußen feiern.« Und sie freute sich doch so darauf, daß die Mama für sie ein richtiges Geburtstagsfest geben wollte, wie sie es sich kaum vorstellen konnte. Woher sollte sie auch?
Aber siehe da, der 16. war ein warmer, sonniger Tag. Vera hatte sich alle Mühe gegeben, eine lustig-bunte Dekoration auf der Terrasse anzubringen. Ein großer Tisch war mit Namenkärtchen versehen, die ein winziges Papierschirmchen oder ein Hütchen trugen und gerade waren die sieben Kerzen auf der Geburtstagstorte angezündet, als die ersten Gäste pünktlich kamen. Das waren Bärbel und noch zwei andere Klassenkameradinnen. Laura empfing sie mit glühenden Wangen. Wie aufregend war das doch, heute die Hauptperson zu sein!
Kurz darauf hielt der »Frosch« vor dem Haus, wie die Kinder den neuen Wagen von Jenny getauft hatten, weil er so grün war wie der Wetterfrosch. Den vorherigen, stark reparaturbedürftigen hatte Dieter seinerzeit in Frankreich gelassen. Es gab ein großes »Hallo«, erneute Glückwünsche und kleine Geschenke für das Geburtstagskind. Die kamen zu den anderen, mit denen Laura schon liebevoll bedacht worden war.
»Ich hab ja direkt einen Ehrenplatz«, stellte Claus vergnügt fest, als er seinen Platz neben Laura fand.
»Du bist ja auch der einzige junge Mann unter lauter Mädchen«, scherzte seine Tante Vera. Seine Mutter fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: »Daß du dich nur auch entsprechend benimmst!«
Dann durfte Laura die Geburtstagstorte anschneiden, und ihr Fest konnte beginnen.
*
Um dieselbe Zeit, am frühen Nachmittag, ging eine junge Frau in einem Mietshaus in der Kaiserstraße von Tür zu Tür und fragte nach einem Ehepaar Matthau, das einmal hier gewohnt haben sollte. Aber keiner der Bewohner konnte ihr eine Auskunft darüber geben.
Schließlich begegnete sie im Treppenhaus einer weißhaarigen Dame. Diese musterte die Fremde mit flinken Augen. »Wen suchen Sie hier? Matthau? Ja, an die erinnere ich mich noch. Die hatten ein Baby, ein Mädchen war das. Aber es war wohl nur angenommen, denn schwanger habe ich die Frau Matthau nie gesehen.«
»Ja, das müssen sie sein«, sagte die junge Frau hastig. »Sind die weggezogen? Haben Sie eine Ahnung, wo ich sie jetzt finden kann?«
»Nein, die sind nicht mehr aufzufinden. Das war ein ziemliches Theater damals, als die nicht wiederkamen. Nach Monaten hat der Vermieter die Wohnung räumen lassen. Keiner hat sich darum gekümmert, und die Miete wurde nicht mehr bezahlt.« Sie hob die Schultern. »Wissen Sie, das waren komische Leute. Nachbarschaftliche Kontakte gab es mit denen nicht. Wer weiß, was aus denen geworden ist.«
»Aber Menschen können doch nicht einfach verschwinden«, stieß die Jüngere hervor.
»Doch, doch, das gibt es schon. Davon hört man doch öfter, und im Fernsehen kommt es auch.« Ein neugieriger Ausdruck trat in ihre Augen. »Warum interessieren Sie sich denn so dafür, sind Sie am Ende eine Verwandte von den Matthaus?«
»Nein, das bin ich nicht. Ich wollte nur wissen, was aus dem Kind geworden ist.«
»Ach ja?« Forschend betrachtete die alte Dame die junge Frau, die unentschlossen stand. Sie hätte gern weiter gefragt, aber irgend etwas in der Miene der anderen verbot es ihr. »Da kann ich Ihnen leider nicht helfen… Aber, warten Sie mal, da war doch mal was?«
»Ja, was denn?« kam es voll geheimer Spannung zurück.
»Hm, da ist nämlich jemand von einem Kinderheim gekommen, der hat auch hier überall herumgefragt nach den Matthaus. Ja, richtig, das fällt mir jetzt wieder ein.«
»Von einem Kinderheim?« fragte die junge Frau entsetzt. »Was für ein Kinderheim war das, wie hieß es?«
»Wenn ich das noch wüßte. Es ist doch schon viele Jahre her.«
»O bitte, versuchen Sie sich zu besinnen. Es ist ungeheuer wichtig für mich.« Es klang erregt und flehend.
»Es war ein Name«, überlegte die andere. »Ja, ein Frauenname, irgendwas mit Maria… Aber weiter weiß ich nicht. Beim besten Willen nicht, tut mir leid. Sehen Sie doch mal im Telefonbuch nach, ob Sie da etwas finden.«
»Ja, das werde ich tun. Sie haben mir sehr geholfen. Ich danke Ihnen.« Damit eilte sie schon davon. Kopfschüttelnd sah die alte Dame ihr nach. Sie hatte nun etwas zum Nachdenken, welche Zusammenhänge es da wohl gab.
*
»Guten Morgen, Frau Behrend«, sagte Vera, etwas erstaunt über den Anruf am frühen Morgen.
Die Heimleiterin kam ohne Umschweife zur Sache.
»Gestern war eine junge Frau bei mir, die sich als Mutter von Laura ausgibt. Sie heißt Alice Pavel und kommt aus Rumänien.«
Vera mußte sich setzen. »Was will sie?« fragte sie. Wahrscheinlich war das eine törichte Frage, denn lag die Antwort nicht klar auf der Hand?
»Sie will ihr Kind sehen«, sagte Adele Behrend denn auch. »Vorher möchte sie aber mit Ihnen reden. Wann würde es ihnen denn passen?«
»Ja, ich weiß nicht – das kommt mir jetzt so überraschend…«, brachte Vera hervor.
»Sicher, mir ging es nicht anders, Frau Gerstner. Das Haus Maria Barein hatte sie an uns verwiesen.«
»Aber wenn sie wirklich die Mutter ist, wieso besinnt sie sich dann erst nach sieben Jahren auf ihr Kind?«
»Das ist eine lange Geschichte, die Frau Pavel Ihnen selber erzählen wird. Ich zweifle eigentlich nicht an der Wahrheit ihrer Darstellung. Es besteht auch eine unverkennbare Ähnlichkeit mit Laura. Entschuldigen Sie, Frau Gerstner, ich muß um neun zu einer wichtigen, unaufschiebbaren Besprechung ins Jugendamt. Sagen Sie mir bitte, wann ich sie zu Ihnen schicken kann. Sie wohnt in einer Pension in Bahnhofsnähe und wartet dort auf meinen Anruf.«
»Also dann um zehn Uhr«, sagte Vera tonlos. Sie hielt den Hörer noch in der Hand, als Frau Behrend längst aufgelegt hatte, sie starrte zu Boden. Was würde diese Begegnung bringen?
Sie rappelte sich auf und ging mechanisch ihrer Hausarbeit nach. Es waren noch einige Spuren zu beseitigen von dem gestrigen Kinderfest. Wie fröhlich waren sie alle gewesen, sie hatten gespielt, gescherzt und gelacht, und die Stunden waren schnell vergangen. Laura hatte gestrahlt. Vera war bange bei dem Gedanken daran, was jetzt unter Umständen auf sie zukommen konnte. Dieses Kind durfte doch nicht wieder entwurzelt werden!
Als es um punkt zehn Uhr klingelte, ganz kurz, kaum angetippt, ging Vera herzklopfend an die Tür. Sie sah sich einer mittelgroßen schlanken Frau gegenüber, mit schmalem Gesicht und ernsten dunklen Augen, hoher Stirn unter straff zurückgestrichenem schwarzbraunem Haar.
»Ich bin Alice Pavel«, sagte die Besucherin.
»Ja. Kommen Sie herein.« Veras Stimme klang belegt. Sie bot Alice Pavel Platz in der Sitzecke im Wohnzimmer an. Ihre Gefühle waren sehr gemischt. Sie hatte sehr viel innere Vorbehalte gegen diese Frau, jetzt mußte sie gerechterweise zugeben, daß sie eine angenehme, gepflegte Erscheinung war, in ihrem schlichten Kostüm mit der blütenweißen Bluse.
»Sie haben es sehr schön hier«, bemerkte Alice Pavel leise, als ihr Blick durch den großen Raum schweifte, darin die Morgensonne die Möbel glänzen ließ. Sie sah auch den Tisch in der Ecke, auf dem, um einen Blumenstrauß herum gruppiert, allerlei hübsche Geschenke standen.
»Das ist Lauras Geburtstagstisch«, erklärte Vera.
Alice Pavel nickte, um ihren Mund zuckte es weh. Sie legte die Hände zusammen, schmucklos wie die ganze Person, und sie sah die Hausfrau an, als wüßte sie nicht, wo beginnen.
»Sie kommen aus Rumänien, wie Frau Behrend mir sagte«, half Vera ihr.
»Ja, aus Bukarest. Ich bin dort Ärztin an einem Krankenhaus.« Sie machte eine Pause, bevor sie mit schwerer Stimme fortfuhr: »Der Mann, der mein Kind damals fortschaffte, hat mir erst auf dem Totenbett gestanden, wohin es gekommen ist.«
»Hat er…« Vera befeuchtete mit der Zungenspitze ihre Lippen, »hat er es Ihnen geraubt?«
»Nein. Ich hatte es verkauft.« Unsägliches Elend lag in dem Blick, der Veras Blick begegnete.
Fassungslos starrte Vera sie an. Hatte sie recht gehört? Eine Mutter, die ihr Kind verkaufte! Sie wollte empört sein, ihr Verachtung ins Gesicht schleudern – aber seltsam, sie konnte es nicht. Sie fühlte sich eher bange, beklommen, als lege sich die Last eines ihr unbekannten Schicksals auf die Schultern.
»Erzählen Sie, Frau Pavel«, sagte sie, als sie wieder Worte fand.
Und Alice Pavel begann… Sie holte weit aus, sprach langsam, schleppend. Wie ein Film im Zeitlupentempo zeigte sich Vera ein junges Leben, das dem ihrigen sehr fern lag.
Arm waren die Menschen in dem kleinen Ort im Hügelland der Moldau, wo Alice als drittes Kind in der Familie geboren wurde. Der Vater starb früh, die Mutter mußte Alice und die beiden älteren Brüder mit Schichtarbeit in einer Fabrik über die Runden bringen. Das Monatsgehalt einer Arbeiterin war so gering, daß es kaum zum Allernötigsten reichte.
Die heranwachsende Alice hatte nur einen Gedanken, dieser Armseligkeit zu entfliehen. Sie wollte viel lernen, und sie lernte leicht und schnell. Die Lehrer förderten sie. Ihr Traum war, in der Hauptstadt zu studieren, später als Ärztin zu helfen. Sie arbeitete dafür. In einem Jahr sollte sie die Schule verlassen – als Beste ihrer Klasse.
Eine Schwangerschaft paßte nicht in diesen Traum.
Es geschah nach einem Dorffest, ein junger Mann aus dem Nachbarort verführte sie. Es mochte auch der Hunger nach ein wenig Liebe und Zärtlichkeit gewesen sein, daß sie es zugelassen hatte.
Vier Monate dauerte es, bis die unerfahrene Siebzehnjährige merkte, daß sie schwanger war. Für Alice eine Katastrophe. Ihr Traum war geplatzt, ihre Zukunft hieß Schande. Hier wurden unverheiratete junge Mütter geächtet, ihre Mutter, hart und verbittert geworden im Daseinskampf, hätte sie davongejagt. Der Vater des Kindes war längst über alle Berge. Sie hätte ihn auch nicht gewollt. Es war nur eine flüchtige Affäre gewesen.
In ihrer Not wandte sich sich an einen Arzt, den hier alle kannten, obwohl sie seinen Namen nur hinter vorgehaltener Hand tuschelten. Dr. Manescu praktizierte nicht mehr. Es hieß, man habe ihm die Zulassung wegen dunkler Geschäfte entzogen. Bewiesen war nichts. Er lebte auch ohne Arbeit gut, ging hin und wieder auf Reisen, niemand wußte, wohin.
Dieser Mann, etwa Anfang oder Mitte fünfzig nahm das untröstliche Mädchen in den Arm.
»Mach dir keine Sorgen, ich kann dir helfen. Du bringst dein Kind heimlich zur Welt – und verdienst dabei eine Menge Geld. Damit kannst du dir dein Studium finanzieren. Von der Existenz des Kindes wird hier niemand erfahren. Es wird im reichen Westen aufwachsen und ein wunderbares Leben haben.«
Alice bekam das Kind, ein Mädchen. Sie sah es nur einmal für zwei kurze Minuten aus fünf Metern Entfernung. Als sie es am nächsten Tag noch einmal sehen wollte, war es verschwunden. Mit ihm Dr. Manescu. Er war wieder einmal »auf Reisen«. Aber er kam wieder.
»Deinem Kind geht es gut«, sagte er, und er gab ihr das Geld. Dreitausend Mark, für Alice eine ungeheure Summe, wenn man bedachte, daß der Arbeitslohn ihrer Mutter siebzig Mark betrug und sie eine Familie davon ernähren mußte. Ein Trostpflaster konnte es aber nicht sein.
Hier stockte Alice Pavel in ihrer Erzählung.
»Woher hatte er das Geld?« fragte Vera nach einer Pause.
»In Osteuropa blüht der Babyhandel«, antwortete Alice. »Rumänien ist eine Hochburg dafür. Manescu gehörte zu einer Mafia-Bande, die Kinder ins Ausland schmuggelt. Aus Verzweiflung über ihre schlechte wirtschaftliche Situation sind immer mehr Eltern bereit, ihre Kinder zu verkaufen. Hauptabnehmer sind Paare aus dem Westen, die sich damit, ohne weitere Umstände, ihren Kinderwunsch erfüllen.«
Vera fröstelte es. Sie sah in Abgründe, von denen sie bisher keine Ahnung hatte.
Sie war dann, fuhr Alice Pavel fort, nachdem sie sich wieder gefaßt hatte, ihren Weg gegangen. Sie hatte studiert, ein Examen nach dem anderen bestanden. Nichts anderes konnte es mehr für sie geben. Dafür war der Preis zu hoch gewesen.
Manchmal fuhr sie in ihr Dorf, um ihre einsam gewordene Mutter zu besuchen. Die Brüder waren aus dem Haus, sie wußten kaum etwas von ihnen. Und jedes Mal, wenn sie dort war, suchte sie auch Dr. Manescu auf, flehte ihn an, ihr zu sagen, wohin er ihr Kind gebracht hatte. Obwohl sie wußte, daß sie kein Anrecht mehr darauf hatte, wollte sie doch wenigstens einen kleinen Anhaltspunkt haben. Irgendwann, so dachte sie immer wieder in all den Jahren, gab es vielleicht doch einen Weg für sie, zu erfahren, was aus ihrem kleinen Mädchen geworden war.
Aber Dr. Manescu schwieg. Er gehorchte damit dem Gebot der Händler-Organisation, der er sich verpflichtet hatte.
Dann wurde er krank, sehr krank. Nur in der Klinik in Bukarest hoffte er noch Hilfe zu finden. Geld spielte keine Rolle dabei, er hatte genug aus seinem verbrecherischen Tun. Er kam auf ihre Station. Rettung gab es nicht mehr für ihn, der Krebs hatte ihn zerfressen. Doch klaren Geistes war er bis zuletzt.
Es waren zu viele, sagte er, als sie wieder und wieder um einen Hinweis bat, flehte, bettelte. Bis zuletzt – dann nannte er ihr einen Namen, eine Stadt in Deutschland…
»Und so kam ich hierher«, schloß Alice Pavel.
Vera betrachtete sie, von den widerstreitendsten Gefühlen erfüllt. »Sie suchten die Matthaus«, stellte sie fest. »Aber die gibt es nicht mehr.«
»Ich weiß, wie mein Kind verlassen und weitergegeben wurde. Nicht einmal das kann ich mir zum Trost sagen, daß es ein gutes Leben hatte. Bis Sie es aufnahmen, Frau Gerstner.«
»Ich konnte eines Tages nicht mehr anders«, gestand Vera. »Es fing damit an, daß sie um unser Haus strich, ein kleines fremdes Mädchen, armselig anzuschauen, mit sehnsüchtigen Blicken zu uns hin. Wir hatten keine Ahnung, daß es aus dem Waisenhaus fortgelaufen war, es tischte uns eine phantastische Geschichte auf…« Sie erzählte, wie sich dann alles allmählich ergeben hatte, die tiefe gegenseitige Zuneigung, die zu dem Entschluß führte, es aus dem Karolinen-Haus zu nehmen.
Danach trat ein bedeutungsvolles Schweigen ein. Bis Vera die Frage stellte, die im Raum stand: »Was haben Sie jetzt vor, Frau Pavel? Wollen Sie uns Laura wieder fortnehmen?«
»Ich dachte, sie sollte zumindest wissen, daß sie noch eine Mutter hat«, sagte Alice leise, mit gesenkten Lidern. »Wie wollte ich sie liebhaben, wenn sie mit mir kommt.« Ein sehnsüchtiger Ausdruck verklärte ihre Miene.
Ein tiefer Seufzer hob Veras Brust. »Laura hat schon soviel verkraften müssen«, sagte sie bedrückt. »Jetzt, wo sie endlich Geborgenheit und Beständigkeit gefunden hat, soll nun alles wieder anders werden?«
Wieder schwiegen sie, lange, bange Sekunden lang. Dann klingelte es plötzlich Sturm. Die beiden Frauen zuckten zusammen, Vera fuhr empor. Sollte das schon Laura sein?
»Ja, wo kommst du denn jetzt schon her?« empfing sie das Kind.
»Hast du vergessen, Mama, daß ich heute nur zwei Stunden habe?« lachte Laura. »Ich bin mit Bärbel gegangen, stell dir vor, die kriegt einen kleinen Hund, da darf ich auch mal mit spazierengehen. Oh, haben wir Besuch?«
Artig sagte sie »Guten Tag« zu der fremden Frau, die aufgestanden war, und sie gab ihr das Händchen.
Vera hielt den Atem an. Was würde jetzt geschehen? Hoffentlich verlor Alice Pavel nicht die Beherrschung. Aber sie sagte nur »Guten Tag, mein Kind«, und sie sah darauf nieder, auf ihr Kind.
»Haben Sie meinen Geburtstagstisch schon gesehen?« fragte Laura zutraulich. »Ich habe nämlich gestern Geburtstag gehabt. Ich bin sieben geworden.«
»Ja, ich weiß.«
»Hat meine Mama Ihnen das schon gesagt. Es war riesig, wir haben ganz toll gefeiert.«
»Ich gratuliere dir auch noch nachträglich…«
»Danke«, strahlte Laura. »Ich bringe jetzt eben meine Sachen rauf«, und sie sprang mit ihrem Ranzen davon.
»Ich werde jetzt auch gehen«, sagte Alice Pavel so mühsam, als strenge sie das Sprechen an. »Ich kann sie doch nicht damit überfallen, daß ich ihre Mutter bin. Würden Sie…« Sie räusperte sich. »Würden Sie Laura darauf vorbereiten?«
Vera nickte, wenn auch schweren Herzens. »Wie lange bleiben Sie denn noch, und wo kann ich Sie erreichen, Frau Pavel?«
Alice nannte ihr den Namen ihrer bescheidenen Pension, in der sie die nächsten Tage noch wohnen würde. »Ich werde dort auf Ihren Anruf warten, wann ich wiederkommen darf.«
»Ist die Frau schon gegangen?« fragte Laura, als sie wieder herunterkam. »Die hat mich so komisch angeguckt.« Aber mit dem gleichen Atemzug kam sie schon wieder auf das Hündchen zu sprechen, das Bärbel gehören sollte.
Bereits nach dem Mittagessen nahm Vera ihren Mann beiseite und erzählte ihm, was sich an diesem Vormittag begeben hatte. Mit gerunzelter Stirn hörte er ihr zu.
»Du redest von dieser Person fast so, als habe sie deine Sympathie, trotz ihrer ungeheuerlichen Tat«, bemerkte er unwillig.
Mit einer hilflosen Geste hob Vera die Schultern, sie sah beiseite. »Ich kann sie nicht verdammen, Edgar. Wie heißt es doch: Wer unter euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Uns ist es immer gutgegangen. Was wissen wir schon davon, in welche Lage ein Mensch kommen kann…«
Der Mann schwieg. Dann überlegte er laut: »Das wird nicht einfach sein, es Laura zu erklären. Aber wissen muß sie es natürlich. Sie könnte uns sonst später einmal Vorwürfe machen. Man weiß ja nicht, ob diese Frau Ruhe geben wird.« Er schüttelte den Kopf, er suchte den Blick seiner Frau. »Die Kleine würde uns fehlen, nicht wahr, Vera?«
»O ja«, flüsterte Vera. »Aber soweit ist es noch nicht.«
Am Nachmittag, als Laura ihre Schulaufgaben gemacht hatte und sich nun eigentlich eine Kindersendung ansehen durfte, blieb der Fernseher ausgeschaltet. »Komm, ich erzähle dir etwas«, sagte Vera und zog das Kind zu sich auf die Couch. Bereitwillig schmiegte es sich an sie. Sich von der Mama etwas erzählen zu lassen, war noch viel schöner.
»Laura, die Frau, die gestern bei uns war, hat den gleichen Familiennamen wie du: Pavel«, begann Vera. »Sie kommt aus einem anderen Land, aus Rumänien, wo es den Menschen nicht so gutgeht wie den meisten hier bei uns. Dort herrschen Armut und große Not vor. Auch Frau Pavel war so arm, daß sie nicht wußte, wovon sie ihr Kind ernähren sollte.«
»Hatte sie keinen Mann? Oder war der auch so arm?«
»Sie hatte keinen Mann. Der war fortgegangen, bevor das Kind zur Welt kam.«
»Das ist aber gemein«, befand Laura.
»Dann ist jemand gekommen«, fuhr Laura fort, »der ihr sagte, daß er das Baby zu Leuten nach Deutschland bringen würde, wo es ein gutes Leben haben sollte. Da hat sie eingewilligt, obwohl ihr das sehr schwer fiel, denn damit sollte sie für immer auf ihr Kind verzichten.«
Sie war geschönt, diese Geschichte. Aber was sollte sie dem Kind von den schmutzigen Geschäften erzählen, die dahinterstanden? Laura würde es noch nicht verstehen.
»Trotzdem hat sie jahrelang versucht zu erfahren, wo ihr Kind denn geblieben sei. Aber der Mann, der allein es wußte, wollte es ihr nicht sagen. In all diesen Jahren, es waren sieben, hat Alice Pavel ihre ganze Kraft daran gesetzt, einen ordentlichen Beruf zu erlernen, sie hat studiert und ist Ärztin geworden in einem Krankenhaus. Todkrank wurde dieser Mann ihr Patient, und mit seinen letzten Worten, bevor er starb, hat er es ihr dann gesagt. Da ist sie nach Deutschland gefahren, um ihr Kind wiederzusehen. Es heißt – Laura Pavel!«
Laura hatte schon aufgemerkt, als die Zahl Sieben und der Name Pavel wieder fielen. Jetzt fuhr sie steil empor. »Sie ist…«, stammelte sie – und brachte es doch nicht hervor.
Vera nickte ernst. »Sie ist deine Mutter, Laura.«
»O nein, Mama, nein!« brach es aus Laura heraus. »Sie darf mich nicht fortnehmen in ein fremdes Land. Sie ist eine fremde Frau. Ich will bei euch bleiben.« Sie zitterte plötzlich am ganzen Körper. Ihre Traumwelt, die voriges Jahr auf so wunderbare Weise Wirklichkeit geworden war, sie sah sie auf einmal bedroht.
Vera zog sie wieder an sich. »Beruhige dich, Laura. Sie wird dich sicher nicht dazu zwingen, wenn du es nicht willst.«
Die schmale Gestalt des Kindes zog sich zusammen, Laura drückte den Kopf gegen Veras Schulter, als wollte sie sich verstecken. Vera streichelte sie. Sie hatte es ihr so schonend wie möglich beibringen wollen, und nun war es doch ein Schock für sie geworden.
»Ich habe es aber gar nicht gutgehabt«, kam es nach einer Weile klagend. »Wenn sie mich deshalb fortgegeben hat, dann ist das gar nicht wahr. Ich war in einem Waisenhaus, da waren die Kinder ganz schlimm, und lieb zu mir war da keiner.«
»Du warst zuerst bei einem Ehepaar, das viel darum gegeben hat, dich behalten zu dürfen. Aber daran hast du wohl keine Erinnerung mehr, du warst noch zu klein.«
Laura machte eine ungewisse Kopfbewegung. »Ich war immer im Karolinen-Haus«, beharrte sie. »Eine Mutter hab ich mir immer nur ausgedacht und einen Vater. Bis ich dich gesehen habe, Mami, und gebetet habe, daß ich bei dir sein dürfte.« Sie richtete sich auf und warf ungestüm die Arme um Veras Hals. »Laß mich bei dir bleiben, Mami, und bei Papa!«
»Wir möchten es ja auch gern, Laura«, murmelte Vera verhalten. »Aber vielleicht, wenn du deine Mutter erst näher kennenlernst…« Sie schluckte hart. »Sie wird wiederkommen, weißt du, und dann sperre dich nicht zu sehr gegen sie. Tu ihr nicht weh.«
*
Sie war so schnell am Telefon, daß man meinen konnte, sie hätte daneben gesessen und immer nur darauf gewartet, daß der Anruf käme.
»Sie können morgen zum Mittagessen zu uns kommen, Frau Pavel«, sagte Vera. »Ich habe Laura darauf vorbereitet.«
»Haben Sie…« Alice stockte.
»Ich habe ihr nichts gesagt, was ihre Mutter in ein schlechtes Licht bringen könnte«, versicherte Vera ernst. »Aber sie hat noch gar kein Gefühl dafür, daß es sie nun plötzlich geben soll.«
»Das kann ich auch nicht verlangen«, kam es leise zurück.
Edgar begrüßte den Gast mit zurückhaltender Höflichkeit. Aber auch er mußte bei sich feststellen, daß Alice Pavel nicht unsympathisch war. Eine intelligente Frau, zweifellos, und es war schließlich aller Achtung wert, daß sie sich, aus bescheidensten Verhältnissen kommend, mit eiserner Energie ihren Berufswunsch erfüllt hatte. Wie sie in der Wangenlinie und mancher Kopfbewegung doch Laura glich!
»Schmeckt Ihnen das, was meine Mami gekocht hat?« fragte Laura, die bis dahin weitgehend stumm geblieben war. Die unterschwellige Spannung war groß.
»Warum sagst du denn Sie zu mir, Laura? Du weißt doch, wer ich bin.«
»Meine Mutter, ja. Aber wenn ich Sie doch gar nicht kenne! Zu Fremden sage ich immer Sie.«
Da beugte Alice den Kopf tiefer über ihren Teller. Sie schwieg.
»Ihr werdet euch kennenlernen, wenn ihr nachher einen Spaziergang zusammen macht. Es ist doch so schön draußen.« Vera bemühte sich, möglichst leichthin zu reden. »Du kannst deiner Mutter ja mal das Haus zeigen, worin du so lange gelebt hast.«
Von diesem Spaziergang kam Laura allein zurück.
»Sie ist schon weitergegangen, Mama«, berichtete sie. »Ich glaube, sie wollte jetzt allein sein.« Und, nach einer kurzen Pause, sehr nachdenklich: »Sie hat geweint, wie ich ihr das Karolinen-Haus gezeigt habe. Nicht richtig laut, aber sie hat sich mehrmals die Augen gewischt, und ihr Gesicht war naß, das hab ich gesehen.«
Vera sorgte dafür, daß Alice und Laura noch öfter zusammenkamen. Sie fuhr sie auch einmal zu einem hübschen Ausflugsziel, ließ sie dort und holte sie erst später wieder ab. Ein anderes Mal waren Katrin und Claus da. Sie wußten Bescheid, und sie beäugten verstohlen die Fremde, während sie zusammen ein Spiel machten.
»Wenn sie nicht so altmodisch angezogen wäre und sich das Haar anders machen und ein bißchen anmalen würde, könnte sie ganz hübsch aussehen«, meinte Katrin später.
»Frau Pavel hat anderes zu tun, als sich anzumalen«, wies Vera ihre naseweise Nichte zurecht. Daß sie doch immer auf Äußerlichkeiten bedacht war, diese Katrin!
Bald kam der Tag, an dem Alice zu Vera sagte: »Ich fahre morgen heim, Frau Gerstner. Lauras Liebe gehört Ihnen. Sie sind die Mama für sie. Ich werde ihr immer eine Fremde bleiben. Deshalb muß ich gehen.«
»Es tut mir leid«, murmelte Vera. »Ich habe getan, was ich konnte.«
»Ja, das haben Sie, und dafür danke ich Ihnen. Daß Sie und Ihr Mann so gut sind zu meinem Kind und Laura es hier so wunderschön hat.«
Sie saßen auf der Terrasse an diesem warmen Maientag. Alice ließ ihren Blick über die blühenden Fliederbüsche, die bunten Beete mit den Frühlingsblumen schweifen, bevor sie fortfuhr: »Was könnte ich ihr dagegen schon bieten in unserem armen, geschundenen Land. Mein Verdienst ist gering, ich unterstütze meine Mutter noch davon. Sie ist alt und müde und soll nicht mehr in die Fabrik gehen.«
»Es geht nicht um das, was Sie ihr bieten können, Alice«, sagte Vera ernst. »Die hübschen Kleider, unser Haus, dieses ganze Wohlleben, das Laura nun hier hat, das alles ist nicht ausschlaggebend. Sie hängt mit ihrem ganzen Herzen an uns, und wir haben sie lieb. Das ist es, weshalb man Laura nicht den Boden fortnehmen sollte, darin sie Wurzeln gefaßt hat.«
»Sie haben recht. Laura soll ein glückliches Kind bleiben.« Damit stand sie auf. »Es war schon viel, daß ich sie gesehen habe und Stunden mit ihr verbringen durfte. Davon werde ich zehren.«
Sie gaben einander stumm die Hand, und sie sahen sich an. Vera hatte den Ausdruck von Leere und Verlorenheit, die jetzt in Alices Augen waren, schon einmal gesehen. Hatte sie an jenem Tag gesehen, als die Frau vom Karolinen-Haus Laura mit sich fortzerrte und das Kind sich noch einmal nach ihr umsah…
»Kommt sie nicht mehr wieder?« fragte Laura, als Vera ihr sagte, daß ihre Mutter zurück nach Rumänien wollte.
»Nein«, preßte Vera hervor. Obwohl sie froh und erleichtert sein sollte, bebte Erschütterung über dieses Frauenschicksal in ihr nach.
Scheu sah Laura sie an. »War sie sehr traurig?«
Vera zögerte. »Sie weiß, daß du lieber bei uns bleibst«, wich sie aus.
»O ja, Mama!« Laura schlang die Arme um Veras Hüften. »Das wäre ganz schlimm gewesen, wenn ich von euch weg und nach Rumänien gemußt hätte!« beteuerte sie leidenschaftlich.
*
Im Spätsommer war es, und es roch schon ein wenig nach Herbst, als Vera und Edgar ihren 10. Hochzeitstag hatten. Für den Abend hatten sie Jenny und Dieter eingeladen. Sie waren sich sehr nahe nach einem gemeinsam verbrachten Urlaub mit Katrin, Claus und Laura. Ein geräumiges Ferienhaus an der Ostsee hatten sie gemietet und fröhliches Strandleben genossen.
»Auf euch!« sagte Dieter Sasse herzlich, als der Champagner in den Gläsern perlte. »Daß ihr glücklich bleiben möget bis zu eurer Goldenen Hochzeit und länger!«
»Danke! Den Wunsch geben wir an euch zurück«, lachte der Hausherr, und sie stießen darauf an.
Vera bemerkte, wie Jenny und Dieter sich in die Augen sahen, als sie die Gläser zurücksetzten. Diese beiden hatten zu einer neuen, tiefen Verbundenheit gefunden. Sicher war der Weg schwer gewesen, aber ihr Schwager hatte eingesehen, daß auch er nicht ganz unschuldig an Jennys tiefem Fall gewesen war.
Ach, es war vorbei!
Sie stand auf, um die Kerzen im Leuchter anzuzünden, deren goldene Flämmchen den Glanz in ihrer aller Augen noch vertiefte.