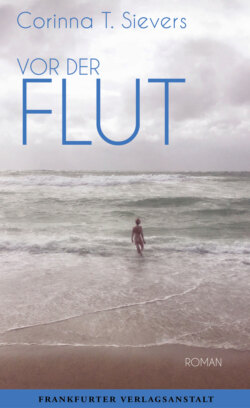Читать книгу Vor der Flut - Corinna T. Sievers - Страница 6
ОглавлениеSamstagmorgen
Graugelb. Zuerst trifft im Großhirn das Licht ein, Sekundenbruchteile später der Ton. Irgendein Nachbar schaufelt Schnee.
Erster bewusster Gedanke: Erik. Ich habe von ihm geträumt, noch kurz vor dem Aufwachen. Träume generiert das Stammhirn, ebenso wie Triebe. Dieser Trieb ist haltlos. Bei aller Unvollkommenheit des Liebesobjektes: Der Erik aus meinem Stammhirn verspricht Seligkeit, allein durch Visualisierung seines Geschlechtsteils.
Im Anfangsstadium der Begierde reicht das an Vollkommenheit: die Vorstellung des erigierten Organs. Körpereigene Endorphinproduzenten lösen Glückseligkeit aus wie einen Rausch.
Aber der Blutspiegel will gehalten werden, und die Unruhe kehrt zurück. Sie weicht einer Getriebenheit, der die Visualisierung des Gliedes nicht mehr genügt. Nur eine Inbesitznahme vermag sie zu befrieden.
Unter der wünschenswerten Voraussetzung, dass der Liebeswunsch vom Objekt erkannt und geteilt wird, folgen Maßnahmen, die dem Zweck des Beisammenseins dienen, normalerweise ein Abendessen in einer Fischbude respektive beim Sternekoch, Mittelmaß ist auf der Insel nicht anzutreffen, am selben Abend Küsse, gelegentliches Herzeigen der Möse und Schwanzstreicheln. Im Normalfall von nun an eine Umkehr ausgeschlossen.
Neben dem Glück stellt der hormonelle Niederschlag etwas Zweites, ebenso Mächtiges zur Verfügung: die Verblendung. Sie überzieht das Liebesobjekt mit Wohlwollen und stattet es mit wirklichkeitsfremder Anziehungskraft aus.
Sie nehmen an, dass die darauf folgende geschlechtliche Vereinigung eine Katharsis darstellen müsse.
Nicht für jeden. Nicht für mich.
Ich antworte Ihnen: Was ist mehr als Geschlechtsverkehr? Vielfacher Geschlechtsverkehr.
Mein Körper hat drei Löcher, die ich mit einer größtmöglichen Zahl an Schwänzen stopfe, nach Möglichkeit kein zweites Mal mit demselben.
Am wenigsten mit Hovards. Mit jedem anderen, nur nicht mit seinem.
Erik dürfte mein fünfhundertster Liebhaber werden. Einzig das zukünftige Glück zählt.
Hovards Diagnose: Ich löse nichtsexuelle Konflikte durch Sexualität.
Tosend meine Seligkeitsgedanken, tosend die dürren Zweige der Pappeln vor meinem Fenster, da verdrängt ein anderes Geräusch mein Erik-Glück: draußen Männerschritte in wilder Folge. Ich lausche ihren Füßen, acht oder zehn, sie haben schwer zu tragen.
Im weißen Hemd barfuß über den Flur in die Stube. Es zieht, im Kamin liegt kalte Asche. Sonst facht Hovard am Morgen das Feuer an, überhaupt vermelden meine Sinne: Er ist nicht da (das Phänomen der spürbaren Abwesenheit des Gatten im Moment des Betretens der gemeinsamen Wohnung oder des Hauses ist allen Verheirateten bekannt, als käme auch das Unbelebte zur Ruhe, in meinem Fall gefolgt von Erleichterung).
Die Männer stehen im Garten. Sie haben eine Kette gebildet, werfen sich mit baumstarken Armen Sandsäcke zu, der letzte stapelt sie auf, errichtet gegen die Flut eine Mauer an der Ostseite des Grundstücks. Dort steht auch Hovard, zu schwach als Mann und Kettenglied, die Stiefel knöcheltief im Wasser. Er dirigiert, wenngleich sein Orchester ihn nicht beachtet. Die Kameraden tragen Blau, neongrün auf ihren Rücken: Seenot. Vor lauter Gischt ist der Himmel eins mit dem Meer.
Ich wollte, der Augenblick dauerte an, so schön sind die arbeitenden Mannsbilder.
Ich hebe den Arm, spreize Daumen und Zeigefinger: Der Eisberg, obschon im Schaum kaum auszumachen, überragt die Spanne um eine halbe Daumenlänge.
Ich habe versäumt, das Hemd zuzuknöpfen, stehe mit gestrecktem Arm und halbnackt am Fenster.
Bald befinden sich Sonne, Mond und Erde in Opposition. Das ist die Springflut.
Die Männer haben fertig geschleppt und gestapelt, sich umgewandt, ihre Münder stehen offen, sie starren in meine Richtung. Nur Hovard nicht, der lehnt an der Pforte, das Gesicht himmelwärts, mit einer Hand abgeschirmt, er beobachtet den Flug der Vögel. Wenn sie über Meer gehen, wird der Sturm abflauen, das ist seine Hoffnung.
Da beginnen die Männer zu lachen, ich höre ihr Grölen durch die Scheibe, sie zeigen mit den Fingern. Vor Scham verlässt mich mein Trotz, ich bin doch noch schön. Ich senke den Kopf, da sitzen die Kaninchen: Es mögen zehn sein, aufgereiht und farblich sortiert auf meiner Schwelle, die Männer schlagen sich auf die Schenkel.
Mich haben sie nicht gesehen.
Mittags wollen wir einen Spaziergang machen. Hovard möchte an den Weststrand, dort ist es geschützt, mit dem Auto eine Viertelstunde. Wir fahren durch die Dörfer, das schönste heißt B., hier lebt Erik.
An der Hauptstraße Boutiquen und Nobelrestaurants im Winterschlaf.
Vorgeblich unscheinbar die Nebenstraßen, schmal und bucklig, münden in armierte Auffahrten, ringsherum Videoaugen. Wege geräumt, als hätte es niemals geschneit.
Ich auf dem Beifahrersitz, meine Hand in Hovards Nacken. Eine der Berührungen, die wir uns gestatten. Sein feines Haar fließt über meine Hand, er wäscht es morgens und abends. An keinem Tag unseres gemeinsamen, ein Vierteljahrhundert andauernden Lebens war Hovard anders als nahezu geruchsfrei. Zudem ist meinerseits ein neurobiologisches Phänomen nicht auszuschließen: ein Schaltkreis von Geruch und Gefühl. Nicht nur, dass mich Männerduft erregt. Umgekehrt löst der Gedanke an das männliche Geschlechtsteil ein eingebildetes Geruchsempfinden aus, eine Geruchs-Fata-Morgana, als entzünde mein Verlangen mein Riechzentrum, als heiße ans Vögeln zu denken, es zu riechen.
Der Gedanke an Hovards Geschlechtsteil riecht nach nichts.
Alles andere als geruchsfrei bin ich nach meinen nächtlichen Streifzügen. Sosehr ich mich auch parfümiere, Haut und Haar dampfen, Zigaretten, Wein, Schweiß und Ejakulat.
Häufigste Konstellation: Vom Vögeln nach Hause gekommen, mitternächtlich oder später, einen Schwanz gelutscht dreißig Minuten zuvor, zwergenhaft, riesenhaft, es entlädt sich der eine wie der andere, nicht selten über mein Gesicht. Notdürftig gewaschen, die Zeit hat gedrängt, mein Liebhaber wird zu Hause erwartet. Keine Ehefrau, die Hovards Geduld besäße.
Er dann hinter der Tür im Pyjama, er wartet immer, bis ich heimkomme, zwecks Kontrolle oder aus Sorge oder beides. Begrüßt mich, Küsse auf den Mund, da geht ein Reißen durch ihn, ein Moment kürzester Drangsal, eine Entgleisung seiner Züge für den Bruchteil einer Sekunde, und ist vorüber. Er nimmt meine Hand, zieht mich an den Tisch, mich und meinen Geruch, eine Schleppe von Sperma und Schuld hinter mir her. Wir setzen uns über Eck, Hovard lässt nicht los. Auf meiner Hand ein Geflecht blauer Venen, denen fährt Hovards Zeigefinger nach. Endlich: Ob ich einen schönen Abend gehabt habe.
Ich bejahe, und wahrheitsgemäß: Ein kleiner Spaziergang, und irgendwo eingekehrt.
Sehe Hovard ins Gesicht, Kiefer, die arbeiten, wie sie nur arbeiten auf der Suche nach einer Formulierung von außerordentlicher Schärfe und Seltenheit und Bedeutung.
Er sagt: Auch unter dem Gesichtspunkt der Hygiene ist deine Handlungsweise wenig wünschenswert, wenn nicht sogar selbstschädigend, Judith.
Nimmt meine Hände zwischen seine. Um uns wird der Dunst ranzig. Ich nicke, und wir schweigen.
Mein Wunsch zu fliehen ist immens, aber Hovards Hand lässt nicht los. Ich weiß nicht, ob ich ihn lieben soll oder hassen. Entscheide ich mich, ihn zu lieben, besteht die Gefahr, mich selbst dafür zu hassen. Manchmal denke ich, nur einer von uns könne existieren.
Irgendwann löst er seinen Griff. Ich stehe auf und gehe, an der Tür drehe ich mich um und sage: Ich werde jetzt ein Bad nehmen.
Hovard mit dem Rücken zu mir sagt nichts, Ehemann und Arzt und Gefängniswärter.
So oder ähnlich jedes Mal.
Da rechts, ich kenne das Sträßchen. Drehe den Kopf, irgendwo am Ende verlässt eine schwarze Limousine die Einfahrt.
Wohnt hier der Raucher? Willst du nachsehen?, fragt Hovard, drosselt schon das Tempo.
Fährt zurück, ohne meine Antwort abzuwarten, und heftig in die Gasse, als der andere Wagen auf die Hauptstraße biegt.
Ich sage: Achtung!, Hovard setzt auf den Gehweg, hält an, hebt zur Entschuldigung die Hand. Die Fahrerin eine feste Blonde, fest auch das Haar. Man kennt solcherlei Haar, stählern um den Kopf nach Art eines Helmes. Blick geradeaus, kein Winken.
War das seine Frau?, fragt Hovard.
Kann sein, sage ich.
Dann hat er nichts zu lachen, sagt Hovard, rollt zurück auf die Fahrbahn und fragt: Welche Hausnummer?
Wir zählen rückwärts, das letzte Haus rechts, handgefertigte Ziegel, Sprossenfenster, Strohdach weizengelb, am Garagentor lehnt ein Kinderschlitten.
Unter fünf Millionen nicht zu haben, nicht auf dieser Insel, sagt Hovard, und: Edelspießer.
Wendet das Auto.
Ich setze das Kraulen fort, dort, wo Hovard es am liebsten hat, am Ansatz des Musculus sternocleidomastoideus, des Großen Kopfwenders oder Kopfnickers.
Auf dem Steilufer beim Leuchtturm, er ist von 1856, weiß mit schwarzer Binde. Sein Feuer ist bei Tag erloschen, es erwacht eine Stunde vor Sonnenuntergang. Der Parkplatz eine asphaltierte Klippe, Schnee und Eis sind geräumt, darüber Türme von Wolken, im Westen reißen sie auf, aus den Fugen stürzt Blau und Gold.
Hovard bei laufendem Motor in anhaltender Betrachtung. Ich betrachte Hovard.
Lass uns, sage ich. Wir steigen aus, gehen über die verlassene Fläche in Richtung des tosenden Meeres. Rechter Hand die schwarze Heide, im Sommer ist sie violett. Weiter nördlich wird die Insel breiter, schemenhaft im Dunst der Rücken eines riesenhaften Wales. Von Kopf bis Schwanz einhundertfünfzig Meter, vielleicht auch mehr, quer über die Insel ausgestreckt und regungslos, er muss gestrandet sein. Sein Rücken ist schmutzig gelb. Vielleicht ist es auch die Wanderdüne, man sieht sie mal hier, mal dort. Dahinter nur noch Sandbänke, der Arktische Ozean. Dort kreuzen die anderen Wale, die nächste Küste ist Grönland.
Wir laufen bis zur Abbruchkante, bleiben an einer Latte stehen. Auf einem Pfosten: Lebensgefahr. Dreißig Meter Tiefe.
Das Kliff ist rot.
Eine hölzerne Treppe führt hinab zum Strand, die Stufen bedeckt von gefrorener Gischt.
Hovard geht voran in der unausrottbaren Überzeugung, mich beschützen zu müssen, tatsächlich rutsche ich aus, rutsche in meinen Ehemann, der hält mir stand.
Unten hat der Sand eine Kruste, Schaumblasen von Wellenkämmen gerissen, zu Glas erstarrt, jeder Schritt klirrt. Wir halten nach Norden, quer über den Strand auf den Meeressaum zu, unter den Sohlen Messermuscheln, rasierklingenscharf. Dann laufen wir am Wasser, Gummistiefel umspült mit jeder Woge, manche Brecher treten über den Rand, laufen innen den Schenkel hinab. Hovard schreitet stramm, nach wenigen Minuten dampfen meine Füße.
Vereinzelt Spaziergänger mit Kapuze, ununterscheidbar, Mensch und Hund gegen den Wind geduckt.
Hovard nimmt meinen Schal, meine Handschuhe, es folgt der Mantel.
Ich bin gern dein Kofferträger, sagt er.
Jetzt pass auf, Kofferträger, sage ich, Pullover über den Kopf, in rascher Folge Hemd, BH, Schuhe, Jeans, Höschen.
Nur mit den Füßen ins Wasser, ruft Hovard, bückt sich, beginnt, meine Kleidungsstücke einzusammeln. Er schüttelt, streicht und faltet, legt sie sich über den Arm.
Die Erkenntnis kommt gleich der Entladung einer seit langem schwelenden Entzündung, dem Reißen gespannter Haut über der widerwärtigen Beule, dies bei ausbleibender Erleichterung, Heilung nicht absehbar: Hovard hält mich für ein Kind, sein Kind.
Das Kind ist nackt.
Bevor Sie denken, ich habe den Verstand verloren: Auf der Insel zieht man sich aus. Vollständig. Wann immer man will. Nur nicht wo. Ausschließlich am Strand. In den Dünen Buden, davor im Sommer Holzbänke, auf denen nackt gespeist wird. Im Winter gibt es die Einrichtung der Strandsauna, geöffnet von November bis März, die schwitzenden Nackten laufen zum Meer, trinken Glühwein im eisigen Sand.
Ich renne los, höre nicht Hovards Rufe: Nur mit den Füßen!, und als mir das Wasser zum Bauch reicht, stürze ich mich vornüber. Die Welle schlägt über mir zusammen, und mit ihr die Kälte, eine Kälte, die ich nicht erwartet habe, Kälte ja, aber nicht die augenblicklich lähmende Wirkung auf meine Muskulatur. Nichts gehorcht mehr: Arme, Beine, Brustkorb. Unumkehrbares Erstarren, gleich einem toten Stück Holz, die Brandung ist stark an diesem Abschnitt, jedes Jahr Tote, Baden nur unter Aufsicht, ich werde umhergeworfen, schlage Purzelbäume.
Dann ist die Welle weitergerollt, ich öffne die Augen, liege am Grund, mich wiegt der Strom, über mir Licht, gebrochen durch die Meeresoberfläche und Millionen Luftblasen. Vollendete Stille, wenn dies der Tod ist, ist er begehrenswert, viel begehrenswerter als alle Begehrlichkeiten meines Seins.
Mir ist nicht mehr kalt. Um meinen Kopf treibt langes Haar, ich bin wunschlos, wäre da nicht das Bedürfnis, ein letztes Mal einzuatmen, nichts Metaphysisches, finaler Instinkt, die Lungen zu füllen, und sei es Salzwasser statt Luft, die letzte Handlung des Ertrinkenden.
Es ertönt Musik, sie ertönt nicht, sie kreist mich ein, schlägt über mir zusammen, befreit mich von meiner Schwere und hebt mich an, masselos geworden, eine Hülle aus Haut. So unwichtig sie Ihnen im Moment des Todes erscheint, Sie sollen von ihr wissen, denn Musik wird eine Rolle spielen. Sie kommt, wann sie will, manchmal, wenn ich ficke, und immer, wenn ich sterbe. Nicht von innen, ich schwöre, sie ist da.
In meinem Wassergrab drei Frauenstimmen, sie schwellen an, singen denselben Ton, Sechzehntelfiguren gleich meinem Herzschlag. Eine von ihnen sein, sobald ich atme.
Ich öffne den Mund, es schmeckt nach Salz und Eis, will inhalieren, hier würde die Geschichte enden, wenn nicht mein Ehemann wäre, Fels in der Brandung, grenzenloser Langweiler. Er würde jeden retten, ob der will oder nicht, er lässt keine Verirrungen zu, hegemonial männlich und dann noch berufen auf seinen hippokratischen Eid.
Packt mich beim Arm, reißt mich in die Höhe, mein Kopf durchstößt die Oberfläche.
Ohne Zutun öffnet sich meine Kehle, Luft pfeift in die Lungen, im Bruchteil einer Sekunde bindet Sauerstoff an rote Blutkörperchen, das Herz verdoppelt seinen Auswurf. Schäumendes, hellrotes Blut erreicht die Endstrombahn, das Hirn.
Die Violinen verstummen und die Wasserfrauen, zuletzt verklingt ein langer Ton.
Das Wasser ist nicht tief, es reicht uns bis zur Brust. Hovard ist vollständig bekleidet, Ströme von Gischt auf seiner Glatze, Lippen blau, zusammengeschnurrt zu einem Strich. Worte werde ich später hören.
Nur die Augäpfel kann ich bewegen: Am Ufer stehen sieben oder acht Figuren, die rufen, klatschen, Hovard hebt mich in seine Arme. Hat selbst Schwierigkeiten zu laufen, so sehr zittert er. Mich an die Brust gepresst, erreicht er den Strand, sinkt in die Knie, legt mich hin, legt sich hin.
Die Spaziergänger streifen ihre Mäntel ab, ihre Pullover, mancher trägt zwei Hosen übereinander. Einer schält Hovard heraus, hilft ihm in fremde Kleidung, ein anderer versucht es mit mir. Reibt mich trocken mit irgendeinem Fetzen, ich würde gern den Kopf heben und ihn ansehen und schaffe es nicht, steif wie eine Marionette, nur er kann mir die Glieder heben. Obwohl mein Blick getrübt ist, ahne ich, es ist ein schöner Mann, dunkles Haar und zerzaust, seine Mütze hat er mir aufgesetzt, eckige Stirn, eckiges Kinn, Augenfarbe im Winterlicht unbestimmbar.
Da geschieht etwas Merkwürdiges: Während der Mann sich mit dem Pullover müht, beginnt sein Hund, mir die Beine zu lecken, beginnt an den Zehen, leckt von unten nach oben. Ein Hirtenhund oder etwas in der Art, er hat viel Fell, seine Zunge ist rau und groß und warm, die schönste Berührung meines Lebens, später einmal werde ich sagen, sie war es, die mich zurückgeholt hat.
Jeans bekomme ich auch, sie sind viel zu groß, der Zerzauste kniet vor mir in langer Unterhose.
Ich bin angezogen, Hovard auch, der Mann fragt: Können Sie stehen?
Und ich: Bitte, würden Sie mir helfen.
In einer kleinen Prozession führt man uns Richtung Parkplatz. Ich eingehakt beim Zerzausten, Hovard bei einem anderen. Eine Frau trägt Hovards nasse Kleider. Der Hund noch immer neben mir, seine Schnauze in meiner Kniekehle.
Auf der Treppe: Einer zieht mich, einer schiebt, dann sind wir oben und am Auto.
Jemand ist vorgelaufen, hat den Motor angelassen, das Gebläse aufgedreht, der Innenraum gleicht einem Tropenhaus. Sie haben uns verladen, Hovard hinter das Steuer, mich daneben, er nennt noch unsere Namen, Adresse, später werden wir Kleider tauschen, uns bedanken. Jetzt schlagen die Türen zu, wir sitzen regungslos im warmen Luftstrom.
Minuten später er: Was hast du dir dabei gedacht.
Meine Zunge, meine Lippen wollen nicht gehorchen.
Du hast doch studiert, sagt Hovard. Du weißt doch, was kaltes Wasser mit einem Körper macht.
Er sieht zu mir hinüber: Erst recht mit einem Kinderkörper.
Später sitzen wir am Feuer. Ich habe Eiergrog gemacht.
Rum, Zucker, heißes Wasser, darin verquirlt ein Eigelb.
Das bin ich Hovard schuldig, obwohl ich normalerweise in der Küche keinen Finger rühre.
Meine Haut ist rosig, der Kopf klar, das Bad in der Nordsee hat mich erfrischt. Anders Hovard. Gesichtsfarbe grau, Skleren rot, zwischen den Brauen eine steile Falte. Ich hocke neben ihm, reibe seine Stirn.
Außer medizinischen Untersuchungen und geschwisterlichen Küssen sind Massagen erlaubt.
Er sagt: Mir tut der Nacken weh.
Ich trete hinter ihn, Fingerspitzen an seinen Schläfen. Über das Jochbein die Wangen abwärts, Hals und Schultern. So trocken die Altmännerhaut, dass sie knistert. Aus seiner Kehle ungewohnte Laute. Wäre er ein anderer, jetzt würde ich ihn küssen.
Wie zuletzt geschehen 1994. Dann aber, ein halbes Jahr nach der Hochzeit, verkündet Hovard seinen Rückzug aus dem ehelichen Bett. Zu kopulieren entspreche nicht seiner Natur. Er liebe mich, aber nicht meinen Körper. Nicht dass etwas damit nicht stimme, ganz im Gegenteil, er interessiere ihn nur einfach nicht. Psychoanalytiker, ebenso wie andere Menschen, haben ein Recht auf sexuelle Integrität. Auch wenn sie darin bestehe, dass sie keinen Sex haben.
Das ist gut fünfundzwanzig Jahre her. Nach einer kurzen Phase der Entbehrung hatte ich den ersten Liebhaber, einen zahnärztlichen Kollegen.
Gelegentlich vermisse er Hautkontakt, sagt Hovard.
Das eine ohne das andere gebe es nicht, sage ich. Ich habe auch keinen Vorschlag, woher er seinen Hautkontakt beziehen könne. Vielleicht gebe es Prostituierte, die nur streicheln. Ich jedenfalls sei nicht zuständig.
Heute Nachmittag bin ich zuständig, denn Hovard wird eine Erkältung bekommen, und ich bin schuld. Er zittert und hält sich gekrümmt, als habe er Leibschmerzen.
Nach dem Eiergrog geht es ihm besser. Wir stehen am Fenster in Betrachtung des Eisberges. Hovard ist größer als ich, aber neuerdings scheint der Unterschied geringer.
Heute ist er grün, sagt Hovard, das hat mit dem Gelb des Himmels zu tun, Blau und Gelb macht Grün.
Ich glaube, er hat sich gedreht, sage ich, sieht irgendwie unheimlich aus, wie er mit der Breitseite auf uns zukommt.
Wie ein Rammbock, sagt Hovard.
Und der Wind immer noch von Ost, sagt Hovard.
Ich nicke, und so vergeht das Wochenende.