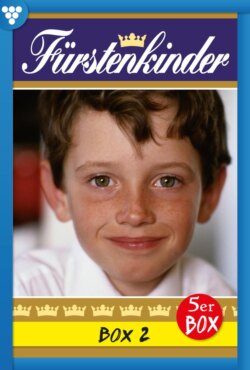Читать книгу Fürstenkinder Box 2 – Adelsroman - Cornelia Waller - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDas Unglück in der Schweiz machte auch in der internationalen Presse Schlagzeilen.
Flugzeugkatastrophe – Unfall oder Terror?
Ein schweres Flugzeugunglück ereignete sich am Dienstag in der Nähe von Zürich. Die Maschine befand sich auf dem Flug von Frankfurt nach New York. Aus den Trümmern der abgestürzten Maschine konnten nur zwei Personen lebend geborgen werden: ein Junge von etwa zwei Jahren und eine junge Frau. Ihre Namen konnten noch nicht ermittelt werden. Die Frau hatte das Bewußtsein bei Redaktionsschluß noch nicht wiedererlangt. Die Unglücksursache ist noch nicht bekannt. Ein Terrorakt ist nicht auszuschließen.
*
In einer Zürcher Klinik spielte Dr. Weigele, ein kinderlieber junger Arzt, mit einem bildschönen, kleinen Buben. Der kleine Kerl jauchzte vor Vergnügen, wenn Hans Weigele ihn vom Stühlchen springen ließ, um ihn dann aufzufangen.
Die großen Augen strahlten, und der kirschrote Mund forderte jubelnd: »Mehr, mehr!«
Spielend und tollend ließ sich Dr. Weigele Zeit mit seiner gründlichen Untersuchung. Aber wie er auch prüfte, klopfte und horchte – nichts! Gott sei Dank! Dieser goldige kleine Kerl hatte das furchtbare Flugzeugunglück ohne den geringsten Schaden, ohne den kleinsten Kratzer überstanden.
Wer mochte das Kind sein? Das festzustellen, konnte sehr schwierig werden, da laut Passagierliste für acht Kinder von eineinhalb bis acht Jahren ein Flug nach Amerika gebucht worden war. Bei den übrigen sieben Kindern war, wie bei den anderen Fluggästen und den Besatzungsmitgliedern, noch keine Identifizierung möglich gewesen.
Dr. Weigeles Gedanken wanderten hinauf in das stille Krankenzimmer ein Stockwerk höher. Er sah in Gedanken das wunderschöne, blasse Frauenantlitz unter der schweren Fülle ihres schönen Haares. Er sah die ratlos und fragend umherirrenden großen Augen der fremden, unbekannten Frau. Augen, wie er sie in dieser Schönheit noch nie sah: Augen von einem klaren, leuchtenden Grün, mit sonnengelben Pünktchen darin. Große, weitgeschnittene Augen, umgeben von einem dichten Kranz langer, seidiger schwarzer Wimpern. Wer war sie, die mit dem Buben als einzige das grauenhafte Inferno des Flugunglückes überlebt hatte?
War es nicht Selbstschutz des Körpers, der Natur, daß ihr Geist die furchtbaren Sekunden einfach ausgelöscht hatte? Die schöne Fremde erinnerte sich an nichts mehr, auch nicht an ihren Namen, Wohnort, Angehörige – an nichts! Sie hatte eine schwere Gehirnerschütterung erlitten. Man entdeckte sie, ein ganzes Stück von dem Flugzeugwrack entfernt, auf einer Bergwiese in einem großen Heuhaufen. Ein kleiner Bub krabbelte vergnügt um sie herum und wollte Blümchen pflücken. Die seit Stunden hart arbeitenden Rettungsmannschaften, die nur grausam verstümmelte Leichen und Körperteile aus dem noch glühenden Wrack geborgen hatten, standen erschüttert wie vor einem Wunder. Manchen der harten Männer traten Tränen in die Augen. Welch ein Bild und welch ein Kontrast.
Auf dem duftenden Heu lag reglos eine wunderschöne Gestalt. Die Augen in dem zarten, schneeweißen Gesicht waren geschlossen, nur die dichten, langen schwarzen Wimpern gaben dem Gesicht etwas Farbe. An den schlanken, sehr gepflegten Händen und an den schmalen Gelenken funkelten kostbare Ringe, goldene Armbänder und juwelenbesetzte Reifen. Das zartgelbe leichte Wollkostüm war bei dem Sturz zerrissen. Der schmale Rock bedeckte nur noch zum Teil den knabenhaften Körper, die langen schlanken Beine.
Schweigend standen die Männer der Rettungsmannschaften nach so viel Grauen und Elend vor dieser vollkommenen Schönheit. Der Jüngste unter ihnen, der heute zum erstenmal half, sagte leise: »Schneewittchen!«
Dann sahen sie das Kind, das ein Händchen voll frischer Wiesenblumen den Männern entgegenstreckte. Auch sein kleiner hellblauer Anzug war beschmutzt und aufgerissen. Ein dicker schwarzer Fleck saß auf der kleinen Stupsnase, aber die großen schwarzbraunen Augen des Kindes lachten. Der Bub hatte nichts von dem furchtbaren Geschehen erfaßt.
Wie durch ein Wunder waren diese beiden Menschen gerettet… als einzige.
Die Ärzte und Schwestern der bekannten Zürcher Klinik schirmten ihre beiden im Augenblick prominenten Patienten hermetisch von der Außenwelt ab. Kein Reporter, und sei er noch so keck und findig, wurde zu den beiden Überlebenden des Flugzeugunglücks gelassen. Die Patientin brauchte unbedingte Ruhe wegen ihrer schweren Gehirnerschütterung, und das Kind sollte durch sensationslüsterne Fragen nicht verunsichert werden.
Die Anweisungen waren sehr streng, die Professor Gundler, der Chefarzt der Zürcher Klinik, erlassen hatte. Keiner würde wohl wagen, dagegen zu verstoßen.
Der »Alte« war ein großartiger Chef, aber er konnte auch fuchsteufelswild werden, wenn seine Anordnungen nicht peinlich genau befolgt wurden. Dann konnte es nicht nur einen Anpfiff, sondern auch einen Hinauswurf geben, und das wollte keiner riskieren.
Sinnend schaute Dr. Weigele den süßen, kleinen Lockenkopf an. Wer mochte der Junge sein?
Da kam ihm plötzlich ein Gedanke. Er setzte sich mit dem Kind auf dem Arm an den weißen Tisch. Wenn er doch nur den Vornamen des Kindes erfahren könnte! Das würde die Nachforschung gewiß erleichtern. Bis jetzt war er nur »der Bub«.
»Sag mal, Bub, wie hat deine Mami immer zu dir gesagt?«
Verständnislos sah ihn der kleine Kerl mit seinen dunklen Augen an. Dann verzog sich das eben noch lachende Gesichtchen:
»Mami? Wo meine Mami?«
Liebevoll drückte Dr. Weigele das kleine Körperchen an sich. Er setzte den Kleinen auf seine Schulter, um den Kleinen abzulenken.
»Sieh, Büberl, wir wollen ja die Mami suchen, deshalb muß ich aber wissen, wie die Mami zu dir gesagt hat. Wie hat sie dich gerufen?«
Das Kerlchen dache intensiv nach. Er krauste das Näschen, schob die klare Kinderstirn in Dackelfalten und steckte den kleinen, schmutzigen Daumen in den Mund.
»Mami… Täus - chen! – Ja. Mami immer Täus und Täus - chen! Oh, Mami doll lieb!! Tomm, Mami holen!«
Zutraulich faßte der Bub Dr. Weigeles Hand, dem das Herz noch schwerer wurde.
Was sollte er tun? Liebevoll betrachtete er das reizende, zutrauliche Kindergesicht. In den großen Augen lagen Vertrauen und Erwartung. Ungeduldig wiederholte er:
»Tomm, Mami dehn!«
In diesem Augenblick kam Schwester Ursula von der Privatstation:
»Herr Doktor, bitte kommen Sie. Unsere schöne Unbekannte ist so unruhig. Was soll ich tun?«
Dr. Weigele überlegte kurz.
»Ja, Schwester Ursula, ich komme! Aber was machen wir mit unserem Klaus?«
Dr. Weigele hatte ganz betont »Klaus« gesagt. Und er hatte die Freude und Genugtuung, daß der Kleine ganz spontan mit dem Lockenköpfchen nickte und bestätigend wiederholte:
»Ja, Täus! Täus ist lieb?!«
Und fragend blickte er seinen großen Freund an. Der Arzt fuhr ihm liebkosend durch den dichten Lockenschopf. Dann sagte er spontan:
»Komm, Kläuschen, du gehst jetzt mit mir, ja? Wir besuchen eine sehr liebe, kranke Dame!«
»O ja, Mami dehn! Mami dehn«, sang er fröhlich.
*
Ein neues Ereignis machte Schlagzeilen in der internationalen Weltpresse und beunruhigte sehr viele Leser:
Weltbekannte Sängerin seit Tagen vermißt!
Wie die Presse erst jetzt erfährt, ist die international bekannt und beliebte Sängerin Marisa del Vana seit ungefähr einer Woche vermißt. Da Frau del Vana als sehr wohlhabend gilt, ist Kidnapping nicht ausgeschlossen. Sachdienliche Hinweise nimmt jede polizeiliche Dienststelle entgegen. Auf Wunsch wird Diskretion zugesichert!
Wer war diese Marisa del Vana?
Das war mit wenigen Sätzen gesagt: die schönste und augenblicklich beste Sängerin der Welt. Eine einmalige Stimme in einem bezaubernd schönen Frauenkörper. Korrekt und zuverlässig in ihrer Arbeit, eine liebenswerte Kollegin, ein weicher, fraulicher Mensch, ohne Sensationen und Abenteuer.
Konnte es möglich sein, daß diese von Millionen Menschen geliebte und verehrte Frau von rauhen Männern gekidnappt worden ist? Sie, deren zarte, vollkommene Schönheit jeden Mann zum Beschützer werden lassen möchte? Deren wunderbare Stimme die Zuhörer andächtig werden ließ?
Da meldete sich die Fluggesellschaft des verunglückten Flugzeuges:
Die bekannte Sängerin Marisa del Vana hat im letzten Augenblick noch einen Platz in der abgestürzten Maschine erhalten, da ein Ticket zurückgegeben worden war. Es muß mit ihrem Tod gerechnet werden.
Im nächsten Tag standen in Hunderten von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten: Das Leben und Schicksal von Marisa del Vana, der berühmtesten Sängerin der Welt.
Viele Fotos erschienen, private und Rollenfotos. Noch einmal sahen die Menschen sie in all ihrem wunderschönen zarten Liebreiz, empfanden noch einmal die starke Ausstrahlung.
*
»So, mein Kerlchen, du bleibst jetzt noch etwas bei unserer lieben Schwester Hilde. Ich muß erst mal sehen, was unsere Kranke macht!«
Dr. Weigele übergab das Kind der freundlichen Schwester und ging in das Zimmer der Unbekannten. Die Kranke schien bei Bewußtsein:
»Doktor, wo bin ich? Was ist das?«
Glücklich setzte sich Dr. Weigele auf den Stuhl neben dem Krankenbett. Er ergriff die schlanke, kraftlose Hand und hielt sie fest.
»Liebe, gnädige Frau, lassen Sie mich Ihnen zuerst sagen, wie froh wir alle sind, daß es Ihnen wieder bessergeht! Und nun zu Ihren Fragen:
Sie sind in Zürich in der Klinik von Professor Gundler. Der Schlauch, den Sie da an der Nase fühlen, kommt gleich heraus. Wir mußten Sie künstlich ernähren, da Sie einige Tage bewußtlos waren. Sie hatten eine Contusio celebri, eine leichte Gehirnquetschung. Sie hatten am Kopf eine kleine Beule!«
Verständnislos hatten die schönen Augen den jungen Arzt angesehen. Dann sagte sie mit ihrer außerordentlich wohlklingenden, weichen Stimme:
»Lieber Doktor, ich verstehe Sie nicht! Wieso Klinik? Gehirnquetschung? Bin ich plötzlich erkrankt – verunglückt? Was ist mit mir?«
»Liebe, gnädige Frau, bitte keine Angst und Unruhe! Ich benachrichtige jetzt unseren Chef. Professor Gundler wird Ihnen alle Fragen beantworten. – Ich sehe nachher noch einmal nach Ihnen!«
Dr. Weigele nickte seiner schönen Unbekannten noch einmal herzlich und aufmunternd zu, dann ging er und holte den Professor.
Kurz darauf saß der Chefarzt, eine vornehme, schlanke Erscheinung, am Bett der Kranken. Das volle graumelierte Haar aus der hohen Stirn gekämmt, die ruhigen grauen Augen in dem männlichen Gesicht, das den Ausdruck von Güte und Humor trug, war Professor Gundler ein Mann, dem manches Frauenauge wohlgefällig folgte. Er aber lebte nach einer tiefen Enttäuschung vor vielen Jahren nur seinen Kranken und seiner Forschung. Nun saß er bei seiner geheimnisvollen, ungewöhnlich schönen Patientin, deren Zustand ihnen allen große Sorgen gemacht hatte. Ihre großen grünen Augen sahen ihn klar, aber ängstlich und verstört an. Ihre schönen Hände bewegten sich unruhig.
Bevor der Professor etwas sagen konnte, überstürzten sich ihre Fragen. – Beruhigend nahm Professor Gundler die schmalen weißen Hände in seine guten, sensiblen Chirurgenhände. Als sie ruhiger wurde, erklärte er der Kranken mit seiner dunkeltönenden Stimme:
»Verehrte, gnädige Frau, zunächst möchte ich Sie von ganzem Herzen begrüßen und Ihnen sagen, wie sehr wir uns alle freuen, daß Sie Ihre weite Traumreise beendet haben und wieder zu uns auf die doch sehr schöne Erde zurückgefunden haben. Jetzt werden Sie erst mal ganz ruhig, die Gefahr ist vorbei. Wenn es Ihnen recht ist, können wir uns gern über die Ursache Ihres jetzigen Zustandes unterhalten. Wie mein Oberarzt Dr. Weigele Ihnen schon sagte, haben Sie eine nur leichte Gehirnquetschung. Können Sie sich erinnern, wie es dazu gekommen ist?«
Gespannt beobachtete der Arzt das weiche, klare Gesicht der Frau.
Nur ein ratloses, vorsichtiges Kopfschütteln.
»Doktor, ich weiß nichts.« Dann ein verzweifelter Schrei: »Doktor, wer bin ich?«
Diese Frage hatten der Professor und sein Stab gefürchtet.
»Bitte, liebe gnädige Frau, keine Aufregung: Diese vorübergehende Gedächtnislücke ist ein typisches Krankheitszeichen und verliert sich in der nächsten Zeit. Erinnern Sie sich, ob Sie Angehörige haben?«
Wieder beobachtete Professor Gundler seine Patientin genau. Er bemerkte die Anstrengung und Qual auf dem blassen Gesicht. Bevor sie sich weiter quälte, strich er über die klare, schöne Stirn und sagte beruhigend:
»Genug, quälen Sie sich nicht mehr. Wir wollen mit dem heute Erreichten zufrieden sein. Ich bin sehr zufrieden. Schlafen Sie möglichst viel, und keine schweren Gedanken. Es wird alles gut!«
»Alles gut!« flüsterte die schöne Fremde, schloß die Augen und schlief ein.
Professor Gundler saß noch lange an ihrem Bett und konnte sich an so viel Schönheit und Lieblichkeit nicht satt sehen. Konnte ein Gott es zulassen, daß dieses zauberhafte Geschöpf ohne Verstand und ohne Erinnerung blieb?
Müde erhob sich der Professor. Wie schon oft, die Grenzen seines Könnens erkennend.
Einige Tage später glaubten die beiden Ärzte es verantworten zu können, den kleinen Klaus, erklärter Liebling des ganzen Hauses, mit zu der schönen Unbekannten zu nehmen. Sie wußte noch immer nicht, wer sie war, und woher sie kam.
Immer drängender wurde Kläuschens Wunsch, seine Mama zu sehen. Wer aber wußte, ob die Unbekannte seine Mutter war? Ob sie nicht zu jenen nicht identifizierbaren Opfern gehört hatte, die vor vier Tagen unter großer allgemeiner Anteilnahme beerdigt worden waren? Alle, Ärzte und Schwestern, machten sich Gedanken und Sorgen um den goldigen kleinen Kerl, der so lieb und anhänglich war.
Professor Gundler und sein Oberarzt hatten sich überlegt, daß der Kleine wie zufällig mit in das Krankenzimmer kommen sollte. Der Professor wollte die übliche, tägliche Visite machen, während Dr. Weigele dann mit dem Kind nachkommen sollte. Sie waren gespannt, ob und wie das Kind auf die Kranke wirkte. Und umgekehrt, erkannte das Kind seine Mutter? Es war ein Experiment. Hoffentlich gab es nicht einen neuen Schock – für beide.
Und nun saß der Professor am Bett seiner Patientin. Körperlich schien sie etwas erholter. Sie brauchte keine künstliche Ernährung mehr. Sie konnte selbst essen, allerdings wie ein Vögelchen. Sie schlief sehr viel, aber wenn sie wach war, drehten sich ihre Gedanken ausschließlich um die eine Frage: Wer bin ich?
Der Professor unterhielt sich gern mit ihr. Dieser bezaubernden Stimme mit dem weichen, klingenden Timbre konnte er stundenlang lauschen. Als er es jetzt wieder dachte, konnte er nicht unterlassen zu sagen:
»Liebe, gnädige Frau, Sie haben eine außerordentlich weiche und angenehme Stimme. Ich möchte die Augen schließen und nur Ihrer Stimme lauschen. Haben Sie gern gesungen?«
Professor Gundler beobachtete die Patientin genau. Sie rieb sich langsam, nachdenklich die Stirn. Sie schloß die Augen, horchte in sich hinein:
»Stimme – gesungen? Da war – etwas war da? Doktor, ich…« Sie griff etwas gequält an ihren schlanken weißen Hals.
»Doktor, nein, ich konnte sicher nicht singen. Aber – etwas war. Wie schön, singen zu können. Aber ich kann es nicht! Sind Sie jetzt sehr enttäuscht, lieber Herr Professor? Sie machen sich so viel Mühe mit mir!«
Lieb und bittend schaute sie Professor Gundler an. Der konnte seinen Blick kaum von diesen wunderschönen Augen lösen.
»Aber nein, meine Liebe. Wir müssen es nur immer wieder versuchen. Haben Sie Geduld.«
Da öffnete sich die Tür, und herein trat Dr. Weigele. Er hatte einen kleinen Buben an der Hand und fragte fröhlich:
»Darf dieser kleine Strolch mit herein? Er ist mir von der Kinderstation nachgelaufen. Hoffentlich stört er Sie nicht, gnädige Frau? Dann wird er sofort wieder hinausexpediert. So, Bürschlein, sag guten Tag!«
Atemlose Stille. Dann eine jubelnde Kinderstimme, die die beiden Ärzte im Zimmer und die Schwestern auf dem Flur erstarren ließ:
»Mami! Meine Mami! Meine liebe Mami!«
Mit einem Satz wollte das Kind auf das Bett der Kranken, die das Kerlchen ungläubig, fassungslos anstarrte. Der Arzt hielt ihn zurück:
»Deine Mami ist noch sehr krank! Du darfst nicht zu ihr aufs Bett.«
Dr. Weigele nahm das aufgeregte Kind auf den Arm.
»Komm, mein Kläuschen, wir müssen gehen.«
Da schrillte ein Schrei, der nichts Menschliches an sich hatte:
»Da, das Feuer! Hilfe, das Flugzeug brennt! Oh, mein Gott, ein Kind! – Wir stürzen…«
Dann auf einmal ganz ruhig:
»Komm, gib mir die Hand… Wir springen!«
Die Kranke sank zurück, eine wohltätige Ohnmacht umfing sie.
*
Die schöne Unbekannte erholte sich bald wieder von ihrem Schock. Man konnte sagen, es war ein heilsamer Schock gewesen. Die Ärzte buchten einen kleinen Erfolg.
»Lieber Herr Professor, ich erinnere mich an das Flugzeug, an das Kind und seine Mutter – eine ganz reizende junge Frau. Ich saß neben ihnen. Wir unterhielten uns. Ich glaube, sie war Ärztin. Ach, Doktor, jetzt verschwimmt wieder alles. Meine Gedanken…«
Begütigend sagte Professor Gundler:
»Nur ganz ruhig, ganz langsam. Wir sind doch schon einen großen Schritt weitergekommen. Sie wissen also bestimmt, daß das Kerlchen nicht Ihr Kind ist?«
Das schien eine Tatsache zu sein, die der Professor mit innerer Genugtuung vernommen hatte. Er mochte sich dieses Gefühl der Erleichterung nicht eingestehen, denn Professor Gundler liebte diese Frau. Und hatte sie ein Kind, gehörte sicher auch irgendwo ein Mann dazu, der Anrechte an dieses wunderbare, liebreizende Geschöpf geltend machen würde.
Die Patientin hatte den Wunsch geäußert, den Kleinen öfter bei sich zu haben. Die stürmische Liebe, die süßen Zärtlichkeiten des Jungen waren ein Geschenk für die Kranke. Sie spielte und lachte mit Kläuschen und fühlte, wie gut ihr das Kind tat.
Auch jetzt war er wieder bei ihr. Sie malten zusammen. Es war nicht zu erkennen, aber es machte beiden Spaß. Mit roten Bäckchen malte Klaus etwas Undefinierbares. Lächelnd betrachtete die junge Frau den kleinen Kerl, der den Buntstift in seinem ungeübten
Fäustchen hielt und so energisch drückte, daß die Spitze immer wieder abbrach. Geduldig spitzte sie den Stift immer wieder an.
»Sag, Kläuschen, was soll das sein, was du da so schön malst?« fragte sie liebevoll.
Der Kleine zeigte stolz auf ein paar Striche und sagte:
»Fester und Tinder. Täus spielt immer mit Fester – und alle Tinder!«
Die mütterliche Frau wurde hellhörig.
»Klaus, hast du mit den Kindern, die du da so schön malst, gespielt? Erzähl mir doch mal, was du da gemacht hast, ja?«
Das Kind nickte ernsthaft:
»Täus spielt mit Fester und Tindern – in Sandtasten. Tuchen backen. – Täuschen auch singen.«
Auf einmal sagte er deutlich:
»Täuschen immer bei Fester. Wo ist Täuschens Fester?«
Die großen Augen füllten sich mit dicken Tränen. Voll Mitleid und Zärtlichkeit nahm die schöne junge Frau das schluchzende Kind in ihre Arme, herzte und küßte es. Der kleine Klaus spürte die Wärme und Mütterlichkeit und schmiegte sich, nur noch leise schluchzend, in die weichen Arme, bis auch das verstummte. Dann kamen zwei runde, braune Ärmchen und legten sich um den Hals der Frau, ein tränennasses Gesichtchen schmiegte sich an ihr Gesicht, ein feuchtes Mäulchen preßte sich an ihre Wange.
»Mami? Bist du meine Mami? Täuschen danz lieb sein! So lieb!«
Und mit aller Kraft seiner kleinen Arme drücke er die junge Frau, die ganz still hielt. Ein eigenartiges, beglückendes Gefühl durchpulste sie. Welch ein Glück, welch ein Geschenk, so ein Kind zu haben, dachte sie. Ob sie auch Mutter war? Warteten irgendwo Kinder auf sie, ein Mann? Ihr Gefühl sagte nein!
Ganz still lag das Kind in ihren Armen. Da stieg wie ein Strom eine heiße, tiefe Dankbarkeit in dem Herzen der jungen Frau auf:
»Herrgott, ich danke dir! Du schenktest mir zum zweiten Mal das Leben, gabst mir Gesundheit, ich darf lieben«, hier drückte sie den kleinen Kerl an sich, »und kann geliebt werden. Lieber, lieber Vater im Himmel, ich danke dir!«
Ganz leicht und froh wurde sie nach diesem kurzen Gebet. Dann nahm sie das Kläuschen hoch und fragte ihn fröhlich:
»So, mein Kerlchen, was sollen wir jetzt tun?«
Der Kleine überlegte, dann sagte er ganz spontan:
»Singen!«
Und schon schmetterte er los, falsch und laut:
»Hänschen tein, dingte allein, in – ne Welt ein…«
Weiter ging es nicht. Da setzte eine weiche, glockenhelle, schwingende Stimme ein:
»Stock und Hut, steh’n ihm gut, er ist frohgemut! Doch die Mutti weint so sehr, hat ja nun kein Kläuschen mehr, da besinnt sich das Kind, kehrt zurück geschwind!«
Die köstliche Stimme sprengte alle Wände, drang hinaus – und das einfache, schlichte Kinderliedchen wurde eine einzige, jubelnde Fanfare des Lebens, der Freude. Als wenn eine ungeheure Flut, gleich einer Naturgewalt, jeden Damm sprengte, so hatte das kleine Liedchen den Riegel des Nichterinnerns gesprengt. Ein Lied nach dem anderen stieg empor, es war wie ein Rausch. Sie mußte einfach singen. Aber noch wußte sie nicht, wer sie war.
Sie merkte nicht, daß vor ihrem Fenster im Park, vor ihrem Zimmer auf dem Flur die Menschen standen und andächtig lauschten. Einige flüsterten nur:
»Ein Engel, so kann nur ein Engel singen!«
»Nein«, sagte ein junger Arzt, »so kann nur Marisa del Vana singen!«
*
Auch Professor Gundler hatte sie gehört, diese beglückende, zauberhafte Stimme der Marisa del Vana.
»Gott sei Dank, jetzt ist er da, der Durchbruch. Jetzt findet Marisa del Vana zu sich selbst.«
Leise ging der Professor in das Zimmer seiner liebsten Patientin. Der Gesang war beendet. Auf ihrem Bett lag die Sängerin, ein gelöstes Lächeln auf dem schönen Gesicht. Sie schlief tief und entspannt. An ihrer Brust schlief der kleine Klaus, von ihrem Arm liebevoll umschlungen. Sein Fäustchen in das runde rote Bäckchen gedrückt, war er bei dem letzten Lied eingeschlafen. Sein Lächeln war so glücklich, als wüßte er, daß seine Mami ihm einen guten Engel geschickt hatte, der ihn lieben würde, wie sie selbst…
Gerührt betrachtete der Professor dieses entzückende Bild und schlich sich auf Zehenspitzen wieder aus dem hellen, luftigen Zimmer. Er wußte, Marisa war genesen. Ein tiefes Dankeschön erfüllte ihn.
Als er eine Stunde später wieder ganz vorsichtig in das Zimmer trat, scholl ihm fröhliches Kinderlachen entgegen. Die freundliche Schwester Ursula hatte einen kleinen Tisch geholt, an dem Kläuschen mit seinen Bauklötzchen spielte. Wenn er einen schönen Turm gebaut hatte, schaute er erwartungsvoll Marisa an, die ihn gebührend bewunderte. Dann mußte sie pusten, und der Turm fiel polternd zusammen. Verzweifelt schrie der kleine Schelm dann auf, mußte gestreichelt und getröstet werden, bis er mit großem Hallo wieder Türmchen baute.
Der Professor trat zu ihr, küßte beide Hände:
»Liebe, liebe gnädige Frau, Sie haben uns heute alle reich beschenkt. Wissen Sie nun, wer Sie sind?«
Marisa sah ihren Arzt lange an! Ein strahlendes Leuchten war in den großen, grün-goldenen Augen:
»Ja, Professor, ich weiß es wieder. Und der kleine Bub hat mir dabei geholfen. Ich bin Marisa del Vana, die Sängerin.«
»Wir wissen es alle. Sie haben uns eine strahlende, klingende Visitenkarte überreicht. Ja«, sagte er still, »ich bin besonders glücklich, die Sängerin, die ich verehre und deren sämtliche Platten ich besitze, nun auch persönlich als sehr liebenswerten Menschen kennenlernen zu können.«
Professor Gundler sah mit seinen gütigen grauen Augen die weit über Deutschlands Grenzen hinaus bekannte Sängerin an, die wirklich verehrungswürdig war – durch ihren anmutigen, schlichten Liebreiz, ihre wunderbare Natürlichkeit.
»Herr Professor, ich möchte mich gern mit Ihnen über den Buben unterhalten.«
Ein liebevoll besorgter Blick streifte das fröhliche Kind.
»Wissen Sie, zu wem das Kind gehörte? Ob es noch Angehörige hat? Wenn nicht, möchte ich es so gern zu mir nehmen.«
Der Arzt sah von der jungen Frau hin auf das friedlich spielende Kind. Als es merkte, daß der Arzt es anschaute, lief der kleine Kerl zu Marisa, umklammerte ihren Hals und sagte, Professor Gundler groß ansehend:
»Meine Mami!«
Das klang so bestimmt und besitzergreifend, daß der Professor ihm beruhigend über die Haare strich. Dann wandte er sich lächelnd an seine schöne Patientin:
»Es ist besser, wenn unser kleiner Klaus nichts von unserem Gespräch hört, gnädige Frau. Heute will ich mich noch eingehend erkundigen, was die Untersuchungen ergeben haben. Dann sprechen wir morgen weiter darüber, gell?«
»Natürlich, lieber Professor. Zu meiner Schande muß ich aber gestehen, daß ich sehr egoistisch geworden bin«, fügte sie leise hinzu. »Es ist einfach unverständlich, aber fast wünsche ich, daß das Kerlchen mich braucht, daß es keine nahen Verwandten mehr hätte.«
Fast schuldbewußt sah sie ihren Arzt an.
»Ja, schimpfen Sie nur mit mir, Professor! Ich schäme mich über meinen Egoismus. Und trotzdem wünsche ich es mir«, sagte Marisa mit entwaffnender Offenheit. Ihre wunderschönen, klaren Augen blickten Professor Gundler erleichtert an, als sie in seinen gütigen Augen ein verständnisvolles Lächeln aufblitzen sah.
Professor Gundler, der Menschenkenner, aber dachte: Sollte dieser außergewöhnlich schöne Mensch, diese begnadete Sängerin, als Frau einsam sein? Hatte sie nur ihrer großen Kunst gelebt, gab es keine persönliche Bindung?
Nachdenklich sah er seine berühmte Patientin an. Marisa mußte wohl seine Gedanken erraten.
»Ich würde diesen Wunsch, dem Kind ein richtiges Zuhause zu geben, nicht äußern, wenn ich irgendwelche Heiratspläne, oder eine starke innere Bindung hätte, lieber Professor. Und ich bin mir auch der Pflichten und Verantwortung bewußt und würde ihnen nicht ausweichen. Wenn ich über das Flugunglück nachdenke«, setzte Marisa sinnend hinzu, »könnte ich glauben, die junge Frau – seine Mutter – hat mir ihren Klaus ans Herz gelegt. Haben Sie etwas Zeit, lieber Professor?«
»Ja, natürlich. Vielleicht ist das, was Sie mir sagen wollen, noch wichtig für meine Nachforschungen. Erzählen Sie also! Aber nur, wenn es Sie nicht zu sehr aufregt!«
Professor Gundler setzte sich erwartungsvoll zu Marisa. Sie stützte den schmalen, lockigen Kopf mit der linken Hand, die rechte spielte gedankenverloren mit einem vergessenen Bauklötzchen. Sie hatte die Augen geschlossen. Noch einmal erlebte sie bewußt und gewollt die furchtbarsten Minuten ihres Lebens.
Besorgt beobachtete der Arzt das zarte, blasse Antlitz, das ihm in der kurzen Zeit so unendlich teuer geworden war. – Behutsam legte er seine sehnige Chirurgenhand auf ihre.
»Ruhig, meine Liebe, ganz ruhig! Das alles ist vorbei! Aber sprechen Sie nur, wenn Sie es wirklich möchten. Kann ich Ihnen helfen?«
Marisa blickte durch ihre langen Wimpern hindurch zu ihm auf.
»Weil ein Flugticket zurückgegeben wurde, bekam ich im letzten Augenblick noch einen Platz in der Unglücksmaschine und setzte mich zu einer jungen Frau mit ihrem Kind. Wir kamen ins Gespräch, und wie sich dann herausstellte, war es eine junge, sehr sympathische Ärztin, die ihre erste Stellung in New York antrat. Sie war ganz glücklich, daß sie ihren Buben mitnehmen konnte, der bisher in einem Kinderheim leben mußte. Die junge Mutter hoffte, daß es noch früh genug für den Buben war, um den beginnenden Hospitalismus… Ist das richtig, Doktor: Hospitalismus?«
Marisa sah den Arzt fragend an.
»Ja, das ist richtig. Hospitalismus gibt es beispielsweise, wenn ein Kind nur in einem Heim aufwächst. Man spricht allgemein von Hospitalismus, wenn sich – durch längeren Heim- oder Krankenhausaufenthalt – seelische oder körperliche Veränderungen einstellen. Das trifft für Kinder und Erwachsene gleichermaßen zu. Wirkliche Schäden sind für Kinder besonders bedeutungsvoll. Sie haben oft ihr ganzes Leben darunter zu leiden. Gott sei Dank ist bei unserem kleinen Klaus noch nicht viel davon zu spüren. Allerdings könnte seine spontane Liebe und Anhänglichkeit zu Ihnen schon ein Anfang sein. Gerade die Heimkinder suchen und brauchen einen Menschen, der ihnen gehört, zu dem sie gehören. Sie können dann mit fast fanatischer Liebe an diesem Menschen hängen. Wie gut für den kleinen Kerl, daß er Sie gefunden hat. Bitte, erzählen Sie weiter. Ich habe Ihnen ja fast eine Vorlesung über Hospitalismus gehalten«, sagte er entschuldigend. »Strengt es Sie auch nicht zu sehr an, über das Unglück…?«
Es klopfte. Herein kam Schwester Ursula, die das Kind zum Essen holen wollte. Anschließend mußte es ins Bettchen. Brav ging Kläuschen mit, aber vorher mußte er seine Mami noch fest in den Arm nehmen. Dann sah er den Professor kritisch an. Die Prüfung mußte zu seiner Zufriedenheit ausgefallen sein, er kletterte dem Professor auf den Schoß, gab ihm einen feuchten Kuß und lief zu Schwester Ursula.
»Einen Augenblick, Schwester Ursula!« rief der Professor.
»Würde es Ihnen möglich sein, mir einen guten Kaffee hierher zu bringen? Es war heute mal wieder ein anstrengender Tag! Wie steht es mit Ihnen, gnädige Frau?« wandte er sich an Marisa. »Auch ein Täßchen Kaffee? Ich finde immer, dabei plaudert es sich so gut!«
Marisa nickte bejahend. Und nachdem der Mokka in den kleinen braunen Schalen vor ihnen stand, berichtete Marisa weiter:
»Ja, sie erzählte, daß sie unter sehr schwierigen Bedingungen ihr Studium durchgeführt hätte, immer von dem Gedanken getrieben, dem Kind bei sich eine wirkliche Heimat zu geben. Ach, Professor…«, Marisa schluchzte auf, unter den Tränen schimmerten die großen Augen wie geschliffene, kostbare Smaragde, »ich finde es so furchtbar, daß diese tapfere junge Ärztin, die für ihr Kind jedes Opfer gebracht hat, gerade in dem Augenblick sterben mußte, als sie am Ziel war. Sie freute sich so auf das Zusammensein mit ihrem Kläuschen.«
Marisa trank ein Schlückchen Mokka, und das heiße, starke Getränk beruhigte sie.
»Ich sagte Ihnen, Professor, daß ich jetzt das Gefühl habe, als wenn die Mutter mir ihr Liebstes selbst gereicht hätte. Sie schien Vertrauen zu haben und erzählte mir, daß sie den Vater ihres Sohnes aus Standesrücksichten nicht geheiratet hätte. Er wußte nichts von seinem Kind. Wenn ich an unser Gespräch zurückdenke, sie mußte den Mann sehr geliebt haben. Ja, aus jedem ihrer Worte klang Liebe und Achtung… Hätten Sie gesehen, Doktor, mit welcher Liebe sie ihren Jungen ansah.« Sie hielt inne. »Und nun komme ich, ein ganz fremder Mensch, und dieser prachtvolle kleine Kerl fällt mir einfach so in den Schoß…«
Der Arzt hielt die schlanke, unruhige Frauenhand.
»Liebe gnädige Frau, wir müssen jetzt mal ganz vernünftig sein. Bitte!«
Die klugen, gütigen Augen des Arztes schauten sie eindringlich an:
»Bitte, überlegen Sie! Angenommen, Sie wären nicht noch im letzten Moment mitgeflogen, die Mutter des Kleinen wäre – wie jetzt verunglückt. Was meinen Sie, wäre voraussichtlich das Schicksal unseres kleinen Freundes gewesen? Ein Waisenhaus? Wollen wir da nicht lieber eine Fügung des gütigen Vaters im Himmel sehen, daß Klaus nun Sie, ein Zuhause, Liebe und Wärme gefunden hat?«
Sehr ernst hatte Marisa die einleuchtenden Worte des Arztes verfolgt. Dann nickte sie, tief aufatmend:
»Sie haben recht, Professor. Aber ich wollte Ihnen ja noch weiter erzählen. Ich saß also neben der jungen Frau, die das Kind auf dem Schoß hielt, mit ihm sprach, scherzte, lachte. Ein kleiner, brauner Teddy fiel herunter, und ich hob ihn auf und gab ihn dem Kleinen. Danach strebte er immer herüber zu mir! Da hielt seine Mutter ihn lachend hoch. Klaus kreischte vor Freude. Sie hielt ihn zu mir herüber und fragte: ›Wollen Sie meinen kleinen Halunken haben?‹ Ich breitete meine Arme aus, lachte und rief: ›Natürlich! Ich mag kleine Halunken!‹ Und jauchzend sprang das Kerlchen in meine Arme, auf meinen Schoß. Er war so zutraulich, daß mir ganz eigenartig wurde. Dann, Doktor, dann kam das Furchtbare! Es ging alles so schnell.
Ich hatte das Kind ganz fest im Arm. Plötzlich ein furchtbarer Knall, wohl eine Explosion. Wir liegen alle durcheinander, die Flugzeugtür unmittelbar vor uns springt heraus, das Flugzeug stürzt ab. Es ist ganz dunkel, das Kind klammert sich fest an mich. Ich kann die Mutter nicht mehr sehen. Die Besatzung bemüht sich um Ruhe. Alles geschieht in Sekundenschnelle. Das Flugzeug sinkt rapide. Instinktiv versuchte ich, zur Tür zu kommen, immer das Kind fest im Arm. Dann – oh, ich sehe es wieder ganz genau vor mir, dann wieder ein furchtbarer Knall, eine zweite Explosion. Und da – Doktor, es brennt! Schreie, schreckliche Schreie, Flammen, in rasender Schnelligkeit breiten sie sich aus. Da habe ich mich mit dem Kind aus dem Türloch fallen lassen. Dann – weiß ich nichts mehr…«
Marisa hatte in ihrer Erregung immer lauter, immer schneller gesprochen. Jetzt war Stille. Erschüttert saß der Professor neben ihr, streichelte sanft und beruhigend ihr Haar. Es war gut, daß sie über dieses grauenhafte Erlebnis endlich einmal gesprochen hatte. Es war gefährlich, ein solches einschneidendes, dramatisches Geschehen ins Unterbewußtsein zu drängen. Eine ganze Weile saß der Arzt nur still neben der Erregten, Zitternden. Ganz allmählich wurde sie ruhiger, der Atem ging wieder gleichmäßig. Dann sprach Professor Gundler mit seiner warmen, sonoren Stimme zu ihr:
»Fast möchte ich sagen, Sie haben recht, Frau del Vana, wenn Sie glauben, die Mutter gab Ihnen ihr Kind. Andernfalls – darüber muß man sich klar sein – würde der kleine Kerl wohl kaum noch leben. Das ist Ihnen doch auch klar, gell? Sie hatten das Kind fest an sich gepreßt, ließen es auch in dieser katastrophalen Situation nicht los. Sie sprangen! Das Kind war für Sie eine erhebliche Belastung, Sie hielten es aber dennoch ganz fest und sprangen. Ich möchte fast sagen, Sie sprangen mit dem Kind wie in Gottes Hand. Diese gütige Vaterhand ließ Sie beide dann auf einen ungewöhnlich hohen, getrockneten Heuberg fallen. Ungewöhnlich deshalb, weil ein Arbeitsversuch gemacht werden sollte: von der ganzen, ziemlich großen Wiese war das trockene Heu hier zusammengetragen, um es von hier aus direkt zu verladen. Sie wissen doch, sonst werden viele, sehr viele kleinere Heuhaufen eingefahren.«
Sinnend schaute der Arzt seine ungläubige Zuhörerin an, die fassungslos stammelte:
»Mein Gott, Doktor, dann war es nur ein Zufall, daß wir auf dem Heu so sanft gelandet sind?«
Der Professor schüttelte langsam den Kopf. Tiefer Ernst lag auf seinen charaktervollen, männlichen Zügen.
»Zufall? So würde ich es nicht nennen! Dieser außergewöhnliche Heuberg war vielleicht das Werkzeug in der Hand Gottes. Ich sehe und erkenne darin ganz einfach eine göttliche Fügung.«
Er stand langsam auf. »Tun Sie das auch, liebe Freundin. Dann wird Ihnen alles klar. Ist Ihnen nicht Ihr Weg, mit dem Kind, direkt vorgezeichnet? Gehen Sie ihn.«
Die Tränen stürzten Marisa aus den jetzt glücklich strahlenden Augen. Beide Hände reichte sie ihrem Arzt und Freund.
»Ich danke Ihnen, lieber, lieber Doktor. Ja, ich kenne meinen Weg – nein, unseren Weg. Ich bin wirklich Kläuschens Mutter geworden. Und ich werde ihm eine gute Mutter sein!«
Das war ein Gelübde!
*
Wieder gab es in der internationalen Presse eine Schlagzeile, die mit dem Flugzeugunglück von Zürich in Verbindung stand:
Wer kennt dieses Kind? Einziges überlebendes Kind der furchtbaren Flugzeugkatastrophe von Zürich. Wer kennt diesen etwa zweijährigen kleinen Jungen oder kann nähere Angaben machen? Vorname wahrscheinlich Klaus. Die Mutter des Kindes, die bei dem Unglück ums Leben kam, war sehr wahrscheinlich Ärztin. Das Kind muß in einem Kinderheim gelebt haben. Sachdienliche Angaben bitte an die Klinik Professor Gundler, Zürich, oder jede Polizeidienststelle.
Daneben war ein Bild des kleinen Klaus abgedruckt.
Am nächsten Abend brachten das deutsche, österreichische und schweizerische Fernsehen das gleiche Bild von Klaus wie die Zeitungen. Danach sagte der Sprecher:
»Anschließend bringen wir ein Bild der beiden einzigen Geretteten der furchtbaren Flugzeugkatastrophe bei Zürich. Wir bitten noch einmal dringend um Angaben über den kleinen Klaus. Wir sind für jeden Hinweis dankbar. Unsere Telefone sind aufnahmebereit unter den Nummern… Und jetzt sehen Sie…«
Das Bild blendete auf.
Eine sehr zarte, sehr blasse Marisa del Vana saß in ihrem Krankenzimmer und auf ihrem Schoß, eng an sie gekuschelt, das Kind, der kleine Klaus.
Das Kind war ganz unbefangen vor der Kamera. Es wußte ja nicht, was das alles bedeutete. Als Marisa ihn liebevoll nach seinem Namen fragte, trompetete er fröhlich:
»Täus – chen, ja, Täuschen is das!«
Und sein rundes Fingerchen zeigte auf sich. Dann aber umarmte er spontan Marisa, drückte sie fest mit seinen kurzen, kräftigen Ärmchen und verkündete laut und ohne Hemmung:
»Das is Täuschens Mami! Mami danz doll lieb! Täuschen auch danz doll lieb, nich, Mami?«
Zart strich Marisa ihm über die kleinen widerspenstigen Löckchen. Sie drückte das Kind leicht an sich, und der warme herzliche Ausdruck ihrer Augen sagte mehr als viele Worte. Es war ein inniges, harmonisches Bild, die schöne junge Frau in dem hellgrünen Hausmantel aus schimmerndem Samt, der die Liebe zu dem Kind in den Augen stand. Der kleine Klaus spielte jetzt selbstvergessen mit einem schwarzweißen Holzfoxterrier auf leuchtend roten Rädern, den er begeistert von Zeit zu Zeit an seine kleine Brust drückte, dann aber vom Schoß herunterrutschte, um seinen Holzfoxl am roten Band durch das Zimmer zu ziehen. Der Hund war ein Geschenk der Kameraleute, die nun an dem lebhaften, hübschen Kind viel Freude hatten. Die Kamera folgte seinem Spiel, aber auch seinen stürmischen Küßchen, wenn er an seiner Mami vorbeiging. Der Leiter des Aufnahmeteams wunderte sich darüber, blendete wieder Marisa ein und fragte sie:
»Wie kommt es, gnädige Frau, daß der kleine Klaus Sie Mami nennt und Sie offensichtlich doch sehr liebt? Ich finde das ganz erstaunlich!«
Marisa nickte. Sinnend sah sie auf das Kerlchen.
»Ich kann Ihre Frage gut verstehen, Herr Burmester!« Marisa zögerte etwas, doch dann sprach sie leise weiter:
»Als das Furchtbare geschah, saß ich neben seiner Mutter und hatte Klaus auf dem Arm. Daher weiß ich, daß seine Mutter Ärztin war…«
Die junge Frau stockte. Als sie weitersprach, schimmerten Tränen in den schönen, ausdrucksvollen Augen. Millionen Fernsehzuschauer blickten wie gebannt in das zarte Gesicht, hörten die weiche, oft verhaltene Stimme. Und alle erfaßten die Tragik der jungen Ärztin, die unter schweren Opfern studiert und das Opfer der Trennung von ihrem Kind gebracht hatte, um ihm eines Tages ein Zuhause geben zu können, dann aber am Ziel – einen grauenhaften Tod fand. Mit schlichten Worten fuhr Marisa fort:
»Wenn es keine Verwandten gibt, die Klaus zu sich nehmen können, möchte ich ihn sehr gern zu mir nehmen. Er soll Geborgenheit, Wärme und den Schutz eines Elternhauses bei mir finden!«
Marisa war sehr ernst geworden. Kläuschen, der ihr etwas sagen wollte, bemerkte das. Eiligst kam er auf seinen prallen, braunen Beinchen zu ihr gelaufen, kletterte behende auf Marisas Schoß, streichelte mit seinen etwas klebrigen, runden Patschhändchen über ihre Wange und fragte besorgt:
»Mami, tau - ig? Mami nich tau - ig! Täuschen danz doll lieb! Ja!«
Und bestätigend nickte der kleine Schelm ganz energisch mit dem Köpfchen. Marisa beugte sich zu ihrem Jungen, streichelte über sein wirres Haar und lächelte ihn an:
»Nein, mein Bübchen, ich bin nicht traurig. So, nun darfst du einmal winken! Da sind viele liebe Menschen, die uns helfen wollen!«
Marisa stand auf und nahm das Kind auf den Arm. Ein schönes, ergreifendes Bild!
Professor Gundler dachte: Lieber Gott, gib, daß sich keine nahen Verwandten melden! Wie sie sich verändert hat! Diese selbstverständliche Mütterlichkeit in Ausdruck und Gesten! Wie ich sie liebe! Die Sterne möchte ich ihr vom Himmel holen, aber bescheide dich, alter Junge! Sie bringt dir Freundschaft, Freundschaft und Vertrauen entgegen! Sei dankbar dafür.«
Tief aufatmend wandte sich Professor Gundler ab.
*
Nach der Fernsehsendung setzte eine Flut von Briefen, Geschenken und Blumen ein. Besonders für Klaus stapelten sich Spielzeug, Kleidungsstücke, Briefe mit und ohne Geld. Von einer alten Frau kam ein Brief, mit zitternder Hand geschrieben. In ihm lagen zehn Euro! Bewegt las Marisa dem Professor diesen Brief vor:
Lieber kleiner Klaus
Als ich Dich eben auf meinem Fernseher sah, wurde ich wieder an meinen Jungen, meinen Klaus erinnert. Er war so alt wie Du, hatte auch so lachende Augen und so schöne Löckchen wie Du! Er hatte für mich, seine Mami, die ersten Wiesenblumen gepflückt. Als er dann fröhlich über die Straße lief, um sie mir zu bringen, kam ein rasender Autofahrer… Mein Junge hat nicht mehr gelitten. Die Blümchen hielt er fest in seinem Händchen. Ich habe sie ihm gelassen. Nur ein kleines Veilchen habe ich behalten. Das war vor fast vierzig Jahren, am Karfreitag…
Liebe, gnädige Frau, verzeihen Sie einer alten Frau! Aber so sonnig, so liebevoll wie dieser kleine Klaus – so war auch meiner. Da kam halt die Erinnerung! Ich lege zehn Euro bei. Machen Sie dem Buben eine kleine Freude damit. Gern gäbe ich mehr, aber als Rentnerin…
Ich werde Sie und den lieben kleinen Klaus in mein Gebet einschließen. Gott schütze Sie! Ihre Gertrud Greveler, Köln, Am Brunnen 16.
Schweigend sahen sich Marisa und der Professor an.
»Ein Mutterschicksal. Vielleicht der Karfreitag eines Lebens…«
Professor Gundler sagte es ernst und sinnend. Dann schüttelte er die Schwere ab, die sich ihrer ermächtigt hatte.
»Nun wollen wir mal sehen, was in dem Briefchen steht! Scheint von einem Kind zu sein!«
Und er las vor:
Lieber Klaus, Du bist ja richtig vom Himmel gefallen. Tat’s weh? Schrecklich! Ich geb’ Dir meinen Teddy. Ist sehr lieb. Du auch zu ihm! Ich bin Fritzchen und sieben Jahre alt. Komm mal!
Darunter schrieb seine Mutter:
Sehr geehrter Herr Professor,
unser kleiner Sohn war nach der Sendung so sehr beeindruckt von dem Schicksal des süßen kleinen Kerls (mein Mann und ich aber auch!), daß er sofort seine Spielsachen durchstöberte, um dann das Liebste zu schicken, was er hat: seinen alten, zerknautschen Teddy, ohne den er, (trotz seiner stolzen sieben Jahre!) nicht einschläft. Ich ließ ihn gewähren. Wir meinen, man kann einem Kind nicht die Freude am Schenken, am Freudemachen nehmen. Unser kleiner Sohn gab seinen liebsten und kostbarsten Besitz. Ich glaubte, Ihnen diese kleine Erklärung geben zu müssen. Sicher bekamen Sie einen Schrecken, als Sie das gute alte Stück auspackten. Wenn der kleine Klaus ihn doch auch etwas gern haben könnte! Ein guter alter Teddy kann so etwas Tröstliches sein.
Im übrigen sind mein Mann und ich gern bereit zu helfen, wo immer Sie auch Hilfe für ›Täus – chen‹ brauchen. Es umfaßt menschliche wie finanzielle Hilfe – bis zur Adoptionsbereitschaft. Unsere Adresse: Rechtsanwalt Dr. Bergmann, München, Wiesengrund 13. Wir alle grüßen Sie, sehr geehrter Herr Professor, die von uns schon immer sehr bewunderte Marisa del Vana und das goldige Kläuschen! Ihre Anneliese Bergmann.«
Schmunzelnd packte der Professor »das gute alte Stück« aus. Ja, arg zerknautscht und mitgenommen sah es aus! Zart streichelte eine sanfte, schmale Frauenhand das strubbelige, graubraune Fellchen. Marisa war, als wäre es hell und leuchtend um sie geworden, da ein kleines Kinderherz sich bedenkenlos vom liebsten und vertrautesten Spielkameraden trennte, um einem fremden Kind zu helfen.
Noch viele Briefe und Päckchen lasen die beiden. Viel spontane Hilfsbereitschaft strömte aus den Zeilen. Aber immer wieder ging Marisas Blick zum Teddy, der sie mit seinen glänzenden schwarzen Knopfaugen freundlich anschaute. Und sie dachte daran, daß Teddys Platz auf Fritzchens Kopfkissen leer war.
In ihre Gedanken hinein sagte der Professor:
»Ich wundere mich, daß wir von dem Kinderheim noch nichts gehört haben. Ich habe schon alle Absender daraufhin nachgesehen – nichts! Was meinen Sie, liebe gnädige Frau, was wir…«
Es klopfte! Herein trat eine junge Schwesternschülerin, einen Brief in der Hand!
»Ein eingeschriebener Brief für Sie, Herr Professor! Wenn Sie bitte unterschreiben wollen!«
»Ach, Schwester Dorle, das ist ja das, worauf wir so warten!«
Schnell unterschrieb und öffnete der Professor den Brief. Angstvoll verfolgte Marisa jede seiner Bewegungen. Er überflog den kurzen, maschinengeschriebenen Brief, dann gab Dr. Gundler ihn aufatmend weiter an Marisa. Seine gütigen Augen kündeten eine gute Botschaft.
Marisa las, daß keine Verwandten bekannt seien, die Mutter sei, unter schwierigen Umständen, allein für das Kind aufgekommen, und die Ärztin Dr. Lore Meiners gewesen. Der Vater sei nicht bekannt. Der kleine Klaus sei ein gut lenkbares, liebebedürftiges Kind. Das Heim sei selbstverständlich gern bereit, Klaus Meiners wieder aufzunehmen. Über die Regelung der Kostenfrage müsse man mit den zuständigen Behörden sprechen. Mit guten Wünschen für das Kind und der Bitte um möglichst baldige Nachricht schloß das etwas kühle, geschäftsmäßige Schreiben.
Wortlos sahen sich Marisa und der Professor an. Dann brach die Freude durch:
»Professor, lieber, lieber Freund, kann mir jetzt noch irgendeiner den Jungen nehmen? Was müssen wir tun, um alles schnell für die Adoption zu veranlassen? Bitte, helfen Sie mir!«
Beglückt hatte der Professor das »Wir« registriert. O ja, er wollte und konnte helfen. Seine Beziehungen reichten über die Schweizer Grenzen hinaus. Und er war glücklich, der geliebten Frau manche Schwierigkeiten abnehmen zu können.
»Wie ist es, Doktor, kann ich mein Kläuschen in der nächsten Woche mitnehmen, wenn ich nach Hause fahre? Oh, ich muß gleich mit meiner lieben, kleinen Mamusch sprechen. Sie hat sich immer so sehr ein Enkelchen gewünscht. Jetzt bringe ich es ihr mit! Ach, lieber Freund, ich bin etwas durcheinander. Aber ich weiß, Sie verstehen mich, gell?«
Marisa strahlte ihren Arzt und Freund an. In ihren wunderschönen leuchtend grünen Augen hatte die große Freude viele kleine Sonnen angezündet. Der Professor schaute wie gebannt in das grün-goldene Strahlen, das ihn ganz gefangenhielt.
»Wie geht es nun weiter, lieber Freund? Was muß ich tun, um den Behördenweg abzukürzen? Was schlagen Sie vor?«
Der Professor riß sich zusammen. Jetzt galt es, der liebsten Frau zu helfen und nicht unerfüllbaren Träumen nachzuhängen.
»Ich werde mich sofort mit meinem Freund, einem ausgezeichneten Juristen, in Verbindung setzen. In Deutschland brauchen Sie auch einen Anwalt, da Sie und Klaus Deutsche sind. Haben Sie einen bekannten Anwalt?«
Marisa zögerte: »Ja, schon. Aber er ist ziemlich alt. Als unseren Vermögensverwalter gibt es keinen besseren, keinen, der gewissenhafter sein könnte. Aber ich glaube, für diese Sache ist er nicht geeignet.«
Der Professor stutzte. Hatte Marisa sich schon so viel ersungen, daß sie einen Vermögensverwalter brauchte? Er wußte so wenig über ihre finanziellen Verhältnisse. Er wußte nur, daß er sie liebte, mit der ganzen Kraft seines unverbrauchten Herzens, daß er aber diese Liebe tief in seinem Herzen verschließen mußte, wollte er ihre Freundschaft behalten.
»Halt, Doktor, mir fällt etwas ein!«
Marisa kramte in den eingegangenen Briefen. Dann hielt sie triumphierend das Schreiben von Frau Bergmann hoch.
»Hier, Rechtsanwalt Dr. Bergmann. Vielleicht kann er uns raten. Außerdem wohnt er auch in München. Vielleicht sollte Ihr Freund sich mit ihm in Verbindung setzen? Was meinen Sie? Ach, lieber Doktor, wenn es doch nur alles schnell über die Bühne ginge!«
Der Professor sah die geliebte Frau lächelnd an.
»Wie ungeduldig, wie jung Sie sind! Vergessen Sie nicht, Marisa, Sie sind noch immer Rekonvaleszentin. Wenn Sie mir Ihre Personalien angeben, können wir schon morgen die Angelegenheit in Angriff nehmen. Also der Name: Marisa del…«
»Halt, lieber Freund«, unterbrach sie ihn, »del Vana ist nur mein Künstlernahme.«
Professor Gundler schaute sie etwas bestürzt an.
»Schade! Der Name paßt so gut zu Ihnen. Marisa del Vana. Schon der Name ist Musik.«
Marisa sah ihren Doktor lächelnd an:
»Mein Name ist Marisa Gräfin von und zu Langenberg auf Langenberg. Fänden Sie diesen Namen nicht zu lang für eine Sängerin? Halt, es fehlen noch einige Vornamen: Alexandra Huberta Rudolfa. Nun stellen Sie sich doch bloß mal alle meine stolzen Namen auf einem Plakat vor. Meinen Künstlernamen del Vana habe ich mir zum Teil bei meiner Mama entliehen.«
»Ist Ihre Frau Mutter Ausländerin?« fragte Dr. Gundler interessiert.
»Ja, Spanierin! Als junger Diplomat war mein Vater Attaché bei der deutschen Botschaft in Madrid. Da lernte er auf einem Ball seiner Botschaft eine bildschöne, blutjunge Comtessa del Vanessa kennen. Sich sehen und lieben, war für beide eins. Mit siebzehn Jahren wurde sie Gräfin Langenberg, mit knapp achtzehn dann Mutter eines Mädchens. Ich blieb leider das einzige Kind. Meine Mutter hätte ihrem geliebten Mann so gern einen Sohn und Stammhalter geschenkt, aber es ging nicht – oder nur unter größter Lebensgefahr. Und nun bringe ich ihr unseren Stammhalter.«
»Sie lieben Ihre Mutter wohl sehr, Marisa?«
»Ja, über alles! Sie ist ein wunderbarer Mensch! Ja, ich liebe, bewundere und verehre sie, aber in manchen Dingen ist sie sehr unselbständig. Unglaublich unselbständig! Denken Sie an die sehr strenge spanische Erziehung. So hatte Mama beispielsweise bis zu ihrer Hochzeit noch nicht einen Schritt ohne ihre Gouvernante außerhalb des Hauses gemacht. Das änderte sich natürlich etwas als Gräfin Langenberg. Aber mein Vater hätte am liebsten jeden ihrer Schritte selbst beschützt, er vergötterte seine sehr schöne, junge Frau. Er hielt ihr jede Aufregung, jeden Ärger, jede Belastung fern. Ist das da ein Wunder, daß sie in vielen praktischen Dingen hilflos wie ein Kind war und blieb? Schauen Sie, Doktor, in solchen Situationen fühle ich mich immer als die Ältere.«
Marisa wurde sehr ernst. Tränen verdunkelten ihre Augen.
»Als vor ungefähr zwei Jahren die Forstgehilfen meinen Vater schwerverletzt auf einer Bahre brachten, er war bei der Jagd mit seinem Pferd gestürzt, waren seine letzten Worte an mich: Schütze sie!
Und der Blick seiner brechenden Augen lag mit unendlicher Liebe auf der einzigen Frau seines Lebens.«
Marisa schwieg. Ihre Gedanken schweiften in die Vergangenheit.
»Am meisten habe ich Mama nach dem Tod meines Vaters bewundert. Damals, als jeder glaubte, sie würde zusammenbrechen, zeigte sie eine Würde und Hoheit, eine Größe und Tapferkeit, die mich immer wieder erschütterte. Erst vor einigen Monaten habe ich zum erstenmal gewagt, mit ihr über diese grauenhaften Tage zu sprechen…«
Marisa war sichtlich bewegt. Ihre Stimme schwankte.
Der Professor legte sanft seine Hand auf ihre schmale Schulter.
»Marisa, wenn die Erinnerung zu quälend ist…«
Marisa kämpfte kurz mit ihren Tränen, dann fuhr sie weiter fort:
»Nein, Doktor, Sie sollen noch die Antwort dieser im Glück kindlich-verspielten, im Leid aber über sich hinauswachsenden, wunderbaren Frau, meiner Mutter, hören. Sie sagte und vermied wie immer das Wort ›Tod‹, wenn sie von meinem Vater sprach:
›Weißt du, Marisa, einige Tage vor seinem Sturz sagte mein Hubertus zu mir: ›Ich habe heute ganz zufällig ein Gedicht gelesen, ich glaube von C.F. Meyer. Das hat mir gefallen. Ich habe es mit unserer Ehe verglichen, es heißt: Der römische Brunnen.‹ ›Dann nahm dein Papa mich in seine starken Arme und sagte mir leise ins Ohr:
›Und jede gibt und nimmt zugleich – und strömt – und ruht…‹«
Marisa fuhr fort: »Dann sagte Mama mit tiefer Überzeugung und einem fernen Blick in ihren großen dunklen Augen: ›Unser Glück war so groß, so wunderbar… Unser Brunnen strömt in mir weiter – bis zuletzt.‹«
Beide schwiegen. Der Professor meinte sinnend:
»Ich kenne das Gedicht, und ich kenne römische Brunnen. Ich liebe es, wenn das Wasser aus der kleinen in die größere und dann in die dritte, noch größere Schale fällt. Ein wunderbarer Vergleich für eine Ehe. Wie zutiefst glücklich müssen die beiden Menschen gewesen sein!«
Der Professor nahm die schlanke, feingliederige Hand der verehrten Frau und küßte sie behutsam.
»Ich danke Ihnen, liebe Freundin, daß Sie mich das wissen ließen. Und nun bringen Sie ihr einen Enkel, diesen entzückenden, kleinen Bengel…«
Die Tür flog auf und der »entzückende, kleine Bengel« stand in all seiner strahlenden Lebendigkeit vor den beiden Menschen. Klaus stürmte in Marisas weitgeöffneten Arme. Da schrie er plötzlich glücklich auf: »Mein Teddy, mein lieber, lieber Teddy! Oh, Mami, Teddy haben!«
Und sehnsüchtig streckte das Kind seine braunen Ärmchen aus, um seinen Teddy an sich zu drücken.
Überrascht sahen sich Marisa und der Professor an. Plötzlich kam Marisa eine Erinnerung!
»Doktor, erinnern Sie sich? Ich erzählte Ihnen doch, daß ich im Flugzeug einen Teddy aufhob und Klaus gab. Damit fing ja eigentlich unsere Freundschaft an. Der kleine Teddy war auch nicht schöner und besser als dieser, aber scheinbar wurde er genauso geliebt wie der von Fritzchen. Ich werde nachher doch mal die Familie Bergmann anrufen. Zuerst möchte ich dann mit Fritzchen sprechen und ihm sagen, welch eine große Freude er Kläuschen gemacht hat, dessen geliebter Teddy im Flugzeug verbrannt ist. Dann möchte ich mich bei der Mutter bedanken und den Vater um seine juristische Hilfe bitten. Und nun, lieber, guter Doktorfreund, möchte ich von Ihnen wissen, wann Sie uns entlassen. Unser treuer Franz soll mich mit dem großen Wagen abholen. Denken Sie, was ich noch alles für meinen Sohn einkaufen muß! Herrlich! Wir werden wahrscheinlich ein bis zwei Tage bis zum Schlößchen brauchen. So wird unsere gemütliche, alte Burg Langenberg meistens genannt. Ach, Doktor, ich bin ja so glücklich – und Ihnen so dankbar!«
Marisa reichte ihrem nun schon so vertrauten Freund die schlanken Hände, die er andächtig küßte.
»Marisa, ich bin immer für Sie und den Strolch da. Immer, das wissen Sie.«
Seine Stimme wurde leise und verhalten.
»Ich wäre sehr froh, wenn Sie mich hin und wieder noch brauchen könnten. Ja, und der Abreisetag? Sagen wir übermorgen? Schenken Sie mir noch einen Tag Ihre Gegenwart. Bitte!«
*
Einige Wochen waren ins Land gezogen! Im Schlößchen am Chiemsee herrschte fröhliches Leben.
Der kleine Klaus Hubertus Fernando Graf Langenberg war der erklärte Liebling aller. Die Großmama hütete ihn zusammen mit Selli wie ihren Augapfel, unterstützt vom gesamten Personal.
Marisa, die geglaubt hatte, nie wieder ein Flugzeug besteigen zu können, hatte ihre Angst überwunden und war nun doch nach New York geflogen. Sie hatte die »Mimi« aus »La Bohéme«, die »Susanne« in »Figaro« und die »Olympia« in »Hoffmanns Erzählungen« gesungen. Selten hatte die berühmte Met solche Beifallsstürme erlebt wie nach jedem Auftritt von Marisa. Die Kritiker rühmten ihre Stimme, die eine vorher nie erreichte Weichheit und Innigkeit gezeigt habe. Auch ihre Schönheit sei zarter, weicher und von einem ganz bestrickenden weiblichen Charme. Man rätselte nach der Ursache. War Marisa del Vana etwa verliebt? Oder lebte sie ihr Leben jetzt nach dem furchtbaren Flugzeugunglück intensiver, bewußter? Niemand wußte darauf eine Antwort. Aber alle waren sich einig darüber, daß Marisa nicht nur die größte, sondern unbestreitbar auch die schönste Sängerin der Welt sei.
Marisa hätte sie mit einigen Worten aufklären können, aber keiner erfuhr von ihrem Glück.
War sie allein in ihrer eleganten Suite im Waldorf-Hotel, dann holte sie ihre Fotos hervor, und ein weiches, verträumtes Lächeln glitt über ihre schönen Züge. Da lachte ihr ein kleiner, sonnenbrauner Bub entgegen, mit knappem Lederhöschen, lustig kariertem Hemdchen und in den runden
Ärmchen einen kleinen Hund, ein Katzenbaby oder irgendein Tierchen, das sich ergeben in seine liebevollen Arme schließen ließ. Konnte er kein Tier finden, holte er seinen Teddy. Auch Klaus schlief nicht ohne seinen braunen, treuen Freund ein. Auffallend war seine furchtlose Liebe zu Pferden. Marisa und ihre Mutter, die Gräfin Fernanda, waren beide sehr gute Reiterinnen. Sie freuten sich über die Liebe des Kindes und darauf, wenn er eines Tages auf seinem Pony mit ihnen reiten würde.
Heute nun sollte Marisa von New York zurückkommen. Das Schloß war in freudiger Erwartung. Franz war schon vor einigen Stunden zum Flugplatz München-Riem gefahren. Der kleine Klaus zappelte vor Ungeduld, und als die gute Selli ihm noch einmal die wirren Locken kämmen wollte, noch einmal die nie ganz sauberen Bubenhände waschen mußte, da protestierte der kleine Kerl ganz energisch: »Nein, nu is genug! Täuschen is fein!«
Er nahm seinen Teddy unter den Arm, setzte den geliebten Sepplhut auf, holte seinen selbstgepflückten Vergißmeinnichtstrauß, der in der warmen Kinderhand schon etwas gelitten hatte, und marschierte los, die Großmama holen.
Gräfin Langenberg stand im kleinen, sonnendurchfluteten Gartenzimmer, in dem Raum, den Marisa wegen seiner Helligkeit und seiner vielen blühenden Blumen immer besonders geliebt hatte. Zwei hohe französische weiße Türen führten auf die breite Terrasse hinaus. Da leuchtete es bunt blühend aus weißen Blumenkästen, aus alten Terrakottaschalen quollen Hängegeranien, anmutige rote und weiße Fuchsien, gelbe Pantöffelchen und leuchtend rote, stolze Salvien. Fröhlich grüßten von dem alten grauen Gemäuer der Burg Langenberg gelbe, rote und weiße Kletterrosen. Eine gelbe Markise dämpfte die grellen Sonnenstrahlen zu einem warmen weichen Gold.
Sinnend betrachtete Gräfin Langenberg den sommerlich gedeckten Kaffeetisch. Recht einladend wirkte er mit dem alten Meißener Porzellan. Die gute Wiener Köchin Lisa hatte wieder ihre berühmte, köstliche Sachertorte zu Marisas Empfang gebacken, ein bunter, lustiger Wiesenblumenstrauß, von der Großmama und Klaus gepflückt, prangte in der Mitte.
Immer wieder genoß Gräfin Fernanda die Schönheit, den tiefen Frieden dieser Natur. Zu ihren Füßen schimmerte blausilbern der weite Chiemsee. Er plätscherte in kleinen Wellen leise murmelnd an die Parkmauer. Da schreckte sie Gepolter und Rufen aus ihrer stillen Beschaulichkeit.
»Doßma! Doßma! Tomm, Doßma! Mami tommt doch dleich!« Klaus lief auf seine liebe Großmama zu, umschlang ihre Beine.
Der kleine Kerl zog seine Großmama mit sich fort. Schnell ging’s jetzt in den geräumigen Schloßhof, dessen blühende Linden einen betäubenden Duft verströmten. Gerade war Marisa aus dem Wagen gestiegen. Jubelnd flog der Junge an ihren Hals! Immer wieder mußte sie das gesunde, sonnenbraune Gesichtchen ansehen, ihn immer wieder fest in ihre Arme schließen, die runden warmen Bäckchen küssen, durch die widerspenstigen Haare streichen. Wie glücklich sie war, wie schön war das Heimkommen, wenn ein Kind wartet!
Mit dem Kind auf dem Arm eilte sie zu ihrer Mutter, die lachend in geringer Entfernung diese stürmische Begrüßung abwartete. Mutter und Tochter begrüßten sich herzlich. Man spürte die tiefe Harmonie zwischen ihnen. Als Marisa ihren Jungen auf den Boden gleiten ließ, rief der kleine Kerl: »Mami, Täus – chen un Doßma für Mami Blumen fückt, da!« Und strahlend wollte Klaus seiner Mami seine Vergißmeinnicht reichen. Ja, wo waren denn seine schönen, hellblauen Blümchen? Ratlos schaute das Kind auf die zerrupften Stengel in seiner kleinen Faust, dann auf die Mami, die Großmama. Die immer lachenden Augen des Buben füllten sich mit dicken Tränen, die über die prallen Bäckchen purzelten. Grenzenlose Enttäuschung, wie sie so jäh eigentlich nur ein Kind empfindet, lag auf dem Gesichtchen. Aufschluchzend warf er sich in Marisas Arme.
»Oh, Mami, meine schönen Bümchen, alle putt! Alle Bümchen für meine liebe Mami ganz putt!«
Marisa tröstete ihn. Sie nahm den zerdrückten Strauß, der fast nur noch aus Stielen bestand, behutsam in ihre Hände und entdeckte zu ihrer Freude noch einige feste Blütenknospen, die sie ihrem kleinen Sohn zeigte.
»Schau her, Kläuschen, das werden noch sehr schöne Blüten. Wir wollen sie gleich in eine Vase stellen. Und morgen früh, wenn du wach wirst, sind die vielleicht schon aufgeblüht. Ich freue mich sehr über deinen Blumenstrauß.«
Da strahlte das kleine Gesicht mit den großen Augen wieder, und glücklich hüpfte Klaus an Marisas Hand ins Haus.
In den nächsten Stunden nahm Klaus seine Mutter völlig für sich in Anspruch, und beide waren glücklich dabei!
Nach dem Kaffee und der köstlichen Sachertorte nahm der Kleine Marisa an die Hand, und beglückt fühlte sie die warme, etwas klebrige Bubenhand in ihrer.
»Tomm, Mami, ganz snell, Hotte in Wiese sehn, ja?«
Übermütig lief Marisa mit ihrem Buben über die saftig grüne Wiese. Ihr weites, buntes Sommerkleid umwehte fröhlich die schlanke Gestalt.
Plötzlich ließ sie den Kleinen los.
»Fang mich, Täuschen!« rief sie ihm lachend zu und lief voran.
Jubelnd und schreiend lief der Bub hinter seiner Mami her, bis sie sich umdrehte und er in ihre weitgeöffneten Arme lief. Dann mußte Klaus vorlaufen, und die Mutti strengte sich furchtbar an, um ihr Kläuschen zu fangen. Bis auch der Bub sich plötzlich umdrehte und mit offenen Ärmchen auf Marisa zulief. Dann rannten sie gemeinsam zu den Pferdekoppeln.
*
Abends saß Marisa mit ihrer Mutter auf der Terrasse. Der Wasser- und Teergeruch vom Chiemsee und seinen Booten vermischte sich mit dem köstlichen Duft frisch gemähter Wiesen, dem Duft der blühenden Linden, des Jasmins und der Rosen. Der Abendfriede der Natur erfüllte auch die Menschen.
Marisa saß, in die sonnengelben Leinenkissen gekuschelt, in ihrem Sessel. Ein zärtliches Lächeln umspielte ihren Mund. Dann streckte sie sich, ergriff liebevoll die schmalen Hände ihrer Mutter:
»Ach, Mama, wie schön ist es, wieder zu Hause, wieder bei dir zu sein. Die Wochen an der Met waren sehr anstrengend. Das New Yorker Publikum ist außerordentlich anspruchsvoll und sehr verwöhnt. Aber sie waren ganz reizend zu mir.«
»Ich hoffe, Marisa, daß du jetzt aber vorläufig bei uns bleibst. Du weißt, der Bub braucht dich! Ich weiß nicht, wie oft er mich täglich gefragt hat, wann du nach Hause kommst.«
Marisa lachte glücklich.
»Mamachen, ahnst du, wie glücklich mich dieses Kind macht? Der kleine Kerl ist so lieb und zärtlich.«
Fragend schauten Marisas große Augen in das vornehme, zarte Gesicht der Mutter. Die nickte ihrer Einzigen liebevoll zu:
»Ja, Marisa, ich glaube, daß ich das wohl weiß! Ich brauche dich nur anzusehen, dann weiß ich, daß meine Tochter sehr froh und zufrieden ist. Du bist eine glückliche junge Mutter, gell? Aber wird dir das auf die Dauer genügen, mein Kind? Wünschst du dir nicht einen Gefährten, eine Ehe, Kinder? Du weißt, daß ich dich liebe, daß ich auch immer bemüht war, dir eine gute Mutter zu sein. Aber nur Mutter zu sein, das hätte mir nicht genügt. Das größte und kostbarste Geschenk meines Lebens war mein Hubertus, dein Vater, und unsere wunderbare Liebe. Wie sehr wünschte ich dir eine solche Erfüllung, mein Kind. Nun, du bist noch jung. Ich wünsche dir so einen ritterlichen, vornehmen Menschen, wie dein Vater einer war.«
Ernst und sinnend blickten die großen tiefschwarzen Augen der Gräfin in eine ferne, leuchtende Vergangenheit.
»Weißt du, Mama, vielleicht ist mein guter Paps der Grund, daß ich den richtigen Mann noch nicht gefunden habe. Ich vergleiche immer! Warten wir mal ab, was die Zukunft bringt, Mama. Auf jeden Fall muß ein Partner auch ein sehr guter Vater für mein Kläuschen sein, sonst bleibe ich lieber allein!«
Gräfin Langenberg nickte ihrer Tochter beipflichtend zu. Dann streichelte sie leicht über ihr Haar.
»Unser Herrgott wird es schon richtig machen. Ich habe immer auf ihn vertraut. Ach, da fällt mir ein, weißt die eigentlich, daß dein Sohn ein reizendes, kleines Muttermal hat? Ein deutliches, sechseckiges Sternchen im Nacken. Direkt unter dem Haaransatz!«
»Ja«, antwortete Marisa lebhaft, »der Professor in Zürich machte mich darauf aufmerksam. Ein ganz harmloses Muttermal, ohne jede Bedeutung.«
Zarte silbergraue Nebel lagen auf dem See. Am Ufer quakten die Frösche ihr Abendkonzert. Ein kleiner Singvogel flötete noch im Traum ein paar verlorene Töne.
Marisa dachte an die Hektik der Städte, an die überfüllten Konzertsäle, an den zermürbenden Streß einer Konzerttournee. Sie dachte auch an einige Kollegen, die ihr durch Eifersucht und kleinliche Schikanen die Proben erschwerten. Sie sah auch den gottbegnadeten italienischen Tenor Pedro, der sie mit seiner fanatischen Leidenschaft verfolgte. Er, dem alle Frauen zu Füßen lagen, wollte sie, die stolze schöne Marisa del Vana. Ihre kühle Freundlichkeit stachelte sein Begehren an. Seine Versuche, sie bei den Aufführungen glühend zu küssen, wo auch nur ein Kuß in der Rolle vorgeschrieben war, verleidete ihr die Arbeit und ekelte sie an.
Um so tiefer empfand die große Sängerin die Ruhe und die Harmonie zu Hause bei ihrer geliebten Mutter und ihrem Buben. Aus diesen Gedanken heraus sagte sie leise:
»Mama, ich werde vorläufig keine Tornee mehr abschließen. In etwa zwei Wochen werde ich auf einem privaten Konzert für die Krebshilfe singen. Ohne Honorar natürlich. Näheres weiß ich noch nicht. Und dann mache ich Ferien! Hier bei dir und bei Klaus, an unserem schönen See. Ach, Mamachen, ich freue mich wie früher, wenn es Schulferien gab. Denk doch, singen nur zum Vergnügen, schwimmen, segeln, reiten, wandern, faulenzen und stundenlang mit dir gemütlich Kaffee trinken, mit meinem Jungen durch die Gegend streifen. Ach, Muttchen, sind Ferien schön, wenn man solch einen süßen kleinen Strolch hat.«
Die Gräfin lachte herzlich. »Du hast recht, Marisa. Das Kerlchen mit seinem Lachen, Jubeln, Weinen und Trotz, vor allem aber mit all seiner Zärtlichkeit, seiner Liebe zu jedem Tier – besonders zu Pferden und Hunden – ist mir wie ein eigener Enkel ans Herz gewachsen. Ich bin sehr froh, daß wir ihn haben!«
Marisa sprang aus ihrem Sessel auf, nahm ihre Mutter stürmisch in die Arme: »Muttchen, wie schön, daß du das sagst! Ich hatte schon befürchtet, mein Klaus brächte zu viel Unruhe in dein Leben!«
»Damit werde ich schon fertig. Aber ich fände es richtiger, wenn du nicht immer von deinem Klaus reden würdest. Schließlich bin ich seine Großmama! Und darum heißt es doch wohl unser Klaus!«
Marisa war sprachlos. Sie konnte sich nicht erinnern, ihre zarte, verwöhnte Mama jemals so energisch gesehen zu haben. Dann aber lachte sie laut. Der Kleine schien seine liebe Großmama enorm zu aktivieren, und das war gut. Mit großer Freude spürte Marisa die neue Energie, sah fröhlich in die kriegerisch blitzenden Augen ihrer Mutter.
»Mamuschka, Liebes, ich bin ganz überrascht! Der Junge krempelt dich ja förmlich um! Wunderbar! Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin! Natürlich ist es unser Klaus! Und ich bin dir sehr, sehr dankbar, daß du mir bei der Erziehung unseres Jungen so fabelhaft hilfst!«
Die Gräfin blickte ihre Tochter lange an. Ihre Augen wurden weich:
»Ich sehe wieder eine Aufgabe, eine große, lohnende Aufgabe. Ich möchte dir helfen, aus unserem Kind einen echten Grafen Langenberg zu machen. Mir scheint, die Anlagen und Voraussetzungen sind da, wenn man auch nichts von seinem Vater weiß. Das ist eigentlich schade, es könnte in manchen Situationen die Erziehung ganz bestimmt erleichtern.«
Marisa kam aus dem Staunen nicht heraus. »Ja, aber Mama, woher weißt du das alles?«
Die Gräfin lächelte fein. »Mein liebes Kind, ist es so erstaunlich, daß man sich auf solch eine große Aufgabe auch vorbereitet? Ich habe mich mit deinem prachtvollen Professor in der Schweiz in Verbindung gesetzt. Der hat mir die richtigen Bücher ausgesucht und zugeschickt. Ich habe sie studiert, nicht nur gelesen. Und wenn ich etwas nicht verstand, habe ich einfach den Professor angerufen und gefragt. Er war auch einmal am Wochenende hier.«
Fast spitzbübisch lachte die alte Gräfin ihre sprachlose Tochter an. »Da wunderst du dich, gell?« Ernster werdend, fügte sie hinzu: »Schau, Marisa, ich wollte aufhören mit dem Traumdasein der letzten beiden Jahre. Verstehst du das? Das Leben geht weiter. Und darum bin ich dem Schicksal so dankbar, das dich mir erhielt und noch dazu einen Enkel schenkte!«
Marisa wurde sehr nachdenklich. Fast machte sie sich Vorwürfe. Sie hatte nie darüber nachgedacht, daß eine Aufgabe der scheinbar so lebensfremden Mutter nach dem großen Verlust ihres Mannes vielleicht hätte helfen können. Hatte sie trotz all ihrer Liebe, all ihrer Überlegung, wie sie ihr helfen könnte, doch etwas versäumt? In ihren großen, sprechenden Augen schimmerten Tränen, als sie das zarte Persönchen liebevoll in die Arme schloß.
»Mama, liebe kleine Mama, habe ich etwas versäumt? Vielleicht hätte ich schon eher für dich eine Aufgabe suchen sollen? Ich habe natürlich darüber nachgedacht, womit du dich ablenken könntest, vielleicht durch eine Reise nach Spanien, wo du für eine längere Zeit die Verwandten dort hättest besuchen können. Aber das wäre nichts für dich gewesen. Ohne unseren ritterlichen Papa wärst du verloren auf einer Reise, gell, Mama?«
Gräfin Fernanda hatte lächelnd zugehört. Jetzt schüttelte sie den dunklen Kopf. »Nein, mein Mädelchen, nur Ablenkung oder Abwechslung habe ich nicht gesucht damals, als er von uns ging. Reisen? Ohne ihn? Nein, Kind. Ich habe so unendlich viel gesehen, weil Papa im diplomatischen Dienst viel reisen mußte und mich immer mitgenommen hat. Schau, die schönsten Fleckchen der Erde habe ich gesehen mit ihm, an seiner Hand. Er führte mich, zeigte mir, was sehenswert war, und ich schritt an seiner Seite, stolz und glücklich! Und immer fühlte ich mich wie eine kleine Königin, eingehüllt in den Purpurmantel seiner Liebe. Nein, jetzt reise ich nicht mehr.« Sie hielt einen Augenblick inne. »Ob du etwas versäumt hast? Mein Liebes, was hätte ich wohl damals ohne dich und deine rührende Liebe und Sorge gemacht? Ohne dich wäre ich ihm, meinem Hubertus gefolgt. Und nun habe ich durch dich eine wunderbare neue Aufgabe. Übrigens, weißt du, daß der Professor dich sehr liebt?«
Überrascht hob Marisa den Kopf. »Ja, das habe ich natürlich bemerkt. Ich freue mich über seine Freundschaft, erwidere sie, möchte sie auch nicht missen. Aber Liebe? Nein, Mama, die kann ich ihm nicht geben. Sicher weiß er das auch, obschon wir nie darüber gesprochen haben. Aber woher weißt du…?«
»Von ihm selbst. Er weiß aber auch, daß seine Liebe ohne Echo ist. Nun hast du einen sehr, sehr guten Freund an ihm.«
Die Gräfin schaute auf das Leuchtzifferblatt ihrer goldenen Uhr.
»So, mein Mädel, es ist bald Mitternacht. Wir wollen jetzt schlafen gehen. Wundere dich nicht, wenn um sechs Uhr Klaus an deinem Bett steht und von dir Geschichten erzählt haben möchte. Möglichst von Pferden!«
Die beiden Damen standen auf. Marisa räumte die bunten Kissen und die sonnengelbe Decke fort, nahm das alte Zinnwindlicht und führte ihre Mutter in das Haus.
Vor den Räumen der Gräfin nahm sie das zierliche Persönchen noch einmal fest in den Arm. »Mama, liebe kleine Mama, ich danke dir für das gute Gespräch! Es ist jetzt alles viel klarer, leichter. Gute Nacht, Mamuschka! Schlaf gut!«
Frohen Herzens ging Marisa in ihre Räume. Elternliebe hatte ihr eine entzückende kleine Wohnung geschaffen. Von einer reizenden Biedermeier-Diele mit polierten kleinen Kirschbaummöbeln führte eine Tür in das große helle Wohnzimmer, dessen große Fenster auf den Chiemsee blickten. Der schöngeschnittene Raum war sparsam mit einigen ausgewählt schönen, alten Barockmöbeln ausgestattet. Besonderes kostbar war der alte, breite Barockschrank aus dem 17. Jahrhundert. Marisa, die altes Porzellan liebte, hatte darin eine erlesene Sammlung außerordentlich wertvoller seltener Stücke. Die zartgelbe, seidig schimmernde Tapete und die hellen chintzbezogenen Sessel und die vielen Pflanzen gaben dem Raum eine heitere Atmosphäre.
Neben dem Wohnzimmer lag das Musikzimmer. Ein großer weißer Steinway-Flügel beherrschte den schlichten Raum. Eine weiße Tür führte in das reizende Ankleidezimmer. Ein kuscheliger Raum zum Träumen und Entspannen, den Marisa besonders liebte. Zwischen Ankleide- und Schlafzimmer lag das große, luxuriöse Bad in zarter Fliederfarbe und blitzendem Chrom. Das sich anschließende elegante Schlafzimmer war ein Hauch von Rosé und mattem Elfenbein.
Jeder der zahlreichen Gebrauchsgegenstände war eine kleine erlesene Kostbarkeit in handgeschnittener, dunkelgrüner Jade, Marisas Lieblingsstein.
Ihre persönliche Bedienung, früher nannte man sie Kammerzofe, hatte alles für die Nacht gerichtet. Die leichte Brokat-Daunendecke war zurückgeschlagen, das hauchzarte Nachtgewand aus weißer Spitze lag zum Hineinschlüpfen bereit. Marisa aber ging weiter. Die nächste Tür führte zu dem Reich ihres Kindes: ein großes, luftiges Schlafzimmer in kräftigem, leuchtendem Blau, mit lustigen blau-rot karierten Gardinen und Bettbezügen. Dahinter ein kleines Bad in strahlendem Gelb mit hellbraunen Duschvorhängen, Gardinen und einem dicken, flauschigen Badeteppich, der den ganzen Raum bedeckte. Die Badetücher waren hell- und dunkelgelb, mit den eingestickten Initialen K.L. unter einem kleinen Krönchen.
Lange stand Marisa am Bettchen ihres schlafenden Kindes. Beglückt hörte sie die tiefen, ruhigen Atemzüge, sah sie das schöne Kindergesicht mit den rosigen, runden Bäckchen.
Neben Klaus auf dem Kopfkissen lag der Teddy und blickte mit seinen glänzenden Knopfaugen unbekümmert in die Nacht. Um seinen dicken, struppigen Hals war von ungeschickter Kinderhand ein buntes Tuch geschlungen.
Marisa hockte sich vor dem Bettchen nieder. Glücklich atmete sie den Duft von Gesundheit, guter Kinderseife. Der Bub wurde unruhig, er strampelte die leichte Daunendecke weg. Als Marisa sie ihm wieder behutsam überlegte, murmelte er schlaftrunken: »Mami bei Täuschen bleiben! Täuschen danz lieb!«
Zärtlich streichelte Marisa über das Gesichtchen. Ein inniges Gebet stieg auf zum Himmel, zum Lenker aller Geschicke:
»Lieber, lieber Gott, hilf mir, meinen Mutterpflichten immer gut nachzukommen. Segne mein Kind, das du mir in deiner Güte schenktest. Hilf mir, daß ich bis zu meiner letzten Stunde vor seiner leiblichen Mutter bestehen kann, bitte, lieber Vater im Himmel. Amen!«
Dann drückte sie noch ein zartes Küßchen auf die kleine braune Faust und ging in ihr Schlafzimmer hinüber. Die Tür zum Zimmer ihres Sohnes ließ sie etwas geöffnet.
Bald danach war sie mit einem innigen Lächeln auf dem schönen Gesicht eingeschlafen.
*
Ein warmer, gleichmäßiger Sommerregen hüllte Wiesen, Berge und den See in silberne Nebel. Man saß am gemütlichen Frühstückstisch. Kläuschen aß mit gutem Appetit sein zweites Honigbrötchen, trank genüßlich seinen Kakao. Seine großen Augen strahlten die beiden Damen an.
»Meckt dut!« verkündete er laut und rieb sich zufrieden sein kleines Bäuchlein. Mutter und Großmutter lachten. Auch ihnen schmeckte es, der Appetit des Buben war ansteckend.
»Heute ist ein Wetter zum Stöbern. Ich gehe nachher mit Klaus auf den Spielboden. Da wollen wir mal in meinen alten Spielsachen nach etwas Brauchbarem für unseren Jungen suchen. Schau, Mama, ich habe schon mein Räuberzivil angezogen!«
Lachend zeigte Marisa auf ihre alte Reithose, die schlichte Hemdbluse.
»O ja, Täus pielen! Mit Mami pielen, ja!« Schnell rutschte er von seinem hohen Stühlchen, lief auf Marisa zu und griff nach ihrer Hand.
»Tomm, wir dehn detzt! Täuschen ist satt!« Da nun Gräfin Fernanda die kleine Tafel aufhob, wurde seine Geduld auf keine Probe mehr gestellt.
Und dann begann für beide ein großer Spaß. Für Marisa war es ein Ausflug in eine glückliche Vergangenheit, in ihre Kindheit. Für den kleinen, noch unverwöhnten Klaus waren es Stunden im Kinderparadies. Das Schönste war für ihn ein wunderbares, großes Schaukelpferd mit richtigem Fell und einem stolzen, langen Schweif.
»Mein Hottematz, Mami! Mami, Hottematz und Täus - chen, ja, Mami! Oh, schönes Hottemätzchen!«
Nach diesem erlebnisreichen Vormittag kamen die beiden – ein großes und ein kleines Kind – nach Dusche und gründlicher Reinigung, strahlend und hungrig zu Tisch.
Franz hatte das Schaukelpferd gebürstet und gestriegelt und in das Spielzimmer des Kleinen gebracht. Marisa freute sich schon auf seine Überraschung.
Ein Telefonanruf für Marisa del Vana unterbrach das angeregte Mittagsmahl. Vom Apparat zurückkommend, fragte sie ihre Mutter:
»Mama, kennst du einen Fürsten Lahrenfels – oder so ähnlich? Dort soll das Konzert zugunsten der Krebshilfe stattfinden. Ich glaube, es ist rheinischer Adel. Der Fürst muß ein Schlößchen und auch größeren Landbesitz in der Nähe von Garmisch haben. Dort findet das Konzert am fünfzehnten Juli, also in einer Woche, statt. Professor Wegner wird mich wieder am Flügel begleiten. Wir wollen noch etwas für den Abend üben. Kann ein behagliches Zimmer für den Professor zu übermorgen gerichtet werden, Mama?«
»Natürlich, Kind! Und nach dem Konzert, Marisa? Bleibt es bei deinem Versprechen, einen längeren Urlaub zu machen? Denk an Klaus!«
Der hob den Kopf und verkündete gähnend:
»Täus will lapen! Täus ist soo müde!«
Marisa nickte ihrer Mutter liebevoll zu.
»Mein Versprechen gilt, Mamachen! Und ich freue mich auf einige freie, ungestörte Wochen mit dir und dem Buben. So, mein Söhnlein, ab nach oben, ab in dein Lape - lape, wie du es nennst!«
Marisa nahm ihren müde getollten Jungen an die Hand und brachte ihn ins Bettchen.
*
Zwischen Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald grüßte – versteckt von hohen Tannen, auf der Spitze eines kleineren Berges, Schloß Lahrenfels, der Sommersitz der Fürsten Lahrenfels-Dyssenburg. Das große alte Wasserschloß, der Stammsitz derer von Lahrenfels-Dyssenburg, lag mit riesigem Grundbesitz in Westfalen. Mehrere tausend Hektar fruchtbaren Bodens, eine bekannte Pferdezucht, mehrere Konservenfabriken, in denen der Segen der Gemüsefelder sofort verarbeitet wurde, eine große Branntweinbrennerei, deren »Münsterländer Schnaps« weit und breit berühmt war und sehr gern getrunken wurde, und eine sehr rationell arbeitende Wurst- und Fleischfabrik, die auch nur Schlachtvieh aus eigenem Betrieb verarbeitete.
Fürst Hasso war mit Leib und Seele Landwirt. Seine große Liebe aber galt seinen Pferden. Auf jedem namhaften Turnier liefen seine Pferde, die er selbst zum Siege ritt.
Heute aber war in Schloß Lahrenfels ein ganz besonderer Tag. Der dreiflügelige, große weiße Bau in gemütlichem bayerischen Barock, lag behäbig in der strahlenden Nachmittagssonne, die sich funkelnd in den vielen blanken Scheiben brach. Im prächtigen Mittelbau wiegten sich in den grünen Blumenkästen vor jedem Fenster wahre Blütenkaskaden.
Prüfend schritt Hasso Lahrenfels- Dyssenburg durch die kostbar eingerichteten weiten Empfangsräume, gefolgt von seinem Hofmeister und der Hausdame, Frau von Gebert. Sie stand dem Hauswesen schon zu Lebzeiten seiner Mutter vor, mit damenhafter Würde und großem Geschick. Im Umgang mit dem zahlreichen Personal war sie zurückhaltend, streng, aber korrekt und gerecht. Die Leute hatten Vertrauen zu ihr. Man arbeitete gern auf Schloß Lahrenfels.
Fürst Hasso wandte sich an seine Hausdame:
»Baronin, das Konzert beginnt um acht Uhr. Darf ich Sie bitten, unseren berühmten Gast, Marisa del Vana, etwas unter Ihre Fittiche zu nehmen? Sind Blumen auf ihren Zimmern? Vielleicht nimmt sie vor dem Singen eine Erfrischung? Ich bin ein Bewunderer dieser herrlichen Stimme, ich sah sie natürlich auch im Konzertsaal. Hoffentlich ist man bei näherer Bekanntschaft nicht enttäuscht. Auf der Bühne ist sie sehr schön, aber ist das Natur?«
»Nun, lieber Fürst, wir werden es bald wissen! Die Zimmer für Marisa del Vana und das Zimmer für ihren Pianisten, Professor Wegner, sind selbstverständlich bereit. Außerdem habe ich noch zwanzig Fremdenzimmer richten lassen, sollte es für einige Herrschaften zu spät werden. Hatten Sie noch Wünsche?«
Fürst Hasso überlegte, dann wandte er sich an seinen Hofmeister:
»Wie ist das, Georg, wird Frau del Vana von uns abgeholt?«
»Nein, Durchlaucht. Die gnädige Frau kommt mit ihrem Wagen und Fahrer.«
Fürst Hasso stutzte, sagte aber nur: »Gut, Georg.« Und dachte bei sich: Sie scheint ja eine anspruchsvolle Dame zu sein.
Frau von Gebert spürte sein Befremden.
»Marisa del Vana muß in sehr guten Verhältnissen leben. Erinnern Sie sich noch an das furchtbare Flugzeugunglück vor einigen Monaten? Sie und ein kleines Kind waren die einzigen Überlebenden. Sie hat dann den zweijährigen Knaben adoptiert.«
»Hat sie denn überhaupt Zeit für den kleinen Kerl? Hoffentlich war das nicht nur die Laune einer Primadonna. Ich finde das nicht sehr gut!«
Leicht tadelnd sah Baronin Gebert den Fürsten an, den sie seit über zwanzig Jahren kannte und mit mütterlicher Liebe in ihr Herz geschlossen hatte.
»Und wenn es nun die Liebe zu diesem elternlosen Kerlchen war, die sie die ganze Sorge und Verantwortung tragen läßt? Ich jedenfalls bewundere diese junge Frau und große Künstlerin«, schloß die Baronin mit besonderer Betonung und sah den Fürsten ernst an.
Der lachte herzlich. In seinen großen, dunkelbraunen Augen funkelten kleine Spottgeister.
»Oh, liebste Baronin, nicht böse sein. Ich sage nichts gegen Ihre so verehrte Marisa del Vana. Sie wissen, daß auch ich sie als Künstlerin großartig finde. Ich habe ihre sämlichen Schallplatten, die ich mir mit Genuß anhöre. Wer ist denn eigentlich der Vater des Kindes? Hätte er nicht als nächster Verwandter das Kind zu sich nehmen müssen? Oder ist er auch bei den Verunglückten gewesen?«
Frau von Gebert zögerte etwas: »Das Kind war unehelich geboren. Die Mutter, eine junge Ärztin, hatte den Namen des Vaters nicht genannt!«
Fürst Hasso schüttelte den Kopf.
»Wieder so ein Schuft. Dann wird es wohl so für den Kleinen am besten sein.«
Inzwischen hatten die drei ihren Rundgang beendet. Die großen, holzgetäfelten Empfangsräume mit den wertvollen alten Möbeln waren tadellos in Ordnung, der reiche Blumenschmuck aus den Gärten und Wiesen des Gutes war bezaubernd angeordnet und verströmte frischen, süßen Sommerduft. Zum Schluß gingen sie in den großen Konzertsaal, der in Künstlerkreisen für seine gute Akustik bekannt war. Auf einem Podium ein großer Flügel, vor den tiefen Fenstern weite Krüge mit wilden Rosen.
Der Hausherr war zufrieden. Er hatte es auch gar nicht anders erwartet. Es hatten sich etwa hundert Gäste angesagt, die, durch Bonner Regierungskreise aufgerufen, ihr außerordentlich hohes Eintrittsgeld für die Krebshilfe spendeten. Marisa hatte auf ihre Gage verzichtet, und Fürst Hasso stellte sein Haus, seine Dienerschaft und ein außergewöhnlich reichhaltiges kaltes, köstliches Büfett zur Verfügung. Die Spitzen der Gesellschaft hatten sich angemeldet: Diplomaten des In- und Auslandes, führende Staatsmänner, viel Geburts- und Geldadel, prominente Künstler und schöne Frauen. Manche unter den Schönheiten in der leisen Hoffnung, den im Augenblick interessantesten und reichsten Junggesellen doch noch die zarten Rosenfesseln der Ehe anzulegen. Fürst Hasso aber entschlüpfte immer wieder. Er fürchtete die Dornen, wenn Duft und Blüte vergangen.
Den wahren Grund allerdings kannten außer ihm nur ein paar vertraute Freunde: Der Fürst hatte einmal geliebt, mit dem ganzen Einsatz eines heißen, leidenschaftlichen Herzens. Nach einem Frühling und Sommer voller Glück und Zärtlichkeit hatte sie ihn verlassen. Was blieb, war eine schmerzende, wehmütige Erinnerung an ein zauberhaftes, lebenssprühendes Geschöpf, an warme rehbraune Augen unter silberblonden Locken, einen roten, lachenden Mund und einen kurzen, nichtssagenden Abschiedsbrief.
Baronin Gebert wußte von dieser großen Liebe. Auch sie hatte das warmherzige junge Menschenkind sehr in ihr Herz geschlossen. Sie ahnte eine Tragik, glaubte auch die Ursache zu kennen – jetzt, nach Jahren. Sie schwieg, weil es zu spät war. Die Uhr ließ sich nicht zurückstellen.
*
Lautlose Stille herrschte in dem großen Musiksaal des Schlosses, der bis auf den letzten Platz von einem anspruchsvollen Publikum gefüllt war.
Marisa del Vana sang!
Sie hatte ganz bewußt ein schlichtes, aber sehr ansprechendes Programm gewählt. Schubert und Schumann wechselten in bunter Folge mit Kinderliedern, die sie neu in ihr Repertoire aufgenommen hatte und mit einer bis dahin nie gesehenen, reizenden Schelmerei vortrug.
Als sie dann zum Schluß mit einer rührenden Zartheit und Innigkeit sang:
Guten Abend, gute Nacht!
Mit Rosen bedacht,
mit Näg’lein besteckt,
schlupf unter die Deck’!
Morgen früh – so Gott will,
wirst du wieder geweckt…,
da war jeder gerührt.
Marisa del Vana, eine Frau von atemberaubender Schönheit, mit einer Stimme von seltener Kraft, aber auch voll Weichheit und Süße, Marisa del Vana, eine zarte, schmale Gestalt in einem weißen langen Seidenkleid von schlichter Eleganz, als einzigen Schmuck nur einen schmalen Goldgürtel mit zwei dunkelgrünen Smaragden als Schließer. Um den schlanken, sonnengebräunten Hals eine kostbare Smaragdkette, die den schimmernden Glanz ihrer strahlenden grünen Augen vertiefte. Weich fielen die Locken auf ihre zarten Schultern.
Der begeisterte Beifall nach ihrem letzten Lied wollte nicht enden. Mit einer angeborenen stolzen Anmut verneigte sich Marisa leicht vor ihren Zuhörern. Der Jubel ihres Publikums brauste erneut auf.
Da trat Hasso Fürst Lahrenfels zu ihr auf das Podium. Mit einem Handkuß dankte er der Künstlerin für den Genuß, bat zugleich aber unter dem Jubel der Gäste um eine Zugabe. Wenn er einen Wunsch äußern dürfte: noch ein Wiegenlied.
»Vielleicht ein etwas ausgefallener Wunsch von einem ausgewachsenen Mann, aber ich glaube, daß ich für viele unserer verehrten Gäste spreche. Bitte, gnädiges Fräulein, noch ein Wiegenlied!«
Der Graf sah in die leuchtenden Augen, in das ebenmäßige, schmale Antlitz und konnte seinen Blick nicht abwenden. Die natürliche Schönheit dieses Geschöpfes faszinierte ihn. Auch Marisa schaute wie gebannt in das männlich schöne, kühne Gesicht mit den großen, tiefdunklen Augen. Wo hatte sie ihn nur schon gesehen? Er war ihr bekannt. Ja, mehr noch, er war ihr vertraut!
Marisa del Vana senkte die langen Wimpern. Dann legte sich ein zartes Lächeln auf ihre weichen Züge. Voll schlug sie die großen Augen zu dem Fürsten auf:
»Haben Sie ein bestimmtes Wiegenlied, das Sie hören möchten, Durchlaucht?«
Fürst Lahrenfels war überrascht von der Sicherheit, der selbstverständlichen, damenhaften Anmut ihrer Sprache und Bewegungen.
»Ja, ich habe ein Wiegenlied sehr gern, das mir hin und wieder meine Mutter sang. Es ist, glaube ich, nicht sehr bekannt. Ich habe es nie wieder gehört. Ich sage Ihnen die ersten Zeilen:
Schlaf ein, mein liebes Kind!
Draußen weht der Abendwind,
und es leuchten schon die Sterne…
weit in dunkler Himmelsferne.
Su – su – su…
Überrascht hob Fürst Hasso den Kopf, als Marisa ihm weiterhalf und fortfuhr:
Alle Welt legt sich zur Ruh.
Schließ auch deine Äuglein zu!
Dann wirst du durchs Traumland
geh’n
und ein schönes Märchen seh’n.
Su – su – su.
Und die ganze lange Nacht
halten Englein bei dir Wacht,
um dein Bettchen leis sie schweben,
schützen zart dein liebes Leben.
Su – su – su.
Es war wie ein holder Bann, der die beiden Menschen umfangen hielt. Marisa faßte sich zuerst. Sie lächelte den Fürsten an.
»Es war auch mein Lieblingslied. Meine gute, alte Kinderfrau mußte es mir jeden Abend singen. Jetzt singe ich es für meinen kleinen Sohn.«
Marisa wandte sich an die Gäste:
»Meine Damen und Herren, auf besonderen Wunsch singe ich ein etwas weniger bekanntes Wiegenlied, Professor Wegner begleitet mich.«
Dankbares Klatschen belohnte den Entschluß.
Nach einem leisen Vorspiel setzte Marisa ein. Den Blick in die Ferne gerichtet, suchte ihr Herz das geliebte Kind. Sie saß in Gedanken an seinem Bettchen, hielt die kleine heiße Hand in ihrer, strich über das Haar, das sich eigenwillig um die schöne klare Kinderstirn ringelte, sah die großen dunklen Augen kleiner und kleiner werden, dann ein tiefer Atemzug – ihr wilder, kleiner Bub schlief, den Teddy fest im Arm. Wieder empfand sie die tiefe Beglückung, und immer zarter, inniger war ihre Stimme geworden.
In tiefem Bann saßen ihre Zuhörer – Politiker, Manager, Finanziers, schöne, gepflegte Frauen, ob kalt oder warmherzig, sie alle ließen sich von dieser begnadeten Künstlerin an die Hand nehmen und zurückführen in ihre Kindheit.
Sicher hatte nicht jeder ein schönes Kindermärchen erlebt, nicht jeder Mutterliebe, Güte und Geborgenheit gefunden, aber die Sehnsucht danach lebte wohl in allen, das schlichte Lied brachte sie zum Klingen.
Als Marisa geendet hatte, herrschte tiefe Stille. Dann brauste ein unbeschreilicher Beifall auf, der alle Schranken niederriß. Fürst Hasso trat noch einmal zu ihr auf das Podium, küßte andächtig ihre beiden Hände und sagte dann mit etwas belegter Stimme leise zu ihr:
»Ich möchte Ihnen von ganzem Herzen danken, gnädiges Fräulein. Mit dem Lied haben Sie mich reich beschenkt. Meine Mutter starb vor fünf Jahren. Ich habe sie sehr geliebt.«
Danach reichte Hasso Fürst Lahrenfels-Dyssenburg seinem berühmten Gast den Arm und führte ihn in die Empfangsräume. Die übrigen Gäste, unter ihnen Professor Wegner, folgten ihnen.
Die illustren Gäste verbrachten einige anregende, angenehme Stunden. Marisa lernte in der Baronin Gebert eine Dame von fraulicher Güte und großer Lebensklugheit kennen. Beide fühlten sich stark zueinander hingezogen. Daher beobachtete die Baronin mit Interesse, daß Fürst Hasso, sobald es seine Pflichten als Hausherr gestatteten, sich in Marisas Nähe aufhielt. Unauffällig folgten ihr seine bewundernden, oft auch nachdenklichen Blicke. Wieder setzte sich Fürst Hasso zu Marisa. Die Baronin erhob sich unter dem Vorwand, nun auch ihre Hausfrauenpflichten erfüllen zu müssen, hauptsächlich aber, um dem Fürsten Gelegenheit zu geben, sein Vorurteil zu revidieren. Sie ahnte ja nicht, wie sehr er Marisas natürliche Schönheit, ihren zarten weiblichen Charme bewunderte und ihre strahlende Stimme liebte. Er überlegte, wie und wo er die verehrte Frau wiedersehen könnte.
»Steht Ihr Programm für die nächsten Konzerte schon fest, gnädiges Fräulein?« fragte Fürst Hasso.
Marisa schüttelte den Kopf. Sie lächelte:
»Mein Bub hat alle meine Pläne durchkreuzt, neue Verträge für die Mailänder Scala und die Met in New York habe ich nicht unterschrieben. Wir werden jetzt erst einmal lange Ferien machen. Dann werde ich vorläufig wahrscheinlich nur in München und bei den Salzburger Festspielen singen. Da habe ich noch Verpflichtungen«, setzte sie erklärend hinzu.
Der Fürst sah sie ernst und fragend an: »Wird es Ihnen nicht schwerfallen, auf den Beifall der begeisterten Zuhörer zu verzichten, liebes, gnädiges Fräulein?«
Fürst Hasso fragte es seltsam eindringlich.
Marisa blickte ihn erstaunt an. Sie schüttelte so energisch den Kopf, daß sich kleine Löckchen aus der Frisur lösten und lustig an ihren Schläfen tanzten.
»Aber nein! Es geht doch um ein Kind, einen kleinen Menschen, für den ich ganz bewußt die Verantwortung übernommen habe.«
Hasso sah sie mit einem langen Blick an. Die Baronin kam dazu: »Frau del Vana, haben Sie kein Bildchen von Ihrem Buben? Ich möchte ihn sehr gern einmal sehen. Sie sicher auch, Durchlaucht?«
Ohne eine Antwort abzuwarten, zog Marisa aus ihrem kleinen weißseidenen Beutel einige zusammengeklappte Fotos. Stolz zeigte sie die Bilder, lauter Schnappschüsse eines lebenssprühenden, bildschönen kleinen Buben.
Lachende, fröhliche Bilder. Häufig mit Marisa, einer strahlenden, übermütig mit dem Kind tollenden jungen Mutter. Sehr hübsch war auch das Bild, das Marisa auf ihrem Fuchs zeigte, in dunkler Reithose, heller Hemdbluse und einem flatternden Seidenschal. Vor sich, im Sattel, der lachende Klaus im grünen Sportanzug mit langer Hose. Immer wieder Klaus! Klaus mit seinem Teddy. Klaus mit einem jungen Hund, liebevoll an sich gepreßt. Klaus, der mit ausgebreiteten Armen auf Marisa zulief. Klaus in seinem Spielzimmer, eifrig mit Holzklötzchen bauend. Klaus, Klaus!
Eifrig, mit zart geröteten Wangen, erklärte Marisa die lebendig wirkenden Bilder.
Das Pferdefoto hielt der Fürst besonders lange in der Hand. »Sind Sie Reiterin?«
Marisa lachte.
»Reiterin? Pferdenärrin! Ich wollte eher auf ein Pferd, als ich laufen konnte! Es ist eigenartig, aber Klaus, dieser kleine Kerl, ist schon jetzt ein Pferdenarr. Er könnte darin mein Sohn sein, aber er ist noch schlimmer, als ich es war. Überhaupt hat er eine große, ganz ausgeprägte Liebe zu jedem Tier und leider auch überhaupt keine Angst! Wir leben jetzt auf einem Gut am Chiemsee, und da gibt es viele Gefahren für so einen kleinen Kerl.«
»Das ist sicher auch der Grund, daß Sie keine Gastspielreisen mehr machen wollen?«
Der Fürst, der die Fotos zusammenlegte, fragte es spontan.
Marisa wurde ernst.
»Ja, aber nicht nur! Schauen Sie, mein Bub ist vom ersten Tag an in einem Heim gewesen. Die junge Mutter, ein sehr lieber, gewissenhafter junger Mensch, war Medizinstudentin. Sie liebte ihren Jungen über alles. Aber das arme Geschöpf mußte arbeiten. Ja, arbeiten und lernen. Sie sorgte doch allein für ihr Kind. Als sie ihr Staatsexamen hatte, wollte sie mit ihrem Kind nach New York, dort war ihr eine gute Stellung angeboten worden. Das Schönste für sie war, daß sie dahin ihren Buben mitnehmen konnte. Und dann geschah es…«
Immer leiser war Marisas Stimme geworden. Tiefer Ernst lag auf dem feinen, edel geschnittenen Antlitz.
Die Baronin legte mit einer liebevollen, etwas mütterlichen Geste die Hand auf die schmale Schulter der jungen Frau.
»Es tut mir leid, wenn wir Schmerzliches berührten. Seien Sie versichert, es war nicht Neugier. Aber wer konnte ungerührt an dem Schicksal dieses Kindes vorübergehen?«
Marisa blickte in die gütigen Augen der Frau.
»Ich möchte ihn die Heimjahre vergessen lassen. Darum bleibe ich bei ihm, verzichte ich auf große Gastspielreisen. Er soll ein richtiges Zuhause, soll Geborgenheit spüren. Klaus ist sehr liebebedürftig.«
Marisa steckte die Bilder ein und wandte sich an die Baronin. Bevor sie aber etwas sagen konnte, schaltete sich Fürst Hasso ein:
»Ich möchte Ihrem Buben gern eine Freude machen! Bitte, liebes gnädiges Fräulein, darf ich Sie und den kleinen Kerl bald einmal abholen? Vielleicht wissen Sie, daß ich hier ein größeres Gestüt habe. Im Moment haben wir fast zwanzig Fohlen. Denken Sie, wie interessant das für den Buben sein wird. Bitte sagen Sie ja!«
Lebhaft unterstützte die Baronin den dringenden Wunsch des Fürsten. Marisa zögerte nur einen kurzen Augenblick, dann erklärte sie lächelnd:
»Ich glaube, solch eine verlockende Einladung darf ich im Interesse meines Jungen nicht ablehnen. Ich danke Ihnen für diese freundliche Einladung.«
»Und wann darf ich Sie abholen? Bitte bestimmen Sie und bitte bald!«
Die Baronin kannte ihren Hasso gar nicht wieder. Er mußte von dieser schönen, liebenswerten Künstlerin sehr stark beeindruckt sein.
Marisa, die ihren waren Namen nicht verraten wollte, meinte:
»Ist Ihnen der nächste Mittwoch recht? Aber bitte, nicht abholen! Ich fahre privat – und sogar sehr gern – einen alten, aber sehr geliebten Wagen. Darin machen wir oft unsere Streifzüge am Chiemsee. Sie müssen wissen, bei Klaus rangiert der Chiemsee direkt nach Pferden und Tieren!«
Marisa hatte inzwischen einen Diener gebeten, ihren Fahrer mit dem Wagen zu bestellen. Sofort erhob sich Fürst Hasso, um selbst den Professor zu unterrichten, falls er mitfahren wollte. Professor Wegner stand in angeregter Unterhaltung mit einigen Herren zusammen. Er war sofort bereit, Marisa zu begleiten und verabschiedete sich mit einer kleinen eleganten Verbeugung nach allen Seiten.
Nach einem fast herzlichen Abschied von der Baronin Gebert verließ Marisa, begleitet von Fürst Hasso und dem Professor, das gastliche Schloß.
Am Fuß der breiten Freitreppe verabschiedete sich Marisa vom Fürsten Lahrenfels-Dyssenburg. Ihr Wagen wartete schon, der gute Franz stand vorschriftsmäßig neben dem geöffneten Schlag.
»Ich danke Ihnen für die schönen Stunden, für Ihre Gegenwart, für Ihr – mein Wiegenlied. Bitte kommen Sie bald einmal wieder. Ich freue mich auf Mittwoch! Ich wünsche Ihnen eine gute und angenehme Heimfahrt. Gute Nacht!«
Lange noch stand Fürst Hasso und sah dem Auto nach, bis sich die Rücklichter in der weichen, dunklen Sommernacht verloren.
*
Ein zarter Dunst lag über dem Chiemsee, als Marisa mit ihrem Buben schon früh aufbrach – Richtung: Werdenfelser Land, zum Schloß Lahrenfels.
Am Tag vorher hatte Marisa die Baronin noch einmal angerufen und gefragt, ob es bei der Verabredung bleibe.
Stürmisch hatte Frau Gebert bejaht. Der Fürst hätte sich selbst um das Zimmer des Kleinen gekümmert. Er hätte so viel Spieltiere angeschleppt, daß das Kinderzimmer schon fast ein kleiner Zoo wäre.
»Es wäre schön, wenn Sie zum Frühstück hier sein könnten. Und bitte richten Sie sich für die Nacht ein. Die Fahrt ist anstrengend, besonders für den Buben!
Also dann, liebe Frau del Vana, bis morgen! Wir freuen uns schon sehr!«
»Wir uns auch! Ich muß dem Buben immer von den vielen kleinen Fohlen erzählen.«
Und nun waren sie gleich da. Klaus hatte meistens auf dem Rücksitz geschlafen, warm eingerollt in eine weiche Wolldecke, den Teddy im Arm. Still hatte Marisa die Fahrt durch das morgenfrische, sonnendurchflutete Land genossen. Eine freudige Erwartung erfüllte sie. Immer wieder fragte sie sich, woher ihr der Fürst so vertraut sein könnte. Nicht nur die ausdrucksvollen, sehr dunklen Augen. Nein, auch die Art, den Kopf zu halten, sein offenes, strahlendes Lächeln waren ihr irgendwie vertraut. Aber woher kannte sie das alles?
Kurz vor dem Schloß hielt Marisa an. Sie machte sich etwas frisch, kämmte die Locken, schaute kurz in den kleinen Spiegel und war zufrieden. Das hellgrüne Drindl mit der blütenweißen Bauernbluse, das zartgrüne Mieder mit den eingestickten weißen Margeriten, das passende hellgrüne Seidentuch – Marisa sah bezaubernd jung und mädchenhaft aus.
Dann kitzelte sie liebevoll Kläuschens kleine Stupsnase, um ihn zu wecken. Drollig krauste er das Näschen, blinzelte erst mit dem rechten, dann mit dem linken Augen und war hellwach. Aufgeregt krabbelte er aus seiner weichen warmen Hülle:
»Mami, wo ist Hottemätze? Täuschen will heiten!« verkündete er energisch.
Marisa lachte. »Wir sind gleich da, mein Kläuschen. Dann trinkst du zuerst etwas Milch, ißt ein Brötchen, und dann gehen wir zu den Pferden.«
Marisa kämmte seine wirren Löckchen, richtete sein rot-weiß kariertes Hemdchen, zog ihm seine roten Sandalen an, gab ihm einen liebevollen Klaps auf die pralle Rückseite im kurzen Lederhöschen, und fertig waren die beiden für ihren Besuch. Dann fuhren sie durch die breite Linden-Allee auf das im sommerlichen Blumenschmuck prunkende bezaubernde Schlößchen zu.
Klaus saß staunend auf dem Rücksitz. Was er sah, mußte er Teddy zeigen.
»Da, Teddylein, is eine Muhkuh! Wie macht Muhkuh?«
Teddy schaute den kleinen Mann aus blanken Knopfaugen fragend an. Kläuschen jubelte: »Mami, Teddy is noch so dumm! Weiß nich, wie die Muhkuh macht!«
Marisa lachte fröhlich auf.
»Nun, weißt du es denn? Wie macht die Kuh?«
Laut und dumpf tönte es hinter ihr: »Mu - u - u - h, Mu - u - uh!«
»Sehr schön, Klaus! Und wie bellt der Hund?«
Klaus überlegte kurz: »Wau - wau! Wau – wau!«
Und dann standen sie auch schon vor der breiten Freitreppe. Mit jungenhafter Freude, umsprungen von seinem braun weißen Jagdhund und einem kleinen, aufgeregt bellenden Rauhhaardackel, eilte Fürst Hasso die Treppe hinunter, immer zwei Stufen auf einmal nehmend. Sein schönes, männliches Gesicht leuchtete auf, als er Marisa erblickte, die ihrem Jungen aus dem Wagen half.
»Willkommen, ganz herzlich willkommen, liebe Frau del Vana!«
Fürst Hasso verneigte sich vor Marisa. Schlank und anmutig stand sie vor ihm, den aufgeregten, zappeligen Jungen an der Hand. Wieder versanken zwei Augenpaare ineinander, atemlos – fassungslos vor etwas unbeschreiblich Zartem, bis dem Bübchen die Zeit zu lang wurde. Er mußte sich bemerkbar machen: »Mami, Arm!« verlangte er energisch. Wie aus einem Traum erwachten die beiden Menschen. Lachend beugte sich der Fürst zu dem Kind nieder. Er fragte Marisa: »Darf ich?« Und dann nahm er Klaus huckepack auf seine breiten Schultern.
Ohne Scheu, laut kreischend vor Freude, saß Klaus hoch oben und hielt sich mit seinen kräftig zupackenden Fäustchen an Hassos Haarschopf fest.
Baronin Gebert stand auf der Terrasse und schloß Marisa herzlich in ihre Arme.
»Sie ahnen nicht, welche Freude Sie uns mit Ihrem Besuch machen! Mir ist, als wenn ein naher, vertrauter Freund zu uns gefunden hat. Ich habe Hasso lange nicht mehr so freudig und erwartungsvoll gesehen.«
Die Baronin nahm Marisa noch einmal in den Arm und gab ihr einen leichten Kuß auf die Wange. Mit gespreizten Beinchen, die Hände auf dem Rücken, stand Klaus vor der Baronin. Prüfend, wie nur in dieser Unbefangenheit Kinder schauen können, sah er sie an. Dann fragte er interessiert: »Bis du auch Doßma?«
Und er streckte seine braunen Ärmchen der Baronin entgegen, die ihn lächelnd auf den Arm hob. Einen Augenblick sahen sie sich an, die gütigen blauen und die klaren braunen Kinderaugen. Dann schlang er beide Ärmchen um den Hals der alten Dame: »Doßma lieb! Täuschen auch danz doll lieb!«
Beglückt hatte die Baronin die Zärtlichkeit des Kerlchens über sich ergehen lassen. Wie schon so oft wünschte sie, Fürst Hasso wäre glücklich verheiratet, und eine fröhliche, gesunde Kinderschar bevölkerte das große Schloß. Immer hatte in den letzten Jahren bei diesen Gedanken ein liebenswertes Geschöpf vor ihren geistigen Augen gestanden, grazil und mädchenhaft, mit lachenden große Augen und silberblondem Haar. Seit dem Konzert aber dachte sie immer an Marisa dabei. Sie spürte, welch tiefen Eindruck die bezaubernde Künstlerin auf den Fürsten gemacht hatte. Wenn doch nur dieses unheilvolle Hausgesetz nicht gewesen wäre! Es war ein Anachronismus in der heutigen Zeit.
Sie wurde in ihrem Gedankengang unterbrochen. Der Diener kam mit einem jungen Hausmädchen und servierte in schweren, bauchigen Silberkannen duftenden Kaffee, Tee und für Klaus köstliche Schokolade. Es wurde eine gemütliche Frühstücksstunde mit frischen Brötchen, knusprigem Toast, goldgelber Butter, westfälischem Schinken, Eiern und eingemachter Erdbeermarmelade. Zum Schluß rieb der Bub sein rundes Bäuchlein und meinte befriedigt:
»Meckt dut. Täus is satt! Nu heiten, Mami, ja?«
Marisa hob das Kind aus dem hohen Stühlchen, in dem Hasso als Kind schon gesessen hatte.
»Wir sind noch nicht fertig mit unserem Frühstück, Kläuschen. Du darfst aber schon etwas spielen. Hast du den beiden Hunden Pit und Peter schon deinen Teddy gezeigt? Schau, Pit ist der kleine Dackel, und Peter der große Jagdhund.«
Klaus nickte begeistert, klemmte seinen Teddy, der heute zur Feier des Tages eine rot-weiße Schleife um seinen dicken, kurzen Hals trug, unter das
Ärmchen und marschierte zielbewußt auf die beiden schlafenden Hunde zu. Unauffällig beobachteten die Erwachsenen, wie er vorsichtig versuchte, die Tiere zu wecken. Dann hockte er sich zu ihnen auf den Boden. »Doße Wauwau, das is Teddy!« sagte er leise.
Peter, der Jagdhund, riskierte ein Auge, riß die Schnauze weit auf, so daß man das kräftige Gebiß sehen konnte, gähnte, rollte sich wieder zusammen und schlief weiter.
Bei dem kleinen Pit hatte Klaus mehr Glück. Er war noch verspielt. Als das Kind sich dem Dackel zuwandte, wedelte er freundlich mit dem Schwanz, für Klaus eine Aufforderung, zu ihm hinzurutschen.
»Teine Wauwau, das is Teddy! Teddy ist danz lieb. Is teine Wauwau auch lieb? Teddy Wauwau steicheln!«
Und er nahm Teddys dicke braune Pfote und fuhr vorsichtig damit über Pits rauhes Fell. Dem machte das Spiel Spaß, er wedelte stärker, schlug mit seiner kleinen Pfote nach dem komischen Tier, das so nach Mensch roch, bellte fröhlich, und das schönste Spiel begann, woran sich schließlich auch Peter, der Jagdhund, beteiligte. Von da ab war es Peter, der den Teddy vorsichtig in seine Schnauze nahm und Klaus nachtrug, wenn er ihn mal irgendwo liegenlassen hatte.
Das Gespräch der drei Erwachsenen am Frühstückstisch war vorübergehend verstummt. Eine heiße Welle von Glück und Liebe stieg wieder in Marisa hoch, als sie ihren Jungen so unbefangen spielen sah. Alle drei verfolgten die anmutigen Bewegungen des Kleinen, sein liebevolles Geplapper mit dem Teddy und den zwei Hunden. Die Baronin sprach aus, was Marisa schon oft gedacht hatte.
»Wer mag der Vater des Kindes sein? Die Mutter haben Sie ja kennengelernt, wie Sie uns neulich erzählten.«
»Ja, eine sehr ernste, junge Frau mit schmalem Gesicht, dunkler Brille und sehr schönen Händen, die mir gleich auffielen. Ihr volles Haar trug sie ganz schmucklos gescheitelt und zu einem tiefen Knoten geschlungen. Ich hatte den Eindruck, daß sie sehr einsam war.«
»Sprach sie vom Vater des Kindes?« wollte die Baronin wissen.
»Ja. Er mußte ihr sehr viel bedeutet haben. Sie sprach mit Achtung – ja, auch noch mit Liebe von ihm.«
Der Kleine löste den Bann, der auf ihnen lag, bei dem Gedanken an das Schicksal eines tapferen jungen Menschen.
»Nu fätig? Nu heiten!« kommandierte er einfach.
Befreit lachend schwang Fürst Hasso den Knirps wieder auf seine Schultern. Ein schönes, kraftvolles Bild: der große, schlanke Mann, dessen dunkle Bräune durch den weißen Sommeranzug noch intensiver wirkte, das gesunde, übermütige Kerlchen auf seiner Schulter, von einer sehnigen, schlanken Männerhand mit dem schweren Wappenring gehalten.
Gelöst ging Marisa auf die beiden zu. Der weite grüne Dirndlrock umschmeichelte schmale braune Knie, die langen schlanken Beine steckten in weißen Sandalen.
»Welch schönes Paar – wie füreinander geschaffen!«
Die Baronin konnte den Blick nicht von dieser bezaubernden Gruppe wenden. Gern wäre sie mitgegangen, um auf der Koppel die Begegnung des Kindes mit den vielen Pferden zu sehen, aber leider hielten sie häusliche Pflichten zurück.
Ein Tag voll Sonne, Freude und Kinderjubel klang aus in einem milden Sommerabend voll Duft und Stille. Auf der sonnenwarmen Terrasse saßen die drei Menschen in schweigender Harmonie. Die gelben Bienenwachskerzen in schweren Silberleuchtern warfen hin und wieder ihr warmes Licht im leichten Lufthauch über den Tisch. Sie ließen die roten, geschliffenen Kristallrömer aufglühen und vielfach funkeln.
Marisa war schöner denn je. Das schlichte, mattgelbe Abendkleid umspielte in weichem Fall die schlanke, ebenmäßige Gestalt. Um den anmutigen Hals und die braunen Arme trug sie einen dunkelbraun leuchtenden, kostbaren alten Bernsteinschmuck, den man in dieser Vollendung selten sah. Er war die Hochzeitsgabe ihres Urgroßvaters an seine geliebte, blonde Frau aus dem Norden gewesen. Lässig ruhten ihre edelgeformten Hände im Schoß. Ihre Haltung war weich und entspannt, ganz dem unbeschreiblichen Zauber des Abends hingegeben. Der Duft der Wachskerzen mischte sich mit dem der vollerblühten Rosen.
Der Fürst konnte den Blick nicht von ihr lösen. Da fragte Marisa leise:
»Der Tag war so wunderbar. Ich danke Ihnen beiden! Darf ich Ihnen ein kleines Gastgeschenk machen? Es würde gut in diese Abendstimmung passen.«
Fürst Hasso sah sie lange an. In seinen dunklen Augen lag Verehrung, scheue Zärtlichkeit und…
»Das war mein stiller Wunsch. Sie haben ihn erraten. Ich danke Ihnen, Marisa.«
Über den Bergen war der Vollmond aufgegangen. Sein klares, silbernes Licht überflutete still das Werdenfelser Land. Marisa erhob sich und trat an die Brüstung, umgeben von wilden, rankenden Rosen. Fürst Hasso hatte die Kerzen gelöscht. Feine Rauchwölkchen stiegen auf.
Marisa schaute über das schweigende Tal, dachte an ihren süßen Buben und sang:
Schlaf ein, mein liebes Kind!
Draußen weht der Abendwind.
Und es leuchten schon die Sterne
weit in dunkle Himmelsferne.
Su – su – su.
Als die letzte Strophe wie ein Hauch verklungen war, stand Hasso auf, ging auf Marisa zu, küßte wortlos und innig ihre Hände und führte sie zu ihrem Platz zurück. Die Baronin war bewegt. Sie streichelte Marisas Hand und sagte:
»Ihre Stimme ist ein großes Gottesgeschenk. Diesen Abend werde ich nicht vergessen!«
Leise, fast unhörbar murmelte Fürst Hasso:
»Nicht nur die Stimme ist ein Gottesgeschenk.« Trotzdem hatte es die Baronin gehört, und es erfüllte ihr Herz mit Hoffnung.
Nach einem erfrischenden Ritt am nächsten Morgen durch die taufunkelnden Wiesen und Wälder in der frühen Morgensonne, Klaus vorne im Sattel des Fürsten, gab es ein gemütliches Frühstück zum Abschied. Dann packte Marisa ihren Klaus samt Teddy, neuem Bilderbuch und einem süßen schwarzen Fellfohlen von Hasso, das Klaus an einem Band ziehen konnte, in ihren alten Wagen, und nach herzlichem Abschied fuhren Mutter und Sohn heimwärts.
*
Die Tage vergingen, rundeten sich zu Wochen. Marisa hatte Wort gehalten und alle weiteren Tourneen, die ihr angeboten wurden, abgelehnt.
Jetzt saß sie mit Mutter und Sohn in einem kleinen Fischerdorf an der Nordsee, braun wie eine Haselnuß, vergnügt und zufrieden. Neben ihr im Strandkorb saß Gräfin Langenberg, genauso vergnügt und zufrieden. Vor ihnen im Sand, nur mit einem Spielhöschen in leuchtendem Gelb gekleidet, spielte Klaus, baute Burgen und gruppierte seine Tiere, ließ sie laufen, brüllen, miauen, wiehern und war voll beschäftigt. Der kleine Klaus war bei den Gästen bekannt, alle mochten den reizenden, kleinen Kerl. Wenn er mit seiner Mami oder Großmama an den Strand kam, seinen kleinen Kastenwagen hinter sich herziehend, bepackt mit Teddy und seinen immer zahlreicher werdenden Tieren, folgten ihnen wohlwollende Blicke.
Da Marisa erst sehr spät für die Saison einen Seeurlaub buchen konnte, mußten sie mit einer kleinen, sehr gemütlichen, aber einfachen Pension vorliebnehmen, weil alles längst belegt war. Um sich frei und ungezwungen bewegen zu können, hatte sich ihre Mutter schlicht als Frau Langenberg mit Tochter und Enkel eingetragen. Niemand wußte, daß sie die im In- und Ausland berühmte Sängerin war. Niemand ahnte die Zusammenhänge zwischen ihr und Klaus. Zum erstenmal in ihrem so behüteten Leben traf sie hier auf Neid, Gehässigkeit und kleinliches Denken.
Marisa war trotz ihrer einfachen Natürlichkeit eine auffallend schöne, strahlende Persönlichkeit. Das einfachste Sommerkleidchen wirkte an ihr elegant. Die Sicherheit ihres Auftretens wurde ihr von weniger begünstigten Geschlechtsgenossinnen als arrogant und hochmütig ausgelegt.
In der Pension gab es einige Damen, die mit Gewalt die Illusion ihrer Jugend und Schönheit festhalten wollten. Sie hatten so sehr gehofft, endlich in diesem Urlaub den Mann fürs Leben, die gute Partie, zu finden! Am Scheitern ihrer Hoffnungen gaben sie Marisa die Schuld, die die Blicke auf sich zog, die sich nett und ungekünstelt mit jungen und älteren Herren unterhielt. Sie ließ sich mit selbstverständlicher Anmut kleine Hilfeleistungen gefallen, einfach weil sie es gewöhnt war, daß man als Dame kleine Handreichungen annahm.
Marisa lächelte darüber, sie konnte die Engstirnigkeit dieser Frauen nur bedauern. Selbst als sich eine scheinbar sehr verbitterte, enttäuschte Dame, deren Begleiter unglücklicherweise bewundernd von Marisa gesprochen hatte, sie bissig anfuhr:
»Fräulein Langenberg mit Sohn! Haha, daß ich nicht lache! Worauf bilden Sie sich wohl soviel ein? Arrogante Person!«
Kopfschüttelnd ging Marisa weiter. Sie überlegte, ob sie dieses Fräulein Benz irgendwie beleidigt hatte. Sie konnte sich nicht erinnern, je mit ihr gesprochen zu haben. Sie vergaß den kleinen Zwischenfall. Die Tage waren weiter sonnig, ihre kleine Familie fröhlich und zufrieden.
Klaus hatte viele Freunde am Strand. Sein bester Freund aber war Jens, der jüngste Sohn der Pensionsbesitzer. Jens war auch ein Tiernarr wie Kläuschen. Um ihm eine Freude zu machen, ließ Marisa ihn schon mal mit Jens – stolze sechs Jahre alt, strohblond, knallblaue Augen, Sommersprossen – spielen, nahm ihn auch öfter mit zum Strand. Dann genoß er selig Schokoladeneis oder Limonade und war abwechselnd ein wieherndes Pony, eine ziemlich kläglich miauende Katze oder ein schreiender Esel. Wenn Klaus ihn rief, dann dauerte es nicht lange, und Jens war da. Marisa fragte sich, wenn sie das Lachen und Jubeln der beiden hörte, ob ihr Junge wohl Spielgefährten vermißte. Schließlich war er auch vom Heim her immer Kinder gewöhnt gewesen. Wieder hörte sie das klare
Stimmchen ihres Buben:
»Hens, mach Wauwau!«
Dann Jens: »Ich heiße Jens! Wie oft soll ich dir das noch sagen, hm? Sag mal erst: Jens!«
Aus leuchtenden Augen starrte Klaus begeistert auf seinen großen Freund. Willig versuchte er es:
»J - j… Hens!«
Da konnte Jens nur noch mit dem Kopf schütteln und mitleidig lächeln.
»Ach, laß nur! Du bist eben noch zu dumm! Komm, wir spielen.«
»Au fein, pielen! Täus is Hottematz, Hens is Wau - wau, ja?«
Der Frieden war wieder hergestellt. Marisa lächelte. Beim Spiel der Kinder hielt sie sich zurück, doch am Abend fragte sie:
»Jens, morgen ist Kinderfest am Strand! Möchtest du mit uns gehen?«
Der Junge sah etwas bekümmert drein und schüttelte traurig den Kopf: »Geht nicht, muß arbeiten!«
»Du mußt arbeiten? Was denn?« fragte Marisa überrascht.
»Ziegenstall und Kaninchenstall. Papa hat frei. Ich muß helfen.«
Am nächsten Tag stieg das von den meisten Kindern sehnlichst erwartete Kinderfest. Bunte Luftballons stiegen immer wieder in den wolkenlosen blauen Sommerhimmel. Die Feuerwehrkapelle spielte unermüdlich fröhliche Kinderlieder und leichte Tanzweisen. Ein kleines Kinderkarussell drehte sich nach eigener Musik, kleine braune Ponys trugen unentwegt ihre leichten kindlichen Lasten durch den Sand, allen voran natürlich der kleine Klaus. Selig saß er auf dem Pferdchen. Er wollte nichts anderes, nur reiten. Unermüdlich ging Marisa neben ihm her. Zeigte ihm – wie auch schon auf Burg Langenberg – wie er sitzen und die Zügel halten mußte.
Marisa war immer wieder überrascht über die Selbstverständlichkeit, mit der der Zweijährige auf dem Pferd saß. Er hätte wirklich ein Kind ihrer Familie sein können! Viele Amateurfotografen knipsten das schöne Bild.
Marisa, in einem grünen Leinenkleid, schlank und leicht neben dem Pony gehend, auf dem ihr Kläuschen in einem einstmals weißen Spielanzug saß und fröhlich sein Pferdchen anspornte, lachte glücklich.
Da war plötzlich ein leises Klicken. Erschrocken blickte Marisa auf und direkt in eine Kamera. Sie fürchtete um ihren Urlaubsfrieden. Sie sah einen zufrieden grinsenden Reporter, der ihr freundlich zunickte und fröhlich rief: »Danke, Marisa. Prima Aufnahmen!« Marisa näherte sich ihm bittend: »Bitte, lassen Sie mir doch einmal dieses bißchen Anonymität. Wir fahren übermorgen, veröffentlichen Sie es meinetwegen dann. Bitte!«
Der Reporter, ein frischer junger Mann mit lustigem Lausbubengesicht, zögerte einen Augenblick.
»Bitte, verstehen Sie mich. Dieses hier ist mein Beruf, und das da im Kasten ist ein Knüller! Seien Sie mir nicht böse! Im übrigen bin ich ein großer Verehrer von Ihnen, gnädige Frau! Und bitte nicht böse sein! Was macht Ihr kleiner Sohn? Hab damals die Fernsehsendung gesehen. Geht’s ihm gut?«
Marisa lachte glücklich.
»Sehr gut geht es ihm. Er macht mir sehr viel Freude. Auch meiner Mutter. Überzeugen Sie sich selbst!« Marisa drehte sich um und rief ihren Sohn. Weit und breit kein Klaus. Aufgeregt rief Marisa:
»Klaus! Kläuschen, wo bist du? Komm schnell!«
Nichts! Keine Antwort.
Marisa glaubte, die Stimme des geliebten Kindes zu hören. Sie lief ein paar Schritte, rief wieder! Nichts! Der junge Reporter, der bei aller Hilfsbereitschaft aber auch eine gute Story witterte, wandte sich an Marisa:
»Nun mal ganz ruhig, gnädige Frau! Verschwunden sein kann er nicht. Im Wasser ist er auch nicht, das wird immer beobachtet. Wir müssen systematisch den Strand absuchen. Er wird friedlich irgendwo sitzen und spielen. Außerdem benachrichtigen wir die Strandwacht. Sie soll ihn ausrufen. Welchen Namen trägt der Kleine?«
»Klaus Langenberg. Strandpension Möwe! Bitte, kommen Sie!«
Beide eilten, in Strandkörben und verlassenen Sandburgen suchend, am kinderreichen Strand entlang. Hinter einem Strandkorb versteckt, sah Fräulein Benz, die Mitbewohnerin aus der Pension, ihnen nach. Ein hämisches, schadenfrohes Lächeln lag um ihre schmalen Lippen. Dann schlenderte sie langsam auf Marisa zu.
»Sie sollten lieber besser auf Ihr Kind achtgeben, als sich überall in den Vordergrund zu spielen. Dann ist so ein armes Kind natürlich lästig. Schämen Sie sich!«
Marisa war wie gelähmt. Ratlos sah sie den jungen Mann an: »Was hat sie gesagt?« Dann wandte sie sich wieder der Frau zu: »Wissen Sie, wo mein Kind ist?«
Fräulein Benz wurde unsicher: »Suchen Sie doch! Sie haben ja einen Begleiter, der Ihnen hilft!« Sie lächelte häßlich.
Da klickte der Auslöser der Kamera. »So«, meinte der Reporter befriedigt, »diesen Giftzwerg wollen wir mal fürs Familienalbum auf die Platte bannen. Sie können sich morgen in der Tageszeitung bewundern!« rief er Fräulein Benz zu. »Aber so schön wie die gnädige Frau werden Sie nicht! Das kann ich Ihnen leider schon jetzt sagen!«
Allmählich hatte sich ein Menschenauflauf gebildet. Es hatte sich herumgesprochen, daß das kleine Kläuschen verschwunden war. Alle seine Freunde meldeten sich und wollten suchen helfen. Nun war der Reporter Hans Becker in seinem Element. Er organisierte verschiedene Suchtrupps, verabredete ein Zeichen, wenn sie Klaus gefunden hatten, und bestimmte einen Strandkorb als Zentrale. Darin sollte Marisa warten.
Marisa war wie erstarrt. Sie hatte nur einen Gedanken: Klaus, mein lieber kleiner Klaus! Wie glücklich war sie in den Monaten mit ihm gewesen. Wie liebte sie sein Lachen, seine Zärtlichkeiten, seine jubelnde, stürmische Freude! Sollte das alles vorbei sein? So grausam konnte Gott doch nicht sein! Mit einem Schrecken dachte sie an ihre Mutter. Sie war nicht mitgegangen zum Strandfest, um Briefschulden zu erledigen.
Immer wieder sah sie in Gedanken das lachende Kinderköpfchen vor sich. Sah den Jungen spielen, reiten, begeistert im Wasser strampeln, der Großma oder sich auf den Schoß klettern, sah ihn mit Jens Burgen bauen. Sie hörte wieder sein helles Jauchzen, wenn er eine Muschel gefunden hatte:
»Oh, Mami, tomm dans snell. Oh, söne Mussel!«
In tiefen Gedanken saß Marisa im Strandkorb, Zeit und Ort vergessend. Die ganze Freude der vergangenen Monate spulte wie ein glücklicher Film an ihr vorbei. Da! Sie glaubte zu träumen, hörte sie da nicht ein geliebtes Stimmchen?
»Henz, zu Mami dehn! Wo ist meine Mami?«
Marisa blieb bewegungslos sitzen. Sie hatte Angst, der glückliche Spuk zerrann. Aber nein! Das Stimmchen wurde unsicher, ängstlich, gleich würde es Tränen geben:
»Mami! Mami! Täus will zu seiner Mami!«
»Täuschen, mein Liebling, hier bin ich!« Glücklich sprang Marisa auf und eilte dem Ruf nach. Da sah sie ihren Jungen! Er saß stolz auf Jens’ kleiner Mistkarre. Oben auf dem Ziegen- und Kaninchenmist, nur durch eine alte Zeitung notdürftig geschützt! In einer Hand hielt er den Zügel für das Pferdchen Jens, in der anderen ein Stück Kuchen, im Arm Teddy und ein Steifftierchen. Als er Marisa sah, wollte er schnell heruntersteigen und rief:
»Hüh, Hottematz. Da ist meine Mami! Täus will hunter! Hens, Taus hunter!«
Das klang sehr energisch. Mit einem Satz war Marisa bei ihm und hob ihren Buben, der sich fröhlich in ihre weitgeöffneten Arme warf, herunter. In der ersten Sekunde empfand Marisa nichts als die ungeheure Erleichterung und Freude, ihren Klaus gesund vor sich zu sehen. Aber in der zweiten Sekunde stieg ihr ein äußerst penetranter Geruch in die Nase. Sie hielt den Buben hoch, schnüffelte etwas. Sollte ihm ein Malheur passiert sein? Aber nein! Klaus krähte vergnügt:
»Stinkt sön, Mami, nich? Hens sagt, is Mist. Stinkt sön wie Stall!«
Und begeistert hielt er ihr sein schmutziges Händchen vor die Nase, was sie bei aller Liebe nicht sehr schön fand.
Da war wieder das leise Klicken der Kamera zu hören. Die Suchtrupps hatten den kleinen Mistwagen mit Pferdchen Jens und Kutscher Klaus gesehen und waren zurückgekommen. Der freundliche junge Reporter Hans Becker nutzte die Gunst der Stunde. Er fotografierte, was ihm auch nur einigermaßen interessant erschien: die vor Glück strahlende Marisa, dann die Marisa mit krausem Näschen, die argwöhnisch das kleine Hinterteil ihres Sohnes untersuchte, das vergnügte Kerlchen, mit dem eher schwarzen als weißen Anzug, den gefüllten Mistwagen mit der alten, verrutschten Zeitung und dann Jens! Bedrückt und unglücklich stand er da, den strohblonden Kopf gesenkt, vor Aufregung den Finger in der Nase und wartete auf ein Donnerwetter, das ja kommen mußte. Und dann zu Hause? Trotz ihrer Sorgen, die sie ausgestanden hatte, tat Marisa der verstörte kleine Jens leid! Sie wandte sich ihm zu, hob das Kinn empor und fragte ihn freundlich:
»Nun erzähl du mir mal, wohin du so schnell mit Klaus verschwunden bist. Du bekommst keine Strafe, mußt es mir aber genau erklären, ja?«
Jens nickte erleichtert:
»Ja, das war nämlich so. Ich wollte Klaus doch nur zeigen, wieviel Mist ich aus dem Stall geholt hatte. Dann wollte Klaus mitgehen, aber das ging doch nicht. Ja, und dann kam eine Frau, die wohnt auch bei uns, und hat Klaus auf den Wagen gesetzt und gesagt, wir sollten schnell wegfahren, sie wollte es seiner Mutter sofort sagen. Ja, und dann sind wir noch etwas spazierengefahren. Ich war Pferd. Klaus hat sooo gelacht!«
Jetzt sah er Marisa treuherzig aus seinen himmelblauen Augen an:
»Ich war ganz schrecklich vorsichtig, bestimmt!«
Die Erwachsenen schauten sich fassungslos an. Wer konnte das gewesen sein?
Aus der hinteren Reihe der Zuschauer und Helfer löste sich langsam eine Gestalt. Jens straffte sich, dann flog er wie ein Pfeil auf die Person zu!
»Komm, du mußt sagen, daß du Klaus auf den Wagen gehoben hast! Du darfst nicht einfach weggehen!« Er wollte die Person festhalten, aber da schlug sie ihm unbeherrscht auf die Finger:
»Du unverschämter Bengel! Läßt du mich gefälligst mit deinen schmutzigen Pfoten los! Du lügst ja! Ich habe euch überhaupt nicht gesehen! Sofort entschuldigst du dich!«
Verstört ließ Jens sie los.
»Aber Sie haben doch…«
»Nichts habe ich! Aber ich werde gleich zu deinen Eltern gehen und mich über deine Lügerei beschweren, du verlogener Bengel! Jetzt mach, daß du wegkommst!«
Die Anwesenden waren dem kurzen Gespräch interessiert gefolgt. Sie hatten nicht mehr an den pfiffigen Reporter gedacht, der im Hintergrund stand und alle fotografierte. Besonders die Szene mit Jens und der unbeherrschten Frau schien ihn sehr zu interessieren. Dann grinste er vergnügt. Als er die schmutzige, fleckige Zeitung aus dem kleinen Mistwagen nahm, fragte er den jetzt völlig verstörten Jens freundlich:
»Hör mal, mein Junge, wer hat denn diese Zeitung auf den Mist gelegt? Nun mal ganz ruhig, es geschieht dir ja nichts!«
Da antwortete das Kind mit scheuem Blick auf die Person:
»Die Frau! Ich weiß es ganz genau.«
Da klappte Hans Becker seelenruhig die Zeitung auseinander und las dann laut vor:
»Kölner Stadtanzeiger.« Dann drehte er sie etwas seitlich und las weiter: »Frau Maria Benz, z.Z. Nordseebad L…, Strandpension Möwe.«
Um das Strandfest nicht so abrupt und mit diesem Mißklang zu beenden, schlug Marisa vor:
»Wie wäre es, wenn wir jetzt zum Abschluß dieses Strandfestes alle zusammen eine Polonäse machten? Unsere gute Feuerwehrkapelle ist noch da. Wer ist für eine kleine Polonäse am Strand, durch die Strandkörbe und Burgen?«
Mit lautem Hallo und viel Begeisterung wurde der Vorschlag angenommen. Alle waren froh, den bedrückenden Zwischenfall der Kinder wegen, die sich lange auf ihr Fest gefreut hatten, so überbrücken zu können. Es wurde schließlich eine sehr vergnügte Polonäse, ein lustiger Abschluß. Marisa mußte mit Klaus den Anfang machen, mit ihrem nach Stall duftenden Kläuschen. Als sie dann den Ablauf des Zuges überlegte, sah sie plötzlich Jens in seiner Stallkluft abseits stehen, mit sehnsüchtigen Augen die Vorbereitungen verfolgend. Da rief Marisa:
»Komm, Jens, du gehst mit Klaus und mir. Wir drei machen den Anfang. Wo ist denn Herr Becker?«
»Hier!« rief es von vorne und wieder klickte es. »Ich bemühe mich, der Nachwelt möglichst viel von Ihrer Schönheit zu erhalten. So, jetzt noch Sie und die so lieblich duftenden Knaben! Wunderbar! Wenn mein Chef da nicht ein paar Extrascheinchen lockermacht!«
Marisa mußte lachen. »Ich wollte Sie gerade einladen, mit uns dreien den Reigen zu eröffnen. Schade, daß Sie keine Zeit haben!«
Vor Begeisterung und echter Freude blieb Hans Becker das Wort im Hals stecken, er war sprachlos!
»Ich soll wirklich…? Ich soll zusammen mit Ihnen die Polonäse anfangen? Das ist ja eine Wucht! Das muß unbedingt fotografiert werden! Wer kann wohl mit meinem Apparat umgehen? Nur zwei bis drei Bildchen?« Er murmelte leise vor sich hin: »Marisa del Vana und der kleine Reporter Hans Becker eröffnen eine Polonäse! Ich kann’s nicht glauben.«
Inzwischen hatte sich ein Amateurfilmer gemeldet, der den gleichen Apparat hatte wie Hans Becker.
Und dann zog die fröhliche bunte Schar – die Kinder mit Fähnchen und Luftballons – über den Strand, ein einfaches, kindliches Vergnügen, aber vielleicht gerade deshalb eine Befreiung nach dem Erlebten.
Als sich der lange Zug zum Schluß wieder am Ausgangspunkt zusammenfand, bildeten alle einen Kreis. Die Kapelle intonierte: »Ihr Brüder, eine gute Nacht!«
Alle reichten sich die Hände und sangen. Plötzlich ertönte eine wunderbare strahlende Frauenstimme, die ihre Fülle, ihren Glanz nicht länger zurückhalten konnte. Und als sie zum Schluß sang:
Gott mag es lenken,
Gott mag es schenken,
er hat die Gnad’!
da sang sie allein. Still und andächtig lauschten die Erwachsenen, viele von ihnen falteten die Hände. Sie waren in dieser Stunde gläubig und dankbar.
*
Nun lagen auch die Ferien an der See schon wieder einige Wochen hinter ihnen. Marisa und ihre Mutter dachten gern an die Tage zurück. Manchmal dachte Marisa auch noch an den verzweifelten, späten Gast, der zaghaft an ihre Zimmertür geklopft hatte: Fräulein Benz! Verweint, mit zerlaufener Wimperntusche, zerstörtem Make-up, bat sie um eine ganz kurze Unterredung. Höflich, aber zurückhaltend gewährte Marisa sie ihr. Und dann war es aus dem ältlichen Fräulein herausgeströmt, alle Bitterkeit, Mißgunst, immer wieder die Enttäuschungen eines liebeleeren Lebens. Viel Schuld trug sie selbst. Sehr viel aber auch eine harte, lieblose Jugend. Und dann war Marisa gekommen, die gerade so war, wie sie selbst gern gewesen wäre. Sie hatte Marisa gehaßt.
»Bitte, verzeihen Sie mir«, sagte sie schluchzend. »Ich sehe mein Unrecht ein. Ich habe mich dann so geschämt. Es war mir eine Lehre. Wer Liebe will, muß erst mal Liebe geben. Ich glaube, Ihr Lied hat mich auch aufgerüttelt. Sie haben es so wunderbar gesungen. Sind Sie Sängerin?«
Mit freundlichen Worten hatte Marisa Fräulein Benz schließlich beruhigt. Am nächsten Morgen war sie abgefahren. Für jeden der beiden Jungen hatte sie eine große Tafel Schokolade hinterlassen. Sie hatte Marisa zum Schluß doch leidgetan.
Marisa saß in ihrem Musikzimmer und übte für ihre Verpflichtung in München die »Marzelline« in Beethovens »Fidelio«. Da kam der Diener Franz und bat sie an das Telefon. Es war ihre Konzertagentur in München. Nachdem einige berufliche und geschäftliche Dinge besprochen worden waren, bat man sie, Fürst Lahrenfels anzurufen.
Marisa war überrascht über das warme Gefühl der Freude und Erwartung, das in ihr hochstieg. Deshalb rief sie sofort an. Sie wurde mit Frau von Gebert verbunden. Selbst durch den Draht spürte Marisa die Freude der Baronin über ihren Anruf.
»Liebe Frau del Vana, wir haben so lange nichts von Ihnen und Ihrem kleinen Goldstück gehört. Wie geht es Ihnen und Ihrer Familie?«
Marisa erklärte in kurzen Worten ihre Abwesenheit. Sprach von ihren Ferien an der Nordsee, ihrer Arbeit für die Wintersaison in der Oper in München.
»Liebe Frau Marisa, trotz Ihrer Arbeit möchte ich Sie aber ganz, ganz herzlich für ein etwas verlängertes Wochenende zu uns bitten! Denken Sie, ich werde Sonntag fünfundsechzig Jahre alt. Da wünsche ich mir nur eins: Ihren lieben Besuch. Und den Buben natürlich! Ich würde mich auch sehr freuen, wenn Ihre Frau Mutter Sie begleiten würde. Bitte, sagen Sie ja, kommen Sie!«
Marisa überlegte nicht lange! Sie freute sich herzlich über die liebenswürdige Einladung und sagte es der Baronin auch.
»Wir beide, der Bub und ich, wir kommen gern. Meine Mutter ist bei einer alten Freundin im Salzburgischen. Sie bleibt noch einige Zeit dort. Sie verbringt jedes Jahr ihren Septemberurlaub dort. Also, liebe Baronin, ich freue mich aufs Wochenende.«
Es wurden ein paar sehr schöne Tage, ein herrliches Wochenende. Aber dann…
Als sie mit ihrem kleinen alten Wagen am Schloß ankamen, mußte der Fürst schon auf sie gewartet haben. Ehe Marisa sich bemerkbar machen konnte, kam Hasso in langen Sätzen die breite Freitreppe herunter, begrüßte Marisa mit herzlicher Freude und schwang Klaus auf seine Schultern. Der nachfolgende Diener fuhr den Wagen in die Garage und kümmerte sich um das Gepäck.
»Es war sehr schade, Frau Marisa, daß ich nicht wußte, wo Sie geblieben waren. Ich habe sehr viel an Sie gedacht. Als ich aus der Zeitung von Ihrem Aufenthalt an der See erfuhr, da war es schon zu spät, Sie waren schon wieder abgereist, wie man mir sagte. Schade! Ich war zu der Zeit auf meinen Gütern in Westfalen. Von da bis zur See ist es nicht weit.«
Marisa lächelte in der Erinnerung an das Kinderfest.
»Ja, das Kinderfest! Noch heute muß ich lachen, wenn ich an meinen Buben auf der Mistkarre denke. Aber es war schön, sehr schön – und ganz anonym! Herrlich?«
»Ja, bis zum Schluß, wo dann dieser pfiffige Reporter Marisa del Vana entdeckte. Seine Story war gut und amüsant geschrieben. Auch die Bilder waren prächtig. Ich habe doch laut gelacht, als ich das Foto von dem stolzen Mistwagenkutscher Klaus sah. Zu gern hätte ich mich mit Ihnen zusammen darüber gefreut! Prima war auch das letzte Bild, wo er mit Ihnen und den »duftenden«, aber sehr vergnügten Jungen die Polonäse anführt.«
Hasso sah Marisa lange an. Dann sagte er leise:
»Da habe ich ihn sehr beneidet!«
Oben auf der Treppe stand wieder die Baronin Gebert. Mit weit geöffneten Armen ging sie auf Marisa zu und schloß sie herzlich in die Arme, der Bub erhielt ein kleines Küßchen auf das pralle Bäckchen.
»Wie ich mich freue, Sie und den Buben hier zu haben! Wir haben uns viel zu lange nicht gesehen. Aber nun erst einmal ein gutes Frühstück, meine Lieben!«
Schnell kletterte Klaus in sein hohes Stühlchen. Als Hasso helfen wollte, sagte er nur:
»Tann alleine!«
Aber dann durfte der Fürst dem Knirps doch das große bunte Kinderlätzchen umbinden. Klaus jubelte vor Freude, als er das darin eingewebte Bild sah:
»Oh, Mami, tuck, Hottematz und Mami Hottematz! Sön!! Dleich heiten?«
Fragend sahen die dunklen Kinderaugen Fürst Hasso an.
»Aber klar, mein Junge! Dein Hottematz wartet schon auf seinen kleinen Reiter. Aber zuerst mußt du essen, damit du auch Kraft hast und die Zügel halten kannst!« Fast liebevoll betrachtete Fürst Hasso das bildschöne, frische Kindergesicht.
»Wo sind deine Hunde?« fragte Klaus und blickte suchend umher.
Fürst Hasso lachte laut:
»Ja, weißt du, ich hatte vergessen, ihnen zu sagen, daß du heute kommst. Sie liegen auf der Wiese in der Sonne. Wir besuchen sie nachher, ja?«
Mit vollen Backen kauend, nickte der Bub zufrieden. Dann sah er tröstend seinen Teddy an.
»Wir dehn dleich zu die Hünde, Teddy! Dleich, wenn Taus satt ist!«
Aber auch das gemütlichste Frühstück hat mal ein Ende.
Liebenswürdig fragte Marisa die Baronin:
»Sie haben sicher noch Vorbereitungen für Ihren Geburtstag zu treffen, Baronin. Bitte lassen Sie mich Ihnen helfen. Ich tue es sehr gern.«
Da wehrte Frau von Gebert aber ganz entschieden ab.
»Meine liebste Marisa, alle Vorbereitungen sind getroffen. Es ist genügend Personal auf Lahrenfels. Und zudem habe ich mir einmal einen Geburtstag nach meinem Geschmack gewünscht: ganz unter uns, nur mit Ihnen und dem Buben! Schauen Sie, seit dem Tod meines sehr geliebten Mannes habe ich mich nicht mehr so auf meinen Geburtstag gefreut wie heuer! Hab’ Sie halt sofort in mein altes Herz geschlossen.«
Die Baronin sah Marisa eigenartig lächelnd an.
»Ja, es war Liebe auf den ersten Blick! Und wenn Sie mir ein großes Geschenk machen wollen, würde ich bitten, kommen Sie öfter, Marisa!«
Tief berührt von der Freundschaft, die ihr hier in schlichten Worten geschenkt wurde, beugte sich Marisa über die Hand der Baronin und küßte sie.
»Ich danke Ihnen für Ihre lieben Worte, Baronin. Bitte glauben Sie mir, daß ich sehr gern zu Ihnen komme. Aber ist der Fürst auch damit einverstanden?«
Frau von Gebert sah Marisa wortlos an. Dann sagte sie nur:
»Dummchen! Er meinte sofort, als ich ihm meinen Geburtstagswunsch erzählte, das wäre meine beste Idee der letzten Jahre gewesen!«
Beide Damen lachten.
Inzwischen war Klaus das Gespräch zu lang geworden. Er ging zu Fürst Hasso in das Zimmer, schob sein warmes, etwas klebriges Händchen vertrauensvoll in die große sehnige Hand des Fürsten. Er schaute auffordernd zu ihm auf:
»Tomm, wir dehn? Wir fei doßen Männer!«
Den Grafen durchrieselte ein warmes, väterliches Gefühl.
»Du hast recht, mein Kleiner! Wir zwei großen Männer gehen jetzt zu unseren Pferden und Hunden. Hast du auch deinen Teddy?«
Immer wieder betrachtete Hasso den Buben, wie er versuchte, mit ihm Schritt zu halten. Ja, zwei große Männer! Solch einen Sohn wünschte er sich. Dieses Kind könnte er bestimmt wie ein eigenes Kind lieben, aber es durfte nicht sein – die furchtbaren, sinnlosen Hausgesetze! Sollte denn zum zweitenmal sein Lebensglück daran zerbrechen?
Auf einmal war ihm das kindliche Geplapper wie eine fröhliche Begleitmusik zu einem dunklen, schicksalhaften Motiv. Da nahm er den jubelnden kleinen Kerl hoch, warf ihn in die sonnenflirrende Luft und fing ihn mit starker Hand wieder auf. Bübchens Begeisterung kannte keine Grenzen. Er schrie immer wieder:
»Mehr! Mehr! Höcher! Noch höcher!« Bis beide zum Schluß atemlos, lachend und verschwitzt auf der Wiese saßen und sich ausruhten.
»Das war doll sön!« sagte Klaus mit einem glücklichen Seufzer. Hasso strich ihm liebevoll über die feuchten wirren Haare.
»Das war es auch, kleiner Mann!«
Strafend schauten ihn die dunklen Augen an.
»Nicht teiner Mann, doßer Mann!«
*
Nach dem leichten, sommerlichen Mittagessen, als Klaus mit seinem Teddy im Arm sein Mittagsschläfchen hielt und auch die Baronin sich zurückgezogen hatte, schlug Hasso Marisa einen Spaziergang oder einen Ritt vor. Sie entschied sich für einen Ritt durch den mittagsstillen Wald. Kurz darauf trafen sie sich vor dem Stall.
Schlank und jung, in tadellos sitzender Reithose, leichter weißseidener Hemdbluse, weichen schwarzen Reitstiefeln und der klassischen schwarzen Reitkappe, schritt sie anmutig auf ihn zu. Marisa sah Fürst Hasso gern im Reitdreß, den er mit der gleichen lässigen Eleganz trug wie den Frack. Sein schwarzer Hengst und ihr rotbrauner Fuchs waren gesattelt und scharrten ungeduldig mit den Hufen. Beide Pferde bekamen ihr Stückchen Zucker, der Fürst half Marisa in den Sattel und ab ging’s.
Nach kurzer Zeit nahm der würzig duftenden Wald sie auf.
Stille war um sie, es gab nur die Laute der Natur: ein Vögelchen sang leise vor sich hin, irgendwo rief ein Kuckuck, Tannenzapfen fielen hin und wieder mit leichtem Geräusch zu Boden, im Unterholz knackte es, wenn ein aufgeschrecktes Häschen sich ins Gebüsch flüchtete, ein Zweig brach durch einen Auftritt. Sonst war Stille und Frieden um die beiden Menschen, deren Blicke ineinander versanken und sich nur schwer wieder voneinander lösten. In einer Lichtung hielt der Fürst sein Pferd an und sprang aus dem Sattel.
»Wollen wir hier etwas rasten? Der Ausblick von hier ins Werdenfelser Land ist besonders schön.«
Er half Marisa aus dem Sattel und führte sie zu einer einfachen Bank aus weißen Birkenstämmen. Beide schwiegen, genossen die wunderbare Natur – und ihr Beisammensein. Nach einiger Zeit unterbrach Hasso die Stille:
»Diese Bank war der Lieblingsplatz meiner Mutter. Sie war ein wunderbarer, gütiger Mensch. Zart, zierlich, sehr weich und weiblich und wickelte meinen stattlichen – fast ein Meter neunzig großen Vater – lächelnd um ihre zarten Finger. Wir drei haben uns ganz großartig verstanden. Dieses Schloß Lahrenfels hat meine Mutter mit in die Ehe gebracht. Sie hat es dann sofort nach meiner Geburt auf mich übertragen. Ich liebe es auch ganz besonders, lebe auch am liebsten hier…«
»Das kann ich verstehen. Sicher spüren Sie den Geist Ihrer Mutter hier am stärksten. Ich finde, Schloß Lahrenfels ist ein Kleinod. Man muß es einfach lieben.«
Spontan griff Hasso nach der schlanken Mädchenhand, die den braunen Reithandschuh abgestreift hatte.
»Ich danke Ihnen! Würden Sie hier leben können? Im Winter sind wir oft ganz eingeschneit. Dann ist die Welt mit all ihrem Trubel, ihren Verlockungen und Abwechslungen ganz weit. Um uns ist dann nichts als die weiche, lautlose Stille des Schnees. Ich liebe diese Zeit besonders!«
Impulsiv bejahte Marisa seine Worte:
»Sie haben recht. Dann riecht es nach Bratäpfeln und Holzrauch vom offenen Feuer, und die Menschen und Hunde genießen die lodernden Flammen am Kamin. Eine herrliche, besinnliche Zeit – wenn ich nicht gerade dann singen müßte.«
»Bedeutet Ihnen Ihr Beruf alles? Könnten Sie sich vorstellen, nicht mehr die so berühmte Marisa del Vana zu sein?«
Marisa hörte nicht die atemlose Spannung aus seinen Worten und sah ihn überrascht an:
»Lieber Fürst, wenn es für mich nur meinen Beruf gäbe, wie hätte ich dann meinen Klaus adoptieren können? Das wäre doch einfach unverantwortlich gewesen. Nein! Mein Beruf ist schön, aber auch sehr schwer. Er verlangt äußerste Selbstdisziplin und sicher oft Verzicht auf die angenehmen Dinge, verstehen Sie das? Ich singe gern, sehr, sehr gern, aber es muß nicht das Konzertpodium sein. Ich habe schon daran gedacht, meinen Vertrag mit der Oper in München zum nächsten Termin zu kündigen. Ich möchte die nächsten Jahre für meinen Jungen da sein.«
Fürst Hasso hatte sehr interessiert zugehört. Er hielt die Augen gesenkt, so daß Marisa das glückliche Strahlen seiner tiefdunklen Augen nicht sehen konnte.
»Es ist sicher kein leichter Entschluß, eine so großartige Karriere eines fremden Kindes wegen aufzugeben«, fragte er forschend.
Etwas verletzt sagte Marisa kühl:
»Bitte sprechen Sie von meinem Sohn nicht als von einem fremden Kind. Bitte sagen Sie das nie wieder! Er ist mein Kind! Er hat doch nur noch mich! Ich könnte ein eigenes Kind nicht mehr lieben.«
Marisa war sehr ernst geworden. Die Nasenflügel ihrer fein geformten, schmalen Nase bebten, die großen Augen wirkten unter dem Schleier ihrer langen, schwarzen Wimpern dunkelgrün, ihre Haltung hatte sich gestrafft, gebot Distanz.
Bezaubert und beglückt hatte Fürst Hasso die reizvolle Wandlung verfolgt. Am liebsten hätte er dieses schöne, stolze Geschöpf in seine Arme gerissen und den verschlossenen, schönen Mund wieder weich geküßt. Aber ein bezauberndes Antlitz mit langen, silberblonden Locken tauchte vor ihm auf. Er spürte wieder den brennenden Schmerz der Enttäuschung. Konnte er noch einmal vertrauen? Er wußte, daß er Marisa liebte, daß er sie liebte mit der ganzen Kraft eines reifen Mannes und reichen Herzens.
»Marisa, liebe, liebste Marisa, bitte verzeihen Sie mir. Ihre Antwort hat mich sehr glücklich gemacht. Sie sehen mich so überrascht und ungläubig an. Es ist so! Vielleicht können Sie mich besser verstehen, wenn ich Ihnen sage, daß ich so gern wieder an eine Frau glauben möchte, nachdem mich vor einigen Jahren eine Frau, die ich über alles liebte, so grenzenlos enttäuscht hat. Ihretwegen hätte ich auch die Konsequenzen aus unserem Hausgesetz gezogen, aber nur ein kühler Abschiedsbrief erklärte mir, sie hätte es sich überlegt, sie könnte mich nicht heiraten. Ich sollte nicht nach ihr forschen, sie käme nicht zurück. Der Schmerz ist inzwischen verklungen, aber die Frage bleibt: warum? Verstehen Sie mich jetzt? Ich möchte wieder glauben und lieben können.«
Marisa nickte. Zart ergriff sie seine Hand:
»Eine Enttäuschung kann sehr weh tun. Aber wissen Sie denn, ob der Abschied wirklich ihr eigener Entschluß war? Können nicht irgendwelche äußere Einflüsse mitgewirkt haben? Gab es jemanden, der gegen diese Ehe gewesen wäre? Aber das haben Sie sich sicher schon oft gefragt, nicht wahr? Man glaubt und verzeiht so gern, wenn man liebt. Könnte nicht doch ein Dritter im Spiel gewesen sein? Wie schade, daß zu der Zeit Ihre liebe Mutter nicht mehr lebte. Zu ihr hätte das junge Mädchen sicher Vertrauen gehabt, meinen Sie nicht?«
In tiefen Gedanken versunken, saß Hasso neben Marisa auf der Bank aus Birkenholz.
»Nein, meine Mutter lebte damals nicht mehr. Aber meine Großmama, Vaters Mutter, verbrachte den Sommer hier bei mir. Eine sehr standesbewußte, etwas kalte Frau, hart und unnachgiebig bis zu ihrem Tod vor einem Jahr. Ich hatte nie ein herzliches Verhältnis zu ihr. Sie lebte fast immer auf unseren Gütern in Westfalen. Wenn ich sie einlud mich hier zu besuchen, antwortete sie stets: ›Ich bleibe hier und wache über dein Erbe.‹ Als Gutsherrin war sie hervorragend. Sie war streng, aber gerecht. Sie wurde geachtet, aber nicht geliebt. Die Gutsleute hatten einen Mordsrespekt vor ihr. – Meine Mutter wurde geliebt«, sagte er lächelnd, »vom Hütejungen bis zu den Verwaltern, auch in Westfalen…«
Dann saßen sie auf, ritten schweigend nach Hause. Es war ein gutes, verständnisvolles Schweigen. Am Stall angekommen, half Fürst Hasso Marisa aus dem Sattel. Lange sah er sie an.
»Ich möchte mich bei Ihnen für das Gespräch bedanken, vielleicht auch für einen Hinweis. Können Sie verstehen, Marisa, daß ich nur noch eine Erklärung für den Brief von vor drei Jahren finden möchte? Meine Liebe ist erloschen, längst. Jetzt möchte ich nur noch den Grund wissen.«
Mit einem lieben Lächeln reichte Marisa dem Fürsten die Hand: »Ich wünsche Ihnen, daß Sie Ihre Ruhe finden und auch wieder Vertrauen.«
*
Mit strahlendem Glanz war der Geburtstagsmorgen der Baronin angebrochen. Verschwenderisch hatte Marisa am Tag vorher die kleine alte Schloßkapelle geschmückt. Überall leuchteten Margeriten, tiefblaue Königskerzen, glühten dunkelrote Gladiolen.
Für die Baronin war es eine kleine Enttäuschung gewesen, daß Marisa nicht mit ihr und dem Fürsten in die Messe gehen wollte. Schade, sie hätte diese liebenswerte junge Frau so gern heute immer neben sich gehabt. Nun, sicher hatte sie Sorge um den Buben.
Die Orgel begann mit einem Vorspiel. Die Baronin horchte überrascht auf. Da gab sich heute ja der alte Hirsel besondere Mühe. Sie würde ihm doch mal eine gute Flasche Wein schicken. Der alte Lehrer war seit seiner Pensionierung ein bißchen klapperig geworden. Klare, kraftvolle Akkorde klangen von der kleinen Orgel. Es formte sich eine Melodie, die sie nie vergessen hatte. Das Vorspiel wurde leiser, dann aber setzte eine wunderbare, volle, weiche Frauenstimme ein:
Danke, für diesen guten Morgen,
danke für jeden neuen Tag,
danke, daß ich all meine Sorgen
auf dich werfen mag.
Danke für alle guten Freunde,
Danke, o Herr, für jedermann,
danke, wenn auch dem größten
Feinde ich verzeihen kann.
Danke für meine Arbeitsstelle,
danke für jedes kleine Glück,
danke für alles Frohe, Helle und für die Musik.
Danke für manche Traurigkeiten,
Danke für jedes gute Wort,
danke, daß deine Hand mich leiten
will an jeden Ort.
Danke, daß ich dein Wort verstehe,
danke, daß deinen Geist du gibst.
Danke, daß in der Fern und Nähe du
die Menschen liebst.
Danke, dein Heil kennt keine Schranken,
danke, ich halt mich fest daran.
Danke, ach Herr, ich will dir danken,
daß ich danken kann.
Leise, innig variierte die Orgel das schlichte Thema. Knieend, den weißhaarigen Kopf in die Hände gelegt, verharrte die Baronin unbeweglich. Nur an dem leichten Zucken ihrer Schultern erkannte der Fürst ihre Erschütterung, ihre Bewegung. Behutsam legte Hasso seine kraftvolle Hand auf die der Baronin. Da lächelte sie ihn unter Tränen an und sagte leise: »Danke.«
Der Geburtstag verlief in schönster Harmonie. Die Baronin hatte sich von Marisa ein Foto von Mutter und Kind gewünscht. »Aber zum Hinstellen!« hatte sie extra gesagt. Auf dem Bild hatte Marisa ihren Jungen auf dem Arm. Während der Aufnahme war überraschend seine Großma, Gräfin Langenberg, erschienen, Klaus hatte ihr verlangend seine Ärmchen entgegengestreckt. Diesen Moment hatte der Fotograf festgehalten. Es war das Lieblingsbild der Großma geworden. Es war ein außerordentlich lebendiges Bild. Marisa mit großen, leuchtenden Augen, ein liebes, mütterliches Lächeln auf dem schönen Gesicht, das gesunde, hübsche Kerlchen mit den vergnügten, tiefdunklen Augen…
Es war ein Bild zum Freuen, wie die Baronin immer wieder sagte.
»Und ich kann mir einbilden, daß der liebe Bub nach mir die Ärmchen ausstreckt!«
Nach dem Nachmittagskaffee saß die Baronin mit Marisa auf der Terrasse. Sie waren allein. Fürst Hasso war mit Klaus zu den Pferden gegangen. Klaus hatte wieder gemeint:
»Tomm, wir fei dehn nach liebe Hottematz. Teddy und Hünde auch. Wir fei doßen Männer, nich?« Und beifallheischend hatte er Hasso angeschaut. Und ähnlich dunkle Augen hatten ihm bestätigend zugeblinzelt. Es wurde Fürst Hasso immer ganz eigenartig zumute, wenn er die warme Kinderhand in seiner spürte. Fast schien es ihm, als wenn alle Probleme kleiner würden, verblaßten, und immer zog eine tiefe Ruhe in sein Herz, das wieder lieben und vertrauen gelernt hatte.
Wenn Fürst Hasso an Marisa dachte, schlug sein Herz schneller. Er liebte sie. Er wollte sie erringen und auf sein großes Erbe verzichten, wenn Marisa seine geliebte Frau werden wollte. Deshalb war er auf seinen Gütern in Westfalen gewesen, hatte in alten Folianten und dicken, ledernen Familienbüchern gestöbert, hatte mit dem alten Rechtsanwalt und Freund der Familie gesprochen – umsonst!
Er war bereit, auf den Reichtum, den großen Grundbesitz und die Fabriken zu verzichten, wenn Marisa seine Frau werden würde. Er konnte sich einfach ein Leben ohne Marisa und ohne den kleinen Klaus nicht mehr vorstellen. Dann würden sie hier auf dem Schlößchen leben, etwas bescheidener, als er jetzt gewohnt war zu leben, es würde ein glückliches, reiches Leben werden, wenn auch Marisa ihn liebte!
Klaus riß sich los, er tollte mit den Hunden. Dann sah er kleine Marienblümchen.
»Tomm, doßer Mann, Bümßen für Mami und für Doßma. Oh, so viele Bümßen. Du auch!«
Er forderte Hasso auf, ihm beim Pflücken zu helfen.
Als die beiden wieder einträchtig auf der Terrasse ankamen, war sie leer. Ganz enttäuscht sahen sich die beiden an, dann blickten sie auf ihre Blümchen. Da hörten sie aus dem kleinen Musikzimmer, in dem nur ein Klavier und einige Sessel standen, Gesang.
Hasso setzte sich bequem in den weißen Terrassensessel, nahm den müden Buben auf den Schoß, legte sein Köpfchen an seine Schulter und streichelte sanft und behutsam das sonnenduftende Haar.
Dann lauschte er mit geschlossenen Augen, ganz dem Zauber der geliebten Stimme hingegeben. Seine Gedanken schweiften ab.
Fürst Hasso sah ein Bild vor sich und es war wie eine Vision, wie eine Verheißung: Marisa und er saßen Hand in Hand, mit grauem Haar und jungen Augen und Herzen hier auf der Terrasse und schauten zufrieden auf das Land. Ein schöner, schlanker, junger Mann galoppierte auf einem schwarzen Hengst heran – Klaus, ihr Sohn!
Als die Baronin und Marisa aus dem Musikzimmer kamen, bot sich ihnen ein rührendes Bild: in dem weißen Sessel saß Hasso, das schlafende Kind unbeweglich im Arm. Das Köpfchen lag an seiner Brust, Hassos Wange auf seinen Haaren. Die Augen des Fürsten waren geöffnet, blickten traumverloren abwesend, als sähe er in eine schöne Zukunft. Als er die beiden Damen sah, legte er warnend den Finger auf die Lippen. Still, leise, ein Kind schläft!
Der Montag war eine heitere Fortsetzung der vergangenen drei Tage. Das Lachen und Jubeln, das Tollen und immer wieder das drollige, kindliche Plaudern bildeten die Begleitmusik dieser strahlenden Herbsttage.
Marisa fiel es schwer, an den morgigen Abschied zu denken. Sie spürte die wachsende Zuneigung des Fürsten. Sie selbst wußte und zweifelte nicht mehr, sie liebte Hasso von Lahrenfels-Dyssenburg. Liebte ihn mit der ganzen unverbrauchten Kraft ihres Herzens. War sie allein, wurde sie traurig. Marisa war überzeugt, daß Fürst Hasso sie nicht so lieben könnte. Zu sehr trug er noch an der Enttäuschung, an seiner verratenen Liebe. Dann ging sie abends an das Bett ihres Kindes, strich ihm die schlaffeuchten Löckchen aus der klaren Stirn, deckte die leichte Daunendecke über das schlafende Körperchen und dankte Gott, daß er ihr dieses Kind geschenkt hatte. Ihre Liebe zu Hasso gab ihr die Kraft zu warten, bis sich sein Herz ihr ganz ohne einen Schatten zugewandt hatte.
Am letzten Morgen wollten Marisa, Hasso und mit ihm natürlich der Bub noch einen kleinen Ritt vor dem Frühstück machen. Stolz saß Klaus wieder vorne auf dem Sattel vor Hasso. Der kleine Kerl krähte vor Freude. Sie ritten langsam und gemächlich, die köstliche Morgenfrische genießend.
Da rief Klaus plötzlich mit einer schnellen, unvorhergesehenen Bewegung des ganzen Körpers: »Da, da – Häslein!«
Und schneller, als Hasso ihn halten konnte, rutschte er unter Hassos Arm hinweg vom Pferd und blieb reglos liegen. Fassungslos sahen sich Marisa und Hasso an, Hasso blickte noch einmal auf seinen leeren Arm, stand dann aber schon Sekunden später neben dem bewußtlosen, blassen Kind. Marisa erschien das alles wie ein böser Spuk. Das konnte doch nicht sein, ihr lachender Bub… so still und blaß.
Hasso hatte das Kind kurz untersucht, ohne ihn viel zu bewegen.
»Ich glaube, es ist nicht so schlimm. Er ist auf diesen Stein gefallen. Ich gehe zum Schloß und hole Leute mit einer Trage. Wir tragen ihn dann ganz vorsichtig ins Haus. Bitte, Marisa, bitte nicht so unglücklich ausschauen. Glauben Sie mir, es ist nicht gefährlich. Ich kenne Reitunfälle. Bitte, Marisa, beruhigen Sie sich.«
Obschon es Hasso übel war vor Angst, wollte er auf jeden Fall versuchen, die geliebte Frau, deren Blässe ihn erschreckte, etwas zu beruhigen. Hilflos lächelte sie ihn an. Sie kniete neben ihrem Jungen, während Hasso zum Schloß galoppierte, um Hilfe zu holen.
Das war ein trauriger kleiner Zug, der sich schweigend dem Hof näherte, den sie vor einer Stunde so fröhlich und unbeschwert verlassen hatten. Frau von Gebert hatte schon nach dem Hausarzt telefoniert, der bald erwartet wurde. Überall sah man blasse, ängstliche Gesichter. Sie alle, die auf Schloß Lahrenfels wohnten oder arbeiteten, hatten den kleinen, lebhaften Jungen in ihr Herz geschlossen. Schneeweiß, ohne eine Träne, schritt Marisa neben der Trage her, auf der ihr kleiner Liebling immer noch bewußtlos, blaß unter der Bräune, lag. Das Kind bewegte sich, es erbrach. Mit behutsamer Hand legte Hasso das Kerlchen auf die Seite, damit er nicht erstickte. Zitternd versuchte Marisa, das Kind mit ihrem kleinen Spitzentüchlein zu reinigen, bis Frau von Gebert mit einem nassen Lappen und Handtuch kam.
»Eine Gehirnerschütterung wird es sein. Habe ich als Kind öfter gehabt«, versuchte Fürst Hasso zu beruhigen. Aber Marisa hörte gar nicht zu. Sie sah nur ihren Sohn, ihr geliebtes Kind. Hatte Gott vor Monaten ein Wunder geschehen lassen, um ihn ihr jetzt nach so viel Glück, Freude und Liebe wieder zu nehmen? Oder wollte er sie nur prüfen?
»Lieber, lieber Gott, rette mein Kind, das du mir doch auf so wunderbare Weise geschenkt hast. Laß mich leiden, gib mir Schmerzen, Krankheit, nimm meine Stimme – alles, aber laß mir mein Kind, mein so sehr geliebtes Kind. Bitte, lieber Gott, hilf uns! Amen.«
In seinem Zimmer mit den vielen, lustigen Tieren setzten sie die leichte Trage vorsichtig ab. Mit mitleidigen Blicken auf das blasse, stille Gesichtchen verließen die Leute leise den Raum. Bis zum Eintreffen des Hausarztes Dr. Riedmann sollte der kleine Kranke nicht bewegt und auch nicht gebettet werden.
Mit tiefer Liebe sah Fürst Hasso Marisa an. Blaß, aufrecht kniete sie mit verstörtem Gesicht neben der Trage, jede Bewegung des Kindes ängstlich beobachtend. Da trat die Baronin wieder ins Zimmer, gefolgt von dem Diener Fritz. Auf einem silbernen Tablett trug er die Mokkamaschine, kleine Tassen und alten Cognac.
»Danke, Fritz, ich mache es schon selbst«, sagte sie zu dem Diener, der den kleinen Klaus besonders liebte.
Mit einem traurigen Blick auf Marisa und das stille Kind verließ er den Raum. Fürst Hasso goß Marisa ein Glas des alten französischen Cognac ein und brachte es ihr. Auch der Baronin und sich schenkte er ein Glas des kostbaren Tropfens ein. Sie tranken ihn wortlos. Dann kam die Baronin mit einem Täßchen Mokka, den Marisa heiß, in kleinen Schlückchen trank. Erleichtert beobachtete Hasso, wie langsam die Farbe wieder in ihre schmalen Wangen stieg. Dankbar nickte er der Baronin zu.
Der Arzt wurde von dem Diener hereingeführt. Er war seit langen Jahren Hausarzt bei der Familie des Fürsten. Schon sein Vater hatte vorher die Familie betreut. Hassos Erinnerungen an seine Kinderkrankheiten, Stürze, Brüche, waren alle mit dem gütigen, alten Dr. Riedmann verbunden.
Die drei im Krankenzimmer atmeten auf. Dr. Riedman trat mit schnellen Schritten in das Zimmer, grüßte freundlich mit kurzem Kopfnicken und beugte sich dann sofort zu dem Kind auf der Trage nieder.
»Wie geschah es?« fragte er, Fürst Hasso anblickend. Mit wenigen Worten erklärte Hasso den Vorgang und schloß:
»Er ist auf einen runden Stein gefallen. Gott sei Dank war er nicht spitz.«
Dr. Riedmann nickte:
»Das hätte unter Umständen sehr übel werden können. Dieses scheint eine einfache Commotio cerebri, also Gehirnerschütterung zu sein. Ich nehme an, daß der Bub bald aus seiner Bewußtlosigkeit erwacht. Dann lassen Sie ihn ruhig liegen, legen Sie ihn ins Bett. Klagt er über Kopfschmerzen, geben Sie von diesen Tabletten hier eine halbe, ich lasse sie Ihnen hier. Sollte die Bewußtlosigkeit allerdings, was ich nicht glaube, noch länger als eine Stunde dauern, dann rufen Sie mich bitte an. Beobachten Sie das Kind. Sollten Sie irgendwelche Verkrampfungen feststellen, bitte sofort anrufen.«
Angstvoll, mit blassen Lippen fragte Marisa:
»Bitte, Herr Doktor, was hätte das zu sagen, wenn er krampfte? Wäre das sehr schlimm?«
Der Doktor zögerte einen Moment, dann sagte er:
»Dann könnte es ein leichter Schädelbruch sein. Aber bitte, gnädige Frau, ganz ruhig. Ich glaube es nicht. Darum keine unnötigen Sorgen vorher. Das kranke Kind braucht immer ganz besonders die Ruhe und Ausgeglichenheit der Mutter.«
Dr. Riedmann setzte sich noch einmal zu dem Kleinen, er prüfte Puls und Atmung und Pupillenreflexe. Nach einem Täßchen Mokka erhob er sich.
Fürst Hasso sah, wie intensiv er das Kind beobachtete, und das beunruhigte ihn. Als der Art sich verabschiedete, begleitete Hasso ihn in die Halle. Nach kurzem Zögern sagte Dr. Riedmann, Hasso ernst anblickend:
»Beobachten Sie das Kind gut. Bin mir noch nicht so ganz klar. Ich bin in der Sprechstunde. Bei jeder, auch der kleinsten Veränderung bitte sofort anrufen. Im Laufe des Nachmittags komme ich auf jeden Fall noch einmal vorbei.«
Ernst stand Fürst Hasso am hohen Fenster der Halle. Er sah nicht die goldene, klare Sonne dieses Spätsommertages, sah nicht das leuchtende, brennende Rot und Gold des Herbstlaubes. Aber da! Sein scharfes Jägerauge erspähte auf der Wiese etwas Kleines, Braunes – ein kleines Tier? Nein, es lag ganz unbeweglich! Das konnte nur Teddy, Kläuschens geliebter, alter, verstrubbelter Teddy sein! Und wenn er nun wach wurde und hatte seinen Teddy nicht? Mit Riesensprüngen raste Fürst Hasso die Treppe hinab und sprang über ein Gatter, lief auf den braunen, unscheinbaren Punkt zu und war glücklich, als er das zerzauste Bärchen in der Hand hielt. Unbewußt streichelte er das zerzauste Fellchen, und auch für ihn ging etwas Tröstliches, Friedvolles von diesem vielgeliebten kleinen Kerl aus.
Schnell war Hasso wieder oben im Kinderzimmer. Die Lage hatte sich nicht verändert. Reglos saß Marisa neben dem Kind und beobachtete es.
»Wollen wir ihn nicht vorsichtig ausziehen – wenigstens das Lederhöschen? Das kneift doch!«
Frau von Gebert knöpfte die beiden gestickten Hosenträger ab. Marisa öffnete das knappe Höschen und das bunte Hemdchen.
»Wir wollen ihn ganz vorsichtig in sein Bettchen legen, was meinen Sie?« fragte Marisa die Baronin und Hasso.
»Ja«, meinte Hasso. »Wir müssen ihn ganz flach und auf die Seite legen. Den Kopf möglichst nicht bewegen. Wir fassen ihn zusammen an. Ich nehme das Köpfchen.«
Marisa zog die kleinen roten Sandalen und die rot-weiß geringelten Söckchen aus. Sie trugen die Trage direkt neben sein Bett, und ganz zart, behutsam hoben sie das Kind hinüber. Hasso hielt das matte Köpfchen. Plötzlich eine Bewegung des Kindes! Hasso, der wußte, was das bedeuten konnte, wagte nicht zu atmen. Er fürchtete den nächsten Moment, das, was auch wohl kommen mußte. Da hörte er ein leises, klagendes Stimmchen:
»Au, doße Mann tut Täuschen weh – au…«
Marisa und Hasso sahen sich an, wortlos, voller Hoffnung. Die Baronin kam dazu. Sie glaubte, nicht recht gehört zu haben und war dann auch voller Hoffnung.
Unbemerkt war Hasso zum Telefon gegangen, um den Doktor kurz zu fragen, ob die große Gefahr nun vorüber war. Ja, weitere Komplikationen wären jetzt unwahrscheinlich. Aber das Kind müsse noch weiter genau beobachtet werden.
Im Kinderzimmer saß Marisa. Ihre Haltung war verkrampft. Als sie Hasso anschaute, Tränen in den schönen Augen, war ihm, als müsse er in diesen Augen versinken wie in einem unergründlichen See. Er stellte sich hinter ihren Stuhl und legte seine Hände fest um ihre schmalen Schultern. Da löste sich bei ihr die große Spannung, die Angst um ihren Sohn, ihren süßen, kleinen Liebling. Ein Schluchzen schüttelte sie, die Tränen der Erleichterung quollen über ihre zarten Wangen. Marisa lehnte den Kopf zurück, er nahm ihn fest, doch behutsam in seine Hände, strich sanft über die duftenden Locken.
»Weinen Sie, Marisa, es erleichtert Sie. Wir haben unseren Jungen aus der Gefahr!«
Ohne es zu merken, hatte Fürst Hasso von »unserem Jungen« gesprochen. Ein tiefer Frieden zog in Marisas Herz.
»Mami auch aua? Muß Mami weinen, so viel aua? Täuschen auch aua.«
Und mit etwas matten, müden Äuglein sah das Kind Marisa an. Sie ging an das Bettchen, gab ihm mit viel Geschick die halbe Tablette, deckte ihn noch mal leicht zu und zog die Gardine zu, um den Raum etwas zu verdunkeln.
»Täuschen will lapen. Wo is mein Teddy?« Schnell trat Hasso an das Bettchen. »Hier ist der gute, brave Teddy. Er ist auch müde. Ich leg ihn zu dir!«
Das Kind sah ihn mit immer kleiner werdenden Augen an: »Doße Mann, hast du auch aua? Dleich heiten wir, mit Mami…« Die letzten Worte kamen nur noch undeutlich. Der kleine Klaus schlief, neben ihm in stummer Wacht sein Teddy.
Ein befreites Aufatmen ging durch das ganze Schloß. Alle freuten sich mit Marisa. Aber die alten, langjährigen Angestellten, die für ihren jungen Herrn, wie man sagt, durchs Feuer gingen, die freuten sich besonders für ihn. Sie hatten festgestellt, daß Fürst Hasso, seit die schöne, berühmte Sängerin mit ihrem Sohn ins Schloß kam, fast wieder so wie früher war, fast so wie damals vor der Geschichte… Wenn man ihn mit dem kleinen Kerl an der Hand sah, konnte man glauben, es wäre sein Sohn. So gut verstanden sich die beiden. Wie schön wäre es doch, wenn wieder Frohsinn und Kinderlachen ins Schloß zögen.
Theres, die alte Köchin, hatte still in ihrem Herrgottswinkel eine Kerze angezündet. In ihrer schlichten Art betete sie:
»Lieber Gott, geh’, mach den Buam wieder gsund! Brauchst doch halt nur hinschaun. Sei so guad. Nimm das Kerzl dafür. Bit’schön, Vater im Himmel. So an brav’s Herzl. Laufen so viel Hallodries rum! Nimm die.«
Danach wurde es der Theres leichter. Und als sie dann für sich und die alten Getreuen einen starken Kaffee gebraut hatte, da ging es ihr bald wieder ganz gut.
Ja, der Glaube und der Kaffee wirkten oft Wunder!
*
Der Tag verrann, aus der Dämmerung wurde Nacht. Dr. Riedmann war noch einmal gekommen und zufrieden wieder gegangen. Abends durfte Klaus ein ganz leichtes Haferflockensüppchen essen, von Theres mit viel Liebe zubereitet. Die Köchin war fest davon überzeugt, daß die glückliche Wendung nur ihrem Gebet zu verdanken war. Abends stellte sie in ihrem Herrgottswinkel noch eine Kerze auf:
»Dank auch schön, lieber Vater im Himmel. Dem Buam geht es halt besser. Dies Kerzl hast verdient, weil so schnell holfen hast. I bin net undankbar. Amen!«
Marisa wollte die Nachtwache am Bett ihres Kindes allein halten. Aber da gab es großen Protest von der Baronin und dem Fürsten. Wollte Marisa die beiden lieben Menschen nicht ernsthaft verletzen, mußte sie sich mit einer Wacheinteilung einverstanden erklären. Zuerst also würde die Baronin von neun bis elf Uhr wachen. Frau von Gebert wollte protestieren, aber ihr half kein Protest. In dieser Zeit sollte sich Marisa hinlegen. Sie sollte dann die Baronin ablösen und bis um drei Uhr wachen, dann würde Hasso für den Rest der Nacht Wache halten. So wurde es beschlossen und gemacht.
Als Marisa, erfrischt durch die Ruhe, gegen elf Uhr ins Kinderzimmer kam, saß die Baronin ganz nahe an dem Bettchen, in dem Klaus mit sanft geröteten Bäckchen lag und friedlich schlief.
»Ach, Liebste, was ist das für ein bezauberndes Kind«, sagte die Baronin. »Wenn ich nur wüßte, an wen er mich so lebhaft erinnert! Ich denke schon die ganze Zeit darüber nach. Ja, ja, ich habe ihn von Herzen lieb, den Bub. Ich bin Ihnen und dem Kerlchen eigentlich sehr dankbar. Der Hasso ist wieder ein fröhlicher Mensch geworden. Wie herzhaft lacht er jetzt doch mit dem Kind, wie erfreut er sich an Ihrer herrlichen Stimme. Ja, mein liebes Kind, Sie haben unserem Haus wieder Sonne geschenkt.«
»Es macht mich glücklich, wenn Sie das so empfinden, Baronin. Muß ich Ihnen sagen, daß ich mit Klaus sehr gern zu Ihnen komme? Mein Junge ist hier genauso gern wie bei mir zu Hause. Er ist hier so selbstverständlich, als gehörte er hierher. Ich bin oft ganz überrascht.«
Die beiden Damen saßen sich gegenüber. Die Baronin genoß Marisas schönen, gepflegten Anblick. Ein warmes Bad hatte die letzten Spuren des aufregenden Tages verwischt.
Der Duft eines kostbaren Badesalzes umgab sie.
Marisa bot einen prächtigen Anblick.
»Marisa, verzeihen Sie einer alten Frau eine vielleicht indiskrete Frage, die Sie natürlich nicht beantworten müssen.«
Marisa blickte die Baronin lächelnd an.
»Bitte, fragen Sie nur. Ich fürchte keine Frage und werde alle beantworten.«
Die Baronin zögerte nun doch einen Augenblick.
»Sie sind ein solch liebes, schönes und begnadetes Geschöpf und sind allein, ich meine, ohne Partner. Gab es eine Enttäuschung in Ihrem Leben? Wenn es Sie schmerzt, darüber zu sprechen, dann bitte nicht.«
»Ich glaube, darauf gibt es nur eine Antwort: Ich habe bisher noch nicht den richtigen Mann gefunden. Ich hatte ein gutes Vorbild, die unendlich glückliche Ehe meiner Eltern. Wir waren eine sehr, sehr glückliche Familie. Mein Vater starb vor einigen Jahren durch einen Jagdunfall. Erst jetzt durch meinen Sohn, durch ihre neuen Aufgaben als Großmama beginnt meine Mutter, den Verlust zu überwinden. Jetzt kommt bei mir noch hinzu, daß der Mann, der mich liebt, auch mein Kind lieben muß wie sein eigenes!«
Als die Baronin nach fast einer Stunde in ihre Zimmer gegangen war, stand Marisa noch lange am geöffneten Fenster und dachte über das Gespräch nach. Ja, es stimmte, daß sie nur dann heiraten würde, wenn ihr Herz sprach. Aber hatte sich das nicht schon klar und deutlich entschieden? Vor ihren geschlossenen Augen trat das Bild Fürst Hassos, das kühne, männliche Gesicht, mit den so vertrauten Augen, am vertrautesten, wenn er lachte. Sie sah die schmale Nase, das volle Haar, die lässig elegante Gestalt. Sah seine schlanken, sehnigen Reiterhände, die so sanft wurden, wenn sie das Kind streichelten. Ja, sie hatte ihn gefunden. Aber Fürst Hasso, konnte er nach seiner großen Liebe und Enttäuschung noch einmal lieben? Würde nicht immer der Schatten der anderen zwischen ihnen stehen?
Sie ging wieder zu ihrem Kind und war glücklich über den tiefen, ruhigen Schlaf. Fürst Hasso konnte in dieser Nacht keine Ruhe finden. Es machte ihn glücklich, die geliebte Frau mit ihrem Sohn unter seinem Dach zu wissen. Der Tag war voller Aufregungen gewesen. Wie gern hätte er die Geliebte in ihrer Sorge in die Arme geschlossen, ihr die Tränen von den blassen Wangen geküßt, doch hatte er es nicht gewagt. Konnte er es dem alten Adelsgeschlecht der Fürsten von Lahrenfels-Dyssenburg gegenüber verantworten, wegen seiner Liebe zu einer Bürgerlichen, auf den Titel und die damit verbundenen westfälischen Güter zu verzichten? Er fühlte, daß er Marisa nicht gleichgültig war. Konnte er auf sie verzichten? Konnte er Marisa, der verwöhnten, gefeierten Künstlerin zumuten, hier auf dem kleineren Schloß mit den geringeren Einkünften zu leben?
Der Fürst hatte sich nicht hingelegt. Er hatte mit seinem harten Hausgesetz gerungen, hatte ihm seine Liebe, seine Liebe zu Marisa und dem Kind, die er beide nicht trennen konnte, gegenübergestellt. Und die Liebe war Siegerin geblieben. Eine große, fast heitere Ruhe überkam den Fürsten. Er hatte sich entschieden. Er würde auf Titel und Reichtum verzichten, um die geliebte Frau zu heiraten. Er sah im Geiste seine zürnende Großmutter vor sich und murmelte leise:
»Ich weiß, Großmama, daß du mich nicht verstanden hättest. Für dich gab es von jeher nur den Adel, der reingehalten werden mußte, die Güter und das Ansehen unter den Standesgenossen. Und was hat dir das eingebracht, Großmama? Warst du ein glücklicher, zufriedener Mensch? Hast du und wurdest du geliebt? Ich hatte als Kind nur Angst vor dir und deinen kalten Augen. Nein, Großmama, dein Leben war lieblos, freudlos. So ein Leben möchte ich nicht. Trotz der Güter und Fabriken. Ich habe die Liebe und das Glück gewählt!«
Fürst Hasso war vor das Ölgemälde seiner Großmutter väterlicherseits getreten. Kalt und stolz blickten ihn die blauen Augen an. Kein Lächeln lag auf den schmalen Lippen. In ihrem dunklen, streng gescheitelten Haar saß das berühmte Diadem aus Brillanten und Smaragden, um den Hals trug sie das zum Familienschmuck gehörende Kollier, eine einzige Kostbarkeit aus Brillanten und großen Smaragden, in Platin gefaßt. Lange Smaragd-Ohrgehänge und ein einziger, riesiger Smaragd als Ring vervollständigten den außerordentlich wertvollen Familienschmuck. Seine Großmutter hatte ihn bei festlichen Gelegenheiten bis zuletzt getragen. Seine Mutter dagegen nie. Sie hatte vor Jahren mal zu ihrem Sohn gesagt: »Weißt du, mein Junge, laß ihn die Großmama nur tragen. Für sie bedeutet er sehr viel. Er verkörpert alles das, wofür sie gelebt und vielleicht auch vieles geopfert hat! Ich fühle mich wohler mit dem Schmuck, den dein lieber Papa mir immer mit so viel Liebe ausgesucht und geschenkt hat.«
Im Geiste sah Hasso seine schöne Marisa in dem königlichen Schmuck. Wie eine Märchenprinzessin würde sie damit ausschauen. Aber eine Bürgerliche würde ihn nie tragen dürfen! Aber er hatte den Schmuck seiner geliebten Mama. Auch er war wertvoll und schön – und war mit Liebe geschenkt und getragen worden.
Fürst Hasso spürte ein starkes Glücksgefühl in sich. Keine Müdigkeit verriet die durchwachte Nacht. Schnell ging er unter die Dusche und machte sich bereit für seine Wache am Bett des fremden Kindes, das er liebte wie ein eigenes.
*
Gegen zwei Uhr nachts war der kleine Klaus aufgewacht. Im Schein der kleinen Lampe sah er Marisa. Sie schreckte leicht auf, als das klare
Stimmchen sie aus ihren Gedanken riß:
»Mami! Mami, Täuschen tinken. Täuschen ist wach!«
Schnell war Marisa am Bettchen. Glücklich sah sie in die wieder klaren Augen. Das Kind streckte ihr verlangend die Ärmchen entgegen:
»Mami liebhaben – Tüßchen deben!«
Glücklich nahm Marisa ihren geliebten Jungen in den Arm. Dann machte sie ihm eine frische Zitrone, die er durstig trank. Bald darauf legte er sich wieder entspannt zum Schlafen hin. Dann aber klopfte er auf sein Kopfkissen:
»Da Mami lapen! Tomm, Mamilein!«
Marisa, die vor seinem Bettchen gehockt hatte, legte zum Schein ihren Kopf auf sein Kissen. Aber der kleine Schelm merkte bald, daß das nicht richtig war:
»Mami danz hichtig lapen bei Täuschen, Tomm, Mamilein. So, nun danz sön lapen. Täus is müde. Mami auch.«
Marisa war aus ihren leichten Hausschuhen geschlüpft und legte sich vorsichtig neben den Buben, der sich ihre Hand unter das pralle Bäckchen schob. Nun war sie gefangen, wollte sie das Kind nicht wecken. Marisa streckte sich bequemer aus und empfand jetzt das Liegen doch sehr angenehm. Sie dachte verschwommen, wie klar die Augen des Kindes sie angesehen hatten, und auf einmal waren es die Augen von Hasso, der sie liebevoll ansah. Sie lächelte zärtlich und schlief mit diesem Lächeln ein. Kopf an Kopf mit ihrem Kind.
Als Hasso gegen drei Uhr nachts seine Wache begann, bot sich ihm ein bezauberndes Bild: eng nebeneinander in dem schmalen Bett lagen schlafend Marisa und ihr kleiner Sohn. Lange schwarze Wimpern warfen zarte Schatten auf im Schlaf sanft gerötete Wangen. Ein Lächeln, so schön und zärtlich, wie er es bei ihr noch nie gesehen hatte, lag um Marisas schönen Mund. Noch im Schlaf hielt sie ihr Kind umschlungen, als wollte sie es schützen.
Hasso konnte sich nicht satt sehen an der rührenden Schönheit dieses Bildes. Vor ihm lag der schönste Frauenkörper, dessen weiche, makellose Formen das grüne Samtgewand mehr verriet als verbarg. Der Saum des Kleides war verrutscht und zeigte die langen, schlanken Beine, die schmalen, gepflegten Füße, deren Nägel rosig schimmerten wie die Nägel der auffallend schönen Hände.
Fürst Hasso genoß diesen Anblick einer vollendeten Schönheit, Anmut und natürlichen Weiblichkeit wie ein Geschenk.
Wenn sie wach würde, könnte es ihr unangenehm sein, von ihm im Schlaf beobachtet zu werden. Es würde ihr gegen Morgen auch sehr kühl werden. Fürst Hasso ging leise und holte eine warme Felldecke, die er ganz zart und vorsichtig über die geliebte Frau breitete. Sie kuschelte sich unbewußt etwas hinein und schlief weiter, gelöst und entspannt wie ein Kind.
Fürst Hasso stand im Nebenzimmer am geöffneten Fenster. In die Dämmerung des langsam aufsteigenden jungen Morgens hinein träumte er von einem großen, berauschenden Glück. Sein Glück hieß Marisa. Ja, Marisa und Klaus! Wie unendlich reich er geworden war, weil er auf Millionen verzichten konnte. Ein tiefer, befreiender Atemzug hob seine breite Brust.
*
Es war eine fröhliche, gelöste Frühstücksrunde, die etwas provisorisch, aber sehr gemütlich im Kinderzimmer saß. Fürst Hasso hatte eigenhändig einen runden Tisch an das Kinderbettchen geschoben, und der strahlende Diener Fritz hatte ihn mit schönem Porzellan und Silber gedeckt. Marisa hatte frische Rosen aus dem Garten geholt, und Theres, die gute, sorgende Köchin hatte für die Herrschaften frische, kleine Brötchen gebacken und leckere Kleinigkeiten gezaubert, die dankend beachtet wurden. Und dann ihr Mokka. Immer wieder mußte Fritz mit der großen schweren Silberkanne herumgehen und einschenken. Strahlend saß der kleine Patient in seinem Bett, von zahlreichen Kissen gestützt, um das Köpfchen zu schonen. Auch ihm schmeckte es. Heute durfte er schon einen Becher Kakao trinken und ein Brötchen mit frischer Himbeerkonfitüre essen.
Wenn Marisa den Augen Hassos begegnete, durchströmte sie ein eigenartig süßes Gefühl. Er erschien ihr verändert, wie von einem Bann oder Zwang befreit. Eine friedvolle Erwartung lag auf seinem Gesicht. In ihre Überlegungen hinein hörte sie ihn sprechen:
»Baronin, würden Sie gleich ein wenig bei unserem kleinen Patienten bleiben? Ich möchte mit Frau Marisa einen Spaziergang machen. Er wird uns guttun.«
Marisa wunderte sich etwas, daß er, der stets sehr höflich war, sie nicht fragte. Auch die Baronin schien das zu wundern, aber auch sie sagte nichts.
»Natürlich, ich bleibe gern bei unserem Kläuschen. Was wollen wir denn spielen?« fragte sie ihn.
Er überlegte nicht lange:
»Mit allen Tieren pielen, ja? Und Mami singt von…« Klaus dachte angestrengt nach. Seine schöne, klare Kinderstirn legte sich in Dackelfalten.
»Mami singen von Hähne dehn!« kommandierte er. Der Fürst und die Baronin sahen Marisa ratlos an. Die aber lächelte und sagte:
»Wenn wir morgens draußen waren, habe ich oft das schlichte Lied: Waldandacht gesungen. Das beginnt: Früh morgens, wenn die Hähne krähn… Dann versuchte Klaus immer, wie ein kleines Hähnchen zu krähen. Natürlich liebt er auch Hähne – wie alles Getier.«
Und schon klang vom Bett her ein vergnügtes »Kikeriki.«
Marisa fürchtete etwas für sein Köpfchen. Deshalb vertröstete sie ihn bis morgen. Dann durfte er auch wieder nach Herzenslust krähen. Der Bub war’s zufrieden.
Fürst Hasso und Marisa verließen das Zimmer.
»Bitte, Marisa, seien Sie mir nicht böse, daß ich so über Sie verfügte, aber ich muß etwas mit Ihnen besprechen.«
Er faßte leicht ihren Arm und führte sie zu der Lieblingsbank seiner Mutter, die auch die seine war.
Schweigend, wie in einem unwirklichen, zarten Traum, saßen die beiden jungen Menschen. Langsam ergriff Hasso die Hand Marisas. In seinen Augen lag Liebe, nichts als eine große, heilige Liebe, als er bat:
»Marisa, Liebste, werden Sie meine Frau, meine über alles geliebte Frau. Sie müssen es gespürt haben, wie ich Sie liebe. Marisa – liebst auch du mich?«
Und sacht nahm er das schöne Gesicht in seine Hände. Marisa blickte ihn an. In den wunderbaren grün-goldenen Augen hatten die Liebe und das Glück tausend kleine leuchtende Sonnen angezündet. Konnte ihr Mund mehr verraten, als diese Augen ihm schon sagten? Dieser geliebte, weiche, rote Mund. Immer und immer wieder versank Hasso in seiner Süße. Die Zeit flog dahin, sie merkten es nicht. Bis Marisa plötzlich an ihre Mutterpflichten dachte. Ganz jung und mädchenhaft, in lieblicher Verwirrung, stand sie vor ihm.
»Hasso, du weißt, daß ich dich liebe. Aber wenn du mich willst, mußt du auch meinen Sohn nehmen. Weißt du das?« Wieder sah er sie liebevoll an und nahm sie in die Arme.
»Aber natürlich, kleine Mama! Ihr beide gehört doch zusammen. Ich muß dir nun auch etwas sagen, ich weiß nicht, ob du mich dann noch willst…«
Hasso zögerte einen Augenblick.
Überrascht sah Marisa ihn an. Konnte da noch der Schatten einer vergangenen Liebe sein?
Hasso, der jede Regung dieses schönen Gesichtes kannte, ihre Gefühle erriet, sagte in ihre angstvollen Gedanken hinein:
»Nein, mein Lieb! Zwischen uns steht kein anderer Mensch, ich mußte mich nur entscheiden: für dich und gegen unser tyrannisches Hausgesetz der Fürsten von Lahrenfels-Dyssenburg. Ich liebe dich über alles. Liebe dich mehr als den Titel mit seinem großen Reichtum. Ich verzichte mit freudigem Herzen, wenn ich dafür dich, mein Geliebtes, erringen kann. Bist du zufrieden mit dem kleineren Besitz hier, mit sehr viel weniger Vermögen? Ich weiß, du bist Reichtum gewöhnt! Kannst du dich mit weniger zufriedengeben?«
Ernst und forschend lag sein Blick auf ihrem weichen Gesicht.
»Liebster, fragst du mich das wirklich? Wo du bereit bist, so viel für mich zu opfern! Oh, du dummer, lieber Mann! Wie glücklich werden wir hier sein! Wir lieben doch beide dieses Schlößchen deiner lieben Mutter. Du sprachst schon mal von euren Hausgesetzen. Was sagen sie? Warum mußt du meinetwegen auf Stellung und Vermögen verzichten? Weil ich Sängerin bin?«
Liebevoll, als müßte er die geliebte Frau schützen, zog er sie wieder in seine Arme. Sein Gesicht in ihre duftenden Locken vergraben, murmelte er:
»Nein, mein Herz, nur weil du nicht von Adel bist. Nicht von Geburtsadel, meine ich. Seelenadel zählt leider nicht. Denn dann wärst du eine Königin! So bist du nur meine Königin und trägst eine unsichtbare Krone.«
Fassungslos starrte Marisa ihn an.
»Ich verstehe das alles nicht, Lieber…«
Dann sah sie ihn sehr ernst und forschend an:
»Hasso, Lieber, wird dir dieser Schritt auch nicht eines Tages mal leid tun? Bedenke, auf was du verzichten willst!«
Stürmisch riß Hasso die Geliebte an sich:
»Nie, mein Herz. Ich habe mich geprüft, bevor ich mit dir sprach. Und nun wollen wir nicht mehr darüber reden. Laß uns bald heiraten. Jeder Tag ohne dich, ohne unseren Jungen, ist verloren!«
Da fiel ihm Marisa, die zurückhaltende, damenhafte Marisa del Vana, wie ein junges, stürmisches Mädchen um den Hals. In ihren wunderschönen Augen schimmerten Tränen des Glücks. Lachend und weinend rief sie:
»Oh, lieber, lieber Gott, ich danke dir für diesen Beweis seiner Liebe! Liebster, del Vana ist mein Künstlername. Ich habe nie darüber gesprochen, weil ich alles, was mit dem Geburtsadel zusammenhängt, nicht so sehr wichtig finde. Der Mensch, der Adel seines Charakters ist doch viel entscheidender. Also, liebster Mann, mein voller Name ist Gräfin von und zu Langenberg auf Langenberg. Mit den stolzen Vornamen: Alexandra Huberta Rudolfa! Mein Vater war früher im Auswärtigen Amt in Madrid als Attaché, wo er meine Mutter, die sehr schöne, sehr junge Comtessa del Vanessa kennen- und liebenlernte. Die Ehe war unendlich glücklich, leider blieb ich ihr einziges Kind. Und unser Sohn ist Klaus Hubertus Fernando Graf Langenberg.«
Wie im Traum hörte Hasso die Worte der geliebten Frau. Weich und zärtlich schmiegte sie sich an ihn.
»Ich kann dir nicht sagen, wie sehr mich deine Opferbereitschaft beglückt hat. Jetzt bin ich froh, daß ich nie über meine Herkunft gesprochen habe. Du hast mir so den größten Beweis deiner selbstlosen Liebe gegeben. Ich danke dir, mein Hasso.«
Noch einmal küßten sie sich innig, das Herz zu voll für Worte.
*
Wunderbare, glückliche Tage begannen. Baronin Gebert, die als erste die große Überraschung erfuhr, geriet außer sich vor Freude. Immer wieder schloß sie Marisa in die Arme. Jetzt gestand sie, daß sie nach dem ersten Besuch schon den Herrgott gebeten hatte, diese beiden Menschen zusammenzuführen. Nun hatte Gott – wie schon so oft – ihre Bitten erhört.
Am Abend ließ Hasso das Personal in die große Halle kommen. Dann erschienen Hasso und Marisa Hand in Hand. Es bedurfte keiner Worte der Erklärung. Die beiden schönen Menschen strahlten so viel Glück aus, daß der Jubel schon losbrach, bevor ein Wort gefallen war. An diesem Abend gab es für alle Angestellten des Schlosses ein kleines Fest, zu dem auch das Brautpaar für ein Stündchen erschien.
Dann telefonierte Marisa mit ihrer Mutter in Salzburg. Sie konnte nicht viel sagen, sie war zu bewegt:
»Mamilein, liebes, ich bin so glücklich. Du ahnst sicher schon – weshalb, gell? Wenn du zurück bist, haben wir uns sehr viel Schönes zu erzählen. Achte auf dich, kleine Mama!«
Hasso übte mit Klaus das Wort »Papa«. Der kleine Kerl war nicht besonders begeistert:
»Du bist doße Mann. Was ist Papa? Heißt Mama. Meine liebe Mami!«
Kriegerisch blitzten seine großen Augen. Hasso lachte und ließ ihn bei »doße Mann«.
Am Unfalltag war Klaus nicht gerade sauber in sein Bett gelegt worden. Marisa wollte ihn ganz vorsichtig baden, denn Dr. Riedmann hatte es erlaubt, da es dem Buben wieder gutging.
»Ich helfe dir, meine Liebes. Ich halte ihn in der Wanne, und du wäschst ihn. Einverstanden, Kerlchen?«
Kerlchen war einverstanden. Als sie ihn dann in dem warmen Wasser hielten, seine Fischlein und Enten um ihn herumschwammen, strahlte Kläuschen:
»Is danz sön – Papa!«
Der kleine Schelm strahlte. Hasso war so begeistert, daß er am liebsten das nasse Kerlchen in den Arm genommen hätte. Er beherrschte sich aber und sagte nur väterlich-wohlwollend:
»Sieh mal, wie schön du das schon kannst. Bist ja auch mein großer Junge!«
»Nein, bin auch doße Mann! Ja! Wir fei doße Männer!«
Und schnell, ehe Hasso sich versah, hatte Klaus ihn naßgespritzt. Sein Jubel war groß, als Hasso das mit gespielt großem Schrecken quittierte. Es war ein richtig lustiges kleines Badefest – bei aller Vorsicht natürlich. Das Waschen war etwas schwieriger, aber es mußte sein.
Hasso stand interessiert dabei, als Marisa das Bübchen dann abrieb und frottierte.
»Bitte, Hasso, halt doch mal das Köpfchen! Ich muß ganz vorsichtig den Hals und den Nacken abtrocken. Weißt du, unten im Haaransatz bleibt das Haar leicht naß. Ja, so ist es gut. Vielleicht noch etwas tiefer. So, mein Büberl, du mußt doch ganz trocken werden!«
Marisa hatte im Eifer gar nicht auf Hasso geachtet. Nun hörte sie einen überraschten Ruf:
»Marisa, da sieh, was ist das?«
Marisa sah ihren Hasso erstaunt an.
»Aber, Lieber, ein Muttermal. Ist das etwas Besonderes?«
»Ich weiß nicht. Er ist wie der Stern der Familie Lahrenfels-Dyssenburg. Seltsamerweise haben die Männer unserer Familie alle dieses Muttermal, den Stern im Nacken.«
Schnell hatte Hasso den Kragen geöffnet, beugte den Kopf und zeigte Marisa das kleine Sternchen unter dem kurzen Haaransatz. Verblüfft streichelte sie darüber hin.
»Jetzt wissen wir auch, wo der Vater dieses Kindes zu suchen ist, dieser feine Herr! Unter meinen eigenen Verwandten! Das ist doch der Höhepunkt. Ein Kind haben und sich dann vor den Folgen drücken. Unglaublich!«
Hassos Stirn hatte sich vor Empörung gerötet. Im Geiste ging er seine näheren und weiteren Verwandten durch. Wem konnte er das Ungeheuerliche zutrauen? Da kam ihm ein Gedanke:
»Weißt du, mein Liebes, wir fahren einfach mal in das Kinderheim, in dem Klaus gelebt hat. Vielleicht kann man uns etwas sagen. Das sind wir dem Kind schuldig!«
»Und wenn man uns das Kind nehmen will? Ich gebe es aber nicht mehr her!«
Tröstend nahm Hasso seine Liebste in die Arme.
»Du weißt doch, daß ich unseren Klaus nie hergeben würde. Durch dieses Sternchen gehört er – wenn überhaupt möglich – noch mehr zu uns! So, und nun ins Bett mit ihm!«
Als die Baronin von dem Sternchen hörte, erschrak sie heftig. Aber warum? Sie hätte es nicht sagen können. Eine Ahnung ließ sie um das Glück, den Frieden dieser ihr so lieben Menschen fürchten.
Hassos Vorschlag, in das Kinderheim zu fahren, fand sie gar nicht gut. Und sie wurde darin unterstützt von Marisa.
»Lieber, wir wollen nicht in das Heim fahren. Für unser Kind ist doch alles geregelt. Schau, ich mag gar nicht an die Zeit denken, wo ich noch nichts von meinem Jungen wußte. Ein Kind fiel vom Himmel und brachte Glück und Liebe.«
Hasso zog Marisa liebevoll an sich:
»Schau, du weißt, daß ich dir die Sterne vom Himmel holen würde, wenn es möglich wäre. Aber hier geht es um unseren Jungen! Er hat ein Anrecht darauf zu erfahren, wer sein Vater ist, wer ihn so schmählich verraten hat. Bitte, versteh mich doch!«
So waren sie nun unterwegs nach München. Die drei hatten zusammen mit der Baronin einige sehr schöne Tage in der Burg Langenberg verlebt. Mutter und Schwiegersohn verstanden sich vom ersten Augenblick an. Beide vereinte sie die große Liebe zu Marisa. Hasso war begeistert von dem zeitlosen Charme der stillen, vornehmen Schönheit seiner Schwiegermutter.
Zu Marisas großer Freude kam dann für einen Tag – die Gräfin hatte ihn angerufen – Professor Gundler aus Zürich. Er wollte seiner schönen, im tiefsten Herzen geliebten Patientin selbst alles erdenkliche Glück wünschen. Sich aber auch vor allem den Mann ansehen, dem es so schnell gelungen war, sie zu erobern. Er wußte, daß es nicht Adel und Reichtum waren, die sie beeinflußt hatten.
Hasso fuhr gemächlich durch den verregneten Chiemgau. Auf den nassen, dunkelglänzenden Straßen war kaum Verkehr. Hasso löste seine Hand vom Steuer und griff nach Marisas lässig im Schoß ruhenden Händen.
»Weißt du, mein Herz, daß der Professor dich liebt? Es lag in seinen Augen, wenn er dich ansah. Liebe und etwas Traurigkeit. Wie reich bin ich gegen ihn!«
»Ich weiß, Hasso. Ich empfinde große, dankbare Freundschaft für ihn. Ich möchte auch, daß er dein Freund wird. Ja, Freundschaft! Mehr konnte ich ihm nicht geben. Für ihn, diesen wertvollen Menschen, wäre das zu wenig gewesen. Er hat mehr verdient.«
*
So fuhren sie weiter. Mal redend, mal schweigend. Aber immer beglückt die geliebte Nähe des anderen empfindend.
Hinter ihnen, auf dem Rücksitz, war es still geworden. Klaus hatte sich in seine Decke gekuschelt und schlief. Immer wieder ergriff Marisa ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit und des Glücks. Dieser kleine Raum faßte ihre ganze geliebte Welt. Und immer, wenn sie ihren Reichtum so beglückend empfand, sagte sie nur:
»Lieber Gott, ich danke dir!«
Gott würde wissen wofür. Und er würde weiter gütig ihre Geschicke lenken. Voll Vertrauen legte sie ihre Familie in seine Hände.
Dann war man am Heim, in dem ihr Bub fast zwei Jahre seines Kinderlebens verbracht hatte.
Da sie angemeldet waren, wurden sie sofort zu der Oberin geführt. Eine schlanke, ernste Ordensschwester empfing sie freundlich. Als sie das gesunde, fröhliche Kind sah, erhielten ihre kühlen, grauen Augen einen warmen Glanz. Sie ergriff die warme, kleine Patschhand:
»Guten Tag, Klaus! Wie geht es dir?«
Seine großen Augen sahen sie ohne Scheu an.
»Dut! Wo is meine Mami?«
Er lief zu Marisa, die sich etwas zurückgehalten hatte. Er ergriff ihre Hand und sagte fröhlich:
»Tomm, Mami, wir pielen mit viele Tinnern?« Er hatte auf dem Flur die Kinder gesehen, die im Haus spielen mußten, weil es regnete.
»Gleich, mein Kerlchen!«
Hasso ergriff das Wort:
»Schwester Oberin, ich hatte Sie gestern angerufen und gebeten nachzuforschen, ob etwas über den Vater unseres Kindes bekannt ist. Frau del Vana und ich, wir werden bald heiraten. Ich möchte Klaus dann sofort adoptieren. Aus bestimmten Gründen aber möchten wir sehr gern wissen, wer der leibliche Vater des Kindes ist. Ist Ihnen darüber etwas bekannt?«
»Nein, leider nicht! Wir kannten nur die Mutter, die regelmäßig zu dem Kind kam und auch immer sehr pünktlich bezahlte. Ich hatte den Eindruck, daß es ihr oft sehr schwerfiel, aber sie klagte nie. Sie studierte Medizin und mußte sich das Studium und den Heimaufenthalt für das Kind selbst verdienen. Ich glaube, sie machte bis zur Erschöpfung Nachtwachen – privat und in der Klinik.«
Das kühle Gesicht der Ordensfrau zeigte plötzlich eine tiefe Bewegung. Ihre klare Stimme wurde leise, zögernd:
»Ich habe in den Heimen schon sehr viel erlebt, Schweres, Unverständliches. Aber dieser Tod eines so tapferen, wertvollen jungen Menschen, einer guten Mutter in dem Moment, als sie am Ziel ist, das war für mich das Erschütternste… Ich werde ihr Glück, ihr Strahlen nie vergessen, als sie den Buben abholte. Tiefe Erschöpfung lag auf dem blassen Gesicht, aber alle Sorgen und Belastungen schienen vergessen. Sie jubelte, als sie mir sagte:
›Schwester Oberin, ich habe es geschafft! Endlich kann ich meinen Buben zu mir nehmen! Übermorgen fliegen wir zwei ins Glück! Ich werde für uns beide eine eigene kleine Wohnung haben. Tagsüber kann ich ihn in den Kindergarten im Haus für Klinikangestellte geben. Ich bin ja so glücklich – und Ihnen allen von Herzen dankbar!‹«
Ein tiefes Schweigen folgte diesen leisen, stockenden Worten. Marisa flossen die Tränen über die Wangen. Kläuschen sah sich unbehaglich um. Dann zeigte er vorsichtig auf Marisas nasse Wangen:
»Mamilein aua? Täuschen teicheln, ei machen!«
Und seine kleinen, runden Fingerchen streichelten liebevoll die Hand seiner Mami.
Nachdenklich, mit einem warmen, lächelnden Blick betrachtete Schwester Oberin Marisa und das Kind. »Wie gut, daß er Sie nun hat«, sagte sie nur. »Ich habe dann noch mit unserer alten Schwester Amara gesprochen. Ich glaube, sie weiß etwas mehr. Die junge Frau hatte ein besonderes Vertrauensverhältnis zu ihr. Schwester Amara ist bereit, mit Ihnen zu sprechen. Aber bitte denken Sie daran, die Schwester ist schon sehr alt, auch schwach, sie macht uns oft große Sorgen. Aber sie ist überzeugt, sie hätte noch eine Aufgabe zu erfüllen. Dann erst würde der Herrgott sie zu sich rufen. Wir wissen nicht, welche Aufgabe, und sie schweigt! Ich führe Sie jetzt zu ihr. Sie möchte auch Klaus sehen.«
In einem spartanisch einfach eingerichteten Betraum saß eine sehr alte, kleine Nonne. Tiefe Falten und Furchen durchzogen ein winziges, fast verschrumpeltes, blasses Gesicht, aus dem aber die klaren, blauen Augen gütig und weise blickten. Eine fast angstvolle Scheu ergriff Marisa. Ihr war plötzlich, als wenn hinter dieser zerbrechlichen Gestalt etwas Schicksalhaftes stehe. Auch Hasso fühlte eine merkwürdige Beklommenheit. Nur Klaus war unbefangen. Er hielt die Hand seiner Mami, das war Geborgenheit. Mit kindlicher Neugier sah er in das alte, gütige Gesicht. Ohne Scheu meinte er:
»Bist du auch Doßma?«
Ein kleines Lächeln glitt über die faltigen Züge. Auch sie fragte: »Guten Tag, kleiner Klaus! Wie geht es dir?«
Wieder antwortete er ohne Hemmungen:
»Dut!« Und er spielte mit der Hand seiner Mutter. Die alte Schwester sah es und nickte bestätigend mit dem Kopf.
»Ich sehe es. Und das ist gut, mein Junge!« Dann winkte sie Hasso zu sich.
»Bitte, kommen Sie ganz nahe. Ich muß Sie ansehen. Kommen Sie etwas tiefer, Sie sind sehr groß. So ist es gut.«
Dann auf einmal wurden ihre gütigen Augen ernst, und sie sagte.
»Sehen Sie mir in die Augen, Fürst Hasso Lahrenfels-Dyssenburg!«
Erstaunt, aber klar und offen sah der lebensvolle junge Mann die zerbrechliche kleine Gestalt an. Ihr Blick verlor seine Härte. Hasso kam sich etwas eigenartig vor und war gespannt auf das, was kommen würde. Woher wußte sie seinen Titel? Nie nannte er sich so!
Da erklang die alte Stimme wieder:
»Fürst Lahrenfels, können Sie mir schwören, bei dem Liebsten, was Sie haben, daß Sie nicht wußten, daß Lore Meiners von Ihnen ein Kind erwartete? Dieses Kind, Klaus Meiners, ist Ihr Sohn!«
Totenstille folgte. Dann richtete sich Hasso, noch ganz benommen von dem Gehörten, auf. Sein Blick suchte Marisa, ließ sie nicht mehr los. Dann sagte er, wie aus einem Traum erwachend:
»Ich sehe die Zusammenhänge noch nicht, aber ich schwöre beim Liebsten, was ich auf der Welt besitze – bei dir, Marisa – daß ich nichts davon gewußt habe! Aber warum hat sie es mir denn nicht gesagt? Ich verstehe das alles nicht. Wie habe ich fast zwei Jahre auf ein Zeichen von ihr gewartet! Warum ging sie, ohne mir von unserem Kind zu sagen? Können Sie mir das erklären, Schwester Amara?«
Wieder zögerte die alte Schwester:
»Ich muß da leider ein Mitglied Ihres Hauses, Ihrer Familie anklagen. Erinnern Sie sich, als Lore Meiners ging, war Ihre Großmutter mehrere Wochen bei Ihnen zu Besuch. Erinnern Sie sich? Nun, sie hat dem armen Mädchen so lange zugesetzt, bis sie selbst glaubte, Ihnen im Weg zu sein, Sie Ihrer Güter zu berauben. Ihre Großmutter bot ihr zehntausend Euro, Lore Meiners hat sie nicht genommen. Sie floh fast aus Ihrem Schloß, als Sie einen ganzen Tag außerhalb zu tun hatten. Lore hat Sie sehr, sehr geliebt. Ja, nur eine große Liebe bringt solch ein Opfer.«
Schwester Amara schloß erschöpft die Augen, dann fuhr sie mit leiser Stimme fort: »Sie wundern sich, daß ich so vieles weiß? Ich kannte Lore schon, als sie noch Schülerin am Gymnasium war. Ich gab in ihrer Klasse Biologie. Sie hatte immer ein besonderes Vertrauen zu mir, ein Geschenk, für das ich dankbar war. Vielleicht ist es tröstlich für Sie zu wissen, daß Lore Meiners nur mit größter Achtung und unendlicher Liebe von Ihnen sprach. Sie sah leider nicht ein, daß sie unrecht tat – an Ihnen und an dem Kind!«
Wieder stockte sie und schloß die Augen, dann begann sie noch einmal: »Ich habe einen Brief für Klaus, für später. Bitte, kommen Sie, Sie sollen ihn lesen!«
Wie in Trance folgte Hasso. Er sah zu Marisa hinüber, die wie erstarrt saß, das Kind auf dem Schoß. Sie hatte das blasse Gesicht in die krausen Löckchen des Buben vergraben. Klaus saß ganz still. Mit dem Feingefühl des Kindes spürte er etwas Bedrückendes. Mit großen Augen saß er und wagte kaum, das Köpfchen zu bewegen.
»Marisa!«
Leise, fast unhörbar flüsterte der Fürst den geliebten Namen. Da hob sie den Kopf. Und als aus seinen dunklen Augen ein Strahl unendlicher Liebe die ihren traf, zündete er auch in ihrem Herzen, in ihren Augen die Lichter wieder an. Sie sahen sich über den Kopf seines – ihres Kindes an. Und was jeder im Auge des anderen las, war Liebe und Vertrauen. Dann erst schritt er hinter der Schwester in den Nebenraum, um die letzte Botschaft einer Unvergessenen zu lesen.
Der Brief war begonnen worden noch vor der Geburt des Kindes.
Mein Kind!
Noch weiß ich nicht, wirst Du ein Bub oder ein Mädel. In einigen Tagen erst erwarte ich Dich. Aber ich will Dir schon heute sagen, wie ich mich auf Dein junges Leben freue und wie ich hoffe, in Dir Deinen geliebten Vater wiederzufinden! Sollte ich die Geburt nicht überleben, wird die gute Schwester Amara Dich zu Deinem Vater bringen, dem Fürsten Hasso Lahrenfels. Er weiß nichts von Dir. Nach dem Gespräch mit seiner Großmutter konnte ich ihm nichts mehr von Dir sagen. Nun gehörst Du mir, und in wenigen Tagen liegst Du in meinen Armen. Ich freue mich so auf Dich – mein kleines, geliebtes Etwas!
Eines aber sollst und mußt Du immer wissen, Dein Vater ist ein echter Edelmann: offen, ehrlich und hilfsbereit zu allen, die seine Hilfe brauchen, und – er ist sehr lieb.
Einundeinhalbes Jahr später dann ein zweiter Brief!
Mein lieber kleiner Klaus!
Nun bist Du schon anderthalb Jahre alt. Jede Stunde, die ich bei Dir sein kann, ist für mich Glück. Aber wie selten ist das, mein kleiner Liebling! Und oft glaube ich, Du erkennst mich nicht wieder. Da sind so viele gute Schwestern, die für Dich sorgen dürfen. Ach, wie ich sie oft darum beneide! Aber warte nur, mein Herzenskind, ich habe die Stellung an der Klinik in New York erhalten. In einigen Wochen hole ich meinen Jungen zu mir. Und dann bleiben wir zusammen.Wie schön wird das werden! Fast zu schön. Ich kann noch gar nicht daran glauben!
Sollte mir etwas zustoßen, dann holt Dich Dein Vater nach Schloß Lahrenfels. Deine Augen und Dein Sternchen, mein Junge, werden ihm alles sagen. Man wird ihn sofort benachrichtigen, denn ein Schreiben an ihn habe ich immer im Gepäck. Aber warum sollte mir etwas geschehen? Ich habe oft so dumme, ganz dumme Angst, fast schon wie Ahnungen. Und dann soll doch für Dich, mein so sehr geliebtes Kind, Dein Weg, Deine Zukunft vorbereitet sein. Bald bist Du bei mir, mein geliebter, kleiner Klaus. Deine glückliche Mutter.
Hasso war allein. Still hatte Schwester Amara das Zimmer verlassen. Lange saß er, die Briefe in der Hand. Er las sie noch einmal und schämte sich seiner Tränen nicht, die über seine braunen Wangen rannen.
»Lore, verzeih mir!« murmelte er. »Während ich mich in meinem Schmerz, in meine vermeintliche Enttäuschung vergrub, immer noch auf ein Zeichen von dir wartete, dann aber bitter und hart wurde, an keine Frauenliebe mehr glauben wollte, hast du den Kampf, den harten Kampf um das nackte Leben für dich und unser Kind aufgenommen. Und nun schenkst du mir noch unseren prachtvollen Jungen! Ich danke dir, Lore! Und unserem Kind werde ich ein guter Vater sein. Du sollst da oben mit mir zufrieden sein. Und seine Mutter, Marisa, liebt ihn, wie du ihn geliebt hast.«
Plötzlich erfaßte ihn die ganze Tragik dieses Frauenlebens, das geliebt und gekämpft hatte, und dann, das leuchtende Ziel vor Augen, so grauenhaft sterben mußte. Es schüttelte ihn wie ein Krampf, er konnte sein Schluchzen nicht unterdrücken.
Es war sein?Requiem…
Als er sich nach einiger Zeit beruhigt hatte, stand Marisa neben ihm und streichelte sanft und still sein Haar. Auch ihr rannen die Tränen über die Wangen.
»Klaus spielt draußen. Möchtest du allein sein, sag es mir, ich kann es verstehen. Du sollst nur wissen, daß du nicht allein sein mußt, daß ich mit dir fühle und trauere.«
Er stand auf und reckte sich, als wenn er alle Zweifel und Bitterkeit, die ihn jahrelang belastet hatte, abschütteln wollte. Er war erschüttert, aber doch dankbar und erleichtert, daß er jetzt ohne Zweifel und ohne die nagende Ungewißheit an jene Frau denken konnte, die er ehrlich geliebt hatte, der er dankbar war für seinen Sohn. – Nach einem herzlichen Abschied von der Oberin, besonders aber von Schwester Amara, die lange Hassos Hand hielt und ihn, Marisa und Kläuschen dann liebevoll verabschiedete.
Marisa und Hasso gingen zum Auto. In ihrer Mitte hüpfte fröhlich ihr Sohn.
Ihr Kind, das vom Himmel gefallen war – direkt in ihre Herzen.