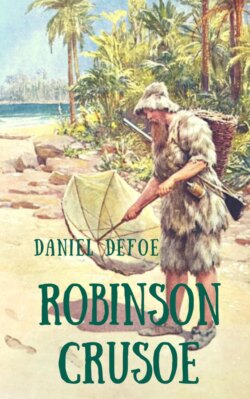Читать книгу Robinson Crusoe - Daniel Defoe, Richard Holmes - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 3
ОглавлениеJetzt vertiefte ich mich gänzlich in die Überlegung, wie ich mich gegen die Wilden, wenn solche sich etwa zeigen sollten, oder gegen die Bestien, wenn deren auf der Insel wären, zu schützen hätte. Ich war anfangs unschlüssig, ob ich mir eine Höhle in die Erde graben oder ein Zelt über derselben errichten solle. Endlich entschloss ich mich Beides zu tun. Die Art und Weise, wie ich es bewerkstelligte, wird dem Leser nicht uninteressant sein.
Ich erkannte bald, dass die Gegend der Insel, in der ich mich damals aufhielt, zu einer Niederlassung nicht geeignet sei, teils weil der Boden dort tief gelegen, sumpfig, dem Meere zu nah und auch ungesund war, und teils, weil sich kein frisches Wasser in der Nähe befand. Ich beschloss daher, einen gesünderen und passenderen Platz auszusuchen.
„Vor Allem“, sagte ich mir, „werden folgende Umstände bei dieser Wahl ins Auge zu fassen sein: erstens gesunde Lage und frisches Wasser; sodann Schutz vor der Sonnenhitze; Sicherung vor wilden Menschen oder Tieren; endlich ein freier Ausblick auf die See, damit du, wenn Gott dir ein Schiff auf Sehweite nahe kommen lässt, nicht die Gelegenheit zu deiner Befreiung versäumst.“ Denn ich hatte noch keineswegs aufgegeben, auf diese zu hoffen.
Bei dem Suchen nach einer geeigneten Stelle fand ich denn auch eine kleine Ebene neben einem felsigen Hügel, der wie die Fronte eines Hauses steil nach jener hinabfiel, so dass von oben her kein lebendes Wesen so leicht an mich herankommen konnte. An der Seite dieses Felsens war eine Höhlung wie der Eingang zu einem Keller, ohne dass jedoch der Felsen an dieser Stelle wirklich ausgehöhlt gewesen wäre.
Auf dieser grünen Fläche nun, gerade vor der Höhlung, beschloss ich, mein Zelt aufzuschlagen. Der ebene Platz war nicht mehr als hundert Ruten breit und nur etwa zweimal so lang und fiel an seinem Ende unregelmäßig gegen das Meer hin ab. Er lag auf der Nordnordwestseite des Hügels, so dass ich immer vor der Höhe geschützt war, bis die Sonne, was in diesen Gegenden spät geschieht, von Ostsüdost her schien.
Ehe ich das Zelt errichtete, zog ich vor der Höhlung einen Halbkreis, zehn Ellen im Halbmesser von dem Felsen aus und zwanzig Ellen im Durchmesser von seinem einen Endpunkt bis zum andern gerechnet.
In diesem Halbkreis pflanzte ich zwei Reihen Palisaden, die ich in den Boden schlug, bis sie fest wie Pfeiler standen. Sie ragten fünf und einen halben Fuß von der Erde empor und waren oben zugespitzt. Beide Reihen standen nur sechs Zoll voneinander entfernt.
Dann legte ich die aus dem Schiffe abgeschnittenen Tauenden reihenweise zwischen die Pfähle und schlug andere Palisaden, die sich wie Strebepfeiler gegen jene stützten, etwa zweieinhalb Schuh hoch auf der Innenseite gleich in die Erde. Der so errichtete Zaun war dermaßen stark, dass weder Menschen, noch Tiere ihn hätten durchbrechen oder übersteigen können. Am meisten Mühe bei der ganzen Arbeit kostete es mich, die Pfähle in dem Wald zu fällen, sie an Ort und Stelle zu schaffen und in den Boden einzutreiben.
Zum Eingang in diesen Platz bestimmte ich nicht eine Tür, sondern ich überstieg den Zaun stets mit Hilfe einer kurzen Leiter. Befand ich mich in der Einfriedigung, so zog ich die Leiter hinter mir her und war so, wie ich glaubte, gegen alle Welt sicher verschanzt. Indes sah ich später ein, dass all diese Vorsichtsmaßregeln unnötig gewesen waren.
In meine neue Festung brachte ich nun mit unsäglicher Mühe all meine Reichtümer, die Lebensmittel, die Munition, das Werkzeug, und was ich sonst oben erwähnt habe. Sodann errichtete ich mir ein großes Zelt, und zwar um vor dem Regen, der zu gewisser Jahreszeit hier sehr heftig ist, geschützt zu sein, ein doppeltes, d. h. ich spannte über ein kleineres Zelt ein größeres, das ich oben mit einem Stück geteerter Leinwand bedeckte, welche ich unter den Schiffssegeln gefunden hatte.
Statt in dem Bett, das ich ans Land gebracht, zu schlafen, nahm ich von jetzt an mein Nachtlager in einer sehr guten Hängematte, die früher dem Steuermann gehört hatte. In das Zelt brachte ich alle meine Vorräte, die keine Nässe vertragen konnten; nachdem ich nun meine Güter solchergestalt sämtlich hereingeschafft, verschloss ich den bis dahin offen gelassenen Eingang und stieg von nun an, wie gesagt, mittels der Leiter aus und ein.
Hierauf machte ich mich daran, ein Loch in den Felsen zu graben, trug alle Erde und Steine, die ich dabei losarbeitete, durch das Zelt und legte sie terrassenförmig um den Zaun, so dass der Erdboden auf dessen Innenseite etwa anderthalb Fuß höher wurde als der äußere. Zugleich gewann ich dabei just hinter meinem Zelt eine Höhlung, die mir für meine Behausung als Keller diente.
Schwere Arbeit und manchen Tag kostete es, bis ich alle diese Dinge zu Stande brachte. Aus der Zwischenzeit sind einige Umstände, die mein Nachdenken in Anspruch nahmen, nachträglich zu erwähnen. Einmal, während ich an meinem Zelt und an der Höhlung arbeitete, erhob sich ein starkes Gewitter. Aus dunklem dickem Gewölke zuckte plötzlich ein Blitz und ein gewaltiger Donnerschlag folgte. Rascher noch wie dieser Blitz überkam mich der Gedanke: O weh, mein Pulver! Das Herz bebte mir bei der Überlegung, dass ein einziger Blitzstrahl meinen ganzen Vorrat vernichten könne, von dem, so meinte ich, nicht nur die Verteidigung, sondern auch die Ernährung meines Lebens gänzlich abhängig sei. Wegen der Gefahr, in der ich selbst dabei schwebte, ängstigte ich mich nicht so sehr, obwohl ein Funke, ins Pulver geraten, mich ja gleichfalls augenblicklich vernichtet haben würde.
Ich war von jenem Gedanken so betroffen, dass ich, sobald der Sturm vorüber war, alles andere stehen und liegen ließ, um nur Beutel und Kästen anzufertigen, in denen ich das Pulver verteilen und in kleinen Partien aufheben wollte; denn ich hoffte, es würde dann wenigstens nicht alles zu gleicher Zeit vom Feuer verzehrt werden. Diese Arbeit brachte ich in etwa vierzehn Tagen fertig. Ich teilte mein Pulver, das etwa zweieinhalb Zentner wog, in wenigstens hundert Häuflein. Von dem Fässchen, das Wasser gezogen hatte, fürchtete ich keine Gefahr und hob es daher in meiner neuen Höhle auf, die ich meine Küche nannte. Das Übrige verbarg ich in Löchern unter dem Felsen, damit es nicht nass werden sollte, und merkte mir aufs Genaueste die Orte, wo ich es aufbewahrt hatte.
Diese Beschäftigung zur Sicherung meines Schießbedarfs unterbrach ich jeden Tag durch Pausen, in denen ich wenigstens einmal mit dem Gewehre ausging, sowohl zum Vergnügen, als auch um zu sehen, ob ich irgendetwas Essbares erlegen könne. Zu gleicher Zeit beabsichtigte ich hierbei mich möglichst mit dem, was die Insel hervorbrachte, bekannt zu machen. Gleich auf dem ersten dieser Streifzüge entdeckte ich zu meiner großen Befriedigung, dass es hier Ziegen gab; sie zeigten jedoch so viel Schlauheit, Vorsicht und Flinkheit, dass ihnen nur mit der allergrößten Schwierigkeit beizukommen war. Dennoch gab ich die Hoffnung nicht auf, hin und wieder eine davon zu schießen. Bei der Verfolgung ihrer Fährten beobachtete ich, dass sie, wenn sie sich auf dem Felsen befanden und mich im Tale erblickten, in größtem Schreck davoneilten, während sie dagegen im Tale weidend, wenn ich auf dem Felsen stand, mich gar nicht beachteten. Da ich hieraus schloss, dass sie durch die Stellung ihrer Augen genötigt seien, den Blick zur Erde zu richten und dem zufolge nicht leicht Gegenstände über ihnen wahrnehmen könnten, wendete ich später den Kunstgriff an, ihnen immer von den Felsen aus beizukommen, von wo aus ich dann auch oft Gelegenheit hatte, Beute zu machen.
Bei der ersten Jagd auf diese Tiere erlegte ich eine Geis, die ein Junges säugte. Das tat mir nun sehr leid. Als die Alte tot hingefallen war, stand das Lamm ganz still neben ihr, bis ich kam und sie aufhob, worauf das Junge mir nach meiner Einfriedigung folgte. Ich legte die Ziege von den Schultern ab und hob das Lamm über die Einpfählung. Meine Hoffnung, es aufziehen zu können, erfüllte sich nicht, denn da es nicht fressen wollte, musste ich es gleichfalls töten und zu meinem Unterhalt verwenden. Die beiden Tiere versahen mich auf lange Zeit mit Fleisch, da ich nur wenig aß und mit meinen Vorräten überhaupt (besonders aber mit dem Brot) so sparsam als möglich umging.
Nachdem ich mich nun fest angesiedelt hatte, fand ich es unumgänglich nötig, mir einen Platz zur Feuerung und Brennmaterial zu verschaffen. Ehe ich berichte, wie ich dies bewerkstelligte, muss ich zunächst angeben, welche sehr verschiedenartigen Gedanken mir, seit ich die Insel bewohnte, durch den Kopf gingen.
Die Aussicht, die sich vor meinem inneren Auge eröffnete, war sehr düster. Ich war auf diese Insel nur durch einen heftigen Sturm, der mich gänzlich von dem beabsichtigten Kurs und Hunderte von Meilen weit von den gewöhnlichen Handelswegen verschlagen hatte, getrieben. Daher hatte ich guten Grund anzunehmen, dass ich nach dem Ratschluss des Himmels auf diesem öden Fleckchen Erde in trostloser Weise mein Leben endigen solle.
So oft ich bei diesem Gedanken verweilte, rannen mir die Tränen reichlich über das Gesicht. Zuweilen haderte ich mit der Vorsehung darüber, dass sie ihre Geschöpfe so ins Verderben führe und so ganz und gar unglücklich und hilflos verlassen mache, dass man für die Erhaltung eines solchen Daseins ihr kaum Dank zollen könne.
Immer aber wurden diese Gedanken durch irgendeine andere Betrachtung rasch in eine abweichende Richtung geleitet. Besonders einmal, als ich, das Gewehr in der Hand, am Strande handelnd über meine Lage nachdachte und mir jene vermessene Frage wieder aufstieß, drängte sich mir die Erwägung auf: Ja, es ist wahr, du bist in einer trostlosen Lage, aber gib dir doch Antwort auf dies: Wo sind deine Gefährten? Waret ihr nicht zu Elfen in dem Boot? Wo sind die anderen Zehn? Warum sind denn nicht sie gerettet, und warum bist nicht du untergegangen? Warum hast du allein diese Auszeichnung erfahren? Ist es besser hier zu sein oder dort in den Fluten? Hat man nicht die Pflicht alles Übel zugleich mit dem, was es Gutes bietet, zu betrachten und mit dem zu vergleichen, was schlimmer sein könnte?
Dann fiel mir ein, wie gut für meinen Unterhalt hier gesorgt sei und in einer wie viel schlimmeren Lage ich mich befinden würde, wenn nicht zufällig das Schiff von dem Platz aus, an dem es gescheitert war, so nahe ans Land getrieben worden war, dass ich alle jene Dinge daraus zu holen vermochte; und ferner wie traurig meine Existenz sein würde, wenn sie so geblieben wäre, wie da ich zuerst ans Ufer kam, ohne alle Notwendigkeiten des Lebens. „Vor Allem aber“ (rief ich in lautem Selbstgespräch aus), „was würde ich ohne ein Gewehr, ohne Munition, ohne jedes Arbeitswerkzeug, ohne Kleider und Betten, ohne Zelt oder sonstiges Obdach angefangen haben?“ Dann erinnerte ich mich, dass ich jetzt alle diese Dinge reichlich besitze und mich auf dem Wege befinde, mir meinen Unterhalt auch ohne die Gewehre verschaffen zu können, wenn meine Munition einmal verbraucht sein würde. Denn von Anfang an hatte ich darauf gedacht, wie ich für die Zeit, in der nicht nur mein Schießbedarf zu Ende sein, sondern auch meine Kraft und Gesundheit in Verfall geraten sein werde, für mich sorgen wolle.
Ich bemerke hierzu, dass die Furcht vor der Vernichtung meines Pulvers durch den Blitz damals noch gar nicht in mir aufgetaucht war, daher auch der Gedanke hieran mich bei dem ersten Gewitter umso jäher überfiel.
Nun aber will ich den traurigen Bericht von einem einsamen Dasein, wie es vielleicht nie ein anderer Mensch auf Erden geführt hat, von seinem Beginne an erzählen und in aller Ordnung fortführen.
Wir hatten nach meiner Berechnung den 30. September, als ich den Fuß zuerst auf die fürchterliche Insel setzte, es war also die Jahreszeit, in welcher bei uns die Sonne in der herbstlichen Tag- und Nachtgleiche steht. Dort dagegen glühte sie senkrecht über meinem Scheitel. Wie ich durch eine Berechnung, die ich angestellt, zu wissen glaubte, lag meine Insel 9 Grad 22 Minuten nördlich von der Linie.
Nach etwa zwölf Tagen fiel mir ein, dass, wenn ich keine Vorkehrungen träfe, ich aus Mangel an Büchern, Feder und Tinte in der Zeitrechnung irre werden müsse und bald sogar den Sonntag nicht mehr von den Wochentagen würde unterscheiden können. Um dies zu verhindern, erfand ich folgendes Auskunftsmittel: ich schnitt mit meinem Messer auf eine große Tafel, die ich kreuzförmig an einen Pfahl befestigte, den ich da, wo ich gelandet war, in die Erde getrieben hatte, die Worte ein:
„Hier bin ich am 30. September 1659 gelandet.“
An den Seiten dieses viereckigen Pfahls machte ich täglich mit dem Messer einen Einschnitt, an jedem siebenten Tage einen doppelt so langen als an den übrigen und wiederum am ersten Tage jedes Monats eine doppelt so große Einkerbung, als diejenigen für die Sonntage waren. Auf diese Weise führte ich meinen Kalender, meine Wochen-, Monats- und Jahresrechnung.
Ich habe hier noch zu bemerken, dass unter den Gegenständen, die ich vom Schiffe gebracht, sich einige an sich ziemlich wertlose, mir aber sehr nützliche, befanden, die ich oben zu erwähnen unterlassen habe: hierzu gehörten unter anderem Federn, Tinte, Papier, die ich zum Teil aus den Vorräten des Kapitäns, des Steuermanns, des Stückmeisters und des Zimmermanns entnommen hatte; ferner mehre Kompasse, einige mathematische Instrumente, Quadranten, Ferngläser, Karten und Schifffahrtsbücher. Das alles hatte ich zusammengerafft, ohne viel darüber nachzudenken, ob ich es jemals brauchen könne oder nicht. Auch drei gute Bibeln waren mir in die Hände gefallen, die mit meinen Sachen von London gekommen waren, und die ich unter meine Reiseeffekten gepackt hatte. Sodann hatte ich einige portugiesische Bücher, darunter drei katholische Gebetbücher und verschiedene andere Schriften, aus dem Wrack mitgenommen und sorgfältig aufbewahrt. Ferner darf ich nicht vergessen, dass an Bord unseres Schiffes ein Hund und zwei Katzen gewesen waren, von denen ich im Verlauf meiner Geschichte noch zu reden haben werde. Denn die beiden Katzen hatte ich mitgenommen; der Hund aber war an dem Tage, nachdem ich die erste Floßfahrt gemacht hatte, von selbst aus dem Schiffe gesprungen und ans Land geschwommen. Er war mir manches Jahr hindurch ein treuer Gefährte, trug und apportierte mir alles Mögliche und leistete mir Gesellschaft, so gut er vermochte. Ihn aber sprechen zu lehren, wollte nicht gelingen, wie große Mühe ich mir auch darum gab.
Wie schon bemerkt, hatte ich auch Federn, Tinte und Papier gefunden. Ich ging damit sehr haushälterisch um, zeichnete aber dennoch, so lange der Vorrat reichte, alle meine Erlebnisse auf das Genaueste auf. Später wurde mir dies unmöglich, da es mir durchaus nicht gelang, Tinte zu bereiten.
Überhaupt gebrach es mir, so viel Gegenstände ich auch um mich aufgehäuft hatte, doch an einer Menge sehr wesentlicher Dinge, so zum Beispiel außer der Tinte an einer Hacke und einem Spaten, oder einer Schaufel, um die Erde damit umzugraben; ferner an Nähnadeln, Stecknadeln und Zwirn. Was die Wäsche angeht, so gewöhnte ich mich schnell daran, sie zu entbehren.
Dieser Mangel an Gerätschaften erschwerte natürlich alle meine Arbeiten, und so dauerte es zum Beispiel fast ein Jahr, bis ich die Einzäunung meiner Wohnung beendigt hatte. Die Pfähle, die ich so schwer wählte, als ich sie nur tragen konnte, nahmen viel Zeit zum Fällen, Vorbereiten und Heimschaffen in Anspruch. Zuweilen brauchte ich zwei Tage, um eine von diesen Palisaden fertig an Ort und Stelle zu bringen, und einen dritten Tag, um sie in die Erde zu treiben. Hierzu bediente ich mich anfangs eines schweren Holzstückes, später aber nahm ich dazu eine der eisernen Brechstangen. Trotzdem war es ein mühsames und zeitraubendes Werk, diese Pfähle festzumachen. Aber was lag daran, dass irgendetwas, das ich verrichtete, Zeit kostete, da ich ja deren in Überfluss hatte? Denn so viel ich vorläufig übersah, blieb mir nach Vollendung jener Arbeit nur noch die übrig, die Insel nach Lebensmitteln zu durchsuchen, was ich ohnehin schon jetzt fast an jedem Tage tat.
Ich fasste nun meine Lage ernsthaft ins Auge und setzte das Ergebnis schriftlich auf, nicht sowohl um den Bericht Denen zu hinterlassen, die etwa nach mir einmal auf die Insel kommen würden (denn ich hatte wenig Aussicht auf Erben), als um mich dadurch von den Gedanken, die täglich auf mich einstürmten und mir die Seele verdüsterten, zu befreien. Meine Vernunft begann allmählich Herr zu werden über meine verzweifelte Stimmung; ich tröstete mich dadurch, dass ich das Gute meiner Lage dem Schlimmen derselben gegenüberstellte und unparteiisch, gleichwie der Kaufmann sein Soll und Haben, die Freuden gegenüber den Leiden, die ich erfuhr, folgendermaßen verzeichnete:
Das Schlechte/Das Gute:
Ich bin auf eine wüste, trostlose Insel ohne alle Hoffnung auf Befreiung verschlagen. Aber ich lebe und bin nicht, wie alle meine Gefährten, ertrunken.
Ich bin vereinsamt und von aller Welt geschieden, dazu verurteilt ein elendes Dasein zu führen. Jedoch bin ich auch erlesen aus der ganzen Schiffsmannschaft, vom Tode verschont zu bleiben, und der, welcher mir das Leben wunderbar erhalten hat, kann mich auch aus dieser elenden Lage wieder erlösen.
Ich bin von der Menschheit getrennt, ein Einsiedler, verbannt vom Menschengeschlechte. Trotzdem bin ich auf diesem öden Orte nicht an Hunger gestorben.
Ich habe keine Kleider, um meine Blöße zu bedecken. Aber ich befinde mich in einem heißen Klima, wo ich Kleider, hätte ich sie, schwerlich tragen könnte.
Ich bin ohne Verteidigungsmittel gegen irgendeinen gewaltsamen Angriff von Menschen oder Tieren. Allein ich bin an eine Insel verschlagen, wo ich keine wilden Tiere zu sehen bekomme, wie ich sie an der afrikanischen Küste sah. Was wäre aus mir geworden, hätte ich dort Schiffbruch gelitten?
Ich habe keine Seele, um mit ihr zu reden, oder mich von ihr trösten zu lassen. Aber Gott schickte durch wunderbare Fügung das Schiff so nahe ans Land, dass ich so viele Dinge daraus holen konnte, die zur Befriedigung meiner Notdurft selbst dienen oder mir die Mittel zur Befriedigung derselben an die Hand geben werden, so lange ich lebe.
Alles in Allem ergab diese Übersicht, dass es zwar kaum eine unglücklichere Lage als die meinige in der Welt gab, dass aber doch negative und positive Umstände darin vorhanden waren, um derentwillen ich dankbar sein musste. Daraus mag man lernen, dass kein Zustand existiert, der nicht etwas Tröstliches darbietet, und bei dem wir nicht bei der Verzeichnung des Guten und Schlimmen immer dem Debet gegenüber auch etwas auf die Seite des Kredits zu setzen haben.
Nachdem ich mich auf solche Weise mit meinem Zustand einigermaßen ausgesöhnt, dagegen aber die Hoffnung, auf der See ein Schiff zu erspähen, aufgegeben hatte, begann ich, mir das Leben so angenehm einrichten, als es nur möglich war.
Meine Wohnung habe ich bereits beschrieben. Sie bestand, wie erwähnt, aus einem Zelt zu Füßen eines Felsens, das mit eigener starker Einzäunung von Pfählen und Tauen umgeben war. Ich durfte diese wohl eine Mauer nennen, besonders nachdem ich eine Art Wall von Erdstücken, etwa zwei Fuß hoch, an der Außenseite auf derselben aufgeführt und nach Ablauf von etwa anderthalb Jahren von diesem Wall aus Holzstücke gegen den Felsen gestemmt und sie mit Baumzweigen und Ähnlichem bedeckt hatte, um den Regen abzuhalten, welcher während gewisser Jahreszeiten sehr heftig war.
Meine Güter hatte ich sämtlich in diese Einhegung und die im Hintergrund derselben befindliche Höhlung gebracht. Anfangs hatten sie dort einen unordentlichen Haufen gebildet und mir allen Platz weggenommen, so dass ich kaum mich hatte rühren können. Daher hatte ich mich daran gemacht, die Höhlung zu erweitern und tiefer in den Felsen einzudringen. Dieser bestand aus lockerem Sandstein und gab leicht nach. Da ich mich gegen wilde Tiere doch hinlänglich geschützt glaubte, arbeitete ich mich ganz durch den Felsen durch und bekam so eine Tür nach außen hin, durch die ich meine Festung verlassen konnte. So hatte ich nicht nur einen Aus- und Eingang, sondern auch einen größeren Behälter für meine Besitztümer bekommen.
Ich begann sodann mir diejenigen Gegenstände anzufertigen, die mir die notwendigsten schienen, nämlich vor Allem einen Tisch und einen Stuhl, da ich ohne diese nicht einmal die geringe Behaglichkeit, die mir auf der Welt geboten war, zu genießen vermocht haben würde. Denn ohne Tisch hätte ich weder schreiben, noch essen, noch andere dergleichen Geschäfte mit einiger Bequemlichkeit vornehmen können.
Hierbei kann ich nicht umhin zu bemerken, dass, da die Vernunft die Wurzel und der Ursprung der Mathematik ist, Jedermann durch vernünftige Berechnung und Ausmessung der Dinge binnen kurzer Zeit ein Meister in allen mechanischen Künsten zu werden vermag. Ich hatte in meinem früheren Leben niemals Handwerkszeug zwischen den Fingern gehabt, und trotzdem erkannte ich jetzt bald, dass es mir durch Arbeit, Ausdauer und Eifer möglich sein würde, alles, was ich brauchte, wenn ich nur das nötige Geräte gehabt hätte, selbst anzufertigen. Indes machte ich eine Menge Dinge auch ohne Handwerkszeug. Einige lediglich mit Hobel und Beil, und zwar waren das Gegenstände, die wohl nie früher auf solche Art verfertigt waren. Zum Beispiel, wenn ich ein Brett nötig hatte, blieb mir nichts übrig, als einen Baum zu fällen und ihn mit der Axt von beiden Seiten so lange zu behauen, bis er dünn wie ein Brett war, worauf ich ihn dann mit dem Hobel glättete. Freilich konnte ich auf diese Weise aus einem ganzen Baum nur ein einziges Brett erhalten; doch da half nichts weiter als die Geduld, und wenn auch die Anfertigung eines einzigen solchen Gegenstandes mich eine enorme Menge Zeit und Arbeit kostete, so war ja Arbeit und Zeit für mich von geringem Wert, und es kam nicht darauf an, ob ich sie so oder so verwendete.
Zunächst machte ich mir aus den kurzen Latten, die ich auf meinem Floß aus dem Schiffe geholt hatte, Tisch und Stuhl. Ferner brachte ich, nachdem einige Bretter in der oben angegebenen Weise fertig geworden waren, große Fächer von anderthalb Fuß Breite übereinander an der Seitenwand meiner Höhle an, um alle meine Werkzeuge, Nägel und eiserne Geräte darauf zu legen und alles zur größeren Bequemlichkeit an einer bestimmten Stelle zu haben. Hierauf schlug ich Pflöcke in die Felswand, um mein Gewehr und anderes dergleichen daran zu hängen. Meine Höhle sah jetzt aus wie ein großes Magazin von allen unentbehrlichen Dingen, und ich hatte Jegliches so zur Hand, dass diese Ordnung mir ein großes Vergnügen gewährte.
Von nun an begann ich auch ein Tagebuch zu führen und darin meine täglichen Beschäftigungen zu verzeichnen. Früher hatte es mir zu sehr an Ruhe, besonders an Gemütsruhe gefehlt, und mein Journal würde in dieser Zeit mit vielen unbedeutenden Dingen angefüllt worden sein. Da hätte ich zum Beispiel vom 30. September nichts zu berichten gehabt, als etwa: Nachdem ich gelandet und dem Tod des Ertrinkens entronnen war, bin ich, nachdem ich zuvor eine ganze Menge Salzwasser, das ich verschluckt, gebrochen hatte und wieder ein wenig zu mir gekommen war, statt Gott für meine Errettung zu danken, mit dem Ausruf: „Ich bin verloren! ich bin verloren!“ händeringend am Strand auf- und abgelaufen, bis ich müde und matt mich auf die Erde zur Ruhe legen musste, wo ich aber nicht schlafen konnte, aus Furcht gefressen zu werden.
Einige Tage nachdem ich schon alles vom Schiff geholt hatte, konnte ich es nicht unterlassen, doch wieder einmal die Spitze des kleinen Berges zu ersteigen und auf die See hinauszuschauen, in der Hoffnung, ein Schiff zu erblicken. Wirklich bildete ich mir auch ein, in großer Entfernung ein Segel zu erspähen. Ich täuschte mich lange mit dieser Hoffnung und blickte starr auf das Meer, bis ich fast erblindete. Dann gab ich es auf, setzte mich nieder, weinte wie ein Kind und vergrößerte so durch eigne Torheit mein Elend.
Erst nachdem ich diesen Kummer einigermaßen überwunden, meine Niederlassung beendigt und mein Hauswesen eingerichtet hatte, und alles um mich so hübsch wie möglich geordnet war, begann ich mein Tagebuch. Ich will den kärglichen Inhalt desselben (ich konnte es nämlich nur so lange fortsetzen, bis mir die Tinte ausging) hier mitteilen, obwohl dasselbe viele Dinge wiederholt, die schon berichtet sind.
Tagebuch.
Den 30. September 1659. Ich armer unglückseliger Robinson Crusoe habe bei einem fürchterlichen Sturm Schiffbruch gelitten und bin auf diese traurige Insel geraten, der ich den Namen „die Insel der Verzweiflung“ gegeben habe. Alle meine Schiffsgefährten sind ertrunken, und ich selbst bin nur mit Not dem Tode entronnen.
Nachdem ich gelandet war, habe ich den Rest des Tages dazu verwendet, meine trostlose Lage zu erwägen und darüber nachzudenken, dass ich weder Nahrung, Wohnung, Kleidung, Waffen, noch irgendeinen Zufluchtsort habe. Es gebrach mir an jedem Trost und ich sah nichts als Verderben um mich her. Ich erwartete, entweder von den wilden Tieren gefressen, oder von wilden Menschen ermordet zu werden, oder Hungers sterben zu müssen. Als die Nacht kam, erstieg ich einen Baum, aus Furcht vor den Bestien. Es regnete die ganze Nacht hindurch, dennoch aber erfreute ich mich eines gesunden Schlafes.
Den 1. Oktober. Am Morgen sah ich mit großer Verwunderung, dass das Schiff von der Flut dem Ufer weit näher getrieben war, als es am vorigen Tage gelegen hatte. Es war mir ein Trost, es aufrecht stehen und unzertrümmert zu sehen. Denn ich hoffte, wenn sich der Wind lege, könnte ich an Bord gehen, um Lebensmittel und sonstige notwendige Gegenstände holen zu können. Andererseits erneuerte aber der Anblick auch meinen Schmerz um den Verlust der Kameraden, die, so schien es mir, wenn sie an Bord geblieben wären, das Schiff hätten retten können, oder wenigstens nicht ertrunken sein würden. Wäre die Mannschaft gerettet worden, so hätten wir vielleicht aus den Trümmern des Schiffes uns ein Boot bauen und in demselben irgendein anderes Fleckchen Erde erreichen können. Ich verbrachte einen großen Teil des Tages damit, mich durch solche Gedanken zu quälen. Endlich aber, als ich das Schiff beinahe auf dem Trockenen liegen sah, ging ich am Strande so nahe wie möglich an es heran, schwamm dann bis zu demselben und begab mich an Bord. Auch an diesem Tage regnete es unaufhörlich, dabei war es jedoch gänzlich windstill.
Vom 1. bis zum 24. Oktober. Alle diese Tage wendete ich nur zu verschiedenen Fahrten nach dem Schiff an, aus welchem ich, jedes Mal die Zeit der Flut benutzend, auf Flößen ans Land brachte, was ich nur vermochte. Auch in dieser Zeit währte der Regen, wiewohl zuweilen von schönem Wetter unterbrochen, fort. Es scheint dies die regnerische Jahreszeit zu sein.
Den 24. Oktober. Mein Floß schlug um und mit ihm meine ganze Ladung. Doch geschah es in seichtem Wasser, und da die Gegenstände schwer waren, bekam ich viele von ihnen während der Ebbe wieder.
Den 25. Oktober. Es regnete die ganze Nacht und den ganzen Tag über; einige Male traten auch starke Windstöße ein. Während eines solchen brach das Schiff in Stücke und es war nichts mehr davon zu sehen außer dem Rumpf, und auch den erblickte ich nur bei niedrigem Wasser. Ich verbrachte den Tag damit, meine Habe in Sicherheit zu bringen, damit sie der Regen nicht verderbe.
Den 26. Oktober. Ich wanderte heute fast den ganzen Tag am Strande umher, um einen Platz für meine Niederlassung zu finden. Besonders war ich darauf bedacht, mich für die Nacht vor den Angriffen der wilden Tiere und Menschen zu sichern. Gegen Abend traf ich auf einen geeigneten Platz unter einem Felsen. Ich markierte einen Halbkreis für meine Wohnung, die ich mit einem Wall, gleichsam einer Festungsmauer, aus einer doppelten Reihe von Palisaden zu umgeben beschloss, welche letztere ich mit Taustücken zu verbinden gedachte.
Vom 26. bis zum 30. Oktober. Ich plagte mich sehr ab, indem ich all meine Habseligkeiten in die neue Wohnung brachte. Unterdessen regnete es eine Zeitlang heftig.
Den 31. Oktober ging ich des Morgens mit meinem Gewehr auf der Insel umher, um zu jagen und das Land auszukundschaften. Ich erlegte eine Ziege und das Junge folgte mir nach meiner Wohnung, wo ich es später schlachten musste, da es nicht fressen wollte.
Den 1. November. Ich schlug mein Zelt unter dem Felsen auf und schlief dort die Nacht zum ersten Mal. Ich habe es so groß als möglich gemacht, um meine Hängematte darin an Pfählen aufhängen zu können.
Den 2. November trug ich alle meine Kisten und Bretter und die Holzstücke, aus denen ich die Flöße verfertigt hatte, zusammen und bildete aus ihnen, etwas nach Innen zurück von der für die Umzäunung bezeichneten Linie, eine Art Zaun um mich her.
Den 3. November. Ich ging mit dem Gewehr aus und schoss zwei entenartige Vögel, die mir eine vortreffliche Mahlzeit lieferten. Am Nachmittag machte ich mich daran, mir einen Tisch zu verfertigen.
Den 4. November. Die Frühstunden verwendete ich dazu, meine Arbeitszeit regelmäßig einzuteilen. Die Morgenzeit bestimmte ich zu einem zwei- bis dreistündigen Ausgang mit dem Gewehr, vorausgesetzt, dass es nicht regnet. Hierauf will ich bis etwa elf Uhr arbeiten und dann verzehren, was ich gerade Essbares habe. Von zwölf bis zwei Uhr gedenke ich mich zum Schlafe niederzulegen, da das Wetter ungemein heiß ist, der Abend soll dann wieder für die Arbeit bestimmt sein. (Die Arbeitszeit an diesem und den nächsten Tagen verwendete ich gänzlich auf die Anfertigung meines Tisches, denn es ging mir anfangs noch langsam mit der Arbeit. Zeit und Notwendigkeit machten mich jedoch bald darauf zu einem perfekten Naturhandwerker, wie es in gleicher Lage wohl mit jedem Andern geschehen würde.)
Den 5. November. Heute ging ich mit der Flinte und meinem Hunde aus und erlegte eine wilde Katze. Ihr Fell war sehr schön, aber das Fleisch ungenießbar. Ich zog ihr, wie ich es mit allen erlegten Tieren zu tun pflege, das Fell ab und bewahrte es auf. Als ich am Strande zurückging, sah ich mancherlei Seevögel, die ich nicht kannte. Erstaunt und fast erschrocken war ich über den Anblick mehrerer Robben, die, während ich sie anstarrte, ohne gleich zu wissen, was es für Tiere seien, ins Meer eilten und mir für diesmal entrannen.
Den 6. November. Nach meinem Morgenspaziergang beendigte ich den Tisch, doch nicht zu meiner Zufriedenheit; bald jedoch lernte ich so etwas besser machen.
Den 7. November. Es hat sich jetzt schönes Wetter eingestellt. Den 7. 8. 9. und 10. und einen Teil des 12. (denn der 11. war ein Sonntag) verwendete ich dazu, um mir einen Stuhl zu verfertigen. Mit großer Mühe brachte ich auch ein leidliches Gestell zu Stande; doch gefiel es mir nicht, obwohl ich es schon während der Arbeit mehre Male wieder in Stücken zerschlagen und aufs Neue begonnen hatte.
Anmerkung. Nach kurzer Zeit versäumte ich die Sonntage einzuhalten, da ich vergessen hatte, die Einschnitte an meinen Pfosten zu machen, und daher bald nicht mehr die Tage unterscheiden konnte.
Den 13. November. Heute regnete es, was mich ungemein erfrischte und auch die Erde abkühlte. Ein Gewitter aber, von dem der Regen begleitet war, erschreckte mich furchtbar, indem es mich um mein Pulver besorgt machte. Sobald das Unwetter vorüber war, beschloss ich, meinen Pulvervorrat in möglichst viele und kleine Partien zu verteilen und ihn so außer Gefahr zu bringen.
Den 14. 15. und 16. November. Diese drei Tage verwendete ich dazu, kleine viereckige Schachteln oder Kästen zu machen, deren jede ein bis zwei Pfund Pulver fasste. In diesen hob ich meinen Pulvervorrat, und zwar jeden Behälter möglichst entfernt von dem andern, auf. An einem dieser Tage schoss ich einen großen Vogel, der mir vortreffliche Speise lieferte, mir aber unbekannt war.
Den 17. November. Heute begann ich hinter meinem Zelt in den Felsen zu graben, um mir größere Bequemlichkeit zu verschaffen.
Anmerkung. Dreierlei entbehrte ich sehr bei dieser Arbeit, nämlich eine Hacke, eine Schaufel und einen Schiebkarren oder Korb. Daher unterbrach ich meine Arbeit und überlegte, wie ich diesem Mangel abhelfen könnte. Statt der Hacke bediente ich mich der eisernen Brechstangen, die sich, obwohl sie schwer waren, doch dazu eigneten. Eine Schaufel oder ein Spaten war mir dagegen so unerlässlich nötig, dass ich ohne sie nichts anfangen konnte. Doch sah ich vorläufig durchaus nicht ab, wie ich mir solch ein Ding verschaffen sollte.
Den 18. November. Am nächsten Tag fand ich beim Durchstreifen des Waldes einen Baum von der Art, die in Brasilien wegen der Härte ihres Holzes Eisenbäume genannt werden. Von diesem hieb ich, wobei ich aber beinahe meine Art verdorben hätte, mit großer Mühe ein Stück ab und brachte es gleichfalls unter großer Anstrengung, da es sehr schwer war, heim. Die ungemeine Härte des Holzes machte lange Zeit erforderlich, bis ich es endlich in Spatenform gestaltet hatte. Der Handgriff war genau geformt wie der der unsrigen in England, die breite Seite am Fuß entbehrte jedoch der eisernen Bekleidung. Trotzdem leistete es mir gute Dienste.
Ich vermisste nun noch einen Korb oder einen Schiebkarren. Einen Korb vermochte ich durchaus nicht zu Stande zu bringen, da es mir an Zweigen fehlte, die sich zu Flechtarbeit eigneten; wenigstens hatte ich bis jetzt noch keine solchen gefunden. Was dagegen den Schiebkarren angeht, so glaubte ich wohl alle Teile eines solchen herausbringen zu können, bis auf das Rad. Wie ich aber damit zu Stande kommen sollte, davon hatte ich nicht den mindesten Begriff. Ebenso unmöglich war mir aber auch die eiserne Hülse, in welcher die Axe laufen musste, anzufertigen. Ich gab daher das ganze Unternehmen auf und machte mir, um die Erde aus meiner Höhle zu schaffen, eine Art von Lehmkübel, wie ihn die Maurer zum Fortschaffen des Mörtels benutzen. Dies war minder schwierig als die Anfertigung des Spatens, und dennoch nahmen mich beide Arbeiten und der vergebliche Versuch, einen Schiebkarren zu verfertigen, vier volle Tage in Anspruch, natürlich abgerechnet meine Morgenspaziergänge mit dem Gewehr, die ich nur ausnahmsweise unterließ und von denen ich selten heimkehrte, ohne etwas Essbares erbeutet zu haben.
Den 23. November. Nach Anfertigung dieser Werkzeuge nahm ich meine frühere Arbeit wieder auf und verwendete achtzehn Tage gänzlich auf Ausweitung und Vertiefung meiner Höhle, damit diese meine Habe bequemer fassen könne.
Anmerkung. Mein Hauptzweck bei diesem Unternehmen war, einen Raum zu bekommen, der mir als Magazin, Küche, Esszimmer und Keller diene. Ich wohnte nämlich für gewöhnlich in meinem Zelt; nur während der feuchten Jahreszeit nötigte mich der heftige Regen, da ich sonst völlig durchnässt worden wäre, dasselbe zu verlassen. Dies bewog mich später, den ganzen Platz vor der Felswand mit Pfählen, in der Form von Dachsparren, zu bedecken. Diese stützten sich gegen den Felsen und ich bedeckte sie mit Zweigen und breiten Baumblättern wie mit einem Strohdach.
Den 10. Dezember. Ich glaubte schon meine Höhle vollendet zu haben, als plötzlich eine große Menge Erde von der Decke an der einen Seite herabstürzte, was mich nicht wenig erschreckte. Und zwar mit Recht, denn wäre ich gerade unter jener Stelle gewesen, so hätte ich keinen Totengräber nötig gehabt. Dies Missgeschick verursachte mir wieder eine große Menge Arbeit, da ich die abgefallene Erde zu entfernen und, was wichtiger war, die Höhlendecke zu stützen hatte, damit ich ein Herunterfallen derselben nicht mehr zu besorgen brauchte.
Den 11. Dezember. Ich machte mich heute gleich an diese Aufgabe und richtete unter dem Gewölbe zwei Pfeiler, die ich mit zwei Querbrettern kreuzte, auf. Am nächsten Tag war ich hiermit zu Ende, fügte dann aber noch weitere Pfeiler und Bretter dazu und hatte so binnen einer Woche das Dach befestigt, und die reihenweise eingeschlagenen Pfosten dienten mir zugleich dazu, meine Wohnung in einzelne Räume abzuteilen.
Den 17. Dezember. Von diesem Tag bis zum 20. gab ich mich damit ab, Gefächer aufzurichten und Nägel in die Pfosten zu schlagen, um alles daran aufzuhängen, was sich dazu eignete. Jetzt fing ich endlich an, in meiner Behausung einigermaßen Ordnung zu haben.
Den 20. Dezember. Ich trug alles, was dahin gehörte, in den Keller und schlug kleine Bretter, wie ein Gesims, auf, um meine Lebensmittel darauf zu legen. Als jedoch meine Bretter auf die Neige gingen, machte ich mir noch einen zweiten Tisch, um allerlei auf denselben stellen zu können.
Den 24. Dezember. Es regnete die ganze Nacht, sowie den ganzen Tag, und ich konnte daher nicht ausgehen.
Den 25. Dezember. Unaufhörlicher Regen.
Den 26. Dezember. Der Regen hatte aufgehört. Die Erde war stark abgekühlt und die Temperatur sehr angenehm.
Den 27. Dezember. Ich erlegte eine junge Geis und lähmte eine andere, die ich fing und an einem Strick nach Hause führte; hier verband und schiente ich ihr das zerbrochene Bein.
Nota bene. Ich sorgte für das Tier so, damit es am Leben bleibe. Das Bein heilte und wurde so gerade wie vorher. Durch mein Füttern machte ich das Tier zahm, es weidete auf dem kleinen grünen Platz vor meiner Tür und lief niemals fort. Jetzt kam mir zum ersten Mal der Gedanke, Tiere aufzuziehen und zu zähmen, um davon zu leben, wenn ich einmal meinen Schießbedarf verbraucht haben würde.
Den 28. bis 31. Dezember. Große Hitze und völlige Windstille, so dass ich nur am Abend zur Jagd ausgehen konnte. Die Tage verbrachte ich damit, alle meine Sachen zu ordnen.
Den 1. Januar. Immer noch große Hitze, doch ging ich in der Frühe und abends mit meinem Gewehr aus; die Zwischenzeit über lag ich still zu Hause. An diesem Abend ging ich tiefer hinein in die Täler, die nach dem Mittelpunkt der Insel hin liegen, und fand dort eine Menge Ziegen, denen ich aber, weil sie so scheu waren, nicht beikommen konnte. Ich beschloss daher, zu versuchen, ob es nicht gelingen werde, sie mit dem Hunde zu jagen.
Den 2. Januar. Sogleich am nächsten Tag stellte ich diesen Versuch an. Ich hatte mich jedoch verrechnet, denn die Ziegen kehrten sich alle mit dem Gehörn gegen den Hund, und er hütete sich wohl, ihnen zu nahe zu kommen.
Den 3. Januar. Heute begann ich mein Gebiet einzuzäunen und machte, da ich noch immer in der Furcht lebte, von jemandem angegriffen zu werden, die Umhegung so dick, fest und stark, wie nur möglich.
Anmerkung. Da ich die Einzäunung früher beschrieben habe, so übergehe ich, was darüber in dem Tagebuch gesagt ist. Es genügt, zu bemerken, dass ich nicht weniger als vom 3. Januar bis zum 14. April mit der Vollendung derselben beschäftigt war, wiewohl sie nur vierundzwanzig Ellen in der Länge (von einem Ende des Felsens bis zum andern gemessen) und acht Ellen in der Tiefe (von der Tür der Höhle, als dem Mittelpunkt, aus gerechnet) maß.
Diese ganze Zeit über arbeitete ich sehr angestrengt, wobei mir jedoch der Regen viele Tage, ja einige Male ganze Wochen hindurch hinderlich war. Doch hielt ich mich nicht vollkommen sicher, bis ich die Einhegung vollendet. Man glaubt kaum, was für eine unbeschreibliche Arbeit sie mir machte; besonders war dies der Fall mit dem Herbeischaffen der Pfähle aus dem Walde und dem Einschlagen derselben in die Erde.
Als der Wall beendigt war, hielt ich ihn für so dicht, dass, wenn Besucher auf die Insel kommen sollten, sie nichts einer menschlichen Wohnung Ähnliches dort entdecken würden. Dass ich mit dieser Ansicht Recht hatte, wird sich später bei einer merkwürdigen Gelegenheit zeigen.
Auch während dieser Beschäftigung machte ich täglich meinen Jagdausflug in die Wälder, das heißt, so oft es der Regen zuließ. Hierbei entdeckte ich häufig erfreuliche Dinge. Besonders gehört dahin, dass ich eine Art wilder Tauben fand, die nicht wie die Waldtauben auf Bäumen, sondern wie die Haustauben in Felslöcher bauten. Ich nahm einige Junge mit mir und bemühte mich sie aufzuziehen. Als sie jedoch älter wurden, flogen sie sämtlich fort, da ich ihnen nicht ausreichendes Futter geben konnte. Indes fand ich oft solche Nester und holte mir dann die Jungen heraus, die ich mir sehr wohl schmecken ließ.