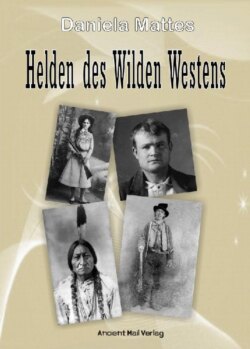Читать книгу Helden des Wilden Westens - Daniela Mattes, Roland Roth - Страница 6
ОглавлениеDer amerikanische Goldrausch
Abb. 9: Goldgräbersiedlung beim Goldrausch in Klondike
Gold wurde und wird in vielen Gebieten gefunden, aber die sicherlich legendärsten Erzählungen, wenn es um Goldsuche oder gar den Goldrausch geht, drehen sich um die Funde in Amerika, hauptsächlich zu der Zeit, als der Westen noch wild war. Sicherlich wäre ohne den großen Ansturm der Goldsucher (Prospektoren) das Land nicht so schnell und an so vielen Stätten besiedelt worden. Schnell wurden Zeltstädte und bei längerem Aufenthalt Holzhütten, danach sogar Gebäude aus Stein errichtet.
Die Sache hatte nur einen Haken, oder sogar zwei: zum einen gab es keine Garantie, dass jeder Gold finden würde oder dass die Vorkommen ewig reichten. Daher musste manch einer pleite wieder abziehen. Der rasche Verfall der Städte führte im Endeffekt dazu, dass diese dann zu Geisterstädten wurden, die man heute in ganz Amerika findet. Der zweite Haken war der, dass die Gier nach Gold viele unehrliche Gesellen anzog, fiese Geschäftemacher, Räuber, Mörder … Aus diesem Grund waren viele Boomtowns gleichzeitig ein Hort der Gesetzlosen und entsprechend gefährlich.
In Amerika gab es viele einzelne Goldräusche, doch nicht jeder davon war berühmt und hatte denselben Ansturm wie die anderen. Die drei berühmtesten waren die in Kalifornien, Colorado und Alaska/Kanada in Klondike. Diese war dann auch der letzte große Goldrausch überhaupt. Wir werden daher hauptsächlich Kalifornien und Klondike beleuchten, da es auch nicht möglich ist, in diesem Bericht alle Schauplätze ausführlich zu besprechen.
Schauen wir zunächst, wo alles begann.
1848 Kalifornien.
„Wer hat’s erfunden? Die Schweizer!“ möchte man beinahe sagen, denn mit einem Schweizer hat eigentlich alles begonnen. Der Kaufmann Johann August Sutter, der eigentlich Suter hieß (23.02.1803 – 18.06.1880), war ein reicher Abkömmling einer Firma, die Papier herstellte und außerdem Druckereien besaß. Als er wegen unsauberer Geschäfte vor den Schweizer Behörden floh, landete er in Kalifornien, das damals zu Mexiko gehörte, und ließ sich 1839 im Sacramento-Tal nieder.
Abb. 10: Ölgemälde: Sutter, eigentl.
Suter, gemalt von Frank Buchser (1866) (Wikipedia, gemeinfrei)
Er vertrieb die Indianer und baute sich ein Reich auf, das er Neu-Helvetien nannte. Schließlich fiel das Gebiet jedoch nach Beendigung des Amerikanisch-Mexikanischen Krieges 1848 von den Mexikanern an die USA und sein Traum vom eigenen Reich zerplatzte. Im selben Jahr wollte er nämlich von James W. Marshall eine Sägemühle am American River bauen lassen. Bei den Grabungsarbeiten fand Marshall ein Goldnugget und Sutter konnte nicht verhindern, dass Marshall dies sofort herumposaunte. Sutter konnte sich vorstellen, was passieren würde … und genau so traf es auch ein.
Abb. 11: Zeitgenössische Darstellung von Sutters Fort (Wikipedia, gemeinfrei)
Marshall bezahlte seine Rechnungen beim örtlichen Kaufmann Kaufmann Samuel Brannan (1819-1889) mit Gold, was natürlich ziemlich auffällig war. Noch ungünstiger war die Tatsache, dass Brannan eine gute Geschäftsidee umsetzte. Er verkaufte lautstark eine riesige Menge Schaufeln, neben die er ein Glas mit Goldstaub stellte und dazu verkündete, dass es im American River Gold gab.
Die Leute stürmten jetzt von überall herbei, wanderten sogar von Deutschland dorthin aus, um an der Fundstelle nach Gold zu suchen, und obwohl es sich dabei eigentlich um SEIN Land handelte, hinderte es die Goldsucher nicht daran, sich darauf munter einen Claim abzustecken und drauf los zu buddeln. Recht und Gesetz spielten bald keine Rolle mehr. Auch seine eigenen Arbeiter widmeten sich lieber der Goldsuche als ihrem Job und so ging Sutter schließlich bankrott.
Aber nicht nur Sutter hatte der Goldrausch geschadet, sondern dem gesamten Land. Über 100.000 Ureinwohner verloren ihr Leben, Flüsse und Seen waren nachhaltig geschädigt. Denn zum Goldabbau wurden sie oft trockengelegt und umgeleitet. Das gesamte Ökosystem geriet aus dem Gleichgewicht.
Doch mit Sutters Ruin ist die Geschichte des Goldrauschs natürlich noch nicht zu Ende. In San Francisco ging es jetzt erst richtig rund. Die Zeitungen berichteten ebenfalls überall vom Goldfund und schürten die Gier der Prospektoren noch weiter. Massenweise landeten die Einwanderer hier mit den Schiffen und sorgten dafür, dass die Bevölkerung in San Francisco explodierte. Unter den ersten Einwanderern und Goldsuchern waren die Chinesen, die später fast 20 Prozent der Bevölkerung San Franciscos ausmachten. Sie wurden anschließend speziell beim Bau der Eisenbahn eingesetzt, mussten sich aber ständig gegen Diskriminierungen und Überfälle wehren.
Abb. 12: Photo panorama of San Francisco, 1853 Source http://www.daguerre.org/gallery/oakland/5ca.html (wikipedia, gemeinfrei)
1849 die „Forty-Niner“
Besonders im Jahr 1849 ging es so richtig rund in Kalifornien, daher hatten die Goldsucher dann auch ihren Spitznamen “Forty-Niner“. Gaststätten, Bordelle und alles, was die Goldsucher so brauchten, konnte man hier finden. Recht und Gesetz war Mangelware, Mord, Raub und Tote waren an der Tagesordnung. Genauso wie Brände in den Holzhütten, verursacht durch die Petroleum- und Lebertran-Lampen. San Francisco ist eine der wenigen Boomtowns, die nach dem Abflauen des Goldrausches nicht zur Geisterstadt geworden ist.
Abb. 13: Plakat aus dem Jahr 1849 für Schiffspassagen nach Kalifornien zum Goldrausch (Wikipedia, gemeinfrei)
Als nun die Forty-Niner ein Jahr nach dem ersten Fund endlich eintrafen, waren die besten Claims schon weg und außerdem stellten sie fest, dass auch das meiste Gold, das man leicht aus dem Fluss herauswaschen konnte, schon verschwunden war. Um weiter zu graben oder komplizierter zu schürfen, benötigte man Geld, welches die Glücksritter natürlich nicht besaßen.
Eine Möglichkeit der Unterstützung bestand darin, dass sich die Goldsucher Arbeitsgeräte von Förderern ausliehen – gegen eine Beteiligung am Erlös des gefundenen Goldes. Einige Männer betrieben diese Art der Förderung im großen Stil, hauptsächlich Kaufleute und Saloonbesitzer. Eine andere Möglichkeit war, sich mit mehreren Männern zusammenzutun, um gemeinsam mit größerem Werkzeug und vereinten Kräften am Goldabbau zu arbeiten.
1853 kam der deutsche Jude Levi Strauss (eigentlich Löb Strauss, geb. 1829 in Buttenheim bei Bamberg) nach San Francisco, wo er mit seinem Schwager und seinem Bruder ein Geschäft eröffnete, das mit Stoffen und Kurzwaren handelte.
Abb. 14: Löb Strauss, Fotograf unbekannt (Wikipedia, public domain)
Er verkaufte auch vor Ort den täglichen Bedarf an die Goldgräber. Dabei führte er Stoffballen, Zeltplanen und Nähzeug mit und entdeckte beizeiten den Bedarf an strapazierfähiger Kleidung, der für die Goldsucher unerlässlich war.
Er verkaufte ihnen die sogenannten Duck Pants, die aus Segeltuchstoff bestanden, die aber nicht lange hielten, bzw. deren Nähte nicht lange genug hielten, da die Goldgräber ihr Werkzeug in die Taschen stopften und sie damit kaputtmachten.
1870 kam der Schneider Jacob Davis auf die Idee, dieses Problem dadurch zu lösen, dass er einfach diese Nähte mit Nieten verstärkte. Weil ihm das Geld zur Patentanmeldung fehlte, bat er Levi Strauss um Hilfe, seinen damaligen Stofflieferanten.
1873 erhielten die beiden das Patent für den Waist Overall, der sich großer Beliebtheit erfreute. Diese wurden aus Denim gefertigt und sind der Vorläufer der heutigen Jeans.
Weitere Stationen des Goldrauschs (ohne nähere Erläuterung):
1850 Goldrausch in Oregon und in British Columbia
1854 die Goldlagerstätten in Kalifornien sind erschöpft;
Wirtschaftskrise
1858 Denver, Colorado, South Platte River
1859/60 Nevada, Comstock Lode
1863 Montana und Idaho
1874 Black Hills, in Custer und Deadwood, South Dakota
1896 Klondike
Klondike oder besser die „Klondike Fields“ liegen im Territorium Yukon, dem kleinsten der drei kanadischen Territorien. Es liegt östlich der Grenze zu Alaska.
Abb. 15: Goldsucher am Chilcoot Trail (Wikipedia, public domain)
Als in Kanada/Alaska im Yukon River Gold gefunden wurde, machten sich die Veteranen aus den vorangegangenen Goldräuschen auf, um auch dem Yukon River in der Stadt Dawson das Gold zu entreißen. Die Strecke dorthin war lang und gefährlich und die meisten überlebten nicht einmal die Anreise.
Es gab nur zwei Wege in die Stadt Dawson: a) 2.700 km den Yukon River entlang, der die meiste Zeit des Jahres zugefroren war oder b) 570 km von der Küste Alaskas über die schwer passierbaren Schluchten und Gebirgspässe (Chilcoot Trail).
1870 kamen bereits die ersten Veteranen aus Kalifornien in das Gebiet am Klondike. Dort gab es hauptsächlich zwei Städte: Circle City auf amerikanischem Gebiet und Forty Mile auf kanadischer Seite. Beide bestanden aus Hütten.
Der richtige Goldrausch in Klondike startete allerdings erst 1896 und die Spitze war 1897/98. Der Abbau des Goldes war hier allerdings wesentlich schwieriger als in Kalifornien, denn wer die gefährliche Anreise überstand, hatte anschließend mit den rauen Lebensbedingungen dort zu kämpfen.
Abb. 16: Warteschlange bei der Registrierung des Claims, 1898 Erik A. Hegg (Wikipedia, gemeinfrei, source: Alaska National Archives)
Im Winter war eine bittere Kälte bis minus 59° Grad C auszuhalten, im Sommer bis plus 38° C, gepaart mit einer üblen Stechmückenplage. Nur ganz wenige Frauen kamen in das Gebiet am Klondike, erst als sich die Bedingungen dort gebessert hatten, reisten viele ihren Männern hinterher, es kamen auch Tänzerinnen und Schauspielerinnen nach. Karrierefrauen inbegriffen, die Gaststätten und Wäschereien eröffneten etc.
Der Skagway Trail zwischen der Stadt Skagway, einem Stützpunkt der Goldgräber, bis hin zum Klondike war so hart, dass er 1897 von über 3.000 toten Pferden gesäumt wurde, die auf der Strecke zusammengebrochen waren wegen Überanstrengung und vor Hunger. Es wurde sogar behauptet, dass die Tiere selbst vor Todessehnsucht in den Abgrund gesprungen wären. Die Stadt existiert heute noch und hat ungefähr 850 Einwohner.
Abb. 17: Claim am Bonanza Creek (Wikipedia, gemeinfrei)
Exkurs: Woher kommt eigentlich das Gold und wie wurde es geschürft und abgebaut?
Das Gold kam aus den Bergen, die größtenteils aus Granit bestehen, also aus erstarrtem Magma. Die nacheinander kristallisierten Mineralien scheiden sich in den Erzgängen wieder ab. Flüsse, die durch die Berge fließen, transportieren diese Mineralien dann mit sich bergabwärts bzw. flussabwärts. Diese Partikel, die man lose im Fluss findet und heraussieben kann, nannte man auch „Placer“ oder Seifen- und Waschgold. Diese Art von Gold suchte man vorrangig und dies war auch mit einfachsten Mitteln zu bewerkstelligen. Diese Fundstätten nannte man daher auch „Arme-Leute-Minen“.
Diese winzigen Goldflöckchen konnten also vom abfließenden Gebirgswasser fortgetrieben werden und aufgrund des geringen Gewichts lange Strecken zurücklegen. Schwerere Goldpartikel und Nuggets blieben auf den kürzeren Strecken hängen, besonders da, wo sich das Wasser verlangsamte, wenn das Gelände weniger abschüssig war oder der Fluss eine Kurve machte. Auf diesen Felsbänken waren die Funde dann wahrscheinlicher und ergiebiger.
Abb. 18: Goldwäscher mit einer „Wiege“, Archives of Pearson Scott Foresman
(Wikipedia, gemeinfrei)
Beim Sieben des Sandes und Kieses im Bachbett musste man achtgeben, dass man nicht das Gold mit Glimmer oder Pyrit (Katzengold) verwechselte. Glimmer ist ein Schichtsilikat bzw. eine Bezeichnung für eine ganze Gruppe von Gesteinen, die u.a. in magmatischen und metamorphen Gesteinen vorkommt. Magmatisch wäre z. B. Granit und metamorph Gneis. Sammler kennen wahrscheinlich den Biotit, Lepidolith und Muskovit.
Die Profis hatten sich aber bereits einiges Wissen angeeignet, mit dem sie das Gold leicht unterscheiden konnten. Denn zum einen sieht Gold aus jedem Betrachtungswinkel gleich aus, während der Pyrit und der Glimmer funkeln und blinken, wenn man sie dreht und zum anderen ist echtes Gold weich. Der Finder musste also nur auf den vermeintlichen Goldnugget beißen und beobachten, ob er nachgab und sich verformte oder ob er hart blieb.
Die kleinen Waschtröge aus Zinn, die die Goldwäscher benutzten, waren ca. 10 cm tief und mit einer Öffnung von ca 25 cm gegenüber dem Boden mit 40 cm versehen. Darin schwenkte man dann vorsichtig den Sand und kippte das Wasser immer wieder über die Öffnung hinaus. Der feuchte Rest, der dann im Sieb hängen blieb, konnte getrennt werden in Goldkörnchen /Flöckchen und in den Sand, der wieder ausgekippt wurde. Die Goldkörnchen oder Flöckchen wurden in einer Flasche mit Wasser aufbewahrt.
Abb. 19: Zum Vergleich: Pyritwürfel im Gestein; Flasche mit
Goldflöckchen in Wasser © Daniela Mattes
Manchmal taten sich die Goldsucher auch zusammen, um gemeinsam das Gold zu waschen. Dann konnten sie größere Werkzeuge benutzen und mit einem mechanischen Siebtrog oder oder einer Goldwaschrinne arbeiten. Die Tröge waren flach mit schrägem Rand und mit Maschendraht bespannt, sodass Gold und Kiesel darin zurückblieben. Wenn das Gold im leichten Sand bis zum Felsgrund hinunter abgesunken war, musste zur Goldgewinnung der Fluss trockengelegt werden und im Bachbett nach dem Gold gegraben werden.
Abb. 20: Hier ein Beispiel für das gemeinsame Goldwaschen in Lappland,
1898 (Wikipedia, gemeinfrei)
Manche gruben so tief hinunter, dass sie von dort aus noch Stollen in den Boden des Schachtes gruben, die wie die Speichen eines Rades in verschiedene Richtungen abgingen. Dabei mussten die Stollen mit Holz gestützt werden. Viele taten dies jedoch nicht, was in dem weichen Gestein dazu führte, dass der Stollen über ihnen zusammenbrach und sie beerdigte.
Interessanterweise gab es auch Goldsucher, die in der Wüste gruben. Sie suchten nach alten Flussbetten der ausgetrockneten Flüsse oder von Flüssen, die ihren Lauf geändert hatten. Dort schaufelten sie Sand in Decken und schleuderten diese im Wind. Der Sand und Staub verteilte sich in alle Richtungen, das Gold blieb in der Decke zurück. Diese Art war wenig gewinnbringend und äußerst mühsam. Wenn es windstill war, mussten sie den Sand sogar auf ihre Schaufel nehmen und den Sand von der Schaufel blasen …
Erst sobald die Goldgräber auf ergiebige Vorkommen gestoßen waren, machten sie sich gewöhnlich auf die Suche nach deren Quelle. Denn das Gold war ja vom Fluss aus dem Muttergestein im Berg ausgewaschen worden. Und dies galt es zu finden. Eine aufwendige Grabung und Zerkleinerung des Gesteins war dafür notwendig, wenn man dem Berg nicht anders begegnen konnte, wurden auch Sprengladungen eingesetzt.
Wer genug Kapital hatte, konnte groß investieren. Er konnte Sprengarbeiten bezahlen, Maschinen beschaffen und Bergarbeiter anstellen und sogar ein sogenanntes Pochwerk zum Zerkleinern des Erzes kaufen. Wer gar nicht weiter kam, konnte immer noch zum letzten Mittel greifen und seine Mine für ein paar Dollar verkaufen an jemanden, der genügend Kapitel in den Abbau investieren konnte.
Die Einzelkämpfer konnten sich jedoch nicht lange halten und das romantische Bild des Goldgräbers, der am Fluss sitzt und ein wenig Sand siebt, wurde rasch abgelöst durch den industriellen Bergbau, der mittels Hydraulikpumpen die Fundstätten durchspülte und ausspülte. Viele ehemalige Profi-Goldgräber wurden durch die Industrialisierung arbeitslos.
Wenn Städte nicht aufblühen oder zumindest bestehen bleiben, nachdem der Goldrausch abgeflaut ist, dann zerfallen sie nach und nach zu Geisterstädten, was normalerweise lediglich bedeutet, dass es sich um leere und verfallene Städte handelt.
Anders jedoch einige Geisterstädte, in denen es tatsächlich Geister gibt … dazu eine Stadt als Beispiel. Trotz verbürgten Spuks werden dort jedes Jahr Freiwillige gesucht, die sich als eine Art „Hausmeister“ um die Stadt und die Touristen kümmern. Zum Glück sind die Geister dort sehr friedlich gestimmt und tun keinem etwas zuleide … Die Rede ist von Garnet in Montana.
„Hausmeister“ in einer Geisterstadt?
Ein Aufruf in der Zeitung, dass die Regierung Leute sucht, die gegen Bezahlung die Sommermonate in der Geisterstadt verbringen, hat mich auf die Stadt Garnet aufmerksam werden lassen. Und natürlich habe ich gleich recherchiert, was es für eine Bewandtnis damit hat und um welche Stadt es sich dabei handelt …
In Amerika gibt es viele Tausend Geisterstädte, verlassene Boomtowns mit versiegten Minen. In der Gegend um Garnet in Montana gab es sogar sage und schreibe 50 Minen!
Abb. 21: Karte von Montana, National Atlas (Wikipedia, gemeinfrei)
Garnet liegt ca. 1.800 m hoch, ca 32 km östlich von Missoula in den Garnet Mountains in Montana, USA. Die nächste Stadt in die entgegengesetzte Richtung ist Butte, die ungefähr 160 km entfernt ist. Die Stadt Garnet entstand in den 1860er Jahren, als das erste Gold und Silber in der Gegend gefunden wurde. Zu Spitzenzeiten lebten dort fast 1.000 Menschen. 1895 trug die Stadt noch den Namen Mitchell, wurde aber nach dem braunen Halbedelstein benannt, der in der Gegend gefunden wurde, als Nebenprodukt sozusagen, und der auch als Schleifmittel eingesetzt wurde. (Garnet – Granat/Almandin).
Solange dort genügend Bodenschätze abgebaut werden konnten, herrschte ein reges Stadtleben. Doch ab 1905 wurden die Funde immer weniger und die Menschen wanderten langsam ab. 1912 brannte die halbe Stadt ab und wurde nicht wieder aufgebaut. Während der Großen Depression 1930 erlebte die Stadt noch einmal einen kurzfristigen Aufschwung, doch geriet dann erneut in Vergessenheit. Während des Zweiten Weltkriegs verließ schließlich auch der letzte Bewohner die Stadt. Erst 1970 wurde von der gemeinnützigen Organisation Garnet Preservation Projekt durch Spendengelder einige Sehenswürdigkeiten wieder aufgebaut: J.R. Wells Hotel, Dahl‘s Saloon, Kelly‘s Bar, und F.A. Davey‘s Store.
Eine Zeitzeugin berichtet über das Alltagsleben in einem Video auf der Internetseite der Stadt: http://www.garnetghosttown.net/history.html
Um nun die Stadt in ihrem bemerkenswert intakten Zustand zu erhalten, sucht das US-Bureau of Land Management in jedem Sommer drei Freiwillige, die gratis mit freier Kost und Logis für ein oder zwei Monate dort hausen dürfen. Als Gegenleistung müssen diese Freiwilligen Touren für die Touristen durchführen, den Souvenirshop betreiben und die Gebäude in Schuss halten. Besonders im September herrscht doch Hochbetrieb, bevor das Wetter wieder schlechter wird und der Weg nach Garnet erschwert ist. Denn obwohl die Stadt das ganze Jahr über Besuchern offensteht, ist die Straße nach Garnet vom 1. Januar bis 30. April komplett für Fahrzeuge gesperrt.
Komfort? Fehlanzeige. Der Aufenthalt ist dort lediglich etwas für Outdoor-Fans. Immerhin gibt es jedoch für die „Hausmeister“ möblierte Hütten mit fließendem Wasser und Anschluss zu den sozialen Netzwerken. Für die Saison 2015 hat die Stadt der Zeitung „Huffington Post“ jedoch bereits mitgeteilt, dass alle Plätze vergeben sind. Viele Interessierte kommen schon seit Jahren dorthin und kennen sich bereits bestens aus. Um heute dauerhaft jemanden dort wohnen zu lassen, stehen leider nicht genügend finanzielle Mittel zur Verfügung.
Im Winter dürfen die Hütten auch gemietet werden – gegen Geld allerdings – was besonders die Skisportler freuen dürfte. Oder die Geisterjäger. Denn im Winter sind die Geister besonders aktiv, wie man hört. Geister? Ja, Sie haben richtig gelesen. Garnet ist ein „verbürgter“ Spukort, in dem mehrere Menschen bereits Geistererscheinungen gesehen haben. Zum Glück sind die Geister stets friedlich.
2010 hat die Zeitung Helena Independent Record bereits einen Bericht über die Geisterjägerin Ellen Baumler veröffentlicht, die sich mit den dortigen Spukgestalten gut auskennt. Nachts hört man aus Kelley’s Saloon das Piano erklingen sowie Männerstimmen, die sich unterhalten. Auch getanzt wird dann – so lange, bis sich ein Lebender dem Saloon nähert. Dann ist der Spuk schlagartig zu Ende. Geisterhafte Stimmen werden auch an anderen Orten in der Stadt gehört, Gestalten, die in altmodischer Kleidung durch die Stadt streifen, werden gesichtet. Interessant ist dabei die Tatsache, dass diese Gestalten Fußspuren im Schnee hinterlassen, die in die Gebäude hinein – aber nicht mehr hinausführen. Und im Hotel wird des Öfteren eine Frau gesehen, die aus dem Fenster starrt.
Die Stadt selbst vermeidet Aussagen über Geister, was natürlich verständlich ist, denn freiwillige Helfer zu finden für eine Geisterstadt, die nicht nur so heißt, sondern auch wirklich eine ist, ist wohl nicht sehr einfach. Aber für Geisterjäger ist es sicher eine hochinteressante Urlaubsalternative! Wer traut sich? Bewerbungen für freiwillige Helfer im Sommer sind hier vorzunehmen:
http://www.blm.gov/mt/st/en/fo/missoula_field_office/garnet_ghost_town/volunteer.html
Nach dieser kurzen Einführung kommen wir zum eigentlichen Thema des Buches. Ich möchte Ihnen gerne eine Auswahl der berühmtesten Helden der damaligen Zeit präsentieren und auch gleichzeitig einen Bogen zur heutigen Zeit damit spannen. Denn einige Helden von damals sind angeblich überhaupt nicht so gestorben, wie die Überlieferung erzählt und einige sind zwar tatsächlich unter den historisch berichteten Umständen zu Tode gekommen, spuken aber heute noch. also schießen wir mal los …
Abb. 22: Adams revolver. An Improved Frame Model of 1854
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adams_revolver_1854.JPG