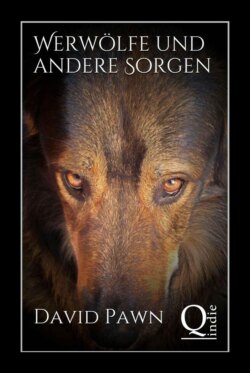Читать книгу Werwölfe und andere Sorgen - David Pawn - Страница 3
Filmriss
ОглавлениеIch habe einen Filmriss. Es muss gestern Abend wieder hoch hergegangen sein, wenn ich davon ausgehe, an wie wenig ich mich noch erinnern kann und wie ich mich fühle. Die Sonne scheint hell ins Zimmer und ihr Licht blendet mich. In meinem Mund habe ich einen Geschmack, als wären in der Nacht mehrere Spinnen hineingekrochen und dort auf meiner Zunge verendet. Ich bin völlig bekleidet und liege auf dem Wohnzimmerfußboden. Das ist schon arg. Sonst schaffe ich es wenigstens, mich auszuziehen und ins Bett fallen zu lassen. Ich weiß nicht einmal mehr, wo ich gestern Abend war. Toms Bar? Das „Milk ‘n‘ alcohol“? Ich habe keinen blassen Schimmer.
Ich bin Reporter. Arbeite für eine von diesen Tageszeitungen mit großen Balkenüberschriften und wenig Fließtext. Wenn man das durchstehen will, muss man hin und wieder einen draufmachen, sonst schnappt man über.
Was riecht denn hier so seltsam? Das muss ich sein. Furchtbar. Ich glaube, ich muss kotzen. Ich erhebe mich mühsam, wanke auf Beinen wie aus Lakritz ins Bad und schaue in den Spiegel. Kein schöner Anblick. So einen Kater hatte ich noch nie. Ich bin unter den dunklen Bartstoppeln ganz blass. Die Stoppeln sehen aus, als hätte ich mich seit drei Tagen nicht rasiert. Habe ich etwa den ganzen Sonntag verpennt? Ist schon Montag?
Ich will ins Wohnzimmer zurückeilen, aber meine Beine gehorchen mir nicht richtig. Ich kann nur ganz langsam gehen. Mein Gehirn ist noch nicht völlig bereit, die Stelzen so zu steuern wie gewohnt. Also schleppe ich mich langsam ins Wohnzimmer zurück, so schlurfend, wie es meine angeschlagene Konstitution erlaubt, und schalte den Fernseher ein.
Frühstücksfernsehen! Und richtig, es ist Montag. Nicht nur der Samstagabend ist weg, auch der ganze Sonntag ist verschwunden. Scheiße! Ich darf nicht so viel saufen, sonst gehe ich eines Tages drauf.
Zurück ins Bad, rasieren, in der Redaktion anrufen, dass ich etwas später komme. Soweit der Plan.
Ich gehe ins Bad und setze mich erst mal auf die Schüssel. Was ’n das? 24 Stunden gepennt und ich kann nicht pinkeln? Das kann nicht gut sein. Aber ich kann keine Rücksicht darauf nehmen. Ich muss mich frisch machen und dann zur Redaktion.
Ich ziehe mein Hemd aus und stelle fest, dass es auf dem Rücken einen Riss hat. Meine Güte, was war das für ein Samstagabend? Das Unterhemd ist auch kaputt und außerdem blutverkrustet. Habe ich eine Kratzbürste an Land gezogen und vernascht? Aber doch wohl nicht in Klamotten?
Ich stopfe die kaputten Sachen in den Mülleimer und den stinkenden Rest von Klamotten in die Wäschetruhe. Die muss auch mal wieder abgearbeitet werden, stelle ich dabei fest. Eine Fliege kriecht auf meinem Arm herum, während ich das tue. Das Vieh scheint sich dort sehr wohlzufühlen. Ich scheuche es weg und es schwirrt um meinen Kopf, um sich schließlich auf meiner Stirn niederzulassen. Na Klasse!
Wedel, wedel!
Die Fliege fliegt auf und summt durchs Zimmer, während ich ins Schlafzimmer schlurfe, um mich mit frischer Wäsche zu versorgen. Danach verschwinde ich unter der Dusche, ehe noch mehr Fliegen auf mich aufmerksam werden.
Beim Rasieren schneide ich mich auch noch. Ist aber nicht so schlimm wie sonst. Blutet fast gar nicht. Ich klebe ein Pflaster drauf und gehe ins Wohnzimmer zurück. Dort rufe ich Carla an, unsere Redaktionsassistentin. Scharfe Braut, aber schon vergeben. Ich sage, dass ich ein bisschen später komme und Carla nimmt es ohne weiteren Kommentar zur Kenntnis. Das kommt immer mal wieder vor, auch bei anderen Reportern, aber wir haben alle so viele Überstunden, dass es lächerlich wäre, wenn sich einer drüber aufregen würde.
Fünfzehn Minuten später bin ich abmarschbereit. Ich hatte mir einen Kaffee gemacht und in der Küche stehengelassen. Hatte einfach keinen Durst. Den Appetit hat es mir auch verschlagen, aber zum Glück verspüre ich keinen Hunger.
Auf der Straße sehen mich die Leute komisch an. Ich wundere mich, ehrlich gesagt, nicht darüber, denn wenn ich immer noch so aussehe wie vorhin im Badezimmerspiegel, gehe ich durchaus als eine gute Figur aus einem B-Movie durch: Night of the Living Dead, Teil 324 oder so. Ich schlurfe auch so dahin wie eine von diesen lebenden Leichen. Ich wollte erst mit dem Wagen fahren, aber es ist ja nicht weit zur Redaktion und in meinem Zustand fahre ich noch gegen einen Baum und dann bin ich wirklich ex. Muss nicht sein.
Carla erwartet mich schon. „Mein Gott, wie siehst du denn aus?“, faucht sie. „Hast du nicht mal geduscht? Na egal, der Alte erwartet dich in fünf Minuten in seinem Büro.“
Nicht geduscht? Klar hab ich geduscht. Ich stampfe zu meinem Schreibtisch und schnuppere an meinem Hemd. Riecht tatsächlich komisch, nicht nach Schweiß, eher ein bisschen süßlich. Muss das neue Rasierwasser sein. Das wäre mir beinahe aus der Hand gefallen heute früh. Nicht nur meine Beine, auch meine Hände spielten bisher noch nicht so richtig mit.
Wenn ich nur wüsste, was der Christian von mir will. Es war irgendwas los am Freitag, aber auch daran kann ich mich nicht mehr so recht erinnern.
„Morgen Peter, Mensch, wie siehst du denn aus?“ Das ist wohl die Standardbegrüßung des Tages. „Muss ja ein übles Wochenende gewesen sein. Hast du wenigstens was rausgekriegt?“
Rausgekriegt? Ich blicke den Chef ein bisschen blöde an und er erkennt gleich, dass ich nicht weiß, wovon er redet.
„Sag nicht, du hast es vergessen. Sag das nicht.“ Er wird ein wenig lauter und schaut hinter seinem Schreibtisch wie ein angriffsbereiter Tiger hervor. „Wie kann man sich nur so das Hirn raussaufen, Mann?“
„Einen Moment, worum geht‘s denn überhaupt?“, versuche ich seine Wut ein wenig zu bremsen.
„Um den Schwulenkiller.“ Mein Chef guckt mich an, als käme ich gerade aus einem anderen Universum. „Du hast mir am Freitagabend hoch und heilig versprochen, dass du dich am Samstag umhören willst, damit wir es für morgen auf die Titelseite klatschen können. Und jetzt kommst du hier kalkweiß und wie ausgekotzt in mein Büro und weißt von nichts. Das ist stark, Mann, das ist selbst für deine Verhältnisse sehr stark.“
Ich stehe betreten in der Gegend herum und weiß nicht, was ich antworten soll. Ich muss wohl wirklich durch diese Schwulenbars gezogen sein, um mich umzuhören, aber offenbar ist nichts weiter dabei rausgekommen als dieser Kater des Jahrhunderts.
„Jetzt muss ich Jan schicken, vielleicht findet der ja noch ein paar Bröckchen. Aber wir waren doch davon ausgegangen, dass man gerade am Samstagabend viel erfahren kann, weil da die meiste Kundschaft in den Läden rumhängt. Wie kannst du mich so hängen lassen, Peter?“ Mein Chef schüttelt resigniert den Kopf und wedelt mich mit der Hand von seinem Schreibtisch weg. „Und dusch dich mal. Du riechst ja, als ob du verwesen würdest.“
Na, danke auch. Ich schlurfe aus dem Zimmer und frage mich, wie ich das hatte vergessen können. Eigentlich ist Christian nicht nur mein Chef, sondern auch ein Freund. Jedenfalls soweit ein Chef ein Freund sein kann. Das ist wohl einer der Gründe, warum er mich nicht gleich gefeuert hat nach der Nummer. Das, und dass ich sonst immer sehr gute Arbeit abgeliefert habe.
Carla erkennt sofort, dass es nicht gerade toll gelaufen ist beim Chef. „Ärger?“, fragt sie trotzdem.
„Ich hab’s vermasselt und kann mich nicht mal dran erinnern“, brumme ich. „Schaff mir mal die Ausgabe vom Freitag auf meinen Schreibtisch, und die vom Donnerstag auch.“ Ich gehe rüber und lasse mich in meinen Sessel fallen. Anschließend werfe ich den Computer an. Als mein Anmeldebildschirm aufflammt, kommt Carla mit den Zeitungen. Sie bleibt in einem Meter Entfernung stehen, rümpft die Nase und wirft mir die Blätter zu.
Sie guckt ganz erschrocken und sagt: „Das ist nicht normal. Du musst dir am Wochenende was eingefangen haben. Typhus oder die Beulenpest oder so was. So riecht doch kein gesunder Mensch.“ Dann verlässt sie fluchtartig die Szene. In der Box neben mir springt der Ventilator von Ricardo an. Das ist unser Sportredakteur.
Ich schaue an mir herunter und stelle fest, dass meine Haut ein bisschen grünlich aussieht. Keine gesunde Farbe, finde ich. Aber erst will ich mich über diesen Schwulenkiller ins Bild setzen, den ich total vergessen habe.
Drei Tote an drei Wochenenden. Aus den Berichten von Zeugen ergibt sich folgendes Bild: Der Täter gabelt seine Opfer in Schwulenbars auf. Er macht sie vermutlich betrunken oder flößt ihnen Drogen ein, dann schleppt er sie ab und begleitet sie nach Hause in ihre Wohnung. Dort sticht er sie nieder und verschwindet. Keine Diebstähle, keine Rituale, kein Sex. Nur ein sauberer Stich mit einem scharfen Dolch oder so und ab durch die Mitte. Die Polizei geht von einem Täter aus, der extremen Hass auf Schwule hat. Vielleicht wurde er von einem mit HIV infiziert. Keine Beschreibung eines mutmaßlichen Täters vorhanden. Eigentlich ist die Erkenntnislage der Polizei gleich Null.
Und ich hatte also mehr über den Killer erfahren wollen als die Polizei, wenn ich Christian glauben soll. Und das muss ich wohl, denn er ist der Chef.
Aber so wie ich heute rumlaufe und mich fühle, kann ich nicht vernünftig arbeiten. Tut mir leid, Leute, aber ich muss zum Arzt. Vielleicht habe ich mir ja wirklich was eingefangen, was diesen Kater verstärkt hat.
Ich gehe rüber zu Carla, bleibe aber in sicherem Abstand stehen. Sie findet heute wahrhaft keinen Gefallen an meinen Reizen. Eine Fliege kriecht über meinen Hals. Das kitzelt ein bisschen und ich wedele das Vieh weg.
„Ich gehe zum Arzt. So kann ich nicht arbeiten.“
„Wird wohl besser sein“, antwortet Carla und versucht ein Lächeln, das ihr aber verrutscht. „Du siehst aus wie der Tod auf Socken. Lass dir ein paar Pillen verschreiben, schlaf dich gründlich aus und dusch dich.“
„Danke für den Tipp“, erwidere ich lakonisch und mache mich auf den Weg zum Onkel Doktor.
Beim Arzt sieht es aus wie üblich. Wartezimmer proppenvoll, Schwestern gelangweilt hinter dem Anmeldungstresen. Eine guckt bloß, die andere lackiert sich die Nägel. Ich will Fräulein Nagellack nicht stören und gehe zu der blasiert Guckenden. Als ich an den Tresen trete, reißt die die Augen auf, als hätte sie noch nie einen Mann gesehen. Ihr Blick fliegt nach links und rechts, als würde sie nach einem Fluchtweg Ausschau halten. Dann hat sie sich gefangen und sagt: „Ihre Chipkarte bitte, worum geht es?“
„Weiß nicht, erst dachte ich, ist nur ein Kater, aber das kann nicht sein. Das kenne ich zu gut. Fühle mich wie erschlagen, Probleme beim Wasserlassen, Appetitlosigkeit und meine Haut wird grün.“ Ich schiebe ihr die Plastikkarte rüber.
Sie schiebt das Ding in das Lesegerät, guckt mich noch mal kurz an und sagt: „Warten Sie bitte in Zimmer drei, Herr Bojko.“
Ich sehe verdattert drein. Ich darf nicht mit den anderen armen Schweinen zusammen im Wartezimmer warten und mir diverse Krankengeschichten anhören? Nachtigall, ick hör dir trapsen! Habe ich Ebola oder so was?
Ich schlurfe ins Zimmer drei, lasse mich dort auf einen Stuhl fallen und warte. Zehn Minuten später kommt der Arzt. Er zögert einen Moment an der Tür, ehe er diese hinter sich schließt. Aus sicherer Entfernung werde ich eine ganze Weile gemustert, ehe er sich endlich dazu aufraffen kann, näher zu treten. Er geht zu dem Schreibtisch am Fenster, lässt sich dort auf einem Stuhl nieder und schaut mich an. Dann fragt er: „Was führt Sie zu mir, Herr Bojko?“
„Tja, ich weiß auch nicht. Heute früh habe ich gedacht, es ist ein Riesenkater. Aber ich bin kein Weichei, das hätte mich nicht so umgehauen, das kenne ich alles. Aber ich fühle mich nach wie vor elend, habe keinen Appetit und Durst und kann auch nicht pinkeln. Dabei muss ich über 24 Stunden geschlafen haben. Meine Blase müsste voll sein wie ein Ballon vorm Start. Meine Kollegen auf Arbeit haben alle gesagt, ich würde einen seltsamen Geruch absondern und meine Haut wird ganz grünlich, sehen Sie.“ Ich zeige meinen Arm vor wie ein Beweisstück.
„Seit wann geht es Ihnen so?“
„Weiß nicht. Ich bin heute früh aufgewacht und hatte alles seit Freitag vergessen.“
Der Doktor nickt sinnend vor sich hin, blickt schließlich auf und mir ins Gesicht. „Wir machen zunächst einen Grundcheck, dann sehen wir weiter. Kommen sie mal her, wir wollen als Erstes Ihren Blutdruck messen.“
Die übliche Prozedur. Ärmel aufkrempeln, Manschette anlegen, Gummibällchen aufpumpen. Unüblich ist der Blick des Arztes. Der guckt immer dümmer aus der Wäsche, auf das Anzeigegerät, auf sein Bällchen, auf meinen Arm und dann in mein Gesicht. „Muss kaputt sein“, murmelt er, schüttelt den Kopf und löst wieder die Manschette von meinem Arm. Die Stelle, wo die Manschette gesessen hatte, ist plötzlich ganz blutunterlaufen.
Ich gucke den blauen Fleck an, dann den Arzt. „Normal ist das nicht, oder?“
„Nein.“ Der Arzt sieht irgendwie erschrocken aus. „Machen Sie sich mal frei.“
Während ich mich ausziehe, geht der Herr Doktor zu einem Schrank am anderen Ende des Zimmers und nimmt dort aus einer Schublade ein paar Latexhandschuhe. Offenbar will er mich nicht mit bloßen Händen anfassen. Er kehrt zu seinem Schreibtisch zurück, holt ein Stethoskop aus einer Schublade und kommt zu mir herüber. Ich stehe mit bloßem Oberkörper vor dem Stuhl und sehe an mir herunter. Mein ganzer Bauch um den Bauchnabel herum ist ein einziger Bluterguss. Die Haut ist fast schwarz.
Der Doktor guckt mich seltsam an, so etwas hat er wohl auch noch nicht gesehen, höchstens während der Ausbildung in einem Lehrfilm oder in der Pathologie. Ich frage mich, ob ich jetzt auf dem städtischen Friedhof Probeliegen kann.
„Was haben Sie denn gemacht? Mit einem Gorilla geboxt?“ Der Arzt versucht seine Unsicherheit mit Witzchen zu überspielen, aber es gelingt ihm nicht so richtig.
Er tritt an mich heran, steckt sich die Oliven des Stethoskops in die Ohren und beginnt mit der Prozedur des Abhörens. Zwei Sekunden. Dann fällt ihm das Stethoskop aus der Hand und baumelt vor seiner Brust. Er glotzt mich an wie einen Zombie. Schließlich nimmt er sich zusammen, greift nach dem Bruststück und setzt es sich an die eigene Brust. Er lauscht ein, zwei Augenblicke und macht dann einen Schritt rückwärts, ohne mich jedoch aus den Augen zu lassen. Plötzlich ist er ein bisschen blass um die Nase. Schnell fängt er sich wieder, schaut mir ins Gesicht und erklärt: „Ihre Herztöne sind sehr schwach. Entschuldigen Sie bitte. Drehen Sie sich mal um.“
Ich gehorche und plötzlich höre ich den Arzt hinter mir heftig die Luft aus den Lungen stoßen. „Mein Gott“, sagt er dann, „oh, mein Gott.“ Das trägt nicht gerade zu meiner Beruhigung bei.
„Was ist?“, frage ich. „Kommen Sie, Doc, machen Sie nicht so ein Theater und sagen Sie mir einfach die Wahrheit. Ist es lebensgefährlich? Wie lange habe ich noch?“
Der Arzt antwortet nicht. Offenbar steht er nur einfach einen Meter hinter meinem Rücken und starrt mich an. Ich komme mir blöde vor. Und außerdem denke ich, dass dieser Arzt sehr unprofessionell ist. So sollte er selbst bei einem schlimmen Fall nicht reagieren. Soll sich ein Beispiel an Dr. House nehmen. Der wäre vermutlich begeistert, was für eine medizinische Sensation da in seine Praxis spaziert ist.
„Ich denke, ich muss Sie zu einem Spezialisten überweisen“, sagt der Herr Doktor einen Augenblick später und fängt an, hysterisch zu lachen.
Jetzt reicht es mir. Ich drehe mich auf dem Absatz um, starre den Arzt an und brülle: „Verdammt, Mann, was ist daran so komisch? Ich habe eine Scheißangst und Sie schütten sich aus vor Lachen.“
Der Doktor schrickt zusammen, hört sofort auf zu lachen, hebt beide Hände abwehrend in meine Richtung und macht einen weiteren Schritt rückwärts. Jetzt steht er mit dem Rücken direkt vor einem Schrank mit Spritzen, Verbandszeug und irgendwelchen Medikamentenproben, die Pharmavertreter hier abgeladen haben. Dann zieht er die rechte Hand zurück und schlägt sie entsetzt vor den Mund.
„Wo! Ist! Das! Problem?“ Ich schreie den Arzt an, so laut ich kann. „Ich will wissen, was ich habe und ich will wissen, ob ich noch zu retten bin.“
„Sie haben eine mehrere Zentimeter tiefe Messerwunde im Rücken. Und nein.“ Der Arzt starrt mich noch immer aus weit aufgerissenen Augen an.
„Was heißt nein? Ich werde sterben an dieser Wunde?“
Der Arzt schüttelt den Kopf. Aber er wirkt dabei, als wäre er nicht ganz bei sich, sondern sehe Dinge in oder aus einer anderen Welt.
„Reden Sie, Mann, oder muss ich erst grob werden?“
„Bitte, bitte nicht.“ Der Typ schiebt sich an dem Schrank entlang in Richtung Ausgangstür. Wahrscheinlich hat er Angst, ich drehe nach dieser Eröffnung durch und falle über ihn her. Aber warum sollte ich? Ich will bloß endlich wissen, was hier gespielt wird. Um den Arzt zu beruhigen, trete ich einen Schritt zurück und setze mich auf den Stuhl, wo mein Hemd über der Lehne hängt.
„So“, sage ich, „jetzt beruhigen wir beide uns wieder und Sie erklären mir, was los ist mit mir und was ich tun kann.“
Der Arzt lässt von seinem Rückzug ab, guckt mich aber immer noch in einer Mischung aus Furcht und Faszination an. Ein wenig sieht er wie ein Insektenforscher aus, der eine absolut phänomenale neue Spezies entdeckt hat, nur ist diese Spezies drei Meter groß und frisst Menschen.
„Ich will es mal so sagen: Der Spezialist, zu dem ich Sie überweisen muss, ist der Pathologe.“
Ich habe nicht richtig gehört. ‚Pathologe‘ kann der Herr Doktor nicht gesagt haben. Pathologen schneiden Leichen auf. „Ich habe ‚Pathologe‘ verstanden“, sage ich daher, lache auf und füge hinzu: „Aber das muss ein Missverständnis sein. Ich bin ja schließlich noch nicht tot.“
„Doch, das sind Sie“, erwidert der Arzt. „Kein Blutdruck, keine Herztöne, eine Stichwunde in der Lunge, die daraufhin offenbar kollabiert ist. Sie sind nach allen Regeln der medizinischen Kunst tot. Allerdings kann ich keinen Totenschein ausstellen, weil Sie hier vor mir sitzen und mit mir reden. Hirntot sind Sie demzufolge nicht. - Ich muss mich setzen, ich muss mich beruhigen.“
Er geht zu seinem Schreibtisch hinüber, reißt die untere Schreibtischtür auf, nimmt ein Becherglas heraus und eine Flasche Johnny Walker, Black Label. Red Label ist nichts für Ärzte, eher für Journalisten! Er schenkt sich eine reichliche Portion ein und schüttet sie in einem Zug in seine Kehle.
„Sie sagen mir allen Ernstes ins Gesicht, ich sei tot und saufen dabei vor meinen Augen.“ Ich kann es nicht fassen. „Vielleicht brauchen Sie einen Spezialisten“, höhne ich. „Irrenarzt.“
„Schauen Sie sich doch an. Leichenflecken. Verfärbung der Haut. Sie riechen auch nach Verwesung. Sie sind tot. Bloß Ihr Hirn hat es noch nicht mitbekommen. Fallen Sie endlich um, damit ich den Fall sauber abschließen und wieder normal denken kann.“
„Tut mir leid, aber den Gefallen kann ich Ihnen nicht tun, Doktor.“ Ich versuche einen zynischen Gesichtsausdruck.
Plötzlich wird der gute Doktor hektisch. Er schiebt die Unterlagen auf seinem Schreibtisch herum, zerrt seine Computertastatur zu sich heran und beginnt, wie wild auf die Tasten zu hämmern. Offenbar ist ihm gerade klar geworden, dass er eine nobelpreisverdächtige medizinische Sensation vor sich hat.
„Was machen Sie da?“
„Ich muss das dokumentieren. Ich werde berühmt. Sie auch.“
„Ich will nicht berühmt werden, jedenfalls nicht als ein gottverdammter Zombie“, fauche ich den Arzt an.
„In Ihren Unterlagen steht, Sie sind bei einer Zeitung beschäftigt. Reporter.“ Der Arzt blickt kurz von seiner Tastatur auf, die er im Zwei-Finger-System bearbeitet. Rattatata - rattatata - rattatata - wie Maschinengewehrfeuer. „Schreiben Sie darüber, wie Sie sich fühlen. Da haben Sie den Pulitzer-Preis sicher.“
„Den gibt es nur für Amerikaner“, antworte ich. „Außerdem müssen Sie sich irren. Kein Mensch, der tot ist, geht zur Arbeit, geht zum Arzt … alles Dinge, die ich heute gemacht habe. Ich bin doch wohl die erste Leiche, mit der Sie sprechen, oder?“
„Natürlich“, antwortet der Arzt und malträtiert weiter seine Schreibmaschine. „Was haben Sie heute zu sich genommen: Essen, Trinken?“, fragt er mich plötzlich.
Ich will ihn auf den Arm nehmen, strecke die Arme steif nach vorn aus und krächze: „Brains!“ Herr Doktor findet das gar nicht lustig. Er versucht von seinem Sessel aufzuspringen, verheddert sich mit dem Kittel in dessen Lehne und stürzt samt Sessel in der Ecke nieder. Es kracht laut, aber weil die Tür gepolstert ist und die Schwestern draußen sicher Besseres zu tun haben (Augenbrauen zupfen?), kommt niemand nachsehen.
Während der Arzt sich wieder berappelt, streife ich meine Sachen über, die ich für die Untersuchung ausgezogen hatte. Er lässt mich dabei keinen Augenblick aus den Augen, so wie ein Dompteur ein Raubtier, das er neu in eine Gruppe zur Dressur aufnimmt.
„War nur Spaß“, sage ich, als der Arzt wieder senkrecht steht. „Ich habe nichts gegessen und getrunken. Soweit ich das sagen kann, seit Samstag nicht. Und ich habe auch kein Wasser lassen und keinen Stuhl absetzen können, oder wie ich sagen würde: mit Pinkeln und Scheißen war’s auch Essig."
„Sehen Sie, tot“, erwidert der Arzt und setzt sich wieder an seinen Schreibtisch. „Kein Stoffwechsel. Seltsam ist bloß, das Darm und Blase noch was festhalten. Aber Ihre motorische Muskulatur funktioniert ja auch noch.“
Wär ja auch noch schöner, wenn ich mich bepisst hätte oder schlimmer.
Aber langsam wird mir klar, was passiert sein muss – teilweise. Ich habe mich also nach diesem Schwulenkiller auf die Suche gemacht. Ich habe den Typen offenbar gefunden. Oder er mich. Und dann hat er mich betäubt, in meine Wohnung geschafft und erstochen. Genau wie er es mit den Schwulen gemacht hatte. Jetzt kam aber das Besondere. Ich hatte überlebt oder war nicht tot geblieben oder war untot geworden oder … ach, hör doch auf mit dem Scheiß. Ich fühlte mich noch immer zum Kotzen.
„Doktor, was soll ich tun? Ich fühle mich nicht tot. Ich bin nicht tot. Ich bin bloß krank.“
Der Arzt sieht mich an, als ob er tatsächlich so was wie Mitleid empfindet. „Gehen Sie nach Hause. Ich schreib Sie wegen Grippe krank. Kann ja schlecht Pneumothorax auf den Krankenschein schreiben, wie es richtig wäre.“
Das war mein letzter Arztbesuch. Dessen bin ich sicher.
In die Redaktion kehre ich nur kurz zurück, um Carla meinen Krankenschein auf den Tisch flattern zu lassen. Ich weiß jetzt, was ich tun will. Ich will diesen Typen finden, der mich erledigt hat. Ich muss diesen Killer finden und somit meine Ruhe.
Wieder Samstag. Ich bin die ganze letzte Woche jeden Abend durch die Schwulenbars gezogen und habe Ausschau gehalten. Aber kein Aufblitzen in meinem Hirn, kein Wiedererkennen. Nur immer scheele Seitenblicke, weil ich trotz aller Chemie wie eine Kloake zu müffeln anfange, wenn ich ‘ne Stunde oder so nicht geduscht habe. Auf den Unterseiten meiner Arme habe ich auch schwarze Blutergüsse, weil sich das Blut eben unten sammelt, wenn das Herz nicht mehr schlägt. Meine Füße sehen aus wie Kohlen. Gestern sind mir zwei Zähne ausgefallen. Einfach so. Lange kann das nicht mehr so weiter gehen.
Ich gehe in die Bar ‚Rosa Kakadu‘, setze mich an den Tresen und bestelle einen Manhattan. Der Barkeeper kennt mich langsam. „Sie suchen wen, stimmt’s?“, fragt er, als er mir das Glas hinstellt. „Immer nur hier sitzen, gaffen und nicht mal trinken. Bulle?“
„Ne.“ Ich schüttele den Kopf. „Reporter. Der Killer, Sie verstehen, oder? Das ist eine ganz große Nummer, wenn ich da was aufschnappen kann. Für die Zeitung und damit auch für mich.“
„Na dann, Waidmanns Heil, aber lassen Sie sich nicht selbst abstechen. Ist nicht gut für den Teint.“ Der Barkeeper lacht über seinen eigenen Witz und ich lache gequält mit. Wenn du wüsstest, du Witzbold.
Zwei Stunden später kommen zwei Paradiesvögel zur Tür herein. Tunten der klassischen Art und hinter den beiden ein Typ in Lederjacke und knallenger Lederhose. Eins fünfzig mit Hände hoch, untersetzt, aber nicht dick. Typ Turner. Hambüchen für Arme. Der sieht mich erst nicht, weil die Tunten ihm im Weg sind. Erst, als die kurz vor der Bar abbiegen und sich in Richtung einer Kuschelecke verziehen. Da hat er mich plötzlich voll im Blick und seine Augen werden groß.
Ich weiß es. Ich weiß es sicher. Der Typ hat mich wiedererkannt. Und er hat gedacht, ich müsste längst unter der Erde liegen und verfaulen. Ich verfaule auch. Bloß nicht unter der Erde.
Ich springe von meinem Barhocker auf, ehe der Kerl die Biege machen kann. „Licht“, rufe ich dem Barmann zu. „Das ist der Schwulenkiller!“ Dann stürze ich nach vorn auf den kleinen Lederverpackten zu.
Plötzlich wird es hell in der Bar. Der Typ kann nicht weg, weil in seinem Rücken mehrere Gäste in Panik zur Tür gestürzt sind, als der Killer erwähnt wurde. Und wenn er nicht flüchten kann, kennt er nur ein Mittel. Er zieht ein Messer aus der Innentasche seiner Jacke und hält es zum Kampf bereit vor sich. Es ist ein sardisches Hirtenmesser. Eine tödliche Waffe, wie ich erfahren musste.
Ich stürze auf den Typen zu und packe ihn am Hals, während er mir das Messer in die Brust rammt. In dem Moment beginnt das große Kreischen in der Bar. Ich sehe aus den Augenwinkeln einen Kellner zu seinem Handy greifen. Hoffentlich ruft der die Polizei an und nicht bloß seine Freundin, um zu sagen, dass es später wird.
„Du solltest doch tot sein“, zischt der Messermann und stößt noch einmal zu.
„Bin ich“, antworte ich und grinse ihn an, dabei entblöße ich die Zahnlücken, die mich seit gestern zieren. Ich halte ihn noch immer am Hals gepackt und drücke zu. „Und du wirst mich begleiten, Süßer“, flöte ich dabei in der besten Tuntenimitation, zu der ich fähig bin.
Er sticht weiter mit dem Messer auf mich ein, was sinnlos ist, weil er nur mein Hemd ruiniert. Aber er wird langsam blau im Gesicht und seine Bewegungen werden schwächer. Ich verstärke den Druck und plötzlich spüre ich, wie sein Kehlkopf bricht. Es ist schnell vorbei mit ihm. Er wird ganz schlaff und lässt das Messer fallen. Da lasse ich ihn los.
Um mich her dreht sich alles. Die Bar, die Leute, die schreiend durcheinanderlaufen, die Lichter der Lampen über mir. Sie wirbeln herum wie ein überdrehtes Karussell. Ich höre eine Polizeisirene. Ich sehe die Welt um mich herum in einem Wirbel versinken.
Licht! Gleißendes Licht! Es ist im Zentrum des Wirbels. Ich wirbele darauf zu. Immer schneller dreht sich die Welt. Etwas poltert. Ich? Bin ich gestürzt? Ich sehe nur dieses Licht.
Bin ich noch in der Bar?
Bin ich noch?
Bin ich?