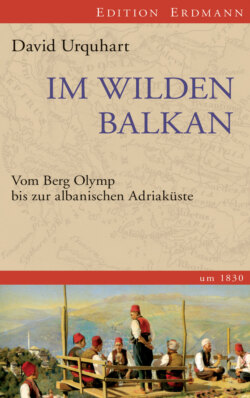Читать книгу Im wilden Balkan - David Urquhart - Страница 13
ZWEITES KAPITEL AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER HANDEL TREIBENDEN ORTSCHAFT AMBELÁKIA
ОглавлениеIn der Türkei vereinigt sich das im Grundsatz und Gefühl freie Volk mit dem Sultan, um die Macht der Statthalter einzuschränken oder sich für den Druck zu rächen, den sie ausübten. In Europa vereinte sich das Volk, nachdem es in den Zustand der Leibeigenschaft gebracht war und die Aufopferung seiner Rechte Gesetzeskraft erlangt hatte, mit dem König, um die Feudalaristokratie zu stürzen, die ursprünglich aus Statthaltern bestanden hatte, denen es aber gelungen war, Ansehen in Besitz zu verwandeln, und diesen Besitz dauernd, erblich und gesetzlich zu machen. In der Türkei aber haben diese Übel noch nicht Wurzel gefasst im System: Sie sind nicht durch Verjährung, Titel und Gesetz geheiligt; sie werden als Verirrungen bezeichnet, als Verbrechen verworfen. Der Landbauer ist kein Leibeigener, er ist nicht einmal ein Arbeiter, er ist Eigentümer.1 Hier brauchen entlaufene Sklaven nicht in eine Freistätte zu flüchten, um dort eine von ihrem Stamm und von der Volksverwaltung getrennte Stadtgemeinde von Verjagten zu errichten. Mit den väterlichen Saatfeldern erbt die ganze Masse der Bevölkerung jene einfachen Institutionen, denen, wenn sie zufällig auf den Boden gelangten, Europa seine gegenwärtigen Fortschritte und seine Freiheiten verdankt.
Als ich das Dasein städtischer Gemeinden und Handel treibender Korporationen im Orient entdeckte, kam ich natürlich darauf, sie mit den Munizipien und Freistaaten des Mittelalters zu vergleichen, die in entlegenen Winkeln oder an bis dahin vernachlässigten Gestaden aufblühten, in strahlendem Gegensatz zu der sie umgebenden Barbarei, und die ihren Reichtum, ihr Gedeihen, ihre Freiheit und ihre Intelligenz nicht den Zufällen der Herkunft, des Bodens oder der Umstände verdankten, sondern einzig den Grundsätzen der Verwaltung.
Deuten die früheren Blätter der Geschichte, deutet die Karte vom mittelländischen Meer auf ein glückliches Zusammentreffen, das Amalfi, Montpellier, Barcelona oder Ancona – Plätzen, die keine Macht hatten, um sich Ansehen zu verschaffen, keine frühere Verdingung oder gewohnte Geschäfte, die nicht im Bereich des Handels gelegen hätten, die nicht mit örtlicher Fruchtbarkeit gesegnet oder wegen einheimischer Manufakturen berühmt waren – jenes Gedeihen verheißen hätte, dessen Aufblühen blendete, dessen Verfall aber ohne Lehre geblieben ist? Ihre öden Hallen, ihre unbewohnten Gebäude, ihre fürstlichen Reste verschwundenen Reichtums erinnern jetzt nur noch an die Sucht des menschlichen Geistes, Gesetze zu geben, und an die Erfolge der Gesetzgebung.
Ambelákia bietet uns die Mittel zu einem Vergleich mit jenen Städten: Seine Geschichte liefert den Beweis dafür, dass die Grundrechte, die die Munizipien Europas, die städtischen Gemeinden im Mittelalter, als Ausnahme erhielten oder mit Gewalt erzwangen, im Orient dem ganzen Volk gemeinsam zustehen und die Grundlage der öffentlichen Meinung sowie der Regierung sind. Ambelákia war vielleicht der Platz, den ich unter allen reichen Erinnerungen an Thessalien mit dem größten Interesse besuchte, und ohne die stattlichen Häuser, die noch das Tal Tempe überschauen, könnte der Reisende an der Wirklichkeit einer fast fabelhaft klingenden Geschichte zweifeln. Ich entlehne aus Beaujours Tableau du Commerce de la Grèce1, das am Anfang unseres Jahrhunderts erschien, die von ihm festgehaltenen Beobachtungen, insoweit sie sich mir durch die an Ort und Stelle eingezogenen Erkundigungen bestätigten.
„Ambelákia gleicht durch seine Tätigkeit mehr einem holländischen Flecken als einem Dorf der Türkei. Dieses Dorf verbreitet durch seine Geschäftigkeit Bewegung und Leben in der Gegend und erzeugt einen unermesslichen Handel, der durch tausend Fäden Deutschland und Griechenland verbindet. Seine Einwohnerzahl hat sich innerhalb von fünfzehn Jahren verdreifacht und beläuft sich jetzt (also im Jahr 1798) auf viertausend, die in ihren Manufakturen leben, wie Bienenschwärme in ihren Körben2. In diesem Dorfe sind sowohl die Laster als auch die Sorgen unbekannt, die aus dem Müßiggang entstehen; die Herzen der Ambelakioten sind rein, ihr Antlitz ist heiter; die Sklaverei, welche zu ihren Füßen die vom Peneios bespülten Ebenen vergiftet, hat niemals die Abhänge des Pelion (Ossa) bestiegen, und gleich ihren Vorfahren regieren sie sich selbst, durch ihren ,Protojeros‘1 und ihre eigenen Magistratspersonen. Zweimal versuchten die Muselmanen von Larissa aus die Felsen zu erklimmen, und zweimal wurden sie von Händen zurückgetrieben, die das Weberschifflein fahren ließen, um die Muskete zu ergreifen.“
„Alle Hände, selbst die der Kinder, sind in den Manufakturen in Arbeit. Während die Männer die Baumwolle färben, richten die Frauen sie zu und spinnen sie. Es gibt dort 24 Manufakturen, in denen jährlich 2500 Ballen Baumwollgarn zu hundert Okas gefärbt werden (6138 Zentner zu 112 Pfund). Dieses Garn findet seinen Weg nach Deutschland und wird in Ofen, Wien, Leipzig, Dresden, Ansbach und Bayreuth abgesetzt. An all diesen Plätzen hatten die ambelakischen Kaufleute eigene Häuser, die je für sich Compagnien in Ambelákia gehörten. Die so entstandene Konkurrenz verringerte den gemeinschaftlichen Profit beträchtlich, und sie schlugen daher vor, sich unter einer Zentral-Handels-Verwaltung zu vereinigen2. Vor zwanzig Jahren wurde dieser Plan entworfen und wenige Jahre darauf ausgeführt. Die niedrigsten Anteile in dieser vereinigten Compagnie waren fünftausend Piaster (zwischen 600 und 700 Pfd. St.), und die höchsten wurden auf zwanzigtausend beschränkt, damit die Kapitalisten nicht allen Profit wegnehmen sollten. Die Arbeiter unterschrieben ihre kleinen Ersparnisse, verbanden sich in einzelne Gesellschaften und erwarben sich Anteile; außer ihrem Kapital wurde auch ihre Arbeit im Generalbetrag gerechnet, danach erhielten sie ihren Anteil am Gewinn und bald verbreitete sich Überfluss in der ganzen Gemeinde. Die Dividenden wurden anfangs auf zehn Prozent beschränkt und der Mehrgwinn zur Vermehrung des Kapitals verwendet, das binnen zweier Jahre von 600 000 Piaster auf eine Million stieg (120 000 Pfd. St.).“
„Drei Direktoren, unter einer angenommenen Firma, leiteten die Angelegenheiten der Compagnie, aber die Unterschrift war auch den drei Associés in Wien gestattet, von wo die Rimessen kamen. Diese beiden Firmen in Ambelákia und Wien hatten ihre Korrespondenten in Pest, Triest, Leipzig, Salonika, Konstantinopel und Smyrna, um die Zufuhr in Empfang zu nehmen, die Rückfracht zu besorgen und den Absatz des griechischen Baumwollengarns zu vermehren. Ein wichtiger Teil ihres Geschäftes war es, die realisierten Fonds von Hand zu Hand und von Platz zu Platz in Umlauf zu setzen, nach Verhältnis ihrer eigenen Umstände und Bedürfnisse und des Kurses.“
So sicherte sich die Compagnie sowohl den Profit des Spekulanten als auch den des Bankiers – Profite, die sich ganz ausnehmend dadurch vermehrten, dass sie in beiden Eigenschaften Zeit, Markt und Spekulation wählen und beherrschen konnten. Stand der Kurs günstig, so remittierten sie Konstanten; stand er ungünstig, so remittierten sie Waren; oder sie spekulierten in Salonika, Konstantinopel oder Smyrna durch Aufkaufen von Wechseln oder durch Verschickung deutscher Waren, nach Konjunkturen und Nachfragen der verschiedenen Märkte, die sie durch ihre ausgedehnten Verbindungen augenblicklich erfuhren und von denen Nutzen zu ziehen der schnelle Umsatz eines so großen Kapitals sie immer in Stand setzte.
„Niemals war eine Handelsgesellschaft nach so sparsamen Grundsätzen eingerichtet, und nie wurden weniger Hände zur Betreibung einer solchen Masse von Geschäften verwendet. Um allen Gewinn in Ambelákia zu vereinigen, waren die Korrespondenten ausnahmslos Ambelakioten, und um den Gewinn gleichmäßiger unter ihnen zu verteilen, waren sie verpflichtet, nach dreijährigem Dienst nach Ambelákia zurückzukehren. Dann mussten sie ein Jahr lang in der Heimat dienen, um sich die kaufmännischen Grundsätze der Compagnie frisch wieder einzuprägen.“
„Lange Zeit herrschte die größte Einigkeit in der Verbindung; die Direktoren waren uneigennützig, die Korrespondenten diensteifrig und die Arbeiter gelehrig und fleißig. Der Profit der Compagnie nahm täglich zu, von einem Kapital, das mit reißender Schnelligkeit ungeheuer groß geworden war. Jede Bilanz ergab einen Gewinn von sechzig bis hundert Prozent, und alles wurde in richtigen Teilen unter Kapitalisten und Arbeiter verteilt, nach Verhältnis zu Kapital und Arbeit. Die Aktien waren verzehnfacht.“
Die auf diesen Zeitraum beispiellosen Gedeihens folgenden Störungen erklärt Beaujour mit der tadelhaften Unbestimmtheit, die Worte für Sachen nimmt, durch den „übermäßig großen Reichtum“, durch „tumultuarische Versammlungen“, dadurch, dass die Arbeiter den Webstuhl mit der Feder vertauscht hätten, durch die Anmaßungen der Reichen und die Unbotmäßigkeit der unteren, aber noch wohlhabenden Klassen. Für uns wird es im Gegenteil Erstaunen erregen, dass eine solche Korporation so lange und so gedeihlich bestehen konnte ohne eine gerichtliche Behörde, die schon zu Beginn Zwistigkeiten und streitige Interessen hätte schlichten müssen, die in Ermangelung einer solchen Behörde nur durch Gewalt entschieden werden konnten. Die Verletzung eines unverständigen Gesetzes gab Anlass zum Streit, der die Gemeinde in zwei Parteien spaltete. Jahrelang reisten sie mit ungeheuren Kosten nach Konstantinopel, Salonika und Wien, schleppten Zeugen mit und bettelten um gesetzliches Urteil, um das gefällte sofort zu verwerfen, und die Compagnie zerfiel in so viele Teile, wie in der Original-Firma Vereinigungen von Arbeitern enthalten waren. Um diese Zeit geriet die Wiener Bank in den Konkurs, in der ihre Fonds niederlegt waren, und mit diesem Unglück vereinten sich politische Ereignisse, um das Glück Ambelákias zu verdunkeln, dessen Gedeihen, dessen Hoffnung endlich ganz vernichtet wurde durch die Handelsumwälzung, die aus den Spinnereien Englands entstand. Die Türkei hörte nun auf, Deutschland mit Garn zu versorgen, sie wurde sogar für diesen ihren Ausfuhrartikel England zinsbar. Zuletzt kam noch die griechische Revolution. Dieses Ereignis hat zur selben Zeit auch die anderen blühenden Ortschaften von Magnesia, Pelion, Ossa und Olymp in einen Zustand fast völliger Vernichtung gebracht. Selbst auf den gegenüberliegenden Höhen des Olymp, über das Tal Tempe hinüber, ist Rapsána von tausend reichen Häusern, die es vor zehn Jahren besaß, ohne sich der „Verschwendung“ oder des „Tumults“ schuldig gemacht zu haben, auf zehn verwaiste Herde herabgekommen. Beaujours Lobpreisungen sind aber ebenso unverdient wie sein Tadel ungerecht. Er sagt: „Hier entsprangen von Neuem große und freisinnige Gedanken auf einem vor zwanzig Jahren der Sklaverei geweihten Boden; hier erhob sich der alte griechische Charakter in seiner früheren Tatkraft, zwischen den Felsströmen und Höhlen des Pelion (Ossa), mit einem Wort, hier, in einem Winkel der neuen Türkei, wurden alle Talente und Tugenden des alten Griechenlands wiedergeboren.“
Hätte eine alte Handelsstadt, hätte ein passend gelegener Seehafen oder hätte die Hauptstadt einer Provinz, im Besitze von Kapital, Verbindung und Einfluss, ihren Handel und ihren Wohlstand so reißend schnell gehoben, so würde eine solche Stadt mit vollem Rechte als ein Beweis gesunder Regierungsgrundsätze geführt werden, geehrt wegen ihres Gemeingeistes und ihrer Intelligenz. Was sollen wir nun von dem Charakter einer Verwaltung sagen, die ein unbekanntes, schwaches und unbedeutendes Dörfchen zu solcher Höhe des Wohlstandes brachte? Dieses Dörfchen hatte nicht ein einziges Feld in der Nähe, hatte kein eigenes Gewerbe, keine Handelsverbindung, keine vorteilhafte Lage, war nicht in der Nähe von Manufakturen, lag nicht auf dem Weg eines Transithandels, lag weder an einem schiffbaren Fluss noch am Meer, hatte nicht einmal einen Hafen in der Nähe, zu ihm führte kein Weg als ein Ziegenpfad über Abgründe. Sein Gewerbe wurde nicht durch neue Entdeckungen, nicht durch chemische Geheimnisse, nicht durch mechanische Erfindungen gefördert. Das einzige Geheimnis seines Aufblühens bestand in der trefflichen Feststellung der Interessen, in der freien Wahl seiner Beamten, in der unmittelbaren Nachrechnung der Ausgaben und folglich in der Vereinigung der Interessen durch den gemeinsamen Druck der Lasten und in der Vereinigung der Sympathien, was die sanfte Fortwirkung dieses einfachen Mechanismus sicherte. In der Tat, hier könnte die Einbildungskraft sich mit neuen Zusammenstellungen und Wirkungen bereichern, wodurch, der dogmatischen Frivolität des Zeitalters entgehend, sie in die Ursachen eindringen und sie begreifen konnte, wodurch das bewundernswerte Gedeihen und die Verwaltungskunst entstand, welche das Menschengeschlecht in seinen ersten Tagen erreicht zu haben scheint – was die Trümmer von Ninive und Babylon und die Einrichtung einer Speisefolge beweisen.
Ambelákia versorgte das geschäftstüchtige Deutschland nicht durch Vervollkommnung seiner Maschinen, sondern durch den Fleiß der Spindel und des Spinnrockens. Es lehrte Montpellier die Färbekunst, nicht experimentierend vom Katheder herab, sondern weil Färben dort ein Geschäft des Hauses und der Küche war, täglicher Beobachtung in jeder Küche unterworfen. Durch die Einfachheit und die Rechtlichkeit, nicht durch die Wissenschaft seines Systems, hielt es Handelsgesellschaften eine Vorlesung und gab ein in der Handelsgeschichte Europas einzigartiges Beispiel einer durch Kapital und Arbeit verbundenen, geschickt, sparsam und glücklich verwalteten Compagnie, in der Interessen des Fleißes und des Vermögens gleichmäßig vertreten waren. Dennoch aber ist das Verwaltungssystem, worauf dies alles gepfropft ist, sind die hier bestehenden Eigentums-, Besitz- und Erbrechte, die Grundlagen des politischen Baues, den tausend Dörfern Thessaliens und dem ganzen Osmanischen Reich gemeinsam. Hier muss man die Wurzel und die verheißenen künftigen Früchte suchen, deren Keime vorhanden sind, obgleich sie schlummernd im Busen jener ursprünglichen Institution liegen, die im Osten noch nicht durch die Gesetzgebung vertilgt oder durch Parteigeist zertreten sind.
Ambelákia ist indes nicht das einzige Beispiel, wie weit verbündete Handels- und Manufakturunternehmung gedeihen kann. Ayvali ist das asiatische Gegenstück zu dem europäischen Ambelákia.1 Es verdankt seinen Ursprung dem Unternehmungsgeist eines griechischen Priesters, der sich am Schluss des 18. Jahrhunderts einen Firman2 von der Pforte erwirkte. Kaum war dies schlechte Dörfchen der Gewalt des Ortsstatthalters entzogen und damit unmittelbar vom Sultan abhängig geworden, als die Munizipaleinrichtung in aller Reinheit und Kraft auflebte. Landbauern, Handwerker, Handelsleute eilten aus der Umgebung herbei; die Oliven der umliegenden Ebenen wurden in Seife verwandelt und auf eigenen Schiffen im Archipelagos3 verbreitet; der Maroquin4 wetteiferte mit dem von Jannena, die Seide mit der von Zagora5, und schnell wachsender, gleichmäßig verteilter Reichtum und eifrig gesuchte und allgemein verbreitete Belohnungen widerlegten hier wiederum das Pasquill europäischer Gesetze und Ansichten von menschlichem Verstand und Rechtlichkeit. Herr Balbi sagt in seinem Abrégé de Géographie: „Als eine wirkliche Schöpfung des Handels und der Geschäftigkeit war dieser kleine Freistaat schnell eine der ertragsreichsten und bestgeordneten Handelsstädte des osmanischen Asien geworden. Aber seine zahlreichen Manufakturen, seine Gerbereien, seine Ölmühlen, seine schöne Schule, seine Büchersammlung, seine Druckerei, seine schönen Kirchen, seine 3000 Häuser und 35 000 Einwohner sind während des Kriegs des griechischen Wiederauferstehens verschwunden.“1 Das sind die weit verbreiteten und verheerenden Wirkungen einer Revolution, die die Philanthropie hervorbrachte und die Religion heiligte, der die Freiheit zujauchzte und die von der Diplomatie gutgeheißen wurde!
1 Urquhart schönt hier die Beschreibung der Besitzverhältnisse, da die von ihm beschriebenen, scheinbar „guten“ Verhältnisse erst in die Zeit der Reformen des Sultans Mahmuds II. (1808–1839) gehören. Letztere stehen nicht zuletzt auch in enger Verbindung mit dem Niedergang des sogenannten Timar-Systems, das lange Zeit die Basis für die Vergabe des Grundbesitzes war. Bis heute ist in der Türkei eigentlich der Staat oberster Grundherr [Red.].
1 Dazu s. oben, Seite 45, Anm. 2 [Red.].
2 Der größte Teil des Garns wurde aber in den Häusern der umliegenden Bezirke gesponnen und den Ambelakioten zum Färben verkauft.
1 Damit ist der griechische Dorfälteste gemeint [Red.].
2 Diese Konkurrenz hatte einen eigentümlichen Charakter: Die Häuser waren Agenten einer Manufaktur und die Konkurrenz zwischen den Agenten erlaubte nicht, dass die Manufaktur ihren ehrlichen Vorteil gegen andere Manufakturen geltend machen konnte. Die Manufakturen hatten daheim eine gemeinschaftliche Verwaltung, die auf eigene Gefahr und Kosten ihre Güter zum Markt schickte, den Profit des Kaufmanns, Maklers und Manufakturisten vereinigend, da die Sache von einer Vereinigung von Kapital und Arbeit getrieben wurde, welche den Gewinn insoweit gleich machte, dass auch der Ärmste auf eine Belohnung rechnen und sowohl die Vorteile der Spekulation ernten, als auch den Lohn für seine Arbeit erhalten konnte.
1 Ayvali, das antike Kydonia, liegt im nordwestlichen Kleinasien gegenüber der Insel Lesbos [Red.].
2 Ein Firman ist im hier gebrauchten Sinn ein offizieller schriftlicher Erlass des türkischen Sultans oder seiner Minister bzw. hohen Beamten [Red.].
3 Der antike Name für das Ägäische Meer [Red.].
4 Ein sehr feines Ziegenleder [Red.].
5 Siehe oben Seite 46, Anm. 1 [Red.].
1 Adriano Balbi, Abrégé de géographie. Redigé par un nouveau plan d’après les derniers traités de paix et les découvertes et les plus récentes. 2. Aufl. Paris 1834. Balbi (1782–1848) stammte aus Venedig. Sein Werk, aus dem Urquhart hier zitiert (S. 641), gehörte zu den bedeutendsten geographischen Überblickspublikationen seiner Zeit.