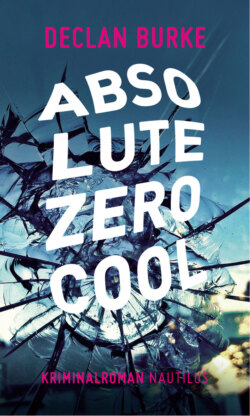Читать книгу Absolute Zero Cool - Declan Burke - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I WINTER
ОглавлениеDer Typ von der Krebsberatung scheucht uns mit einer zusammengerollten Zeitung von den Fenstern weg, damit seine Patienten uns nicht beim Rauchen sehen. Wir sind die Kinder, die gerade in den Brunnen fallen.
Einige meiner Mitraucher schleichen um die nächste Ecke in die Nähe des gläsernen Korridors, der den alten mit dem neuen Krankenhausbereich verbindet. Dort weht ein kalter Wind. Sie drängen sich zitternd zusammen. Es ist ein grauer Tag im Dezember. Schneegraupel klebt an den Fenstern. Eisiger Ostwind.
Der Typ von der Krebsberatung klopft gegen die Fenster, ruckt den Kopf hin und her, gestikuliert mit dem Daumen. Ich zeige ihm den Finger.
Er macht das Fenster auf, lehnt sich hinaus und winkt mich zu sich. Ich schlendere zu ihm. Als ich nahe genug bin, tut er so, als würde er meinen Namen vom Plastikschild abschreiben.
»Verstehe ich das richtig?«, frage ich. »Wollen Sie mir disziplinarische Maßnahmen pantomimisch androhen?«
Das provoziert ihn so sehr, dass er einen Stift aus der Tasche zieht und sich meinen Namen auf dem Handrücken notiert. »Ich werde mich über Sie beschweren, Karlsson.«
»Wie undankbar. Wenn wir nicht rauchen, haben Sie bald keinen Job mehr.«
Sein Gesicht läuft rot an. Er möchte nicht gern daran erinnert werden, dass er ein Parasit ist. Das geht vielen so. »Ganz unter uns«, sage ich. »Stress macht die Leute kaputt.«
Ihm glüht der Kopf, als er das Fenster schließt. Ich versuche, eine Beziehung herzustellen zwischen meinem Rauchen und der Krebserkrankung seiner Patienten, aber es will mir nicht so recht gelingen. Die Zuständigkeiten gehen ineinander über, okay, und krebserregende Stoffe sind überall zu finden. Trotzdem finde ich keine Berührungspunkte.
Mein Zitat für den heutigen Tag stammt von Henry G. Strauss: Ich habe vollstes Verständnis für den Amerikaner, der von den schlimmen Folgen des Rauchens las und darüber so sehr erschrak, dass er das Lesen aufgab.
»Das unterscheidet sich nicht wesentlich von der ersten Fassung«, sagt Billy. Wir sind wieder draußen auf der Terrasse. Noch so ein schöner Morgen. Ich hoffe, das gute Wetter hält an, denn ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn ins Haus einladen möchte.
»Ich glaube, es funktioniert ganz gut«, sage ich. »Du musst schon ein bisschen schräg rüberkommen, sonst nimmt uns keiner ab, dass du fähig bist, das Krankenhaus in die Luft zu jagen.«
»Schon richtig. Aber ich weiß nicht, ob ich ihm den Finger zeigen soll. Das ist doch irgendwie überflüssig. Ich an meiner Stelle wäre da etwas subtiler.«
»Ich denk mal drüber nach«, sage ich und mache mir eine Notiz.
»Was kommt dann?«, fragt er.
»Die Szene, wo du den dünnen Mann für die Leistenoperation rasierst.«
»Prima, der Nächste bitte!«
Heute rasiere ich einen dünnen Mann namens Tiernan, der eine Leistenoperation vor sich hat. Die Latexhandschuhe sind kalt, aber er scheint das nicht zu registrieren. Er tut so, als würde er nicht bemerken, dass ein fremder Mann sich an seinen Genitalien zu schaffen macht.
Stattdessen erzählt er mir von einem Freund, der jemanden kennt, der während der Anästhesie gestorben ist. Tiernan sagt, er möchte nicht sterben, ohne es zu wissen. In Wirklichkeit will er damit sagen, dass er überhaupt nicht sterben will. In Wirklichkeit will er damit sagen, dass er keinen hat, den er ins Vertrauen ziehen kann, nur den Typen, der ihm den Intimbereich rasiert.
»Ich bin nur fürs Rasieren zuständig«, sage ich. »Ich schiebe Rollstühle durch die Gegend und hebe schwere Patienten hoch, wenn die Pfleger viel zu tun haben. Wenn Sie einen Priester sehen wollen, kann ich versuchen, einen herzuholen. Aber es ist ja nur eine Leisten-OP. Reißen Sie sich zusammen.«
Er ist schockiert. Ich wische den Rest vom billigen Rasierschaum weg. »Sie glauben, Sie haben ein Problem?«, frage ich. »Ich muss Tag für Tag die Schwänze von anderen Männern angucken. Wollen Sie mit mir tauschen?«
Er arbeitet in einer Reiseagentur und verbringt den ganzen Tag damit, Pornobilder per E-Mail an seine Freunde zu verschicken, die so tun, als würden sie seinen angeblich ironischen Umgang damit gut finden.
»Sie möchten nicht sterben?«, frage ich. »Dann tun Sie was. Wenn Sie was tun, dann ist das Sterben nicht mehr so schlimm. Malen Sie ein Bild. Schaffen Sie sich ein Kind an. Und dann lassen Sie los. Sterben ist eigentlich nichts anderes als Loslassen.«
Aber er hört nicht zu. Er denkt wieder an diesen Typen, den sein Freund gekannt hat, der starb, ohne es mitzubekommen. Ich finde das total witzig. Ich meine, wenn die Toten eins wissen, dann, dass sie tot sind. Und falls das ungefähr so ähnlich sein sollte wie die Gewissheit der Lebenden, dass sie leben, dann ist es jedenfalls keine große Sache.
Er sieht zu, wie ich die Latexhandschuhe abstreife.
»Passen Sie gut auf«, sage ich. »Sie werden später vielleicht darauf zurückgreifen müssen. Sie wären überrascht, wie viele Menschen gelernt haben, ohne Würde zu leben. Statistisch gesehen haben Sie gute Chancen, einer von denen zu werden.«
Die Oberschwester kommt rein. Ich frage mich, ob man diese Art von Geschäftigkeit auf der Krankenpflegerschule lernt. Sie macht Tiernans Kittel auf. Oberschwestern prüfen normalerweise nicht, ob die Rasur korrekt ist, aber vor ein paar Wochen habe ich versehentlich die falsche Seite rasiert.
»Wie geht es Ihnen, Mr Tiernan?«, fragt sie. Das sagt sie, um darüber hinwegzutäuschen, dass sie meine Arbeit überprüft.
»Ich hab einen Höllendurst«, sagt er.
»Es dauert nicht mehr lange«, sagt sie. »Bald ist es vorbei.« Sie spricht mit mir, ohne mich anzuschauen.
»Karlsson, bringen Sie Mr Tiernan bitte um Viertel vor vier nach unten in den OP.«
»Hoffentlich passiert unterwegs nichts Unvorhergesehenes«, sage ich. Aber sie hört nicht hin.
Er lümmelt auf seinem Stuhl und tippt sich mit dem Ende seines Bleistifts gegen die Lippen.
»Du nennst mich immer noch Karlsson«, sagt er.
»Genau genommen sind es die anderen Charaktere, die dich Karlsson nennen.«
»Sie sollen mich Billy nennen.«
»Das könnte ich ändern, klar. Aber wenn du Billy wirst, bist du nicht mehr Karlsson.«
»Ich bin nicht mehr Karlsson.«
»Nicht für mich oder dich. Aber wenn die anderen Personen dich Billy nennen, dann erwarten sie, dass du auch so aussiehst wie jemand, der Billy heißt. Und dann muss ich mir die Mühe machen, dein Aussehen zu ändern, und zwar jedes Mal, wenn es beschrieben wird. Deine Haare, deine Augen, die Art, wie du läufst…«
»Ändern wir das jetzt, oder ändern wir das nicht?«
Sein Ton gefällt mir nicht.
»Ich will dir ja nicht zu nahe treten, Billy, aber ich tu dir hier einen Gefallen. Okay? Und da wir das zusätzlich zu meiner anderen Arbeit machen, können wir uns nicht mit jedem winzigen Detail herumschlagen. Du musst dir deine Rolle mehr wie ein Schauspieler vorstellen. Kapiert? So tun, als wäre die Geschichte ein Film von Mike Leigh oder einer von diesen Dogma-Streifen. Du fügst einfach hier und da etwas zu der Karlsson-Rolle hinzu, erfindest neue Dialoge, einen Spleen, eine Marotte.
Veränderst ihn so, dass er dir mehr ähnelt, aber du solltest vorsichtig rangehen. Wie findest du das?«
Er braucht eine Weile zum Überlegen.
»Okay«, sagt er dann. »Ich kann’s ja mal probieren.«
»Prima. Also pass auf. Ich hab mir überlegt, dass wir diesen Kram mit dem Papst und Camus weglassen.«
»Welchen Kram?«
»Diese Torwartsache.«
Er schüttelt den Kopf. »Kann mich nicht daran erinnern. Was hab ich denn dazu gesagt?«
Albert Camus und Papst Johannes Paul II. waren beide in ihrer Jugend Torwarte. Ich stelle mir vor, wie sie an den entgegengesetzten Seiten des Stadions stehen und sich gegenseitig den Ball zuspielen, während die Hooligans auf ihren Plätzen den Aufstand proben.
Als ehemalige Torwarte haben Camus und Papst Johannes Paul II. vielleicht oder vielleicht auch nicht gekichert, als sie von James Joyces Anspruch lasen, er wolle gleichzeitig Wärter und Kreuziger des Bewusstseins seiner Nation sein.
Was mich betrifft, so wurde ich geboren. Später lernte ich lesen, dann schreiben. Seitdem beschäftige ich mich größtenteils mit Büchern. Mit Büchern und mit Masturbieren.
Schreiben und Masturbieren haben gemeinsam, dass sie für temporäre Erleichterung sorgen und die Illusion vermitteln, man hätte etwas erreicht. Viele große Schriftsteller sind begeisterte Onanisten gewesen, und viele begeisterte Onanisten waren große Schriftsteller. Der einzige wesentliche Unterschied ist, ob für sie das Wichsen oder das Schreiben zuerst kommt.
Was mich betrifft, ich schreibe was, hole mir einen runter und gehe ins Bett. Nur ein Barbar würde zuerst wichsen und dann schreiben.
Mein Zitat für den heutigen Tag stammt von dem dänischen Schriftsteller Isak Dinesen: Ich schreibe jeden Tag ein bisschen, ohne Hoffnung und ohne Verzweiflung.
Jonathan Williams ist ein amüsanter Waliser, auch wenn er dem Hollywood-Klischee eines netten englischen Professors sehr ähnelt.
»Nein«, sagt er. »Ich hab die Karlsson-Geschichte niemandem gegeben.« Seine Stimme dröhnt durchs Telefon. »Ohne deine Erlaubnis würde ich das niemals tun.«
»Nicht mal, um ein Leservotum zu bekommen?«
»Soweit ich weiß nicht. Und ich würde mich bestimmt daran erinnern«, lacht er. »Ein Leservotum über dieses besondere Prachtstück.«
»Deshalb frage ich ja.«
»Warum? Gibt’s ein Problem?«
»Nicht direkt ein Problem.« Ich erzähle ihm, dass ich eine Auszeit genommen habe, sechs Wochen Klausur zum Schreiben, und von Billys Idee, die Karlsson-Geschichte zu überarbeiten. »Ich frage mich nur, wie er an die Geschichte rangekommen ist.«
»Ich habe keine Ahnung«, sagt er. »Von mir hat er sie bestimmt nicht bekommen.«
Jonathan ist nicht mehr mein Agent, aber da er ein guter Kerl ist, fragt er noch, wie’s bei mir so läuft. Ich erzähle ihm, dass mein Lektor bei Harcourt mich wegen des Abgabetermins bedrängt.
»Vergiss ihn«, mahnt er. »Mach es gut, das ist das Allerwichtigste. In zehn Jahren interessiert sich niemand dafür, ob du den Abgabetermin eingehalten hast oder nicht.«
Die Worte eines Heiligen.
»Falls es dir nichts ausmacht, würde ich dich gern was fragen…«
»Schieß los.«
»Hast du dich beim Arts Council beworben, damit sie die Kosten deiner Klausur tragen?«
»Hab ich, ja, aber ich hatte kein Glück. Anscheinend werden Kriminalkomödien nicht gefördert.«
»Ich nehme an, du hast nicht die Karlsson-Geschichte eingereicht«, sagt er.
»Doch, hab ich. Sie wollten ja Arbeitsproben von mir haben, und Karlsson lag halt herum.«
»Das ist wahrscheinlich die Lösung«, sagt er. »Jemand vom Arts Council hat die Geschichte gelesen und sie deinem Freund Billy gegeben. Das ist natürlich nicht die feine Art, aber es erklärt alles.«
»Und ich kann nicht herauskriegen, wer es gelesen hat?«
»Wahrscheinlich nicht. Solche Gutachten sind in der Regel anonym, um Mauscheleien auszuschließen. Aber ich kann ja mal diskret nachfragen, wenn du willst.«
»Das wäre super.«
»Mach dir keine Sorgen«, sagt er. »Wegen der Rechte, meine ich. Falls es irgendwann Probleme geben sollte, dann erzähle ich allen, die danach fragen, dass ich das Manuskript in seiner ursprünglichen Form gelesen habe und dass du der einzige Urheber bist.«
»Vielen Dank, Jonathan.«
»Keine Ursache. Oh, und sag doch bitte Anna, dass ich nach ihr gefragt habe, wenn du sie das nächste Mal siehst. Sie ist wirklich nett, findest du nicht?«
Anna MacKerrig, die Tochter von Lord Lawrence MacKerrig, der als nobel gesonnener Adeliger und schottischer Presbyterianer vor zwanzig Jahren die Künstlerresidenz in Sligo gegründet hat.
»Ich hab sie schon länger nicht mehr gesehen, aber ich richte es ihr aus, wenn ich sie treffe.«
»Sehr schön. Also ich rede dann mit … Oh, jetzt fällt mir wieder ein, warum ich dich überhaupt angerufen habe.«
»Ja?«
»Wegen The Big O. Ein italienischer Verlag hat ein Angebot gemacht. Der Vorschuss ist mehr eine symbolische Geste, aber immerhin…«
»Macht nichts, ist doch toll, wir sagen zu. Eine italienische Ausgabe wäre hübsch.«
»Ganz bestimmt.« Er lacht vor sich hin. »Vielleicht reicht das Honorar ja für ein Wochenende in Rom.«
Vielleicht. Wenn ich hinschwimme.
»Ich melde mich dann«, sagt er und ist wieder weg.
»Weißt du«, sagt Billy, »ich glaube nicht, dass ich Schriftsteller sein möchte. Ich sehe ja, dass du was draufhast und Karlsson eine gewisse Tiefe verleihen willst. Aber jetzt…«
»Hast du deine Meinung geändert, seit du mich kennengelernt hast?«
Ich meine das scherzhaft, aber er nickt. »Ich glaube«, sagt er, »dass es nicht zusammenpasst, dass Karlsson einerseits ein Schriftsteller werden und kreativ sein will und andererseits das Krankenhaus in die Luft sprengen möchte.«
»Die Lust der Zerstörung ist gleichzeitig eine schaffende Lust.«
»Hmm«, sagt er. »Ich bin nicht sicher, ob die Leute mich mögen, wenn ich solche nihilistischen Phrasen dresche. Diese Endzeitsprüche kommen beim Publikum nicht mehr so gut an.«
»Wie wär’s dann damit«, sage ich. »Zu Anfang willst du Schriftsteller werden. Leider bekommst du nur Absagen. Also bist du enttäuscht und entschließt dich, das Krankenhaus in die Luft zu sprengen.«
»Zu narzisstisch. Nur ein Schriftsteller kann so egomanisch denken.«
»Aber ein Krankenhaus in die Luft zu sprengen ist doch nicht narzisstisch.«
»Es geht darum, Aufmerksamkeit zu erregen, oder? Du hast mich doch in die Situation gebracht, dass ich etwas Drastisches tun muss.«
»Lass mich da raus, Billy. Das mit dem Krankenhaus war deine Idee.«
»Ich war doch nicht immer so, Mann. Wenn du mich vorher gefragt hättest, dann hätte ich dir erzählt, dass ich davon geträumt habe, als Kapitän einer Charteryacht zwischen den griechischen Inseln herumzusegeln.«
»Ein Hilfsarbeiter, der auf einer Yacht durch die Ägäis schippert?«
Er kneift die Augen zusammen. »Soll das etwa heißen, dass die Unterschicht kein Recht auf Träume hat?«
»Die Unterschicht kann träumen, was sie will, Billy, aber wir reden hier nicht über irgendwelche bescheuerten Groschenromane. Wenn dein Traum plausibel gewesen wäre, dann…«
»Ein plausibler Traum?«
»Du kannst es auch realisierbare Phantasie nennen. Jeder darf sich wünschen, was er will, viel Glück dabei, aber wenn es nicht zur Logik der Geschichte passt, dann geht’s halt nicht.«
»Das schränkt aber ganz schön ein, oder?«
»Es gibt nun mal keine Einhörner im Weltraum, Billy.«
Er grinst. »Könnte es aber geben, wenn sie speziell für sie entworfene Helme tragen würden.«
»Na schön. Wenn du gern Einhörner auf dem Mars hast und Aushilfen, die mit Yachten herumschippern, soll es mir Recht sein. Aber niemand wird so was kaufen.«
»Damit gibst du nur zu, dass du nicht gut genug bist, um es überzeugend zu schreiben.« Leichtes Achselzucken. »Vielleicht ist das ja der Grund, warum du immer noch neben deinem normalen Job schreibst und dir spezielle Auszeiten fürs Überarbeiten nehmen musst.«
»Kann schon sein. Vielleicht sollten wir das Ganze einfach vergessen, damit ich mich wieder mit dem beschäftigen kann, was mir beim Schreiben Spaß macht.«
Er steht auf. »Lass uns mal eine Pause machen. Wir kriegen heute ganz eindeutig nichts Konstruktives mehr auf die Reihe.« Er dreht sich eine Zigarette von meinem Tabak und zündet sie an. »Eine Sache noch«, er bläst den Rauch aus. »Man kann nicht einfach so drohen, den Stecker zu ziehen. Entweder man tut es oder nicht. Wenn man nicht vollkommen davon überzeugt ist, dann funktioniert es nicht. Der Anfang ist das Einfachste. Wenn es dir jetzt schon schwerfällt, dann wird es ein Albtraum, wenn wir in die Endphase kommen.«
Er hat recht, aber sich jetzt zu entschuldigen ginge einfach zu weit.
»Übrigens«, sage ich, »bin ich morgen nicht hier. Wir fahren mit Rosie zu Debs Eltern.«
»Kein Problem.«
»Ich bin bestimmt nicht vor Sonntagabend zurück.«
»Dann sehen wir uns also Montagmorgen.«
»Montag, ja.«
Debs steht im Durchgang zum Patio des kleinen Häuschens, hat Rosie über die Schulter gelegt und klopft ihr auf den Rücken, damit sie ihr Bäuerchen macht. Ich lege das Manuskript auf den Tresen, stelle die Kaffeebecher daneben und gehe in die Hocke, um Rosie ins Gesicht zu sehen, aber sie hat glasige Augen und döst, nachdem sie sich satt getrunken hat.
»Weißt du«, sagt Debs, »es ist ganz gut, dass niemand sonst das sehen kann, was ich sehe. Mir würde nämlich gar nicht gefallen, dass andere Leute meinen Mann für einen Geisteskranken halten, der stundenlang mit seinen erfundenen Figuren reden muss, um mit seinem Alltag klarzukommen.«
»Soll ich die Kleine nehmen?«
»Das passt gut.« Sie reicht mir Rosie rüber und riecht dabei an ihr. »Ich glaube, sie braucht eine frische Windel. Bei der Gelegenheit kannst du auch ihren Strampler wechseln. Zieh ihr diesen kleinen Kimono an.«
»Den weißen?«
»Nein, den rosafarbenen, den deine Mutter ihr gekauft hat. In Rosa sieht sie besonders hübsch aus.«
»Komm her zu mir«, singe ich und streichle Rosies Rücken. Sie rülpst, und eine weiße, cremige Flüssigkeit rinnt über meine Schulter. »Bist ein gutes Mädchen.«
Ich hege große Sympathie für Orpheus. Vielleicht fühle ich mich deshalb so zu Kellern, Untergeschossen, Höhlen und Katakomben hingezogen. Bestimmt hängt das mit diesem Freud’schen Schauder zusammen, der mit meiner Faszination für Gewölbe, Grabstätten und Bunker einhergeht. Während meiner regelmäßigen Besichtigungsgänge durch den höhlenartigen Untergrund der Tiefgarage frage ich mich allerdings manchmal, ob solche pseudogynäkologischen Erkundungen nur meine Sehnsucht nach einer Rückkehr in den Mutterleib kaschieren oder eher von einem bösartigen Drang zum Penetrieren und Eindringen zeugen. Steige ich in die Unterwelt hinab, um Eurydike zu befreien oder um sicherzustellen, dass mein absehbarer Blick zurück ihre Hoffnungen für immer zerstört?
Orpheus hatte das Glück, von einem feinsinnigen und hochtalentierten Künstler wie Apollonios von Rhodos erschaffen zu werden. In der ursprünglichen Mythologie ist er ein angesehenes Mitglied der Argonauten, die seine geliebte Frau vor dem Vergessen retten.
Leider hatte er das Pech, dass seine Geschichte später von Virgil, Plato und Ovid bearbeitet wurde, die daraus nicht nur eine Tragödie machten, in der der Held sich mit den Schrecken der Hölle herumschlagen muss, sondern ihn auch noch als Feigling darstellten, der an Eurydikes Auslöschung schuld ist. Weil seine Liebe nicht wahrhaftig war, wurde Orpheus von den unberechenbaren Göttern bestraft.
In meiner Unterwelt durchstreife ich die Schatten und düsteren Ecken der Katakomben des Krankenhauses und frage mich, ob je ein Sterblicher mutig die Urteile der Götter ertrug, die ja die Ewigkeit auf ihrer Seite haben, um ausgiebig das Für und Wider einer endgültigen Selbstaufopferung zu diskutieren.
Später beim Abendessen mit einem guten Glas Rotwein bemühe ich mich, die Feinheiten herauszukitzeln.
»Du möchtest also wissen«, sagt Cassie, »ob es mir lieber wäre, wenn du mich aus der Hölle rettest oder wenn du mir dort Gesellschaft leistest?«
»So ungefähr, ja.«
»Schwer zu sagen.« Sie nimmt etwas Pasta in den Mund und kaut nachdenklich. »Könnten wir nicht einfach die Plätze tauschen?«
»Ich glaube nicht, dass Orpheus diese Option hatte.«
»Typisch. Der Typ, der das geschrieben hat, war garantiert ein Sexist.«
»Eigentlich waren es mehrere Autoren. Aber sie waren alle Sexisten, das stimmt schon.«
»Das ist ziemlich spannend. Würdest du es tun?«, fragt sie.
»Was tun?«
»Den Platz mit mir tauschen.«
»Das macht doch keinen Sinn. Ich sollte besser am Leben bleiben und versuchen, dich da rauszuholen, oder?«
»Nein, die Möglichkeit gebe ich dir nicht. Würdest du also?«
»Ich weiß nicht.«
»Warum nicht?«
»Na ja, schwer zu sagen. Du bist ja nicht in der Hölle.«
»Karlsson, wir sind gerade zusammengezogen. Wie viel schlimmer könnte die Hölle denn sein?«
»Eins zu null für dich.«
Ich lernte Cassie über eine Kontaktanzeige kennen. Ihr Text gefiel mir, weil sie erklärte, sie lege Wert auf »durchschnittlichen Sinn für Humor«. Die meisten Leute schreiben in solchen Fällen »guten Sinn für Humor«, aber Cassie redete nicht um den heißen Brei herum. Entweder etwas ist witzig oder nicht, sagte sie.
Die meisten Leute behaupten, dass ihnen zu allererst der Sinn für Humor beim Anderen gefallen hat, womit sie durchblicken lassen, dass das äußere Erscheinungsbild ihnen nicht so wichtig sei, weil Schönheit ja vergänglich ist. Dazu gehört die Annahme, dass der Sinn für Humor nicht altern kann, dass Humor keine Falten bekommt, nicht austrocknet und keinen Tumor entwickelt. Die meisten Leute glauben, dass Dinge, die sie nicht sehen können – Hoffnung, Sauerstoff, Gott – sich nicht ändern, nicht alt werden und nicht sterben.
Ein Sinn für Humor ist wie alles andere: Er dient einem bestimmten Zweck und wird dann in eine andere Energieform umgewandelt. Das Kunststück besteht darin, geschmeidig und im Fluss zu bleiben, um mit jeder neuen Erscheinungsform ganz spezifisch umgehen zu können.
»Den nächsten Abschnitt möchtest du vielleicht lieber streichen«, sage ich. »Es ist ein Ausschnitt aus dem Roman, den Karlsson gerade schreibt.«
»Ist er denn gut?«
»Eigentlich nicht. Größtenteils sind es nur Kritzeleien oder Entwürfe.«
»Können wir was davon verwerten?«
»Eigentlich nicht. Ehrlich gesagt, sollten sie ja Schund sein, um Karlssons Großmannssucht zu illustrieren. Und soweit ich mich erinnere, waren das die Passagen, die Jonathan rausgestrichen hat. Die Teile mit den perversen Sexgeschichten und so.«
»Jetzt bin ich aber neugierig. Wohlan, Macduff!«
Sermo Vulgus: Roman (Auszug)
Cassie, meine Ellbogen rutschen in unbeholfenen Windungen über die billige Lackierung des Sperrholztischs, während ich schreibe, um die Erinnerung zu löschen. Der dünne weiße Schwamm saugt die Worte auf. Begrab mich in einem billig lackierten Sperrholzsarg, Cassie. Dann schau hinweg über die Vergangenheit. Trainiere deine Augen, dass sie bis hinter den Horizont unseres Tuns und Wissens schauen können, dorthin zurück, wo unsere Zukunft endet.
Cassie, wir hätten zusammen tanzen sollen, wenigstens einmal, aber du stolpertest über Worte wie ›Vorstellungen‹.
Habe ich dich wirklich gehasst? Habe ich dich erwählt wegen deiner überbordenden Form, dieses Überflusses, der mir erlaubte, in der angenehmen Wärme inzestuöser Vergessenheit zu schwelgen? Warst du wirklich die Mutter, die ich nie hatte? Der Coitus interruptus war für mich immer die süßeste Erfüllung, Herausziehen und Fortgleiten, um schlaff und zufrieden zurück in die Welt zu taumeln.
Cassie, warum habe ich dich erst begehrt, als du für mich verloren warst?
»Schmeiß es weg«, sagt er.
»Gut.«
»Dieses ganze Inzestgeschwätz, mein Gott…«
»Ich hab ja gesagt, es wird gestrichen.«
»Was kommt als Nächstes?«
»Du wirst zum ersten Mal offiziell verwarnt.«
Die alten neuen Vorschriften lauteten: Rauchen im Krankenhaus verboten. Die neuen neuen Vorschriften lauten: Rauchen auf dem Krankenhausgelände verboten. Also hatte der Typ von der Krebsberatung sich offiziell beschwert. Wenn er sich mündlich beschwert hätte, hätte ich eine mündliche Rüge bekommen. Eine offizielle schriftliche Beschwerde hat eine offizielle schriftliche Verwarnung zur Folge. Mein Vorgesetzter erklärt mir das, nachdem er mir die offizielle Verwarnung überreicht hat. »Und was ist mit den Regenwäldern?«, frage ich. »Holzt keine Bäume ab für offizielle Verwarnungen. Wenn ihr mich verwarnen wollt, dann schickt mir eine E-Mail oder eine SMS. Oder druckt es auf Recycling-Papier. Schreibt die neue Verwarnung auf die Rückseite der vorherigen.«
»So ist nun mal der Dienstweg«, sagt er. Er trägt ein zugeknöpftes gestreiftes Hemd unter einem Pulli mit V-Ausschnitt, seine fettigen Haare reichen bis über den Kragen.
»Gehen Sie mal zum Friseur«, sage ich. »Sie sehen aus wie ein schmieriger Mönch. Bringen Sie sich auf Vordermann, öffnen Sie den obersten Knopf. Dass Sie verheiratet sind, ist keine Entschuldigung.«
Das sage ich nicht. Tatsächlich sage ich: »Wie wäre es mit der hintersten Ecke des überfüllten Parkplatzes, dort, wo diese geizigen Drecksäcke ihre Autos abstellen, die keine Parkgebühren zahlen wollen?«
»Karlsson, überall auf dem Krankenhausgrundstück ist das Rauchen verboten.«
»Von dort aus kann man das Krankenhaus nicht mal sehen.«
»So ist nun mal die Regel.«
»Hören Sie mal, ich verstehe ja, wieso das Rauchen im Krankenhaus verboten ist, aber…«
»Karlsson, wenn ich Sie dabei erwische, wie sie irgendwo auf dem Grundstück des Krankenhauses rauchen, sind Sie gefeuert.«
»Okay. Und wann wird es verboten, auf dem Krankenhausgelände zu trinken? Wann überprüfen wir zum Beispiel die Thermoskannen der Chirurgen, wenn sie morgens hier ankommen?«
»Es ist doch zu Ihrem eigenen Nutzen«, sagt er. »Sie leben länger.«
Die neue Richtlinie hat überhaupt nichts mit meiner Gesundheit zu tun und auch nicht mit seiner. Er ist einfach von dieser Krankheit infiziert, die ihn dazu drängt, jede neue Vorschrift wie eine Art Placebo des Tages zu befolgen. Wem schade ich denn, wenn ich auf dem überfüllten Parkplatz rauche? Ich gefährde meine Gesundheit, na klar, aber ihn bringe ich um.
»Wenn Sie jemandem vorschreiben können, wie er sich umzubringen hat«, sage ich, »dann können Sie ihm auch alles andere vorschreiben. Warten Sie einfach mal ab, bis jemand kommt und Ihnen rät, aus welchem Fenster Sie springen sollen.«
Das sage ich nicht.
»Ich habe Sie gewarnt«, sagt er.
»Das kann man wohl sagen. Kann ich noch eine Extraportion Drohung dazubekommen?«
Aber er hört nicht zu. Mein Zitat für den heutigen Tag stammt von Aristoteles: Es gibt kein großes Genie ohne einen Schuss Verrücktheit.
»Vielleicht sollten wir das Aristoteles-Zitat streichen«, sagt er. »Ich frage mich, ob die Leute auf so was wie Wahnsinn positiv reagieren, es sei denn, Russell Crowe spielt die Hauptrolle. Und die vulgäre Ausdrucksweise sollte auch rausfliegen.«
»Kein Wahnsinn«, sage ich und notiere mir das. »Außerdem keine unanständigen Worte. Sonst noch was?«
»Nur eins noch.« Er zieht ein Blatt Papier aus seinem Rucksack. »Das hier habe ich gestern Abend geschrieben. Ich hab mich in Bezug auf Cassie an etwas erinnert. Interessiert dich das?«
»Klar, wieso nicht?«
Er hält mir das Blatt hin.
»Nein«, sage ich. »Du hast es geschrieben, also lies es auch.«
»Ich hab nicht so eine gute Stimme zum Vorlesen«, sagt er.
»Du willst doch, dass es realistischer wird, oder? Authentischer?«
Er schaut mich scheel an, macht sich über sich selbst lustig und grinst. »Na gut«, sagt er dann.
Manchmal singt Cassie im Schlaf. Die Worte sind nicht zu verstehen, eine Melodie ist nicht vorhanden. Es klingt wie Stöhnen, kurzes Aufschreien, schrilles Quieken. Nichts davon ergibt irgendeinen Sinn. Auch als zusammenhängende Sequenz ergibt es keinen Sinn. Falls es eine direkte Verbindungslinie zwischen dem Rauschen des Weltalls und einem Requiem von Mozart gibt, zwischen bedeutungslosem Zischen und perfektem Klanggebilde, dann gehört Cassie mit ihrem Gesang in einen Chor der Wale.
Manchmal singt sie zwei Monate nicht, dann dreimal in der Woche. Es dauert mal fünf Sekunden, mal eine Minute. Warum?
Ich habe ihren Gesang aufgenommen, ohne sie um Erlaubnis zu bitten. Ein unverzeihlicher Übergriff. Aber Cassie weiß gar nicht, dass sie singt. Wenn ich es ihr erzähle, wird sie vielleicht nie mehr singen. Was dann?
Ich habe das Band langsamer abgespielt, dann beschleunigt und es rückwärts laufen lassen. Keine meiner Manipulationen hat irgendwelchen Sinn zutage gefördert. Einstweilen habe ich die folgenden Möglichkeiten ausgeschlossen: Hymnen, Popsongs, Erkennungsmelodien von Fernsehsendungen, Werbejingles, Kinderlieder.
Ich weiß nur, dass ihr Gesang nicht dazu da ist, gehört zu werden. Es ist noch nicht mal wie das unbewusste Schreien eines Babys, das zwar ein unartikuliertes Plärren ist, aber immerhin auf Hunger, eine nasse Windel oder Schmerz hinweist.
Im Dunkeln warte ich darauf, dass Cassie singt. Im Augenblick des Wartens erreiche ich den Tangentialpunkt, an dem ich die Menschheit berühre, diese einzigartige Rasse, die einen Kreisbogen entlangstrebt, der entworfen wurde, um der unumstößlichen Logik der Natur zu widersprechen.
»Und?«, fragt er.
»Du hast den richtigen Ton getroffen«, sage ich. »Und ich finde, es ist dir gut gelungen, dir den Anschein eines mitfühlenden Perversen zu geben.«
»Es stört dich also nicht, wenn ich ab und zu was beisteuere?«
»Überhaupt nicht. Je mehr du schreibst, umso weniger Arbeit habe ich.«
»He«, sagt er mit einem schüchternen, dümmlichen Grinsen, »wäre es nicht witzig, wenn ich darüber schreibe, dass ich kein Schriftsteller sein will?«
»Hol mir mal schnell ein Korsett«, sage ich. »Könnte sein, dass ich mir eine Rippe angeknackst habe.«
Heute Morgen hängt dichter Nebel über den Bergen, und ganz feine Tropfen rieseln ständig herab. So ein Nieselregen, der überall durchdringt, ohne dass man es merkt. Ich trete vom Fenster zurück, die Lichter sind ausgeschaltet, ich trinke meinen Kaffee und schaue zu, wie Billy etwas liest, das er geschrieben hat. Ab und zu schaut er auf und sieht hinüber zum Haus.
Gegen halb neun geht er, läuft linkisch um das Bambusbeet auf der anderen Seite des Karpfentümpels herum, mit hochgezogenen Schultern wegen des Regens.
Die Art, wie er geht, bringt mich auf den Gedanken, dass er die acht Zentimeter, die er angeblich zugelegt hat, dicken Innensohlen in seinen Schuhen verdankt.
Nicht mal eine Tasse Kaffee hat er bekommen. Jetzt war ich dran.
In umgekehrter Reihenfolge funktioniert die Kommandohierarchie im Krankenhaus ungefähr so:
Kakerlaken
Aushilfskräfte
Vorgesetzte der Aushilfskräfte
Krankenschwestern
Stationsschwestern
Oberschwestern
Assistenzärzte
Berater
Spezialisten
Wirtschaftsprüfer
Verwaltungsrat
Gott
Alle diese wundersamen Kreaturen müssen ihre Notdurft verrichten. Früher oder später sind die Rohre verstopft. Dann warten alle darauf, dass eine der Aushilfen kommt und den Augiasstall ausmistet. Anschließend beginnt alles von vorn.
Ich nenne diesen Prozess »Dienstag«.
Alle haben was gegen Montage, aber Montage laufen immer gut.
Dienstage sind übel.
Dienstag ist der Mr Hyde des Montags. Er lungert im Schatten herum und zwirbelt sich seinen ausladenden Schnurrbart. Die Dienstage locken Freitag den 13. auf den Parkplatz und zünden ihm die Füße an, nur um zuzuschauen, wie er tanzt. Wenn der Dienstag ein Kontinent wäre, dann wäre er Afrika südlich der Sahara: verleugnet, zerstört und höllisch fies.
Dienstage stehen permanent vor einer Rebellion. Ich kann das spüren. Dienstage wollen Samstagabende sein, und die wenigen süßen Ausnahmen im Jahr genügen ihnen nicht. Wenn euch also irgendwann alles um die Ohren fliegt, dann sagt nicht, ihr seid nicht gewarnt worden.
Wir haben die Dienstage zu sehr an die Kandare genommen, ihnen keine freie Zeit gelassen. Wir haben uns keine Gedanken über die Arbeitsbedingungen der Dienstage gemacht. Der Dienstag ist wie der blindwütige Samson, dessen Haar unbemerkt, aber stetig wächst.
Ich habe euch gewarnt.
Der Gewerkschaftsvertreter ist am Telefon, also muss heute wohl Dienstag sein.
»Du hast schon wieder eine offizielle Verwarnung bekommen, Karlsson«, sagt er. »Wenn ein Mitglied sich auf der Arbeit daneben benimmt, wirft das ein schlechtes Licht auf die Gewerkschaft. Das solltest du beherzigen, denn wir sitzen alle im selben Boot. Wenn jeder seinen Beitrag leistet, ist es für alle einfacher. Du weißt doch, dass die Arbeitsverträge der Reinigungskräfte nächsten Monat neu verhandelt werden.«
»Solltet ihr nicht auf meiner Seite stehen?«, frage ich. »Man hat mich in den Arsch gefickt, metaphorisch gesprochen. Wie kann denn in diesem Zusammenhang jeder seinen Beitrag leisten, wenn jemandem im metaphorischen Sinn der Arsch aufgerissen wird?«
»Regeln sind nun mal Regeln«, sagt er.
»Es gibt aber auch schlechte Gesetze. Das Gesetz ist ein Scheißdreck, und es muss auch als Scheißdreck betrachtet werden.«
Aber es ist Dienstag, und er hört nicht zu. »Noch ein Vergehen und du bist suspendiert«, sagt er.
»Noch eins und ich bin gefeuert. Wie soll ich denn suspendiert werden, wenn ich schon gefeuert bin?«
»Dies ist eine disziplinarische Verwarnung. Du bekommst eine offizielle Benachrichtigung innerhalb von drei Arbeitstagen.«
»Kann ich nicht warten, bis die offizielle Benachrichtigung eingetroffen ist, bevor ich mich als diszipliniert betrachte? Ich hab Probleme mit imaginären Maßnahmen von Autoritäten. Ich bin Atheist, schick mir eine Heuschreckenplage.«
Aber es ist Dienstag. Er hört nicht zu.
»Wieder diese obszöne Ausdrucksweise«, sagt er.
»Wie du meinst.«
»Außerdem ist vielleicht zu viel von Dienstagen die Rede. Aber das soll nur eine Anregung sein. Du bist der Schriftsteller.«
»Nein, vielleicht hast du recht. Ich geh noch mal drüber.«
»Okay. Was kommt jetzt?«
»Ein weiterer Ausschnitt aus deinem Roman über Cassie.«
»Ich dachte, das werfen wir alles weg.«
»Die letzte Passage haben wir weggeworfen, ja. Aber danach ist mir klar geworden, dass diese Ausschnitte eigentlich Liebesbriefe von Karlsson an Cassie sind.«
»Echt?«
»Was willst du jetzt also tun?«
Er zuckt mit den Schultern. »Wir können’s ja mal probieren.«
Sermo Vulgus: Roman (Auszug)
Als junger Mann in Wien wurde Hitler von einer Jüdin abgewiesen. Eine Kugel zerfetzte seinen Ärmel, als er über das Niemandsland stürmte.
Cassie, fünfzehn Zentimeter hätten das Leben der Sechs Millionen retten können.
Cassie, sie behaupten, Hitler hätte sich einst in der Gesellschaft von Juden wohlgefühlt.
Wie können sie dann so unbekümmert von Schicksal, Vorsehung und prokreativem Sex sprechen?
Verdamme die Zukunft, Cassie, dämme sie ein. Mach’s mir mit der Hand, dem Mund, mit dem Arsch. Gib mir deine Achselhöhlen, du Dirne. Lass uns die Körper von Jungfrauen aufreißen, auf dass ihre Wunden sich weiten und uns ficken wie toll, bis Gott aus seinem Himmel fällt. Ergehen wir uns in Schleim, Blut, Mösensaft und Sperma; spar dir deine Tränen für den Essig auf, den wir den durstigen Märtyrern reichen.
»Das soll ein Liebesbrief sein?«, fragt er.
»Es ist ein Liebesbrief von Karlsson.«
»Mit Frauen kennt er sich wohl nicht so gut aus?«
Debs zieht die Patiotür auf und steckt den Kopf heraus.
»He, Hemingway«, ruft sie. »Deine Tochter hat volle Windeln. Hopp-hopp.«
Ich winke ihr zu. »Ich muss los«, sage ich zu Billy. »Familientag. Wir fahren raus nach Drumcliffe zum Mittagessen. Es wird Zeit, dass Rosie dem Grab von Yeats einen Besuch abstattet.«
Er nimmt die Sonnenbrille ab und zwinkert mir mit seinem einen Auge zu. »Wirf ein kaltes Auge auf ihn«, sagt er. Schwer zu sagen, ob er sein strahlend Blaues meint oder die Dörrpflaume.
Ich halte den Auszug aus Sermo Vulgus hoch. »Was willst du jetzt damit machen?«
»Als Liebesbrief finde ich es nicht so gut«, sagt er.
»Ich kann es wegwerfen, wenn du willst.«
»Vielleicht können wir es ja an einer anderen Stelle einbauen. Wo es nichts mit Cassie zu tun hat.«
»Kriegen wir hin. Dann bis morgen.«
»Am Samstag?«
»Oh, stimmt. Also bis Montag.«
»Super«, sagt er. »Ich würde morgen gern mal ausschlafen. Dieses frühe Aufstehen macht mich echt fertig.«
»Versuch mal, ein Kind zu kriegen«, sage ich. »Dann weißt du, was Frühaufstehen bedeutet.«
Er schaut mich kurz an und wirkt irgendwie kämpferisch.
»Das hängt ja wohl ganz von dir ab, oder?«
»Möchtest du, dass Cassie schwanger wird?«
»Das wäre bestimmt gut für uns beide.«
»Aber sie nimmt die Pille, oder?«
»Tut sie. Vielleicht könntest du ihre Pillen ja gegen Folsäuretabletten austauschen oder so.«
»Ohne dass sie es merkt?«
»Manchmal muss man Böses tun, um das Gute zu erreichen«, sagt er. »Die besten Geschichten handeln doch genau davon.«
Buddhistische Mönche ergehen sich darin, komplexe Mosaikkunstwerke aus Tausenden genau umrissenen allerfeinsten Häufchen farbigem Staub herzustellen. Manchmal arbeiten sie jahrelang daran. Wenn sie damit fertig sind, fegen sie den ganzen Staub in eine Ecke und fangen von neuem an.
Ich erfreue mich an diesem perversen Gedanken, während ich die Fliesen im Krankenhauskorridor wische. Wenn ich das Ende des langen Flurs erreicht habe, sind schon wieder viele Leute über den gewischten Teil getrampelt. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Die Priester sagen das, um die Pferde nicht scheuzumachen. Es wäre korrekter zu sagen Asche von Asche, Staub von Staub.
Es wäre sogar noch korrekter, überhaupt nichts zu sagen und die Leute selbst entscheiden zu lassen.
Die Leute schleppen den Dreck an ihren Schuhen ins Krankenhaus. Sie bringen Staub rein, Hundescheiße, Bakterien, Speichel, sauren Regen, Kohlenmonoxid und dreckige Kaugummireste. Aber sie dürfen nicht auf dem überfüllten Parkplatz rauchen.
Ich erkundige mich, ob ich während der Putzerei einen Mundschutz tragen darf, damit ich nicht die eingeschleppten Krankheitserreger der Besucher einatmen muss. Aber weil ich nur eine Aushilfskraft bin, wird diese Anfrage als witzig gemeinte Anmaßung abgetan. Nur Chirurgen dürfen Masken tragen, mit der offiziellen Begründung, es würde die Patienten schützen, tatsächlich aber fürchten sich die Chirurgen vor den unsichtbaren Gefahren, die einem frisch aufgeschlitzten oder erkrankten menschlichen Körper entweichen.
Ein Mann steht mitten im Korridor, und ich muss um ihn herumwischen. Seine Schultern hängen herab. Er wirkt so schlaff, dass man den Eindruck hat, alle seine Bänder seien ein klein wenig überdehnt worden.
»Entschuldigung«, sage ich. »Wären Sie so nett und treten ein Stück zur Seite?«
Er dreht sich um und schaut mich an. Mit weit aufgerissenen, sehr trockenen Augen. Dann sagt er mit heiserer Stimme: »Meine Tochter ist gerade gestorben.«
»Das tut mir leid«, sage ich. Das könnte jetzt heuchlerisch rüberkommen, aber ich finde ihn ziemlich anmaßend. Ich frage mich, warum die Leute immer glauben, ihr Schmerz sei für andere von Belang. Ich frage mich, warum die Leute heutzutage ständig ihren Schmerz mit anderen teilen wollen. Wenn dieser Typ mitten auf dem Teppich stehen und eine Tüte Süßigkeiten verzehren würde, käme er nie auf die Idee, dem Mann mit dem Staubsauger eins von seinen Karamellbonbons anzubieten.
»Sie war acht Jahre alt«, sagt er.
»Sie müssen sie sich als ein Mosaik vorstellen«, sage ich. »Stellen Sie sich vor, ihre Tochter wäre ein unglaublich komplexes Mosaik, das so schön geworden ist, wie es nur möglich war. Und nun stellen Sie sich vor, wie es beiseitegefegt wird, damit ein neues wunderschönes Mosaik daraus geformt werden kann. Vielleicht hat es ja schon angefangen. Gehen Sie mal nach oben in die Entbindungsstation, vielleicht werden Sie ihr Lächeln dort wiederfinden, dieses besondere Funkeln in ihren Augen. Gehen Sie hin, während die Mutter noch darüber nachgrübelt, wie lange es wohl dauert, bis ihre mütterlichen Gefühle endlich erwachen, vielleicht haben Sie ja Glück. Aber vielleicht wurde sie diesmal auch als Junge geboren, Sie sollten da keine Scheuklappen tragen. Und darf ich Sie jetzt bitten, zur Seite zu treten? Ich habe nämlich schon eine offizielle Verwarnung bekommen.«
Er starrt mich an, ohne etwas zu verstehen. Dann füllen sich seine großen, ausgetrockneten Augen mit Tränen. Sie laufen über seine Pausbäckchen. Er erbebt, schluchzt auf, krampft sich zusammen und beginnt loszuheulen.
»Nichts existiert für immer«, sage ich. »Heutzutage hat sogar das schlimmste Leid ein Verfallsdatum.«
Aber er hört nicht zu.
Cassie ruft an und bittet mich, auf dem Heimweg eine DVD auszuleihen. Wir machen es uns auf dem Sofa gemütlich, trinken Wein, rauchen einen Joint und schauen uns den Film an.
»Weißt du, was richtig gruselig ist?«, fragt Cassie. »Dass ein Hai einem ganz persönlich was übelnimmt.«
»Abgesehen von einem Meteor auf Abwegen ist ein Hai bestimmt das Schlimmste, was einem passieren kann.«
»Wenn er einen richtigen Hass auf dich hat.«
»Aber das ist eine Schwäche von Der weiße Hai. Haie stammen aus einer Zeit, als es noch gar keinen Hass gab.«
Sie schaut mich fragend an.
»Hass ist eine Erfindung der Menschheit«, führe ich weiter aus, »die es erst seit ungefähr einer Million Jahren gibt. Haie gibt es schon seit vierhundert Millionen Jahren.
Cassie ist ziemlich stoned und total fasziniert. »Echt jetzt?«
»Ernsthaft. Und sie haben sich während dieser Zeit fast überhaupt nicht verändert.«
»Woher weiß man das?«
»Unterirdische Architektur.«
»Gibt’s da wirklich Gebäude?« Sie kichert. »Zum Beispiel ein Hai-Museum?«
»Ich meine die Ablagerungen.«
Ich erkläre ihr, dass die wahre Geschichte des Planeten in einer steinernen Galerie nachzuverfolgen ist. Angefangen bei den Knochenablagerungen bis hin zu den Säulenreihen des Parthenons, von der perfekten mathematischen Struktur der Pyramiden bis zur geometrischen Anlage in Cusco, von der Lava, die Pompeji eingeschlossen hat, bis zur Keilschrift am Fuß antiker Säulen. »Wenn du willst, dass man sich an dich erinnert, Cassie, dann musst du mit Stein arbeiten. Moses kam nicht vom Berg Sinai herunter und hatte die Zehn Gebote auf Papyrus unterm Arm.«
»Stimmt.«
»Denk an all die vergangenen Zivilisationen. Ihre Existenz wird durch Steine dokumentiert, durch Trümmer und erhaltene Gebäude. Das Kolosseum. Die Sphinx. Newgrange. Die Akropolis. Angkor Wat. Macchu Picchu. Knossos. Stein auf Stein auf Stein.«
»Ist ja echt aufregend«, sagt Cassie und verdreht die Augen, als sie aufsteht. »Ich mach mir einen Entkoffeinierten. Willst du auch einen?«
»Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Haie lernen, wie man Brücken baut«, gebe ich zu bedenken. Aber der Kessel zischt schon, und sie kann mich nicht hören. Abgesehen davon hört sie nicht zu.