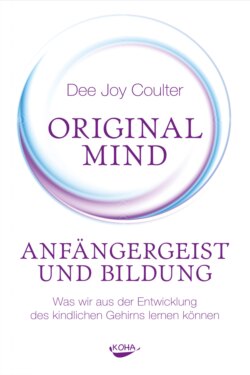Читать книгу Original Mind - Anfängergeist und Bildung - Dee Joy Coulter - Страница 9
Оглавление2. VOM SINNESEINDRUCK ZUR WAHRNEHMUNG UND ZURÜCK
Wir spüren unendlich viel mehr Dinge, als wir wahrnehmen …
Wir baden in einem Pool an Sinneseindrücken, aus dem unsere
Wahrnehmung das entnimmt, was genau jetzt hilfreich ist.
Serge Carfantan
Philosophie und Spiritualität
Wir haben jetzt die wichtige Unterscheidung getroffen zwischen Sinneseindrücken, die vor einer genauen Fokussierung auftreten, und Wahrnehmungen, die sich bilden, wenn wir dem Reiz unsere Aufmerksamkeit zugewandt und ihn benannt haben. Das Überwechseln vom Sinneseindruck zu Wahrnehmung geschieht ganz natürlich und erfolgt umso schneller, je vertrauter wir mit unserer Umgebung sind. Vielleicht erinnern Sie sich daran, wie Sie einmal nach einer längeren Abwesenheit zu Hause erst mal durch die Wohnung wanderten, als wollten Sie sich vergewissern, dass noch alles da ist. Dabei feuerte Ihr Gehirn blitzschnell Wahrnehmungen, um all die bekannten Dinge wieder zu inventarisieren.
Wenn wir uns jedoch die Sinneseindrücke vor ihrer Verwandlung in Wahrnehmungen genauer betrachten, können wir etwas erforschen, was uns sonst nicht bewusst ist – den Akt der Rückverwandlung von der Wahrnehmung zum Sinneseindruck. Wir können lernen, eine nur selten genutzte Schwelle unseres Bewusstseins zu überschreiten!
Diese Fähigkeit, Schwellen zu überschreiten, ist die Grundlage jeglicher Intuition! Wenn Sie es üben, werden Sie vielleicht unter anderem bemerken, wie sich Ihre Intuition deutlich verbessert. Es ist einer der im Vorwort erwähnten verborgenen Schätze unserer gemeinsamen Reise, etwas, was nicht gelehrt werden kann, doch wenn es in Ihnen aufsteigt, kann es ein wertvoller Bestandteil Ihrer natürlichen geistigen Brillanz werden. Dieses Kapitel enthält eine Fülle von Übungsmöglichkeiten, um unsere erstaunlichen intuitiven Fähigkeiten zu erkunden und zu entfalten.
DAS TERRAIN ZWISCHEN ZWEI MYSTERIEN
Die Frage steht weiterhin im Raum, wie das Gehirn Informationen zu einer kohärenten Wahrnehmungserfahrung »verbindet«.
David Whitney
Center for Mind and Brain, University of California, Davis
In vielen Bereichen der Wissenschaft sind die polaren Extreme rätselhaft. In den Randbereichen scheinen manche Regeln plötzlich nicht mehr zuzutreffen. Newtons 1687 veröffentlichte Ideen dienten den Physikern fast drei Jahrhunderte lang wunderbar, bis sie sich mit den extrem kleinen subatomaren Teilchen und den extrem großen Wechselwirkungen zwischen Himmelskörpern befassten. Aus der Beschäftigung mit dem Mikro-Universum ging die Quantenmechanik hervor, und Einsteins Relativitätstheorie widmete sich den Phänomenen des Makro-Universums.
Auch beim Bevölkerungswachstum bergen die Extreme Rätsel. Wenn eine Bevölkerung vom Ausstreben bedroht ist, werden oft sehr viel mehr Kinder geboren. Wenn jedoch Überbevölkerung die Lebensgrundlagen bedroht, geht die Geburtenrate oft stark zurück und die Fruchtbarkeit lässt auf geheimnisvolle Weise nach.
Auch im Feature-Binding stoßen wir in den Extremen auf ähnliche Phänomene. Auf der zellulären Ebene ringen die Neurowissenschaftler immer noch mit der Frage, wie das Gehirn Informationen über Farben, Bewegungen, Formen und Klänge zu einer Wahrnehmung verknüpft. Im großen Maßstab hingegen debattieren die kognitiven Theoretiker darum, welche Rolle diese Fähigkeit zur Verbindung bei der Bewusstseinsbildung spielt und ob es überhaupt Bewusstsein geben kann, bevor solch eine Verknüpfung von unzusammenhängenden Eindrücken stattgefunden hat. Doch genau wie die Wissenschaft trotz dieser Rätsel das Gebiet zwischen den Extremen der Physik oder dem Bevölkerungswachstum erforscht, können wir auch die vielen faszinierenden Aspekte des Feature-Binding erkunden, die zwischen diese beiden Rätsel fallen.
Wir haben damit ja bereits begonnen. Die Bewegungspfade und die Wellenmuster, die Menschen beschäftigen, die gerade sehen gelernt haben, sind unverknüpfte Eindrücke. Sobald eine Wahrnehmung auftaucht, sei es eine Blume oder das Gesicht der Mutter, haben sich diese Eindrücke verbunden. Unser Geist stellt diese Verbindungen praktisch unmittelbar her, doch wir wollen hier versuchen, diese Eindrücke zu erfahren, bevor sie sich verknüpfen.
Machen wir ein Experiment. Lauschen Sie auf die Geräusche, die Sie jetzt gerade umgeben, und beachten Sie dabei zwei oder drei einfache Klänge. Zum Beispiel höre ich jetzt gerade ein Klappern … von Tellern, ein Brummen … des Kühlschranks, ein Ping … von meinem Computer, um den Eingang einer Email anzuzeigen. Was ich auch gerade höre, wird von meinem Geist möglichst sofort mit der Geräuschquelle verbunden. Das ist Feature-Binding in Aktion. Es wird meistens schon allein davon ausgelöst, dass wir uns unserer Umgebung aufmerksam zuwenden.
Ein Kaninchen hält bei allen überraschenden Geräuschen kurz inne und rennt dann instinktiv weg, ohne sich darum zu kümmern, was das Geräusch verursacht haben könnte. Was machen Sie, wenn Sie überraschend ein unbekanntes Geräusch erschreckt? In jenem Moment, kurz bevor Sie denken »Was war das?«, erleben Sie einen reinen Klang.
Doch nicht jedes einfache Geräusch ist flüchtig oder überraschend. In der Musik des Nahen Ostens gibt es ein Element namens »Bordun« oder »Drone«, welches reinem Klang recht nahe kommt. Es bildet einen anhaltenden summenden Hintergrund, um den die Melodie herum tanzt. Es erdet gewissermaßen das Musikstück, ohne selbst Informationen zu übermitteln. Die Formen der Melodie werden vom Ohr bemerkt und beim zweiten Hören vielleicht wiedererkannt, doch mit dem darunter liegenden Summton beschäftigt sich das Ohr nicht so.
Etliche moderne westliche Komponisten suchten nach solchen unverbundenen oder unvorhersehbaren Klängen. Der berühmte Pianist Keith Jarrett meditiert vor seinen Auftritten, um sich von allen musikalischen Mustern in seinem Geist zu lösen und frei von allen Erwartungen mit dem Ton anzufangen, der sich bildet, wenn er seine Hand auf die Tasten legt.
Dem Un-Komponisten John Cage ging es vor allem um das, was er Unbestimmtheit, nannte, die Vereinzelung von Tönen, Tongruppen und Stille-Intervallen. Oft verwendete er auch mechanische Klänge oder Umweltgeräusche. Er bat die Zuhörer häufig, sich vom fokussierten Zuhören zu lösen und ihre Ohren den reinen Klängen zu öffnen. Doch selbst sein erfahrenes Publikum war nicht auf das extreme Experiment vorbereitet, welches John Cage 1952 bei einem New Yorker Konzert durchführte. An jenem Abend stellte er ein neues Stück vor, welches er 4‘33“ nannte (4 Minuten, 33 Sekunden), das aus drei zeitlich genau definierten Bewegungen bestand. Der Pianist betrat die Bühne, setzte sich an das Klavier, stellte seine Stoppuhr und seine Noten auf und öffnete den Klavierdeckel für die erste Bewegung. Er begann, die Seiten umzublättern, aber er spielte nicht. Dann schloss er das Klavier wieder und öffnete es für die nächste Bewegung, blätterte ein paar weitere Seiten um, schloss es und öffnete es ein letztes Mal für die dritte Bewegung.
Leider ging diese Chance, ohne Fokus zu lauschen, an den meisten Zuhörern ungenutzt vorüber. John Cage erzählt von dieser Premiere: »Sie haben es nicht kapiert. … Was sie für Stille hielten, weil sie nicht zu lauschen wussten, war voll zufälliger Geräusche. Während der ersten Bewegung konnte man den Wind draußen rauschen hören. Während der zweiten Bewegung begannen Regentropfen auf das Dach zu trommeln. Und während der dritten Bewegung machten die Zuhörer alle möglichen interessanten Geräusche, als sie anfingen, miteinander zu reden, oder aufstanden und gingen.«
Sie können jederzeit üben, ohne Fokus zu lauschen. Der Trick besteht darin, die Geräusche zu sich kommen zu lassen, statt ihnen entgegenzugehen. Spazieren Sie durch die Natur und lassen Sie die zufälligen Geräusche an Ihr Ohr dringen. Sie können das natürlich genauso entspannt mit städtischen Geräuschen machen. Erfahrene Lehrer nutzen diese Fähigkeit in der Pausenaufsicht. Sie lassen die gewöhnlichen Geräusche zu einem Hintergrundbrummen verblassen. Wenn es irgendwo ein Problem gibt, wird es sich deutlich von diesem Hintergrundklang abheben und sie können sich dem schnell zuwenden.
Bevor wir die anderen Sinne erkunden, möchte ich Ihnen noch davon erzählen, wie Säuglinge Klänge wahrnehmen. Es gibt zwei Geräusche, auf die sie besonders mit Beruhigung und Aufmerksamkeit reagieren. Die Wissenschaftler haben dazu bei Neugeborenen den sogenannten vagalen Tonus gemessen, einen Parameter des Immunsystems. Je höher dieser Index ist, desto größer sind die Überlebenschancen des Kindes. Bei gefährdeten Neugeborenen auf der Intensiv-Station stieg dieser Vagustonus jedes Mal deutlich an, wenn das Kind die Stimme der Mutter hörte. Dieser Effekt konnte von keinem anderen Geräusch hervorgerufen werden.
Neben der Stimme der Mutter gibt es noch ein zweites Geräusch, welches im Mutterleib besonders deutlich ist – den Herzschlag der Mutter. Um die Kinder zu beruhigen läuft deshalb in vielen Säuglingsstationen Musik, der der Herzschlag eines entspannten Erwachsenen unterlegt ist. Und wenn die Mutter während der Schwangerschaft oft eine bestimmte Serie geschaut und sich dabei entspannt hat, beruhigten sich die Babys innerhalb von dreißig Sekunden, nachdem sie die entsprechende Titelmusik gehört hatten. Diese Ergebnisse legen die Vermutung nahe, dass die erste Aufgabe des Ohres darin besteht, die Verbindung zur Mutter zu stärken, indem es Geräusche verzeichnet, die mit der Mutter zusammenhängen. So beginnen die ersten Erfahrungen der Verbindung von Sinneseindrücken zu Wahrnehmungen.
SICHTWEISEN
Der das Denken steuernde Wille muss aufhören,
vom Subjekt zum Objekt zu fließen,
und anfangen, vom Objekt zum Subjekt zu fließen. …
Diese Läuterung der subjektiven Erfahrung erfolgt
durch die Praxis des Staunens, der Verehrung, der Einheit
und der vollständigen Hingabe.
John Gardner
Right Action, Right Thinking
Das Auge sieht über zwei grundlegende Mechanismen. Der erste ist das Fokussieren, welches in der Mitte des Auges erfolgt und dazu dient, Dinge genau in den Blick zu nehmen und jede Einzelheit zu erkennen. In der Natur sind es vor allem die Raubtiere, die sich dieser Art des Sehens bedienen, um ihre Beute zu erkennen, aufzuspüren, Entfernungen abzuschätzen und zuzuschlagen. Der zweite Mechanismus, die periphere Sicht, wird vor allem von Beutetieren verwendet, die damit Bewegungen ihres Umfeldes viel schneller erfassen können als mit dem fokussierten Sehen. Raubtiere haben deshalb nach vorne gerichtete Augen, die zusammen einzelne Dinge genau erkennen können, während Beutetiere wie Kaninchen und Pferde seitlich ausgerichtete Augen haben. Bei Kaninchen sitzen die Augen so weit auseinander, dass sie kein gemeinsames Blickfeld mehr haben, weshalb sie alles, was unmittelbar vor ihnen liegt, kaum sehen können. Pferde können Dinge fokussieren, zu denen sie einen gewissen Abstand haben, doch nichts, was näher als etwa einen Meter ist. Ausgebildete Springpferde vertrauen vollkommen darauf, dass ihnen der Reiter signalisiert, wann sie zum Sprung ansetzen müssen, weil sie das Hindernis aus der Nähe nicht mehr erkennen können.
Wir Menschen können beide Mechanismen nutzen. Unser peripheres Sehen nutzt die Randbereiche unserer Augen. Es reagiert viel schneller und bemerkt die kleinsten Bewegungen. Deshalb legen Vogelbeobachter den Kopf schief, patrouillieren Soldaten die feindlichen Linien seitlich und überwachen gute Lehrer die Klasse mit den »Augen am Hinterkopf«. Auch Mannschaftssportler verlassen sich vor allem beim Hochleistungssport auf diese Fähigkeit, um Veränderungen in den Bewegungsmustern der eigenen Mannschaft und des Gegners sofort aufzunehmen. Da solche Bewegungen rasch, unerwartet und ohne Einbettung in andere Eindrücke erfolgen, können wir sie als reine visuelle Informationen oder unverbundene Sinneseindrücke bezeichnen. So gut unser peripheres Sehen im Wahrnehmen der feinsten Bewegungsimpulse ist, so schwach ist es im Erkennen von Farben und Details. Dafür müssen wir uns der Bewegung zuwenden und zum fokussierten Sehen mit dem zentralen Augenbereich übergehen.
Unser hoch analytisches visuelles System macht es uns nicht leicht, reine visuelle Eindrücke zu gewinnen. Am besten geht es mit Licht und Farbe. Sowohl Menschen, die zum ersten Mal sehen, als auch Neugeborene scheinen vom Licht stark beeindruckt zu sein. Vielleicht sehnen wir uns nach dieser reinen, glanzvollen Erfahrung, wenn wir ein Feuerwerk bestaunen, nach Sternschnuppen suchen oder uns das Aufleuchten eines Weihnachtsbaums berührt. Solche Lichteffekte ermöglichen uns Erfahrungen reiner visueller Eindrücke. Um Ähnliches mit Farbe zu erleben, bedurfte es jedoch einiger herausragender Künstler.
Während im 20. Jahrhundert einige Komponisten nach der reinen Erfahrung des Klangs suchten, gab es auch bildende Künstler, die ihre Liebe zur Farbe als reine Erfahrung zu vermitteln strebten. Der französische Maler Yves Klein war besonders von einem bestimmten Blauton fasziniert. Er arbeitete sogar mit einem Chemiker zusammen, um ein Bindemittel zu entwickeln, welches dem Pigment all seine strahlende Brillanz ließ. Klein bemalte fast zweihundert Leinwände mit nichts als dieser Farbe, die er International Klein Blau nannte. Manche dieser Leinwände waren einfach von dem Blauton bedeckt und luden den Betrachter ein, das Bild weniger anzuschauen, als sich mehr dem reinen Eindruck der Farbe hinzugeben, der von dem Bild ausging.
Ähnlich wie es John Cage in der Musik anstrebte, suchte der amerikanische Autor, Kriegsgegner und Künstler Ad Reinhardt nach einem Weg, die bildende Kunst von allen Formen und Informationen zu befreien. In seiner Erregung über das oppositionelle Denken während des Vietnamkriegs versuchte er, diese Polarisierung mit seinen Texten und seiner Kunst aufzuheben. Es ging ihm darum, »ein unmanipuliertes, nicht manipulierbares, nutzloses, nicht vermarktbares, nicht reduzierbares, nicht fotografierbares, nicht vervielfältigbares, unerklärliches Bild« zu schaffen. Die letzten dreizehn Jahre seines Künstlerlebens malte er auf große Leinwände mit höchster Sorgfalt kaum erkennbare Schwarz-in-Schwarz-Quadrate. Auf einer Ausstellung über sein Lebenswerk war kürzlich als zentrales Exponat eines seiner großformatigen Werke zu sehen, welches seit über fünfzig Jahren sorgfältig erhalten wird. Es zieht die Betrachter immer noch machtvoll in seinen Bann. Sie standen lange bewegungslos davor, ließen die analytische Wahrnehmung los und nahmen einfach die Schwärze auf, die von dem Bild ausging.
Diese visuellen Ereignisse haben auch eine starke Beziehung zu dem reinen Eindruck von Wellen. Man könnte sicher das Licht selbst schon als Wellenerfahrung bezeichnen, doch das ist nur der Anfang. Mit etwas Übung können auch Sie mehr in den Genuss der Welt der Wellen kommen. Das Geheimnis besteht auch hier darin, die Eindrücke auf Sie zukommen zu lassen, statt nach ihnen zu suchen. Spüren Sie der aufbrandenden Empfindung nach, wenn Sie ein Pferd plötzlich losgaloppieren sehen. Spüren Sie den Strom des vorbeirauschenden Verkehrs, die mäandernden Bewegungen der Einkaufswagen im Supermarkt, das Herabströmen des Regens. Lassen Sie Ihren Blick weich werden und entdecken Sie die Bewegungspfade, die sich in der Welt um Sie herum abspielen.
NASEWEIS: DAS ERSTAUNLICHE RIECHSYSTEM
Unsere Nase steht mit einem speziellen neurologischen Organ in Verbindung, dem sogenannten olfaktorischen System, welches in unserem Großhirn sitzt. Es besteht aus einer sehr unabhängig agierenden kolbenförmigen Region mit etlichen Verzweigungen, die vom Rest des Gehirns nur wenig beeinflusst wird. Würde man Gehirn-Regionen einen Status zuordnen, säße dieser sogenannte Riechkolben mit seinen Verzweigungen in einer höchst elitären Gegend. Zu seinen Nachbarn gehören der Hippocampus, der Hauptsitz unseres Gedächtnisses; der frontale Cortex, in dem all unser höheres Denken stattfindet; und die Amygdala, unsere emotionale Wächterin, die traumatische Erinnerungen abspeichert und ständig nach Gefahren Ausschau hält.
Die volkstümliche Überlieferung weiß seit jeher um die Fähigkeit der Nase, die Wahrheit zu erkennen und sich einen unabhängigen, unbeeinflussten Eindruck zu verschaffen. Das amerikanische Wort sage für einen Weisen stammt von dem lateinischen Wort sagax, was eine Person bezeichnet, die einen besonders feinen Geruchssinn hat. Dieses Gespür der Nase für Wahrheit kommt auch zum Ausdruck, wenn wir von einem Journalisten sagen, »er hat eine gute Nase für Sensationen« oder in Redewendungen wie »das riecht nach einer Falle« oder »die können sich nicht riechen«.
Bei Verhören achten Kriminalbeamte darauf, ob der Verdächtige die Nase berührt. Beim Lügen gerät der Körper unter Stress, was die Blutgefäße in der Nase anschwellen lässt. Durch Reiben oder an der Nase Ziehen schwellen sie wieder ab. Die Nase spielt auch für die Wiedererkennung eines Gesichts eine große Rolle. Durch Nasenoperationen kann sich der Anblick eines Menschen bis zur Unkenntlichkeit verändern. Eine rote Kugel auf der Nase galt ursprünglich als beschämend, doch inzwischen wird ein Darsteller damit zum Clown.
Wenn wir durch die Nase einatmen, strömt die Luft zu einer Höhlung in der Nähe des Riechkolbens und kühlt dabei den frontalen Cortes. Auf ihrem Weg vom Herzen zum frontalen Cortex verläuft ein Zweig der Halsschlagader durch diese Höhlung. Wenn das Blut hier nur um zwei Zehntel Grad abgekühlt wird, können wir schon einen »kühlen Kopf« bewahren. Sonst werden wir leicht »hitzköpfig« und handeln, ohne vorher nachzudenken. Vielleicht erinnern Sie sich an Zeitungs-Fotos von Randalierern: Sie atmen häufig durch den Mund und haben das Gesicht zur Grimasse verzogen. Beides fördert die Hitzköpfigkeit.
Der Kühlungseffekt der Nasenhöhle beruht auf zwei Verhaltensweisen: der Einatmung kühler Luft durch die Nase, weshalb die Nasenatmung sehr wichtig ist, und dem Vorbeiströmen des kühleren Bluts auf dem Weg vom Kopf zum Herzen. Wenn das Gesicht eine Grimasse bildet, fließt das Blut direkt vom Gehirn zum Herzen, ohne den Umweg über die Nasenhöhle zu machen. Wenn ein Mensch hingegen lächelt, leiten die Gesichtsmuskeln das Blut durch ein Netzwerk von Adern zur Nasenhöhle hin. Der vietnamesische Mönch und Nobelpreis-Kandidat Thich Nhat Hanh rät deshalb allen: »Strebe nach Frieden. Lächele, atme und gehe langsam.« Das ist nicht nur ein weiser philosophischer Rat, sondern auch neurologisch sinnvoll. Sie können diesen Rat prüfen, indem sie ausprobieren, welche Wirkung es auf ihren Geisteszustand hat, ob Sie durch die Nase oder den Mund atmen und ob Sie lächeln oder eine Grimasse schneiden.
Die Nasenhöhle hinter dem Nasenrücken ist der einzige ungeschützte Zugang zum Gehirn. Dass dieser in einen so wichtigen Bereich des Gehirns führt, macht Medizinern gleichzeitig Sorgen und Hoffnung. Sie sorgen sich, weil auf diesem Weg Umweltgifte wie Abgase, Pestizide oder Schimmelgifte direkt ins Gehirn gelangen und dort ernsthaften neurologischen Schaden anrichten können. Alzheimer-Plaque bildet sich als Erstes in dem Bereich um den Riechkolben, und auch Parkinson entwickelt sich hier. Deshalb gehört der Verlust des Geruchssinns zu den ersten Anzeichen dieser Krankheiten. Bislang versuchten die Mediziner, diese Regionen des Gehirns über den Blutstrom mit Medikamenten zu erreichen, doch sie scheiterten an der Blut-Hirn-Schranke, die keine Fremdsubstanzen ins Gehirn dringen lässt. Jetzt forscht man an Inhalationsmitteln und hofft, diese Krankheiten über die Nase direkter behandeln zu können.
Und eine weitere spannende Entdeckung verweist auf die besondere Stellung des Geruchssinns. Gehirnzellen können sich zwar in einem gewissen Umfang regenerieren, doch sie erneuern sich und ihre Verbindungen zu anderen Zellen nur selten vollständig. Man hat diesen Prozess der Zellerneuerung, die sogenannte Neurogenese nur in zwei Bereichen des Gehirns nachweisen können: dem Hippocampus (dem Hauptsitz des Gedächtnisses) und dem olfaktorischen System.
Jüngere Untersuchungen zeigen, dass etwa zehn Prozent der Hippocampus-Zellen sich regelmäßig erneuern. Doch im olfaktorischen System werden alle sechs Monate hundert Prozent aller Zellen durch identische neue Zellen ersetzt. Die Wissenschaftler wissen nicht, warum das so ist, doch wenn dieser Prozess behindert wird, siecht der Riechkolben schnell dahin. Diese Fähigkeit zur Regeneration bildet die Grundlage einer Forschung an Ratten, bei der die Zellhülle der olfaktorischen Nervenzellen verwendet wird, um zertrennte Rückenmarksnerven wieder miteinander zu verbinden. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass die Zellen sich reparieren und die Ratten danach wieder laufen können. Die Wissenschaftler hoffen, damit einen Weg zu finden, auch menschliche Rückenmarksverletzungen zu heilen. Während das olfaktorische System vor zwanzig Jahren noch als wissenschaftlich uninteressant galt, erscheint es heute als neurologische Goldgrube.
Im nächsten Abschnitt werden wir uns den Gerüchen selbst zuwenden, wie wir sie aufnehmen und wie wir unverbundene Geruchsempfindungen entdecken können.
VON DÜFTEN ZU PHEROMONEN
Die Neigung der Nase, Gerüche zu identifizieren und mit einem Namen oder einer Assoziation zu versehen, ist so stark, dass die Suche nach einem nicht derartig belegten bewussten Geruch aussichtslos erscheint. Da der Riechkolben unmittelbar neben dem Hauptsitz des Gedächtnisses sitzt, lösen Gerüche sehr leicht Erinnerungen aus. So kann Aromatherapie Menschen mit Alzheimer helfen, ihre schwindenden Erinnerungen wieder zu fassen. Ein einziger Geruch kann eine ganze Flut von Erinnerungen auslösen, wie bei dem Autor Marcel Proust, den ein einziger Duft aus der Kindheit zu seinen Memoiren Auf der Suche nach der verlorenen Zeit inspirierte.
Es scheint jedoch unterschiedliche Kategorien von Gerüchen zu geben. Das primäre olfaktorische System nimmt Umweltgerüche wie Parfüm, Blumendüfte, Abgase oder Essensgerüche auf und leitet sie an den Riechkolben weiter, um sie vom frontalen Cortex identifizieren und im Hippocampus Erinnerungen bilden zu lassen.
Manche Anthropologen halten jedoch zwei Gruppen von Gerüchen für noch ursprünglicher. Der Geruch von Rauch und der Geruch von verdorbener Nahrung spielen für das Überleben eine äußerst zentrale Rolle. Manche Wissenschaftler meinen sogar, die Nase sei ursprünglich genau dafür entwickelt worden. Durch die moderne technologische Entwicklung brauchen wir diese Fähigkeiten jedoch kaum noch. Wir haben Rauchmelder, die auf uns aufpassen, und die Supermärkte versorgen uns ständig mit frischen Lebensmitteln. Viele Menschen sind daher nur noch eingeschränkt fähig, Gerüche zu identifizieren.
Da viele Krankheiten von bestimmten Körpergerüchen gekennzeichnet sind, gehörte es früher auch zur westlichen medizinischen Ausbildung, den Geruchssinn zur Diagnose zu verwenden. Diabetes, Darmbeschwerden, Leberprobleme, Nierenversagen und Lungenkrebs bilden Duftmarker, die im Atem »riechbar« werden. In der östlichen Medizin ist die Lehre von Gerüchen als diagnostischem Instrument immer noch Teil der Ausbildung, doch im Westen ist es aus den Lehrplänen verschwunden, und immer weniger Studenten haben den feine Geruchssinn, der dafür notwendig ist. Die Diagnostik verlässt sich heute viel mehr auf visuelle Beobachtungen, Aussagen der Patienten und technische Messgeräte. Das neuerliche Interesse für den Geruchssinn hat dazu geführt, dass nun elektronische Riechgeräte und Hundenasen die Batterie der diagnostischen Mittel bereichern. Die frühesten elektronischen »Nasen« stammten aus der Parfüm-Industrie. Inzwischen sind die Geräte sehr viel einfacher, tragbarer und preiswerter geworden. Ein vielversprechender Ansatz identifiziert die Moleküle in der Atemluft mit Hilfe von Laserstrahlen. Therapiehunde wurden ausgebildet, um anzuzeigen, wann die Veränderungen im Atem ihrer menschlichen Gefährten auf einen bevorstehenden epileptischen Anfall oder auf niedrigen oder hohen Blutzucker schließen ließen. Manche Hunde haben sogar gelernt, im menschlichen Atem mit bemerkenswerter 99-prozentiger Sicherheit Krebs zu erkennen.
Die menschliche Nase ist zu solchen Dingen von Natur aus nicht fähig, denn sie kann jeden Geruch nur ein paar Minuten lang wahrnehmen. Weil sich die Nase nicht verschließen kann, schützt sie sich damit vor olfaktorischer Überwältigung. Um einen Geruch anhaltend wahrzunehmen, müssen wir alle paar Minuten bewusst schnuppern. Vielleicht kennen Sie das: Auf dem Weg zur Haustür weist Ihre Nase Sie darauf hin, dass der Müll hinausgetragen werden müsste. Wenn Sie sich dann entscheiden, zuvor noch einen Blick in die Post zu werfen, verblasst die Wahrnehmung des Geruchs und die Chance ist groß, dass Sie den Müll wieder komplett vergessen.
Hunde erleben Gerüche ganz anders. Sie haben eine spezielle Art zu atmen, um ihre Umgebung ständig auf Gerüche abzutasten. Beim Einatmen beben ihre Nasenflügel, um die Luft zu verwirbeln, und beim Ausatmen flattern die seitlichen Schlitze der Nasenlöcher, um eine leichte Luftströmung zu erzeugen, die den Geruch beim nächsten Atemzug frischer erscheinen lässt.
Die Nasen von Hunden und den meisten anderen Tieren verfügen über zwei Geruchssysteme. Das eine ähnelt unserem primären Geruchssinn: Es registriert alle starken Gerüche der Umgebung. Der zweite Mechanismus dient dem Umgang mit sehr schwachen Düften, den sogenannten Pheromonen. Dazu gehören alle Körpergerüche, vom Atem über Urin, Stuhl, vaginale Gerüche, Erbrochenes und Blut bis zu schwärendem Fleisch, aber auch Gerüche von emotionalen Zuständen wie Angst oder Aggression, und die bereits erwähnten vielen Gerüche der gesundheitlichen Problemen und Krankheiten. Starke Pheromone werden von dem primären Geruchssystem verarbeitet, den schwachen widmet sich jedoch ein einfacheres System namens vomeronasales Organ oder VNO. Dieses winzige Organ sitzt bei Säugetieren tief in der Nase und bei Reptilien im Gaumen. Es steht mit dem Riechkolben in Verbindung, verfügt jedoch über eigene neuronale Bahnen und dient einzig und allein dem Aufspüren von Pheromonen. Solche Pheromone kommen einem nicht eingebundenen Geruchseindruck vielleicht am nächsten. Und wie sieht es damit beim Menschen aus?
Weil das vomeronasale Organ so klein und gut versteckt ist, hat man es beim Menschen erst kürzlich entdeckt. In der Hoffnung, neue Stoffe für die Parfümindustrie zu finden, versuchen die Wissenschaftler daraufhin, einzelne Pheromone herauszufiltern, doch die Ergebnisse waren enttäuschend. Erwachsene scheinen Pheromone nicht deutlich wahrnehmen zu können. Säuglinge reagieren da viel intensiver, insbesondere auf den Geruch ihres eigenen Fruchtwassers und der Milch ihrer Mutter. Der Fruchtwassergeruch wirkt sofort beruhigend, während sie beim Geruch der Muttermilch frustriert anfangen zu schreien, wenn sie nicht gleich die Quelle finden können. Die Gerüche der Mutter scheinen für die frühkindliche Bindung von großer Bedeutung zu sein. Auch diese möchte ich als reine Sinneseindrücke bezeichnen.
Das ist alles, was die Wissenschaft über die menschliche Reaktion auf Pheromone weiß. Ich möchte Sie ermuntern, eigene Forschungen anzustellen. Können Menschen Angst riechen? Welche Rolle spielen solche »animalischen Kräfte« bei der Partnerwahl? Führen manche emotionale Ereignisse zu schlechtem Atem?
GESCHMACK, BERÜHRUNG UND BEWEGUNG
Wie Kirschen und Beeren behagen,
muss man Kinder und Sperlinge fragen.
Johann Wolfgang von Goethe
Unser Geschmack beruht zum großen Teil aufvergangenen Erfahrungen und den Assoziationen, die damit einhergingen. War die erste Begegnung angenehm, und war es ein gutes Beispiel für diesen Geschmack? Auch bei Geschmäckern scheint es also ziemlich schwierig zu sein, einen Sinneseindruck zu erleben, der nicht verknüpft ist. Vom Genuss vertrauter Speisen über das Ausprobieren neuer Gerichte bis zum Prüfen, ob etwas noch genießbar ist oder vielleicht den bitteren Geschmack von Giftigem hat – wir verbinden alles mit Geruch oder mit Erinnerungen an bereits Erlebtes. Über die Geschmackserfahrung eines Neugeborenen können wir jedoch ein wenig über reine, unverknüpfte Geschmäcker lernen. Selbst unmittelbar nach der Geburt reagieren Säuglinge auf drei verschiedene Geschmäcker, und manche Studien lassen vermuten, dass sie das vielleicht sogar schon im Mutterleib tun. Wenn ihnen ein sauer schmeckender Tupfer mit milder Essigsäure angeboten wird, spitzen sie die Lippen, rümpfen die Nase und blinzeln stark mit den Augen. Wenn ihnen ein Tupfer mit Zuckerwasser angeboten wird, lecken sie sich die Lippen, fangen an zu saugen und zeigen Anzeichen von Zufriedenheit. Und wenn es eine ziemlich bitter schmeckende milde Chininlösung ist, strecken sie die Zunge heraus, versuchen zu würgen und zu spucken und kneifen die Augen zusammen.
Manche Wissenschaftler vermuten, diese impulsive Ablehnung des Bitteren diene den Neugeborenen als Schutz vor Giften, da Gifte häufig bitter sind. Auch Kinder mögen in der Regel nichts Bitteres, erst als Erwachsene entwickeln wir uns darüber hinaus und genießen Dinge wie Kaffee, bittere Schokolade oder grüne Salate. Doch selbst kleine Dosen bitterer Nahrungsmittel können heranwachsenden Föten schaden, weshalb viele Schwangere eine natürliche Abneigung gegen alles Bittere entwickeln.
Wenn wir wissen, wie sich bestimmte Geschmäcker auf dem Gesicht eines Babys widerspiegeln, sagt das jedoch noch wenig über ihre tatsächliche Geschmackserfahrung aus. Ich habe vielleicht einen Hinweis auf eine Antwort entdeckt. Während der 1970er-Jahre nahm ich an einer Gruppentherapie teil, in der es unter anderem um sogenanntes »Reparenting« ging, einen Therapieprozess, der dazu dient, den Teilnehmern in einem kindlichen Zustand gesunde elterliche Botschaften zu übermitteln. Die Gruppe traf sich jede Woche, um zunächst eine Stunde lang unter der Obhut der beiden Therapeuten zu spielen und dann in der zweiten Stunde das Erlebte zu besprechen. Die Teilnehmer begaben sich während der ersten Stunde in eine Art halbhypnotischen Wachzustand, in dem sie sich wie Kinder fühlten und verhielten, mit Spielzeug spielten und den Therapeuten kindliche Fragen stellten. Zu Beginn der Spielstunde fragten die Therapeuten jeweils, wer denn vielleicht ein Fläschchen haben wolle, und bereiteten dann warme Milchflaschen vor. Und tatsächlich fing die entsprechende Person dann im Laufe der Stunde häufig an, zu weinen und wie ein Kind nach der Flasche zu verlangen. Ich war mir sicher, dass mir das nie passieren würde. Ich verabscheue den Geschmack warmer Milch und konnte mir nicht vorstellen, bei diesem Geschmack im regredierten Zustand eines kleinen Kindes bleiben zu können. Doch nach sechs Monate wagte ich einen Versuch, und es hatte großen Einfluss auf mein Verständnis von frühkindlicher Erfahrung.
Ich kam bewusst hungrig zu der Veranstaltung. Dann rollte ich mich in einer Ecke zusammen und ließ mich in eine ganz frühe Zeit zurücktreiben. Plötzlich spürte ich, wie mein ganzer Körper aus meinem Bauch heraus von einem Schmerz erfasst wurde. Als Nächstes drang ein durchdringendes Schreien an mein Ohr. Ein kurzer Blick aus der Erwachsenen-Perspektive zeigte mir, dass das tatsächlich meine Stimme war! Ich ließ mich wieder in den kindlichen Zustand zurückfallen. Jemand kam, hielt mich und gab mir die Flasche. Ein erneuter kurzer Blick aus der Erwachsenen-Perspektive ließ mich erkennen, dass ich keinen besonderen Geschmack im Mund wahrnahm, dann überließ ich mich wieder dem Genuss der Wärme, die sich in mir ausbreitete und sich besonders in meinen Händen und Füßen zu sammeln schien. Die Zehen- und Fingerbewegungen der Babys, die gestillt werden, scheinen offenbar Teil der noch im ganzen Körper und nicht nur im Mund verankerten Geschmacks-Erfahrung zu sein. Es lässt sich vielleicht am ehesten mit dem sich ausbreitenden Wärmegefühl vergleichen, welches sich nach einem langen Aufenthalt in der Kälte mit einer Tasse heißem Tee oder Kakao einstellt.
Der letzte unserer fünf Sinne, der Tastsinn, ist wieder leichter als reiner Sinneseindruck zu erfahren. Wenn wir über samtenen Stoff streichen, die Temperatur des Wassers aus dem Hahn prüfen, eine schwere Tasche probeweise hochheben oder einem kranken Kind die Hand auf die Stirn legen, verwenden wir unseren Tastsinn, um Informationen zu erlangen. Doch wenn wir unsere Suche auf Ganzkörper-Erfahrungen ausdehnen, können wir eine Fülle von unverknüpften Körpereindrücken entdecken. Die ganze Spielplatzgeräte- und Vergnügungspark-Industrie lebt von unserer Freude an solchen unverbundenen Empfindungen. Springen, Drehen, Fallen, Schaukeln und Wiegen sind alle für sich allein erfahrbar. Sie brauchen keinen Kontext, und selbst kleinste Kinder lieben diese Bewegungen.
Manchmal entstehen solche Bewegungen ganz unvermittelt. Wenn ein Vogelschwarm aufsteigt, ein Fischschwarm losschießt, oder ein Hornissenschwarm entsteht, geschieht dies aus einem sogenannten Aktionsimpuls heraus. Im menschlichen Verhalten zeigt sich dieser Aktionsimpuls vielleicht in randalierenden Menschenmengen, in Begeisterungsstürmen eines Publikums oder in heroischen Akten. Lebensretter, die ins Wasser gesprungen, in ein brennendes Haus gerannt oder mit übermenschlichen Kräften ein Auto von einem Verletzten hoben, können hinterher oft nicht erklären, warum sie sich so verhielten, und können sich nicht erinnern, darüber nachgedacht zu haben.
Eine weitere wichtige, wenn auch unangenehme Funktion des Tastsinns ist, Schmerz wahrzunehmen. Die meisten Schmerzempfindungen werden auf irgendeine Weise zugeordnet und analysiert und fallen damit in die Kategorie der verknüpften Sinneseindrücke. Doch wie ist es mit Wohlbefinden? Kann es vielleicht zu einer Art Hintergrundqualität werden, die mitschwingt, ohne dass wir es bemerken? Wenn wir nach einer schmerzhaften Krankheit wieder unsere Gesundheit schätzen, ist das eindeutig eine verknüpfte Erfahrung, die unser Gehirn bewusst und zufrieden abspeichert. Doch wenn wir unsere Gesundheit als selbstverständlich nehmen, rückt die Abwesenheit von Schmerz in den Hintergrund. Auch hier empfinden wir die reinen Sinneseindrücke eines Babys nach: Wenn es schmerzfrei ist, ruht es, schläft es und widmet sich den jeweils auftretenden Sinnesreizen. Auch kleine Kinder halten körperliches Wohlgefühl so lange für selbstverständlich, bis es unterbrochen wird.
WEITERE GENÜSSLICHE SINNESEINDRÜCKE
So beginnt ein kleines Kind damit, die Welt als reine Sinneseindrücke zu erfahren und sich allmählich ein Inventar an verknüpften Informationen zuzulegen, und wir haben hier damit begonnen zu versuchen, uns wieder dem reinen Sinneseindruck anzunähern. Vermutlich haben Sie dabei bemerkt, wie ein unverknüpfter Sinneseindruck durch Benennen zu einem verknüpften wurde. Im nächsten Kapitel werden wir anfangen, uns diesen verknüpften Informationen als Wahrnehmungen zuzuwenden, und erforschen, wie Sprache dazu dient, diese Wahrnehmungen zu festigen. Je stärker wir in die Welt der Sprache hineinwachsen, desto unzugänglicher werden die unmittelbaren Sinneseindrücke.
Doch jeder unserer Sinne erlebt besondere Momente, in denen wir wortlos werden und uns wieder dem reinen Sinneseindruck hingeben. Die folgenden Beispiele können Sie vielleicht zu solchen Erfahrungen inspirieren.
In Bezug auf Geschmack versuchen gute Köche immer wieder, Geschmackserlebnisse zu kreieren, die den Gästen vor Genuss die Sprache verschlägt. Es gibt wunderbare Filmszenen dieses Moments, zum Beispiel in Tom Jones oder in Babettes Fest.
Die Natur kann uns auch über den Geruchssinn in diesen erweiterten Zustand versetzen. Der Duft eines blühenden Lavendelfelds oder der frische Geruch des Waldes nach einem Regenschauer können uns so tief berühren, dass wir in Schweigen verfallen.
Ähnliches geschieht manchmal angesichts überwältigender Schönheit, sei es wenn uns ein Kunstwerk gefangen nimmt oder wenn sich das ganze Panorama eines farbenprächtigen Sonnenuntergangs vor uns entfaltet.
Auch Musik kann Zuhörer und Ausführende in diese sprachlose Welt versetzen, ja sie tut es so oft, dass wir es beinahe erwarten. Solche Art der Musikerfahrung gehört zu den zutiefst erfüllenden Erlebnissen des Lebens.
Zu guter Letzt können der Tastsinn und das Spüren sowohl Liebende in ekstatische Zustände versetzen als auch einen Zugang zu subtilen Energiefeldern vermitteln. Die Energie einer Gedenkstätte oder eines spirituellen Ortes kann so ergreifend sein, dass wir spontan in ehrfürchtiges Schweigen verfallen.
Wir haben uns bislang darum bemüht, die Fähigkeit zu reinen, unverknüpften Sinneseindrücken zurückzugewinnen. Jetzt wird es darum gehen, daraus bewusst Wahrnehmungen zu bilden. Dazu bedarf einer gewissen fokussierten Aufmerksamkeit und Analyse, und es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Qualitäten zu verstärken. Es geht darum, den frontalen Cortex zu aktivieren. Sie werden mit diesem Bereich des Gehirns im Laufe unserer Reise noch sehr vertraut werden und ihn gut zu nutzen wissen. In den ersten Übungen dazu möchte ich Sie anregen, Ihre Aufmerksamkeit und Ihren Fokus mit Hilfe von fünf wirksamen sensorischen Auslösern spielerisch zu stärken.
Wenn Ihre Ohren Mühe haben zu hören, können Sie die Augenbrauen heben. Damit heben sich auch die Ohren ein wenig, wodurch sich das Trommelfell anspannt und die Aufmerksamkeit wacher wird. Tiere, die die Ohren spitzen, tun etwas ganz Ähnliches.
Wenn Sie merken, wie ihre Augen abschweifen oder Ihr Blickfeld verschwimmt, kann Blinzeln helfen, den Fokus zu aktivieren. Achten Sie mal darauf, was Sie tun, wenn Sie bei schlechter Sicht Auto fahren oder einen Text zu Ende lesen wollen, obwohl Sie sehr müde und Ihre Augen erschöpft sind. Wahrscheinlich werden Sie merken, wie Sie blinzeln.
Wenn Sie sich geistig erschöpft fühlen und Ihnen die Welt schal erscheint, probieren Sie mal, tief und schnüffelnd durch die Nase zu atmen. Das erfrischt nicht nur Ihren Geruchssinn, sondern auch Ihr Denkvermögen. Wenn Studenten, Manager oder alte Menschen Gehirnaerobic-Atemübungen machen, um ihren Geist auf Trab zu halten, bedienen Sie sich genau dieses Mechanismus.
Wenn Sie einen wachen Geist brauchen, können Sie auch mit der Zunge gegen den Gaumen schnalzen. Tierforscher haben festgestellt, dass viele Säugetiere solche Schnalzlaute verwenden, um die Aufmerksamkeit ihrer Jungen zu erregen.
Und wenn Sie mal um die richtigen Worte ringen, können Sie die Fingern Ihrer rechten Hand beklopfen oder mit Daumen und Mittelfinger der rechten Hand schnalzen. Der Bereich des Gehirns, der diese Finger bewegt, liegt im linken frontalen Cortex direkt neben dem wichtigsten Sprachzentrum und kann dieses anregen, die passenden Worte zu finden.
Im nächsten Abschnitt der Reise werden wir entdecken, dass viele Kinder und Naturvölker genau dazu fähig sind. Sie können die Welt der Formen wahrnehmen und dann ihren Fokus so verändern, dass sie nur die energetischen Aspekte hinter den Formen sehen. Sie können sich frei über die Schwelle zwischen Sinneseindruck und Wahrnehmung hin- und herbewegen. Auch der zu Anfang erwähnte Mönch schien das zu tun, als er die Blume jedes Mal neu sah, wenn er sich ihr zuwandte. Wenn Sie die beschriebenen Übungen praktizieren, können auch Sie Wege finden, diese Schwelle leichter zu überschreiten.