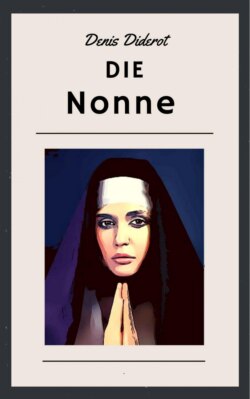Читать книгу Denis Diderot: Die Nonne - Denis Diderot - Страница 5
Kapitel 2
ОглавлениеVon diesem Augenblick an war ich in meine Zelle eingeschlossen; man gebot mir Schweigen, ich wurde von aller Welt getrennt, mir selbst überlassen, und ich sah klar, dass man entschlossen war, ohne meine Einwilligung über mich zu verfügen. Ich wollte mich zu nichts verpflichten; das war mein fester Wille, und alle wahren und falschen Schrecken, in die man mich unaufhörlich stürzte, erschütterten mich nicht. Ich bekam niemand mehr zu sehen, weder die Oberin, noch die Novizenmutter, noch meine Gefährtinnen. Deshalb ließ ich die Erstere benachrichtigen und tat, als beuge ich mich dem Willen meiner Eltern; doch mein Plan war, dieser Verfolgung ein Ende zu machen und öffentlich gegen die Gewalttat, die man mit mir im Sinne hatte, zu protestieren. Ich sagte also, man könne über mein Schicksal bestimmen, und darüber verfügen, wie man wolle. Jetzt herrschte Freude im ganzen Hause, und mit den Zärtlichkeiten kehrten auch die Schmeicheleien und die Verführungskünste wieder. Gott hatte zu meinem Herzen gesprochen, niemand war für den Zustand der Vollkommenheit besser geschaffen, als ich. Es war unmöglich, dass es hätte anders sein können; man hatte das stets erwartet. Man erfüllte seine Pflichten nicht mit solchem Eifer und solcher Ausdauer, wenn man sich nicht dazu wahrhaft berufen fühlt. Die Novizenmutter hatte nie bei einem ihrer Zöglinge eine besser zutage tretende Berufung bemerkt; sie war über die Laune, die ich gehabt, ganz überrascht gewesen, hatte aber stets zu unserer Oberin gesagt, man müsse nur zu warten wissen, es würde vorübergehen; die besten Nonnen hätten solche Momente gehabt, das wären Einflüsterungen des bösen Geistes, der seine Bemühungen verdoppelte, wenn er sieht, dass ihm seine Beute verloren geht; ich war im Begriff, ihm zu entwischen, und es würde von nun an für mich nur noch Rosen geben; die Pflichten des religiösen Lebens würden mir um so erträglicher erscheinen, als ich sie mir stark übertrieben vorgestellt hatte, und diese plötzliche Erschwerung des Joches wäre eine Gnade des Himmels, der sich dieses Mittels bedient, um es zu erleichtern.
Ich benahm mich sehr vorsichtig und glaubte, für mich bürgen zu können. Ich sah meinen Vater; er sprach in kühlem Tone mit mir; ich sah meine Mutter, sie umarmte mich, ich erhielt Glückwunschschreiben von meinen Schwestern und vielen andern. Ich erfuhr, dass ein Herr Sornin, Vikar von Saint-Roch, die Predigt halten und dass Herr Thierrn, Kanzler der Universität, mein Gelübde entgegennehmen würde. Alles ging gut, bis zum Vorabend des großen Tages, bis auf den Punkt, dass ich erfahren hatte, die Zeremonie würde heimlich stattfinden, es würden derselben sehr wenig Leute beiwohnen, und die Kirchentür würde nur den Verwandten geöffnet werden. Deshalb ließ ich durch die Pförtnerin alle Personen aus der Nachbarschaft, alle meine Freunde und Freundinnen einladen; auch bekam ich die Erlaubnis, einigen meiner Bekannten zu schreiben. Alle diese Leute, die man nicht erwartet hatte, erschienen; man musste sie eintreten lassen, und die Versammlung war ungefähr so groß, wie ich sie zu meinem Plan brauchte.
Man hatte schon am vorigen Abend alles vorbereitet, die Glocken wurden geläutet, um aller Welt zu verkünden, dass ein armes Mädchen unglücklich gemacht werden sollte.
Mir schlug das Herz heftig. Man schmückte mich, denn an diesem Tage wird sorgfältig Toilette gemacht, und wenn ich mir jetzt alle diese Zeremonien wieder vorstelle, so glaube ich, die Sache hat etwas Rührendes und Feierliches für ein unschuldiges junges Mädchen, das ihre Neigung nicht anderswohin zieht. Man führte mich in die Kirche; die Heilige Messe wurde zelebriert, der gute Vikar, der eine Entsagung bei mir voraussetzte, die ich nicht besaß, hielt eine Rede, in der auch nicht ein Wort enthalten war, das nicht mit meinen Gefühlen im Widerspruch gestanden hätte. Endlich rückte der schreckliche Augenblick heran; als ich in den Raum treten sollte, wo ich das Gelübde aussprechen musste, fühlte ich, wie mir die Beine den Dienst versagten; zwei meiner Gefährtinnen nahmen mich unter den Arm; mein Kopf sank auf die Schulter der einen, und ich schleppte mich mühsam weiter. Ich weiß nicht, was in der Seele der Anwesenden vorging, doch sie sahen ein junges sterbendes Opfer, das man zum Altar trug, und von allen Seiten hörte ich Seufzer und Schluchzen; nur von meinem Vater und meiner Mutter hörte ich nichts.
Alle waren aufgestanden, mehrere junge Mädchen waren auf Stühle gestiegen und hielten sich an den Gitterstäben fest. Es trat eine tiefe Pause ein, dann sagte der Priester, der bei meiner Einkleidung den Vorsitz führte:
„Marie Susanne Simonin, geloben Sie Gott Keuschheit, Armut und Gehorsam?“ Mit fester Stimme erwiderte ich ihm:
„Nein, mein Herr, nein.“
Er hielt inne und sagte:
„Mein Kind, fassen Sie sich, und hören Sie mich an!“
„Monseigneur“, versetzte ich, „Sie fragen mich, ob ich Gott Keuschheit, Armut und Gehorsam gelobe, ich habe Sie angehört und sage Ihnen: Nein!“
Damit wandte ich mich zu den Anwesenden, unter denen sich ein ziemlich lautes Gemurmel erhoben hatte; ich machte ein Zeichen, dass ich sprechen wollte, das Gemurmel hörte auf, und ich sagte:
„Ich nehme Sie zum Zeugen, meine Herren, und vor allem Sie, mein Vater und meine Mutter ...“
Bei diesen Worten ließ eine der Schwestern den Vorhang fallen, und ich sah ein, dass es unnütz war, fortzufahren. Die Nonnen umringten mich und überhäuften mich mit Vorwürfen, die ich anhörte, ohne ein Wort zu erwidern. Man führte mich in meine Zelle und schloss mich dort ein.
Hier begann ich allein, meinen Betrachtungen überlassen, meine Seele zu beruhigen; ich dachte über meinen Schritt nach und bereute ihn durchaus nicht. Ich sah, dass ich nach dem Aufsehen, das ich erregt, unmöglich länger hier bleiben konnte und dass man vielleicht nicht wieder wagen würde, mich in ein Kloster zu bringen. Was man mit mir anfangen würde, wusste ich nicht, doch es gab für mich nichts Schlimmeres, als wider meinen Willen Nonne zu werden. Ich blieb ziemlich lange, ohne dass auch das geringste Geräusch zu meinen Ohren drang. Die Schwestern, die mir das Essen brachten, stellten es auf die Erde und gingen stillschweigend davon. Nach einem Monat brachte man mir weltliche Kleider, ich zog die Haustracht aus, die Oberin erschien, sagte nur, ich solle ihr folgen und ging voran. Ich ging mit ihr bis zur Klosterpforte. Dort stieg ich in einen Wagen, in dem meine Mutter allein saß und auf mich wartete. Ich nahm auf dem Vordersitz Platz, und der Wagen setzte sich in Bewegung. Wir blieben eine Zeitlang einander gegenübersitzen, ohne ein Wort zu sprechen; ich hielt die Augen gesenkt und wagte nicht, sie anzusehen. Ich weiß nicht, was in meiner Seele vorging, doch plötzlich warf ich mich ihr zu Füßen und legte meinen Kopf auf ihre Knie; sprechen konnte ich nicht, sondern schluchzte nur und weinte. Sie stieß mich heftig zurück; ich erhob mich nicht, sondern ergriff eine ihrer Hände und rief, während ich sie mit meinen Tränen benetzte und küsste:
„Sie sind noch immer meine Mutter, und ich bin doch Ihr Kind.“
Sie antwortete, indem sie mich noch härter zurückstieß und ihre Hände aus den meinen riss:
„Stehe auf, Unglückliche; erhebe dich!“
Ich gehorchte ihr, setzte mich wieder und zog meinen Schleier über das Gesicht. In dem Ton ihrer Stimme lag so viel Autorität und Festigkeit, dass ich glaubte, mich ihren Augen entziehen zu müssen. Meine Tränen rannen an meinen Armen herunter, und ich war damit vollständig bedeckt, ohne dass ich es bemerkt hatte. Wir kamen nach Hause, wo sie mich sogleich in ein kleines Zimmer brachte, das sie für mich hergerichtet hatte.
Damit betrat ich mein neues Gefängnis, in dem ich sechs Monate zubrachte, und wo ich alle Tage vergeblich um die Gnade flehte, sie zu sprechen, meinen Vater wieder zu sehen oder ihnen wenigstens schreiben zu dürfen. Man brachte mir zu essen und bediente mich; eine Magd begleitete mich an den Festtagen zur Messe und schloss mich dann wieder ein. Ich las, ich arbeitete, ich weinte, und manchmal sang ich auch, und so flossen meine Tage dahin. Ein geheimes Gefühl hielt mich aufrecht, das Gefühl, dass ich frei war und dass mein Schicksal, so hart es auch war, sich ändern konnte. Doch es war bestimmt, ich sollte Nonne werden, und ich ward es. Diese unglaubliche Unmenschlichkeit und Hartnäckigkeit vonseiten meiner Eltern bestärkten mich vollends in der Annahme, die ich hinsichtlich meiner Geburt hegte; wenigstens habe ich nie einen anderen Grund finden können, sie zu entschuldigen. Doch was bis dahin nur eine Vermutung war, sollte sich bald in Gewissheit verwandeln.
Während ich zu Hause eingesperrt war, machte ich nur wenige äußerliche Religionsübungen; doch schickte man mich an den Vorabenden der großen Feste zur Beichte. Ich habe bereits gesagt, dass ich denselben Beichtvater wie meine Mutter hatte; ich sprach mit ihm und setzte ihm die ganze Härte des Benehmens auseinander, mit der man seit drei Jahren gegen mich verfuhr.
Er wusste das. Besonders beklagte ich mich über meine Mutter mit Bitterkeit und Groll. Dieser Priester war spät in den geistlichen Stand eingetreten. Er war menschlich gesinnt, hörte mich ruhig an und sagte zu mir:
„Mein Kind, beklagen Sie Ihre Mutter, beklagen Sie sie noch mehr, als Sie sie tadeln, Ihre Seele ist gut, seien Sie überzeugt, dass sie gegen ihren Willen so handelt.“
„Gegen ihren Willen, mein Herr, was kann sie denn dazu zwingen? Hat sie mich nicht in die Welt gesetzt? Und welcher Unterschied besteht denn zwischen mir und meinen Schwestern?“
„Ein großer Unterschied.“
„Ein großer? Ich verstehe Ihre Worte nicht!“
Ich wollte eben einen Vergleich zwischen mir und meinen Schwestern anstellen, als er mich unterbrach und sagte:
„Nein, sage ich Ihnen, Nein; die Unmenschlichkeit ist nicht das Laster Ihrer Eltern. Versuchen Sie, Ihr Schicksal in Geduld zu tragen. Ich werde Ihre Mutter aufsuchen, und seien Sie überzeugt, dass ich allen Einfluss, den ich auf ihren Geist besitze, aufbieten werde, um Ihnen dienlich zu sein.“
Am folgenden Sonnabend gegen 5½ Uhr abends kam die Magd, die mich bediente, zu mir herauf und sagte:
„Ihre Frau Mutter befiehlt Ihnen, sich anzuziehen und herunterzukommen!“
Vor der Tür fand ich einen Wagen, in dem wir, die Magd und ich, Platz nahmen, und ich erfuhr, dass wir zum Pater Seraphin zu den Feuillantinern fuhren. Er erwartete uns und war allein. Die Magd entfernte sich, und ich trat in das Sprechzimmer. Unruhig und neugierig, was er mir wohl zu sagen haben möchte, setzte ich mich, und er sprach nun Folgendes zu mir:
„Mein Fräulein, das Rätsel des strengen Benehmens Ihrer Eltern gegen Sie soll sich jetzt für Sie lösen; ich habe hierfür die Erlaubnis Ihrer Frau Mutter erhalten. Sie sind klug, Sie besitzen Geist und Festigkeit und stehen in einem Alter, wo man Ihnen ein Geheimnis anvertrauen darf, selbst wenn es Sie nicht persönlich anginge. Ihre Mutter hat geglaubt, auch Sie ohne dieses Mittel ihren Plänen zugänglich zu machen; doch sie hat sich getäuscht und ist erzürnt darüber. Heute kommt sie auf meinen Rat zurück und beauftragt mich, Ihnen mitzuteilen, dass Sie nicht die Tochter des Herrn Simonin sind.“
Auf der Stelle erwiderte ich ihm:
„Das hatte ich geahnt!“
„Sehen Sie jetzt, mein Fräulein, denken Sie darüber nach, und urteilen Sie, ob Ihre Frau Mutter ohne Einwilligung, ja, selbst mit der Einwilligung Ihres Herrn Vaters, Sie Kindern gleichstellen darf, deren Schwester Sie nicht sind ...“
„Aber, mein Herr, wer ist denn mein Vater?“
„Mein Fräulein, das hat man mir nicht anvertraut. Es ist nur zu gewiss“, fügte er hinzu, „dass man Ihre Schwestern übertrieben begünstigt und alle möglichen Vorkehrungen getroffen hat, durch Ehekontrakte, durch Veräußerung der Güter, durch Stipulationen, durch Fideikommisse und andere Mittel, den Ihnen zukommenden Pflichtteil auf nichts zu reduzieren, im Falle Sie eines Tages sich an die Gerichte wenden sollten. Wenn Sie eines Tages Ihre Eltern verlieren, so werden Sie wenig vorfinden; Sie weisen das Kloster zurück, vielleicht werden Sie das noch bedauern ...“
„Nein, mein Herr, niemals; auch verlange ich nichts!“
„Sie wissen nicht, was Arbeit, Not und Sorgen sind!“
„Ich kenne wenigstens den Preis der Freiheit und die Last eines Standes, zu dem man sich nicht berufen fühlt!“
„Ich habe gesagt, was ich Ihnen zu sagen hatte; jetzt ist es an Ihnen, darüber nachzudenken!“
Damit erhob er sich.
„Mein Herr, noch eine Frage!“
„Soviel Sie wollen ...“
„Wissen meine Schwestern, was Sie mir mitgeteilt haben?“
„Nein, mein Fräulein!“
„Wie konnten sie sich dann entschließen, ihre Schwester zu plündern, denn sie halten mich doch dafür?“
„Ach, mein Fräulein, der Eigennutz, der Eigennutz; sie hätten nicht so gute Partien gemacht, und deshalb rate ich Ihnen, nicht auf Ihre Schwestern zu rechnen, wenn Sie Ihre Eltern verlieren sollten; seien Sie überzeugt, man wird Ihnen bis auf den letzten Heller den kleinen Teil streitig machen, den sie mit Ihnen zu teilen haben. Sie haben viele Kinder, und dieser Vorwand wird ihnen stichhaltig genug erscheinen, um Sie zur Armut zu zwingen. Wenn Sie mir folgen wollen, so versöhnen Sie sich mit Ihren Eltern, tun Sie, was Ihre Mutter von Ihnen erwartet und gehen Sie ins Kloster! Man wird Ihnen eine kleine Pension aussetzen, mit der Sie Ihre Tage, wenn nicht glücklich, so doch erträglich verbringen werden. Gehen Sie, mein Fräulein, Sie sind gut und klug, und denken Sie über das nach, was Sie eben gehört haben!“
Ich erhob mich und begann zu weinen. Ich sah, dass er selbst gerührt war; er schlug die Augen gen Himmel und begleitete mich hinaus. Die Magd, die mich hergebracht, erschien, und wir kehrten nach Hause zurück.
Es war spät, und ich beschloss, meiner Mutter mein Herz auszuschütten, daher ließ ich sie um eine Unterredung bitten, die mir auch bewilligt wurde.
Es war im Winter, sie saß in einem Sessel vor dem Feuer, ihr Gesicht war streng, ihr Blick starr, die Züge unbeweglich. Ich näherte mich ihr, warf mich ihr zu Füßen, und bat sie für alles Unrecht, das ich gegen sie begangen, um Verzeihung.
„Eben durch das“, erklärte sie, „was du mir sagen wirst, kannst du dir diese Verzeihung verdienen. Stehe auf, dein Vater ist abwesend; du hast also volle Zeit, dich auszusprechen! Du hast den Pater Seraphin gesehen; weißt endlich, wer du bist, und was du von mir erwarten kannst, wenn es nicht in deiner Absicht liegt, mich mein ganzes Leben für einen Fehltritt zu strafen, den ich schon allzu sehr gebüßt habe. Nun, was willst du von mir, was hast du beschlossen?“
„Mama“, erwiderte ich ihr, „ich weiß, dass ich nichts besitze, und nichts beanspruchen darf. Ich bin weit entfernt, Ihre Leiden vergrößern zu wollen, vielleicht hätten Sie mich Ihrem Willen gefügiger gefunden, hätten Sie mich früher von einigen Umständen unterrichtet, die ich nur schwer vermuten konnte; doch schließlich weiß ich Bescheid, ich kenne mich, und es bleibt mir nichts weiter übrig, als mich meiner Lebensstellung anzupassen. Ich wundere mich nicht mehr über den Unterschied, den man zwischen meinen Schwestern und mir gemacht hat; ich erkenne die Berechtigung desselben an und unterwerfe mich ihm; aber ich bin doch immer Ihr Kind. Sie haben mich in Ihrem Schöße getragen, und ich hoffe, das werden Sie nicht vergessen!“
„Wehe mir“, unterbrach sie mich lebhaft, „wenn ich dich nicht soweit anerkennen würde, wie es in meiner Macht steht!“ „Nun gut, Mama“, sagte ich zu ihr, „so geben Sie mir Ihre Liebe wieder, schenken Sie mir wieder Ihre Gegenwart, und verschaffen Sie mir wieder die Zärtlichkeit des Mannes, der sich für meinen Vater hält!“
„Es fehlt nicht viel daran, und er ist über deine Geburt ebenso klar unterrichtet, wie du und ich. Ich sehe dich nie in seiner Nähe, ohne seine Vorwürfe zu hören; er macht sie mir durch die Härte, mit der er dich behandelt. Hoffe von ihm nie die Gefühle eines zärtlichen Vaters. Und dann, – soll ich es dir gestehen, – erinnerst du mich an einen Verrat, an eine so gehässige Undankbarkeit vonseiten eines andern, dass ich den Gedanken daran nicht zu ertragen vermag: Dieser Mann tritt unaufhörlich zwischen dich und mich. Er stößt mich zurück, und der Hass, den ich gegen ihn hege, fällt auf dich zurück!“
„Wie?“, erwiderte ich, „darf ich nicht hoffen, dass Sie mich, Sie und Herr Simonin, wie eine Fremde, eine Unbekannte behandeln, die Sie aus Menschlichkeit aufgenommen haben?“
„Das können wir beide nicht. Mein Kind, vergifte mein Leben nicht länger. Wenn du keine Schwestern hättest, so weiß ich, was mir zu tun übrig bliebe, doch du hast zwei, und beide haben eine zahlreiche Familie. Schon vor langer Zeit ist die Leidenschaft, die mich aufrecht hielt, erloschen, das Gewissen ist wieder in seine Rechte getreten.“
„Doch der Mann, dem ich das Leben verdanke?“
„Er ist nicht mehr; er ist gestorben, ohne sich deiner zu erinnern; doch das ist die geringste seiner Missetaten.“
Bei diesen Worten verzerrte sich ihr Gesicht, ihre Augen blitzten; die Entrüstung bemächtigte sich ihrer Züge; sie wollte sprechen, doch sie konnte keine Silbe mehr hervorbringen; das Zittern ihrer Lippen verhinderte sie daran. Sie saß, ihr Kopf neigte sich auf ihre Hände, denn sie wollte mir die heftige Erregung verbergen, die in ihr vorging. In diesem Zustand blieb sie eine Zeit lang, dann erhob sie sich, ging einige Male im Zimmer auf und ab, ohne zu sprechen; endlich drängte sie ihre Tränen zurück und sagte:
„Das Ungeheuer! es ist nicht seine Schuld, wenn du nicht durch alle Leiden, die er mir verursacht hat, in meinem Schoße erstickt bist. Gott hat uns beide erhalten, damit die Mutter ihren Fehltritt durch das Kind sühne. Meine Tochter, du hast nichts und wirst nie etwas haben. Das wenige, das ich für dich tun kann, entziehe ich deinen Schwestern; das sind die Folgen meiner Schwäche. Jedoch hoffe ich, dass ich mir bei meinem Tode nichts vorzuwerfen brauche; denn ich werde deine Ausstattung durch meine Ersparnisse erworben haben. Ich missbrauche die Nachsicht meines Gatten durchaus nicht und lege alle Tage beiseite, was ich durch seine Freigebigkeit erhalte. Ich habe alles verkauft, was ich an Schmucksachen besaß, und habe von ihm die Erlaubnis bekommen, über den empfangenen Betrag nach Belieben zu verfügen. Ich liebte das Spiel; ich spiele nicht mehr; ich liebte das Theater; ich habe darauf verzichtet; ich liebte die Gesellschaft; ich lebe zurückgezogen; ich liebte den Prunk; ich habe ihm entsagt. Wenn du ins Kloster trittst, so wie es mein Wille und der des Herrn Simonin ist, so wird deine Ausstattung die Frucht dessen sein, was ich alle Tage zurücklege.“
„Aber Mama“, versetzte ich, „es kommen noch immer einige wohlhabende Leute hierher; vielleicht findet sich einer, der, mit meiner Person zufrieden, nicht einmal die Ersparnisse verlangen wird, die Sie für meine Ausstattung bestimmt haben?“
„Daran darfst du nicht denken; das Aufsehen, das du gemacht, hat alles verdorben!“
„So ist das Übel unheilbar?“
„Unheilbar!“
„Wenn ich nun aber keinen Gatten finde, so brauche ich doch deswegen nicht in ein Kloster eingesperrt zu werden?“
„Wenn du meinen Schmerz und meine Gewissensbisse nicht verlängern willst, bis ich die Augen schließe, so muss es sein. Einst wird auch meine Stunde schlagen; in diesem schrecklichen Augenblick werden deine Schwestern an meinem Bette stehen; sage mir, ob ich dich unter ihnen dulden kann. Welchen Eindruck würde deine Gegenwart in diesem letzten Moment machen? Meine Tochter, denn du bist es wider meinen Willen, deine Schwestern haben vom Gesetz einen Namen erhalten, den du nur dem Verbrechen dankst. Betrübe eine Mutter nicht, welche sühnen will, lasse sie friedlich ins Grab steigen; mag sie sich selbst sagen, wenn sie im Begriff steht, vor dem großen Richter zu erscheinen, dass sie ihren Fehler, soviel es an ihr lag, gut gemacht hat, dass sie sich schmeicheln darf, dass du nach ihrem Tode keinen Hader in das Haus tragen und keine Rechte beanspruchen wirst, die du nicht besitzest.“
„Mama“, sagte ich zu ihr, „seien Sie darüber unbesorgt, lassen Sie einen Rechtsgelehrten kommen, er mag eine Schenkungsakte aufsetzen, und ich unterschreibe alles, was er mir befiehlt.“
„Das ist nicht möglich; ein Kind enterbt sich nicht selbst, das ist die Strafe vonseiten eines Vaters und einer mit Recht erzürnten Mutter. Wenn es Gott gefiele, mich morgen zu sich zu rufen, so müsste ich mich morgen zum äußersten entschließen und mich meinem Gatten eröffnen, um im Einverständnis mit ihm dieselben Maßregeln zu treffen. Zwinge mich nicht zu einem Schritte, der mich in seinen Augen verhasst macht und Folgen nach sich ziehen würde, die dich entehren müssten. Wenn du mich überlebst, so wirst du ohne Namen, ohne Vermögen und ohne Stand dastehen; Unglückliche, sage mir, was soll aus dir werden? .... Welche Gedanken soll ich ins Grab mit mir nehmen? Ich soll also deinem Vater sagen ... Doch was soll ich ihm sagen? Dass du nicht sein Kind bist? Meine Tochter, wenn weiter nichts nötig wäre, um mich zu deinen Füßen zu werfen und dich zu bestimmen ... Doch du fühlst nichts, du hast die unbeugsame Seele deines Vaters ...“
In diesem Augenblick trat Herr Simonin ein und bemerkte die Aufregung seiner Frau. Er liebte sie, und da er heftig war, so blieb er plötzlich stehen, warf mir einen schrecklichen Blick zu und sagte: „Hinaus.“
Wäre er mein Vater gewesen, ich hätte ihm nicht gehorcht, doch er war es nicht. Zu dem Diener, welcher mir leuchtete, sich wendend, fügte er hinzu:
„Sagen Sie ihr, sie soll nicht wieder hier erscheinen.“
Ich schloss mich wieder in mein kleines Gefängnis ein und dachte über das nach, was mir meine Mutter gesagt hatte; dann ersuchte ich die Magd, welche mich bediente, sie möchte mich benachrichtigen, wenn mein Vater ausgegangen wäre, und schon am nächsten Tage erbat ich eine Unterredung mit meiner Mutter; doch sie ließ mir antworten, sie hätte Herrn Simonin das Gegenteil versprochen, aber ich könne ihr mit einem Bleistift, den sie mir schicke, schreiben.
Ich schrieb ihr daher Folgendes auf ein Blatt Papier:
„Mama, ich bin traurig wegen aller der Leiden, die ich Ihnen verursacht habe, und bitte Sie deswegen um Verzeihung; es ist meine Absicht, ihnen ein Ende zu machen. Verlangen Sie von mir alles, was Ihnen beliebt, und wenn es Ihr Wille ist, dass ich Nonne werden soll, so wünsche ich nur, dass es auch der Wille Gottes sein möge.“
Die Magd nahm diese Zeilen und brachte sie meiner Mutter. Einen Augenblick später kam sie wieder heraus und sagte zu mir hocherfreut:
„Fräulein, da es nur eines Wortes bedurfte, Ihren Vater, Ihre Mutter und Sie glücklich zu machen, warum haben Sie das so lange aufgeschoben? Der Herr und die Madame haben ein Gesicht gemacht, wie ich es, seit ich hier bin, bei ihnen nicht gesehen; sie zankten sich Ihretwegen unaufhörlich; Gott sei Dank werde ich das jetzt nicht mehr sehen.“
Einige Tage vergingen, ohne dass ich etwas hörte; doch eines Morgens gegen 9 Uhr öffnete sich meine Tür plötzlich; es war Herr Simonin, der im Schlafrock und in der Nachtmütze eintrat. Ich erhob mich und machte ihm eine Verbeugung, während er zu mir sagte:
„Susanna, erkennst du dieses Billett?“
„Ja, mein Herr!“
„Hast du's aus freien Stücken geschrieben?“
„Darauf kann ich nur „Ja“ sagen!“
„Bist du wenigstens entschlossen, das auszuführen, was du darin versprichst?“
„Ich bin es!“
„Hast du keine Vorliebe für irgendein Kloster?“
„Nein, sie sind mir gleichgültig!“
„Es ist gut; das genügt!“ – – –
Etwa 14 Tage vergingen, ohne dass ich von dem, was man mit mir beabsichtigte, auch nur das Geringste erfuhr; ich glaube, man hatte sich an verschiedene fromme Häuser gewendet, doch der Skandal meines ersten Schrittes war meiner Aufnahme als Postulantin hinderlich. In Longchamp war man weniger schwierig, und zwar jedenfalls, weil man hatte durchblicken lassen, ich wäre musikalisch und hätte Stimme. Man übertrieb wohl die Schwierigkeiten, die man gehabt, und die Gnade, die man mir angedeihen ließ, dass man mich in diesem Hause aufnahm; man veranlasste mich sogar, an die Oberin zu schreiben. Ich hatte keine Ahnung von den Folgen dieses schriftlichen Zeugnisses, das man mir abverlangte; man fürchtete anscheinend, ich könnte mein Gelübde widerrufen, und wollte ein Zeugnis von meiner eigenen Hand haben, dass mein Entschluss ein freiwilliger gewesen war.