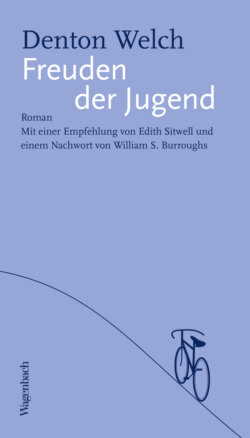Читать книгу Freuden der Jugend - Denton Welch - Страница 5
I
ОглавлениеEINIGE JAHRE VOR DEM KRIEG, als der Junge fünfzehn war, verbrachte er die Sommerferien mit seinem Vater und seinen beiden älteren Brüdern in einem Hotel nahe der Themse in Surrey. Das Hotel war früher ein Landsitz gewesen und davor ein königliches Jagdschloß. Doch inzwischen hatte der Innenhof ein Glasdach und diente als Teesalon, im Erdgeschoß gab es eine Reihe von Toiletten und Waschräumen mit blankgeschrubbten Kacheln und glitzernden Armaturen, und seitwärts hatte man einen neuen Flügel angebaut, der unten einen Ballsaal enthielt, und im Obergeschoß lagen kleine Zimmer, die schmal wie Klosterzellen waren.
Unverändert war indessen die reizvolle Parklandschaft ringsum, mit terrassenförmigen Gärten und Rasenflächen bis hinunter zu einem kleinen künstlichen Teich, der fast vollständig von dichten Brombeerhecken eingeschlossen wurde. Nur der Teich und seine Ufer wirkten vernachlässigt; das übrige Gelände – mit dem Springbrunnen, der Grotte, der Gartenlaube und dem liebevoll angelegten Tierfriedhof – machte einen sehr gepflegten Eindruck.
Der Junge (er hieß Orvil Pym) war am späten Nachmittag mit seinem Vater angekommen. Sie waren vorgefahren in einem jener großen schwarzen, auf Hochglanz polierten Daimler, von denen die Argwöhnischen immer vermuten, sie seien nur gemietet.
Mr. Pym, für sechs Monate aus Fernost zu Besuch in der alten Heimat, hatte Orvil vom Internat in den Midlands abgeholt. Orvil war in den letzten Tagen vor Beginn der Ferien noch krank geworden. Es schien sich um eine Fleischvergiftung zu handeln, und da er von Natur aus etwas anfällig war und sich vor dem Leben ängstigte, hatte er zu den ersten Opfern gehört. Bald jedoch waren zwei Krankensäle im Sanatorium mit Jungs aus seinem Gebäude belegt, bei denen dieselben Symptome aufgetreten waren. Die Sache war nicht weiter schlimm – ein bißchen Fieber, Übelkeit, leichter Durchfall – und die Boys waren munter und guter Dinge, kegelten mit den weißen Nachttöpfen auf dem Dielenboden, erzählten Schauergeschichten, führten zotige Reden und spielten einander üble Streiche nach dem Schlafengehen.
Die Fleischvergiftung setzte der Frau des Heimleiters mehr zu als den eigentlich Betroffenen. Sie kochte gutes Essen in ihrem Haus. Die Jungs wußten das. Jeder wußte es. Sie sparte an nichts und gehörte nicht zu denen, die auf Kosten anderer versuchten, Geld abzuzweigen und für ihren Lebensabend auf die hohe Kante zu legen. Im Gegenteil, erst am letzten Sonntag hatte es Lachs und Gurkengemüse gegeben, und als Nachtisch hatte sie einen Biskuit-Auflauf mit echter Schlagsahne serviert!
Mit gesenkten Augen lief sie nun herum, und immer wieder trieb es ihr ohne erkennbaren Anlaß die Schamröte ins Gesicht. Schrecklich, auch nur daran zu denken, was die Frauen der anderen Heimleiter alles über sie sagen mochten. Die Mißgünstigen unter ihnen würden sich hämisch darüber freuen, daß ausgerechnet sie, die sich auf ihr gutes Essen und ihre Großzügigkeit mit Recht einiges zugute hielt, die Hälfte ihrer Boys vergiftet hatte. Und die anderen würden sie bemitleiden. Beides war ihr gleichermaßen verhaßt.
›Was kann es nur gewesen sein?‹, dachte sie verzweifelt. ›War es womöglich die Dosenwurst, die ich zum Tee serviert habe?‹
Für Orvil war es eine Freude und Erleichterung, endlich einmal richtig krank zu sein. Vieles in seinem ersten Jahr im Internat war so erschreckend und entnervend gewesen, daß er sich die ganze Zeit nach einem eigenen Zimmer gesehnt hatte, in dem er in Ruhe schlafen konnte.
Diese Ruhe hatte er im Sanatorium zunächst auch gefunden, doch dann wurden nach und nach die anderen Boys eingeliefert, und bald ging es zu wie in einem Biergarten.
Eines Abends konnte es Orvil nicht mehr ertragen. Sein Gesicht und die Arme hatten sich bläulich verfärbt, und häßliche rote Flecken breiteten sich darauf aus. Drei Ursachen wirkten da zusammen: die Vergiftung, seine Ängstlichkeit und die vielen Tabletten, die er einnehmen mußte. Offenbar handelte es sich um ein sehr starkes Medikament. Wie in Trance wälzte er sich aus seinem Bett, hüpfte auf allen vieren herum und quakte. »Ich bin ein Frosch, ich bin ein Frosch, ein großer weißer Frosch.«
Den Boys im Saal verschlug es die Sprache. Dann rief ein großer Bursche, dem bereits die ersten schwarzen Haare aus den Nasenlöchern sprossen, mit angstvoller Stimme nach draußen: »Schwester, Schwester, kommen Sie schnell! Pym ist verrückt geworden! Er hüpft hier herum und sagt, er ist ein Frosch!«
Die Schwester kam hereingerannt und hob Orvil vom Boden auf. Sie war eine kleine Person, aber recht kräftig und energisch, und Orvils Gewicht bereitete ihr keine Mühe. Während sie ihn zurück zu seinem Bett führte, lachte sie still in sich hinein.
»Na sowas«, sagte sie. »Bildet sich ein, er ist ein Frosch!« Sie strich ihm über sein dichtes widerspenstiges Lockenhaar, und als er wieder im Bett lag, knöpfte sie ihm den obersten Knopf seiner Schlafanzugjacke zu, den er immer offenließ. Dann eilte sie hinaus, um Handtücher und eine Schüssel Wasser zu holen.
Orvil tat weiterhin, als sei er nicht ganz bei Sinnen. Als sie wieder hereinkam, hörte sie die Boys untereinander tuscheln: »Pym phantasiert. Er sieht komische Sachen …«
Die Schwester zog ihm die Jacke aus, tauchte ein Handtuch in das lauwarme Wasser und rieb ihm Brust und Arme ab. Er hielt die Augen geschlossen, denn er wollte nicht sehen, wie sie auf seine nackte Brust herunterschaute. Sie hielt ihm den einen Arm hoch und ließ das Wasser daran herablaufen, bis es ihn in der Achselhöhle kitzelte. Er erschauerte leicht, und sie lachte.
»Das verschafft dir ein bißchen Kühlung«, sagte sie. »Danach fühlst du dich besser.«
Als sie ihm den Oberkörper abgetrocknet hatte, zog sie ihm die Jacke wieder an. Dann zog sie ihm, fast in einer einzigen Bewegung, die Hose herunter. Geschickt warf sie ihm ein Handtuch über den Unterleib und begann, ihn darunter zwischen den Beinen zu waschen. Die kühle Nässe des Handtuchs auf seiner verschwitzten Haut ließ Orvil frösteln, doch er hatte nichts gegen die raschen deftigen Bewegungen ihrer Hand. Schließlich geschah es unter einer schicklichen Abdeckung. Außerdem hatte er ja noch seine Jacke an, und damit fühlte er sich sicher genug.
›Wie eigenartig‹, dachte er. ›Hat sie bei Florence Nightingale gelernt, daß man das so macht?‹
Abwechselnd preßte er nun die Schenkel zusammen und öffnete sie wieder, und sein ganzer Unterleib ging in zuckenden Stößen auf und nieder. »Nun wackel doch nicht so!«, sagte sie und gab ihm einen leichten Klaps auf den Schenkel.
Orvil versuchte vergeblich, seine Zuckungen unter Kontrolle zu bekommen, und dann begannen auch noch seine Zähne zu klappern. Es hörte sich an, als habe er ein schlecht sitzendes Gebiß im Mund, und einmal biß er sich dabei auf die Zunge und gab ein gequältes Grunzen von sich.
»Na, was sind wir denn jetzt? Ein kleines Schweinchen?«, meinte die Schwester ungehalten. Sie hatte nicht gemerkt, was mit ihm geschehen war. Sie trocknete ihm die Beine ab, zog ihm die Hose hoch und knotete ihm den dünnen Stoffgürtel etwas zu fest. Dann deckte sie ihn zu und stopfte die Bettdecke an beiden Seiten fest unter die Matratze.
»So, jetzt fühlst du dich gleich wieder gut«, sagte sie und gab ihm zwei von den Tabletten, die ihn bereits so fleckig gemacht hatten. Noch einmal versuchte sie, ihm durch sein dichtes Haar zu streichen, und wieder gab sie es lachend auf. »Struppig wie ein Foxterrier«, sagte sie. »Oder ein Strohdach, das in hundert Jahren keinen Tropfen Regen durchläßt.« Dann fügte sie etwas weicher hinzu: »Gute Nacht, mein Schatz« und ließ ihn allein.
›Schatz klingt eigentlich sehr nach Sex‹, fand Orvil. Er dachte an allerlei Wörter und die unterschiedlichen Empfindungen, die sie in ihm auslösten. Endlich schlief er ein.
Orvil war freudig erregt, als er vor dem Haupteingang des Sanatoriums die große schwarze Limousine sah, in der sein Vater auf ihn wartete. Der Anblick war so unerwartet, daß es ihm schien, als habe eine gute Fee seine sehnsüchtigen Wünsche erhört.
›So groß hätte der Wagen gar nicht sein müssen für meine Flucht‹, dachte er. ›Aber die gute Fee läßt sich nicht lumpen. Sie würde mir nie einen Baby Austin schicken.‹
Er rannte hinaus, und in der grellen Sonne wurde ihm schwindelig, und er spürte ein lästiges Ohrensausen.
»Hallo, Daddy!«, rief er und hielt seinem Vater den Schlag auf. Orvil bekam seinen Vater nur alle drei Jahre einmal zu sehen, und er verband mit ihm kaum mehr als schwarze Limousinen und aufregende Mahlzeiten in Restaurants. Sie hatten sich sehr wenig zu sagen, und das einzige, was ihnen ein tiefes Bedürfnis gewesen wäre, durfte nicht angesprochen werden: Orvils Mutter war vor drei Jahren gestorben, und er wußte, das Gesicht seines Vaters würde schon bei der bloßen Erwähnung ihres Namens starr und abweisend werden und seine Stimme schroff und kalt und ärgerlich. Sie war so sehr geliebt und verehrt worden, daß man nie von ihr reden durfte. Es war geradezu widerwärtig, wenn man offen davon sprach, daß eine solche Frau einmal gelebt hatte. Es war so undenkbar, sie zu erwähnen, daß man zu kunstvollen Umschreibungen greifen mußte, wenn man von der Vergangenheit sprach.
»Hallo, Mikrobe«, sagte Mr. Pym. So nannte er seinen Jüngsten schon seit jeher. Manchmal sagte er auch ›Made‹, doch gewöhnlich war es ›Mikrobe‹.
»Geht es dir wieder besser?«, fragte er jetzt. »Du siehst immer noch ein bißchen fleckig aus.«
»Ach, ich bin wieder ganz in Ordnung. Wollen wir jetzt gleich losfahren?«, drängte Orvil. Er beeilte sich, seine Reisetasche im Wagen zu verstauen, und er fühlte sich erst sicher, als sie das Dorf und die Gebäude des Internats weit hinter sich gelassen hatten.
Der Chauffeur steuerte die große Limousine mit sicherer Hand die gewundene Landstraße entlang. Einige Augenblicke genoß Orvil seine Freiheit in vollen Zügen, doch dann machte er sich schon die ersten Sorgen, denn die Ferien hatten ja schon vor einigen Tagen begonnen, und jede Sekunde brachte ihn dem Anfang des nächsten Schuljahrs näher.
Mr. Pym schlug vor, in Oxford zu übernachten und bei dieser Gelegenheit nachzusehen, ob Charles (sein ältester Sohn) noch da sei. Charles führte ein so unabhängiges Leben, daß er seinem Vater nie einen Brief schrieb und ihm mitteilte, wo er sich gerade aufhielt. Mr. Pym mußte es jedesmal selbst herausfinden.
Charles war nicht da. Seine Wirtin sagte, er sei gegen Ende des Semesters mit zwei anderen jungen Herren zu einer Reise aufgebrochen. »Sie sind in seinem blauen Wagen weggefahren, der immer so fürchterlich knattert«, sagte sie und schnaubte verächtlich durch die Nase. Orvil haßte den blauen Bugatti seines Bruders fast so sehr, wie es die Wirtin zu tun schien. Besonders widerlich fand er die strammen Lederriemen über der gewölbten Motorhaube und das obszöne Auspuffrohr, das ihn immer an den gierigen Schlund eines Staubsaugers erinnerte.
Orvil und sein Vater gingen zurück zum ›Mitre‹ und setzten sich unter dem Glasdach der Terrasse in Korbsessel. Mr. Pym bestellte Gin und französischen Vermouth für sich und einen Orangensaft für Orvil. Dann griff er wortlos zu einigen Zeitschriften, die auf dem Tisch lagen, und begann darin zu blättern. Orvil starrte traurig und enttäuscht vor sich hin. Sein Vater schaute hoch, nahm die aufgespießte Kirsche aus seinem Cocktail und hielt sie ihm hin, wie er es früher immer zu tun pflegte, als Orvil noch sehr klein war. Orvil nahm die grellrosa Frucht zwischen die Zähne und zog sie von dem dünnen Zahnstocher herunter, den sein Vater am anderen Ende festhielt. Er spürte den eigenartigen Geschmack von Alkohol und Sirup im Mund, und für einen Augenblick war er wieder acht Jahre alt, saß im Schlafanzug am offenen Kamin und trank seine heiße Milch, während sein Vater an dem Cocktail nippte und ihm vorlas, bis die Standuhr mit zwei Schlägen anzeigte, daß es halb acht war.
›Wie viele gin-getränkte Cocktailkirschen mag ich wohl gegessen haben, bis ich zehn war?‹, dachte er.
»Gehn wir hinein zum Essen«, sagte Mr. Pym nach seinem dritten ›Gin-and-French‹ und erhob sich. Er ließ seinem Sohn den Vortritt in den Speisesaal. Orvil gefiel das.
Einigermaßen verwirrt blieb er mitten im Raum stehen und sah sich die bunten Wappenschilde an den Wänden an, während er darauf wartete, daß sein Vater einen Tisch auswählte. Als er das Wappen vom College seines Bruders entdeckte, steuerte Mr. Pym gerade auf den Tisch neben einer alten Dame zu, die offenbar nichts als gekochte Eier aß. Die Schalen von zwei Eiern lagen bereits vor ihr auf dem weißen Tischtuch. Sie schnappte mit ihren Nußknacker-Lippen und machte gerade eine barsche Bemerkung zu dem jungen Kellner, der sich über sie beugte. Einmal zuckte ihre Hand zu ihrem Mund hoch, und Orvil sah, daß sich die Haut wie durchsichtige Gelatine über ihren Handrücken spannte. An einem Finger trug sie einen Ring mit einem sichelförmigen Aufsatz, der mit großen Diamanten besetzt war. Einen Ring, zu dem er sich weißlackierte Schlafzimmermöbel vorstellte, kunstvolle Arrangements von Rosen aus Seidenpapier, Rohrstühle, Paneele mit Einlegearbeiten, silberne Schuhlöffel und Spangen und Engelsgesichter von Reynolds auf den oxydierten Deckeln von Puderdosen.
Orvil beobachtete sie verstohlen, während er seine Tomatensuppe löffelte, zu der er eine Menge Melba-Toast aß. Danach gab es gebratene Ente mit Orangensalat, Kartoffelbrei und Sahnespinat. Sahnespinat erinnerte ihn immer an etwas. Er versuchte sich dagegen zu wehren, doch jedesmal, wenn er Spinat auf einem Teller sah, mußte er wieder daran denken: Auf einer Wiese voll Butterblumen war er einmal in einen Kuhfladen getreten. Er hatte heruntergeschaut auf seinen Fuß, der durch die Kruste gebrochen war und in einer saftigen dunkelgrünen Masse steckte. ›Was für eine wundervolle Farbe‹, hatte er gedacht. ›Wie grüner Samt oder Jade. Oder Sahnespinat.‹
Jetzt, als ihm der Kellner den Spinat auf den Teller schöpfte, sah er das Bild wieder vor sich. ›Ich esse Kuhfladen, ich esse einen Kuhfladen!‹, sagte er sich immer wieder.
»Was möchtest du zum Nachtisch?«, fragte sein Vater. Er war ein Mensch, der am liebsten anderen beim Essen zusah. Er selbst hatte sich diesmal nur saftige schwarze Pilze auf Toast bringen lassen. Die Pilze mit ihren eingedrückten Lamellen wirkten wie geschrumpfte Skalps von Orientalen.
Orvil studierte die Speisekarte.
»Ich möchte Pêche Melba«, sagte er.
»Aber es wird kein frischer Pfirsich sein«, gab ihm sein Vater zu bedenken.
»Ich glaube, ich habe noch nie eine Pêche Melba mit frischen Pfirsichen gegessen«, sagte Orvil nachdenklich. »Es sind immer große gelbe Pfirsichhälften aus der Dose.«
»Ich weiß. Das ist es ja. Sie machen es nie richtig. Sie sollten es lieber sein lassen, wenn sie keine frischen Pfirsiche dazu nehmen wollen.« Mr. Pym schien sehr verärgert zu sein. Dabei wußte Orvil, daß nichts auf der Welt seinen Vater dazu bringen konnte, selbst einmal Pêche Melba zu essen.
»Aber frische Pfirsiche kosten in England manchmal eine halbe Krone das Stück, oder mehr«, sagte Orvil zur Verteidigung der guten britischen Pêche Melba aus der Dose.
Sein Vater schwieg dazu und widmete sich jetzt einem Whisky Soda.
Die Pêche Melba wurde serviert, mit ihrer dicken roten zähflüssig herablaufenden Escoffier-Sauce. Die beiden Hälften waren wieder zusammengefügt worden, so daß sie wie ein Paar schweißglänzende Hinterbacken aussahen. ›Wie der Hintern einer Schlafpuppe aus Zelluloid‹, sagte sich Orvil. ›Nur bei dieser Puppe ist er aufgeplatzt, und es kommen Schneeflocken und große Blutklumpen heraus …‹
Er leckte ein wenig rote Soße vom Löffel und verteilte sie mit der Zunge im Mund. Sie hatte einen leicht metallischen Geschmack. Sein Vater sah ihm geduldig und zufrieden zu, bis das letzte Stück Pfirsich verschwunden war. Dann standen sie beide auf und gingen wieder hinaus zu den Korbsesseln auf der Terrasse.
»Du gießt ein«, sagte Mr. Pym, als der Kaffee gebracht wurde. Und erneut, wie schon beim Eintritt in den Speisesaal, war Orvil erfreut, daß ihm sein Vater das Gefühl gab, wichtig zu sein.
Mr. Pym trank seinen Kaffee schwarz, mit drei Stückchen Würfelzucker in der winzigen Tasse. Dann lehnte er sich zurück und nickte ein. Orvil studierte die feinen geplatzten Äderchen auf der Nase und den Wangen seines Vaters. Er fragte sich, ob sein Vater wieder Opium geraucht hatte. Er vermutete das jedesmal, wenn sein Vater plötzlich einschlief. Zwar hatte er über Opium nichts Näheres in Erfahrung bringen können, doch er wußte, daß sein Vater es manchmal rauchte, denn dieser hatte einmal mit deutlich gekünstelter Beiläufigkeit gesagt: »Ein Bursche in Java schlug eines Abends vor, wir sollten jeder eine Pfeife rauchen; aber von dem Zeug wurde mir nur übel, deshalb habe ich es nie mehr angerührt.«
Sooft er mit seinem Vater zusammen war, hatte Orvil seither darauf geachtet, ob er einen Hauch von Opium erhaschen würde. Er kannte den Geruch, denn als er neun Jahre alt war, hatte ihm seine Tante, die seine Vorliebe für ausgefallene Geschenkartikel kannte, ein altes chinesisches Opiumkästchen geschenkt. Die Droge hatte das Elfenbein des Kästchens kastanienbraun verfärbt. Als Orvil den Deckel aufklappte, drang ein ganz ungewohnter Duft heraus, der so unverkennbar war, daß er ihm unvergeßlich blieb. Klebrige braune Reste von Opium bedeckten noch die Seiten und den Boden des Kästchens. In den Ferien, wenn er zu dem Wandbord mit seinen kleinen Schätzen zurückkehrte, klappte er jedesmal als erstes das Kästchen auf und sog den eigenartigen Opiumgeruch ein.
Noch einmal sah er jetzt seinen Vater an. Er wollte gern zu Bett gehen und fragte sich, ob er seinen Vater aufwecken sollte. Eigentlich hätte er ihn lieber schlafen lassen, doch er fürchtete, Mr. Pym könne im Schlaf etwas tun, was ihn vor den anderen Hotelgästen blamieren würde – rülpsen oder schnarchen oder fluchen. Oder vielleicht würde er schreckliche Familiengeheimnisse preisgeben in jener außerordentlich beunruhigenden Stimme, wie sie Leute haben, die im Schlaf reden.
Er faßte ihn leicht an der Schulter und sagte: »Ich geh jetzt schlafen, Daddy.«
Mr. Pym öffnete die Augen. Für einige Sekunden waren sie glasig wie die Augen eines toten Dorschs. Dann nahmen sie ihn wahr, und Mr. Pym sagte: »Gute Nacht, Mikrobe. Schlaf gut. Laß dich nicht von den Flöhen piesacken.«
Orvil verbrachte eine unruhige und sehr merkwürdige Nacht. Mehrmals verspürte er das starke Verlangen, etwas Verbotenes an sich zu tun, doch jedesmal widerstand er und kam sich sehr willensstark und gut vor, als habe Gott ihm übermenschliche Kräfte verliehen. Seine Träume waren wundersamer und erschreckender als gewöhnlich. In einem dieser Träume lag er in einer riesigen offenen Wunde. Es war sehr behaglich in dem daunenweichen Fleisch, aus dem sachte das Blut gluckste. Doch er wußte, schon das leiseste Wimperzucken würde dem Riesen, in dessen klaffender roter Brustwunde er lag, entsetzliche Schmerzen bereiten. In einem anderen Traum schwebten Diamanten von grotesken Ausmaßen an langen goldenen Fäden. Sie hatten das Aussehen von Sonnenblumen, und Orvil war ein kleines Kind, das man unter den künstlichen Blütenblättern dieser Blumen ausgesetzt hatte. Ein heftiger Wind erfaßte die Diamanten, so daß ihm die Zacken ins Gesicht schlugen. Wie glitzernde schauerliche Fußbälle aus Eis flogen die Riesendiamanten gegen seinen Kopf und rissen ihm das Fleisch ab, bis seine Augen voll Blut waren und seine Schädelknochen vibrierten und dröhnten.
Beim Erwachen hörte er sich das Liebeslied von Thais singen. So nannte er es jedenfalls, seit er es bei einem seiner Lehrer auf dem Grammophon gehört hatte. Er hatte damals zunächst nicht weiter auf die Platte geachtet, doch sein exzentrischer Lehrer, dem seine getönten Brillengläser ein fast dämonisches Aussehen verliehen, war im Zimmer auf und ab gegangen, hatte ihm mit eindringlichen Worten einiges über die Aufnahme erzählt und sie ihm anschließend noch einmal vorgespielt.
Der Anlaß hatte sich ergeben während einer eigenartigen Teeparty, die der Lehrer für seine Französisch-Klasse gab. Orvil erinnerte sich noch gut an das einsam gelegene Haus, das fast unbewohnt wirkte, das Eßzimmer mit der niedrigen Decke, den Hausboy in Pfadfinder-Uniform, die großen fettdurchweichten Doughnuts mit angekrustetem Zucker, die klobigen Tassen (groß wie Baby-Pötte) und die papierdünnen alten Teelöffel, die neben den massiven Untertassen recht verloren aussahen.
Diese Löffel waren ihm besonders in Erinnerung geblieben, denn es waren wunderschöne Exemplare aus der frühen viktorianischen Zeit, vorne wie Muscheln geformt, und die Stiele mit Wappen verziert. Wie sehr hatte er sich gewünscht, so einen Löffel zu besitzen. Doch er hatte nicht den Mut gehabt, einen verschwinden zu lassen …
Orvil sprang aus dem Bett und stellte sich vor den Spiegel. Er fürchtete, daß er jetzt, mit fünfzehn, im Begriff sei, sein gutes Aussehen zu verlieren. »O Gott, laß mich keinen Stimmbruch kriegen und laß mir keine Bartstoppeln wachsen«, hatte er in letzter Zeit öfter gebetet. Doch Gott hatte ihn nicht erhört. Beim Singen war ihm die Stimme in den hohen Lagen umgekippt, und als er jetzt sein Gesicht im Spiegel sah, mußte er feststellen, daß ihm schon wieder goldene Härchen entlang der Oberlippe sprossen. Erst vor einem Monat hatte er sie mit einem Rasiermesser, das er auf dem Dachboden seiner Tante gefunden hatte, heimlich abrasiert. Sein Onkel war Pfarrer, und die Leute aus der Gemeinde brachten der Tante immer ihren alten Kram für den nächsten Trödelmarkt. Sooft Orvil im Pfarrhaus zu Gast war, stieg er auf den Dachboden, wo das Zeug aufbewahrt wurde, und bediente sich. Seine Tante wußte nichts davon. Er sah sich mit den entwendeten Sachen immer vor und versteckte sie gut.
Bei seinem letzten Besuch hatte er das altmodische Rasiermesser entdeckt und einen jener Apparate, die Cricketspieler unter der Hose tragen, um ihre Weichteile zu schützen. Er hatte sich gewundert, daß jemand auf die Idee gekommen war, so etwas bei seiner Tante abzugeben. Es mußte wohl eine Frau gewesen sein, die nicht wußte, wozu der Gegenstand diente. Er selbst hatte es auch nicht gewußt und erst einen seiner Lehrer danach fragen müssen.
Er war mit den beiden Dingen nach unten in sein Zimmer gerannt und hatte den ausgebeulten Lederschutz angelegt. Er war ihm viel zu groß und fühlte sich an wie eine harte Hand zwischen seinen Schenkeln. Das Ziegenleder war blankgescheuert und schwarz von Schweiß. Er hatte sich damit vor den Spiegel gestellt und mit dem alten Rasiermesser den Flaum von der Oberlippe geschabt.
Dann, ohne den Lederschutz abzunehmen, hatte er sich angezogen und war nach unten gegangen. Im Gespräch mit seiner Tante und seinen Vettern hatte er ein heimliches Gefühl der Erregung und Befriedigung gespürt und sich sehr sicher und überlegen gefühlt.
Das Rasiermesser hatte er mit ins Internat genommen und während des letzten Schuljahrs zweimal benutzt – in der Toilette im Obergeschoß, die als einzige eine abschließbare Tür hatte. Er hatte sich auf den Toilettensitz gestellt und das Rasiermesser in den Wasserkasten getaucht, und dann hatte er sich rasiert, wobei er mit einem nassen Finger erst sorgfältig an der Oberlippe entlangstrich, ehe er das Rasiermesser ansetzte.
Jetzt, als er sein Gesicht im Spiegel betrachtete, überlegte er, ob er sich schon wieder rasieren sollte. Er hatte Angst, daß die Härchen durch ständiges Rasieren stärker und dicker würden. Andererseits bereitete es ihm jedesmal Vergnügen, wenn er sie abrasierte. Er beschloß, es an diesem Morgen sein zu lassen. Er sagte sich, daß das bißchen Flaum keinem auffallen würde.
Er versuchte sich auch einzureden, daß niemand die schwarzen Ringe unter seinen Augen bemerken würde. Im Spiegel waren sie allerdings so überdeutlich, daß er kaum sein übriges Gesicht sah. Die Boys im Internat hatten ihn gelegentlich damit aufgezogen und ihn mit einem beziehungsvollen Unterton gefragt: »Du siehst heute morgen wieder so mitgenommen aus, Pym – was hast du denn wieder getrieben?«
Er wußte, worauf sie anspielten, und er zitterte jedesmal vor rechtschaffener Empörung. Er konnte gegen die Ringe unter seinen Augen einfach nichts tun. Seine Ängstlichkeit und Aufgeregtheit hielt ihn nachts oft wach. Hinzu kam, daß er empfindliche Augen hatte, die sehr rasch ermüdeten.
Er hoffte, daß andere dies erkennen würden, wenn ihnen die Ringe auffielen. Nicht auszudenken, wenn auch sie so argwöhnisch und verdorben wären wie die Boys im Internat …
Orvil nahm sein Handtuch und machte sich auf den Weg zum Badezimmer am hinteren Ende des Flurs. Neben der Tür hing ein Münzautomat, aus dem man verschiedene Sorten Pillen und Tabletten ziehen konnte: Aspirin, Chinin, Cascara Sagrada. Er hatte jetzt Geld, denn am Tag zuvor hatte sein Vater all sein Kleingeld hervorgeholt und ihm in die Hosentasche gesteckt, als sie dicht nebeneinander im Fond des Wagens saßen. Orvil, schläfrig von der monotonen Fahrt, war nervös zusammengezuckt, als fürchte er eine unsittliche Berührung. Doch dann hatte er die harten Münzen gespürt, die gegen seinen Schenkel drückten.
Er ging zurück in sein Zimmer und holte sich drei Sixpence-Stücke. Er steckte sie nacheinander in die drei Schlitze und nahm unten die kleinen Schachteln heraus. Während er das Wasser einließ und der Raum sich mit Dampf füllte, las er sich die Instruktionen durch. Dann nahm er aus jedem Röhrchen eine Tablette ein und räkelte sich in seinem Badewasser. Bald danach fühlte er sich besser – sehr friedlich und wohlig.
Nach dem Frühstück verirrte er sich auf dem Rückweg zum Zimmer. Im Gewirr der Korridore stieß er schließlich auf ein Zimmermädchen. Die kleine adrette Person machte einen netten Eindruck und wirkte intelligent und sehr fraulich. »Haben Sie sich verlaufen, Sir?«, fragte sie mitfühlend. Es war ein angenehmes Gefühl, mit ›Sir‹ angeredet zu werden. Doch zugleich fühlte er sich ertappt und beschämt. »Ja«, sagte er, »ich muß irgendwo falsch abgebogen sein.«
»Dieses alte Haus ist ein richtiges chinesisches Puzzle, nicht?«, sagte sie und lachte. Orvil fand das eine sehr einfallsreiche und gescheite Bemerkung. Er hatte den Ausdruck ›chinesisches Puzzle‹ noch nie gehört. Plötzlich sah er das Hotel als ein schreckliches Labyrinth, in dem irgendwo im Dunkeln der Minotaurus auf ihn wartete.
An diesem Tag fuhren sie nach Salisbury. Ben, Mr. Pyms zweitältester Sohn, war außerhalb der Stadt in einem Ausbildungslager des Officers’ Training Corps seiner Schule.
Sie hielten vor einem Hotel und ließen ihr Gepäck hineinbringen. Dann fuhren sie aus der Stadt. Mr. Pym sagte dem Chauffeur, er solle fahren, bis er weiße Zelte sehe. Orvil entdeckte sie als erster. Der Chauffeur fuhr darauf zu, mußte aber feststellen, daß er die Landstraße nicht verlassen konnte: Der Feldweg, der zum Camp führte, war völlig aufgeweicht und bestand nur noch aus Schlamm.
Mr. Pym und Orvil stiegen aus und begannen schweigend durch den Schlamm zu stapfen. Sie fühlten sich etwas schuldbewußt, doch zugleich waren sie auch froh, daß sie dieses Lagerleben nicht ertragen mußten. Obwohl etwas in ihnen sich doch heimlich danach sehnte.
Plötzlich kam ihnen Ben entgegen. Er war sehr verschwitzt und schlecht gelaunt, bot aber dennoch eine stattliche Erscheinung. Er war offensichtlich im Dienst, denn er trug verdreckte Arbeitshosen und schleppte zwei randvolle Bottiche aus der Latrine, die er bei jedem Schritt wütend überschwappen ließ. Als er seinen Vater und Orvil erblickte, setzte er die Bottiche mit einem Ruck ab und stand einen Augenblick entgeistert da. Dann lachte er laut heraus, und die Situation war gerettet. Die anderen beiden liefen auf ihn zu, um ihn zu begrüßen, doch er hob abwehrend die Hände und rief: »Kommt mir nicht zu nahe, sonst fallt ihr in Ohnmacht.«
Der Gestank aus den Bottichen war in der Tat überwältigend. Orvil fühlte sich merkwürdig hin- und hergerissen zwischen Ekel und Faszination. Er hätte am liebsten mit einem Stecken in der Brühe herumgerührt, die Kotklumpen aufgespießt und hoch in die Luft geworfen. Doch sein zweites Ich – ein sehr feminines, auf Reinlichkeit bedachtes Ich – wehrte sich heftig gegen eine solche Vorstellung und gab ihm sogar ein, daß sein frischer, sauberer, gutaussehender Bruder nun für immer mit einem Makel behaftet sein würde, nie mehr zu trennen von dem ekelhaften Zeug, mit dem er hier umging.
Mr. Pym vereinbarte mit Ben, daß dieser nach Salisbury kommen solle, wenn sein Dienst vorüber war. Nach einem gemeinsamen Abendessen würden sie dann alle zum ›Searchlight Tattoo‹ gehen.
Orvil sah sich noch einmal um nach seinem geliebten Bruder, der unter seiner schmutzigen Hülle immer noch so charmant und weiß und sauber wirkte. Mit zorniger Beharrlichkeit versteifte er sich darauf, wie gut sein Bruder aussah, um das Bild von ihm auszulöschen, wie er diese beiden Bottiche schleppte.
Im Hotelzimmer legte sich Orvil auf das Bett und versuchte, ein wenig zu schlafen. Die Cascara-Sagrada-Pille hatte zu wirken begonnen, und überdies fühlte er sich niedergeschlagen und elend. ›Wenn ich doch nur sterben könnte!‹, dachte er. Oder wenn er nur frei und unbeschwert sein könnte, aber zugleich mit allen Rechten eines Erwachsenen. Mit ein bißchen Geld, einem kleinen Zimmer und mit einer Arbeit, die ihm Freude machte. Wenn doch nur seine faszinierende Mutter mit dem sonnengebräunten Teint aus ihrem Grab auferstehen und zu ihm zurückkommen könnte, in ihrem merkwürdig unansehnlichen rotgrün gemusterten Tartankleid mit dem glänzenden Gürtel, den sie im Modegeschäft einer Bekannten gekauft hatte. Wenn er ihr die Ringe wieder über die Finger streifen könnte und ihre Augenbrauen nachziehen mit der winzigen schwarzen Bürste, wie er es immer so geschickt getan hatte.
Im Halbschlaf sah er es jetzt vor sich. Seine Mutter schwebte aus dem Grab herauf. Doch sie trug nicht das rotgrün gemusterte Kleid, sondern ein zerdrücktes pfirsichfarbenes Nachthemd, ihre Augen waren geschlossen, ihr goldglänzendes toastfarbenes Haar filzig und plattgedrückt von Erdklumpen. Erde krümelte aus ihren leeren Augenhöhlen, und dann sah Orvil mit Entsetzen, wie ein Stück von ihrem Gesicht abfiel und in der Spalte zwischen ihren Brüsten verschwand – es war ihre Nase, die ihr abgefault war!
»O Darling! O Darling!«, rief er. Er wußte nicht, wie er das Grauen dieses immer wiederkehrenden Angsttraums ertragen sollte. Immer sah er, wie sie krampfhaft versuchte, sich aus dem Grab zu befreien. Bis ihm wieder einfiel, daß sie ja eingeäschert worden war. Und dann sah er ihren halb verkohlten Leib in den Flammen und hörte sie gellend schreien.
Er erinnerte sich an den Nachmittag, als sie ihn mit ihrer Haarbürste geschlagen hatte. Sie hatte ihn durchs ganze Badezimmer gejagt und schließlich unter dem hellblauen Waschbecken zu fassen bekommen, und dann hatte sie begonnen, heftig auf ihn einzuschlagen. In ihrem Zorn vergaß sie, die Bürste umzudrehen. Sie schlug blindlings auf ihn ein, und er spürte, wie ihm die Borsten in die Haut stachen. Als sie erneut zuschlug, versuchte er, sich zu wehren. Plötzlich stolperten sie mitten im Badezimmer im Kreis, rissen einander an den Kleidern und fuchtelten wütend mit den Fäusten. Fast war ihnen jetzt nach Lachen zumute, doch der Zorn war stärker.
Am Abend, als sie einander verziehen hatten und sie zu ihm ins Bad kam, um ihm den Rücken zu schrubben, machte er sich steif und wollte sich nicht umdrehen. Sie sollte nicht die purpurnen Male der harten Borsten auf seinem Hintern sehen.
Die Tür wurde leise geöffnet, und Ben kam herein. In seinem Halbschlaf dachte Orvil für einen Augenblick, ein gutaussehender Fremder habe aus Versehen die falsche Tür geöffnet, denn Ben trug seine Uniform mit den blanken Messingknöpfen, und sein weißblondes Haar schimmerte wie Fischleim.
Ben legte sich neben ihn auf das Bett und begann zu erzählen. Orvil hörte, wie draußen Wassertropfen in großen Abständen aus der verstopften Dachrinne nach unten auf die Steinplatten fielen. Er lauschte und wartete, bis es wieder plop machte, und er hörte nur mit halbem Ohr auf die Geschichten, die sein Bruder vom Leben im Camp erzählte.
Ben berichtete von den Ölsardinen, die ranzig und schlecht geworden waren, weil man die Dosen schon Stunden vor dem Abendessen aufgemacht hatte; von dem Jungen, den man bewußtlos unter seinem zusammengefallenen Zelt hervorzog; von den Burschen, die Schweißfüße hatten und die ganze Nacht schnarchten; von den aufregenden Nachtübungen, wo man stundenlang dicht an dicht in dunklen Schützengräben lag. Die letzte Geschichte handelte von einem armen Kerl, den sie mit einem schweren Kochlöffel so lange auf den Kopf schlugen, bis ihm hellgrüner Schleim aus dem Mund lief.
Ben lachte glucksend in sich hinein und genoß seine Schauergeschichten in vollen Zügen. Er war ein gutherziger Mensch, doch er konnte sich nur so richtig freuen, wenn er von wüsten Dingen erzählte.
Jetzt hielt er die Hand hoch. An einem Fingernagel war die Nagelhaut aufgerissen.
»Was kann ich dagegen tun?«, fragte er. »Es zieht und schmerzt jedesmal, wenn ich etwas anfasse.«
Orvil sah es sich an. Es schien ihm eine recht geringfügige Verletzung zu sein.
»Am besten, wir fragen Daddy, was da zu tun ist«, sagte er gleichgültig.
Sie standen auf und gingen hinunter zum Tee. Anschließend ging Mr. Pym mit ihnen in eine Apotheke und ließ sich für Ben eine Nagelsalbe geben. Orvil fühlte sich noch leicht benommen von dem verschlafenen Nachmittag, und als ein Lippenstift vom Ladentisch rollte, bückte er sich und steckte ihn ein, noch ehe ihm recht bewußt wurde, was er tat.
Als sein Vater ihn fragte, was da heruntergefallen sei, gelang es ihm, leichthin zu sagen: »Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war ein Lippenstift. Er ist direkt unter den Ladentisch gerollt.« Im Hinausgehen sah er aus den Augenwinkeln, wie die Verkäuferin auf allen vieren um den Ladentisch kroch und darunter herumtastete.
Im Foyer des Hotels sah ein drahtiger Mann mit Hakennase von seiner Zeitung hoch, stand auf und kam ihnen mit ausgestreckter Hand entgegen.
»Hallo, Pym!«, sagte er. »Was für eine nette Überraschung!«
Mr. Pym kannte den Mann aus Fernost. Es war eine flüchtige Bekanntschaft, und sie hatten einander seit Jahren nicht mehr gesehen, doch jetzt schüttelten sie einander sehr freundschaftlich die Hand.
Auch der Mann, wie sich herausstellte, war nach Salisbury gekommen, weil sein Sohn im O. T. C. Camp war. Sein Vaterstolz war so übertrieben, daß er lächerlich wirkte. Aufgeregt erzählte er eine kleine Anekdote nach der anderen. Er verdrehte die Augen und zeigte sein hübsches neues schneeweißes Gebiß. Er schilderte die wagemutigen Taten seines Sohnes und hob immer wieder dessen attraktive Erscheinung hervor. Abschließend sagte er in einem humorvollen Cockney-Akzent, der jedoch die Ernsthaftigkeit der Bemerkung nicht überdecken konnte: »Ich sollt’ vielleicht nicht damit angeben, aber Jim ist einfach ein bemerkenswert prächtiger Bursche.«
Orvil fand das sehr erstaunlich. Er hatte nie gedacht, daß Väter imstande wären, über ihre Söhne anders als mit kühler Nachsicht oder einigem Unmut zu reden. Er war plötzlich neidisch auf diesen unbekannten Jim, und um das Gefühl loszuwerden, sagte er sich, daß das Getue des Mannes alle beide recht lächerlich aussehen ließ.
Sie verabschiedeten sich jetzt, um in den Speisesaal zu gehen, und als sie die Tür erreichten, geschah das, was Orvil die ganze Zeit erwartet hatte – der Mann wandte sich noch einmal an Mr. Pym und sagte hastig: »Ach übrigens, es hat mir schrecklich leid getan, als ich hörte, daß Ihre –«
Mr. Pym brachte ihn abrupt zum Schweigen, ehe er es aussprechen konnte.
»Es war am besten so«, sagte er mit Nachdruck. »Sie hätte sonst als hilfloser Krüppel weiterleben müssen, und Sie können sich wohl denken, was sie davon gehalten hätte.« Er sagte es in einem merkwürdig anzüglichen und gemeinen Tonfall. Der Mann verdrückte sich daraufhin mit hochrotem Gesicht und wünschte sich wohl, er hätte sich nicht zu dieser Bemerkung gezwungen, die ohnehin nicht aufrichtig gemeint war.
Ein sehr altmodischer Kellner mit Plattfüßen und schütterem Haar geleitete sie an einen Tisch. Er hatte eine fettige Serviette über dem Arm. Orvil betrachtete ihn wie ein Fossil im Museum. Er wollte nicht daran denken, daß es ein Mensch war, sonst hätte ihm das Essen nicht mehr geschmeckt. Etwas unendlich Unglückliches quoll aus dem Kellner in Wellen heraus, und Orvil stemmte sich dagegen und versuchte, sich auf die Speisekarte zu konzentrieren.
Ben ließ sich ein Bier bringen. Eigentlich hätte er lieber einen Whisky Soda getrunken, doch er sagte sich, daß das für einen Jungen von siebzehn Jahren dumm und anmaßend wäre. Er hatte einen ausgeprägten Sinn für das, was sich schickte, und daran hielt er sich eisern.
Nach dem Essen gingen sie hinaus zum Wagen. Orvil setzte sich nach vorn zum Chauffeur, der sehr mürrisch und verärgert war. »Aber wollen Sie denn nicht auch das ›Tattoo‹ sehen?«, fragte er, um ihn ein bißchen aufzutauen.
»Alles schön und gut, aber ich hatte etwas anderes vor«, sagte der Chauffeur mit wichtiger Miene. Er hatte bisher jeden Abend freigehabt, um in den Pubs zu trinken und Frauen aufzugabeln. Auf diese liebe Gewohnheit mußte er nun verzichten und trauerte seiner verlorenen Freiheit nach. Den Frauen von Salisbury würde es an diesem Abend versagt bleiben, seine Bekanntschaft zu machen, es sei denn, er konnte beim ›Tattoo‹ eine finden. Nun, vielleicht würde er Glück haben. Er stellte sich vor, mit ihr im Gras zu liegen und die nassen Halme unter den Händen zu spüren und sein verschwitztes Gesicht darin zu kühlen.
Orvil sah ihn von der Seite an und dachte an die Mädchen in Liebesromanen, die mit dem Chauffeur ihres Vaters durchbrannten. Er konnte verstehen, was daran so reizvoll war. Es hatte nicht soviel mit dem Chauffeur selbst zu tun (dieser hier zumindest war fleischig und rosig wie ein Schwein) – nein, es war der Rausch der Geschwindigkeit; die Uniform, die einem das Gefühl gab, von einem mysteriösen Offizier einer fremden Armee entführt zu werden; das Abenteuer, mit einem Mann allein zu sein wie auf einer einsamen Insel; und das berauschende Gefühl, einem langweiligen behüteten Leben zu entrinnen.
Der Wagen hielt, und sie mußten eine Weile im Dunkeln durch morastiges Gelände irren, bis sie die Zuschauertribüne erreichten und ihre Plätze einnehmen konnten.
Das Tattoo hatte noch nicht begonnen. Nur ein einziger Scheinwerfer war eingeschaltet, und in seinem Lichtkegel stand ein korpulenter Mann, der die Zuschauer zum Singen animierte. Er ruderte mit den Armen, und der Schweiß lief ihm über das Gesicht. Aus der großen Menschenmenge kam nur ein schwaches Echo. Der Mann verausgabte sich, als sei er von Sinnen, und wenn er den Oberkörper zurückbeugte, quoll sein Bauch so stark hervor, daß es aussah, als werde er gleich platzen. Orvil stellte sich vor, wie ihm die dampfenden Eingeweide heraushängen würden, und er erschauerte bei dem Gedanken an den scheußlichen roten Fleck, der sich auf Hemd und Hose des ganz in Weiß gekleideten Mannes ausbreiten würde. Der Bauch schwang wie eine riesige pralle Schweinsblase bedenklich hin und her. Der Mann hatte sich das Hemd fast bis zum Nabel aufgeknöpft, und die schwabbeligen Fettwülste um die Brustwarzen hüpften auf und nieder wie die Brüste eines jungen Mädchens. Wenn der Mann eine ausholende Bewegung mit den Armen machte und das Hemd weit auseinanderklaffte, konnte Orvil sie deutlich sehen. Wie zwei Portionen Pudding oder Götterspeise, die plötzlich lebendig wurden. Orvil fand den Anblick so lustig und grotesk, daß er fast herausgelacht hätte.
Jetzt ertönten dumpfe Trommelschläge, und der Gesang brach ab. Scheinwerfer gingen an und leuchteten eine Ecke des großen Platzes aus.
Zuerst konnte Orvil nichts erkennen, doch dann sah er aus der Dunkelheit eine weiße Ziege auftauchen. Sie bekam in den Strahlen der Scheinwerfer eine gespenstisch grünliche Färbung, und hinter ihrer winzigen Gestalt wogte ein gewaltiger Aufmarsch von Musikzügen heran.
Orvil fand, daß er selten ein so überwältigendes Schauspiel gesehen hatte. Er konnte sich nicht sattsehen an den stattlichen Tambourmajoren, die ihre silberglänzenden Stäbe in die Luft warfen, und an den Gladiator-Gestalten in Leopardenfellen mit ihren umgehängten Baßtrommeln, die so groß wie Wagenräder waren. Der Marschtritt und die rhythmischen Klänge brandeten über den weiten Platz heran. Es war ein berauschendes Erlebnis. Vorneweg trippelte diese gespenstische kleine Ziege, deren weiße Mähne im Winde wehte, und Hunderte von Männern in protzigen scharlachroten Uniformen mit goldenen Tressen und Pelzmützen schritten folgsam hinter ihr her.
Beim Anblick dieses Schauspiels mußte Orvil unwillkürlich an die üblen Witze denken, die sich die Jungs im Internat so oft mit Ziegen leisteten. Immer wieder dachten sie sich groteske Vorfälle aus, in denen es um Ziegen ging. Und jetzt stellte er sich plötzlich vor, die Ziege auf dem großen Platz werde von dem ganzen Regiment schändlich mißbraucht – sie waren alle verrückt geworden, sie schändeten ihr Maskottchen und würden es zertrampeln, bis es tot am Boden lag.
»Nicht daran denken, nicht daran denken«, sagte er sich verzweifelt, doch es gelang ihm nur mit Mühe, sich wieder auf die wirkliche Szene vor seinen Augen zu konzentrieren.
Die Musikzüge marschierten jetzt aus dem Lichtkegel. Abrupt schwangen die Scheinwerfer herum und illuminierten die andere Seite des Platzes. Man sah eine schlammfarbene Stadtmauer mit Tor. Seltsame Gestalten in arabischen Gewändern ließen sich von der Mauer fallen, als seien sie von Kugeln getroffen worden. Andere versuchten einen Ausbruch, doch auch sie fielen bald um und wälzten sich schreiend am Boden. Die britischen Truppen mit ihren viktorianischen Helmen rückten unaufhaltsam vor. Weiße Rauchwölkchen aus ihren Flinten hingen wie kleine Wattebäusche in der Luft. Die Sieger stießen Schlachtrufe aus und johlten. Die Besiegten krochen im Staub und winselten um Gnade.
Als alles vorüber war und sie Ben in der Nähe seines Lagers abgesetzt hatten, wandte sich Orvil an den Chauffeur.
»Wie hat es Ihnen gefallen?«, fragte er.
»Danke, wirklich sehr gut«, kam die glatte höfliche Antwort.
Orvil betrachtete das grobe Profil des Chauffeurs. Dieser schien jetzt wieder ganz zufrieden zu sein, und nach einer Weile sagte er in scherzhaftem Ton: »Also diese kleine Ziege sah wirklich niedlich aus, Mister Orvil.« Das ›Mister‹ überraschte Orvil. Der Chauffeur hielt es mehr mit demokratischen Umgangsformen, und wenn er schlechtgelaunt war, unterließ er es sogar recht oft, Mr. Pym mit ›Sir‹ anzureden.
Schweigend saß Orvil neben ihm, schon ganz in Gedanken an den nächsten Tag und ihre Ankunft in dem Hotel, wo sie den Rest der Ferien verbringen sollten.