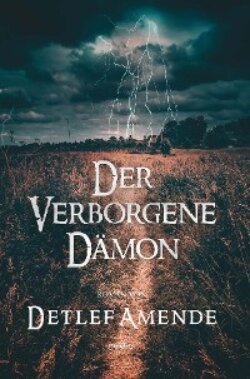Читать книгу Der verborgene Dämon - Detlef Amende - Страница 6
CHANCEN
ОглавлениеAlles schien wie immer, und nur wenige Wissenschaftler und Spezialisten schrieben in internen Berichten von einigen rätselhaften Beobachtungen. In Nordamerika hatte bei Gewittern die Anzahl der Blitze stark zugenommen und in manchen afrikanischen Küstenstädten standen plötzlich überall riesengroße schmutzige Pfützen in den Straßen. In Bolivien war Anfang des Jahres 2016 der zweitgrößte See des Landes, der Lago Poopó, merkwürdigerweise ausgetrocknet. Monatelang herrschte akute Wasserknappheit in vielen großen Städten des Landes. Aber sonst ging alles seinen Gang.
Bei uns Zuhause spürte man davon offenbar nichts. Wie die meisten Menschen in Europa machten sich meine Eltern über solche Dinge keine Gedanken. Beide waren verbeamtet, hatten ein Niedrig-Energie-Haus gebaut, trennten gewissenhaft und ordentlich den Hausmüll und brauchten die Zukunft nicht fürchten. So sah die Welt aus, als ich laufen lernte und die Windeln hinter mir ließ. In meinen frühesten Kindheitserinnerungen sehe ich mich noch inmitten einer unübersichtlichen Menge Steckbausteine knien, mit denen ich höchst interessante Konstruktionen erschuf. Papa thronte in einiger Entfernung mit übereinandergeschlagenen Beinen auf dem Sessel der Couchgarnitur und las Zeitung, Mama hörte ich aus Richtung des in der offenen Küche platzierten und wegen seiner Lautstärke durchaus furchteinflößenden Kaffeeautomaten über die auf allen Kanälen ins Unendliche anwachsende Werbung schimpfen. Man hat wohl in dieser Zeit, in der Informationsüberschuss chic und zur Mode geworden war, die Welt mit Unwichtigem geflutet, um wichtiges - wo gewollt - gezielt untergehen lassen zu können. So war es offenbar auch Opa ergangen. Er hatte eine Berechnung angestellt, die die wichtigsten Faktoren berücksichtigte. Auf diese Art und Weise war er trotz der positiven Annahme, dass im Jahr 2100 mehr als die Hälfte aller Primärenergie aus CO2-neutralen Quellen stammen werde, zu einem wahrscheinlichen Temperaturanstieg von mehr als sieben Grad im Verhältnis zum Anfang des Jahrhunderts gekommen. Aber seine Botschaft hatte niemanden interessiert.
Ich wurde zu einer Zeit eingeschult, in der nach Öffnung der türkischen Grenze Richtung Balkan die zweite größere Flüchtlingswelle Mitteleuropa erreichte. Uns Erstklässler betraf dies aber nur dadurch, dass eines Tages mehrere, eher fremdartig aussehende und aus dunklen Augen ängstlich um sich schauende Neulinge, einige Jungen und mehrere Mädchen die Klassengruppe verstärkten. Aber es machte Spaß, mit ihnen zu spielen und zu toben – nur sprechen wollten die mit uns nicht so viel. Erst als die Lehrerin allen erklärte, dass die Neuen einfach unsere Sprache nicht kannten, haben wir verstanden, warum die untereinander immer so ein komisches Kauderwelsch redeten. Erst viele Monate später, als sie schon ein bisschen Deutsch konnten, haben sie uns erklärt, dass sie aus einem Land kämen, wo Flugzeuge alle Häuser kaputt gebombt und fremde Männer mit schwarzen Tüchern um den Kopf und schwarzen Fahnen ihren Müttern, Vätern oder den Geschwistern die Köpfe abgeschnitten hätten. Ungläubig lachten wir, dann weinten ein paar von ihnen und andere fingen an, sich wütend mit uns zu prügeln. Nachdem die Klassenlehrerin, eine kleine zierliche, aber energische Frau, das mitbekam, zeigte sie uns im Unterricht ausgewählte Fotos von schier endlosen Trümmerlandschaften und erklärte: Das waren einmal bunte Städte, in denen Kinder wie ihr gespielt und gelernt haben. Die Väter und Mütter sind jetzt tot. Vielleicht erschien ihr selbst das im Nachhinein zu hart, aber diese Konfrontation erzeugte Gefühle. Und sie lehrte uns, dass es außerhalb der für uns so friedlichen und glücklichen Erlebniswelt noch viele andere Regionen auf der Erde gab, in denen statt dessen Krieg, Hunger, Armut, Not und Krankheit zu den Selbstverständlichkeiten zählten. So standen uns Hiesigen die Tränen in den Augen und wir lernten, dass wir den Neulingen Respekt entgegenzubringen hatten und ihnen würden helfen müssen. Das wollten wir dann auch wirklich und so wuchs langsam etwas Vertrauen zwischen uns. Sie erzählten mehr von ihrer ehemaligen Heimat und davon, wie Kämpfer aus verschiedenen anderen Ländern sich dort gegenseitig ermordet haben. Aber obwohl sich die Lehrerin Mühe gab, einiges auf kindgerechte Art verständlich zu erläutern, wollten wir von Krieg nichts wissen. Natürlich nicht. Krieg passt nicht in die Köpfe von Kindern. Nur in die von skrupellosen Erwachsenen. Und so drehte sich unsere Welt einfach weiter. Wir lernten neue Zahlen und Buchstaben, ohne etwas von den Ereignissen zu ahnen, die sich in fernen Teilen der Welt anbahnten.
Auch ein Jahr danach bekam ich als wohlbehütet aufwachsendes Kind von diesen politischen Geschehnissen nicht viel mit. Erst viel später als Jugendlicher hat mir Vater mal erzählt, dass das Eingeständnis von 2020 eine Zäsur von Weltbedeutung gewesen sein musste: Damals hatte die UN zugeben müssen, dass hinsichtlich der Senkung der CO2-Emissionen bis dato nichts, aber auch gar nichts erreicht worden war. Alle Bemühungen, den Anteil erneuerbarer Energien zu erhöhen, zunehmend auf Kohlekraftwerke zu verzichten, insgesamt weniger Energie zu verbrauchen, hatten die jährlichen Emissionsmengen an Kohlendioxid nicht reduzieren können. Die internationale Zusammenarbeit an diesem Thema ließ daraufhin nach, viele Staaten zogen nun mehr und mehr nationale Alleingänge vor. An meiner Schule zuckten die Lehrer nur ratlos mit den Schultern, wenn sie sich darüber unterhielten. Für viele Menschen mit erhalten gebliebenem gesellschaftlichem Gewissen und Problembewusstsein war das ein Schock. Alles vergebens? Wirklich alles umsonst? Selbst unter Umweltaktivisten breitete sich Resignation aus. Die virtuelle Gemeinde der an Nachhaltigkeit und Ökologie Interessierten zerfiel. Kernkraftgegner mutierten zu Kernkraftbefürwortern, andere gaben auf oder wandten sich in spirituellem Frohlocken der neu entstandenen Sekte der „Lichtmenschen“ zu. Aber all das spielte für einen Zweitklässler keine Rolle. Ich interessierte mich vielmehr für Papas neuen Globus. Eine riesengroße Kugel, die wunderschön leuchten konnte, war mit feinsten Linien und Buchstaben bemalt. Ich wusste schon, dass sie unsere Erde darstellt mit all den fernen Ländern, Meeren und Gebirgen. Sie drehte sich in einem Halbkreis, der auf dem wuchtigen Sockel komischerweise etwas schräg befestigt war. In einem Display konnte man Namen von Flüssen oder Städten eingeben und dann leuchtete die jeweils richtige Stelle. Papa nahm sich viel Zeit, mir auf dem Globus Länder, Gebirge und Flüsse zu zeigen. Da gab es unseren Heimat-Kontinent Europa. Fast auf der anderen Seite lag Nordamerika mit den USA, die mit den übrigen Ländern nichts mehr zu tun haben wollten. Noch eine halbe Umdrehung weiter umfuhr Papa mit dem Zeigefinger eine große Fläche. Das war Russland, das in der Raumfahrt und im Cyberwar unbedingt die Macht haben wollte. Darunter zeigte er mir, wo die großen chinesischen Ballungsgebiete liegen, in denen jährlich Millionen Menschen nur an den Folgen der Luftverschmutzung starben. Anschließend drehte Papa die Kugel wieder etwas zurück und legt den Finger auf den Mittleren Osten. Hier bekriegten sich immer noch die Länder Iran und Saudi-Arabien. Ohne mit meinen knapp acht Jahren viel davon zu verstehen, erzählte Papa noch, dass Russland sich in der Zwischenzeit aus dem Konflikt in Syrien zurückgezogen hat. Das bewog im Frühjahr 2022 die USA, in einer Blitz-Intervention große Teile des ehemaligen Syriens zu besetzen und diesen Staat kurzerhand zu einem amerikanischen Protektorat zu erklären. Kurz nach dessen Ausrufung wurden die USA von den schlimmsten Busch- und Waldbränden der jüngeren Geschichte heimgesucht. Zwölftausend Quadratkilometer südkalifornischer Fläche standen rund um Los Angeles in Flammen. Die Behörden sahen sich veranlasst, zehn Prozent des Stadtgebietes zu evakuieren. Für zirka dreihundertachtzigtausend Menschen mussten in entfernten Gebieten Notunterkünfte gebaut, die dazugehörigen Versorgungsverbindungen etabliert sowie die Umsiedlungsmaßnahmen durchgesetzt werden. Die Kosten des Löscheinsatzes, der Umsiedlungsaktion und der wirtschaftlichen Folgen hatten Kalifornien und damit die gesamte USA fast an den Rand einer Wirtschaftskrise gebracht. Viele Amerikaner sprachen damals von Sabotage oder Brandstiftung durch die Chinesen oder Russen. Diesmal wollte Papa, dass ich die geographischen Orte, an denen die großen Feuer brannten, selber auf dem Globus finde. Ich suchte lange nach Kalifornien und fand sogar Australien. Auch dort brachen etwa zum gleichen Zeitpunkt durch lang anhaltende Trockenheit nördlich der Millionenstadt Sidney großflächige Buschbrände aus. Hohe Temperaturen und starke Winde hatten dafür gesorgt, dass die Feuer sich soweit ausbreiteten, dass sie mit den zur Verfügung stehenden Löschmitteln nicht mehr bekämpft werden konnten. Die Konsequenzen für die Landwirtschaft waren unüberschaubar. Australien musste in der Folge Unmengen an Lebensmitteln importieren und rutschte so in eine fatale Staatsüberschuldung. Das Land wurde mit dem Problem allein gelassen und musste hilflos zusehen, bis sich das Inferno von selbst aufgezehrt hatte.
Einige Monate später, als ich mich auf die dritte Klasse freute, wurde Mitteleuropa von einer Hitzewelle geplagt. Ich kann mich noch an die heißen Sommermonate erinnern. Meine schulischen Leistungen waren in dieser Zeit ganz ansehnlich, weil der Umgang mit den kryptischen Symbolen des Alphabets und der Algebra mir eine Menge Spaß bereitete. So musste ich nicht allzu viel meiner nachmittäglichen Freizeit in die Erledigung von Hausaufgaben und Übungen investieren, sondern trieb mich stattdessen häufig irgendwo draußen herum. Die glücklichen Ferienwochen verbrachten meine Kumpels und ich – darunter auch einige von den Neuen – oft ganztägig im Schwimmbad, wir unternahmen Fahrradtouren oder stundenlange Exkursionen in das von unserem Haus nicht weit entfernte Waldstück, wo sich das dichte Unterholz mit ein wenig Geschick in kaum zu entdeckende Geheimquartiere umfunktionieren ließ. Uns Kindern haben die extremen Temperaturen offensichtlich kaum zugesetzt. Aber ich kann mich auch erinnern, dass viele Leute gestöhnt und gejammert haben. Mehr als zehn Wochen lang herrschten damals Tagestemperaturen von über fünfundvierzig Grad und nachts kühlte die Luft sich nicht mehr unter fünfundzwanzig Grad ab. Wir hörten oft das Martinshorn der Rettungswagen und die Eltern erzählten mir später, dass in diesen Monaten in ganz Europa Zehntausende älterer oder kranker Menschen an Schwäche gestorben sind. Versorgungsengpässe müssen den Leuten das Leben schwer gemacht haben, zum Beispiel bei den begehrten Kühlaggregaten, die dann nicht mehr frei gekauft werden durften, sondern nur für Krankenhäuser und die öffentliche Verwaltung reserviert worden sind. Und trotz der Proteste, die allein dieser Umstand auslöste, stiegen zudem auch noch die Preise, was zu berechtigtem Unmut in der Bevölkerung führte. Viele Leute wollten das nicht mehr hinnehmen und gaben sich der angeblich „selbstbefreienden“ Lebensweise hin. Sie sahen ihr Heil in der schon zuvor entstandenen Sekte der „Lichtmenschen“, die mit ihrem neuen Zentrum in den USA in dieser Zeit einen Zulauf von Millionen Begeisterten verbuchte.
Zu meinem zehnten Geburtstag schenkte Opa mir die dicke, von einem gewaltigen Einweckgummi zusammengehaltene Mappe voller Berechnungen mit den Worten: Leon, bewahre dieses Geschenk gut auf. Auch wenn du das noch nicht verstehst, du wirst die Niederschriften irgendwann gebrauchen können! Seinen bedeutungsvollen Blick habe ich bis heute nicht vergessen. Dennoch vertraute ich den Packen Unterlagen dann ohne größeres Verlustgefühl meinem Papa an, war aber mächtig stolz, nunmehr Besitzer irgendeines, wie auch immer gearteten Schatzes geworden zu sein. Und als „Schatzbesitzer“ kann man seine Kinderzeit genießen, obwohl auch für unsere Familie damals die Lebenshaltungskosten immens gestiegen sein mussten. Ich bekam das mit, weil sich die Eltern um die Bezahlung meiner Schulbücher für die vierte Klasse zankten. Doch meistens versuchten sie, die Sorge um ihren Schützling vor mir zu verbergen, so gut sie konnten. Außer bei dem Netz, das sie über meinem Bett anbrachten und das ich so über alle Maßen scheußlich wie unnötig fand. Ich bin doch kein Mädchen, das einen Schleier über der Bettdecke haben möchte! Aber diese Maßnahme müsse sein, hatte Mama gesagt und Papa verbot mir mit aller Strenge, drüben noch einmal in den Wald zu gehen. Was ist los? Nein, ich hätte nichts Falsches getan und das wäre um Gottes willen auch keine Strafe. Zur Schule musste ich neuerdings auch bei warmem Wetter nur noch mit langärmeliger und langbeiniger Kleidung gehen und befürchtete, dafür von den Anderen voll „gedisst“ zu werden. Komisch war nur, dass es vielen meiner Schulkameraden ähnlich ging. Die trugen plötzlich auch so voll uncoole Klamotten und dann lachten wir uns alle gegenseitig aus. Aber das Lachen verging uns, als eines Morgens unsere Klassenlehrerin und der Schuldirektor mit ernsten Gesichtern den Klassenraum betraten und uns bekannt gaben, dass Elvira S., wir nannten sie immer Elvis, nicht mehr in unsere Schule käme. Elvis war schon seit über einer Woche nicht mehr zum Unterricht gekommen und jetzt sagte die Klassenlehrerin, sie hätte mit einer schlimmen Krankheit im Krankenhaus gelegen. Wir waren alle tief betroffen und fragten nach. Der Direx erklärte, dass seit mehreren Wochen in Deutschland die asiatische Buschmücke gehäuft aufgetreten ist, sich nun mit hoher Geschwindigkeit vermehrt und weiter schnell ausbreitet. Diese Mückenart überträgt das Virus des sogenannten Dengue-Fiebers, an dem man sterben kann. Und Elvis war von solch einer Mücke gestochen worden. Da niemand mit diesem Krankheitsbild rechnete, obwohl - was wir Kinder nicht wussten - das Robert-Koch-Institut Monate zuvor eine bundesweite Warnung herausgegeben hatte, war Elvis falsch behandelt worden und ist dann an den Folgen des Mückenstiches erkrankt. Wir sollten sie nicht mehr wieder sehen … Doch nun ging die Angst um an der Schule. Freiwillig setzten die meisten Schüler auch an anderen Schulen und auch in den höheren Klassen schon im September die Kapuzen ihrer Anoraks auf. Unsere Blicke streiften jeden Morgen vor Unterrichtsbeginn alle Wände des Klassenraums, ob sich nicht eines von diesen „Aliens“ auf die Lauer gelegt hätte und gnadenlos zu töten wäre. Jedenfalls waren wir Schüler aufgefordert worden, unsere Augen offen zu halten und jeden noch so kleinen Vorfall sofort zu melden. So war auch meine Aufmerksamkeit in diesen Herbstwochen des Jahres 2024 – außer immer noch auf das Lernen – hauptsächlich auf die unmittelbare Umgebung gerichtet und ich bekam nur am Rande oder über Gesprächsfetzen meiner Eltern mit, was sich draußen in der großen weiten Welt so alles abspielte.
Schon im Frühjahr war auf vormals irakischem Gebiet das wahhabitische Kalifat ausgerufen und in den nördlichen Restgebieten der Region das freie Kurdistan gegründet worden. Das Nebeneinander des Kalifats mit dem amerikanischen Protektorat verlief seltsamerweise recht konfliktfrei und der Handel entwickelte sich prächtig. Warum Russland diese Konstellation hinnahm, stiftete in der Welt zwar Verwunderung, aber dieses Wohlwollen hatte seine Gründe, wie sich einige Jahre später herausstellen sollte. Europa wusste wieder einmal nicht, wie auf diese unklare Gemengelage zu reagieren sei und verfiel erneut in einen tiefen Streit über das weitere Vorgehen zur Sicherung der eigenen Energiebasis. Im Ergebnis dieser verbittert geführten Auseinandersetzung riefen Polen, Ungarn, die Slowakei und Österreich gemeinsam den Artikel fünfzig des EU-Vertrages auf und traten aus der Europäischen Gemeinschaft aus. Interessanterweise hatte dies lediglich eine Entspannung des Brüsseler Haushaltes nach sich gezogen und blieb zunächst ohne direkte politische Folgen.
Im Jahr danach wurde die „Lichtsekte“ immer mächtiger. Sie umfasste bald mehr als fünfhundert Millionen Mitglieder und war mittlerweile von Teilen der Scientology-Bewegung unterwandert worden. In einem Akt der Verzweiflung hatten sich nach langwierigen Geheimverhandlungen der Papst, der oberste islamische Gelehrte der Universität Kairo, die orthodoxen Patriarchen und israelischen Oberrabbiner auf eine gemeinsame Position geeinigt und zusammen mit der evangelischen und anglikanischen Kirche die Grundsatzerklärung ‚Kehret um‘ veröffentlicht. Darin wurden die Menschen inständig dazu aufgerufen und ermutigt, auf den Pfad der Tugend und der Vernunft zurückzukehren und sich der Bewältigung der Gegenwartsprobleme zuzuwenden, anstatt irrationalen Heilsversprechen zu folgen. Dem schlossen sich der iranische Wächterrat, die Führung der kommunistischen Partei Chinas sowie die Staaten Tadschikistan, Finnland, Uruguay und Gambia an. Trotz aller medialen Aufmerksamkeit, die das Papier weltweit erlangte, half aber auch dieser Versuch nichts mehr. Das geschätzte Vermögen der „Lichtsekte“ war im Jahr 2025 auf über achthundert Milliarden Dollar angewachsen und ermöglichte deren grauen Eminenzen, massiv Einfluss auf die anstehende US-Präsidentschaftswahl auszuüben. So wunderten sich nur wenige, dass dieses Mal ein religiöser Fanatiker in das Amt des bis dahin mächtigsten Politikers der Welt gehoben wurde. Eine seiner ersten Amtshandlungen bestand darin, die immer noch in Streit stehenden Spratly-Inseln im Südchinesischen Meer in einer Nacht- und Nebelaktion militärisch zu besetzen, um auf das zwei Jahre zuvor erlassene Exportverbot Chinas für seine einheimischen Waren zu reagieren. Die Bedeutung all dessen konnte ich selbst als Sechstklässler nicht annähernd einschätzen. Mama und Papa hatten tagelang nur noch Nachrichten verfolgt, wenn sie nicht auf Arbeit oder zum Einkaufen waren und entsprechend besorgte Mienen aufgesetzt. Ich sprang auch ganz aufgeregt umher und natürlich fragte ich, was denn los sei und wie das alles zusammenhänge. Sie erklärten alles geduldig, aber vieles – insbesondere die Hintergründe der akuten Gefahr – blieben mir schleierhaft. Wann würden die Chinesen zurückschlagen? Das kann nicht gut gehen. Würden sie Amerika mit Atomwaffen angreifen? Aber China griff trotz der Versetzung seiner Streitkräfte in den höchsten Alarmzustand und der Anordnung der Generalmobilmachung nicht ein, sondern brach stattdessen wenige Tage später die diplomatischen Beziehungen zu den USA vollständig ab. Deren Ansehen in der Welt war durch diese Aktion endgültig ins Bodenlose gerutscht. Die britischen und französischen Abfangjäger, die – ebenfalls mit Atomwaffen bestückt – mit schon laufenden Motoren in den europäischen Hangars bereitgestanden hatten, wurden wieder geparkt und unter ihren Planen versteckt. Man atmete auf und auch ich atmete mehrfach gut hörbar durch, obwohl ich nichts verstanden hatte. Nur die Bilder der zerstörten Städte in Syrien kamen mir erneut in Erinnerung.
Und dann wurde es Zeit, sich einer anderen Großwetterlage zuzuwenden, denn „Silke“ kam. Das Tiefdruckgebiet mit dem sympathischen Namen braute sich in den Wochen, in denen alle Aufmerksamkeit auf das Südchinesische Meer gerichtet war, fast unbemerkt über dem Atlantik zusammen. Durch das warme Ozeanwasser konnte das Tief Unmengen an Energie aufnehmen und war völlig unerwartet binnen weniger Stunden nach Osten bis an die europäische Westküste herangezogen. Am Abend zuvor flimmerten die eindringlichen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes und die Aufforderung der Bundesregierung, die Bevölkerung solle zuhause zu bleiben und sich schützen, über die Mattscheibe. Den Eltern wurde angst und bange. Ich dagegen freute mich diebisch über einen schulfreien Tag und war gespannt, was passieren würde. Morgens gegen acht – tatsächlich wehte bereits ein sehr kräftiger Wind – fuhr Papa in den Baumarkt, um einige Holzbohlen zu kaufen, mit denen er die großflächigen Fenster unseres Hauses zu sichern gedachte. Aber es war nichts mehr zu holen. Er versuchte sein Glück in einem weiteren Baumarkt, aber hier hatten die Leute bereits in den Nachtstunden die verschlossenen Türen mit Gewalt aufgebrochen und den ganzen Laden gestürmt und ausgeräumt. Entnervt und wütend wegen der Verkehrsstaus in der Stadt und der Vergeblichkeit seiner Bemühungen kam er erst am späten Vormittag zurück. Derweil herrschte richtiger Sturm mit extremen Windstößen und uns blieb nur, die Gartenmöbel zu sichern und mit ein paar zusätzlichen Schrauben den Carport zu verstärken. Überall in der Nachbarschaft rannten die Leute mit zerzausten Frisuren umher, trugen irgendwelche Gerätschaften beiseite oder werkelten wie besessen an ihrem Hab und Gut. Gegen Mittag verdunkelten sich die Wolken immer mehr und die Orkanböen wurden unberechenbar. Unter verwehten Haaren und Klamotten zog Mama unterdessen mit letzter Kraft ein Fahrrad und einen alten Blumentopf ins Haus. Die Leute ringsum waren plötzlich alle verschwunden und schon flog mit einem großen Knall die Haustür ins Schloss. Papa rief mich. Alle im Haus? Gut. Der Himmel war mittlerweile fast schwarz. Überall begann ein bedrohliches, lautes Pfeifen. Einige Minuten später waren von draußen ohrenbetäubende Geräusche und mehrere gewaltige Schläge zu hören. Mir wurde die ganze Sache jetzt unheimlich. Papa rannte zum Fenster und ich behände hinterher. Dachziegeln waren auf die Terrasse gestürzt. Im gleichen Moment löste sich eines der recht undurchlässigen Zaunfelder an der Grundstücksgrenze aus seiner Verankerung, kam auf uns zu geflogen, krachte mit brachialer Gewalt genau neben dem Fenster, hinter dem wir standen, gegen die Hauswand. Das ohrenbetäubende Zerbersten und Kratzen war selbst bei dem mittlerweile heulenden Orkan zu vernehmen. Glück gehabt! Papa lief zum anderen Fenster und wurde blass. Das Auto stand schräg, schaukelte gewaltig hin und her und hatte etliche Kratzer und Beulen, in der Einfahrt polterte ein Haufen Müll umher und – das Dach vom Carport fehlte. Wahrscheinlich flatterten seine Reste zerborsten auf einem Nachbargrundstück oder auf der Straße herum. Der Orkan wurde immer stärker. Wieder rannte Papa, diesmal zum Notausschalter der Heizungs- und Elektroanlage. Draußen flog in etwa einem Meter Höhe ein Kinderwagen die Straße entlang, Mama schlug die Hände vors Gesicht. Panik übermannte mich. Ich flitzte die Treppe hinauf ins Kinderzimmer. Niemand sollte mein Zittern bemerken. Ich hatte kein Zeitgefühl mehr. Und dann setzte plötzlich Stille ein. Ich lauschte auf, wartete einen Moment angespannt und hörte dann Mama rufen. Okay. Schon kam sie die Treppe herauf und beruhigte mich. Sie und Papa hatten zuvor unendliche Minuten lang unter Aufbietung ihrer ganzen Kräfte die aus den Scharnieren gesprungene Terrassentür in ihrem Rahmen gehalten. Wenn der Sturm ins Haus gedrungen wäre, hätte er vermutlich etliche Fenster nach außen gedrückt und große Teile der Inneneinrichtung in Kleinholz verwandelt. Es war vorbei. Langsam kehrte das Tageslicht zurück, aber unsere Umgebung blieb gespenstisch leise. Ich ging mit Mama hinunter, um zu inspizieren, was hier alles zu Bruch gegangen war. Die Eltern setzten sich erstmal kurz an den Esstisch und atmeten durch. Papa hatte die lose Terrassentür mittlerweile an die Wand gelehnt und durch die Türöffnung hörte man, dass draußen zwar immer noch der Wind rauschte, aber keine Gegenstände mehr durch die Luft polterten. So plötzlich der Orkan gekommen war, so plötzlich war er wieder verschwunden. Wir schauten uns um. Im Haus war bis auf die Türscharniere an der Glaswand zur Terrasse nichts weiter kaputt gegangen, aber vor dem Haus und im Garten ruhte friedlich und unbewegt das Chaos aus Geröll, fremden Gerätschaften, Holzplanken, zerschlagenen Blumenkübeln und Resten von Dachziegeln. Papa meinte, das kriegen wir schon wieder hin. Aber das zerschrammte Auto und den Rest vom Carport musternd, schien Mama zu resignieren. Werden wir so viel Geld für all die Reparaturen aufbringen können? Erst am späten Nachmittag kamen dann auch die Nachbarn langsam wieder aus ihren Häusern. Die Straße belebte sich etwas, aber die Leute waren noch immer außer sich. Dabei sollte dies noch nicht alles gewesen sein, denn als Papa den Strom einschalten wollte, tat sich nichts. Noch einmal. Nein. Noch mal. Wieder nichts. Da erst wurde meinen Eltern bewusst, in welcher Lage wir uns befanden. Mama rannte in die Küche und öffnete den Wasserhahn an der Spüle. Wasser kam, die Erleichterung war förmlich greifbar. Wir hatten wenigstens etwas zu trinken und die Toiletten konnten benutzt werden. Dann beratschlagten sich Mama und Papa ausgiebig. Ich war immer noch aufgeregt, wollte auch mit helfen, konnte aber im Moment nicht viel tun. Bis zum Abend musste erstmal die Terrassentür wieder befestigt werden, um im Haus sicher zu sein. Der Strom könne jetzt tagelang wegbleiben, gab Papa zu bedenken und erwähnte, dass der Tank im Auto noch zu ungefähr einem Drittel gefüllt sei. Ohne Strom kein Kochen, kein Kaffee, kein Fernsehen, kein Radio, keine Information, kein Geld am Bankautomaten, aber auch kein Tanken, denn an den Tankstellen würden die Pumpen nicht mehr arbeiten. Wir versuchten, herauszufinden, ob die Versorgung mit Elektrizität sogar großflächig ausgefallen war. Dann würde auch die Versorgung mit Lebensmitteln in den Supermärkten nicht mehr reibungslos funktionieren und Tumulte und Plünderungen könnten entstehen. Mama prüfte die Vorräte in Kühlschrank und Gefrierfach – leider nicht sehr ergiebig, meinte sie. In der Zwischenzeit war Papa im Wohnzimmer dabei, einige Schrankfächer nach Batterien zu durchwühlen. Jetzt konnte ich helfen und brachte flugs aus meinem Kinderzimmer den kleinen Radiowecker, den ich vergangenes Jahr von Oma zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte. Er wurde unsere einzige zuverlässige Informationsquelle, denn unter den Leuten in der Nachbarschaft kreisten mittlerweile die wildesten Gerüchte. Jemand hatte erzählt, die Bundeswehr käme, ein anderer meinte, bis auch das Wasser wegbliebe, wäre nur eine Frage von wenigen Augenblicken. Die Batterien aus dem Wohnzimmerschrank gaben noch etwas her und so warteten wir auf die volle Stunde, um gemeinsam vor dem kleinen Radio die Nachrichten zu hören. Tief „Silke“ war von der französischen Atlantikküste aus nach Ostnordost gezogen und hatte dabei in ganz Mitteleuropa eine breite Spur der Verwüstung hinterlassen. In Frankreich, den Beneluxstaaten und in Deutschland waren weite Teile der Infrastruktur in Mitleidenschaft gezogen worden. Müde gingen wir zu Bett, konnten aber alle nicht so richtig schlafen. Immer wieder waren von der Straße laute Rufe und aus der Ferne die Sirenen der Rettungswagen und Polizeiautos zu hören. Noch während der Nacht richtete der Orkan schwere Schäden an der polnischen Ostseeküste an.
Am anderen Morgen saßen wir schon recht zeitig gemeinsam am Frühstückstisch, aßen weiches Toastbrot und tranken Wasser. Immerhin. Papa schaltete noch mal mein Radio ein und wir bekamen durch die inzwischen ununterbrochene Berichterstattung mit, dass die Stromversorgung wohl im Verlauf des darauf folgenden Tages wieder sichergestellt werden könnte. Ich fragte, was denn mit der Schule sei. Mama lachte und meinte, die nächsten Tage könne ich getrost zuhause bleiben. Papa räumte die Einfahrt frei und brachte unseren Kombi wieder zum Laufen. Garten und Terrasse sahen zwar immer noch aus wie eine große Müllhalde, aber wir konnten wenigstens losfahren und versuchen, in irgendeinem Supermarkt etwas zu Essen aufzutreiben. In unserem Wohngebiet hatten einige Anwohner schmalere Straßen schon wieder grob vom Unrat befreit, dennoch mussten wir zweimal umkehren und einen anderen Weg Richtung Innenstadt suchen. Am Lebensmittel-Discounter angekommen, sahen wir etliche dunkelgrüne Mannschaftswagen. Die Polizisten waren mächtig bewaffnet, standen überall auf dem Parkplatz und am Eingang und sorgten dafür, dass die Leute diszipliniert blieben. Wir bekamen Brot, Mineralwasser, Zucker, Margarine, Nudeln und sogar etwas Wurst und brauchten nicht einmal dafür bezahlen. Ich unterbreitete Papa den Vorschlag, noch zu einem anderen Supermarkt zu fahren. Da wurde er überraschend ernst. Wenn das jetzt alle ausnutzten, bekämen viele gar nichts mehr. Das leuchtete mir ein und wieder zuhause angekommen, war Mama zufrieden mit dem, was wir ihr überreichen konnten. Tagsüber durfte ich mithelfen, weiter aufzuräumen. Ich kehrte mit gekonntem Schwung die letzten Stücke der herunter gefallenen Dachziegel zusammen und half Papa eifrig dabei, vom Rest unseres Gartenzaunes einige halb schräg hängende Felder abzulösen und flach hinzulegen. Mama postierte für spätere Stunden vorsorglich an mehreren Orten Kerzen und Zündhölzer. Doch am Abend dann sahen wir plötzlich die Straßenbeleuchtung angehen. Endlich! Papa lief zum Hauptschalter und alles ging wieder. Das Treppenhauslicht brannte, weil es gestern nicht ausgeschaltet worden war, der Kühlschrank sprang an und Mama prüfte die Jalousien im Erdgeschoss. Zum Essen bereitete Mama Nudeln und Tomatensoße vor und als wir anschließend zusammen vor dem Fernseher saßen, um die Nachrichten zu verfolgen, waren sich die Eltern mit tief besorgten Gesichtern einig, was wir für ein Glück gehabt hatten. Überall in Europa hatten sich schwere Unfälle ereignet. Aufgrund der Schnelligkeit, mit der das Orkantief über den Kontinent gefegt war, hatte man den Bahnverkehr nicht rechtzeitig stoppen können. Züge waren an vielen Orten wegen Oberleitungsschäden auf freier Strecke stehen geblieben und die Menschen mussten darin ausharren. Der gesamte Luftverkehr war zwar Richtung Süden umgeleitet worden, dennoch drückte eine Böe am Frankfurter Flughafen ein noch notlandendes Flugzeug zu Seite und verursachte einen Absturz mit vielen Toten und Verletzten. Im ganzen Land hatten sich zahllose Straßenverkehrsunfälle ereignet. Strommasten und Funktürme waren wie die Streichhölzer eingeknickt und umgestürzte Bäume blockierten Straßen und Wege. Dächer sind abgedeckt worden und Baukräne umgefallen. In den Großstädten hatten umherfliegende Verkehrsschilder und Werbetafeln viele Menschen verletzt, die nicht mehr rechtzeitig nach Hause gekommen waren. Die Funknetze waren wegen Überlastung zusammengebrochen und in vielen Ortschaften die Einkaufsmeilen durch zu Bruch gegangene Schaufensterscheiben und herabgefallene Dachstücke verwüstet. Erste freigegebene Hubschrauberaufnahmen zeigten über dem Schwarzwald das ganze Ausmaß der Waldschäden und der Zerstörungen an Hochspannungsleitungen. In unserer Region hatte man schon vor Jahren auf Druck der Landesregierung gegen die Bundesnetzagentur über weite Strecken Erdkabel verlegt und dieser Umstand hat uns offenbar jetzt den Strom schnell zurückgebracht. In anderen Bundesländern dagegen blieb die Situation noch immer angespannt. Bundeswehr, Technisches Hilfswerk und örtliche Feuerwehren kämpften überall rund um die Uhr, um die schlimmste Not zu lindern. Betroffen gingen wir an diesem Abend zu Bett, schliefen aber bereits besser als zuvor, und in den nächsten Tagen normalisierte sich alles langsam. Viele Menschen halfen beim Aufräumen, um die Straßen sicher befahren zu können. Ich musste wieder zum Unterricht und auch meine Eltern gingen wie immer ihren beruflichen Obliegenheiten nach. Im Fernsehen war der Orkan Thema Nummer eins. Auch in der Schule behandelten wir dieses Ereignis. Viele Klassenkameraden berichteten aus ihrem weiteren Familienkreis über schlimme Folgen. Im Südwesten Deutschlands hatten viele Menschen noch zwei Tage später keinen Strom, viele Industrieanlagen standen still und hatten nun Mühe, ihren Betrieb wieder aufzunehmen. Die Lehrer sprachen mit uns über alles. Sie erklärten, wie und warum der Anstieg der mittleren Temperatur der Atmosphäre solche Folgen nach sich zieht und wir lernten, welchen volkswirtschaftlichen Schaden ein Orkan anrichten kann und dass wir uns im naturwissenschaftlichen Unterricht anstrengen sollten, um die Vorgänge in der Umwelt noch besser verstehen zu können. So wurde an unserer Schule der sogenannte „objektorientierte Unterricht“ neu eingeführt. Das war eines der wahlweise obligatorischen Angebote, die ab der sechsten Klasse fachübergreifendes Wissen vermitteln sollten. Wir behandelten zum Beispiel das Thema „Wasser“. Dies beinhaltete nicht nur Wasserkreisläufe, wie wir sie aus dem Erdkundeunterricht kannten oder die Aufbereitung von Abwasser und die Wasserversorgung der Bevölkerung, die uns die Umweltkundelehrerin erklärt hatte. Wir lernten viel mehr: Warum schwimmt ein Schnipsel Papier auf der Wasseroberfläche und warum klappt das nicht mehr, wenn man etwas Spülmittel dazu tut? Wir ließen Wassertropfen auf einer heißen Kochplatte tanzen. Von einem nahegelegenen Tümpel brachten wir einige Proben trüber Brühe mit und konnten unter dem Mikroskop viele Kleintierchen darin beobachten. Warum wird dieses Lebenselixier elektrisch leitfähig, wenn man Salz dazu gibt? Was passiert dann mit den Tierchen? Warum steigt das Wasser in dünnen Röhrchen von alleine nach oben? Fragen über Fragen, die allerdings erst einmal gestellt sein wollen, bevor man ihre Beantwortung interessant finden kann. Und mit diesen Antworten lernten wir die Bedeutung und die Kraft des Wassers kennen und verstanden, wie Süßwasser beim Gefrieren Kristalle bildet und warum das uralte Eis in Grönland auch ganz schnell wieder auftauen kann. Solcherlei Unterricht bereitete Spaß und ermöglichte uns, später in anderen Zusammenhängen über den Tellerrand eines Unterrichtsfaches hinaus zu schauen. Zum Glück ist mir die daraus erwachsene Neugier über die nächsten Jahre erhalten geblieben, obwohl die Mädchen der Klasse – und freilich auch die der Nachbarklassen – seltsamerweise immer hübscher wurden. Das lenkte natürlich in keiner Weise vom Schulischen ab, obwohl man diesem überaus erfreulichen Umstand von Zeit zu Zeit unbedingt eine gehörige Portion verstärkte Aufmerksamkeit widmen musste.
So wurde ich langsam erwachsen, genoss meine Jugendzeit und nahm dabei kaum wahr, welche Entwicklungen in der Welt unterdessen immer bedrohlicher wurden. In Polen waren zwei Sommer nacheinander durch längere Trockenphasen die Getreideernten um ein ganzes Drittel geringer ausgefallen, als üblich. In Kasachstan hatten Heuschreckenschwärme einen Großteil der landwirtschaftlichen Erträge zerstört und Mittel- und Westeuropa wurde weiter von der asiatischen Buschmücke geplagt. Die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen mit Denguefieber erreichte immer neue Rekorde und führte aufgrund der notwendigen Schutzmaßnahmen zu Kosten in Milliardenhöhe und damit zu erheblich gestiegenen Krankenkassenbeiträgen. Dennoch war das gesellschaftliche Umfeld, in dem wir uns damals bewegten, trotz der Ideen und Bemühungen unserer Lehrer nicht von viel Verständnis für ökologische Probleme geprägt. Nennenswerte Umweltbewegungen existierten nicht mehr und warnenden UN-Organisationen schenkte man keinen Glauben. Es schien, als sei menschliche Flexibilität in Phlegma umgeschlagen. Stattdessen nahmen internationale Konflikte und deren Schärfe zu und die Zahl diplomatischer Verwicklungen zwischen den Staaten beunruhigte die Erwachsenen zunehmend. Wie wir Schüler der siebten Klasse im Umweltkundeunterricht erfuhren, wurde im Süden der Türkei ein Mammut-Staudammprojekt umgesetzt. Zweiundzwanzig Staudämme, neun Elektrizitätswerke und fünfundzwanzig riesige Bewässerungsanlagen sollten gebaut werden. Die Lehrer hatten uns immer ermuntert, im Unterricht unsere Meinungen zu sagen und miteinander zu diskutieren, und so meldete ich mich und meinte, dass Wasserkraft doch eine vernünftige Sache sei. Fürs Klima prinzipiell richtig, bestätigte die Lehrerin, wandte aber ein, wir dürften die gewaltigen Umweltschäden und die gesellschaftlichen Folgen nicht vergessen. Sie erzählte uns, dass über einen Zeitraum von vielen Monaten über neuntausend Dörfer und Kleinsiedlungen geräumt, eine Vielzahl von Kleinbauern ruiniert und insgesamt fast einhunderttausend Menschen vertrieben worden waren. Auch der Eingriff in die Natur war ein einziges Desaster. Sie bereitete an ihrem Laptop verschiedene Dateien vor und dann sahen wir eine filmische Dokumentation an, die schon uns unerfahrene Schüler die Köpfe schütteln ließ. Der Rückstau beider Flüsse Euphrat und Tigris flutete oberhalb der Staudämme historischen Kulturlandschaften und unterhalb vertrocknete das Schwemmland. Die zu geringe Bewaldung der Berghänge zog deren Oberfläche in Mitleidenschaft und das Erdreich rutschte in die Stauseen, die daraufhin zu verschlammen drohten. In den Gebieten, die man bewässern wollte, stieg der Grundwasserspiegel, was vermehrt Bodensalze nach oben beförderte. Experten mussten sich eingestehen, dass auf salzhaltigen Böden auch mit zusätzlicher Bewässerung kein vernünftiger Ertrag mehr zu erzielen ist. Weitere Filmausschnitte zeigten, wie dem neu entstandenen Kurdistan, dem Protektorat Amerikanisch-Syrien und dem wahhabitischen Kalifat die eigenständige Versorgung mit Trinkwasser entzogen wurde. Beide Flüsse, die früher das fruchtbare Zweistromland versorgt hatten, begannen an ihrem Mittel- und Unterlauf auszutrocknen. Die Lehrerin erklärte uns, dass der Kampf ums Wasser fast einen neuen Krieg auslöste, der nur in allerletzter Minute verhindert werden konnte. Da wir das Thema interessant fanden, versprach sie, mit ihrem Kollegen zu reden, damit es im Politikunterricht weiterbehandelt würde. Das klappte prima und so setzte unser Politiklehrer, den ich wegen seiner väterlichen Art und seiner verständlichen Erläuterungen gern mochte, in den darauf folgenden Unterrichtsstunden genau bei diesen Inhalten fort. Er berichtete, dass dieser Kampf ums Wasser und die mit ihm verbundene Kriegsgefahr der anderen Weltmacht China nicht entgangen ist und Peking dazu veranlasste, seine Militärausgaben kurzerhand zu verdoppeln – was vor der Weltöffentlichkeit ganz unumwunden zugegeben wurde. Was er auch noch erwähnte: Seiner Theorie zufolge greift der Mensch in die Natur ein, das ruft eine Wechselwirkung natürlicher Prozesse hervor und deren Folgen wiederum beeinflussen dann das Handeln Dritter. Er bezeichnete dies als einen „kybernetischen Zusammenhang“. Das fand ich äußerst spannend. Er kehrte jedoch gleich wieder zum ursprünglichen Thema zurück und erläuterte, wie sich im Reich der Mitte mit der Aufrüstung auch die chinesische Raumfahrt weiter entwickelte. Dies ließ befürchten, dass – wie auch immer geartete – Weltraumtechnologie ebenfalls für militärische Zwecke genutzt werden würde. Von Experten war dieser Verdacht schon seit einer merkwürdigen diplomatischen Irritation diskutiert worden, über die der Politiklehrer uns in der nächsten Unterrichtsstunde einen Zeitungsartikel mitbrachte, den ich voller Wissbegier unter die Lupe nahm. Darin wurde von einem Fall berichtet, der sich bereits drei Jahre zuvor ereignet hatte. Unser Lehrer erklärte noch einmal die Vorgeschichte. Einige kleinere, aber brisante Pressemeldungen, die zunächst lanciert, jedoch sofort wieder dementiert worden waren, hatten zwar so gut wie keine öffentliche Beachtung gefunden, waren jedoch von einigen Regierungen in Europa sehr wohl mit Besorgnis registriert worden. In diesen Meldungen ist von einem eigenartigen Vorgang die Rede gewesen.
Was wurde aus R. K. und J. D.?
Aus Guizhou, einer der ärmsten Provinzen Chinas im Südwesten des Landes, berichteten Internet-Blogger, dass unter Reisbauern angeblich Paniken ausgebrochen waren. Zwei Journalisten R. K. und J. D., die sich auf der Suche nach möglichen Menschenrechtsverletzungen zu dieser Zeit in China aufhielten, sind daraufhin inkognito in jene Provinz gereist, weil sie Revolten gegen die örtliche Führung vermuteten und eventuelle Gegenmaßnahmen des Staates ans Tageslicht zu bringen gedachten. Als sie vor Ort eintrafen, müssen Reisbauern völlig verängstigt in ihren Häusern gesessen und wirres Zeug von Außerirdischen gefaselt haben. Die beiden beschlossen trotz der Gefahr, vom Geheimdienst entdeckt zu werden, sich mehr Zeit zu nehmen, um das Vertrauen der Bauern zu gewinnen. Sowohl die Älteren mit ihrem gebückten Gang, den zerfurchten Gesichtern und der traditionellen Kleidung als auch die wenigen Jüngeren in Jeans und T-Shirts berichteten von kreisrunden Flugzeugen, die lautlos gekommen und schnell wie Raketen, aber ohne wahrnehmbaren Antrieb wieder davon geflogen seien. UFOs? Möglich, aber höchstwahrscheinlich sehr irdische UFOs. Fotografische Dokumentationen standen nicht zur Verfügung und so zogen die zwei Journalisten ins Nachbardorf, wohin ihnen ihr Ruf, durchaus vertrauenswürdig zu sein, schon vorausgeeilt war und wo die Leute exakt das gleiche erzählten. Alle in der Gegend hätten panische Angst bekommen und wären, als gelte es, das nackte Leben zu retten, von den Reisfeldern sofort nach Hause gerannt, um sich in ihren baufälligen Hütten in Sicherheit zu bringen. Manche zitterten noch, als sie ihre unglaubliche Geschichte endlich jemandem von außerhalb erzählen konnten. Beiden Journalisten wurde offenbar schnell klar, dass sich hier etwas ereignet hatte, das die chinesische Führung um jeden Preis würde geheim halten wollen. Sie verabschiedeten sich vermutlich hastig und müssen sich dann getrennt voneinander auf abenteuerlichem Weg ins Ausland abgesetzt haben, wo sie ihre Recherchen doch tatsächlich der Netzgemeinde präsentieren konnten. Einmal veröffentlicht, führte dieses Thema dann schon noch zu einigen Diskussionen im Internet, aber der Ruf der Journalisten war ruiniert. Verschwörungstheoretiker! So zumindest war das offizielle Statement der chinesischen Staatspresse – nichts dran, an dem dummen Geschwätz der illegal Ausgereisten. Und so trumpfte wieder einmal der Joker „Verlogenheit“ auf. Was später von R. K. und J. D. in ihren weiteren beruflichen Bemühungen publiziert worden ist, hat man geschickt totgeschwiegen. Ihrer Laufbahn wurde allein durch die Fragestellung, ob bei den unbekannten Flugobjekten eventuell völlig neuartige Gravitationsantriebe ausprobiert worden sein könnten, weil man die dafür erforderlichen Gravitationswellen 2016 ja schon entdeckt hatte, ein jähes Ende bereitet. So blieb ihr Wirken erfolgreich unbeachtet und die Aufrüstung Chinas konnte trotz dieser kleinen Ärgernisse kontinuierlich weiter gehen. Man könnte meinen, die Menschheit hätte keine anderen Probleme …
Ich fragte unseren Politiklehrer, was denn eine „Verschwörungstheorie“ sei. Er schmunzelte und meinte, das sei eine Methode, um missliebige Wahrheiten als vermeintliche Lügen darzustellen. Man muss dieses System nur einmal etabliert haben, dann funktioniert es. Und zwar nach beiden Seiten: Genug Verwirrte in der Welt nerven mit ihren hanebüchenen Geschichten. Zum Beispiel solche, die behaupten, eine Mondlandung hätte niemals stattgefunden. Diese Leute kann man getrost als Verschwörungstheoretiker hinstellen, was in diesem Fall den Vorteil bietet, sich selbst auf die Seite der Sachlichkeit und Objektivität zu schlagen. Hat man dies mehrfach öffentlich glaubhaft getan, kann jeder Andere, der tatsächlich wissenschaftlich exakt vorgeht, aufmerksam beobachtet, ehrliche Notifikation betreibt und die Seriosität zu seinen Prinzipien zählt, bei allem, was er äußert, ebenfalls als Verschwörungstheoretiker denunziert werden, was in diesem zweiten Fall den Vorteil bietet, auch wahre Informationen wunderbar verunglimpfen zu können. Ich war erschrocken darüber, mit welcher Raffinesse sich die Leute gegenseitig hinters Licht führen. Unser Lehrer muss meine verzweifelte Miene wohl richtig gedeutet haben und ergänzte, dass rechtschaffene Methodenkompetenz sich solcher Verfahren ja nicht unbedingt bedienen müsse. Das verstand ich nicht wirklich, grinste aber erstmal sehr wissend und war froh, dass die Schule für heute vorbei war. Am Nachmittag wachste ich die Skier und begab mich auf den Weg zu Gabi aus der Nachbarklasse, um sie zu einer kleinen Tour durch den verschneiten Wald hinter unserem Wohngebiet zu überreden. Ich klingelte. Ihre Mutter öffnete und schüttelte bedauernd den Kopf. Gabi sei heute mit ihrer Freundin in die Stadt gefahren. Die Tür fiel ins Schloss und ich stand etwas ratlos und enttäuscht auf meinen Skiern. Dann eben doch nur eine kleine Tour allein, es wird sowieso bald dunkel. Ich kann anschließend auch noch die Hausaufgaben für nächste Woche anfangen, nahm ich mir vor. Später, nach dem Abendessen saß ich – wie so oft – mit den Eltern vor dem Fernseher. Wir unterhielten uns über verschiedene Alltäglichkeiten und schauten die Nachrichten. Danach fesselte uns ein interessanter Beitrag, in dem Meteorologen und Experten angrenzender Fachgebiete auf Veränderung der Passatwinde im Indischen Ozean hinwiesen. Der indische Monsun als Ganzes stellte bisher eine verlässliche Klimaerscheinung mit nur relativ geringfügigen Schwankungen im Verlauf längerer Zeiträume dar. Doch man zeigte anschaulich, wie die Passatwinde der unteren Troposphäre die Richtungsstabilität der jährlichen Monsunströmungen verändern. Alle warnten eindringlich davor, dass in diesem Jahr mit frühzeitig einsetzenden und starken Monsunregen zu rechnen sei. Mit Nachdruck rieten die Wissenschaftler den betroffenen Ländern, umfangreiche Vorbereitungs- und Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Vater zog ein erstauntes Gesicht und Mutter meinte, dass das alles merkwürdig sei. Als der Abend zu Ende ging, dachte ich noch an Gabi. Vielleicht mochte sie nicht Ski fahren? Aber der Winter ist ja schon fast vorbei, dann kommt wieder die Fahrradsaison. Anderentags sah ich Gabi in der Pause auf dem Schulhof, aber sie zeigt mir die kalte Schulter und unterhielt sich auffällig lange mit einem Jungen aus einer der Klassen über uns. Dafür stand jetzt ihre Freundin leicht gelangweilt daneben.
Nicht lange, und die Schneeglöckchen verblühten, die Tage wurden wieder heller. Mein Fahrrad wartete entstaubt und einsatzbereit in unserem Carport auf seinen ersten diesjährigen Einsatz, und Gabis ehemalige beste Freundin war jetzt meine beste Freundin. Sie lernte ebenfalls sehr gut in der Schule, erledigte ihre Hausaufgaben meistens im Handumdrehen und dadurch konnten wir beide oft Zeit gemeinsam miteinander verbringen. Bei sonnigem Wetter trafen wir uns im Freibad regelmäßig an einer verabredeten Stelle, breiteten unsere Luftmatratzen aus und lästerten nach Spiel und Spaß im noch zu kalten Wasser trefflich über ebenfalls anwesende Schulkameraden. Sonnenschein, Fassbrause, Softeis und zwei in Handtücher eingewickelte und mit blauen Lippen zitternde Teenager mit nassen Haaren – das waren die Zutaten eines glücklichen Frühjahrs. In dieser Jahreszeit mussten wir noch keine Angst vor der Buschmücke haben, obwohl das Wetter ungewöhnlich oft schon heiß und schwül war. Und dann kamen in den Nachrichten die ersten Meldungen über den viel zu früh einsetzenden Monsunregen. Schon im April ergossen sich auf dem indischen Subkontinent monatliche Niederschlagsmengen von mehr als zweitausendfünfhundert Liter pro Quadratmeter, was zuvor nur als Spitzenwert des Hauptmonsunmonates Juli und auch nur in der bis dahin am meisten bedrohten Provinz Cherrapunji beobachtet worden war. Sowohl der Ganges als auch die Flüsse Narmadi, Mahanadi und Godavari waren kurze Zeit später über ihre Ufer getreten und durch die unglaublichen und nicht enden wollenden Regenfälle innerhalb weniger Wochen auf eine Breite von vielen Kilometern angewachsen. Der Krishna im Süden Indiens bildete mittlerweile ein weitflächiges und langgezogenes Netz flacher Binnenseen. Von Juni bis August stiegen die Niederschläge noch einmal fast auf das Doppelte, nie da gewesene Sturzregen schier biblischen Ausmaßes überzogen viele Regionen. Überall im Land begruben gewaltige Erdrutsche und Schlammlawinen die Menschen unter sich, tiefer gelegene Ebenen hatten sich fast komplett in Tümpel-Landschaften verwandelt und in den Großstädten stand das Wasser meterhoch in allen Straßen. Erst nachdem Zehntausende durch Stromschläge, Ertrinken und einstürzende Häuserwände den Tod gefunden hatten, wurde landesweit das Militär aktiviert. In den großen Metropolen waren Hunderttausende in ihren Wohnungen gefangen. Geschäfte blieben geschlossen, das öffentliche Leben hörte auf. Das Wasser hatte Millionen Landarbeiter, Pilger und die Ärmsten der Armen aus der Kaste der Unberührbaren in unzähligen Regionen auf kleinen Inseln von der Außenwelt abgeschnitten. Die Armee versuchte, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu helfen, musste aber wetterbedingt immer wieder Rettungsflüge aussetzen, eben errichtete Hilfsbrücken davon schwimmen sehen oder ihr eigenes schweres Gerät aufgeben. Überall herrschten Trinkwassermangel und Lebensmittelknappheit, weil die noch vorhandenen Vorräte vom Wasser mitgerissen und unbrauchbar gemacht worden waren. In den träge und behäbig dahin strömenden Flüssen trieben unter gleichmäßig dunkelgrauem Himmel Unmengen an Tierkadavern, Unrat und Müll und schon in den darauf folgenden Wochen hunderttausende Leichen vor sich hin. Die Stromversorgung wurde abgestellt, Telefonverbindungen existierten nicht mehr. In den Großstädten Mumbai und Kalkutta griffen Hungersnöte und Krankheiten um sich und in vielen kleineren und mittleren Städten brachen Proteste und Revolten aus.
In Bangladesch war das Mündungsdelta von Ganges und Brahmaputra komplett überflutet. Dort grassierten überall Ruhr, Typhus und Cholera, die Krankenhäuser waren völlig überfüllt und konnten nicht mehr helfen. Abermillionen Menschen begaben sich auf die Flucht nach Norden und entlang der wenigen Fluchtrouten ereigneten sich Massenpaniken und gewalttätigen Auseinandersetzungen. In der Zwischenzeit fanden die Larven der Anophelesmücke in den schier unendlichen Weiten stehender Gewässer auf dem gesamten Subkontinent ideale Bedingungen vor. Myriaden der Blutsauger im ländlichen Raum, in den Slums der Großstädte, in Wohnungen und öffentlichen Gebäuden führten dazu, dass sich die Malaria epidemisch ausbreitete. Bangladesch war völlig überfordert, aber auch in Indien brach nun die Wirtschaft zusammen. Die landesweite Verteilung von Treibstoffen, Lebensmitteln und Medikamenten scheiterte an von Schlamm bedeckten Straßen, eingestürzten Brücken, unterspülten Eisenbahnlinien oder schlicht an fehlenden Hilfskräften. Organisationsstrukturen funktionierten nicht mehr, Industriebetriebe standen still. Viele Menschen gaben sich jetzt nur noch ihrem Karma hin und erwarteten demütig ihr Schicksal. In dieser ausweglosen Situation hat Indien seinen Nationalstolz zur Seite gelegt und in einem eindringlichen Appell an die Weltgemeinschaft um Hilfe ersucht. Die Führung Chinas bot an, Teile ihrer Landstreitkräfte zu entsenden, was man in Neu-Delhi allerdings dankend ablehnte. Die UN beschloss, eine sogenannte Geberkonferenz einzuberufen, auf der eine Unterstützung von etwas mehr als zwei Milliarden Dollar bewilligt wurde. Bis dieser eher symbolische Betrag aber zusammenkam und vor Ort zur Verfügung stand, sollte einige Zeit vergehen. Wer bis dahin einen Rest Lebensmut aufbrachte, begab sich auf den Weg nach Westindien in die Küstenregion des Bundesstaates Maharastra, denn hier – nördlich von Mumbai – sahen die Menschen ihre Chance, dem Chaos zu entkommen. Immer mehr versammelten sich und dann setzte der große Flüchtlingsstrom ein. Als wolle sich mit der letzten Kraft der Verzweiflung eine eigenständige Industrie entwickeln, wurden Wälder gerodet, Unmengen an Holz zur Küste gebracht und Boote über Boote gebaut. Hunderttausende zimmerten an ihrer Flucht nach Arabien. Der Landweg Richtung Iran war versperrt, da Pakistan, obwohl selbst vom Monsun betroffen, seine Grenze zum inzwischen wehrlosen Indien komplett abgeriegelt und sich dabei auch noch einiges Terrain einverleibt hatte. Also blieb nichts anderes übrig, als die mehr als tausendfünfhundert Kilometer bis nach Oman über das Arabische Meer in selbstgebauten Fischerbooten zu wagen. Und diesen Wahnsinnsversuch unternahmen viele, sehr viele. Finanziell großzügig von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt, bereitete sich auf der anderen Seite des Meeres das Sultanat Oman in einer beispiellosen Aktion auf diese Flüchtlingswelle vor. Logistisch perfekt ausgestattete Auffanglager an der Küste wurden errichtet und hunderte hochseetaugliche Schiffe für Rettungsaktionen gechartert. Eben waren noch schnell ein paar Verwaltungsvorschriften für die Ankömmlinge erlassen worden, und dann wähnte man sich gerüstet. Vielleicht stand hauptsächlich der Wunsch nach mehr billigen Arbeitskräften aus dem Ausland dahinter, vielleicht trugen diese Bemühungen aber auch tatsächlich humanitären Charakter. Saudi-Arabien jedenfalls sah die Entwicklung mit wachsender Besorgnis und konsultierte zunächst seinen Verbündeten, die USA. Derweil ging in Indien die Katastrophe immer weiter. Entsetzliche Bilder schockierten die Welt. Vor den Kameras verzweifelter und hilfloser Berichterstatter raffte der Tod die Menschen dahin und trotz der nunmehr zögerlich einsetzenden internationalen Hilfe wollte das Sterben nicht aufhören. Eine mediale Sturmflut überrollte den Globus und brachte das alltägliche Leben aus der Fasson. Proteste wurden laut, wichtige Menschen oder solche, die sich für wichtig hielten, meldeten sich über Monate auf den weltweiten Fernsehkanälen mit Aufrufen, Kritiken oder Kommentaren zu Wort. Warum wird nur so zögerlich geholfen? Wo bleiben die großen Militärmächte? Wo bleibt der menschliche Zusammenhalt? Noch ein halbes Jahr später, als das Wasser wieder gegangen war und Indien den Tod von mehr als achtzig Millionen Menschen und den kompletten wirtschaftlichen Zusammenbruch konstatieren musste, ereiferten sich die ungeschoren Gebliebenen in scheinheiligen gegenseitigen Vorwürfen, zu wenig unternommen zu haben. Selbst Zyniker erhielten Applaus für ihre menschenverachtende Aussage, dass die indische Bevölkerung ja nicht einmal um ein Zehntel dezimiert sei. Und schon gaben sich die ersten hochkarätigen Wirtschaftsdelegationen verschiedener Staaten in dem geschundenen Land die Klinken in die Hand – schneller als zuvor irgendeine Hilfe eingetroffen war. Aber eine öffentliche Diskussion darüber, was diese Naturkatastrophe verursacht hatte und wie man Vergleichbares in Zukunft würde verhindern können, fand kaum statt – und wenn, dann unter Experten und nur hinter vorgehaltener Hand. Man versuchte, wo immer möglich, das gesellschaftliche Leben in Gang zu bringen. Der Monsun des Folgesommers fiel wieder einigermaßen regulär aus, doch Indien und Bangladesch waren in die Steinzeit zurückgespült und durch die gewährten Wiederaufbaukredite in die vollständige politische Abhängigkeit gerutscht.
Die Welt fand langsam den Weg in den Modus der alltäglichen Geschäftigkeit wieder. Das Leben musste weiter gehen und die Erderwärmung schloss sich dem an. Das lokale Wettergeschehen hatte sich von der Allgemeinheit unbeobachtet in vielen Regionen der Erde gewandelt, ganz allmählich häuften sich die Extreme. Die jährlichen Tornados über den USA wurden fast nur als F4- oder F5-Stürme auf der Fujita-Skala eingestuft, die Phasen von Trockenheit und Waldbränden im Mittelmeerraum hielten immer länger an und in den gemäßigten Breitengraden nahm der Niederschlag in den Sommermonaten den Charakter ungebremster Sturzregen an, was allerorten regelmäßig zu lokalen Überschwemmungen, Schlammlawinen und geschädigter Infrastruktur führte.
Von all den Geschehnissen sind mir hauptsächlich die Momente in Erinnerung geblieben, in denen ich zusammen mit den Eltern, die die Tränen in ihren Augen oft nicht verbergen konnten, vor dem Fernseher saß und sich die Bilder sterbender Menschen in mein Gehirn eingebrannt hatten. Aber ich erinnere mich auch an andere Momente, in denen weniger dramatische Meldungen als diejenigen über schreckliche Naturkatastrophen meine Aufmerksamkeit fanden. Mit fünfzehn Jahren nimmt man schon große Teile der Erwachsenenwelt bewusst als die eigene wahr und so entging mir nicht, dass die Bienenvölker in Nordamerika ausstarben und man sich zur Bestäubung von Kulturpflanzen mit Zuchtvölkern helfen musste. Interessiert las ich auch Pressemeldungen über die eingeschleppte Unkrautpflanze Ambrosia, die sich im Untergehölz der mitteleuropäischen Mischwälder unkontrolliert ausbreitete und damit den Lebensraum einheimischer Flora und Fauna wesentlich beeinträchtigte. Ich registrierte ebenfalls die alarmierenden Verlautbarungen, dass die Staatsverschuldung mehrerer großer europäischer Staaten auf die sagenhafte Höhe des jeweiligen dreifachen Bruttoinlandsprodukts stieg und dadurch von den Hütern der Finanzen selbst im Nachgang eine schwere Finanzkrise ausgelöst wurde. Obwohl volkswirtschaftliches Gedankengut für mich eher ein Buch mit sieben Siegeln blieb, gingen dennoch die konkreten Auswirkungen auf unseren familiären Geldbeutel auch an mir nicht spurlos vorbei. Mutter klagte häufig über mangelhafte Einlagensicherung, gestiegene Krankenkassenbeiträge, immer höhere Lohnsteuern und immense Energiekosten. Deshalb musste ich mich leider damit abfinden, dass mein Taschengeld um einen nicht unerheblichen Betrag gekürzt wurde. Die Eltern benötigten etwas Geduld, mein Verständnis zu erringen, aber sie erklärten mir die Ursachen. Die Preise auf dem Energiemarkt hatten sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt – und das, obwohl Investitionen in erneuerbare Energiequellen überall auf der Welt schon seit einiger Zeit stagnierten und damit der Anteil nichtfossiler Quellen am Primärenergieverbrauch nicht steigen konnte – was dringend erforderlich gewesen wäre. Der weltweite Mangel an sogenannten seltenen Erden, die man für die Herstellung von Photovoltaikanlagen benötigt, ermöglichte China, als einziger verbliebener Exporteur die hohen Preise zu diktieren, und das führte fatalerweise zu einem erneuten Anstieg der Erdöl- und Kohlenachfrage.
So wuchs ich in eine Welt hinein, deren absurde Verwerfungen selbst mir als relativ jungem und unerfahrenem Menschen schon auffielen. Hatte nicht oft genug das außergewöhnliche Wetter zu Trockenheit geführt und anderenorts der Wassermangel wiederum zu Krieg? Ohne tatsächlich etwas ändern zu können, versuchte ich dennoch bereits in diesem Alter, schlaue Ideen zu entwickeln, wie solche Missstände auf einen besseren Weg zu bringen wären, zum Beispiel mit mehr Energie. Wie könnte man ohne seltene Erden den Wirkungsgrad von Photovoltaikzellen von derzeit zwanzig Prozent auf wenigstens fünfzig oder sechzig Prozent erhöhen? Ließen sich die vielen kleinen Alltagsgeräte, in denen Batterien schlummern, die später die Umwelt vergiften, auch anders betreiben? Uhren zum Beispiel verbrauchen nur geringste Energiemengen. Könnte man dafür nicht Mini-Akkus einsetzen, die durch Ausnutzen von Luftdruckschwankungen ständig wieder aufgeladen würden? Mit derlei Hobbys beschäftigt, vergingen die ansonsten schönen und auch abwechslungsreichen Jugendjahre. Für die Schule musste ich nicht viel tun, glücklicherweise fiel mir das Lernen recht leicht und so bereitete ich mich ohne allzu viel Mühe auf das nahende Abitur vor. Zu meiner Leidenschaft ‚Umwelt‘ gesellte sich noch ein anderes Interesse, das sich später auch in der weiteren beruflichen Orientierung als hilfreich erweisen sollte – das Programmieren. Der Umgang mit Computern war schon seit langem allenthalben notwendig und bei meinen Mitschülern natürlich auch beliebt, obwohl die meisten sich nur mit ihren Tablets und Smartphones beschäftigten. Ich aber wollte auch die Details etwas genauer kennenlernen und wandte mich den neuesten Betriebssystemen und ihren verschiedenen Besonderheiten zu. Netzwerktechnik und Funktechnologie sind ja überaus interessant und wenn man den richtigen Zugang findet, auch durchaus spannend. Ich bemerkte durch Zufall, dass sich trotz Antivirensoftware und Firewall auf einem meiner Rechner solche Datenpakete die Hand schüttelten, die dort nichts zu suchen hatten. Na, schau einer an, dachte ich mit verwundertem Blick auf das Ergebnisfenster des selbst geschriebenen Überwachungsprogramms. Nach näheren Analysen und internen Transformationen wurden die kyrillischen Zeichen in den Hauptspeicherauszügen immer häufiger und ich stellte zu meinem Leidwesen fest, dass offenbar russische ‚Spezialisten‘ unterwegs waren. Ich hatte keine Ahnung, was die aktuell denn so vorhaben könnten, doch schon wenige Tage später platzte die Bombe: In den Fernsehnachrichten zur besten Sendezeit wurde berichtet, dass etwa zwei Drittel der bisherigen großen internationalen Serverstationen durch Russland gekapert und mit einer eigenen, nicht wieder entfernbaren Software ausgestattet worden sind. Experten zufolge bedeutete das nicht mehr und nicht weniger, als dass Russland nunmehr das Internet beherrschte und kontrollierte. Die gesamte Netzgemeinde schrie auf – konnte aber nichts tun. Weltweite Proteste verhallten und waren nicht in der Lage, eine Rücknahme der Aktion zu bewirken. Zusätzlich ist das neue russische Internet mit einem System aus Kommunikationssatelliten verbunden worden, um so die totale Kontrolle über den weltweiten Datenaustausch zu erlangen. Nach außen funktionierte alles wie immer, aber nun herrschte Russland über die Einführung und Vergabe einmaliger Internetbegriffe und nicht mehr die im kalifornischen Los Angeles angesiedelte und angeblich gemeinnützige Vereinigung ‚Internet Corporation for Assigned Names and Numbers‘. Russland baute auf diese Weise das Netzwerk der sogenannten Serverplattformen SPF auf, über die der gesamte internet- und funkbasierte Datenverkehr abgewickelt wurde. Einige Teile des ehemaligen Netzes blieben zwar international, büßten aber ihre wesentlichen Leistungsparameter wie Datenmenge und Schnelligkeit der Übertragung ein. Ich hätte nicht vermutet, dass auch der Journalismus durch diese Entwicklung schwer beeinträchtigt werden würde. Die globale Berichterstattung bevorzugte schon deshalb, weil sie nicht einer möglichen russischen Zensur unterworfen sein wollte, den verbliebenen freien Rest des Internets, war aber dadurch sowohl quantitativ als auch qualitativ enorm eingeschränkt. Nun gut, ich konnte mich an meinem Computer darauf einstellen und habe auch den Eltern die entsprechenden heißen Tipps für ihre Emails und Telefonate gegeben. So blieben wir von dieser an Frechheit nicht zu überbietender Maßnahme zunächst unbeeindruckt und gaben uns alle voller Vorfreude der Vorbereitung des geplanten Urlaubs hin. Tunesien sollte das Ziel sein. Mutter meinte, die Reise würde bestimmt einer der letzten gemeinsamen Urlaube. Das kann gut sein, grinste ich, denn für das nächste Jahr ist mit meinen Freunden eine Abi-Tour angesagt. Umso mehr wollte ich dieses Mal noch mit den Eltern zusammen in die Ferien, zumal ich wusste, dass beide dafür hart gespart hatten. Wir schauten uns in Prospekten die Bilder der am Meer gelegenen, zwischen weißen Mauerbögen verwinkelt gestalteten Hotelanlage an, ich buchte die Flüge über das freie Internet und schon war der Sommer heran und Mutter am Koffer packen. Vater studierte das Kartenmaterial, spekulierte über mögliche Ausflugsziele und riet Mutter noch, auch ein Kopftuch mitzunehmen. Ich hatte mir unter tolerierendem Schmunzeln der Eltern einen Fensterplatz im Flieger ergattert und dann sah ich im Landeanflug auf Tunis aus geringer Höhe durch das Bullauge die sonnenüberstrahlten Strände und eine Vielzahl von Segelbooten vor der Küste. Im Reisebus Richtung Hotel stieg die Spannung und wir wurden bei Ankunft nicht enttäuscht. Eine pompös verglaste Hotelfassade nahm uns in Empfang und von der luxuriös ausgestatteten Eingangshalle waren wir mächtig beeindruckt. Wir checkten ein und auch das gebuchte Apartment mit Meeresblick faszinierte mich. Noch am Abend unternahmen wir einen ersten Rundgang durch die allenthalben von Palmen gesäumte, parkähnliche Umgebung, die mehrere Pools und verschieden Sportanlagen umfasste. Toll, so hatten wir uns das vorgestellt. Am nächsten Morgen beschlossen die Eltern, erstmal den weißen Sandstrand und das türkisblaue, warme Mittelmeerwasser zu genießen, und erst die darauf folgende Woche an der Rezeption den einen oder anderen Ausflug ins Landesinnere zu buchen. Das war mir recht, denn ich freute mich ja schon auf Wasser, Wind und Wellen. Eine Woche darauf saßen wir abends, geschafft vom vielen Schwimmen und befreit von der tagsüber notwendigen Schicht Sonnencreme bei allerlei Getränken im schattigen Grün nahe dem großen Pool und freuten uns auf die bevorstehenden Ausflüge, als plötzlich Sirenen ertönten und laute Motorengeräusche die Idylle jäh beendeten. Wir sahen uns erschrocken an, dann ertönten überall Lautsprecher. Das Hotelpersonal kam herangerannt, schrie, forderte alle Urlauber hektisch auf, sofort das Hotel zu verlassen. Wir hätten höchstens ein Stunde Zeit. Ich konnte diese Aufforderung nicht glauben. Auch Vater und Mutter realisierten die Situation erst, als bewaffnete Polizisten erschienen und antreibend irgendwelche unverständlichen Anweisungen brüllten. Wir bekamen Angst. Was zum Teufel ist los?! Ein Terroranschlag? Hals über Kopf rannten wir nach oben ins Apartment. Wir verstauten unser Habe, so gut das in der Kürze der Zeit ging, hasteten mit unseren Koffern wieder nach unten und schon fanden wir uns vor dem Haupteingang auf der Straße inmitten einer Unzahl herumirrender anderer Urlauber wieder. Mutter und Vater waren völlig durcheinander. Auch ich rätselte, was jetzt zu tun wäre. Wir hatten ja nicht einmal ausgecheckt. Der gesamte Vorplatz des Hotels stand voller olivgrüner Militärbusse. Die Motoren liefen schon. Überall wimmelten Polizisten und Soldaten. „Tunisia is to be evacuated!!“, schrie einer. Was? Das ganze Land soll evakuiert werden? Im selben Moment wurden wir harsch aufgefordert, unser Gepäck in einem der olivgrünen Busse zu verstauen und einzusteigen. Wir fuhren Richtung Flughafen, die Strecke kam mir von der Herfahrt noch bekannt vor. Im Bus mutmaßten wir kopfschüttelnd, um was es denn hier überhaupt gehen könnte. Unsicherheit umfing uns. Dann fiel dieses Wort: Ebola! Der Schock saß tief. Ich versuchte, mit meinem Smartphone das freie Internet zu kontaktieren. Tatsächlich! Laut einem Nachrichtenportal müssen mehrere Flüchtlingstrosse aus tausenden, an Ebola erkrankten Afrikanern heute an Tunesiens Küste und offenbar direkt vor unserer Hotelanlage angekommen sein. Wir wussten nicht, dass die Epidemie bereits vor vielen Monaten ausgebrochen war und genau an unserem ersten Urlaubstag die damals ausgesandten, internationalen Hilfsteams zu ihrer eigenen Sicherheit ergebnislos zurückbeordert worden sind. Man sah sich nicht mehr in der Lage, die weitere schnelle Ausbreitung einzudämmen. Seit einigen Tagen schon wurden sämtliche Touristen aus Afrika ausgeflogen, und wir hatten nichts, aber auch gar nichts mitbekommen. Kopfschütteln. Unser Konvoi aus olivgrünen Bussen fuhr am Flughafen mit hoher Geschwindigkeit direkt aufs Rollfeld. Menschen über Menschen. Von überall her trafen weitere Konvois ein. Das Gepäck wurde in aller Eile von Hand in den Flugzeugen verstaut. Ständig starteten Maschinen. Nach kurzer Zeit hob auch unser Flieger ab.
Wir hatten doch eine Woche Spaß, und der Rückflug war ganz geschmeidig. So frotzelte ich am Tag nach unserer Rückkehr, als die Eltern noch beim Auspacken waren. Mutter fragte entsetzt, wie man denn die Leute ruhig dorthin in Urlaub fliegen lassen, und nur eine Woche später eine derartige Grundsatzentscheidung treffen könne. Vater meinte, wir sollten froh sein, dort überhaupt noch weggekommen zu sein. Nach dem Abendessen saß ich wieder einmal gemeinsam mit den Eltern vor dem Fernseher, um Nachrichtensendungen zu schauen. Wir wollten uns informieren und endlich das ganze Ausmaß dieser Tragödie wissen. Doch nur spärliche Informationen und Bilder standen zur Verfügung, niemand wusste so recht Bescheid. Die Krankheit hatte sich über den gesamten Kontinent ausgebreitet. Der internationale Flugverkehr von und nach Afrika wurde weltweit komplett eingestellt. Rohstoffe und Güter von Algier bis Mogadishu, von Monrovia bis Dar es Salam und von Luanda bis Maputo durften ab sofort nur in wenigen, äußerst strengen Quarantänevorschriften unterworfenen Häfen verschifft werden. Kriegsschiffe lagen vor wichtigen Küstenstädten und überwachten den unter diesen Umständen noch realisierbaren Export von Baumwolle, Kakao, Kaffee, Bananen oder Rohdiamanten. Von den Journalisten, die sich auf eigene Faust und unter hohem Risiko auf den Weg begeben hatten, um zu berichten, kehrten die meisten nicht wieder zurück. Luftaufnahmen zeigten in den ländlichen Gebieten überall verlassene Dörfer und Siedlungen. Amerikas „Lichtsekte“ triumphierte. Nun sei der Moment gekommen, die Erde den Erbärmlichen zu überlassen und hinan zu steigen auf dem göttlichen Wege zur ewigen Schönheit. Doch die Lebenden wollten leben und begaben sich auf den langen und tödlichen Weg nach Norden und Osten. Zirka zwei Monate nach unserem tollen Urlaub erreichten die gewaltigen Flüchtlingsströme Djibouti. Dort an der Meerenge von Bab al-Mandab beträgt die Entfernung zur arabischen Halbinsel nur etwa sechzig Kilometer. Auch an der Mittelmeerküste bildeten sich immer größere Zelt- und Hüttenlager der Flüchtenden. Menschenansammlungen, wie gemacht, um Ebola weiter zu übertragen. Doch die Wanderung der Elenden war bereits seit längerem beobachtet worden, die Welt gedachte, sich zu schützen. Saudi-arabische und US-amerikanische Kriegsschiffe erwarteten die Sterbenden im Roten Meer und im Golf von Aden. NATO-Verbände waren auf Malta, Sizilien und Gibraltar in Alarmbereitschaft versetzt worden und zwischen Zypern und Israel bereiteten sich mehrere große Flugzeugträger auf ihren Einsatz gegen die Todgeweihten vor. Zeitgleich mit dem Abwurf von unzähligen Hilfspaketen über den Küstenlinien fielen draußen auf dem Meer die ersten Schüsse auf Schlauchboote, Flöße und kleinere Kutter der einheimischen Fischer.
Tief geschockt von dieser Gnadenlosigkeit menschlichen Handels stellte ich mir die Frage: Auf welche Gewalt kann man verzichten, wie viel Hilfe kann man leisten, um dennoch die Zahl der außerhalb Afrikas neu infizierten Menschen in einer beherrschbar kleinen Größenordnung zu halten? Dies fragte ich einmal in der Unterrichtspause unseren Politiklehrer, der in seiner väterlichen Art antwortete, ich solle nicht so viel grübeln. In zugespitzten Situationen seien oft extreme Handlungsweisen notwendig, meine Fragestellung hingegen wäre nur in der Entstehungsphase einer solchen Situation zulässig. Ob denn dann der vollständige Verzicht auf jegliche Gewalt eine Lösung sei, fragte ich unbefriedigt nach. Möglich. Aber nur, wenn alle dem Prinzip folgten! Doch so eine Einstellung erschwerte mir den uns jungen Männern nach dem Abitur bevorstehenden Wehrdienst nur. Innerer Pazifismus biete keine Hilfe bei der Bewältigung unsinniger Herausforderungen. Ich sprach oft mit Vater über dieses Thema und er gab mir den Rat, mich – wenn dies gelänge – für den Bereich Cyberwar-Abwehr einteilen zu lassen. Das wäre bei meinen Computerkenntnissen und schulischen Leistungen erreichbar. Ich würde Einiges dazu lernen und müsste zumindest nach der Grundausbildung nicht nur „herumballern“. Eine solche Argumentation fand ich überzeugend und umso höher war ich motiviert, das bevorstehende Abitur möglichst mit der Note eins abzuschließen. Das allerdings war schon eine Herausforderung, obwohl alle Schüler bestimmte Prüfungen auswählen und so ihre Stärken in den Vordergrund stellen konnten. Ich entschied mich für Physik, Mathematik und Biologie – meine Lieblingsfächer. Trotzdem spürten wir alle eine riesige Anspannung vor den schriftlichen und mündlichen Prüfungen, aber als diese hinter uns lagen, war die Erleichterung umso größer. Ich hatte mit einem Durchschnitt von 1,2 mein Ziel nur knapp verfehlt und nun fühlten wir uns wie die gemachten Leute: Was kostet die Welt? Nichts – sie gehört uns! Was möchten Sie bitte studieren? Kein Problem. Sie wollen promovieren? Selbstverständlich! Nichts schien unmöglich – bis der Brief aus grauem Behördenpapier mir die Einberufung bescherte. Na ja, war ja absehbar gewesen und ich erinnerte mich zum Musterungstermin an Vaters Rat, mich auf die Abwehr von Cyberwar-Attacken aus dem Ausland zu bewerben. Das hat man bewilligt und nach einer Eignungsprüfung und einem Sicherheitscheck wurde ich 2033 nach Potsdam beordert. Dieser Ortswechsel war schon ein gewaltiger Einschnitt und ich sagte mir: Jetzt bist du erwachsen, Leon! Das bedeutete nicht weniger, als das Zimmer meiner Kindheit und Jugend zu verlassen, in eine fremde Stadt zu gehen, bei kasernierter Unterbringung im rollenden Vier-Schicht-System zu schuften und mich auf Anhieb mit wildfremden Menschen auseinandersetzen und verstehen zu müssen. Nach der Grundausbildung, die freilich für jede Waffengattung die gleiche war und sich in weiten Teilen darauf beschränkte, im Untergehölz deutscher Heide- und Waldgebiete die sich immer weiter ausbreitende Ambrosia-Pflanze zu jäten, bekam ich zusammen mit den anderen Neuen nach einer entsprechenden Geheimhaltungsverpflichtung die ersten Einweisungen in die Thematik der elektronischen Kriegsführung. Mit meinen Vorkenntnissen hatte ich zwar eine solide Basis, aber in den fachlichen Details erfuhr ich viel Neues und überaus Interessantes. Die Technik, die uns zur Verfügung stand, hatte ich so nie zuvor gesehen. Unglaublich – wenn die Leute draußen auf der Straße wüssten, was und wie man alles überwachen kann, welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen! Einerseits bestand die Aufgabe in der Beobachtung des übrig gebliebenen freien Teils des Internets. Andererseits waren wir gehalten, vor allem Cyberangriffe aus dem russisch kontrollierten SPF-Netz zu erkennen und zu blockieren. Das Abgreifen von Datenströmen ist dabei vergleichbar mit der Erhebung medizinischer Informationen für eine Diagnose. Aber zu wissen, welche Krankheit man hat, reicht nicht. Die Therapie ist das Ziel, im militärischen Sinn also sowohl die Abwehr von Angriffen als auch die Durchführung von aktiver Gegenwehr. Und da habe ich manchmal nicht schlecht gestaunt, mit welchen teilweise abartigen Mitteln und Methoden wir umgehen mussten. Aber Vater hatte Recht. Auf diese Weise noch etwas dazuzulernen, ist allemal besser, als bei miserablem Wetter auf dem Gefechtsfeld herumzuballern und ständig mit der Überlegung konfrontiert zu sein, ob ich als Soldat nun ein Mörder bin oder - weil es der Staat befohlen hat - legitimiert Menschen töten darf oder muss. Doch auch die elektronische Kriegsführung warf genügend grundlegende Fragen auf. Wenn ich vor dem Monitor reale Drohnen steuere, wie in einem Computerspiel, dann reicht ein Mausklick, um im tatsächlichen Kampfgebiet die Rakete abzufeuern. Bin ich dann kein Mörder? Ich bekam mit, wie in Deutschland Infrastrukturen der Strom- und Wasserversorgung angegriffen und Flugzeuge gehackt wurden. Mehrfach hätten Unbekannte beinahe die Kontrolle über Passagierflugzeuge übernommen und sie ferngesteuert irgendwo hinlenken wollen. Ausländische Geheimdienste, die wir nicht immer identifizieren konnten, tummelten sich in den sozialen Medien und wiegelten die Leute gegeneinander auf, um Unfrieden zu stiften. Kein Staat traute dem anderen, auch wenn man nach außen vorgab, politisch zu kooperieren, oder sich zum Kreis irgendwelcher Verbündeter zählte. Schillers Idealismus ‚Alle Menschen werden Brüder‘ hatte sich ins Gegenteil verkehrt. Zum ersten Mal im Leben wankte mein Weltbild des klassischen Humanismus, das die Eltern mir auf so vorbildliche Weise nahe gelegt hatte. Wie um alles in der Welt sollen Menschen, deren Kulturkreise oder Religionen sich nicht ansatzweise über den Weg trauen, gemeinsam die Herausforderungen unserer Zeit bewältigen? Mir wurde langsam klar, warum vor fünf Jahren in Indien die Welt nur so zögerlich geholfen hat. Und ein weiterer Umstand gab mir in jener Zeit zu denken: Mit dem Austritt der USA aus der NATO unter Federführung der „Lichtsekte“ ergab sich eine andere Polarisierung der Großmächte auf dem Globus. Auf der einen Seite durften technische Hilfsmittel, die aus den USA stammten, plötzlich nicht mehr genutzt werden und auf der anderen Seite ließen unerwarteterweise gerade die amerikanischen Abhörversuche in Deutschland nach. Unser Kontinent Europa interessierte die USA einfach nicht mehr. Man war aufgrund des mittlerweile auf das Dreifache gestiegenen Ölpreises stattdessen in einen handfesten und mit allen Bandagen geführten Handelskrieg mit China verwickelt und wollte gleichzeitig seine Verpflichtungen gegenüber dem Verbündeten Saudi-Arabien nachkommen. Dieser hatte wegen der Flüchtlingsströme aus dem Oman nach Norden den Notstand ausgerufen und sein Militär in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Hilfe von der UNO war nicht mehr zu erwarten und es bestand nach wie vor die Absicht, sich vor der Ebola-Pandemie in Afrika schützen zu wollen. Aber genauere Informationen bekamen auch wir im Cyberwar-Abwehrzentrum nicht. Was jedoch durch die von uns über dem Nahen Osten ferngesteuerten unbemannten Drohnen heraus kam, war der Umstand, dass sowohl Euphrat und Tigris als auch der Jordan an ihren mittleren Flussläufen fast vollständig ausgetrocknet waren. Wir registrierten in einigen Abhöraktionen, dass man sich dort mit aller Kraft gegen das einsetzende Massensterben stemmte. Doch die Wiege der Menschheit schien zu verdursten. Meine Anschauung von der Welt begann sich so durch mehr und mehr ambivalente Gedanken zu differenzieren und nach diesem Jahr des Pflichtwehrdienstes fühlte ich mich merklich erleichtert und wie befreit, den Blick von jenen, sicherlich nur ansatzweise erlebten menschlichen Abgründen weg wieder nach vorn richten zu können. Ich will studieren! Aber welches Fach? Auch darüber hatte ich schon früher oft mit den Eltern diskutiert und Mutter meinte, dass nicht eine spezielle Fachrichtung das Beste wäre, sondern die Zukunft in bestimmten Fachkombinationen liege. Das fand ich auch, denn genau diese übergreifende Sichtweise war damals in der Schule bei unserem objektorientierten Unterricht das Ziel der Methoden- und Wissensvermittlung gewesen. Nach einigem Hin und Her entschied ich mich für die Biophysik. Na klar, die Königin der Wissenschaften, die Physik brauche ich überall. Zusammen mit Biologie eröffnete sie mir Möglichkeiten, meinem Hobby ‚Umwelt‘ weiter nachzugehen und vielleicht später auch, mich auf dem Gebiet der Bionik zu spezialisieren. Dort an der Schnittstelle zwischen Elektronik und Biologie, sind Physik, Medizin, Molekularbiologie und im besonderen Kreativität und Phantasie gefordert. Das wäre wirklich fachübergreifend. Gesagt, getan.