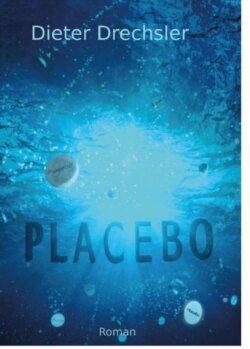Читать книгу Placebo - Dieter Drechsler - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPlacebo
Der Aufstieg ist mühsam. Schon seit einer Stunde folgen sie dem teilweise mit Geröll bedeckten, steilen Fußweg, der sie in immer enger werdenden Serpentinen zum Tempel führt.
Ciel ist diesen Weg schon oft gegangen. Gelassen, mit einer unbestimmten Würde, schreitet sie der kleinen Gruppe voran.
Nur wenige Schritte hinter ihr Maidali aus Port-au-Prince, die trotz der ungewohnten Anstrengung nur mühsam ihre Nervosität verbergen kann.
Mit einigem Abstand zu den beiden Frauen stolpert, völlig unbekümmert, Nelio den Berg hoch. An einer kurzen, ausgefransten Leine zerrt er ein hoch beladenes Muli hinter sich her, das immer wieder mal unwillig schnaubend stehen bleibt, wenn es mit seinen Hufen keinen sicheren Tritt findet.
Einige Kehren tiefer folgt eine Gruppe bunt gekleideter Frauen, die geschickt ihre Gepäckbündel auf dem Kopf balancieren. Als letzte haben sich zwei asketisch wirkende Männer der Gruppe angeschlossen.
Immer höher windet sich der Weg um die geröllbedeckte Bergflanke herum und dann ist auch der glutheiße Passatwind zu spüren, der sich an den kahlen Hängen in Haitis Süden aufgeheizt hat. Bis vor einer halben Stunde haben ab und zu schüttere Bäume noch etwas Schatten gespendet, aber nun brennt die Sonne ungnädig auf die kleine Prozession hernieder.
Im Schatten eines bedrohlich wirkenden Felsüberhanges macht Ciel Halt und blickt zurück. Das Dorf Bong, das sie vor einigen Stunden verlassen haben, ist schon längst ihren Blicken entschwunden. Sie schaut in die erhitzten Gesichter ihrer Begleiter, die nach und nach aufschließen.
Aufatmend lassen sich die Pilger auf den kühlen Felsboden sinken und die Wasserflaschen kreisen. Ciel bleibt aber stehen und begibt sich bereits nach zehn Minuten wieder schweigend auf den Weg, damit sie noch vor der Dunkelheit ihr gemeinsames Ziel erreichen.
Die Berglandschaft wandelt sich. Kleine Steinhaufen markieren den schmalen Pfad, der sich kaum noch erkennbar durch ein Felsenlabyrinth schlängelt.
Als sie angekommen sind, weitet sich der Weg zu einer kleinen Hochfläche, auf deren gegenüberliegender Seite ein hoher, rußgeschwärzter Eingang einer Höhle gähnt, der von grob gemeißelten Säulen eingerahmt wird.
Ciel bleibt mitten auf dem kleinen Platz stehen. Sie ist froh, dass es einige Minuten dauert, bis ihn alle erreicht haben, denn sie benötigt die Zeit, um sich auf das, was sie erwartet, einzustimmen. Erst dann schreitet sie gefasst auf den Höhleneingang zu.
Sie spürt, wie mit jedem Meter die uralte Magie dieses Ortes zunimmt, und nur ein paar Schritte weiter, als hätte sie eine unsichtbare Grenze überschritten, fühlt sie sich von dieser unbekannten Macht durchflutet. Trotz der Wärme laufen ihr Schauer über den Rücken. Ihr ist dieser Kontakt nicht unangenehm, beinahe so, als würde sie einem guten Freund begegnen. Trotzdem scheut sie immer wieder vor der elementaren Energie dieser spirituellen Berührung ein wenig zurück.
Auf unerklärliche Weise kostet es sie Kraft, die sie jedoch in einer anderen Form zurückerhält. Sie weiß, dass sie ohne diese Erfahrung ihre Arbeit auf Haiti nicht so lange hätte durchstehen können und nennt dieses innere Erlebnis schlicht »Transformation.«
Ergriffen kniet sie nieder, bis sie sich von diesem emotionalen Ansturm erholt hat. Dann richtet sie sich auf und wendet sich den wartenden Pilgern zu.
»De ryen (willkommen)!«
Erst jetzt legen die Pilger, die sich der Magie des Ortes ebenso wenig entziehen können und sich nicht von der Stelle rührten, ihre Bündel ab.
Sogar der pragmatische Nelio, dem die Wallfahrten längst zur Routine geworden sind, wartete andächtig, ehe er die Gurte seines Mulis öffnet, das sich über die Erleichterung freut und ungeduldig trappelt.
Ciel ist eine Voodoo-Priesterin, eine Mambo, und lebt die meiste Zeit des Jahres in Port-au-Prince. Etwa alle sechs Monate begibt sie sich auf die beschwerliche Pilgerreise zu dieser Grotte, die dem heiligen Loa Ogoun Feray geweiht ist, der nach französisch-katholischer Tradition auch St. Jacques genannt wird.
Bis auf Nelio sind ihre Begleiter zufällig. Wie immer hatte sie ihn über ihr Vorhaben zeitig informiert, damit er mit seinem Muli die Ausrüstung hoch transportiert. Außerdem kümmert er sich jedes Mal darum, dass der Termin der Wallfahrt im Dorf und der Umgebung verbreitet wird. Von ihm weiß sie auch, dass sie mittlerweile die einzige Mambo ist, die noch den mühsamen, dreieinhalbstündigen Aufstieg auf sich nimmt.
Es ist spät geworden. Die Sonne versinkt bereits hinter den benachbarten Bergen und die Felsen des Labyrinthes werfen lange kühle Schatten.
Auf dem kleinen Platz vor dem Heiligtum hat Nelio Schilfmatten ausgebreitet und in deren Mitte Holzschalen mit gesüßtem Reis und Früchten gestellt, während Ciel, der Tradition gehorchend, in der Höhle ein kleines Feuer entfacht.
Nach und nach lassen sich die Pilger auf den Schilfmatten nieder und ergänzen das Mahl mit bescheidenen Maisfladen, kleinen Kuchen, eingelegten Bohnen oder etwas Gemüse, um dann ihr Abendessen, im Gegensatz zur haitischen Gepflogenheit, nahezu schweigend einzunehmen.
Als die untergehende Sonne die Bergspitzen noch einmal golden aufglühen lässt, erhebt sich Ciel mit ernstem Gesicht, als hätte sie auf dieses Zeichen gewartet. Mit gemessenen Schritten geht sie zur Höhle, die durch das flackernde Feuer wie ein rot zuckender Schlund erscheint. Die ohnehin leise geführten Gespräche auf der Schilfmatte verstummen. Bedeutungsvoll entnimmt Ciel der Glut ein Stück verkohltes Holz und beginnt mit ihm auf dem geglätteten Boden davor zu zeichnen. Während im unruhigen Schein der Flammen auf dem rauen Felsboden allmählich das Symbol des Ogoun Feray, das heilige Veve, entsteht, spricht sie dazu leise die uralten Gebete und Verse, die seit Generationen von Mambo zu Mambo weitergegeben wurden.
Während die Pilger aufmerksam beobachten, wie sich das heilige Veve allmählich vollendet, werden sie von Nelios gedämpften Trommelrhythmen seiner Congas eingestimmt. Erst nach dem letzten Kohlestrich stehen sie auf und überreichen Ciel die mitgebrachten Opfergaben. Es sind kleine Fläschchen mit Rum, Schalen mit Fleischgerichten oder Päckchen mit Tabak, die von Gebeten begleitet dem Feuer übergeben werden.
Es ist weit nach Mitternacht, ehe sich Ciel müde in ihrem Schlafsack einrollen kann. Der Schlaf aber will sich nicht einstellen, denn sie muss an die Frau aus dem Dorf denken, die plötzlich in tiefer Trance die Rolle des anwesenden Ogoun Feray übernahm. Wie so oft war die »Besessene« überraschend gut über die Lebenssituationen der Pilger informiert und konnte ihnen »göttliche« Ratschläge erteilen.
Nachdenklich schaut Ciel zu dem sternenübersäten, tiefblauen Nachthimmel auf. Trotz der beinahe spürbaren, unermesslichen Dimensionen fühlt sie sich geborgen. Es dauert nicht lange, bis sich ihre aufgewühlten Gedanken und Gefühle beruhigen und ihr den Schlaf gönnen.
Am nächsten Morgen sind sie die letzten, die den heiligen Platz verlassen. Während Nelio das Muli bepackt, berichtet er Ciel, dass sich zwei Frauen noch vor Sonnenaufgang auf den Heimweg begeben haben. Statt Antwort zu geben, macht sie nur eine besorgte Miene, denn der geröllübersäte Weg durch das Labyrinth ist in der Dunkelheit gefährlich, dennoch ist noch nie etwas Ernstes passiert.
Die morgendliche Kühle macht den Abstieg vergleichsweise angenehm und in weniger als einer Stunde haben sie die kargen Höhen hinter sich gelassen. Nun führt ein breiter Weg die Pilger durch sorgfältig kultivierte und zum Teil abgeerntete Terrassenfelder. Eine entspannte Heimkehrstimmung macht sich breit, die durch rhythmische Sprechgesänge einiger Frauen vertieft wird.
Trotz der allgemeinen Vergnügtheit bleibt es Ciel nicht verborgen, dass Maidali zwar in den Refrain einstimmt, aber ihre melancholischen Blicke immer wieder zu ihr hinüberwandern.
»Nicht jedem ist es gegönnt, Ogoun Feray so nahe zu kommen«, spricht sie Ciel bewusst unverfänglich an.
»Das ist es nicht!«, antwortet Maidali heftig. »Wovon sollen wir denn leben, wenn Marcial wirklich zurückkommt?«
Mit einer so scharfen Reaktion hat Ciel nicht gerechnet und kann nur wortlos nicken. Sie kennt diese typisch haitischen Zustände leider nur zu gut und erinnert sich an Maidalis Gebet an der Grotte, dass ihr Mann doch zur Familie zurückkommen möge.
Maidalis Mann hat, trotz der Zerstörungen durch das Erdbeben, in einer pharmazeutischen Fabrik Arbeit gefunden. Am Anfang kam er fast jeden Sonntag nachhause, aber in letzter Zeit geschah es immer unregelmäßiger und dann brachte er kaum noch Geld mit.
Wie alle Arbeiter ist er gezwungen im fabrikeigenen Camp zu leben und in dem angeschlossenen Supermarkt einzukaufen, der ihnen mit überhöhten Preisen das sauer verdiente Geld wieder aus den Taschen zieht. Wer dieses System zu umgehen versucht, findet sich auf der Straße wieder.
Stockend erzählt Maidali, dass sie bei Marcials letzten Besuch vor zwei Wochen, als er nur zwei Dollar mitbrachte, ihm enttäuscht Vorhaltungen gemacht hatte. Er hatte daraufhin die Hütte wütend verlassen, und sich seitdem nicht mehr blickenlassen.
Ciel atmet tief durch. Sie arbeitet nun schon seit fast fünfzehn Jahren als deutsche Ärztin auf Haiti und verlässt die Insel nur zu den Regenzeiten im Frühjahr und Herbst. In diesen eineinhalb Jahrzehnten hat sich die Situation der Haitianer immer weiter verschlechtert.
Trotzdem wird sie in vier Wochen wieder an ihrem Schreibtisch in Köln sitzen und sich die Finger wund wählen, um finanzielle Unterstützung für ihre Arbeit zu erbetteln. Ihre Überzeugung, das Richtige zu tun, bröckelt, denn in letzter Zeit hat sich das hässliche Gefühl, dass sie gegen Windmühlenflügel kämpft, dazu gesellt.
Maidali holt sie in die Realität zurück. »Warum schweigst du?«
»Eskize mwen (Entschuldigung), Maidali«, antwortet Ciel beschämt. »Auch ich muss mir über meine Zukunft Gedanken machen.«
***
Vorsichtig dreht Alexander den Zündschlüssel im Schloss und erschreckt sich beinahe, als der Motor seines gut fünfzehn Jahre alten Fiesta, trotz der vergangenen, feuchtkalten Nacht, problemlos anspringt. Zur Sicherheit lässt er ihn eine halbe Minute warmlaufen, ehe er sich aus der engen Parklücke quält.
Besorgt sieht er an der nächsten roten Ampel auf die Uhr, aber bis zu dem Termin mit seinem Redakteur hat er noch eine Stunde Zeit und entspannt sich. Normalerweise erhält er seine Reportagenaufträge einfach per Telefon oder SMS, seltener per E-Mail, aber dieses Mal will ihn der Chefredakteur unbedingt vorher sprechen.
»Guten Morgen Alexander!«, quakt der Lautsprecher an der Schranke zum Verlagsgelände.
»Guten Morgen Laura, ist unser Chef schon da?«, fragt er durch das runtergekurbelte Fenster.
Durch die spiegelnde Pförtnerhausscheibe kann er nur andeutungsweise erkennen, dass sie ihre tiefschwarze Mähne schüttelt.
»Der kommt frühestens in einer halben Stunde. Du darfst heute ausnahmsweise vorne parken und ich habe frischen Kaffee für dich.«
»Danke!«
Der Duft von dem gerade aufgebrühten Kaffee, gemischt mit kaltem Zigarettenrauch, schlägt ihm entgegen, als er die Tür zum Pförtnerhaus öffnet.
»Hei!«
Lauras Augen strahlen. »Da bist du ja schon.«
Sie zeigt auf die Kaffeemaschine.
»Bitte, bedien´ dich.«
Er schenkt sich eine Tasse ein und setzt sich auf einen abgeschabten Bürostuhl in der Nähe des Einganges. Während er vorsichtig den heißen Kaffee schlürft, beobachtete er über dem Tassenrand hinweg Laura, die einen Besucher abfertigt.
Sie haben gemeinsam Journalistik studiert. Während er sich mit zahllosen kleinen Beiträgen mehr schlecht als recht über Wasser hält, hat sie zumindest eine »feste Anstellung bei einem Verlag«, wie sie ihre berufliche Situation ironisch darstellt. Für Reportagen hat sie allerdings kaum noch Zeit.
Laura wendet sich ihm zu. Ihre schwarze Mähne umrahmt ihr Gesicht und unterstreicht ihr Lächeln.
»Wie geht’s dir?«
»Noch ganz OK. Der Chef will mich heute persönlich sehen.«
»Noch ganz OK? Vielleicht kommt ja der große Auftrag?«, frotzelt Laura, weil sie selbst nicht daran glaubt.
Alexander sieht sie prüfend an.
»Hast du was gehört?«
»Hier an der Schranke? Natürlich nicht«, spottet sie lachend. »Ich würde es dir einfach wünschen«, fügt sie ernst hinzu.
Sie werden durch die Ankunft des Chefredakteurs unterbrochen.
»Guten Morgen Herr Sievers!«, begrüßt ihn Laura durchs Mikrofon.
Sie öffnet die Schranke durch Knopfdruck und flüstert unbewusst.
»Er ist da. Ich drücke dir die Daumen. Sagst du mir Bescheid, wie es ausgegangen ist?«
»Mach' ich!«, ruft Alexander, der schon halb zur Tür raus ist. »Und vielen Dank für den Kaffee.«
Noch nicht mal eine Stunde später ist er zurück und lässt sich breit grinsend auf den freien Bürostuhl fallen. Laura platzt beinahe vor Neugier.
»Was gab es?«
»Ich habe einen richtigen Reportageauftrag«, hört er sich sagen und kann es selbst kaum glauben.
»Super«, freut sie sich mit ihm. »Worum geht es denn?«
»Du kennst doch diese Beiträge im Kölner Regionalteil, in denen wichtige oder innovative Firmen vorgestellt werden.«
»Ja!?«
»In diesem Rahmen soll ich den neuen Trend: »Alternative und natürliche Heilmittel«, recherchieren.« Er flüstert verschwörerisch: »Rein zufällig habe ich zur Orientierung einige Herstelleradressen mit auf den Weg bekommen.«
Laura sieht in melancholisch an.
»So etwas hätte ich auch gerne mal gemacht.«
***
»Und - gibt es was Neues?«
Jens Höfner, Leiter des Labors, zuckt zusammen, als ihn sein Kollege Tom anspricht.
»Eigentlich nicht«, antwortet er ausweichend, denn vor wenigen Minuten war die Betriebsratsitzung mit dem Fazit zu Ende gegangen, dass die Zukunftsaussichten der Cardea PharmaLab GmbH, und damit auch seine eigene, als fast fünfzigjähriger Pharmakologe, alles andere als rosig sind.
Er legt die Hand auf die Klinke zu seinem Büro, das an dem Labor angrenzt, um dort mit der neuen Situation erst mal selbst fertig zu werden.
»Und uneigentlich?«, bohrt Tom misstrauisch nach und kommt mit weiten Schritten auf Jens zu. Der wie immer zu weite Laborkittel umflattert ihn dabei. Zusammen mit dem hageren Gesicht, das von einer markanten Nase geprägt wird, muss Jens unwillkürlich an einen Geier denken.
»Du weißt es doch auch«, antwortet Jens und wendet sich Tom zu, »der Firma ging es schon mal besser.«
Tom nickt betroffen. »Mit Generica ist wohl kein Geschäft mehr zu machen.«
»Da sagst du was«. Jens winkt resigniert ab. »Gegen die Großen kommen wir einfach nicht an. Unsere Rezepturen sind absolut identisch und trotzdem verkauft sich deren teures Zeug wie geschnitten Brot.«
»Haste schon gelesen?«, Tom reicht ihm ein aufgeschlagenes Fachmagazin, »Einige Ärzte berichten neuerdings über starke Nebenwirkungen generischer Präparate.«
Jens wirft einen leicht verzweifelten Blick auf die Seite.
»Das ist die Härte!«, wettert er ärgerlich. »Nur, weil wir billiger sind, sind die Patienten fest davon überzeugt, dass das Präparat nicht so wirksam ist, und pflegen mit Hingabe irgendwelche Nocebo-Effekte.«
»Vielleicht wird das von den Multis sogar unterstützt?«, spekuliert Tom.
Jens winkt ab. »Das haben die gar nicht nötig, die Patienten machen das ganz alleine. Du kennst das doch: Wat nichs koss, dat iss nix.«
»Wir brauchen dringend was Neues«, seufzt Tom nachdenklich. »Ach übrigens!«, er zeigt auf einen Labortisch, der mit verschiedenen Messgeräten und Apparaturen ausgestattet ist, »deine Geschichte mit dem Extrakt aus Weidenruten funktioniert leider nicht.«
»Meine Geschichte?«
Jens geht mit einem fragenden Seitenblick zu dem Tisch und sieht sich stirnrunzelnd die Messprotokolle an.
»Was funktioniert denn nicht? Die Wirkstoffe sind doch alle da.«
»Das habe ich ja auch hingekriegt. Aber das dicke Ende kam dann doch noch.«
»Ja?«, fragt Jens ungeduldig.
»Deine Idee, die begleitenden Adjuvantien, also Hilfsstoffe zur Acetylsalicylsäure, also ASS, so wie sie in der natürlichen Weidenrinde vorkommen, auch zu extrahieren und alles in einem Präparat unterzubringen, war genial.« Tom wiegt anerkennend seinen hageren Kopf. »Leider gibt es ein Problem.«
Auf Jens´ Stirn bildet sich eine ärgerliche Falte. »Mein Gott Tom, machs doch nicht so spannend!«
»Die Mischung der einzelnen Komponenten ist sehr kritisch. In Verbindung mit einer Überdosierung von ASS kann und wird es eine lang anhaltende totale Schmerzunempfindlichkeit und letztlich sogar Lähmungen verursachen.«
Jens´ Gedanken überschlagen sich fast. Das ist im Kern eigentlich genau das, was sie erreichen wollten. Durch die natürlichen Adjuvantien, er nennt sie Türöffner, braucht man viel weniger ASS bei gleichem Resultat. Damit gibt es deutlich weniger der gefürchteten Nebenwirkungen, solange die Mischung nicht verändert wird.
»Gibt es schon Daten?«
»Wir haben Mäuse zum Test überdosiert gefüttert. - Ihr Nervensystem war anschließend paralysiert. Die hätten es nicht gemerkt, wenn wir sie halbiert hätten.«
»Verstehe. Ab welcher Dosierung wird es denn kritisch?«, fragt Jens besorgt.
»Hochgerechnet auf einen Menschen«, Tom macht eine abwägende Handbewegung, »so etwa ab fünfhundert Milligramm dürfte es spannend werden. Und genau diese Menge werfen einige Aspirinfreaks Tag für Tag ein, weil irgendjemand mal behauptet hat, ASS würde einem Herzinfarkt vorbeugen.«
»Gerüchte sind eine coole Verkaufstrategie und gleichzeitig wird die Rentenkasse entlastet«, bemerkt Jens sarkastisch. »Kriegen wir die Kuh vom Eis?«
Tom hebt hilflos die Schultern.
»Tut mir leid, zurzeit sehe ich nicht mal den Ansatz einer Lösung.«
***
Vanessa, ihr bürgerlicher Name kommt ihr richtig fremd vor, schaut nachdenklich aus dem Fenster des ICE, der sie geräuschlos mit Tempo dreihundert von Köln kommend durch den Westerwald nach Frankfurt transportiert. Ausgerechnet der Anblick der sauberen Ortschaften und herausgeputzten Häuser, die sich hinter den gepflegten Hecken ihrer Gärten verstecken, erinnert sie merkwürdigerweise an den allgegenwärtigen Müll Haitis. Irritiert wendet sich ab.
Eine Woche ist es nun her, seitdem sie wieder in Deutschland ist. Die Auswirkungen des Jetlags sind zwar fast völlig verschwunden, aber ohne den Wecker wäre sie heute Morgen immer noch nicht rechtzeitig wachgeworden.
»Vielleicht liegt es daran«, sinniert sie und blättert ihre Präsentation auf dem Notebook durch. Die Spenderliste für Haiti ist lang geworden. Ein »Who's who« der rheinischen Wirtschaft, die ihre Wirkung bei den Frankfurter Bankern sicher nicht verfehlen wird. Zufrieden ruft sie die nächste Seite auf, als eine automatische Durchsage die Ankunft ankündigt und der ICE leise rumpelnd in dem Frankfurter Bahnhof einrollt. Hastig klappt sie ihr Notebook zu und beeilt sich zum Ausgang zu kommen. Da sich auf dem Gang eine kurze Schlange gebildet hat, findet sie genug Zeit einen prüfenden Blick in den bodenlangen Spiegel der Garderobe zu werfen.
Sie hat sich für einen dezent eleganten Hosenanzug entschieden, der ihren Auftritt vor dem Vorstand der Genossenschaftsbanken seriös unterstreichen wird. Zur Betonung hat sie sich noch eine Brosche in Form eines Äskulapstabes, das Symbol des ärztlichen Standes, angesteckt.
Am frühen Nachmittag ist sie bereits wieder auf dem Rückweg nach Köln. Die anfänglichen Schwierigkeiten, ihr Notebook an das Hausnetz der Bank anzuschließen, hatte sie zwar gehörig nervös gemacht, doch mit der überschwänglichen Hilfe des Vorstandes, dem die Probleme vermutlich sehr vertraut waren, konnte sie doch noch nahezu pünktlich beginnen. Sie wurde aber das Gefühl nicht los, dass ihr Vortrag um Unterstützung durch die Bank, nicht mehr entscheidend gewesen war. Nur der ausdrückliche Wunsch der Werbeabteilung nach aussagekräftigen Fotos für die Kundenzeitschrift und dem Internetportal beunruhigt sie nachhaltig, weil sie damit keine Erfahrungen hat.
»Was soll’s«, sagt sie achselzuckend zu sich selbst, »das Geld wird für ein weiteres Jahr reichen und das mit den Fotos kriegen wir auch noch hin.«
Denn wie jedes Mal bei ihren Deutschlandaufenthalten hat sie sich die Finger wundgewählt, unzählige Telefonate geführt, ihr Projekt vorgestellt und um Förderung gebeten.
»Gebeten?«, sie lächelt ironisch über sich selbst. »Gebettelt!«
So problemlos die Fahrt nach Frankfurt und zurück war, die Heimfahrt mit dem väterlichen Kombi, den sie im Parkhaus unter dem Bahnhof abgestellt hatte, wuchs sich allerdings zu einer Irrfahrt durch chaotisch anmutende Baustellen aus. Der Kölner Verkehrsalltag hatte sie wieder einmal voll im Griff.
Durch zahllose Staus genervt, und nach einer Fahrtdauer, die sich der Zugreise anglich, manövriert sie den Wagen in die geräumige Einfahrt des elterlichen Hauses. Wie immer wird sie schon erwartet.
»Hallo Vanessa!«, begrüßt ihr Vater sie und wirft einen unauffälligen Blick, wie er meint, auf die kritischen Stellen der Karosserie.
»Hallo Papps, alles in Ordnung!«, lacht sie. »Komm mal mit nach Haiti. Spätestens nach einer Woche bist du froh, dass die Scheinwerfer nicht verschwunden sind oder der Wagen ohne Räder auf den Bremsscheiben steht.«
Schwungvoll steigt sie aus und überreicht ihm schmunzelnd die Schlüssel.
Der nächste Tag ist mit Verpflichtungen ausgefüllt. Einer ihrer Sponsoren erwartet sie, im Rahmen einer Gesundheitsmesse, in einer halben Stunde auf dem Stand. Und am Nachmittag soll sie ihr Projekt in einem Gemeindesaal im Kölner Norden vorstellen.
Nervös trommelt sie mit den Fingern auf das Lenkrad, denn es geht nicht, vermutlich wegen eines dünnen Regens, der aus einem grauverhangenen Himmel fällt, voran.
Vermutlich deshalb muss sie unwillkürlich an das sommerliche heiße Haiti denken. Ob ihre rechte Hand und Fahrer Kaholo, ein hünenhafter Haitianer, wirklich nur die Tagesrationen an Medikamenten herausgibt und darauf achtet, dass sie sofort in seinem Beisein geschluckt werden? Denn mitgegebene Tabletten landen direkt auf dem Wochenmarkt in Port-au-Prince, um die spärlichen Haushaltskassen aufzubessern.
Vanessa atmet tief durch und schiebt ihre trüben Gedanken beiseite, denn sie hat trotz des Staus ihren Parkplatz erreicht. Außerdem konnte sie sich bisher immer auf Kaholo verlassen, warum sollte es diesmal anders sein?
Obwohl das Gedränge und der Lärm in der Messehalle spontan ihren Fluchtinstinkt wecken, steht sie nach nervösem Suchen doch noch pünktlich vor dem Stand ihres Sponsors.
Kaum angekommen stürzt ein aufgeregter Marketingmanager mit hochrotem Kopf auf sie zu, um ihr hektisch ein Informationsblatt in die Hand zu drücken.
»Hier sind unsere Themenschwerpunkte. Die ersten Presseleute sind schon da.«
»Aha, und was soll ich denen sagen?«
»Das steht alles auf dem Blatt!«, antwortet er hastig. »Ich muss mich jetzt um die Hostessen kümmern«, und er verschwindet irgendwo im chaotischen Treiben.
Vanessa überfliegt das Script. Nach wenigen Zeilen wird ihr klar, dass sie entweder das falsche Blatt erhalten hat, oder der Manager nicht über ihr Fachgebiet informiert ist.
Nach einer kurzen Suche findet sie ihn, auf die Hostessen einredend, in einem Besprechungsraum.
»Ich bin jetzt hier beschäftigt!«, herrscht er Vanessa an, als sie sich bemerkbar macht.
»Ich brauche nur das korrekte Script«, entgegnet sie kühl. Fasziniert beobachtet sie, dass seine Gesichtsfarbe einen noch tieferen Rotton annimmt. Unwirsch reißt er ihr das Blatt aus der Hand.
»Was ist daran falsch?«, bellt er sie an.
»Ich bin keine Pharmakologin, sondern eine praktizierende Ärztin!«
»Oh Gott!«
Trotzdem steht sie zehn Minuten später auf einer kleinen Bühne und vermischt geschickt ihre eigene Präsentation mit dem neuen Marketingkonzept ihres Sponsors.
Erst nach der Vorstellung spürt sie, wie sehr sie das angestrengt hat und flüchtet, um den überschwänglichen Dankesworten des Marketingmanagers zu entkommen, in eine Cafeteria in der Nähe des Halleneinganges.
Während sie auf den bestellten Orangensaft wartet, erkennt sie einen leger gekleideten jungen Mann am Nachbartisch wieder, den sie vorher unter den Zuschauern gesehen hatte.
Lächelnd erwidert er ihren Blick.
»Hallo, das war eine sehr interessante Präsentation!«, lobt er sie mit verhaltener Stimme über die Tische hinweg.
»Danke!«, lächelt sie zurück und schaut bewusst in eine andere Richtung, aber es nutzt nichts.
»Mein Name ist Alexander Bach!«, tönt es herüber. Mit kritisch gekrauster Stirn sieht sie ihn ungnädig an und bereut es. Entweder hat er ihre deutliche Ablehnung übersehen oder schlichtweg ignoriert. Jedenfalls stellt er sich als Reporter vor und berichtet ihr kurz von seinem Auftrag.
»Kann ich Ihnen eine Frage stellen?«
Genervt nippt sie an dem mit zu vielen Eiswürfeln verdünnten Orangensaft, um Zeit zu gewinnen.
»Ja bitte!«
»Ist es wirklich so, dass in den Entwicklungsländern vermehrt natürliche Heilmittel eingesetzt werden?«
»Ja natürlich, für die Produkte der westlichen Pharmaindustrie fehlt schlichtweg das Geld«, antwortet sie nüchtern und hofft inständig, damit das Gespräch beendet zu haben.
Betroffen schweigt Alexander für einige Sekunden.
»Sind denn die natürlichen Heilmittel genauso wirksam?«
Vanessa zögert mit der Antwort, obwohl sie im Grunde mit dieser Frage rechnete, weil sie sich diese auch immer wieder stellt. Sie schaut Alexander an und ihr Blick fällt auf seinen Fotoapparat, den er lässig über der linken Schulter hängen hat. Der offene, unverbrauchte Gesichtsausdruck unter dem blonden Schopf gefällt ihr und sein Interesse an dem Thema ist ehrlich. Der Wunsch der Genossenschaftsbank nach werbewirksamen Fotos kommt ihr in den Sinn.
»Die Antwort finden Sie auf Haiti.«
Alexander sieht sie verblüfft an. »Äh, wie meinen Sie das?«
»Sie suchen nach einer Antwort über die Wirksamkeit von natürlichen Heilmitteln und ich benötige gute Fotos, um auch in Zukunft meine Arbeit in Haiti fortsetzen zu können.«
»Ist das ein Auftrag?«, fragt er unsicher und sieht sich um, als hätte sie womöglich jemand Anderen gemeint. »Darf ich an Ihren Tisch kommen?«
Sie nickt und schildert ihm anschließend ihre Situation.
»Bei mir sieht es nicht viel anders aus«, grient Alexander, »mein Auto ist fünfzehn Jahre alt und der Kredit für diesen Fotoapparat ist noch nicht abbezahlt.«
Vanessa kann nur mit Mühe ein Schmunzeln über die erzwungene Parallele unterdrücken und schaut auf die Uhr.
»Ich habe heute noch einen weiteren Termin. Ich melde mich. Kann ich Ihre Karte haben?«, fragt sie, bevor sie sich verabschiedet.
***
Wie so oft ist Jens als Erster im Labor, öffnet den Schaltschrank und drückt, ohne wirklich Hinsehen zu müssen, im Inneren einige Tasten. Während die elektrischen Rollladen hochfahren und der lang gestreckte Raum aus dem Dunkel auftaucht, sieht er sich wehmütig um.
Früher hatten hier acht Kollegen gearbeitet, die von sechs Praktikanten unterstützt wurden. Jetzt waren sie nur noch dritt.
Dafür klicken und summen nun überall Roboter, die unermüdlich Proben schütteln oder Messungen durchführen.
»Wie lang noch?«, fragt er sich und wendet sich abrupt ab.
In seinem Büro angekommen betrachtet er den Prospektstapel, den er gestern auf der Messe zusammengesammelt hatte.
»Macht das noch Sinn?«, fragt er sich seufzend und beginnt ihn trotzdem durchzuarbeiten.
Nach einer Stunde zieht er Bilanz.
Es gibt praktisch kaum ein Prospekt der modernen pharmazeutischen Industrie, den nicht das Wort »Natur«, »biologisch« oder »natürlich« ziert. Der Marketingtrend zu so genannten natürlichen Heilmitteln ist unübersehbar.
Mit nachdenklicher Miene macht er sich mit den sortierten Unterlagen auf den Weg zu seinem Chef.
Alfred Husse wirft nur einen flüchtigen Blick auf die Prospekte, die ihm Jens auf dem Besprechungstisch aufschichtet.
»Wir müssen ohnehin unsere Strategie ändern und komplett neu aufstellen«, bemerkt er trocken und schiebt sie unwillig zur Seite.
»OK«, Jens zeigt spöttisch auf den kleineren Stapel, »bei den hier vorgestellten synthetischen Medikamenten ist lediglich der Aufdruck »natürlich«.«
Alfred Husse nimmt einen der Prospekte auf und blättert ihn wenig interessiert durch. Lässig wirft er ihn auf den Tisch zurück. »Das wird uns auch nicht weiterhelfen.«
Er sieht Jens durch die altmodische Hornbrille an. Die durch die dicken Gläser vergrößerten Augen haben einen unübersehbar resignierten Ausdruck.
»Setzen wir uns doch.«
Er wartet bis Jens Platz genommen hatte, ehe er fortfährt.
»Warum machen wir nicht einen großen Schritt in diese Richtung und spezifizieren als Erster die Drogen der traditionellen chinesischen Medizin für den deutschen Markt?«
»Was? Dieses Chinazeug?«, Jens verschärft den Tonfall, »welche Maßstäbe sollen wir denn an Schlangenköpfe oder Tigerpimmel anlegen? Ich sehe schon die roten Aufkleber. – Extra lang! Beachten Sie den Frischestempel!«, frotzelt er aufgebracht.
Alfred Husse verzieht keine Miene und schweigt. Verunsichert wechselt Jens kurzerhand das Thema. »Unser neues Schmerzmittel ist fertig.«
Alfreds Augen signalisieren müdes Interesse. »Ja?«
»Wir können es jetzt zur klinischen Prüfung geben.«
»Das dauert ja wieder drei Ewigkeiten«, winkt sein Gegenüber ab.
»Alfred, ich kenne unsere Situation. Ein ehemaliger Studienkollege von mir könnte den Vorgang vielleicht drastisch beschleunigen.«
»Aha?«
Jens beugt sich ein wenig nach vorne.
»Die verwendeten Wirkstoffe sind alle bekannt und katalogisiert. Von dieser Seite sind keine Verzögerungen zu erwarten. Es geht also nur noch um die Terminierung der Prüfung.«
»Verstehe«, schmunzelt Alfred Husse verschmitzt. »Er bekommt die Proben einfach etwas früher als heute.«
Ein kehliges Lachen dröhnt durch das Büro.
Jens bleibt ernst.
»Das ist für ihn mit viel Aufwand verbunden. Er muss parallel zur verkürzten klinischen Prüfung das Protokoll für einen längeren Zeitraum erstellen.«
Ein unwilliger Schatten überzieht das Gesicht seines Gegenübers.
»Ich habe es mir schon gedacht, dass es teurer wird. – Frag ihn!«
»OK werd' ich sofort machen«, sagt Jens beschwichtigend. »Wie werden wir unser neues Medikament denn nennen?«
»Das überlasse ich dir«, meint Alfred Husse gönnerhaft.
»Eine kleine Abstimmung im Labor ergab: Cardea Salicin Natur.«
»Das hört sich sehr gut an! Ich werde es der Werbeabteilung vorschlagen.«
***
Wie erstarrt sieht Alexander Vanessa Weigert hinterher, als sie die Cafeteria verlässt. Monatelang erhielt er nur winzige Aufträge, die kaum die Kosten einspielen und er nächtelang Taxi fahren muss, um seine Miete bezahlen zu können, und nun zeichnet sich, zusätzlich zu einer richtigen Reportage, sogar die Chance für einen internationalen Einsatz ab.
»Komm wieder runter!«, ermahnt er sich selbst. »Noch haste keinen Auftrag!«
Trotzdem prüft er den Akkustand seines Handys, um keinen Anruf zu verpassen, ehe er sich wieder in das Messegetümmel stürzt.
Sein Presseausweis bewirkt kleine Wunder und öffnet Türen, die dem normalen Besucher in der Regel verschlossen bleiben. Aber er ist froh, dass während eines informellen Gespräches sein Handy klingelt und er eine Ausrede hat, um dem nicht enden wollenden Wortschwall eines Koffein gedopten Marketingleiters entkommen zu können.
Zwanzig Minuten später sitzt er dem Anrufer gegenüber. Der Gegensatz ist erfrischend. Das Gespräch verläuft ruhig, auch wenn die Diskrepanz zwischen den Wünschen der Firma und einer glaubwürdigen Reportage nicht einfach zu überbrücken ist. Nahezu widerstandslos folgt er der Einladung zu einem Abendessen, da sich sein Magen, auf Grund des überall reichlich angebotenen Kaffees, ohnehin schon sauer gemeldet hat.
Am nächsten Morgen, er hatte noch nicht mal die Augen geöffnet, und als hätte der Gedanke die ganze Nacht auf diesen Moment gelauert, stellt er als Erstes fest, dass Vanessa Weigert nicht angerufen hat.
Eine gewisse unbestimmte Enttäuschung ergreift ihn, aber sie wird schnell von der Arbeit an seiner Reportage verdrängt, denn die Auswertung des gesammelten Materials ist schwierig. Seine Erfahrungen mit der Pharmaindustrie beschränkten sich bisher auf Kopfschmerztabletten und sein letzter Arztbesuch liegt auch schon über fünf, oder sind es schon zehn? Jahre zurück. Immer wieder stolpert er über Fachbegriffe oder nebulöse Werbeaussagen und muss ein Online-Lexikon zurate ziehen. Trotz der werbetechnischen Tricks wird ihm nach und nach klar, dass viele Mittel gegen Krankheiten angeboten werden, die eigentlich gar keine sind.
Mit gequältem Blick nimmt er einen weiteren Prospekt vom Stapel, der in seiner Aufmachung an eine pharmazeutisch-medizinische Fachinformation erinnert, sich aber letztlich auch nur pseudowissenschaftlich an interessierte Endverbraucher wendet.
»Abführmittel auf Feigenbasis«, stellt er nach kurzer Lektüre fest und trägt das Ergebnis in einer Liste ein.
Gerade als er den nächsten Prospekt aufschlägt, knurrt sein Handy, das er unter einen Stapel Papiere begraben hat. Hektisch schiebt er ihn beiseite und starrt auf das Display: Vanessa Weigert.
Alexander spürt, wie sich sein Herzschlag beschleunigt. Dennoch benötigt er eine schier unendliche Sekunde, um die grüne Taste zu drücken.
»Alexander Bach«, kiekst er in das Mikrofon, weil seine Stimmbänder plötzlich belegt sind.
»Hallo Herr Bach«, meldet sich Vanessa mit munterer Stimme. »Erinnern Sie sich noch an unser Gespräch, gestern in der Cafeteria?«
Alexander räuspert sich. »Oh ja, wie sollte ich das vergessen, ich habe auf Ihren Anruf gewartet.«
Vanessa überhört die versteckte Kritik.
»Ich habe ein gute und eine schlechte Nachricht. - Welche möchte Sie zuerst hören?«
Alexander traut seinen Ohren nicht. Für ihn wäre die mögliche Reportage auf Haiti ein wichtiger Karriereschritt, und sie kokettiert damit. Er versucht, die Nervosität in seiner Stimme zu unterdrücken.
»Beide!«
»Gut, dann beginne ich mit der Guten. Unser Sponsor übernimmt Ihre anfallenden Reisekosten.«
»Unser Sponsor?« Hat sie »unser Sponsor« gesagt? Alexander kann es kaum fassen. »Das, das hört sich schon mal sehr viel versprechend an«, stottert er, »so schlecht kann die schlechte Nachricht gar nicht mehr sein.«
»OK. Der Abgabetermin ist der fünfzehnte Juli.«
»So schlimm hört sich das nicht an.«
Vanessa lacht.
»Zwischen der Regenzeit und dem Abgabetermin bleiben uns nur vier Wochen. - Bei rund fünfunddreißig Grad, im Schatten wohlgemerkt.«
»Fünfunddreißig Grad?«, fragt er ungläubig und hofft, sich diesmal verhört zu haben.
»Ja leider! Zum Glück ist die Luft im Sommer für haitische Verhältnisse relativ trocken. Wir fliegen Ende Mai, OK?«
Alexander kann es kaum fassen.
»Ende Mai, - meinerseits ja«, antwortet er zögerlich. An Vanessas Tempo muss er sich noch gewöhnen. »Ich weiß aber noch nicht, was mein Chefredakteur dazu sagt.«
»Klar«, antwortet Vanessa unbekümmert, als wäre auch diese Hürde schon längst genommen. »Das wär's erst mal. Ich warte auf Ihren Anruf.«
Alexander ist wie betäubt, nachdem sie aufgelegt hat. Es dauerte einige Sekunden, bis er einen klaren Gedanken fassen und sich innerlich auf das Gespräch mit seinem Redakteur vorbereiten kann.
Eine halbe Stunde später steht er vor der Schranke des Verlagsgeländes.
»Hallo Laura!«
»Hi, Alexander. Schon wieder hier?«, wundert sie sich.
»Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus«, antwortet er geheimnisvoll, »lässt du mich rein?«
»Danke für die erschöpfende Information«, ärgert sich Laura gekränkt. »Parkplatz dreiundzwanzig, melde dich mal.«
Die Schranke hebt sich.
Auf dem Weg zum Chefredakteur spürt Alexander, wie er zunehmend nervöser wird und muss vor der Bürotür mehrmals tief durchatmen, aber das Chaos im Kopf bleibt.
Was wird ihn erwarten? Abgesehen von den üblichen redaktionellen Meinungsverschiedenheiten hat er bisher nichts wirklich Schlechtes über seinen Chef gehört. Im ungünstigsten Fall muss er eben die Reportageserie abgeben, wenn er auf die Haitireise besteht ...
Er gibt sich einen Ruck, klopft an und öffnet die Tür.
»Guten Tag, Herr Sievers!«
Alexander merkt, wie ihm die Röte ins Gesicht steigt, weil er mehr krächzt als spricht.
»Hallo Alexander!« Der leicht untersetzte Mann mittleren Alters steht ohne zu zögern auf und reichte ihm die Hand. »Bitte, setzen wir uns doch« und zeigt zu dem Besprechungstisch, auf dem eine Wasserflasche mit Gläsern steht.
Alexanders Nervosität ist nicht zu übersehen und der Chefredakteur wartet geduldig, bis sich Alexander mit leicht zitternden Fingern eingeschenkt und einen Schluck genommen hat.
»Nun erzähl mal. Was tut sich denn bei dir?«
Mit kurzen Worten umreißt Alexander seinen Auftrag und lässt auch die Wetterbedingungen nicht unerwähnt.
»Das hört sich ja sehr äußerst vielversprechend an. So etwas bekommt man nicht alle Tage angeboten«, meint der Chefredakteur jovial und denkt einige Sekunden lang schweigend nach. Dann geht er wortlos zu seinem Schreibtisch, um anschließend mit einigen Notizen zu zurückzukehren, die er Alexander auf den Tisch legt.
»Bitte«, er sieht Alexander erwartungsvoll an. »Erst letzte Woche haben wir bei der Redaktionskonferenz über eine Reportage, naja eher so eine Art Nachlese, auf Haiti nachgedacht. - Und jetzt kommst du und planst dorthin zu reisen«. Er schüttelt schmunzelnd den Kopf. »Bei solchen Zufällen kann man ins Grübeln kommen. Traust du dir das zu?«
Alexander hat mit allen möglichen Hindernissen gerechnet, aber dass er offene Türen einrennt, überhaupt nicht.
»Im Prinzip ja«, hört er sich sagen und ärgert sich über seine unentschlossene Antwort.
»Gut«, antwortet Herr Sievers mit verbindlichem Unterton, »dann kläre bitte, ob es mit deinem anderen Auftraggeber Probleme gibt, wenn du im Anschluss für uns dort tätig bist.«
Alexander nickt schweigend und kann das Gehörte kaum fassen.
»Du hast dich sicherlich schon mit der Situation in Haiti beschäftigt?«
Alexander nickt vorsorglich und ruft sein Wissen über Haiti ab. Obwohl es dort über dreihunderttausend Erdbebenopfer gegeben hat, taucht seit Längerem nichts mehr in den Nachrichten auf. Er bemerkt beschämt, dass er kaum mehr über diese Insel weiß und hofft inständig, dass sein Chef nicht nach Details fragt.
»Es ist nach wie vor ein Katastrophengebiet«, fährt der Chefredakteur fort, »und du wirst einen Assistenten benötigen. An wen denkst du denn?«
»Das muss ich mir noch genau überlegen«, antwortet Alexander ausweichend, weil ihm tausend andere Gedanken gleichzeitig durch den Kopf schießen. »Ich gebe rechtzeitig Bescheid«, fügt er hastig hinzu.
Es ist schon fast Mittag, als Alexander nach unzähligen Telefonaten und Gesprächen mit einem Stapel Unterlagen auf dem Parkplatz steht und das bisher Geschehene Revue passieren lässt.
Es ist wahr, er hat eine Auslandreportage!
Wie in Trance schließt er sein Auto auf. Gedankenverloren fällt dabei sein Blick auf das Pförtnerhäuschen mit den spiegelnden Scheiben und sein abwesender Gesichtsausdruck wandelt sich. Energisch öffnet er die klemmende Fonttür seines Fiestas, legt die Ordner ab, um anschließend mit festem Schritt zu dem Häuschen zu gehen.
»Hallo Laura!«
»Hi Alexander«, strahlt sie in an.
»Wie lange hast du noch?«, fragt er geradeheraus.
Sie sieht auf die Uhr über dem Schreibtisch.
»Nur noch ein paar Minuten. Meine Ablösung kommt gleich. - Wieso?«, fragt sie mit skeptisch gekrauster Stirn.
»Ich möchte mit dir etwas besprechen. Hast du danach Zeit?«
Laura signalisiert ihm Zustimmung und öffnet nebenbei per Knopfdruck einem Kollegen die Schranke. Mit kritischem Blick verfolgt sie dessen ungeschickte Ausfahrt.
Ohne Alexander anzusehen, fragt sie: »Ist was passiert?«
»Wie man's nimmt.«
Besorgt dreht sie sich um und sieht in sein schmunzelndes Gesicht.
»Duuu!«, droht sie ihm mit der Faust.
In diesem Augenblick tritt ihre Ablösung ein und meint verschmitzt: »Wie ich sehe, kennt ihr euch wohl schon länger?«
»Überhaupt nicht, dieser Herr da ist mir völlig fremd und ich erwarte von ihm, dass er sofort mit mir zusammen das Büro verlässt.«
***
Vanessa kann sich nicht entscheiden, ob sie sich ärgern oder lachen soll, als sie ihren Vater wieder in der Einfahrt stehen sieht und sie mit weiten, ausholenden Handbewegungen auf den Platz vor der Garage einweist.
»Ich bringe dir morgen zwei Kellen mit!«, ruft sie ihm anstatt einer Begrüßung beim Aussteigen zu.
»Zwei Kellen? Wozu?«, fragt er verständnislos.
»Damit du mir beim Einparken deutlichere Signale geben kannst.«
»Vanessa«, ermahnt sie ihr Vater, »ich will dir doch nur helfen.«
Du hast doch nur Angst um dein heilig’ Blechle, schießt es ihr durch den Kopf und beißt sich auf die Zunge.
»Danke Paps. Aber die Einfahrt ist wirklich breit genug.«
Sie zeigt auf das graue gemusterte Betonpflaster, das sogar einem Lastzug bequem Platz bieten würde und eilt ins Haus.
Ihre Mutter scheint sich nicht zu freuen.
»Kind, Tag für Tag bist du unterwegs. Du solltest mehr an dich denken.«
»Das tue ich doch! Ab jetzt wird es ruhiger.«
In den letzten Tagen war sie sehr erfolgreich gewesen. Das Spendenkonto hat sich gut gefüllt und wird nun für fast eineinhalb Jahre reichen. Zusätzlich hat sich ihr Hauptsponsor überraschend schnell mit der Tageszeitung, für die Alexander arbeitet, geeinigt, und ihre Arbeit auf Haiti wird mit einer Reportage gewürdigt werden.
Trotz der Erfolge hat sie kein gutes Gefühl. Irgendetwas stimmt nicht. Es geht alles viel zu glatt.
Sie zuckt zusammen, als ihre Mutter sie mit leicht erhobener Stimme anspricht.
»Kind, du hörst mir ja gar nicht zu. Möchtest du nicht was essen? Wir haben auf dich gewartet!«
Der leicht vorwurfsvolle Ton ist nicht zu überhören.
»Ja, gerne«, schwindelt Vanessa, obwohl sie noch gar keinen Hunger hat. Ihre Mutter kocht abwechselungsreich und gut. Trotzdem geht sie mit in die Küche, um die Portionen auf ihrem Teller in realistischen Grenzen zu halten.
Nach dem Essen und einem anregenden Kaffee, bei dem wieder mal ihre Lebensplanung thematisiert wurde: »Du musst auch mal an später denken«, setzt sie sich an ihren Computer und ruft die E-Mails ab.
Die Liste ist in den letzten Tagen immer länger geworden. Einige Absender künden Spenden an und erwarten eine Bestätigung, andere möchten einfach nur ein paar Bilder oder Informationen. Obwohl sie sich die Antworten mit Textbausteinen vereinfacht hat, hat sie mit der Beantwortung und den persönlichen Anschreiben noch genug zu tun.
Eisern arbeitet sie E-Mail für E-Mail ab, bis sie eine aus Haiti öffnet.
»Aha, das Internet funktioniert dort auch wieder«, freut sie sich, denn bis zu ihrer Abreise musste sie dafür ihr Handy benutzen.
Kaholo hat ihr geschrieben. Das alleine ist schon eine Besonderheit, denn normalweiser meidet er den Kugelschreiber oder die Tastatur, wie der Teufel das Weihwasser.
Amüsiert liest Vanessa die typisch kreolischen Ausdrücke, die jedem Französischlehrer den Schweiß auf die Stirn treiben würden. Der Inhalt ist allerdings ernst genug. Kaholo berichtet über einen Besuch der Gesundheitspolizei, die ihm verboten hat Medikamente auszuteilen. Das dürften jetzt nur noch Ärzte.
Sie schaut auf die Uhr und greift zum Telefon.
»Olá! Kaholo, Ciel hier!«, meldet sie sich mit ihrem haitischen Namen. »Wie geht es dir? Ich habe deine E-Mail gelesen, was ist passiert?«
Kaholo berichtet ihr von dem Besuch und schwört, dass er keine Medikamente verschrieben oder mit ihnen gehandelt habe.
»Ich weiß doch, dass du nicht selbstständig therapierst«, beruhigt sie ihn, »das hast du sicherlich auch dieser Gesundheitspolizei gesagt?«
»Byentendu (selbstverständlich), es interessiert die einfach nicht!«, antwortet er empört und schickt ärgerlich einige kreolische Schimpfwörter hinterher. »Dabei geht es doch nur um die von dir verordneten Langzeitbehandlungen. Ciel, was soll ich machen? Ich kann die Leute doch nicht hängen lassen.«
Vanessa ist beeindruckt und schämt sich für ihre Zweifel an seiner Zuverlässigkeit, die sie zwischendurch für einen Moment gehabt hatte.
»Weißt du was? Gehe bitte mit den Patienten zu einer zuverlässigen Apotheke und gebe ihnen Geld für das, was sie benötigen. Sie sollen dort die Medikamente selber kaufen und sofort einnehmen.«
»Gute Idee, ich werde sofort losfahren. - Ciel wann kommst du zurück? Die Leute fragen nach dir.«
Vanessa schluckt betroffen.
»Ich habe hier noch sehr viel zu erledigen, damit ich überhaupt wieder zurückkommen kann. Es wird noch zwei Wochen dauern.«
»Oke, n ‘ap boule (bis dann).«
Nachdenklich legt Vanessa auf.
Gesundheitspolizei? Ihr ist es neu, dass es sie gibt und hat ernste Zweifel, dass es mit rechten Dingen zugeht. Aber Kaholo traut sie es zu, dass er zwischen selbst ernannten Polizisten und realen Beamten unterscheiden kann, obwohl es letztlich die gleichen Konsequenzen für ihn hat. Sie beschließt, bei der haitischen Botschaft in Berlin nachzufragen.
***
»Hast du im Lotto gewonnen oder einen Opferstock geplündert? Der Laden da oben ist doch sündhaft teuer«, gibt Laura stirnrunzelnd zu bedenken, als Alexander im Aufzug auf die Taste des zwölften Stocks drückt, neben der in fantasievollen Buchstaben der Name des Restaurants prangt.
»Große Ereignisse werfen ...«
»Nicht schon wieder«, stöhnt Laura auf, ihre Augen blitzen belustigt im Lampenlicht, »oder willst du mir etwa ein Heiratsantrag machen?« und setzt theatralisch eine erschrockene Miene auf, als befürchte sie das Schlimmste.
»Sag das nicht noch einmal!«, Alexander droht ihr schmunzelnd mit dem Zeigefinger, »sonst drücke ich sofort wieder Erdgeschoss.«
Der Aufzug hält mit einem sanften Ruck und die stählernen Türen geben ihnen den Blick in einen aufwändig gestylten Vorraum frei.
Der kritische, beinahe überhebliche Blick des auf sie wartenden Kellners spricht Bände.
»Sie möchten bei uns etwas essen?«, fragt er vorsichtig, um nicht arrogant zu wirken.
Laura sieht unsicher zu Alexander auf, der ihren Blick lächelnd erwidert.
»Schon möglich«, antwortet er bestimmt, »es wäre schön, wenn wir draußen sitzen könnten.«
Der Kellner führt sie zu einem windgeschützten, penibel gedeckten Tisch, der ihnen eine spektakuläre Aussicht über die Stadt ermöglicht. Die Geräusche des Verkehrs wehen nur noch gedämpft und wie von weit her zu dem Dachgarten empor, den sich das Restaurant vor dem Penthouse mit reichlich Buchsbäumen und Blumenkübeln eingerichtet hat.
Laura sieht sich begeistert um.
»Wow! - Warst du schon mal hier?«
»Ja, aber nur zum Fotografieren«, gibt er zu, vergisst aber seine Rolle als Gastgeber nicht. »Was hältst du von einem Caipirinha als Aperitif?«
»Chic«, Laura beugt sich zu ihm hinüber, dabei fällt ihre schwarze Mähne nach vorne und verdeckt zur Hälfte ihr Gesicht. »Ich bin aber total hungrig«, flüstert sie etwas verlegen.
»Dann wollen wir doch mal schauen, was es heute gibt«, lächelt Alexander, bestellt die beiden Drinks und bittet souverän um die Speisenkarte.
Laura sucht unsicher Alexanders Augen. »Nun mal ehrlich! Was ist los, dass du mich in diesen Nobelschuppen schleppst?«
Ein schelmisches Lächeln umspielt sein Gesicht.
»Erstens ist es mir danach, den heutigen Tag mit dir zu feiern, und zweitens möchte ich dich etwas fragen.«
Laura lehnt sich verunsichert mit verschränkten Armen in die weichen Polster zurück.
Alexander holt tief Luft. »Ich habe den Auftrag für eine Reportage auf Haiti erhalten« und macht eine rhetorische Pause. Da aber Laura keine erkennbare Reaktion zeigt und schweigt, fährt er leicht verunsichert fort. »Da mein Französisch bekanntermaßen hundsmiserabel ist, habe ich mich dazu entschlossen, dich als meine Assistentin mitzunehmen.«
»Das ist nicht wahr!«, entfährt es ihr.
Alexander genießt einen Augenblick lang ihre Fassungslosigkeit, um dann die Hand wie zu einem Schwur zu heben.
»So wahr wir hier sitzen. Ah - da kommt unser Caipirinha.«
Laura ergreift ihr Glas, als würde es ihr Halt geben und schaut Alexander mit einem zaghaften Lächeln an.
»Ich kann es noch nicht fassen«, flüstert sie ungläubig, »wie sicher ist es denn?«
»Ich habe es auch erst geglaubt, als ich den Auftrag in der Hand hielt«, tröstet sie Alexander. »Naja, und bei den Formalitäten wurde ich allen Ernstes gefragt, wen ich denn als Assistenten mitnehme«. Er nickt ihr aufmunternd zu, »Mir fiel diese Entscheidung nicht sehr schwer. Jetzt bist du dran.«
»Ich war noch nie auf Haiti«, wirft Laura schüchtern ein. »Was habe ich zu tun und wann geht es los?«
»Wenn ich mich richtig erinnere, warst du schon mal längere Zeit in der Dominikanischen Republik und damals in Paris hätten wir ohne dein perfektes Französisch nur die Hälfte gesehen.«
Sie werden von dem Kellner unterbrochen, der ihre Bestellung aufnimmt.
Während sie auf ihr Menü warten, berichtet Alexander ihr von dem Kontakt mit Vanessa Weigert, von dem Gespräch mit dem Chefredakteur und dem Auftrag.
»Du hast aber auch ein Glück«, bemerkt Laura ein wenig neidisch.
»Naja, wie man es nimmt. Etwas Entscheidendes vermisse ich trotzdem noch.«
»So?«, sie runzelt verständnislos die Stirn. »Was denn noch?«
»Deine Zusage.«
Laura hebt erleichtert ihr Glas. »Hallo Partner. - Wann geht es denn los?«
»So in knapp zwei Wochen.«
***
Jens war schon lange nicht mehr im Kölner Dom gewesen. Immer wieder gleitet sein Blick an den endlos hohen Säulen nach oben, zwischen denen die bunten Fenster einen starken Kontrast zu dem eher farblosen gotischen Mauerwerk bilden. Der dünne Stundenschlag der Domuhr schwebt durch das Kirchenschiff und erinnert ihn an die vereinbarte Zeit. Hastig wirft er zur Orientierung einen Blick in den sündhaft teuren Katalog, den er nebenan im Kiosk erstanden hat und lenkt seine Schritte zu dem Chorumgang.
Erst nachdem er den Altar erreicht hat, verringert sich die Lautstärke des vielsprachigen Stimmengewirrs der Touristen. Abgeschirmt durch das hohe gotische Chorgestühl kommt sogar eine andächtige Stille auf.
Unsicher sieht sich Jens um. Abgesehen von einem asiatischen Pärchen, das eingehend die Schrifttafeln an einer benachbarten Chorkapelle studiert, ist er trotz des Besucherrummels im Hauptschiff alleine.
Wieder muss er den Katalog zurate ziehen, um dann seinen Blick zu heben. Sein ehemaliger Studienkollege Michael Kästner hat als Treffpunkt die Mailänder Madonna vorgeschlagen, die unter einem vergoldeten Baldachin, auf einem Podest stehend, wie eine Königin verzeihend zu ihm hinunterlächelt.
»Ist sie nicht schön?«, flüsterte ein Besucher neben Jens.
Verblüfft fährt Jens herum und sieht in ein ihm unbekanntes Gesicht, das von einem angegrauten Dreitagebart eingerahmt wird.
»Ja, doch«, antwortet Jens ausweichend und wendet sich zum Gehen, um den Fremden los zu werden.
»Leider gibt es im Dom kein Altar des heiligen Damian. Ich hätte es angemessener gefunden, wenn wir Pharmazeuten uns unter seinem Schutz getroffen hätten.«
Jens bleibt überrascht stehen.
»Michael - du? Entschuldige bitte, - nach all den Jahren und hier im Halbdunkeln, - ich habe dich nicht wiedererkannt.«
Der Angesprochene blickt schmunzelnd zur Statue hoch.
»Sie hat sich seit siebenhundert Jahren kaum verändert.«
»Dafür hat sie eine hölzerne Seele.«
Michael macht eine beschwichtigende Handbewegung. »Sag das nicht zu laut. Viele sind der Überzeugung, dass ein heiliges Bild oder eine Statue wie ein Tor in die andere, himmlische Dimension wirkt.«
»Oha!«, antwortet Jens übertrieben reumütig. »Ich stelle nachher eine Kerze auf und bete um Verzeihung.«
Michael lacht leise.
»Ich erinnere mich. Du warst noch nie besonders gläubig. Komm, suchen wir uns einen profaneren Platz, an dem wir Unheiliges besprechen können.«
Der Mai verwöhnt Köln wieder einmal mit Sonnenschein, und ihre Augen benötigen einige Sekunden, um sich an die Helligkeit vor dem Domportal zu gewöhnen. Nachdem sie sich durch unzählige geführte Touristengruppen geschoben haben, die hektisch fotografierend das gewaltige Domportal blockieren, haben sie nur noch wenig Hoffnung in der Cafeteria gegenüber einen freien Platz zu finden. Dennoch ergattern sie den einzigen freien Tisch, der ihnen sogar einen ungestörten Blick auf den Dom erlaubt.
»Ich habe die Unterlagen über dein neues Medikament durchgelesen. Viel Neues konnte ich darin nicht entdecken«, beginnt Michael das Gespräch.
»Das ist ja das Besondere. Alle Wirkstoffe sind seit Jahren bekannt und gut katalogisiert. Ähnliche Präparate gibt es zuhauf – aber die Mischung ist entscheidend.«
»OK«, Michael sieht Jens leise zweifelnd an. »Dann sollte die Zulassung keine Schwierigkeiten machen. An einer Verträglichkeitsprüfung in Deutschland führt aber kein Weg dran vorbei.«
Jens nimmt einen Schluck von seinem Cappuccino, um zu überlegen. Zweifel steigen in ihm auf. Kann er seinem Gegenüber wirklich vertrauen?
»Dauert das lange? Du kennst ja die Situation in unserer Branche.«
Michael wirft ihm einen viel sagenden Blick zu.
»Ich werde mein Bestes tun. Aber mit gut sechs bis sieben Monaten musst du schon rechnen.«
»So lange? Kann man das Verfahren eventuell beschleunigen?«
»Weißt du, wie viel Arbeit das ist?«, winkt Michael ärgerlich ab. »Das ist schon extrem kurz!«
Er atmet verzeihend tief durch und sieht Jens in die Augen. »Vielleicht hast du noch nie diese Prozedur erlebt. Je nach Medikament kann sie unter Umständen Jahre dauern. Allein schon deswegen testen wir in der Regel im Ausland, um Zeit zu gewinnen. Aber an der Kontrollgruppe in Deutschland kommen wir nicht drum herum und ich werde aus naheliegenden Gründen auch nicht daran rühren.«
Jens ist geschockt. Das hat er sich anders vorgestellt. Außerdem muss er an verschiedene Presseberichte über Medikamententests in Südafrika denken, und der Film, »Der ewige Gärtner«, ist ihm noch lebhaft in Erinnerung.
»Verstehe«, antwortet er kleinlaut, »morgen Vormittag bekommst du die Packungen.«
Beim Abschied klopft Michael ihm auf die Schulter. »Das wird schon klappen! Und wenn du etwas dazu beitragen willst, dann stelle im Dom ausnahmsweise mal zwei Kerzen auf. Eine für dich und bitte eine für mich. - Wir können es gebrauchen.«
Michael lässt einen irritierten Jens zurück.
***
Zufrieden schaut Alexander auf den Laufzettel, den er bei der Reportagebesprechung von seinem Chefreakteur erhalten hatte. In der vergangenen Woche hatte er, bis auf einen, die darin aufgelisteten pharmazeutischen Betriebe aufgesucht und trotz übereifriger Marketingchefs eine ausreichend neutrale Berichterstattung erarbeiten können.
Langsam nähert er sich dem Tor zur Cardea PharmaLab GmbH, der letzten Adresse, die er besuchen wird und sieht sich dabei neugierig um.
Die weitläufigen Wiesen hinter dem mannshohen Stahlgitterzaun haben wohl schon länger keinen Gärtner gesehen, denn das Gras wuchert kniehoch und die Natur ist erfolgreich dabei, die Fahrwege zurückzuerobern.
Da er der einzige Besucher zu sein scheint, hält er direkt vor der Schranke. Der Pförtner lässt sich etliche Sekunden Zeit, ehe er seinen Blick von einem kleinen Fernseher löst und dem Besucher schweigend einen mürrischen Blick gönnt.
»Guten Tag, ich möchte zu Herrn Jens Höfer!«, ruft ihm Alexander durch das geöffnete Beifahrerfenster zu.
Ohne erkennbare Mimik wendet sich der Pförtner ab, um sich wieder dem Nachmittagsprogramm zu widmen, während seine rechte Hand nach dem Schalter tastet, um die Schranke zu öffnen.
Alexander ist sich irgendwie sicher, dass er bei der Nennung eines x-beliebigen anderen Namen ebenfalls hineingelassen worden wäre.
Vorsichtig fährt er in das Gelände hinein, um nach etlichen Metern ein halb vom Gras überwuchertes, schiefes Hinweisschild zu entdecken, das ihn zu dem Besucherparkplatz weist.
Da dessen Markierungen ebenfalls unter Unkraut verschwunden sind, stellt er seinen Fiesta kurzerhand neben der elegant geschwungenen Treppe ab, die zu einer großzügig verglasten Eingangshalle führt.
»Sie sind sicher Herr Alexander Bach«, begrüßt ihn die Dame am Empfang und führt ihn, nach einem flüchtigen Blick auf seine Visitenkarte, in einen Besprechungsraum, der den hochglanzpolierten Palisander-Charme der siebziger Jahre ausströmt.
Leicht vergilbte, großformatige Bilder in Metallrahmen schmücken die Wände und belegen eine Firmengeschichte, die bis zum Anfang des vorigen Jahrhunderts zurückführt.
Während Alexander, um die Wartezeit zu überbrücken, sich das Älteste der Galerie ansieht, tritt ein sportlich wirkender Mann, mit einem weißen Kittel bekleidet, hinzu.
»Guten Tag Herr Bach!«, Jens zeigt lächelnd auf das Bild. »Diese ehrwürdigen Herren bewiesen richtigen Pioniergeist. Erstaunlich, mit welchem Mut sie die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft mehr oder weniger erfolgreich umsetzten.«
Nach dem obligatorischen Austausch der Visitenkarten informiert ihn Alexander über die Reportage.
»Eine Reportage über natürliche Heilmittel«, sinniert Jens und schaut Alexander direkt ins Gesicht. »Natürlich? - Na ja, natürlich ist eine Frage der Definition.«
Alexander ist wie elektrisiert. So eine Antwort hat er noch nie erhalten.
»Wie meinen Sie das?«
»Die Zeiten, in der Miraculix mit der goldenen Sichel Kräuter schnitt und verabreichte, sind, Odin sei Dank, schon lange vorbei.«
»Die Tendenz geht doch wieder in Richtung natürliche Heilmittel?«, fragt Alexander vorsichtig nach, denn die anderen Hersteller haben sich völlig anders präsentiert.
»Das stimmt. Für eine kleine Erkältung oder Bauchweh sind die Kräutermischungen aus dem SB-Regal und heiße Wickel auch in Ordnung.«
»Sie halten wohl nicht viel von natürlichen Medikamenten?«, fragt Alexander gespielt verunsichert, denn er vermutet dahinter Kalkül.
»Die bringen uns Pharmazeuten eines Tages noch an den Bettelstab«, seufzt Jens und schmunzelt über Alexanders überraschtes Gesicht. »Keine Sorge, das wäre zu einfach. Ganz im Gegenteil.«
Jens zeigt auf eine Sesselgruppe. »Bitte setzen wir uns. Möchten Sie einen Kaffee oder Wasser?«
»Wasser bitte.«
Nachdem er mit dem Gewünschten zurückkehrt, nimmt er den Faden wieder auf.
»Die Natur bietet uns unglaublich viele Wirkstoffkombinationen. Nehmen wir doch mal die Silberweide, die in ihrer Rinde Acetylsalizylsäure zur Abwehr von Fressfeinden einlagert.«
»Acetylsalizylsäure? Ist das nicht Aspirin oder ASS?«, fragt Alexander nach.
»Entschuldigung, sie haben Recht. Das sind die Handelsnamen.« Jens nimmt verlegen einen Schluck Wasser, ehe er fortfährt.
»Also unser Beispielbaum am Flussufer hat gerade einen Käferangriff abwehren müssen und zu seinem Schutz viel Acetylsalizylsäure produziert. Eine andere Weide am Wegrand kommt, weil sie seit Jahren unbehelligt ist, auf nicht einmal auf drei Prozent des üblichen Mittelwertes. Für eine gezielte Schmerzbehandlung sind derartige Wirkstoffschwankungen selbstverständlich nicht geeignet.«
Alexander macht sich einige Notizen, ehe er nachfragt.
»Wie macht denn das die pharmazeutische Industrie, wenn sie natürliche Heilmittel anbietet?«
»Meine Gesellschaft, wie auch viele andere, benutzen die komplexen Rezepturen der Natur und standardisieren sie.«
»Die Rezepturen der Pflanzen?«
»Ja. Zum Beispiel gegen Ihre Kopfschmerzen brauchen Sie, pur eingenommen, etwa zwei- bis fünfhundert Milligramm ASS, um sie hinreichend zu dämpfen. Packt man die ganze Wirkstoffpalette der Weide, die der Baum zusammen mit ASS herstellt, ebenfalls in die Tablette hinein, benötigen der Patient nur noch fünf oder sechs Milligramm ASS, um die gleiche Wirkung zu erzielen.«
»Nur fünf bis sechs Milligramm, also zwei bis drei Prozent, reichen dann?«
Jens nickt und macht eine umfassende Handbewegung.
»Die Nebenwirkungen von ASS sind natürlich auch entsprechend geringer. Mit anderen Worten, wenn Sie den Beipackzettel lesen, bekommen Sie keine neuen Kopfschmerzen.«
»Das verstehen Sie also unter natürlich«, grient Alexander amüsiert.
»Wir orientieren uns an der Natur, aber für eine gezielte, erfolgreiche Therapie sind präzise Wirkstoffgehalte wichtig.«
»Wie heißt denn Ihr Schmerzmittel?«
»Cardea Salicin Natur. Es befindet sich zurzeit in der klinischen Prüfung. – Es wird in wenigen Monaten auf den Markt kommen«, fügt er optimistisch hinzu.
***
Die muddelige Wärme verschlägt ihr fast den Atem, als sich die Kabinentür des Jets öffnet.
»Willkommen auf Haiti!«, schmunzelt die Stewardess ironisch, der Ciels Reaktion nicht verborgen geblieben ist.
Die Luft über dem Rollfeld flimmert. Schon nach wenigen Metern hat sie das Gefühl, barfuß über glühende Kohlen zu gehen und ist froh, als sie den Shuttlebus erreicht, obwohl er wohl schon seit Stunden in der Sonne steht.Itze
Dennoch wird die Geduld der Passagiere auf eine harte Probe gestellt, ehe sich der Busfahrer, dem das nassgeschwitzte T-Shirt auf der Haut klebt, endlich auf seinen schwarzen Kunstledersitz schiebt.
Die Fahrt gleicht einer Geländetour.
»Das sind noch die Folgen des Erdbebens«, erklärt Ciel mit ungewollt zittriger Stimme und zeigt zum Fenster hinaus. »Das Metallzelt da vorne, das ist das derzeitige Terminal.«
Die Abfertigung unter dem aufgeheizten Stahldach erweist sich als weitere Geduldsprobe, die nicht jeder der Wartenden besteht. Aufgebracht attackieren einige lautstark die Zollbeamten in ihrem klimatisierten Schalterhäuschen, als wären sie für die unerträgliche Hitze verantwortlich.
Ciel rollt genervt die Augen.
»Manche begreifen einfach nicht, dass es für sie jetzt noch länger dauern kann.«
Vor dem provisorischen Terminal werden sie von Kaholo erwartet.
»Die Abfertigung war ja heute ausgesprochen zügig«, stellt er mit einem breiten Grinsen fest, zeigt dabei ungeniert eine unübersehbare Zahnlücke. »Willkommen auf Haiti!«
Nach einer holprigen Fahrt über vom Erdbeben aufgerissenem Pflaster erreichen sie Ciels Haus, das, erhöht in einem Vorort von Port-au-Prince gelegen, einen Blick über die Stadt erlaubt.
»Hier hat das Erdbeben nicht so gewütet«, stellt Alexander im Vergleich zu den anderen Stadtvierteln fest, die sie durchfahren haben.
»Wir haben sehr sehr viel Glück gehabt«, antwortet Ciel ernst.
In diesem Augenblick öffnet sich die Haustür, die vermutlich vor vierzig Jahren beim Bau des Hauses zum letzten Mal einen Anstrich erhalten hatte. Eine rundliche Frau in einem bunten Kleid tritt heraus, stürmt zum Auto und reißt die Beifahrertür auf.
»Ciel, ma Ciel! Bienvenue!«
»Flore, ich freue mich, wieder zuhause zu sein. - Das sind meine Freunde Alexander und Laura aus Deutschland.«
Die Beiden werden in die nicht endende, stürmische Begrüßung eingeschlossen und Laura bemerkt, dass ihre französischen Sprachkenntnisse anscheinend nicht immer ausreichen.
Während sich Kaholo mit der Unterbringung des Gepäcks beschäftigt, führt Flore sie auf die zum Teil überdachte Terrasse, an der ein kleiner Garten angrenzt. Sie zeigt auf den gedeckten Tisch.
»Bitte setzt euch, ihr werdet sicher hungrig und müde sein« und schwebt aufgeregt in die Küche.
»Hübsch hast du es hier«, meint Laura und sieht sich um.
»Ich habe leider kaum Gelegenheit, das auszukosten. Entweder ist es einfach zu spät oder schon zu dunkel.«
***
Am nächsten Morgen benötigt keiner einen Wecker, denn ihre inneren Uhren ticken noch europäisch. Es ist noch dämmerig, als sie sich wieder auf der Terrasse treffen. Im Gegensatz zum gestrigen Abend ist die Temperatur angenehm, fast kühl.
Nach dem Frühstück überlegen sie gemeinsam den Tagesplan und Kaholo berichtet über die dringenden Fälle.
»In Saint Gerard sind viele krank, weil die Wasserleitung immer noch nicht repariert ist. Manche Babys sind schon ganz dünn.«
»Haben wir denn noch genug Heilerde?«, fragt Ciel mit einem Seufzer.
»Für eine Woche - vielleicht. Wir müssen bald neue holen.«
Mit Kaholo’s Hilfe stellt sie den Routenplan auf und wendet sich anschließend an Alexander und Laura.
»Kommt einfach mal mit und seht euch das an. Bitte keine Fotos ohne Zustimmung der Patienten oder deren Begleitern. Die Haitianer haben es satt, in ihrem Elend gezeigt zu werden«, fügt sie hinzu.
Alexander nickt erschrocken und hebt zustimmend die Hand.
»Versteht man hier mein europäisches Französisch?«, fragt Laura mit kurzem Blick auf Flore unsicher.
»Fast immer. Aber manchmal spricht man hier ein extremes Kreol. Um einfach mal unter sich zu sein. Oder um die Ausländer zu zanken«, fügt Ciel lachend hinzu.
Nach einer Stunde ist der Geländewagen gepackt und sie fahren los. Nach gut dreihundert Metern hält Kaholo überraschend an, kurbelt das Fenster runter und ruft einem, am Straßenrand wartenden, Händler etwas zu. Einen Augenblick später reicht er Alexander ein weißes T-Shirt nach hinten.
»Besser«, erklärt Kaholo lakonisch.
Alexander hat dieses »Besser« schon beim Packen kennen gelernt, als ihm Kaholo seinen Fotoapparat abnahm und auf sein Portmonee in der Gesäßtasche zeigte. Beide Teile verschwanden in einer abschließbaren Blechkiste im Innern des Autos. Eine weitere Erklärung erübrigte sich.
»Die seriösen Männer tragen hier ausschließlich weiße T-Shirts«, klärt Ciel den verblüfft dreinschauenden Alexander auf.
»Verstehe! Da werde ich mir wohl noch einige kaufen müssen«, lacht er erleichtert.
Nach zwanzigminütiger Fahrt, größtenteils im Schritttempo durch enge Gassen mit abgrundtiefen Schlaglöchern, bleibt Kaholo auf einem kleinen Platz unter einem kümmerlichen Baum stehen.
»Unsere erste Station. Hier bauen wir unseren Pavillon auf«, erklärt Ciel.
Alexander steigt aus und hält sich fassungslos die Nase zu.
»Wo sind wir hier?«, fragt er entsetzt.
»Im vierten Bezirk, Saint Gerard. Hier, an diesem Hang in den Hütten über uns, wohnen ungefähr fünfzehn- bis zwanzigtausend Haitianer. - Vor dem Erdbeben waren es sehr viel mehr«, fügt sie seufzend hinzu.
Noch während sie ausladen, quält sich schaukelnd ein ehemals weißer Tanklastzug ebenfalls die Gasse hoch, dem eine Schar Kinder und Frauen, mit ausgedienten Plastiktanks und anderen Behältern bewaffnet, folgen.
Nachdem ihn der wild gestikulierende Fahrer zentimeternah an ihrem Van vorbei gesteuert hat, hält er unweit an und entfernt die Kette von dem großen Ablasshahn, der hinten aus dem Tank herausragt.
Sofort stellt sich eine der Frauen abschirmend davor und übernimmt resolut die Verteilung des Wassers, während der Fahrer sich gelangweilt rauchend in den spärlichen Schatten setzt.
»Wie oft kommt der Tanklastzug?«, fragt Alexander.
»Einmal am Tag.«
Er sieht Ciel ungläubig an. »Einmal am Tag? Das ist dann ja nicht mal ein halber Liter für jeden der zwanzigtausend Menschen«, überschlägt Alexander.
»Weiter unten gibt es Gott sei Dank wieder funktionierende öffentliche Zapfstellen, die leider nur stundenweise Wasser haben.«
In der Zwischenzeit hat Kaholo mit der Aufstellung eines Tisches den Aufbau beendet. Zusätzlich schirmt ein Paravent das Innere vor neugierigen Blicken ab.
Ciel sieht mit ernstem Gesicht zu den ersten Patienten hinüber, die bereits die mobile Praxis umlagern. »So, ich werde gefragt. Bitte, bleibt für heute im Hintergrund.«
***
Nervös spielen seine Finger auf der abgenutzten Schreibtischplatte. Vor ihm liegt eine E-Mail vom Michael. Immer wieder, wie unter einem Zwang, liest er den Text.
»Verträglichkeitstest zeigt typische Salicylprobleme auf. Patienten klagen über Atemnot und Trägheit, einige über Magenschmerzen.«
Jens lehnt sich zurück und geht in Gedanken alle Möglichkeiten durch, wie man diese Nebenwirkungen beseitigen kann. Ihm ist bewusst, dass, falls man die Dosis des Hauptwirkstoffs verringert, das Mittel nicht wie gewünscht wirkt und der Erfolg ausbleibt. Reduziert er andere Bestandteile, geht der positive Effekt ebenfalls verloren.
»Anderseits«, grübelt er, »sind alle verwendeten Komponenten mitsamt ihren Nebenwirkungen bestens bekannt und die von ihm ermittelte Dosierung liegt weit unterhalb der Menge, die Probleme bereitet.«
Er schüttelt den Kopf, eigentlich dürfte es keine geben. Energisch klickt er mit der Maus auf sein E-Mail Programm und bittet Michael um weitere Informationen.
Das Absendesymbol auf seinem Bildschirm war gerade verschwunden, als sein Chef in sein Büro tritt und sich schwer auf den Bürostuhl fallen lässt.
»Na, das wird ja wohl nichts mit deinem so unglaublich natürlichen Schmerzmittel.«
Jens richtet sich auf und zieht angriffslustig die Augenbrauen hoch.
»Das werden wir noch sehen.«
Sein Chef winkt resigniert ab. »Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass unsere lieben Mitbewerber das nicht auch schon längst abgecheckt haben.«
»Da wäre ich mir nicht sicher. Bisher glaubte man an die Reinheit der Wirkstoffe, um sauber therapieren zu können. Denk doch mal an Digitalis. Ein Tee aus ein paar Fingerhutblättern bringt dich um. Bei reinem Digitalis benötigst du dafür etwa die hundertfache Menge.«
»Das ist doch ein alter Hut«, knurrt sein Chef ungnädig. »Außerdem, wer weiß denn schon, welche Wechselwirkungen die einzelnen Stoffe miteinander eingehen. – Ehrlich gesagt, ich glaube nicht daran, dass das zu kontrollieren ist.«
Jens sieht ihm gerade ins Gesicht.
»Es sind mehrere Kombipräparate mit diesen Wirkstoffen auf dem Markt, ohne dass es irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Allerdings verwenden nur wir exakt die natürliche Zusammensetzung. - Ich bin mir irgendwie sicher, dass bei der Prüfung etwas schief läuft.«
Der Chef erhebt sich schwer und schnauft dabei.
»Jens – du weißt, wie es um uns bestellt ist. Wir könnten einen Erfolg gut gebrauchen. Halte mich bitte auf dem Laufenden.«
Er klopft Jens zum Abschied kumpelhaft auf die Schulter und wälzt sich hinaus.
Nachdenklich schaut Jens ihm hinterher. Während der Unterredung mit dem Chef ist ihm klar geworden, dass mit dem Test irgendwas nicht stimmen kann. Er beschließt, mit Michael zu reden.
***
Die schwere Kirchenpforte der romanischen Kirche, Maria im Kapitol, dröhnt dumpf, als sie hinter Jens ungedämpft ins Schloss fällt. Verlegen sieht er sich um und stellt zu seiner Erleichterung fest, dass er der einzige Besucher zu sein scheint. Da er noch etwas Zeit hat, schlendert er durch das Seitenschiff, das allein schon einer Vorstadtgemeinde ausreichend Raum bieten würde. Jeder einzelne der mächtigen Quader, die die hohen Rundbögen tragen, strahlt die Würde ihrer mehr als eintausendvierhundertjährigen Geschichte aus. Beeindruckt durchschreitet er einen dieser steinernen Bögen, um in das Mittelschiff zu gelangen und bleibt fasziniert vor dem kunstvoll gemauerten Lettner stehen, der sich wie eine Brücke quer durch die Kirche schwingt.
Hinter dem Lettner sind der Altar und ein großzügiger Chor sichtbar, den ein weiterer, geschmiedeter Lettner abtrennt.
Während Jens den imponierenden Anblick auf sich wirken lässt, nähern sich leise Schritte. Beunruhigt und sich etwas gestört fühlend, wendet er sich um.
»Hallo Jens!«, begrüßt ihn der neue Besucher.
»Hallo Michael!«, antwortet Jens erleichtert und macht eine ratlose, allumfassende Geste. »Was bringt dich nur dazu, dich immer wieder in den Schutz des Krummstabes zu begeben?«
»Zum Glück kann ich ihn derzeit entbehren«, lacht Michael gedämpft, »anderseits, vor zweitausend Jahren stand genau hier der Tempel der Ärzte und Apotheker. Der, der Göttin Minerva. – Wie wär’s, sehen wir uns noch etwas um?«
Bedächtigen Schritts schreiten sie durch die Bögen des Lettners in den mit schimmernden Mosaiken ausgestatteten Chor.
Jens hat aber keinen Blick für die Kunst des Mittelalters, ihn beschäftigt nur noch ein Thema.
»Naja, vielleicht benötigen wir doch die Unterstützung deiner Minerva«, spinnt er den Faden weiter, »wenn ich an den Test denke ...«
»Die Beschwerde hat mich sehr beunruhigt«, seufzt Michael und nach einer kurzen Pause: »Du sagtest mir, alle Komponenten wären klassifiziert.« Er wirft Jens einen vorwurfsvollen Blick zu. »Ich habe, ehrlich gesagt, dir vertraut und nicht mit solchen Schwierigkeiten gerechnet.«
»Glaub mir, ich auch nicht. Da läuft etwas schief«, antwortet Jens und bleibt vor dem Altar mit einem Pestkreuz stehen. Einem inneren Gefühl folgend entzündet er eine der angebotenen Kerzen und beobachtet sinnierend die kleine Flamme. Als er anschließend den obligatorischen Euro spendet, wird er jäh in die Wirklichkeit zurückgeholt, denn die Münze poltert im Opferstock unchristlich laut hinunter.
In Michaels Gesicht arbeitet es. »Mit dieser schwäbischen Klinik arbeiten wir schon seit Jahren zusammen und möchte es mit ihr nicht verderben. Dieser Verträglichkeitstest hätte eine alltägliche Routine sein müssen.«
Bleiche Walknochen über einem reich geschnitzten Beichtstuhl ziehen die Aufmerksamkeit der beiden Besucher auf sich.
Jens flüstert. »Es kommt immer wieder mal vor, dass in Köln sogar ein Wal strandet. Kann es nicht sein, dass bei der Dosierung ein Fehler passiert ist?«. Er sieht Michael direkt ins Gesicht. »Kann ich mit den Leuten mal reden?«
»Wie bitte? Nein!«, entgegnet Michael verblüfft. »Das widerspricht allen Vorschriften!«
»Vorschriften? Du kommst mir mit Vorschriften? Die Zukunft meiner Firma hängt davon ab!«, stößt Jens aufgebracht hervor.
Michael dreht sich schweigend um und geht zügig Richtung Hauptportal. Jens wird bewusst, dass er den Bogen überspannt hat und folgt ihm betreten.
Am kunstvoll geschmiedeten Gitter des romanischen Tors bleibt Michael abrupt stehen und wendet sich Jens zu.
»Jens! Ich biete dir, wie du weißt, einen besonderen Dienst. Da kann ich solche Aktionen oder damit verbundene Risiken ü - ber - haupt - nicht - ge - brau - chen!«, hallt Michaels heftige Aussage durch die Kirche.
Jens lässt nicht locker. »Was hältst du davon, wenn ich als Beauftragter deiner Firma die Klinik mal besuche.«
Michael schüttelt ungläubig den Kopf.
»Du willst mich wohl nicht verstehen? - Auf keinen Fall!«
Unübersehbar empört wendet er sich zum Gehen. Während er der schweren Kirchenpforte zustrebt, versucht er Jens´ merkwürdig uneinsichtiges Verhalten zu verstehen.
»Jens und seine Firma haben wohl nichts mehr zu verlieren. Hätte ich mir doch nur eine Auskunft über die Cardea PharmaLab GmbH eingeholt«, schießt es ihm durch den Kopf und winkt innerlich ab. »Quatsch, vielleicht hat er ja Recht.«
Er bleibt stehen und sieht Jens entgegen.
»Ich werde mich drum kümmern. Versprochen.«
»Danke«, murmelt Jens kleinlaut, weil er damit nicht mehr gerechnet hat.
Michael sieht ihn mit einem schrägen Blick an. »Ich muss verrückt sein.«
***
Kirschengroße Regentropfen trommeln auf das Dach der Terrasse. Unzählige Blitze zucken und beleuchten einen dichten Wasservorhang, der den Ausblick in den Garten, geschweige denn auf die tiefer liegende Stadt, unmöglich macht. Die mit Feuchtigkeit übergesättigte Luft ist kaum zu atmen.
Alexander starrt in den undurchdringlichen Wasserschleier und versucht das heute Gesehene zu verarbeiten. So hat er sich Haiti nicht vorgestellt. Auch Laura geht schweigend ihren Gedanken nach.
Mit einer solchen, allgegenwärtigen Armut hat er nicht gerechnet. Und diese Armut hier ist hässlich! Es fällt ihm schwer, ein journalistisches Konzept zu entwickeln, dass auf der einen Seite der Wahrheit gerecht wird und auf der anderen nicht den Leser abstößt und damit die Haitianer letztlich allein gelassen werden.
Ciel tritt auf die Terrasse und legt eine Hand auf Lauras Schulter.
»Du warst sehr tüchtig und hast mir sehr geholfen.«
»Ich kann doch nicht einfach nur zusehen«, in Lauras Gesicht arbeitet es. Sie sieht zu Ciel auf. »Was meinst du, werden die Babys wieder gesund?«
Ciel hat im Grunde auf diese Frage gewartet.
»Einige schaffen es und deswegen versuche ich es einfach«, antwortet sie schlicht.
Laura richtet ihren Blick wieder in den endlos herabströmenden Regen hinaus.
»Wie hältst du das nur aus?«
Ciel lehnt sich rücklings an das hölzerne Geländer, das federnd etwas nachgibt. Sie denkt einen Augenblick lang nach, ehe sie antwortet.
»Nach solchen Tagen frage ich mich das auch immer wieder. Aber die Antwort ist einfach: Helfen hilft und heißt nicht, sich aufzuopfern. - Damit ist keinem gedient.«
Alexander zieht mit spitzen Fingern sein nass geschwitztes T-Shirt von der Haut ab. »Diesen Spagat versuche ich in Gedanken die ganze Zeit journalistisch umzusetzen. - Können wir morgen mit den ersten Bildern anfangen?«
»Morgen werden wir in die Außenbezirke fahren«, kündigt Ciel an. »Mal sehen, die Leute sind dort aufgeschlossener.«
Rumpelnd müht sich der Geländewagen langsam über geborstenen Asphalt den Pass hinauf. Während Kaholo zumindest den schlimmsten Schlaglöchern ausweicht, sieht sich Alexander, die wenig magenfreundliche Schüttelei ignorierend, interessiert um, indessen Laura und Ciel auf den Rücksitzen Schwierigkeiten haben, die aufsteigende Übelkeit zu ignorieren.
In den Außenbezirken von Port-au-Prince stehen die Hütten weniger dicht auf kleinen eingezäunten Arealen. Hinter den teilweise fantasievollen Einfriedungen kann man kleine Gärten erkennen, die allerdings größtenteils wie abgeerntet wirken.
Ciel zeigt auf die sorgfältig aufbereiteten Beete.
»Durch das Erdbeben haben viele ihre Existenz verloren und sind nun auf die Erträge ihrer Gärten angewiesen«, erklärt sie mit bitterem Unterton und fügt: »jetzt fehlt das Saatgut«, hinzu.
»Werden von der UNO denn nicht noch Lebensmittel verteilt?«, fragt Laura.
»Hier draußen kommt kaum etwas an und es dauert eben ein viertel Jahr, bis man wieder etwas ernten kann.«
Kaholo verlässt die so genannte Hauptstraße und biegt in eine namenlose matschige Gasse ein, die oberhalb eines dicht bebauten Slums entlangführt. Nach einer kurzen Strecke bleiben sie auf einem kleinen, zugemüllten Platz stehen, der von rohen Blechhütten umgeben ist, zwischen denen schmale Gänge in einem halbdunklen Labyrinth verschwinden.
Alexander überlegt nur einen Augenblick lang, wie denn die Anwohner über ihre Ankunft informiert werden. Dann aber sieht er Kinder davonflitzen, die sicherlich dafür sorgen, dass sich Ciels Ankunft in Windeseile verbreitet.
Zusammen mit Kaholo stellt er den Pavillon auf, um anschließend seine Fotoausrüstung aus dem Schließfach des Geländewagens zu holen.
Sie brauchen, wie erwartet, nicht lange zu warten, bis die ersten Patienten eintreffen. Bei dem Blick durch den Sucher seiner Kamera fällt es Alexander auf, dass die Kinder hier etwas besser ernährt wirken, als die in der Stadt.
Die Reaktionen auf seinen Fotoapparat sind unterschiedlich. Einige reagieren trotz Erklärung ablehnend, andere zucken desinteressiert mit den Schultern. Zu den entspannenden Worten Ciels mischt sich nun hin und wieder das Verschlussgeräusch des Apparates.
Fasziniert beobachtet er Ciel, wie sie ruhig die abenteuerlichsten Verletzungen oder eitrige Entzündungen behandelt und ist erstaunt, mit welcher Gelassenheit die Patienten die, trotz örtlicher Betäubung, sicherlich immer noch schmerzhafte Wundenversorgung ertragen. Dass Ciel einigen Patienten nach der Behandlung die Hand auflegt und dabei leise etwas flüstert, überrascht ihn auch nicht mehr.
Nach zwei Stunden ebbt der Zustrom von Patienten ab, und sie entscheiden sich, weiterzufahren.
Der neue Einsatzort unterscheidet sich nur unwesentlich vom vorgegangenen. Es ist bereits später Nachmittag, ehe sie ihre Arbeit beenden können. Zusätzlich warnen riesige Wolkentürme vor einem herannahenden Unwetter.
»Wir müssen noch bei unserem Apotheker Gérard vorbei fahren. Unsere Vorräte sind fast aufgebraucht«, bemerkt Kaholo, während er den Diesel startet.
»Schaffen wir das denn vor dem Gewitter?«, fragt Ciel besorgt.
»Wird es so schlimm?«, wundert sich Alexander und schaut besorgt zu der schwarzen Front hoch, die sich über die Berge schiebt.
»Jantsuél (gütiger Himmel)!«, lacht Kaholo, »das Gewitter wird wie immer sein, aber durch die Wassermassen werden die Straßen unpassierbar.«
Es sind immer wieder die extremen Gegensätze, die Laura an Port-au-Prince faszinieren. An der rechten Straßenseite reihen sich einige moderne Gebäude mit Schaufenstern, wie man sie überall in der westlichen Welt findet, und auf der anderen türmen sich primitive Hütten übereinander, dicht gedrängt den steilen Hang hinauf.
»Wir sind da«, bemerkt Ciel.
Fluchend manövriert Kaholo den Geländewagen durch die ohnehin schmale Einfahrt, die durch fliegende Händler, die ihre armseligen Waren am Boden ausgebreitet haben, zusätzlich verengt wird.
Im Innenhof werden sie von einem nervösen Apotheker empfangen, der sie auf einen Parkplatz neben seinen grünen Landrover einweist.
Kaum hat Kaholo den Motor abgestellt, winkt er sie hastig in sein Haus. »Prese (schnell), es wird gleich regnen.«
Verschwitzt schälen sich die vier aus dem Auto und folgen ihm in sein Geschäft.
Nachdem Laura als Letzte den Verkaufsraum betreten hat, schließt Gérard Latortue hinter ihnen die Tür, obwohl der riesige Ventilator an der Decke die schwüle Luft nur mit Mühe durchrühren kann. Halb heruntergelassene Rollläden verhindern ungewollte Einblicke und sorgen für ein diffuses Licht.
Alexander sieht sich um. Ein einfacher, langer Tisch beherrscht den Raum und dient als Tresen. Uralte, verblichene Pappaufsteller und Plakate werben für verschiedene Arzneimittel, die hauptsächlich gegen Durchfall und Fieber helfen sollen.
Ein nahezu leeres Regal umrahmt eine massiv wirkende Tür, die vermutlich zum Lagerraum führt. Zwei abgewetzte wacklige Stühle vervollständigen die Einrichtung.
»Bonswa Gérard, mein Freund! Ist alles in Ordnung?«, fragt Ciel besorgt.
»Mesi Ciel! Du warst lange weg und die Zeiten haben sich geändert. Man muss heutzutage vorsichtig sein. Du hast Freunde mitgebracht?«, fragt der Apotheker Gérard Latortue mit geschäftsmäßiger Freundlichkeit.
»Eskize mwen (Entschuldigung), das sind Alexander und Laura aus Deutschland, die meine Arbeit hier auf Haiti eine Zeit lang begleiten.«
»Oke«, nickt Gérard Latortue uninteressiert und fragt übergangslos. »Was brauchst du?«
Ciel sieht ihn prüfend an. So unpersönlich hat sie ihn noch nie erlebt, und sie arbeiten schon lange zusammen. Mit seiner Hilfe wird sie von den komplizierten und zeitraubenden Formalismen der haitischen Bürokratie verschont. Denn neben den normalen Standardmedikamenten importiert er die gespendeten Heil- und Hilfsmittel aus Deutschland. Die diskrete Bezahlung seiner Dienste erfolgt zum Teil per »Naturalien« und entlastet die Kasse.
Kaholo ergreift das Wort und diktiert ihm ihren Bedarf, wird aber von Gérard Latortue, der auf einem Klemmbrett mitschreibt, mehrmals unterbrochen, weil er sich verschrieben hat und korrigieren muss.
Mit gekrauster Stirn verfolgt Ciel die Prozedur.
»Die Hitze«, stöhnt er übertrieben, als er ihre Blicke bemerkt und verschwindet im Lager.
Nach einer Weile kommt er verschwitzt mit gestapelten Kartons auf einer Sackkarre wieder zurück und stellt sie hastig vor ihnen ab, als wären sie giftig.
Hilfsbereit nimmt Alexander die obersten Kartons auf und wendet sich zur Tür.
»Rete!«
»Stop!«, übersetzt Ciel.
Alexander bleibt erschrocken stehen und sieht sich ratlos um.
Gérard Latortue wirft ihm einen vernichtenden Blick zu, um dann vorsichtig die Apothekentür zu öffnen. Erst nachdem er sich draußen besorgt umgesehen hat, erlaubt er ihm zu gehen.
»Schlechte Zeiten!«, ruft er verlegen lächelnd zum Abschied hinterher.
***
»Ich muss wirklich verrückt sein«, sagt Michael kopfschüttelnd zu sich selbst, als er wieder in seinem Auto sitzt und den Motor startet.
Nach einer schier endlosen Kurverei durch die Parketagen muss er zum Entsetzen eines nachfolgenden Fahrers abrupt bremsen, weil er in Gedanken an Jens und das neue Medikament beinahe die Ausfahrt verpasst hätte.
Trotz des alltäglichen Staus auf dem Kölner Autobahnring kann er zwanzig Minuten später den BMW auf seinem reservierten Parkplatz abstellen. Elastisch nimmt er die zwei Stufen der breiten Treppe zur Eingangshalle und wartet anschließend nervös wippend auf einen der beiden Aufzüge. Seine Agentur liegt im vierten Stock eines seelenlosen Gebäudes aus den siebziger Jahren. Einige Elemente der verspiegelten Glasfront sind blind geworden und deuten unmissverständlich darauf hin, dass die besten Zeiten dieses Hauses vorüber sind.
Das Kreischen eines vergewaltigten Elektrobohrers und der Geruch von schmorendem Kunststoff empfangen ihn, als sich die matt glänzenden Stahltüren des Aufzuges öffnen.
Sein Blick fällt auf die weit geöffneten Türflügel seines Büros. Dazwischen kniet ein Techniker in einem blauen Overall und werkelt schwitzend an einem der Bodenscharniere.
Darüber thront seine Sekretärin hinter ihrem Schreibtisch, die sich mit schmerzhaft verzogenem Gesicht die Ohren zu hält. Dabei spreizt sie grazil die kleinen Finger ab, von denen einer beringt ist.
Mit erhobener Stimme versucht sie sich gegen den Lärm durchzusetzen.
»Guten Tag Herr Kästner!«
»Hallo«, er zeigt fragend auf die Tür, »was ist denn passiert und dauert das etwa länger?«
Wie die Antwort auf seine Frage, heult die Bohrmaschine schrill auf und von einem Fluch des Technikers begleitet erstirbt sie plötzlich, nachdem ein scharfer, metallischer Klick den Bruch eines Werkzeuges angezeigt hat.
Vorsichtig nimmt die Sekretärin die Hände herunter.
»Heute Morgen bin ich kaum reingekommen, weil die Tür klemmte. Ein Scharnier ist gebrochen«, klagt sie mit leidender Miene.
»Verstehe! Und nun?«
Sie weist mit einem vorwurfsvollen Blick auf den am Boden knienden Mann.
»Dieser Monteur von der Hausverwaltung sagte, es dauert nicht lange. - Allerdings bohrt er nun schon fast eine Stunde.«
»Es ist schwieriger als gedacht«, erklärt der Techniker kurzatmig, während er sich aufrappelt und seine schwarz verschmierten Finger am Overall abwischt, der kaum noch eine saubere Stelle anbietet. Kleine Schweißperlen glitzern auf seiner Stirn.
»Das alte Material«, er hält triumphierend einen gebrochenen Bolzen hoch, »ist so hart und spröde wie Glas. In spätestens in einer Stunde bin ich wieder da.«
»Na also«, Michael tröstet die Sekretärin, »genießen wir bis dahin die Ruhe.«
Er hat noch nicht mal die Zeit seine Post durchzusehen, da dröhnt plötzlich das helle Schlagen eines Elektrohammers durch das Haus. Entnervt vereinbart er kurz entschlossen mit dem Leiter der Bodenseeklinik in Meersburg einen Termin, gibt seiner Sekretärin frei und steht wenige Minuten später im Aufzug. Aufatmend drückt er auf den Knopf nach unten. Sogar im Erdgeschoss verfolgt ihn noch das Hämmern des schweren Bohrgerätes.
Nachdem sich die Tür seines BMWs geschlossen hat, genießt er für einige Sekunden die abgeschirmte Ruhe. Erst dann startet er den Motor und verlässt den Parkplatz. Während der melodische Trailer im Autoradio die Zweiuhrnachrichten ankündigt, fädelt er sich bereits auf die Autobahn Richtung Süden ein.
Es dämmert schon, als er durch die engen Straßen von Meersburg kurvt und auf den Hotelparkplatz zusteuert. »Sie haben das Ziel erreicht!«, bestätigt der Navigator, den Michael bei dieser Tour nur noch aus Gewohnheit mitlaufen lässt, seine Ankunft.
Dezent versteckte Lampen leiten ihn durch den Vorgarten zum Hoteleingang und vermitteln ihm das Gefühl, angekommen zu sein.
Der Portier begrüßt ihn mit Namen. »Guten Tag Herr Kästner! Hatten Sie eine gute Reise?«
»Ja, danke.« Michael sieht sich lächelnd um. »Pardon, wissen Sie zufällig, wie oft ich schon hier war?«
Der Portier sieht prüfend auf das Terminal.
»Das zwölfte Mal, Herr Kästner.«
Michael bedankt sich und nimmt seinen Schlüssel in Empfang. Das Zimmer ist wie erwartet komfortabel eingerichtet und die Fenster bieten ihm einen spätabendlichen Blick auf den Bodensee, der bereits nach und nach in der Dunkelheit versinkt.
Er genießt das Schauspiel der Farben, bis von der Helligkeit des Tages nur noch ein schmaler rötlicher Streifen am Horizont zu sehen ist. Müdigkeit umfängt ihn. Vom Bett aus zappt er eine Weile zwischen den Fernsehkanälen herum, bis er mitten in der Nacht amüsiert feststellt, dass er dabei eingeschlafen war.
Der Kaffeeduft verspricht mehr, als das Frühstücksbüfett halten kann. Schmunzelnd stellt Michael fest, dass sich in all den Jahren, in denen er hier eingekehrt ist, fast nichts verändert hat. Sogar die Anordnung der angebotenen Speisen ist gleich geblieben.
Nach dem Frühstück findet er, mit einer Tasse Kaffee und der Auftragsmappe bewaffnet, in einem Erker des Restaurants einen ruhigen Platz, der ihm zudem einen freien Blick auf den See erlaubt.
Konzentriert bereitet er sich auf das Gespräch mit dem Leiter der Meersburger Klinik vor. Er kennt diesen Mann schon seit vielen Jahren, der von Besuch zu Besuch unübersehbar nervöser und hektischer geworden war. Michael erinnert sich noch lebhaft an das letzte Gespräch in der Klinik. An den durchschwitzten, weißen Kittel seines Gesprächspartners, obwohl die Klimaanlage den Raum auf höchstens achtzehn Grad runtergekühlt hatte. An die fahrigen Bewegungen, den verschütteten Kaffee auf dem Schreibtisch und die kurzen, hektischen Wortfetzen, die aus einem atemlosen Mund gestoßen wurden.
Innerlich hatte sich Michael schon von ihm verabschiedet und war um so überraschter, dass er für heute trotzdem einen Termin mit ihm bekommen hat.
Die neue Sekretärin, die sich hinter ihrem Schreibtisch verschanzt hat, wirkt über alles erhaben und kampferprobt.
»Sie haben einen Termin mit Herrn Mutius?«, fragte sie ein wenig ungläubig und schaut dabei kühl lächelnd auf Michaels Visitenkarte. »Herr Kästner.«
»Ja, für heute um elf Uhr, Frau Kastell.«
Er findet ihren Namen, den er an der Bürotür abgelesen hat, irgendwie passend.
Sie sieht ihn vorwurfsvoll an, als wäre er für ihr nicht informiert sein verantwortlich und verschwindet im Büro des Chefs.
Michael sieht ihr zuversichtlich hinterher und stellt dabei unwillkürlich fest, dass ihr Rock eine Nummer zu eng ist.
Einige Augenblicke später taucht sie wieder auf und versucht kühl, obwohl ihre geröteten Wangen eine andere Sprache sprechen, das Heft wieder in die Hand zu bekommen.
»Bitte, Herr Kästner. Sie werden erwartet.«
»Ich danke Ihnen, Frau Kastell.«
Unbewusst atmet Michael tief ein, ehe er das Büro betritt und ist überrascht. Wider Erwarten ist der Leiter der Klinik entspannt und kommt ihm lächelnd mit ausgestreckter Hand entgegen.
»Guten Tag, Herr Kästner! Wir haben uns länger nicht gesehen. Wie geht es Ihnen?«
Der Händedruck ist angenehm, registriert Michael unbewusst.
»Guten Tag, Herr Doktor Mutius! Danke gut und Ihnen?«
»Ich kann nicht klagen«, antwortet der Chefarzt lächelnd und macht eine einladende Geste. »Darf ich Ihnen eine Tasse Kaffee oder etwas anderes anbieten?«
Michael bittet um ein Glas Wasser.
Nachdem Frau Kastell das Gewünschte gebracht hat, erläutert er dem Leiter der Klinik die Problematik mit dem neuen Medikament.
»In Cardea Salicin Natur werden, wie Sie sicherlich in meiner Expertise gelesen haben, ausschließlich bekannte Wirkstoffe verwendet. Daher sind die hier festgestellten Unverträglichkeiten nicht zu erwarten gewesen«, schließt Michael seine Ausführungen.
Der Leiter der Klinik zieht die linke Augenbraue hoch.
»Wie Sie wissen, sind wir eine Privatklinik. In diesem Rahmen ist das Wohlbefinden unserer Patienten unser oberstes Ziel.«
Sein routiniertes Lächeln verschwindet und macht einem ernsten Ausdruck Platz. »Derartige Nebenwirkungen können wir uns bei dem heutigen Wettbewerb einfach nicht erlauben.«
Michael dankt in Gedanken dem Portier seines Hotels.
»Herr Doktor, wir arbeiten seit mehr als zwölf Jahren erfolgreich zusammen. Das in dieser Zeit aufgebaute Vertrauen habe ich nicht leichtfertig oder aus Kalkül für ein womöglich fragwürdiges Medikament auf Spiel gesetzt und werde es auch nicht in der Zukunft tun.«
Der Leiter der Klinik lehnt sich im Sessel zurück und das Lächeln kehrt ansatzweise auf sein Gesicht zurück.
Michael atmet innerlich auf. »Ist es möglich, dass ich, im Rahmen der Ursachenforschung, eine Einsicht in die Patientenakten erhalte, um mir die Medikation anzusehen?«
»Sie erwarten sehr viel von mir, Herr Kästner.« Doktor Mutius seufzt unwillig, um dann noch ein »Meinetwegen« herauszupressen.
»Ich danke Ihnen, Herr Doktor. Wann darf ich anfangen?«
Doktor Mutius steht umständlich auf. Seine Haltung verrät überdeutlich, dass er seine Entscheidung im Grunde bereut und er das Gespräch beenden möchte.
»Am besten sofort, damit wir es hinter uns haben. Ich gebe der Station 3 Bescheid.« Er wirft Michael einen viel sagenden, fast leidenden Blick zu. »Ich erwarte von Ihnen äußerste Diskretion.«
***
Die Rückfahrt verläuft schweigend. Heute hatten sie ein Slum besucht, das durch das Erdbeben besonders stark betroffen worden war. Die alptraumhaften Bilder laufen Alexander und Laura immer noch nach, denn zusätzlich zu den üblichen Hygienekrankheiten leiden viele der ohnehin geschwächten Patienten immer noch an den Folgen der meist schlecht oder gar nicht behandelten Verletzungen und Brüche.
Ciel beugt sich vom Rücksitz nach vorne.
»Kaholo, wir haben noch etwas Zeit. Bringe uns bitte nochmal zu Gérard Latortue.«
»Pa gen pwoblem (kein Problem). Brauchen wir denn noch etwas?«, wundert er sich.
»Nein, ich muss mit ihm reden.«
Kaholo wirft einen prüfenden Blick in den Rückspiegel und verzichtet auf eine Rückfrage, als sich dabei seine und Ciels Blicke kreuzen.
Eine halbe Stunde später erreichen sie die Apotheke und müssen auf der Straße anhalten, denn die Toreinfahrt ist von fliegenden Händlern vollends in Beschlag genommen worden und zu einem Fußweg verkümmert.
Ärgerlich kurbelt Kaholo das Fenster herunter, da er mit Hupe nichts erreicht hat. Ein Schauer haitischer Flüche prasselt auf die Händler nieder, verfehlt aber seine Wirkung. Erst als er mit erhobener Stimme androht, über die ausgebreiteten Waren hinweg zu fahren und demonstrativ den ersten Gang einlegt, wird von Schimpfkanonaden begleitet eine knappe Fahrspur frei gemacht.
»Wärst du wirklich über deren Waren hinweggefahren?«, fragt Laura verunsichert.
»Natürlich nicht«, lacht Kaholo, »aber mittlerweile gehört es wohl zum Ritual.«
»Die Händler haben Sorge, diesen recht guten, vor allen Dingen trockenen, Platz zu verlieren«, erklärt Ciel die merkwürdige Situation. »Alexander, kommst du mit? Ich brauche vielleicht deine Unterstützung.«
»Meine Unterstützung? Wobei?«
»Das Verhalten des Apothekers war gestern alles andere als normal. So kenne ich ihn nicht. Ich möchte herausfinden, wovor Gérard Latortue Angst hat, ehe es meine Arbeit stört.«
»Und wie soll ich dabei helfen?«
»Deine Anwesenheit wird genügen. Ich werde so tun, als würde ich mit dir etwas besprechen. Das wird unsern Freund völlig verunsichern.«
»Verstehe!«, antwortet Alexander nachdenklich. »Hoffentlich mauert er dann nicht endgültig.«
Ciel macht eine abwägende Geste. »Ich glaube nicht. Gehen wir.«
Gérard Latortue hat ihre Ankunft schon längst bemerkt. Nervös steht er in der geöffneten Tür und winkt ihnen, schnell hereinzukommen.
»Prese, Prese! Ciel. - Hast du etwas vergessen?«, begrüßte er sie mit abschätzendem Blick zu Alexander.
»Bonswa, mein Freund! Vielleicht. - Hast du etwas Zeit für uns?«
Sie treten in den, wie immer, halb verdunkelten Verkaufsraum.
Sorgfältig verschließt Gérard Latortue hinter ihnen die Tür und rüttelt prüfend an der Klinke. Erst dann wendet er sich seinen Besuchern zu.
»Du hast etwas vergessen?«, wundert er sich.
»Ja, ich habe vergessen dich zu fragen, warum du so besorgst bist.«
Gérard Latortue sieht sie nicht an, als er zögernd antwortet.
»Schlechte Zeiten.«
»Schlechte Zeiten?«, wiederholt Ciel mit hochgezogenen Augenbrauen und zeigt auf die Tür. »Schließt du dich jetzt mit all deinen Kunden ein?«
»Nicht mit allen«, gibt er verlegen zu.
»Warum denn dann mit uns?«
Als hätte er ihre Frage nicht gehört, sieht er sie an und fragt: »Was brauchst du?«
Wie im Auto vereinbart, übersetzt Ciel Alexander das kurze Gespräch.
Nach kurzem, gespielten Nachdenken antwortet er: »Macht es Sinn, die Geschäftsbeziehung mit ihm infrage zu stellen?«
»Auf keinen Fall!«
Ciel wendet sich dem Apotheker zu, der das Gespräch mit besorgter Miene verfolgt hat.
»Wir kennen uns schon so viele Jahre, Gérard. Kann ich mich denn auch in Zukunft auf dich verlassen?«
Gérard Latortue reißt erschrocken die Augen auf.
»Sekonsa (natürlich) Ciel. Bitte bedenke, das Erdbeben hat vieles verändert. Die Zeiten sind schlechter geworden.«
»Wie schlecht denn?«
Gérard Latortue sieht sich unbewusst flüchtig um, ehe er antwortet.
»Ich habe jetzt andere Lieferanten.«
Alexander ist die Bewegung des Apothekers nicht entgangen.
»Hast du seine Reaktion bemerkt?«, fragt Ciel auf Deutsch, »Ich glaube, da liegt der Hase im Pfeffer.«
Sie nickt zustimmend und in ihr keimt ein Verdacht.
»Wirst du mir und damit deinen Landsleuten denn weiterhin alles zu vernünftigen Preisen liefern können?«
»Das Leben auf Haiti ist teuer geworden«, antwortet Gérard Latortue ausweichend.
Ciel sucht die Augen ihres Gegenüber. »Mein Freund, wie du weißt, bin ich hier auf Haiti, um zu helfen und nicht um Geschäfte zu machen.«
Mit einem verhaltenen Seufzer zeigt er auf die beiden wackligen Stühle unter dem verdunkelten Fenster. »Komm, setzen wir uns.«
Er wartet, bis Ciel sich gesetzt und Alexander sich hinter ihr einen Platz zum Anlehnen gesucht hat.
»Das Erdbeben hat nicht nur unsere Häuser zerstört, sondern auch die Strukturen in unserem Land. Wir haben keine Regierung mehr, keine Polizei, nichts mehr.« Er zuckt mit den Schultern. »Jeder macht jetzt, was er will.«
Ciel ahnt, was er ihr sagen will.
»Wir hatten auch Besuch von einer Gesundheitspolizei, die es offiziell nicht gibt.«
Gérard Latortue sieht sie überrascht an.
»Bei dir?« Er schüttelt den Kopf. »Und was hast du dann gemacht?«
Mit kurzen Worten berichtet sie ihm von dem Vorfall.
»Aha. Darum war Kaholo mit einigen Patienten bei mir«, erinnert sich Gérard Latortue. Er beugt sich näher zu Ciel heran.
»Ich kann einige Medikamente nur noch bei einem bestimmten Lieferanten kaufen«, flüstert er verschwörerisch. »Heute Abend erwarte ich die erste Sendung von ihm.«
Ciel legt ihre Hand auf den Arm des Apothekers.
»Ich habe mir so etwas schon gedacht. Wir müssen auf der Hut sein.«
Gérard Latortue richtet sich auf seinem Stuhl auf und verschränkt die Arme auf seiner Brust. Er sieht Ciel unsicher an.
»Was können wir denn schon tun?«, fragt er mit einem resignierten Unterton. »Einem Kollegen in der Unterstadt haben einige Jugendliche das Geschäft verwüstet, weil er angeblich nicht genug Aspirin auf Lager hatte. Das - war - kein - Zufall!«, fügt er scharf hinzu.
»Verstehe!«, antwortet Ciel schnell, «kennst du diese Leute?«
Gérard Latortue sieht sie mitleidig an. »Kisa (wie bitte)?«, und steht eckig auf, um kühl von oben auf sie herabzusehen. »Ich muss noch etwas vorbereiten. Wenn du etwas brauchst, rufe mich bitte vorher an. Du hast ja meine Nummer.«
***
Das allabendliche Gewitter war nur kurz, sorgte aber dennoch für eine gewisse Abkühlung. Froh durchatmen zu können, hat Alexander seinen Laptop auf der Terrasse aufgestellt und überträgt die digitale Fotoausbeute des Tages auf die Festplatte. Während des langwierigen Datentransfers sichtet er das bereits überspielte Bildmaterial, löscht unbrauchbare Bilder und sortiert geeignete in einen speziellen Ordner. Viele Aufnahmen landen allerdings im allgemeinen Archiv.
Bei dieser Arbeit wird ihm plötzlich bewusst, dass ihn die Bilder, die schaurige Erinnerungen an das heute Gesehene wieder hervorzerren, kaum berühren.
»Stumpft man schon ab?«, fragt er sich laut.
Laura ist in einem Buch vertieft, dass sie sich von Ciel ausgeliehen hat. Irritiert schaut sie auf.
»Wie bitte?«
»Ach nichts, ich habe mit mir selbst gesprochen.«
»Du sichtest die Fotos, nicht wahr? Lass mal sehen.«
Eigentlich liebt er es nicht, wenn man sein Rohmaterial begutachtet. Oft genug hat er sich dabei Vorwürfe anhören müssen, die von »Warum bist du nicht näher ran gegangen?« bis zu »Wieso ist es nicht scharf?« reichten. Trotzdem rückt er beiseite, um Laura den Blick auf den Bildschirm zu ermöglichen.
Stumm betrachten sie gemeinsam die Bilder, die er nacheinander durchklickt. Alexander bemerkt, wie sie bei einigen ab und zu schwer atmet und schluckt.
»Das hier, wäre das nicht für die Werbung geeignet?«
Laura zeigt auf den Bildschirm, auf dem eine dankbar lächelnde Mutter mit einem sehr abgemagerten Baby auf dem Arm zu sehen ist.
»Ist das nicht schräg?«, Alexander schnauft ärgerlich. »Da habt ihr beide, du und Ciel, doch ganze andere Hilfen geleistet, und das banalste Bild wird zur Werbung benutzt.«
»Ich glaube nicht, dass entzündete und eiternde Wunden verkaufsfördernd sind«, gibt Laura mit ärgerlicher Stirnfalte zu bedenken.
»Das ist es ja!«, poltert Alexander. »Wo bleibt denn da die Realität?«
»Mir laufen die Eindrücke von heute auch noch nach«, versucht Laura ihn zu besänftigen.
»OK, OK«, lenkt Alexander ein, »da fällt mir ein, da muss eine Aufnahme dabei sein, da sieht man, wie ihr ein entzündetes Bein verbindet« und sucht das Bild heraus.
»Hier. Die grässliche Wunde ist schon abgedeckt, nur die Entzündung rundherum ist noch zu sehen. Was hältst du davon?«
»Hmm«, stimmt Laura zu. »Hier sieht man, dass schon etwas geleistet worden ist.«
Alexander malt mit den Händen einen imaginären Bilderrahmen in die Luft.
»Und unten drunter, mit großen Buchstaben in Blutrot: Lieber Spender, dein Geld ist angekommen.«
Laura verzieht wie angeekelt ihr Gesicht. »Solchen Sarkasmus finde ich widerlich. Die Leute, die dafür Geld geben, meinen es doch einfach nur gut.«
»Entschuldige, du hast ja Recht. Nur, die ahnen ja gar nicht, was hier wirklich los ist.«
»Da sagst du was«, stimmt sie ihm zu, um von dem unseligen Thema abzulenken. »Hoffentlich geht das mit dem Apotheker gut aus.«
»Das ist unser Stoff für die übernächste Woche: Haiti in den Klauen der Pillenmafia.«
Laura sieht Alexander besorgt an. »Sonst geht es dir noch gut?«
»Jein! - Merkst du nicht, wie wir uns verbiegen müssen? Heute sorgen wir für niedliche Bettelbilder und nächste Woche für auflagestärkende Horrorschlagzeilen.«
Ciel war von den Beiden unbemerkt hinzugetreten.
»Ich habe nicht vorgehabt, euch zu belauschen«, beschwert sie sich, »aber ihr seid kaum zu überhören.«
»Wir diskutieren nur über die Bilderauswahl«, erklärt Laura mit einem vorwurfsvollen Blick zu Alexander.
Er sieht zu Ciel auf. »Was wir hier machen, grenzt an professioneller Schizophrenie.«
»Jetzt bleib doch mal auf dem Teppich!«, schimpft Laura. »So ist das hier eben. Nebenan, in der Dominikanischen Republik, versaufen die Gäste abends an der Bar pro Nase so viel Geld, wie ein haitischer Bauer in zwei Jahren nicht verdienen kann, und da beschwert sich kein Schwein darüber!«
Ciel sieht Alexander nachdenklich an.
»Am Anfang widmete ich mich auch mit Begeisterung meiner selbst gewählten Aufgabe. Ich sah weder nach links oder rechts und arbeitete wie besessen. Bis ich eines Tages ernüchtert feststellte, dass mein ganzer Einsatz nichts, aber auch gar nichts, geändert hatte. Zu meinem Entsetzen musste ich feststellen, dass ich sogar ein Teil dieses unheilvollen Systems geworden war. - Trotzdem bin ich geblieben«, fügt sie mit resigniertem Unterton hinzu.
»Wieso meinst du, ein Teil dieses Systems geworden zu sein?«, fragt Alexander verwundert.
»Nachdem sich meine Tätigkeit rumgesprochen hatte, tauchten nacheinander die Regierenden mit Gefolge und Presse bei mir auf, schüttelten mir medienwirksam minutenlang die Hand und lobten meine Arbeit über alles. Diese Anerkennung tat mir natürlich gut, bis mir eines Tages klar wurde, dass die Herren sich nur in Szene setzen wollten. Und ich, ich war nur ein williger Statist auf ihrer politischen Bühne.«
»Wenn ich an unsere Bilderauswahl denke«, stellt Alexander ernüchtert fest, »ist es bei uns in Deutschland eigentlich nicht viel anders.«
»Das sehe ich aber anders!«, protestiert Laura, »man kann doch Werbung und Berichterstattung nicht mit Politik vergleichen!«
Ciel hebt beschwichtigend die Hände.
»Ich weiß, was Alexander meint. Aber ist es nicht so, dass man trotz dieser notwendigen Umstände seine Arbeit macht, damit eben den Menschen, die unter solchen Bedingungen leben müssen, letztlich doch geholfen wird?«
»Ein ganz schön hoher Preis«, stellt Alexander trocken fest.
»Ich finde, du übertreibst«, tadelt Laura. »So lange man bei der Wahrheit und sich selbst treu bleibt, ist es doch in Ordnung.«
Ciel lässt sich auf einen der geflochtenen Sessel nieder, der zwischen Laura und Alexander steht und sieht ihn für einige Sekunden ernst an, ehe sie fragt.
»Du bist also der Meinung, dass mein Apotheker Gérard in die Fänge einer - Pillenmafia - geraten ist?«
Sie betont dabei Pillenmafia so, als würde sie über etwas Ekeliges sprechen.
Alexander wiegt den Kopf. »Ich bin zwar kein Kriminalist, aber es spricht doch einiges dafür.«
Auf Laura Stirn bildet sich wieder eine senkrechte Falte.
»Einiges? Es sind doch nur zwei Argumente. Da ist einmal sein ängstliches Verhalten und dann, dass er angeblich nur noch einen Lieferanten hätte.«
»Ich kenne ihn seit vielen Jahren. Wir sind beinahe Freunde«, wirft Ciel ein. »So wie er, verhält sich nur jemand der Angst hat - und ängstlich war Gérard Latortue nie.«
Laura wollte gerade etwas erwidern, als das Telefon im Haus läutet. Man hört Flores schlurfende Schritte und anschließend, wie sie sich meldet. Sekunden später erscheint sie auf der Terrasse.
»Souple, Madame Ciel. Le Pharmacien.«
Ciel tauscht mit Laura und Alexander bedeutungsvolle Blicke, ehe sie im Haus verschwindet.
Nach einem kurzen Gespräch kommt sie wieder zurück und lässt sich wie erschöpft in ihren Sessel fallen.
»Das war Gérard Latortue«, sie macht eine bedeutungsvolle Pause, »er hat die Medikamente, die er heute von dem neuen Lieferanten bekommen hat, analysiert.«
»Ja und?«, fragt Alexander ungeduldig, obwohl er die Antwort schon ahnt.
»Es sind durchweg Fälschungen und sie sind vollkommen wirkungslos.«
»Oh Gott!«, entfährt es Laura. »Was machen wir jetzt?«
»Wir? Mit wir ist auch er gemeint. Wir sind auf ihn angewiesen. Er kann das Zeug natürlich nicht verkaufen und außerdem ist er dann auch noch sein Geld los.«
»Kann er die Medikamente nicht zurückgeben oder zur Polizei gehen?«
Ciel schüttelt den Kopf.
»Das würde er wahrscheinlich nicht überleben«, sagt sie dumpf.
Laura sieht Ciel erschrocken an und schweigt betroffen.
»Das kann man doch nicht einfach so hinnehmen!«, knurrt Alexander. »Wir müssen was unternehmen!«
Er bemerkt nicht, dass Flore im Türrahmen erscheint und besorgt die drei beobachtet. Ihre Stimme klingt zaghaft, als sie zum Essen einlädt.
»Eskize mwen, das Abendessen ist fertig.«
Ciel ist für diese Ablenkung dankbar.
»Mesi, Flore! Ich denke, es wird uns allen gut tun.«
***
Ein kaum wahrnehmbarer Ruck signalisiert Michael, dass er auf der Station 3 angekommen ist. Während sich die stählernen Türflügel zurückziehen, wirft er noch einen prüfenden Blick in den Spiegel, der die gesamte Rückwand des Aufzuges einnimmt und muss schmunzeln, denn der geliehene Arztkittel verleiht ihm zweifellos eine gewisse, zumindest optische Kompetenz.
Vor dem Aufzug, dessen Türen sich hinter ihm geräuschlos schließen, weisen ihm hochglanzpolierte Metallbuchstaben den Weg zur Station 3. Der elastische Bodenbelag dämpft seine Schritte und der kleine Clip an der Brusttasche, den er von Frau Kastell angesteckt bekommen hat, öffnet ihm wie von Geisterhand die elegant satinierten Glastüren. Der mit ausgewählten Bildern dekorierte Flur weitet sich für den Stationsempfang, der ihn an die Rezeption seines Hotels erinnert.
Eine Krankenschwester sieht ihm freundlich entgegen.
»Guten Tag. Sie sind sicherlich Herr Kästner!?«
Michael muss sich zusammenreißen. Die charmante Erscheinung mit tiefbraunen Augen und der warmen Stimme hat eine regelrecht hypnotische Wirkung auf ihn.
»Guten Tag. - Äh ja, hat man Sie schon über meine Aufgabe informiert?«
»Selbstverständlich. Ich habe die gewünschten Unterlagen herausgesucht und in das Besprechungszimmer gelegt. Dort können Sie ungestört arbeiten.« Sie erhebt kaum merklich ihre Stimme: »Herr Kästner!«
Michael ertappt sich, dass er sie vermutlich die ganze Zeit angestarrt hat und spürt, wie ihm die Röte ins Gesicht steigt.
»Entschuldigung, danke«, stammelt er verlegen.
Mit kühlem Blick steht sie auf und öffnet eine gegenüberliegende Tür. »Das Besprechungszimmer ist hier, Herr Kästner.«
Er beeilt sich, in das Zimmer zu gehen und ist froh, als sich die Tür hinter ihm schließt.
»Das hätte mir nicht passieren dürfen«, gesteht er sich beschämt ein, denn möglicherweise ist er noch auf ihre Hilfe angewiesen.
Zu seiner Beruhigung ist der Aktenstapel nicht so hoch, wie befürchtet und er macht sich, nachdem er seinen Laptop in Betrieb genommen hat, an die Arbeit.
Stunde um Stunde kämpft er sich durch Listen und Karteikarten, tippt die Ergebnisse in seinen Computer, prüft und vergleicht die Medikation und steht vor einem Rätsel. Obwohl die Patienten wegen ihrer unterschiedlichen Erkrankungen, mit Ausnahme von Cardea Salicin Natur, verschiedene Medikamente erhielten, traten bei fast allen die gleichen Symptome auf.
»Wechselwirkungen scheiden damit also aus«, sagt er zu sich selbst und lehnt sich auf den Stuhl zurück, »vielleicht ist das Zeug doch nicht so harmlos.«
Während er die zweite Flasche Mineralwasser leert, betrachtet er nachdenklich den Bildschirm mit den aufgelisteten Daten. Nur vier der achtundzwanzig Patienten haben zusätzlich eine Nachtmedikation gemeinsam erhalten.
»Was ist eine Nachtmedikation?«, überlegt er.
Kurz entschlossen geht er zum Empfang und ihm fällt ein Stein vom Herzen, denn eine andere, ältere Schwester sieht ihn erwartungsvoll an.
»Sie prüfen die Unterlagen, nicht wahr? Kann ich Ihnen helfen?«
»Ich glaube schon, genau dazu habe ich eine Frage. Was ist eine Nachtmedikation?«
Die Schwester lächelt verbindlich.
»Das sind harmlose, schwach dosierte Schlafmittel und manchmal auch Schmerzmittel und so weiter.«
»Danke. Bekommen das alle Patienten?«
Das Lächeln verschwindet und macht einem leicht misstrauischen Ausdruck Platz.
»Es steht alles in den Unterlagen, die Sie ja vorliegen haben.«
Die ausweichende Antwort und der Hinweis auf die Patientenmappen lassen in Michael die Alarmglocken schellen. Er erspart sich weitere Fragen.
»Danke für die Unterstützung. Ich habe noch einiges zu tun. Wann beginnt denn in Ihrem Hause die Nachtruhe?«
Die Schwester zieht ein wenig die Augenbrauen hoch und antwortet betont routiniert, wie eine Stewardess, die ihre Passagiere mit den Notausgängen vertraut macht.
»Das Abendessen servieren wir für die Patienten ab sechs Uhr und ab sieben versorgen wir sie für die Nacht. Anschließend beginnt bei uns die Nachtruhe. Letztlich entscheiden unsere Patienten natürlich selbst, wann sie das Licht ausschalten.«
»Danke für Ihre Auskünfte. Hoffentlich bin ich um acht Uhr auch mit der Arbeit fertig«, seufzt Michael theatralisch und geht in das Besprechungszimmer zurück.
Unruhig geht er auf und ab. Ihn beschäftigt nur noch ein Gedanke. Wie er unauffällig an die Zusammensetzung der Nachtmedikation gelangen kann. Eine Unterstützung vom Leiter der Klinik oder von der Station bezieht er in seine Überlegungen erst gar nicht ein.
Von anderen Krankenhäusern und aus eigener Erfahrung weiß er, dass die Schälchen mit den Medikamenten vor dem Abendbrot von den Schwestern zusammengestellt und mit den Essen verteilt werden.
»Das ist die einzige Chance, die Zusammensetzung der Nachtmedikation zu überprüfen und mit den Patientenmappen zu vergleichen«, sagt er zu sich selbst.
Automatisch schaut er auf die Uhr.
»Noch eine Stunde.«
Um nicht untätig zu sein, überbrückt er die Wartezeit mit der eigentlich überflüssigen Kontrolle seiner ermittelten Daten.
Die Unruhe draußen auf dem Gang nimmt merklich zu.
Er wartet noch zehn Minuten und sieht sich um. Auf der gegenüberliegenden Seite des Ganges ist eine der Türen halb geöffnet. Licht fällt aus dem Zimmer heraus und er kann deckenhohe Regalwände mit zahllosen Schubladen erkennen. Die Stationsapotheke, stellt er zufrieden fest.
Er schnappt sich eine der Patientenmappen und geht mit einem aufgesetzt fragenden Blick hinüber.
Er hat Glück. Zwei Schwestern sortieren konzentriert Medikamente in kleine, unterteilte weiße Plastikschalen, die namentlich beschriftet sind und ergänzen die Eintragungen in den Patientenmappen. Im Anschluss werden die fertigen Schälchen mit einem durchsichtigen Deckel verschlossen und auf einen Rolltisch abgelegt.
Michael wirft einen Blick in die Schälchen. In nahezu allen liegen in der dritten Unterteilung dieselben Medikamente. Nur die Ersten und die Mittleren sind unterschiedlich gefüllt.
»Entschuldigung bitte. Darf ich stören?«, fragt Michael gewollt zaghaft.
Eine der Schwestern sieht ärgerlich auf.
»Wir haben nicht viel Zeit. Worum geht es denn?«, fragt sie dennoch höflich.
»Ich habe nur eine Frage zur Medikation. Können Sie das lesen?«
Er schlägt eine Seite der Patientenmappe auf und zeigt mit dem Finger auf einen Eintrag, der, wie nahezu alle anderen auch, sehr flüchtig geschrieben worden ist.
Der Schwester genügt ein kurzer Blick.
»Das ist ein Eintrag von Johanna. Das heißt Tetracyclin, ein Antibiotikum.«
Sie sieht zu ihm auf.
»War das alles?«, fragt sie beinahe ungläubig.
»Ja danke, es war mir eine Hilfe.«
Michael weist auf die fertigen Schälchen.
»Bekommen Ihre Patienten alle dasselbe?«
»Die Medikamente in den Dispensern? Selbstverständlich nicht!«, entrüstet sich die Schwester, »wie kommen Sie darauf?«
»Weil hier überall dieselben Tabletten drin sind.«
Er zeigt auf die dritten Fächer der Dispenser.
»Das sind harmlose Schlaf- oder Beruhigungsmittel und Schmerzmittel, damit unsere Patienten ruhig und entspannt schlafen können. Das bieten wir allen an. Sie wissen ja, die fremde Umgebung und so weiter.«
»Natürlich, nochmals danke.«
Michael merkt sich den Namen des Patienten auf dem Dispenser und geht in das Besprechungszimmer zurück. Er lässt aber diesmal die Tür weit offen stehen. Während er am Schreibtisch anscheinend weitere Listen auswertet, beobachtet er dabei unauffällig den Gang. Wie erwartet haben die beiden Schwestern schon nach wenigen Minuten ihre Arbeit im Apothekenraum beendet und schieben den Rolltisch mit den Dispensern heraus, um mit ihm in einem der Flure zu verschwinden.
Sekunden später drückt Michael die Klinke des Apothekenraumes herunter und atmet auf. Er ist nicht abgeschlossen. Ohne zu zögern geht er hinein, lässt aber die Tür angelehnt offen stehen.
Der Raum wirkt aufgeräumt. Alle Schränke und Schubladen sind ordentlich geschlossen. Sogar die Patientenmappen liegen sorgfältig gestapelt auf dem kleinen Schreibtisch, der seitlich neben der Tür seinen Platz gefunden hat.
Hastig öffnet er die oberste Mappe und sieht sich die Medikation für den heutigen Abend an. Wie erwartet findet er den Eintrag über Name und Dosis der therapeutischen Medikamente. Ein Vermerk über die Nachtmedikation oder deren Zusammensetzung fehlt allerdings. Wie elektrisiert öffnet er die anderen Mappen und findet auch die, deren Namen er sich gemerkt hat. Überall dasselbe.
»Über die Nachtmedikation wird offensichtlich nicht immer Buch geführt. - Das erklärt alles«, stellt Michael halblaut sprechend fest.
Er klappt die Mappen zu und legt sie exakt so wieder zurück, wie er sie vorgefunden hat und verlässt den Raum.
Sein Blutdruck schnellt in die Höhe, als er auf den Gang tritt und eine vorbeieilende Schwester ihn stirnrunzelnd ansieht und vermutlich überlegt, ob er zur Station gehört oder nicht.
Er nickt ihr zu und geht wie selbstverständlich in den Besprechungsraum hinüber. Erst als er dessen Tür hinter sich schließt spürt er, wie diese Aktion an seinen Nerven gezerrt hat.
Eine gute Stunde später sitzt er entspannt im Hotelrestaurant und genießt eine der Meersburger Fischspezialitäten mit dem angenehmen Gefühl, sie sich wirklich verdient zu haben.
Eine milde, rötliche Morgensonne empfängt ihn, als er am nächsten Morgen durch einen kleinen Park zur Klinik geht.
»Guten Morgen Herr Kästner!«, begrüßt ihn Frau Kastell kühl, als er ihr Büro betritt. »Sicherlich haben sie wieder einen Termin mit Herrn Dr. Mutius?«
»Ihnen auch einen guten Morgen Frau Kastell!« Michael macht eine zerknirschte Miene. »Ja, ich hatte noch gestern spätabends mit Herrn Dr. Mutius gesprochen und mich um neun mit ihm verabredet.«
Der Leiter der Klinik hört dem Michael konzentriert zu und verzieht während des Berichts keine Miene. Nur kleine Schweißtropfen auf der Stirn und die unruhigen Finger verraten eine zunehmende Nervosität.
Mit dem Resümee: »... die Ursache für die beanstandeten Nebenwirkungen liegt an der Kombination von Cardea Salicin Natur mit herkömmlichen Schmerzmitteln, die haupt- oder zusätzlich mit der üblichen Nachtmedikation gereicht wurden«, beendet Michael seine Analyse.
Der Leiter der Klinik steht auf. »Ich bin froh, dass Sie die Ursache herausgefunden haben« und öffnet zur Überraschung Michaels die Tür seines Büros. »Wir bleiben in Verbindung.«
»Natürlich, Dr. Mutius!«, antwortet Michel automatisch und fühlt sich hinausgeworfen.
Verblüfft und beschämt sieht er zur Sekretärin hinüber, die das Geschehen beobachtet hatte. Er spürt, wie ihm die Röte ins Gesicht steigt.
»Kopf hoch, Herr Kästner! Früher wurden die Boten schlechter Nachrichten geköpft«, tröstet sie ihn schmunzelnd.
Auf der Autobahn Richtung Norden geht er in Gedanken nochmals das Erlebte durch.
»Dr. Mutius ist eigentlich wieder ganz der Alte«, stellt er zufrieden fest. »Nur - woher wusste die Sekretärin, dass ich eine schlechte Nachricht für ihn und die Klinik hatte?«
***
Eine angenehme, morgendliche Kühle weht Alexander entgegen, als er die Terrasse betritt. Nach den vorangegangenen schwülen Nächten, in denen er auf den nass geschwitzten Laken kaum schlafen konnte, war die letzte eine wahre Wohltat. Genussvoll reckt er sich ausgiebig und atmet tief durch.
»Bonjou Alessander!«, wird er von hinten angesprochen.
Überrascht klappt er seine weit ausgebreiteten Arme ein und dreht sich verlegen um.
Flore, die ein großes Tablett mit dem Frühstück balanciert, steht schmunzelnd hinter ihm.
»Bonjour Flore!«
Mit beiden Händen deutet er ihr an, dass er ihr das Tablett abnehmen möchte. Sie weicht aber mit einer geschmeidigen Bewegung aus und stellt es mit einem mädchenhaften Lächeln auf dem großen Tisch ab.
Fasziniert stellt Alexander mit den Augen eines Fotografen fest, dass ihr ganzer Körper an dem Lächeln beteiligt ist. Er bedauert, dass er diesen Moment nicht festhalten kann.
Ciel und Laura treten leise plaudernd auf die Terrasse. Während Laura wie immer in eine ihrer zahllosen Jeans geschlüpft ist, erscheint Ciel in einem typisch haitisch geschnittenen, weißen Kleid.
Sie bemerkt Alexanders erstaunten Blick.
»Heute ist ein besonderer Tag«, und mit einladender Handbewegung ergänzt sie: »Setzen wir uns doch.«
»Haben wir deinen Geburtstag übersehen?«, fragt er vorsichtig, nachdem alle Platz genommen haben.
»Nein«, lacht Ciel, »heute ist das Ogounfest.«
»Aha, das Ogounfest?«
»Ogoun c‘est grand Loa (er ist ein großer Geist) und der oberste Krieger«, erklärt Flore, während sie Tassen und Teller auf dem Tisch verteilt.
Alexander sieht ratlos in die Runde.
»Sollten wir uns auch etwas anderes anziehen?«, fragt Laura unsicher und sieht prüfend an sich herunter.
»Nein, das braucht ihr auf Haiti nicht«, beruhigt Ciel. »Aber der 25. Juli ist der Tag des Ogoun, einer der wichtigsten geistigen Persönlichkeiten im haitischen Glauben und das sollte man schon würdigen. Wir werden heute zu einer kleinen Kapelle, hier in der Nähe, fahren. Dort werde ich eine Andacht halten und anschließend bleiben wir noch eine Weile mit der Gemeinde zusammen. Manchmal muss ich auch noch Kranke behandeln. Ihr könnt gerne mitkommen.«
»Du, du hältst eine, eine Andacht?«, stottert Laura ungläubig.
»Ja, ich bin eine initiierte Mambo, also Voodoopriesterin.«
Alexander benötigt eine Sekunde, um diese Information zu verarbeiten. »Cool!«, er kann sein Erstaunen kaum verbergen. »Da kann ich bestimmt tolle Bilder machen.«
»Alex!«, Laura sieht ihn empört an.
Ciel lächelt verzeihend. »Während der Andacht natürlich nicht. Danach ist es vielleicht möglich«, erklärt sie diplomatisch und wirft einen Blick auf die Uhr. »Wir sollten jetzt frühstücken, in einer halben Stunde geht’s los.«
Vor der Kapelle hat sich schon eine kleine Gruppe versammelt, als sie nach der kurzen Fahrt ankommen. Während Ciel ihre Gemeinde begrüßt, schauen Alexander und Laura sich neugierig um.
Trotz der Nähe zu Innenstadt hat sich der kleine Platz weitestgehend erhalten können. Noch nicht mal die obligatorischen blauen UN-Zelte sind vertreten. Sogar einige knorrige Bäume haben überlebt und spenden einen, wenn auch spärlichen, Schatten.
Die Kapelle selbst besteht nur aus einer schlicht gemauerten Apsis und dem Altar, die von einem ausladenden, baldachinähnlichen Dach geschützt werden. Die Seiten sind offengeblieben. In der flachen, blau ausgemalten Apsis ist ein mittelalterlicher Ritter dargestellt, der ein riesiges Schwert schwingt.
Vor dem Altar türmen sich die verschiedensten Opfergaben. Flaschen aller Größen, geflochtene Etuis, geschmückte Dosen, reich bestickte, kleine Tücher und anderes mehr. Trotz aller Schlichtheit geht von dem kleinen Altar eine besondere Stimmung aus.
»Der Reiter stellt wohl Saint Jacques dar«, flüstert Laura nachdenklich.
»Saint Jacques? Dann ist das ja eine christliche Kapelle?«, wundert sich Alexander. »Was hat sie mit dem Ogoun zu tun?«
»Im haitischen Voodoo sind der Saint Jacques und der Loa Ogoun identisch. Beide kämpfen mit dem Schwert für den Glauben«, erklärt Laura leise. »Viele christliche Heilige haben eine Entsprechung im Voodoo.« Sie zupft Alexander am Ärmel. »Wir müssen gehen.«
Langsam füllt sich der Platz vor der Kapelle und einige der Besucher legen vor dem Altar meist bescheidene Opfergaben ab.
Drei ältere Männer, deren weiße Haare einen markanten Kontrast zu ihrer dunklen Haut bilden, lassen sich mit fellbespannten Trommeln und Klanghölzern auf Schilfmatten, die Kaholo an der linken Seite ausgebreitet hat, nieder. Ihre Hände streicheln förmlich die Instrumente und melodisch weiche Rhythmen und Tonfolgen locken noch mehr Zuschauer an.
Irgendjemand hat das obligatorische Holzfeuer entzündet, dessen heller Rauch die Gäste manchmal vollständig einhüllt, die sich aber daran nicht zu stören scheinen.
Dagegen bedenken einige Laura und Alexander immer wieder mit kritischen Blicken, die sich daraufhin an den Rand des Platzes zurückziehen.
Trotz der zahlreichen Besucher, die ihnen den Blick versperren, können sie beobachten, wie Ciel vor dem Altar mit einem Stück Holzkohle ein großes Ornament auf den geglätteten Boden zeichnet. Während es sich allmählich der Vollendung nähert, wippen die Besucher im Takt der Trommeln und klatschen in die Hände.
»Das erinnert mich an Gospelgesänge«, stellt Alexander beeindruckt fest, während er, ohne es zu merken, sachte mitwippt.
Nach dem letzten Kohlestrich Ciels ändern sich die Trommelklänge und einige Frauen stimmen einen Sprechgesang an, der im Wechsel durch kurze Refrains der Gemeinde begleitet wird.
Dazu beginnen nahezu alle Teilnehmer, für europäische Maßstäbe mit ungewohnten Bewegungen, zu tanzen.
Nebel von reichlich geopfertem Tabak und Weihrauch steigt auf und hüllt die wogende Gemeinde in einen magisch wirkenden, grauen Dunst.
Bis plötzlich der Gesang abrupt stoppt. Nur die Trommeln sind noch zu hören und sorgen für eine magische Stimmung.
Laura und Alexander können nur schemenhaft erkennen, dass einer der Tänzer wie von Krämpfen geschüttelt am Boden liegt. Ciel beugt sich über ihn und streicht mit den Händen über den schweißnassen Körper. Der Tänzer entspannt sich und richtet sich halb auf. Er ruft etwas und die Gemeinde antwortet, dann zeigt er plötzlich mit ausgestrecktem Arm auf eine junge Frau, die sich mit einem spitzen Aufschrei niederkniet.
»Was geschieht da?«, fragt Laura besorgt und reckt den Hals.
»Ich kann auch nichts erkennen, nur dass Ciel zu der knienden Frau geht und sie aufrichtet.«
»Schade, dass wir nicht dabei sein dürfen«, seufzt Laura und lässt sich frustriert auf den niedrigen Mauerrest nieder, den sie zum besseren Sehen bestiegen hatte.
»Wir gehören eben nicht dazu«, meint Alexander mit resigniertem Unterton.
Wieder einmal ändert sich der Klang der Trommeln und die Beiden recken sich erneut, um doch noch etwas von den Geschehnissen mitzubekommen.
Die junge Frau ist, trotz der im Takt hin und her wogenden Menschen, hin und wieder zu sehen, wie sie jetzt übertrieben ausgelassen tanzt und dabei an einer auffallend großen Zigarre pafft.
»Sie raucht für Ogoun«, flüstert Laura.
»Was?«, fragt Alexander ungläubig.
»Loa Ogoun raucht gerne, und sie verhält sich jetzt so, als wäre sie der Ogoun«, erklärt sie beiläufig, während sie wieder auf dem Mäuerchen den Hals reckt.
Alexander erinnert sich an diverse reißerische Berichte über Voodoo-Feiern, die er vor langer Zeit verschlungen hatte.
»Aha, dann ist sie das Medium.«
Er greift nach seinem Fotoapparat und macht einen Schritt auf die Tanzenden zu. »Wir sollten uns das unbedingt näher ansehen.«
Laura hält ihn erschrocken zurück. »Lieber nicht. Schau mal unauffällig nach links rüber.«
Ein Haitianer, mit einem weiten, buntbestickten, bodenlangen Umhang bekleidet, steht etwas abseits auf der gegenüberliegenden Seite und stützt sich auf einen langen Stab, der am oberen Ende eine merkwürdige Verdickung aufweist. Die Zeremonie scheint ihn nicht zu interessieren, sondern sein unfreundlich wirkender Blick ruht ungeniert auf Laura und Alexander.
»Was hat der?«, fragt Alexander und sieht sich unsicher um. Beruhigt stellt er fest, dass sie ansonsten alleine sind.
»Vielleicht will er einfach nicht, dass wir der Zeremonie zu nahe kommen.«
»Meinst du?«, Alexander wirkt nicht überzeugt. »Ciel hätte uns auf jeden Fall vorher gewarnt oder gar nicht erst mitgenommen, wenn unsere Anwesenheit eine Art Sakrileg wäre.«
Die lauter werdenden Trommeln lenken ihre Aufmerksamkeit wieder auf das Geschehen vor dem Altar.
Das Medium ist verschwunden. Kleine Flaschen mit Rum werden herumgereicht, aus denen die Tänzer einen kräftigen Schluck nehmen.
Ciel löst sich aus der Gemeinde und kommt zu den Beiden hinüber. Die Konzentration der letzten Stunde ist ihr anzusehen, dennoch strahlt sie eine tiefe Zufriedenheit aus.
»Ist die Feier denn zu Ende?«, fragt Laura mit einem viel sagenden Blick auf die Tanzenden.
»Nur der spirituelle Teil«, bestätigt Ciel lächelnd, »und heute sind keine Kranken dabei.«
»Schade, dass wir nicht dabei sein durften«, beklagt sich Alexander und fängt sich einen vorwurfsvollen Blick Lauras ein.
»Seit dem Erdbeben reagieren die Haitianer auf Kamerateams zunehmend allergisch«, erklärt Ciel kühl. »Einer der Musiker schimpfte, als er deine Kamera sah: Wir sind doch keine Tiere im Zoo. - Dem konnte und wollte ich nichts entgegensetzen.«
Laura wirft Alexander einen »Siehste!«-Blick zu und informiert Ciel über den merkwürdigen Haitianer. »Übrigens, wir waren nicht die einzigen fremden Besucher hier. Ein Haitianer hat auch nicht an der Andacht teilgenommen, sondern uns nur angestiert.«
Alexander sieht sich suchend um, aber der Fremde ist verschwunden.
»Aha. - Wie sah er denn aus?«, fragt Ciel verwundert.
Laura beschreibt ihn und dass er sich auf einen Stab stützte.
»Der Stab und der Umhang weisen ihn als Würdenträger aus, - wenn er denn einer ist.«
»Wenn er denn einer ist? Gibt es Zweifel?«, wundert sich Laura.
»In den Slums gibt es neuerdings unzählig viele, die sich zu Höherem berufen fühlen. Das Erdbeben hat nicht nur unsere Häuser, sondern auch die sozialen Strukturen zerstört und die Katastrophe hat leider Möchtegernfürsten oder Apokalypsepredigern Wasser auf die Mühlen gegeben.«
»Bei uns wäre es vermutlich auch nicht anders«, stimmt ihr Laura zu und macht ein betrübtes Gesicht.
Alexander sieht amüsiert zu den Tanzenden hinüber.
»Die sind ja gut drauf. Wie geht es dort weiter?«
Ciel sieht schmunzelnd zu den Tänzern rüber.
»Mit der gleichen Tiefe, mit der sie ihre Sünden bereuen, feiern sie ihren Glauben.«
***
Das letzte Licht des Tages ist verblasst und ein tiefblauer Sternenhimmel wölbt sich über Port-au-Prince, als sie wieder Ciels Haus erreichen.
Zu ihrer Überraschung empfängt sie Flore, in der weit geöffneten Tür stehend.
»Bonswa, Flore! - Du bist schon zuhause?«
»Wi, Madame Ciel«, antwortet Flore mit belegter Stimme.
»Ist alles in Ordnung?«, fragt Ciel besorgt.
»Mesi, Madame Ciel. - Es sind nur noch wenige zum Fest in Carrefour Feuilles gekommen«, winkt Flore ab und geht zur Seite, um alle ins Haus zu lassen.
Ciel legt tröstend ihre Hand auf Flores Schulter. »Komm - wir lassen den Tag auf der Terrasse ausklingen«, und verschwindet in der Küche.
Alexander entzündet mit spitzen Fingern und zu kurzen Streichhölzern die alte kupferne Öllampe, deren warmes Licht nur mit Mühe bis zum ausgeblichenen Holzgeländer reicht. Die Grillen, die sich nahezu überall in den Ritzen verstecken und energisch zirpen, scheint es nicht zu stören.
Ciel kommt mit einer Flasche Rotwein und Gläsern wieder.
»Den haben wir uns verdient, nicht wahr?«, lächelt sie. »Diesen Wein hat mir vor Jahren der Vater eines kleinen Jungen geschenkt, dessen Hand ich erfolgreich behandeln konnte«, erklärt sie zu der Herkunft der Flasche und schenkt allen ein.
Trotz des Weines kommt keine rechte Fröhlichkeit auf. Flore berichtet mit sparsamen Worten von ihrer Feier und den wenigen Besuchern.
»Das Erdbeben hat die Menschen und unser Leben verändert«, stellt sie abschließend betrübt fest.
Laura beendet das betretene Schweigen, das nach Flores Bericht die Stimmung drückte.
»Ciel, dass du eine Mambo bist. - Wie kam es eigentlich dazu?«
Ciel lehnt sich nachdenklich lächelnd, mit dem Glas in der Hand, in ihrem Sessel zurück.
»In meiner Anfangszeit hier, in Port-au-Prince, hatte ich Kontakt zu einer sehr alten Mambo, die in der Nachbarschaft lebte. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden und zusammen einiges auf die Beine gestellt. Ich habe unglaublich viel von ihr über Haiti und seine Bewohner gelernt. Eines Tages, es war im darauffolgenden Herbst, besuchte sie mich hier in diesem Haus. Es war nicht ungewöhnlich, aber ich spürte, dass es einen besonderen Anlass gab, und so war es! Sie fragte mich, ob ich nicht eine Mambo werden wollte.«
Ciel nimmt einen Schluck aus ihrem Glas.
»Daran habe ich nicht einmal im Traum gedacht. Warum ausgerechnet ich, ich bin eine Weiße, habe ich sie gefragt. Ihre schlichte Antwort war: »weil ich gehen werde.« Tagelang konnte ich an nichts Anderes mehr denken. Dann sagte ich trotz aller Zweifel zu und ein viertel Jahr später wurde ich von ihr initiiert und erhielt meinen haitischen Namen: Ciel.«
»Was ist aus ihr geworden?«, fragt Alexander.
»Kannst du dir das nicht denken?«, zischt Laura.
Ciel macht eine besänftigende Handbewegung.
»Sie ist eine Woche später gestorben.«
Alexander atmet tief durch und sieht Ciel betroffen an.
»Entschuldigung. Das ist ja unheimlich.«
Ciel schüttelt lächelnd den Kopf.
»Nicht wirklich. Sie war eine sehr gute Mambo und ahnte, wie es um sie bestellt war. Sie war eine gute Psychologin und wusste genau, wie sie mich kriegen konnte.«
Flore schmunzelnd: »Wi, Madame. Sie konnte sehr gut mit Menschen umgehen, besonders mit dir«, fügt sie mit belustigt blitzenden Augen hinzu.
Ciel lacht leise.
»Flore hat Recht. Sie hat mich aber nie ausgenutzt. Ohne ihre Unterstützung hätte ich Haiti nie verstanden und wäre vermutlich spätestens im zweiten Jahr frustriert gescheitert.«
»Wie oft hältst du solche - äh - Voodoo-Feiern?«, fragt Alexander nachdenklich.
»Zurzeit etwa alle zwei, naja, eher drei Monate. Vor dem Erdbeben war es häufiger. Außerdem kann man hier manche Krankheiten nur mit Voodoo heilen.«
Laura sieht Ciel mit großen Augen an.
»Ja? Welche denn?«, fragt sie gedehnt.
»Wenn ein Patient schon länger an einer Krankheit körperlich leidet, dann leidet natürlich auch seine Seele. Herkömmliche Medikamente können dann oft nur noch wenig ausrichten.«
Laura nickt nachdenklich zustimmend. »Ich habe eine Nachbarin, der würde Voodoo sicherlich auch helfen. Aber wenn ich ihr damit käme, würde sie wahrscheinlich die Polizei rufen.«
Alexander wiegt kritisch seinen Kopf.
»So richtig überzeugt bin ich von dem Zauber nicht«, muffelt er.
Ciel schaut ihn verzeihend lächelnd an.
»Voodoo ist nicht das, was im Kino gezeigt wird oder naiven Touristen für viele Dollars vorgeführt wird. Außerdem gehören immer zwei dazu.«
Alexander zieht etwas arrogant die Augenbrauen hoch.
»Vielleicht habe ich ja in Zukunft doch einmal die Gelegenheit, es aus der Nähe mitzuerleben und mich überzeugen zu lassen.«
Laura ärgert sich über Alexanders unhöfliche Bemerkung.
»Mein Gott! Du glaubst doch nur das, was du anschließend auf einem deiner Fotos meinst, erkennen zu können.«
»So einfach mach’ ich mir das nicht« verteidigt er sich schwach, obwohl er ihr insgeheim Recht gibt.
»Pa fe sa (hört damit auf)!«, Flore macht ein bekümmertes Gesicht. »Der Abend ist doch viel zu schön, um sich zu streiten.«
***
»Du bist hundertprozentig davon überzeugt, dass es Sinn macht, deine Rezeptur ein drittes Mal zu überprüfen?«
Jens sieht Tom nervös an, in dessen Pupillen sich die gläsernen Apparaturen des Labors widerspiegeln. »Wir müssen uns absolut sicher sein, sonst können wir einpacken.«
»Jens, Cardea - Salicin - Natur - ist - sauber«, erwidert Tom genervt. »Glaub mir, eine weitere Überprüfung macht keinen Sinn.«
»Mach doch, was du willst!«, schnauzt Jens und lässt Tom einfach stehen.
»Gibt es Probleme?«, fragt beunruhigt der Chef, der zur Tür hinein kommt und die aufgeregten Stimmen gehört hatte.
Tom winkt generös ab.
»Jens ist reichlich nervös.«
Der Chef macht ein besorgtes Gesicht. »Hat er was über die Zulassung gesagt?«
»Nein, darum ging es nicht, er wollte Cardea Salicin Natur ein drittes Mal testen.«
»Gibt es denn neue Erkenntnisse oder hat er Bedenken?«, fragt der Chef mit gekrauster Stirn.
Tom zieht hilflos die Schultern hoch. »Mir ist nichts bekannt.«
Der Chef klopft ihm tröstend auf die Schulter.
»Wir sind zurzeit alle etwas angespannt. Wenn wir die Zulassung haben, gebe ich einen aus.«
Jens starrt auf den bedrohlich hoch geworden Stapel unerledigter Post auf seinem Schreibtisch. Über zwei Wochen ist es her, dass er sich mit Michael getroffen hatte, und seit zwei Wochen wartet er auf den erlösenden Anruf oder eine Nachricht. Mittlerweile wäre es ihm sogar egal, wenn das Medikament nicht zugelassen würde, denn diese Ungewissheit kann er noch schlechter ertragen.
Sein Chef poltert, ohne anzuklopfen, in sein Büro.
»Hallo Jens! Was gibt es Neues?«
Jens lehnt sich im Sessel zurück und sieht ihn vorwurfsvoll an.
»Mein Gott - du wärst doch der Erste, den ich informieren würde.«
»Ich habe gehört, du willst das Mittel nochmal checken lassen?«, fragt der Chef mit kritischem Unterton.
»Ich möchte einfach absolut sicher sein, dass es in Ordnung ist.«
»Absolut? Du wärst in unserer Branche der Erste, dem es gelänge«, lacht der Chef aufgesetzt.
Jens winkt ärgerlich ab.
»Ha, ha, ich krümme mich vor Lachen. Du weißt doch, wie ich es meine.«
»Warum meldet sich dein Freund und Agent denn nicht?«, bohrt der Chef weiter.
»Wenn ich das wüsste, könnte ich ruhiger schlafen«, erklärt Jens. »Er versprach mir, sich um die gemeldeten Unverträglichkeiten zu kümmern und verbat sich ausdrücklich telefonische Nachfragen.«
»Alles klar«, winkt der Chef entmutigt ab und wendet sich zum Gehen, »dann üben wir uns weiterhin in Geduld.«
***
Laura wollte gerade ein apathisch wirkendes Kind aus den Armen einer Mutter heben, als Ciel sie beiseite stößt und es selber hochnimmt. Irritiert und gekränkt geht Laura zur Seite und beobachtet mit gekrauster Stirn das weitere Vorgehen Ciels, die mittlerweile das schmuddelige T-Shirt des Kindes hochgeschoben hat.
»Siehst du die roten Kränze auf der Haut? Ich fürchte, es hat Typhus«, erklärt sie mit einem Seitenblick zur Laura, »und du bist nicht gegen diese Keime geimpft.«
»Ach so«, seufzt Laura erleichtert.
Nach einer gründlichen Untersuchung bestätigt sich Ciels Verdacht. Eindringlich erklärt sie der Mutter die Einnahme antibiotischer Tabletten und gibt ihr Pflegetipps.
Laura ist sich nicht sicher, ob die junge Frau nicht nur aus Höflichkeit vorgibt, sich alles merken zu können. Nachdem das Kind die erste Ration Tabletten geschluckt hat und zusammen mit der Mutter gegangen ist, zieht sich Ciel die Latexhandschuhe aus und nimmt aufatmend den Mundschutz ab.
»Dieses Kind ist zwar das erste und bisher einzige, aber wir werden uns wieder einmal auf eine Epidemie einstellen müssen.«
»Das weißt du jetzt schon? Ist Typhus so ansteckend?«, fragt Laura unsicher und erinnert sich besorgt an Ciels etwas rüde Reaktion.
»Eigentlich nicht, dennoch muss man vorsichtig sein. Aber hier in den Slums gibt es kaum vernünftige Latrinen, zu wenig Wasser und für eine einfache Hygiene fehlt es an Verständnis und Geld.«
»Was hat denn Geld damit zu tun?«, wundert sich Laura.
»Auf Haiti sehr viel. Die Erde der winzigen Gärten in der Stadt ist völlig ausgelaugt und Kunstdünger ist viel zu teuer. Die Leute bringen stattdessen Fäkalien aus, um überhaupt noch etwas ernten zu können und weil Wasser und Brennstoff knapp sind, werden die Feldfrüchte oft nicht gekocht, sondern ungewaschen roh verzehrt.«
»Und der Kreislauf ist geschlossen«, stellt Laura betrübt fest.
Ciel wirft ihr einen traurigen Blick zu und begrüßt die nächsten Patientinnen, die mit ernsten Mienen ihre Kinder in den Armen tragen. Auch die Diagnosen sind eindeutig.
Als hätten sie es heraufbeschworen, wurden ihnen noch zwei Typhuspatienten gebracht.
Ciel macht ein besorgtes Gesicht.
»Mit Heilkräutern ist hier nichts zu machen. Wir werden uns mit reichlich Antibiotika eindecken müssen. Außerdem werde ich sofort die anderen Hilfsorganisationen informieren. - Kaholo, wir bauen ab!«, ruft sie nach vorne.
Als sich ihr Geländewagen durch abgrundtiefen Schlamm zur Hauptstraße wühlt, fragt Kaholo ernst: »Souple Ciel, fahren wir zum Apotheker oder erst nach Hause?«
Ciel stöhnt ungewollt bei den harten Stößen, die trotz der starken Federung des Geländewagens durchkommen.
»Zum Gérard bitte.«
Alexander dreht sich zu den beiden Frauen nach hinten.
»Hoffentlich wird er wirksame Mittel liefern«, gibt er schnodderig zu bedenken.
Ciel beugt sich vor und sieht ihm direkt in die Augen.
»Ich vertraue ihm!«
Alexander sieht beschämt zur Seite und schweigt.
Laura sieht sie von der Seite verständnisvoll an.
»Wie lange arbeitet ihr denn schon zusammen?«
»Von Anfang an«, erklärt Ciel und wird von Kaholos Schimpfkanonaden abgelenkt, der das Seitenfenster hinunter gekurbelt hat und auf Kreolisch vermutlich mit dem Schlimmsten droht. Trotzdem wird die Einfahrt von den Händlern, die das kaum beeindruckt, wieder mal nur zögerlich geräumt.
»Was hat er denen gesagt?«, fragt Laura schmunzelnd.
»Das möchte ich lieber nicht übersetzen«, lacht Ciel, »sonst kriegt ihr noch einen schlechten Eindruck von mir.«
Nach weiteren verbalen Attacken kann Kaholo den Geländewagen endlich auf dem Parkplatz im Hof abstellen.
Erleichtert steigen alle aus und recken sich nach der holprigen Fahrt die Glieder.
Ciel sieht mit gerunzelter Stirn zu der geschlossenen, massiven Eingangstür und den Rollladen hinüber.
»Ob Gérard Latortue überhaupt da ist?«
»Kisa? (Was?)«, Kaholo macht ein besorgtes Gesicht. »Sein Auto ist da, ich sehe mal nach« und geht quer über den Hof zur Apotheke.
Alexander sieht ihm einen Augenblick unschlüssig hinterher und folgt ihm.
»Warte, ich komme mit!«
Sie treffen gleichzeitig an der Tür ein. Nach einem kurzen, schweigenden Blickkontakt mit Kaholo drückt Alexander die Klinke herunter. Die Tür ist nicht verschlossen! Gemeinsam starren sie in das Innere. Es dauert ein paar Sekunden, bis sich ihre Augen an das Dunkel gewöhnt haben.
Kaholo zuckt mit den Schultern und ruft verhalten »Hallo?« hinein.
Ein schleifendes Rascheln verrät, dass sich irgendetwas in der Apotheke aufhält.
Unbewusst halten beide den Atem an und schauen sich ernst an. Kaholo signalisiert Alexander, dass er etwas sagen will.
Er legt eine Hand an den Mundwinkel. »Mwen rele (ich bin) Kaholo, ist alles in Ordnung?«
Nach mehreren Sekunden Stille dringt ein kaum wahrnehmbares Stöhnen aus dem Inneren.
Entsetzt starrt Kaholo in das Dunkel und bleibt wie versteinert stehen, worauf Alexander vorsichtig, Schritt für Schritt, in die stockdunkle Apotheke hineingeht.
Das durch die geöffnete Tür einfallende Licht erhellt nur den ersten Meter des Korridors. Er verzichtet darauf Licht einzuschalten oder die Rollladen hochzuziehen, denn ihm ist klar, dass er vor der geöffneten Eingangstür ohnehin eine gute Zielscheibe bietet.
Unbewusst hält Alexander den Atem an, als er den dunklen Verkaufsraum erreicht, bleibt stehen und wartet, dass sich seine Augen auch an diese Dunkelheit gewöhnen. Es hilft nicht.
Der Rollladen ist, obwohl es Tag ist, vollständig herabgelassen worden. Das durch die wenigen Ritzen dringende Licht der abendlichen Sonne erreicht nicht einmal den Fußboden.
Vorsichtig tastet Alexander auf der Wand nach dem Lichtschalter und findet ihn. Die klebrige Oberfläche ekelt ihm und er muss sich überwinden, ihn zu betätigen. Mit einem lauten Klicken bestätigt der Schalter seine Funktion, aber es bleibt Dunkel. Dafür streift ein warmer Lufthauch Alexanders Gesicht.
Alexander versteift sich und starrt in die Dunkelheit, um irgendetwas zu erkennen. Als ihn der Lufthauch ein zweites Mal trifft, erinnert er sich an den großen Ventilator an der Decke.
Erleichtert schiebt er sich weiter in den Laden hinein.
»Zwischen der Tür und dem Fenster dürfte eigentlich nichts stehen«, versucht er sich zu orientieren.
Vorsichtig tastend schiebt er sich Fuß für Fuß zum Fenster vor, um Tageslicht hineinzulassen. Erst jetzt bemerkt er, dass die dicken Mauern des alten Gebäudes nahezu alle Geräusche schlucken, und seine Sinne sind bis zum Reißen gespannt. Nach etwa einem Meter stößt sein Fuß an etwas weiches, nachgiebiges.
Alexander unterdrückt die aufkommende Panik und wartet ein paar Sekunden, ohne sich zu bewegen, ab. Er spürt, wie sich sein Kreislauf beschleunigt und sein Blut in den Ohren zu rauschen beginnt. Da nichts weiter geschieht, bückt er sich vorsichtig, bis seine Fingerspitzen das weiche Etwas am Boden berühren.
»Kleidung, kein Fell«, stellt er erleichtert fest und seine Finger folgen tastend den Konturen. Ist es ein warmer menschlicher Körper, der eigenartig verkrümmt am Boden liegt und atmet.
»Kaholo, schnell, hole bitte Ciel, ich habe hier jemanden gefunden!«
Mit zwei Schritten ist er am Fenster, und noch während er den Rollladen hochzieht, sieht er nach der Person, die auf dem staubigen Boden liegt. Es ist Gérard Latortue, der sich mit beiden Händen den Bauch hält. Alexander beugt sich zu dem Mann herunter und untersucht ihn flüchtig, der jedoch mit apathisch halb geschlossenen Augen kaum noch etwas wahrzunehmen scheint.
»Er scheint äußerlich nicht verletzt zu sein, zumindest kann ich nirgendwo Blut entdecken«, stellt Alexander erleichtert fest und sieht sich um. In einer Ecke des Regals findet er eine dünne Decke, die schon lange keine Waschmaschine mehr gesehen hat. Während er sie vorsichtig dem Apotheker als Kopfkissen unterschiebt, hört er Ciels eilige Schritte auf dem Steinboden.
»Kisa ki rive ou? (Was ist passiert) mein Freund?«, ruft sie, während sie den Raum betritt.
»Mwen mouri (ich sterbe), mein Bauch tut so weh«, haucht Gérard Latortue kaum hörbar.
Ohne seine Lage zu verändern, tastet sie ihn vorsichtig ab, bis sie unter dem Rippenbogen angekommen eine heftige Reaktion bei ihm auslöst. Vorwurfsvoll stöhnend sieht der Kranke mit flatternden Lidern zu ihr auf.
»Mwen regret sa (es tut mir leid)«, entschuldigt sich Ciel und macht eine besänftigende Handbewegung. »Du hast eine Gallenkolik. Wie lange geht das schon so?«
»Maten an (seit heute Morgen). Kannst du mir helfen?«
»Wi, mein Freund. - Ich gebe dir als Erstes ein krampflösendes Mittel. Zum Hinunterschlucken musst du aber aufstehen.«
Eine halbe Stunde später sitzt Gérard Latortue, schweißgebadet und blass, auf einem der beiden wackligen Stühle. Vorsichtig fühlt er seinen Bauch ab und ist anscheinend mit dem Ergebnis zufrieden.
»Mesi, Ciel. Dich hat ein Engel geschickt.«
Lächelnd winkt sie ab. »Das Schlimmste hattest du ja bereits überstanden. Es konnte nur noch besser werden.«
»Wirklich?«, fragt er ungläubig und sieht sich um. »Warum seid ihr eigentlich alle gekommen?« und klopft sich beschämt den Staub von der Kleidung.
»Eine Typhusepidemie bahnt sich an«, erklärt Ciel. »Kannst du uns denn noch, ohne Probleme zu bekommen, echte Medikamente beschaffen?«
»Das hat mir etliche schlaflose Nächte bereitet«, schnauft Gérard Latortue angestrengt und legt zur Bekräftigung seine Hand auf die schmerzende Stelle, » - aber ich habe eine Lösung gefunden.«
Er sieht triumphierend in die Runde.
»Nun, welche denn?«, fragt Ciel gespielt ungeduldig, die das rhetorische Manöver durchschaut hat.
»Ich habe mithilfe eines Freundes eine Importgesellschaft gegründet. Zwischen Maissäcken und Puddingpulverkartons werden die Medikamente kaum auffallen. Außerdem liegt der Kontor in dem von den Yankees (Amerikanern) kontrollierten Hafenbereich.«
Ciel ist erleichtert. »Das hört sich gut an.«
Während Ciel, Kaholo und Gérard Latortue den Bedarf und die Abwicklung besprechen, gehen Laura und Alexander zu den Händlern in der Toreinfahrt hinaus.
»Ein haitischer Trödelmarkt«, stellt Laura erfreut fest und bemüht sich dennoch ein möglichst uninteressiertes Gesicht zu machen, um nicht Hoffnungen bei den Anbietern zu wecken. Sie erinnert sich noch sehr gut an die Traube von Menschen, die sie vor einigen Tagen mit hölzernen Kämmen verfolgte, nur weil sie nach dem Preis für ein hübsch geschnitztes Exemplar gefragt hatte.
Eine halbe Stunde später sind sie wieder auf dem Heimweg.
Ciel kaut nervös an ihrer Unterlippe.
»Geht es dir gut?«, fragt Laura, die es beobachtet hatte.
Ciel wiegt ihren Kopf.
»Die Typhusfälle machen mir Sorgen und außerdem bin ich mir sicher, dass unser hypochondrischer Apotheker andere massive Schwierigkeiten hat.«
***
Alexanders Unzufriedenheit ist nicht zu überhören.
»Es kann doch nicht sein, dass wir uns verbiegen müssen«, schnauzt er ungehalten, »um Medikamente bekommen zu können!«
»Wir sind auf Haiti«, erinnert ihn Ciel genervt.
»Trotzdem muss man solchen Verbrechern das Handwerk legen. Jetzt sind es nur ein paar Tabletten, später kontrollieren sie den gesamten Markt.«
»Na und?«, lacht Laura spöttisch, »dann hätten wir hier endlich auch deutsche Verhältnisse« und wirft mit ironischem Schwung ihre schwarze Mähne zurück.
Alexander wirft ihr einen vernichtenden Blick zu. »Wie lustig. Ich werde eine Reportage über diese beschissene Situation starten. Vielleicht bewegt sich dann was.«
»Du bist wohl auf eine Tracht Prügel mit anschließenden fünf Wochen Reha aus?«, spottet Laura.
»Quatsch!«, schnauzt Alexander, »man muss das natürlich einigermaßen intelligent anpacken.«
»Ach so, intelligent«, ätzt Laura, »und wie willst ausgerechnet - Du - das denn machen?«
»Mich wundert nicht, dass - Du - danach fragst«, kontert Alexander giftig.
Ciel, die den Disput mit kritischer Miene verfolgt hat, haut mit der Hand mit auf den Tisch.
»Jetzt ist aber gut! So seid ihr mir keine Hilfe. Ganz im Gegenteil. Wenn ich euch so höre, mache ich mir ernsthafte Sorgen.«
Alexander merkt, wie ihm die Röte ins Gesicht steigt. Mit einem vorwurfsvollen Blick zu Laura atmet er tief durch, ehe er antwortet.
»Entschuldige bitte, Ciel! Auf keinen Fall darf deine Arbeit auf irgendeine Art und Weise durch unsere gestört werden. Vermutlich ist es das, was Laura befürchtet.«
Lauras Augen blitzen angriffslustig.
»Befürchten ... befürchten. Ich bin einfach realistisch. Haiti ist ein rechtsfreier Raum. Es gibt keine funktionierende Regierung, keine Polizei, nichts. Und dann kommst du und glaubst mit ein paar Textzeilen den Verbrechern das Handwerk legen zu können.«
»Zumindest kann man es ja mal versuchen«, antwortet er betont leise. »Seht bitte mal her.«
Er fischt eine kleine Medikamentenschachtel aus seiner Tasche und überreicht sie Ciel.
»Das ist eins von den gefälschten Präparaten. Ich habe Gérard Latortue um ein Muster gebeten.«
Ciel dreht die Schachtel in ihren Fingern und betrachtet sie von allen Seiten und schaut auch mal rein.
»Die sieht richtig echt aus«, meint Ciel und reicht sie Laura weiter.
»Auf den ersten Blick ja«, erklärt Alexander. »Einem direkten Vergleich mit dem Original hält sie aber nicht Stand. Vermutlich ist das auch nicht notwendig.«
Laura gibt sie ihm mit einer gelangweilten Miene zurück. »Soso, - hilft uns das weiter?«
»Möglicherweise ja«, antwortet Alexander lächelnd. »Mir ist aufgefallen, dass es hier kaum Plakate oder sonstige aktuelle, großformatige Werbung gibt. Das Größte, was hier ich bisher gesehen habe, war ein DIN-A3 Blatt, das vermutlich auf einem Computer ausgedruckt worden ist.«
»Die Plakatwände sind seit dem Erdbeben nicht mehr neu beklebt worden«, stimmt ihm Ciel zu, »allerdings vermisse ich sie auch nicht.«
»Das lässt darauf schließen«, fährt Alexander fort, »dass es zurzeit keine Druckereien oder funktionierenden Druckmaschinen auf Haiti gibt.« Er hält die Schachtel hoch. »Diese so genannten Medikamente werden also nicht auf Haiti hergestellt.«
»Toll!«, lobt ihn Laura überschwänglich. »War das nicht schon vorher klar? - Und wo kommen sie deiner Meinung nach her?«
»Aus der Dominikanischen Republik.«
»Woher willst du das so genau wissen?«, fragt Laura verblüfft.
»Diese Pillenmafia rechnet selbstverständlich damit, dass die Leute ziemlich schnell auf andere, vor allen Dingen auf wirksame Mittel, ausweichen werden. Sie muss daher, ohne viel Zeit zu verlieren, auf die geänderte Nachfrage reagieren können. Das geht nur, wenn die Fertigung in der Nähe ist und vollständig von ihnen kontrolliert werden kann. Ein indisches Garagenlabor scheidet daher aus.«
»Diese Art Medikamentenhandel hat auf Haiti eine lange Tradition«, berichtet Ciel zustimmend. »Allerdings wurden vor dem Erdbeben nur teure Mittel angeboten, die größtenteils aus Kolumbien kamen. Meistens ging es dabei um Viagra und Cholesterinsenker. Einige pfiffige Bootseigner organisierten regelrechte Einkaufstouren, so wie bei uns früher die Butterfahrten.«
Laura macht ein nachdenkliches Gesicht.
»Und weil dieser Markt weggebrochen ist, gehen diese miesen Typen jetzt an ihre eigenen Landsleute ran.«
Ciel hat es schon seit längeren bemerkt, aber bisher verdrängt. Die Tatsache, dass jemand die Not auf diese Art und Weise ausnutzt, um sich an den Ärmsten der Armen zu bereichern, passt nicht in ihr Bild von Haiti. Nachdenklich sieht sie Alexander an und fragt wenig hoffnungsvoll mit rauer Stimme: »Was hast du vor, dagegen zu tun?«
»Eine Reportage natürlich, um Druck bei den Pharmakonzernen aufzubauen«, antwortet er schlicht.
***
Das Dröhnen eines riesigen Rasenmähers empfängt Jens, als er die Fahrertür öffnet und aussteigt.
»Das wurde ja auch mal Zeit«, sinniert er und schreitet die weit geschwungene Treppe zur verglasten Eingangshalle hoch. Wie immer geht er durch das Labor in sein Büro, obwohl er einen direkten Zugang vom Flur aus hätte.
»Moin, Moin!«
»Guten Morgen Jens!«, kommt es dumpf zurück. Tom schiebt sich mit seinem Laborstuhl von den zahllosen gläsernen Petrischälchen weg und nimmt seinen Mundschutz ab. Er zeigt lächelnd zum Labortisch.
»Erinnerst du dich noch an das Artemisinin?«
»Das Malariamittel aus Beifußextrakten? Ja natürlich«, wundert sich Jens. »Wir haben es vor Jahren doch eine Zeit lang hergestellt, bis die ersten Resistenzen auftauchten.«
»Genau«, stimmt ihm Tom zu. »Ich habe mich«, fährt er fort, »in den letzten Tagen wieder mal mit dem traditionellen chinesischen Medikament gegen Malaria beschäftigt.«
»Über dieses braune staubige Zeug gibt es weder gültige Rezepte noch eine ernsthafte Dokumentation«, winkt Jens ab, obwohl er an den Vorschlag des Chefs denken muss.
»Meine Mäuse fressen alles«, Tom lacht verhalten, » - sogar dieses braune, staubige Zeug.«
»Und?«
»Und?« Tom sieht Jens hintergründig an. »Fast alle wurden ihre resistente Malaria wieder los.«
»Im Ernst?«, fragt Jens fassungslos.
»Die Anderen, die nur Artemisinin bekamen, nicht.«
Jens angelte sich einen Stuhl und setzte sich. Wenn sich dieser Test bestätigt, dann … Er wagt es nicht, weiter zu denken.
»Sag mal, wie kamst du denn darauf, das TCM-Zeug zu testen?«
»Auslöser war im Grunde das Wirkprinzip von deinem Cardea Salicin Natur. Die ersten Versuche hatte ich aber schon in der Zeit gemacht, als wir noch Artemisinin herstellten. Daher bin ich mittlerweile so weit, dass ich nur noch sechsundneunzig Adjuvantien selektieren muss.«
»Hast du schon eine Idee, wie das TCM-Zeug wirkt?«
Tom nickt zustimmend. Jens drängt sich dabei das Bild eines Geiers auf.
»Der Proteinaufbau der Malariaerreger wird gestört, sie mutieren regelrecht und werden dadurch vom Immunsystem angreifbar. Aber es geschieht nur dann, wenn das Artemisinin und die chinesischen Adjuvantien gleichzeitig vorhanden sind.«
»Wenn dir das gelingt, - dann -, dann sind wir aus dem Schneider«, stottert Jens und klopft Tom anerkennend auf die Schulter. »Weiß der Chef schon davon?«
»Nö, der hat mich nur gefragt, was ich mit dem TCM-Zeug wollte. Bitte sag du ihm auch nichts. Ich möchte erst die Untersuchung abschließen und belastbare Fakten haben.«
»Logo, kein Problem«, nickt Jens wie abwesend, weil er seine Gedanken sortieren muss und wird ernst. »Schlag mich nicht tot. Wie lange wirst du noch brauchen?«
Tom zählt durch.
»Mit dem Auswahlverfahren habe ich noch circa fünfundzwanzig Durchgänge. - Na ja, die Proben brauchen etwa zwei Tage, um eine eindeutige Reaktion anzuzeigen. Die Mäuse anschließend mindestens zwei Wochen. Also noch einen guten Monat.«
»Ich fürchte, du bist eher fertig, bevor ich die Zulassung oder Absage für das Cardea Salicin Natur habe«, stellt Jens nachdenklich fest und sieht Tom fragend an. »Würde dir ein Assistent helfen?«
»Nö. Die meiste Zeit gucke ich ja nur zu, ob die Malariaplasmodien in den Schälchen sich mit ihren neuen Nachbarn vertragen oder nicht.«
Jens geht in sein Büro und sieht sich um. Sein Büroausstattung hat sich in den letzten fünfzehn Jahren kaum verändert und macht einen leicht verwohnten Eindruck. Der neue Computer mitsamt Zubehör und das neue Telefon heben sich mit ihrem schicken Design markant von der altmodischen Palisandereinrichtung ab.
Wenn er darauf angesprochen wurde, überspielte er diesen Zustand.
»So sieht man wenigstens sofort, dass das wirklich Notwendige auf dem neuesten Stand ist.«
Übertrieben seufzend setzt er sich und startet als erstes den Computer. Dabei fällt sein Blick auf den Stapel unerledigter Post, der immer noch beeindruckend hoch ist und beschließt innerlich seufzend ihn heute und sofort anzugehen.
Kurz vor der Mittagspause, sein Magen hat ihm schon länger signalisiert, dass es wieder einmal so weit ist, tobt sein Handy auf dem Schreibtisch los. Jens schielt auf das Display und ist wie elektrisiert.
»Michael« blinkt die Anzeige.
Obwohl er sehnsüchtig auf diesen Anruf wartete, muss er sich überwinden, das Gespräch anzunehmen.
»Hallo Michael!« Er bemüht sich, seine Aufgeregtheit zu verbergen und seiner Stimme einen erfreuten Klang zu geben.
»Hallo Jens, können wir uns heute um drei in der Krypta der Sankt Gereonskirche treffen?«
Jens verdreht die Augen, ehe er antwortet. »In der Krypta? - Ja gerne«, schwindelt er.
»OK. Bis nachher.«
Michael legt abrupt auf.
Automatisch sieht Jens auf die Uhr. Erst zwölf.
Ein massives Hungergefühl überfällt ihn, wie immer, wenn er aufgeregt ist. Nervös fährt er den Computer runter und geht ins Labor.
»Brauchst du nie etwas zu essen?«, fragt er Tom, in der Hoffnung, dass er nicht alleine in die Kantine gehen muss.
»Ich hab schon zwischendurch was gehabt. Ich bin ja immer früh hier«, entschuldigt der sich verblüfft.
»Ach komm. Dann machst du eben zweimal Pause.«
Tom wirft einen Blick auf seinen Schreibtisch, ehe er sich zu einem »Meinetwegen« entschließt.
Trotzdem der Pächter sich der neuen Personalsituation angepasst und die Tische geschickt verteilt hat, wirkt die Kantine völlig überdimensioniert. An der Essensausgabe brauchen sie nicht zu warten und suchen sich einen Platz, der mit langweiligen, immergrünen Kübelpflanzen vom Gastraum zumindest optisch separiert ist.
»Ich hatte eben einen Anruf unserer Zulassungsagentur«, begann Jens das Gespräch.
»Ah. Gibt es was Neues?«
»Mal sehen, ich treffe ihn erst heute um drei.«
»Nervös?«, frotzelt Tom grinsend.
Jens sieht ihn verschmitzt lächelnd an. »Ach wo - überhaupt nicht.«
Jens war schon lange nicht mehr an der Gereonskirche gewesen. Bewundernd gleitet sein Blick über die romanische Fassade und bleibt an dem alles überragenden Dekagon hängen. »War dieses Gebäude nicht für Jahrhunderte der größte Kuppelbau nördlich der Alpen?«, erinnert er sich.
Suchend umrundet er den mächtigen Bau und findet den unscheinbaren Abgang, der zu dem, von einem Rundbogen überwölbten Eingang führt. Die Tür zur Krypta steht offen. Zögernd steigt Jens die wenigen Stufen hinunter, um dann in einem gedrungenen, von doppelten Arkaden gestützten, Raum zu stehen, der die Würde von elf Jahrhunderten ausstrahlt.
Ein unbestimmbares Gefühl von Ehrfurcht nimmt von ihm Besitz, das durch die mystisch beleuchteten Sarkophage hinter einem schmiedeeisernen Gitter vertieft wird.
Unsicher sieht er sich um. Er scheint der einzige Besucher zu sein.
Um die Wartezeit zu überbrücken, geht er gemessenen Schrittes zum steinernen Hochaltar, der das Gewölbe am anderen Ende abschließt und bleibt betrachtend davor stehen.
Das sandige Knirschen von Schritten durchdringt die Stille, um wieder zu verstummen. Jens wendet sich um, kann aber niemanden sehen, denn die Säulen lassen keinen ungehinderten Blick zu. Neugierig, aber mir einer gewissen Zurückhaltung, geht Jens zurück.
Die eisernen Tore zu der Grabkammer sind jetzt weit geöffnet, und zwischen den steinernen Sarkophagen bewegt sich wie suchend eine Gestalt.
Als er sich ihr nähert, erkennt er Michael, der sich aufrichtet und ihm entgegensieht.
»Spürst du auch die jahrtausendalte Mystik dieses Raumes?«, begrüßt ihn Michael und steigt bedächtig die paar Stufen aus der Grabkammer zu ihm herauf. »Leider sind die Inschriften nicht mehr zu entziffern.«
»Diese Krypta hat was«, antwortet Jens diplomatisch.
»Ich liebe Orte, die mit Sicherheit schon vor dem Christentum heilig waren.«
»Eine germanische Runenstele mit Rinderschädel würde hier aber sehr fremd wirken«, spottet Jens. »Können wir uns denn nicht ganz normal treffen?«, fragt er vorsichtig, weil er Michaels Vorliebe nur mühsam nachvollziehen kann.
»Hast du einen besseren Vorschlag? Etwa bei dir im Büro oder ziehst du eine Kneipe vor?«, Michael schüttelt den Kopf. »Hier sind wir unter uns.«
»Übrigens«, er zeigt auf den mittleren Sarkophag, »der heilige Sankt Gereon hilft dir bei Kopfschmerzen und ist Schutzpatron der Soldaten.«
Jens verzichtet auf eine Entgegnung, um einer Diskussion zu entgehen, die er vermutlich nicht bestehen würde.
»Du hast ja Recht. Vielleich bin ich nur etwas nervös.«
Michael lacht leise.
»Tut mir leid. Glaub mir, ich war es bis heute Vormittag auch und ich habe dich, als die Nachricht kam, natürlich sofort angerufen.«
»Nun spann mich nicht so auf die Folter!«, schnauft Jens angespannt. »Was ist rausgekommen?«
»Es war ein Dosierungsfehler der Klinik. Dein Cardea Salicin Natur ist, richtig dosiert, in Ordnung.«
»Gott sei Dank!«
Sie setzten sich in eine der Kirchenbänke und Michael erzählt ihm leise von seiner Recherche.
»Dass du das auf dich genommen hast!«, lobt ihn Jens beeindruckt.
Michael zuckt mit den Schultern. »Mir wurde klar, dass der Fehler nicht an dem Medikament liegen konnte. - Jetzt warten wir nur noch auf den klinischen Test. Nach der Bearbeitung steht dann einer Zulassung nichts mehr im Wege.«
Bei dem Verlassen der Krypta kommen sie an den Opferkerzen vorbei. Michael macht halt und zeigt lächelnd auf den rußgeschwärzten Ständer.
»An deiner Stelle würde ich mal einige aufstellen.«
Jens sieht Michael verblüfft an. »Warum?«
»Sankt Gereon hilft gegen Kopfschmerzen und die werdet ihr bekommen. - Ihr werdet nämlich mit heftigen Widerständen der etablierten Multis rechnen müssen.«
»Aha? Wieso?«
»Dein Cardea Salicin Natur verringert drastisch den Bedarf von Aspirin und seinen Derivaten. Die zu erwartenden Umsatzverluste werden eure Mitbewerber nicht so einfach hinnehmen.«
***
»Ciel, tout bagay anfom (ist alles in Ordnung)?«
»Mesi Flore!«, entschuldigt sich Ciel, als sie in Flores besorgtes Gesicht sieht. »Ich konnte nicht mehr schlafen.«
Flore stellt das Tablett mit dem Geschirr ab. »Auf Haiti sagt man: Als es dämmerte, sah ich durch die Augen von gestern«, mahnt sie fürsorglich, während sie den Terrassentisch deckt.
Ciel reckt ihre steif gewordenen Gelenke.
»Du hast Recht. Es waren Alexanders Reportagepläne und die zu erwartende Typhusepidemie, die mir die Nacht raubten und ich hoffte, leider vergeblich, an der frischen Luft mehr Ruhe zu finden.«
Wenig später haben sich alle am Frühstückstisch eingefunden.
Ciel sieht in die Runde. Bis auf Kaholo scheinen alle ausgeruht zu sein. Wie jeden Morgen protestiert er ungekämmt und schweigend mit langem Gähnen gegen den, seiner Meinung nach, unmenschlich frühen Arbeitsbeginn.
»Wir müssen heute als Erstes die Antibiotika gegen Typhus bestellen!«
»Beim Apotheker?«, fragt Alexander beiläufig, der sich intensiv mit einer Melonenscheibe beschäftigt.
»Wo denn sonst!«, zischt Ciel ärgerlich. In diesem Moment bereut sie es wieder einmal, ihn mitgenommen zu haben.
Kaholo schaut überrascht zwischen Ciel und Alexander hin und her und versucht vergeblich den Grund für ihre Verstimmung herauszufinden.
»Kile? (Wann?) Jetzt gleich?«
»Sagte ich doch!«, knurrt Ciel.
»Oke. Ich fahre gleich runter«, meint Kaholo mit beschwichtigendem Ton und sieht Alexander fragend an, der aber nach wie vor ungerührt die Melone bearbeitet.
Laura wechselt vorsorglich das Thema. »Wo fahren wir denn heute hin?«
Ciel atmet tief durch, ehe sie antwortet. »Wir bleiben in der Stadt. Ich fürchte nämlich, dass es in den anderen Bezirken auch losgeht.«
Wie immer vermeidet sie das hässliche Wort: Slum.
Laura sieht Ciel erschrocken an. »Oh Gott! Als hätte das Erdbeben nicht gereicht. Hoffentlich kann Gérard schnell genug liefern.«
»Diese Sorge hat mich kaum schlafen lassen.«
»Meine Nacht war auch etwas kurz.« Alexander lehnt sich in dem Stuhl zurück. »Ich habe heute Morgen eine E-Mail von unserer Redaktion bekommen. Sie würde eine redaktionelle Aktion gegen die Pillenmafia unterstützen.«
»Was ist eine redaktionelle Aktion?«, fragt Ciel mit einem scharfen Unterton und denkt dabei unwillkürlich an die übertriebenen Schlagzeilen der Boulevardpresse.
»Das ist eine ganz normale Reportage. Es geht darum, solche Vorgänge öffentlich zu machen und damit einen gewissen Druck auf die Hersteller und Politik auszuüben. Meinem Verlag geht es, logisch, auch ums Geld. Aber was wir hier unternehmen, worüber wir berichten, bestimmen selbstverständlich nur wir.«
»Soso, nur wir.« Ciel zieht spöttisch die Augenbrauen hoch.
»Und was ist, wenn es nicht zu einer Reportage kommt?«
»Das habe ich die Redaktion auch gefragt. Sie hält das Thema für äußerst brisant und wir sollen auf jeden Fall am Ball bleiben.«
Ciel sucht Alexanders´ Augen.
»Die Menschen hier in Port-au-Prince sind auf unsere Hilfe angewiesen und die darf auf keinen Fall gefährdet werden.«
Laura wirft mit einer kurzen Bewegung ärgerlich ihre schwarze Mähne zurück.
»Wenn ich nur daran denke, dass es hier Verbrecher gibt, die skrupellos die Ärmsten der Armen organisiert betrügen, sogar ihren Tod in Kauf nehmen und im Grunde Ciels jahrzehntelange Arbeit ad absurdum führen, - wird - mir - schlecht!«
Die kehlige Stimme Flores beendet das betroffene Schweigen nach Lauras Gefühlsausbruch. »Kisa pi nou fe? (Was können wir denn tun?)«
»Nichts anderes, als bisher und alles Weitere extrem vorsichtig«, antwortet Alexander ernst. »Ich glaube, wir haben nur eine, - eine einzige Chance.«
***
Alexander kaut nervös an seinem Kugelschreiber. Jetzt, während er sich intensiv auf die neue Reportage vorbereitet, wird ihm die gesamte Problematik bewusst. Bisher waren sie im Windschatten Ciels gesegelt. Bei dem neuen Projekt werden sie ganz auf sich allein gestellt sein.
Vor allem bereitet ihm die Einsicht Kopfschmerzen, dass ihnen eine unauffällige Arbeit wegen der unterschiedlichen Hautfarben, ein Aspekt, den er bisher völlig vernachlässigt hatte, kaum möglich sein wird. Abgesehen davon, dass er praktisch noch nichts in der Hand hat.
Das unbestimmte Gefühl, sich mit der Reportage übernommen zu haben, ergreift mehr und mehr von ihm Besitz.
Dass seine Fotoausrüstung der neuen Aufgabe angepasst werden muss, ist vergleichsweise nebensächlich.
Abrupt steht er auf und geht mit der Aufstellung zu Laura.
»Hast du einen Augenblick Zeit? Ich habe eine To-do Liste für die Reportage zusammengestellt. Werfe doch bitte mal einen Blick drauf.«
Laura verdreht die Augen, als sie Alexanders Handschrift sieht.
»Mein Gott, hast du eine Klaue.«
»Die Liste war ja eigentlich nur für mich gedacht, bis sie immer umfangreicher wurde«, entschuldigt er sich.
Laura liest sich die Liste leise murmelnd vor und stockt.
»Was bedeutet - Haut - farbe?«, buchstabiert sie mit kritischem Unterton.
»Das ist meines Erachtens unser Hauptproblem. Wir fallen doch jetzt schon auf, wenn wir nur unsere normalen Aufnahmen machen. - Ich habe noch keine Idee, wie wir als Weiße ungesehen observieren können.«
»Das fällt dir aber früh ein!«, tadelt Laura ungnädig.
Alexander zieht hilflos die Schultern hoch. »Ach, weißt du, bis jetzt waren mir die Menschen auf meinen Bildern wichtig. Da spielte die Hautfarbe allenfalls eine fototechnische Rolle.«
Laura sieht ihn überrascht an.
»Entschuldige bitte, jetzt wo du das sagst ... Ich hätte auch nicht daran gedacht.« Nachdenklich gibt sie ihm das Blatt wieder zurück. »Deine Aufstellung sieht sehr komplett aus.«
»Danke! Was meinst du, was sollten wir als erstes machen?«
»Das, was oben auf deiner Liste steht: Mit dem Apotheker reden«, antwortet Laura sachlich und sieht ihn verwundert an. »Was Anderes kommt ja wohl nicht infrage.«
Gérard Latortue fuchtelt aufgebracht mit den Händen, während er redet.
»Wollt ihr mich umbringen?«, er zeigt mit dem Finger auf Ciel, als wollte er sie aufspießen. »Ciel - nach all den Jahren, - ich habe dir vertraut. - Das, das, das war wohl ein Fehler«, fügt er stotternd vor Aufregung hinzu und lässt sich wie ein nasser Mehlsack auf einem der beiden wackligen Stühle in seiner Apotheke fallen.
»Hätte ich euch bloß nichts erzählt«, stöhnt er theatralisch im Selbstgespräch und blickt schwer atmend zum nahezu blinden Fenster hinaus.
Ciel sieht vorwurfsvoll zu Alexander und Laura rüber und macht eine »Ich habe es ja geahnt«-Miene, ehe sie sich Gérard Latortue zuwendet.
»Mon Ami (mein Freund). Ohne deine Zustimmung werden wir nichts unternehmen.«
Sie wartet einen Augenblick, bis sie sich der Wirkung ihrer Worte sicher ist, ehe sie fortfährt. »Aber glaubst du wirklich, dass es so weiter gehen kann? Jetzt sind es nur ein paar Tabletten, später kontrollieren sie dich und deine Apotheke.«
Gérard Latortue schüttelt seinen Kopf. »Ich habe eine Familie, eine sehr kranke Frau und die Eltern zu ernähren« und sieht sie traurig an. »Für Heldentum ist da kein Platz.«
»Dann willst du also in Zukunft an deine Landsleute wirkungslose Medikamente verkaufen«, stellt Ciel pragmatisch in den Raum.
Gérard Latortue scheint auf seinem Stuhl zu schrumpfen, richtet sich aber nach einer Weile wieder auf, um mit ernster Miene auf Alexander zuzugehen, der, unsicher geworden, bemüht ist, dem energischen Blick standzuhalten.
Gérard Latortue stemmt seine Arme in die Seiten und bleibt wenige Zentimeter vor Alexander stehen.
»Du bist in einem fremden Land und zudem ein Weißer. - Wie willst du diesen Leuten hier das Handwerk legen? Also …!«
Alexander weiß, dass eine unbedachte Antwort das Projekt gefährden könnte.
»Über die Vertriebswege könnte man an die Hintermänner gelangen ...«
Er wird vom Apotheker unterbrochen.
»Byentendu (natürlich)! Ein wenig observieren und dann ein Interview und schon hast du den Boss!«, verhöhnt er ihn aufgebracht mit übertriebenen Gesten.
Plötzlich reckt er sich und legt Alexander jovial die Hand auf dessen Schulter.
»Mein Junge«, seine Stimme hat einen väterlichen Klang angenommen, »es geht hier um viel Geld und du hast es mit Profis zu tun. Die werden sich das Geschäft nicht so einfach aus den Händen nehmen lassen.«
Alexander neigt sich ein wenig, um Gérard Latortue direkt in die Augen sehen zu können.
»Ich habe nichts davon gesagt, dass ich es mir einfach vorstelle. Auf der einen Seite darf die Arbeit von Ciel und Ihnen nicht gefährdet werden, anderseits habe ich den dringenden Wunsch zu überleben. Dennoch muss etwas dagegen unternommen werden.«
Gérard Latortue rückt ein wenig von Alexander ab.
»Was ist als Nächstes geplant?«
»Nichts weiter«, antwortet Alexander und ergreift die Initiative. »Wann erhalten Sie die nächste Lieferung?«
Gérard Latortue schaut ihn irritiert an.
»Du hast keinen Plan?«, kopfschüttelnd geht er zu seinem Stuhl zurück und stöhnt aufgesetzt, als er sich setzt. »Er hat noch nicht mal einen Plan!«
Alexander zwingt sich zur Ruhe und stellt sich mit verschränkten Armen vor ihn hin.
»So kommen wir nicht weiter. Bitte, wann kommt die nächste Lieferung?«
Gérard Latortue zögert, wirft einen kurzen Blick zu Ciel und sagt nervös mit den Augen zwinkernd: »Demen apremidi (morgen Nachmittag).«
»Wie findet die Übergabe statt?«
Gérard Latortue macht eine belanglose Geste.
»Es ist ganz normale Lieferung, wie immer hier auf meinem Hof. Was soll diese Fragerei?«
»Wie wird die Ware bezahlt?«, fragt Alexander ungerührt.
»Cash«, knurrt Gérard Latortue unwillig.
»Bei dem Fahrer?«
»Mein Gott, selbstverständlich nicht!«, empört sich Gérard Latortue. »Zum Kassieren kommt jemand mit einem Motorrad vorbei.«
Alexander bedankt sich und sagt zur Ciel, die das Gespräch nervös verfolgt hatte,»Das war alles.«
Sie klopft Gérard Latortue aufmunternd auf die Schulter, der mit unglücklichem Gesicht zu ihr aufschaut. Als sich ihre Blicke kreuzen, bleibt ihr sein mühsam verdeckter Ärger nicht verborgen.
»Haben wir eine andere Wahl?«, fragt sie ihn leise.
»Mwen pa genyen (ich weiß nicht)«, antwortet er ausweichend.
***
Vorsichtig manövriert Kaholo den Geländewagen durch die schmale Gasse, die von den Händlern in der Toreinfahrt freigemacht worden ist. Es hat wieder geregnet. Als sie die Straße erreichen und Kaholo den Wagen langsam durch den knöcheltiefen Schlamm Richtung Hauptstraße lenkt, sieht sich Laura um und beugt sich plötzlich nach vorne.
»Alex!« Sie zeigt auf die endlosen Reihen einfacher Hütten, die rechts die Straße säumen. »Wie willst du hier bis Morgen eine Überwachung organisieren, ohne dass dich dabei Hunderte von Kindern und Erwachsenen beobachten?«
»Wenn wir die Hauptstraße erreichen haben, dreh dich bitte mal um. Das hier ist eine Sackgasse. Du kannst von der Hauptstraße aus die Apotheke sehen und beobachten, wer dort ein- und ausgeht.«
»Wieso …?«, Laura wird durch das Holpern des Geländewagens unterbrochen, als er sich auf die schlecht asphaltierte Hauptstraße hochschiebt. »Wieso ich?« wiederholt sie mit gekrauster Stirn.
Alexander zeigt auf eine kleine Bar, die der Einfahrt zur Sackgasse gegenüberliegt. Haitischer Komba, ein Mix aus karibischen Jazz und Afromusik, dröhnt aus viel zu kleinen Lautsprechern über die Köpfe der Gäste hinweg. Im Schatten unter der knallbunten Markise sind sogar einige weiße Gesichter auszumachen.
»Von hier aus kannst du mir morgen per Handy das Signal senden, wenn der Kurier kommt.«
»Aha! Von hier aus und morgen! Es ist ja schön, dass ich es auch schon erfahre«, schnauzt Laura empört, »und wo bist du?«
»Ich warte auf deinen Anruf und werde dann mit einem Hubschrauber die Verfolgung aufnehmen.«
»Das meinst du doch nicht im Ernst?«, fragt Laura, unüberhörbar um Alexanders Geisteszustand besorgt.
»Eine Verfolgung eines Motorrades ist auf der Straße kaum möglich und scheidet damit aus«, antwortet Alexander schlicht.
»Ein Hubschrauber ist ja auch viel unauffälliger«, höhnt sie.
Alexander zwingt sich zur Ruhe. »Vielleicht ist es dir noch nicht aufgefallen, aber allein gestern Vormittag habe ich zwölf oder dreizehn Hubschrauberflüge über Port-au-Prince gezählt.«
Ciel hat dem Gespräch unfreiwillig zugehört und meint: »Alexander hat Recht. Seit dem Erdbeben haben Hubschrauberflüge extrem zugenommen.«
»Sekonsa (genauso ist es)«, bestätigt Kaholo, »zum Glück fliegen sie nicht auch noch nachts.«