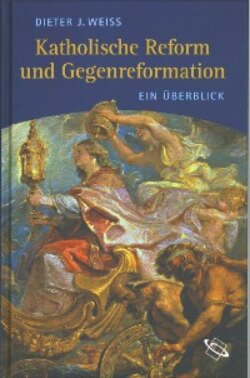Читать книгу Katholische Reform und Gegenreformation - Dieter J. Weiß - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der christliche Humanismus
ОглавлениеDie geistige Bewegung des Humanismus als Erneuerung der antiken Bildung war im Wesentlichen in Italien entstanden. Die Abwendung von Aristoteles und der späten Scholastik und die Hinwendung zu Plato und zum Augustinismus hatten dazu beigetragen. Die neue Richtung der Theologie trachtete danach, die scholastischen Spekulationen zu überwinden. Sie basierte auf der Bibel und den Kirchenvätern. Neue griechische Texte waren durch die Flucht der christlichen Gelehrten nach dem Fall Konstantinopels (1453) in den Westen gelangt. Die Humanisten entwickelten philologische Methoden, mit denen sie kritische Textausgaben erarbeiteten. An der Pariser Universität wurden seit 1476 die Sprachen Griechisch und Hebräisch gelehrt.
An italienischen Fürstenhöfen und Universitäten bildeten sich humanistisch gestimmte Zentren. In Florenz entstand in der Mitte des 15. Jahrhunderts die platonisch geprägte Akademie. Lorenzo Valla (1407–1457) interpretierte die neuen und verbesserten Texte in Philosophie und Theologie und verknüpfte dies mit Reformforderungen an den Klerus. Mit seiner Kritik an der Konstantinischen Schenkung verband er die Forderung nach dem Verzicht des Papsttums auf weltliche Macht. Auch an der Kurie war die moderne Geisteshaltung vertreten. Papst Nikolaus V. gründete die vatikanische Bibliothek und versammelte Gelehrte an seinem Hof, Enea Silvio Piccolomini (1405 –1464), als Papst Pius II., war selbst ein gelehrter Humanist.
Vertreter dieser Geisteshaltung gab es in vielen europäischen Ländern. Als Vermittler humanistischer Ideen in das Heilige Römische Reich fungierte Nikolaus von Kues (1401–1464). Der Teilnehmer des Konzils von Basel vertrat dort zunächst eine gemäßigt konziliaristische Position, Zeichen der Wahrheit war für ihn die Übereinstimmung von Papst und Konzil. Nach der Ankündigung des Unionskonzils mit der griechischen Kirche betonte der 1448 zum Kardinal erhobene Cusanus stärker die Bedeutung des Kirchenoberhauptes als Garanten der Einheit. Als Kardinallegat wirkte er ab 1451 auf Visitationsreisen im Reich für die Kirchenreform in Diözesen und Orden. Er bemühte sich um eine verinnerlichte Religiosität.
Gelehrte Humanisten wirkten als Juristen an den Fürstenhöfen oder sammelten sich in den Reichsstädten, nur einige fanden zeitweilig den Weg an die Universitäten. In Nürnberg etwa war Willibald Pirckheimer (1470 – 1530) Mittelpunkt eines Kreises, der antike und patristische griechische Schriftsteller übersetzte. Seine hochgebildete Schwester Caritas (1467– 1532), Äbtissin des Klosters St. Clara in der Reichsstadt, leistete der Reformation für ihren Konvent erfolgreich Widerstand.
Weitere Zentren des Humanismus entstanden in Heidelberg und am Oberrhein, in Schlettstadt, Straßburg, Freiburg und Basel. Besonders die Elsässer Humanisten kritisierten bestehende Missstände und forderten eine Reform. Den Bruch Martin Luthers mit der überkommenen Kirche lehnten sie aber ab. Johannes Reuchlin (1455 –1522) wurde zum Begründer der hebräischen Sprachwissenschaft in Deutschland. Dies verwickelte ihn in eine Auseinandersetzung mit dem jüdischen Konvertiten Johann Pfefferkorn (1469 –1522/23), der sich für die Vernichtung hebräischer Bücher einsetzte. Reuchlins Name wurde zum Symbol für die jüngeren Humanisten in ihrer Auseinandersetzung mit der scholastisch geprägten Universität Köln. Im Zusammenhang dieser literarischen Fehde entstanden als schlagkräftige Satire die Dunkelmännerbriefe (Epistolae obscurorum virorum, 1515/17), die das Überlegenheitsgefühl der Humanisten gegenüber der Scholastik zum Ausdruck brachten. Als führender Repräsentant des Humanismus gilt Erasmus von Rotterdam.
Erasmus Desiderius von Rotterdam (1466 –1536): Der Sohn eines Priesters empfing seine Ausbildung im Umkreis der Devotio moderna. 1492 erhielt er die Priesterweihe und erstrebte die Erneuerung der Kirche aus der Hl. Schrift und die Reinigung von Äußerlichkeiten. So erarbeitete er eine Edition des Neuen Testaments in griechischer Sprache (Basel 1516). Im Anschluss gab er die Werke des Kirchenvaters Hieronymus neu heraus. Die Vertreter mittelalterlicher Bildung und Latinität galten ihm als „barbari“, während er die Verbindung des an Cicero orientierten klassischen Lateins mit dem antiken und neuen Lebensgefühl höherer Bildung propagierte. Erasmus wollte die antike Kultur mit christlichem Glaubensgut vereinigen. Gegen Luther richtete er die Schrift De libero arbitrio und mahnte zur kirchlichen Einheit, womit er die zeitweise Unionspolitik Kaiser Karls V. stützte.
Die Freundschaft und der wissenschaftliche Austausch der Gelehrten gehören zu den Merkmalen des Humanismus. Sir Thomas Morus (1477/ 78 –1535, heilig gesprochen 1935) war Erasmus in Freundschaft verbunden. Der gelehrte Engländer hatte in seiner Utopia (1516) in satirischer Form Kritik an den Staats- und Religionsverhältnissen geübt und ein „kommunistisches“ Staatsideal entworfen. Nachdem er als Lordkanzler versucht hatte, König Heinrich VIII. (1509 –1547) von der Gründung einer Staatskirche abzuhalten, wurde er wegen seiner katholischen Überzeugung zum Märtyrer.
Die Humanisten erkannten die Reformbedürftigkeit der Kirche und behandelten sie in ihren Schriften. Manche von ihnen zeigten deshalb anfänglich Sympathie für das Anliegen Martin Luthers. Den Bildungsaristokraten der älteren Generation widerstrebten aber die mit der Reformation verbundenen Unruhen. Gasparo Contarini und andere verankerten die humanistischen Reformideen an der Kurie. Diese Humanisten stehen für eine patristisch geprägte Theologie und einen eigenen Reformweg, der durch die dogmatische Verfestigung in Trient in den Hintergrund rückte.