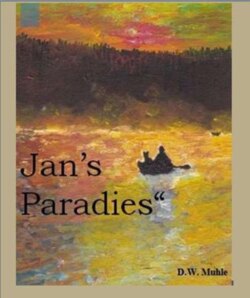Читать книгу Jan´s Paradies - Dieter Muhle - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Flucht
ОглавлениеUnsere Rucksäcke sind gepackt und stehen bereit. Walter macht noch mal eine Runde um unsere Hütte. Es wäre gelogen, zu behaupten, wir wären nicht stark angespannt gewesen. Walter kommt zurück und sagt: „Dann lasst uns mal verschwinden, Kollegen, alles ist ruhig draußen, da rührt sich nichts. Jan, du gehst zuerst, dann Wilhelm und dann ich. So machen, wie abgesprochen.“
Jan schultert seinen Rucksack und verschwindet aus der Tür. Fünf Minuten später ziehe ich los. Es sind knapp fünfzig Schritte, die ich zu gehen habe, um an die Stelle des Zauns zu gelangen, genau entgegengesetzt zum großen Eingangstor. Die Nacht ist nicht sehr dunkel, dahinziehende Wolken werfen immer wieder Schatten über das Gelände. Auf der anderen Seite des Zauns hockt bereits Jan. Mit einem Knüppel drückt er zwei schwach gespannte Stacheldrähte auseinander. Ich werfe meinen Rucksack durch die Öffnung und krieche hinterher. Jan ist mir behilflich und unbeschadet gelange ich auf die andere Seite. Mehr als zwei Jahre war ich niemals außerhalb dieses Stacheldrahtzauns gewesen. Aber jetzt ist keine Zeit, dem Campleben nachzutrauern, dem Gefühl des Versorgtseins zu entsagen, jetzt müssen wir für uns selbst sorgen, dafür aber in Freiheit.
Walter ist durch. Jan schmeißt den Knüppel in ein Gebüsch. Wir tippeln los durch lichten Fichtenwald. Bald werden wir eine Straße erreichen. Es ist nicht die, die zum Camp führt. Nur ein breit geschotterter Weg, der an einer Farm vorbeiführen soll. Die müssen wir entlang laufen, bis wir das Farmhaus erreichen. Gut eine Stunde dauert unser Marsch. Links und rechts des Weges wechseln sich Wald und Ackerfelder ab. Der Zaun ist morsch, der einen Teil der Ackerflächen umgibt, teilweise ist er bereits umgefallen. Es ist kurz nach zwei Uhr, als wir das Farmhaus erreichen. Es soll unbewohnt sein. Die Farm steht zum Verkauf, das zeigt das schief hängende ‚For Sale’ Schild am halboffenen Eingangstor, das auch nicht mehr gerade in seinen Angeln hängt. In einer schon recht baufälligen Scheune steht der kleine Ford Lastwagen bereit. Bis hierher hat also alles reibungslos geklappt. Margret und Josef müssen da ganz ordentliche Aktivitäten vom Stapel gelassen haben. Walter meint, Josef muß es irgendwo geklaut und am Vortag oder in der Nacht zuvor in der Scheune abgestellt haben.
Wir machen uns sofort auf den Weg. Walter fährt, Jan und ich sind mit unseren Rucksäcken unter die Segeltuch Abdeckung der Ladefläche gekrochen. Wir fahren nicht auf unserem abgetippelten Weg zurück, sondern nehmen den Weg weiter am Farmhaus vorbei. Walter ist instruiert, wie er zunächst zu fahren hat. Später kennt er den Weg selber. Zwei Stunden dauert unsere Fahrt. Jan und ich sehen nicht, wo es langgeht, durchgerüttelt werden wir dafür umso schlimmer auf der ungepolsterten Ladefläche.
Sonntagmorgen um halb fünf, das Tageslicht ist bereits da, als wir unsere Reise per Auto beenden. Alles ist so einfach gewesen bisher. Walter sagt uns, wir sollen so tun, als sei alles ganz normal, nur keine Hast aufkommen lassen. Nirgendwo ist ein Mensch zu sehen, nichts regt sich in unserer Umgebung. Walter holt aus einem Versteck einen Schlüssel hervor, schließt ohne Eile das Vorhängeschloß an der Tür der Lagerhalle auf. Das Auto lassen wir einfach so stehen, wie Walter es abgestellt hat. In der Halle lagern verschiedene kleine Kisten und auch Sackgut ist dort aufgestapelt. Wir durchqueren den Raum bis zum anderen Ende. Hier gibt es eine große Schiebetür, die ebenfalls mit einem Vorhängeschloß gesichert ist. Neben dieser Tür hängt der Schlüssel. Walter findet ihn sofort. Er war hier mal zu Hause, das sehe ich.
Draußen kommt es mir vor, wie auf einer kleinen Werft. Hier allerdings eine breite und überdachte Helling, auf deren Schräge und auf Schienen sich zwei Flugzeuge auf flachen
Loren befinden. Walter macht sich an einer Winde zu schaffen und langsam gleitet eines der Flugzeuge ins Wasser, bis es auf seinen Schwimmern selbständig wird. Walter bedeutet mir, die Lore mit der Winde wieder hochzukurbeln, für mich kein Problem, kenne ich mich als Seemann mit Winden und Kurbeln zur Genüge aus. Jan muß währenddessen am Rand der Helling das Flugzeug an einem Schwimmer in Position halten. Walter selbst geht noch einmal zurück in die Lagerhalle und als er zurückkehrt, wedelt er mit einem Schlüsselbund und sagt grinsend: „Ohne die geht’s nicht, Kollegen.“
Walter ist im Flugzeug verschwunden, er will darin noch einmal alles inspizieren, bevor wir den Abflug machen. Der Tag ist längst angebrochen. Ein paar weiße und zerstreute Kumuluswolken ziehen am blauen Himmel ihre langsame Bahn. Ich bin noch nie in einem Flugzeug geflogen, habe auch aus der Nähe noch nie eins betrachten können. Nur, wenn sie dann wie Vögel in den Lüften über mich hinweggerauscht sind, konnte ich mir so vage Vorstellungen von diesen Dingern machen. Jetzt, aus der unmittelbaren Nähe betrachtet, sieht unser Flieger doch recht klobig aus und entspricht so kaum meinen Vorstellungen von früher.
Auf Walters Anweisung bringen Jan und ich das Flugzeug nochmals in die richtige Position, so dass es nun genau mit dem Bug aufs offene Wasser zeigt und das Heck, das noch ein beträchtliches Stück in den Hangar hineinragt, nicht irgendwo anecken kann. Dann entern wir auf. Jan als letzter schließt vorschriftsmäßig die Flugzeugtür. Er kennt sich da aus. Während ich mich recht dumm anstelle und nach einem Sitzplatz suche und nirgendwo einen entdecken kann, bis Walter uns Handzeichen gibt, uns auf den Boden zu setzen und uns an seitlichen Handschlaufen festzuhalten. Der Motor dröhnt. Sprachliche Verständigung ist unmöglich. Walter gibt mehr Gas, dann noch mehr und schon geht die Post ab. Wir holpern über das Wasser, als ginge es mit dem Pferdefuhrwerk im Galopp übers Kopfsteinpflaster. Das Holpern hört auf, unser Vogel fliegt.
Ich hocke an der Backbordseite auf dem Boden, Jan an Steuerbord. Direkt vor uns sitzt Walter auf dem einzelnen Pilotensitz und hantiert mit seinen Hebeln und Armaturen. Noch starre ich nach vorne und halte mich krampfhaft an der Handschlaufe fest, habe keinen Blick für mein Umfeld. Walter läßt seinen Flieger weiter steigen. Ich werfe einen verstolenen Blick auf Jan. Der grinst mich unverschämt an. Mit dem rechten Daumen nach oben, will er mir wohl mitteilen, dass wir es geschafft haben.
Wie lange ist es her? Nur ein paar Stunden, als wir uns aus dem Staub machten. Es könnte ein spannender Traum gewesen sein, aber es ist Wirklichkeit, ich bin hellwach. Im Camp werden sie zur Zeit beim Frühstueck sein und sich über unsere Abwesenheit wundern. Die zuerst, die immer mit uns einen Tisch teilten. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals die Mahlzeiten versäumten. Unsere Tischgenossen werden nachsehen, wenn sie fertig gegessen haben. Auf dem Tisch in unserer Hütte werden sie zwei Briefe vorfinden. Der eine ist an die Campleitung und der andere an Walters Frau, Margret Conrad, adressiert. Sie werden es bekannt machen. Zuerst den anderen Internierten und es wird sich rumsprechen. Unser Campältester wird eine Meldung machen an den Campkommandanten. Der wird die beiden Briefe konfiszieren und ebenfalls Meldung machen an die Polizei oder an wen auch immer.
Der Brief an die Campleitung ist von uns drei unterschrieben und Walter hat ihn in englischer Sprache verfasst mit folgendem Wortlaut – so weit ich mich noch erinnern kann: „Wir haben nicht die Absicht, dem Land Kanada Schaden zuzufügen durch Sabotage oder Ähnliches. Keiner von uns hat jemals den Krieg zwischen Deutschland und Ihrer Nation gutgeheißen. Keiner von uns hat jemals eine strafbare Handlung begangen, außer, dass es in Kanada im Moment strafbar ist, in Deutschland geboren worden oder Deutscher zu sein. Wir möchten stark betonen, dass es während unserer Campzeit an nichts gemangelt hat, außer der Freiheit. Wir werden uns daher in die Freiheit begeben und uns dort selber internieren. Walter Conrad, Jan Henning, Wilhelm Bergemann.“
An Margret hat Walter einen liebevollen Brief geschrieben, auch ihr mitgeteilt, dass sie erst auf diesem Weg von seinen Plänen erfahren muß und sie davon überrascht sein wird. Sie möge sich keine Sorgen machen, er habe alles bedacht und der Krieg werde ja nicht ewig dauern. Er hoffe, dass man dann wieder ein normales Eheleben führen könne. Das Flugzeug würde er sich für eine Zeit ausleihen, es sei ja kein Diebstahl sein Eigentum zu entführen und zu benutzen.
Margret ist also aus der Sache raus – hoffen wir es. Josef wird man möglicherweise auf die Spur kommen, aber der hat vorgesorgt, so viel wissen wir.
Es ist uns nicht schlecht gegangen im Camp. Langeweile kam nicht auf. Dagegen gab es genügend Unterhaltung und Abwechslung im Campleben. Das Erlernen der englichen Sprache war vielen von uns Deutschen beinahe zur Pflicht geworden. Sport wie Fussball, Handball, Geräteturnen war beliebt und auch Boxkämpfe wurden veranstaltet. Es gab eigentlich nichts zu beklagen. Die Verpflegung ausreichend und die deutschen Köche und Bäcker gaben sich alle Mühe, Schmackhaftes auf den Tisch zu bringen. Der zweite Weltkrieg war nach unserer Meinung noch lange nicht zu Ende, als Internierte uns somit das Glück hold. Hier im Inneren von Kanada, weit weg von irgendwelcher Front und somit in Sicherheit. Über Siege und Verluste der deutschen Wehrmacht waren wir informiert. Allerdings einseitig und aus Sicht der Alliierten.
Alle im Camp waren Zivilisten und keine Wehrmachtsangehörige gewesen. Daher nicht Kriegsgefangene, sondern Internierte. Interniert hat man uns, weil wir der kriegsführenden Feindesnation angehörten. Unser Pech, wahrscheinlicher noch unser Glück, bei Kriegsbeginn, aus welchen Gründen auch immer, wir uns auf kanadischem Gebiet befanden und eine Ausreise in die Heimat nicht mehr gestattet wurde.
Jede Altersgruppe ist vertreten. Unter uns sind Seeleute der deutschen Handelsschifffahrt, Geologen, Ingenieure, Handelsvertreter, zwei Universitäts Professoren, die komplette Flugzeugbesatzung eines Flugbootes, Techniker aus verschiedenen Bereichen, Journalisten und andere, die aus unterschiedlichen Gründen ins Camp gebracht wurden.
Dass Walter Conrad interniert wurde, obwohl er bereits an die fünf Jahre in Kanada gelebt und mit einer Kanadierin verheiratet war, lag wohl daran, dass er immer noch einen deutschen Pass besaß und bis dahin sich auch nicht um die kanadische Staatsbürgerschaft bemüht hatte.
Walter, fünfunddreißig Jahre alt, mit dunkelblondem Haar im Stoppelschnitt geschoren – damals noch im Camp – einem gepflegten Schnauzbart unter der leichten Adlernase, grau-blauen Augen, mittelgroße, aber kräftigen Figur mit immer gepflegtem Aussehen ist von Beruf Ingenieur für Flugzeugbau, dabei auch Pilot. Bis zum Kriegsausbruch vertritt er eine deutsche Flugzeugfirma in Kanada. Das Geschäft läuft gut. Walter ist Verkaufsstratege und auch Pilot, denn er hat die deutschen Kleinflugzeuge auch vorzuführen. Einige kanadische Techniker stehen in seinen Diensten. Dazu gehört ein Büro in Ottawa, das von seiner Frau Margret und einer weiteren Mitarbeiterin versorgt wird. Über dem Büro haben Walter und Margret ihre Wohnung. Walter spricht ein ausgezeichnetes Englisch, auch der französischen Sprache ist er mächtig.
Mit zwei privaten Frachtflugzeugen haben sich Walter und Margret ein zweites Standbein geschaffen. Aus einem Nachlaß konnten sie sie günstig erwerben und sich damit ein kleines Transportunternehmen aufbauen. Fracht, aber auch Passagiere werden in die umliegenden Gebiete geflogen. Dieses Frachtunternehmen läuft unter dem Namen von Margret Conrad, geborene Gustafson. Hier hatten die kanadischen Behörden bei Kriegsausbruch keinen Zugriff wie bei allen deutschen Unternehmungen in Kanada.
Jan Henning ist einunddreißig Jahre alt. Er hat sich im Camp einen rotblonden Vollbart wachsen lassen, den er von Zeit zu Zeit zurechtstutzt. Mit seinem hellblonden, lockigen Schopf, den fast grünen Augen, sieht er immer noch wie ein Jüngling aus. Knapp einenmeterneunzig groß, kräftiger Gestalt, macht er Eindruck auf seine Mitmenschen. Sein schiefes Grinsen bei Gelegenheit, macht weiteren Eindruck und man wird sich an diesen Menschen erinnern, den vergißt man nicht.
Jan ist von Beruf Geologe, aber auch Spaßvogel. Niemand wird ihm den Geologen auf den Kopf zusagen. Er ist drei Jahre vor Kriegsbeginn nach Kanada gekommen und hat bereits an etlichen Orten Kanadas für Minengesellschaften gearbeitet. Meistens waren es Prospektierarbeiten gewesen in unwegsamen Gebieten. Jan kennt sich in der Wildnis recht gut aus und er hat einige Abenteuer und Gefahren überstehen müssen.
Josef ist Halbindianer. Seine Mutter eine Halblut Cree, sein Vater Schwede. Ob das so der Wahrheit entspricht, ist nicht nachzuprüfen. Josef ist Walters Freund. Walter hat ihm großes mechanisches Wissen vermittelt, nachdem Josef in den Anfängen zunächst nur als einfacher Mechaniker eingestellt war. Josef ist lerneifrig und Walter treu ergeben. Vorher hatte er nie eine Chance auf der Leiter nach oben. Walter hat sie ihm gegeben. Er betraut Josef auch mit der Wartung seiner Privatflugzeuge und auf seinen Privatflügen ist Josef oft sein Begleiter. Er lernt auch die Maschinen zu fliegen und ist schon länger einer der Piloten im Transportgeschäft.
Josef ist achtundzwanzig Jahre alt, eine mittelgroße und untersetzte kräftige Gestalt. Mit seinen dunklen Augen, seinem glänzenden, kurzgeschnittenen schwarzen Haar, könnte er auch ein Südeuropäer sein. Walter ist sein Berater und Freund. Aber auch Josef ist Berater in Dingen, von denen Walter profitiert. Dass Josef seine Flugzeuglizenz bekommen hat, dafür sorgten Walter und Margret. Es war schwierig genug, den Behörden klarzumachen, einem Nichtweißen mit einem indianischen Namen dieses nicht vorzuenthalten, wenn der die Befähigung zum Fliegen besitzt, die nötigen Flugstunden nachweisen kann und ebenso die notwendigen mechanischen Kenntnisse und eine gute Schulbildung genossen hat.
Mein Name ist Wilhelm Bergemann und ich bin achtundzwanzig Jahre alt – damals, als wir abhauten - wurde in Den Haag, Holland geboren und bin in Bremen aufgewachsen. Meine Mutter ist Holländerin und mein Vater Deutscher. Als ich interniert wurde, war ich zweiter Offizier auf einem Norddeutschen Lloyd Dampfer gewesen. Wegen einer Havarie auf dem Sankt Lorence Strom, einige Wochen vor Kriegsbeginn, zwangen uns die langwierigen Reparaturarbeiten zu längerer Liegezeit in Montreal. Dort hat man uns dann von Bord geholt und die gesamte Besatzung in ein Camp für internierte Deutsche verfrachtet. Unser Dampfer ist dann wohl Kriegsbeute geworden. Anderen deutschen Handelsschiffen, die bei Kriegsbeginn noch irgendwo im Hafen lagen, muß es ähnlich ergangen sein.
Meine Wenigkeit mißt einenmeterachtzig Länge. Bin sonst ganz gut gebaut mit anständigen Muskeln, die ich mir im Laufe meiner Zeit vom Moses bis zum Matrosendasein aneignen konnte durch manchmal doch recht harte Arbeit. Meine Haarfarbe ist mittelblond – als Kind waren sie noch ganz hell – die Augen sind, wie meine Mutter mir sagte, blau-grün, manchmal auch blau- grau. Ich selber habe das nie so genau feststellen können. Meine Hände sind groß und können entsprechend zupacken. Sonst ist an mir eigentlich alles normal. Mein Steuermanns Examen habe ich in Bremen gemacht. Das Kapitäns Examen steht noch aus, war aber geplant. Nun ist der Krieg dazwischen gekommen und ich erzähl‘ erst mal die Geschichte weiter.
Über Walters Frau, Margret, werde ich zu einem späteren Zeitpunkt noch berichten, über Liza auch.
Hundertfünfunddreißig Internierte belegen Anfang 1940 unser Camp. Untergebracht sind wir in gut isolierten Holzhütten zu je fünf Mann. Man hat uns gesagt, wir hätten Glück. In anderen Camps sollte es schlimmer sein, vor allem bei den deutschen Kriegsgefangenen, die man aus England brachte oder wo sie auch immer in englische Gefangenschaft geraten waren.. Aber wir vermuteten, dass sie in Neufundland untergebracht wurden, welches noch englische Kolonie war und noch keine Provinz von Kanada. Vielleicht war es auch anders, wir wußten es nicht genau.
Die Zusammensetzung unserer Leute in den einzelnen Wohnbaracken bestimmte die kanadische Campleitung. Wir Seeleute von unserem Lloyddampfer hätten uns sonst wohl zusammengetan und Wohngruppen gebildet, weil wir uns kannten. Doch die Campleitung mischte uns auf, auch wenn am Anfang immer noch ein Kommen und Gehen stattfand. So passierte es auch, dass Anfang 1940 Walter, Jan und ich die Baracke alleine teilten. Ein Mann unserer Gruppe, namens Heinze, erkrankte schwer, war wohl auch schon krank eingeliefert worden. Im Hospital, außerhalb des Camps, soll er dann auch bald verstorben sein. Einige Monate später kam Dr. Weitz frei. Ein Wissenschaftler und Dozent für Physik an einer kanadischen Universität soll er gewesen sein.Viele Male mußte er sich beim Campkommandanten einfinden. Dort warteten immer einige Männer auf ihn, die ihn für mehrere Stunden scheinbar unter die Lupe nahmen. Man munkelte, Dr. Weitz habe politisches Asyl beantragt. Als Deutscher, jüdischen Glaubens, verständlich in unseren Augen.
Wir drei Übriggebliebenen richteten uns so gemütlich ein, so gut es ging. Mit der Zeit wurden wir auch leidenschaftliche Skatspieler. Im großen Eßsaal gab es oft Skattourniere, an denen wir drei teilnahmen. Walter, Jan und ich lernten uns näher kennen. Jeder erzählt aus seinem Leben. Keinem von uns fällt die Decke auf den Kopf. Zu trösten gibt es nichts. Einzig Walter bläst manchmal Trübsal, wenn Margret, seine Frau, sich nach ihren monatlichen Besuchen wieder verabschieden muß. Jan und ich kennen Margret nicht, da gleich am großen und bewachten Eingangstor für solche Besuche ein Raum vorgesehen ist. Es ist nicht nur Walter, der Besuche empfängt. Es gibt da auch andere, die weiterhin ihre ehemaligen guten Beziehungen zu kanadischen Familien oder Einzelpersonen pflegen. Im übrigen nehmen wir unsere Lage hin, zu ändern ist ja nichts.
Wenn abends um zehn Uhr die Lichter ausgehen, liegen wir meistens schon in unseren Kojen, da erzählt dann immer noch mal einer irgendeine Story, einen neuen Witz, den er aufgeschnappt hat, oder wir diskutieren über den Krieg und sonstige Ereignisse des Tages. Meine beiden akademischen Mitbewohner haben meistens das Wort. Ich, als so ein Halbgebildeter, nur mit meinem Steuermanns Examen, bin nicht so wortgewandt, höre lieber zu und profitiere von dem Allgemeinwissen der beiden. Bin aber nicht so ein Duckmäuser, der als Dritter im Bunde nur die Schauze hält. Die mache ich schon auf und vertrete meine Meinung kräftig genug. Spitze auch den Jan manchmal ganz schön an, wenn der seine Klamotten so schlampig rumliegen läßt. Ordnung muss sein, die liegt mir als Seemann praktisch im Blut. Auch Akademiker sind nicht davon befreit, ist meine Meinung. Jan hat das im Laufe der Zeit kapiert. Walter hält immer auf Ordnung.
Ich habe keine Ahnung von Flugzeugen, Jan auch nicht viel. Ich habe keine Ahnung von Geologie, Walter auch nicht. Walter und Jan haben keine Ahnung von der christlichen Seefahrt, aber das ist mein Revier. So hat jeder sein Wissensgebiet, mit dem er sich persönlich darstellt, stolz darauf ist, sich nicht unterzuordnen braucht und sich nicht minderwertig fühlt. Jeder ist Herrscher über sein Gebiet. Mit meinem Kapitän oder meinem 1. Offizier in einer Wohngruppe hätte das anders ausgesehen. Die Campleitung oder wer das auch immer mal ausgeheckt hatte, löste damit das gewohnte Hierachiedenken, zumindest größtenteils, ab und das war meiner Meinung nach gut so und sehr brauchbar für ein Campleben.
Irgendwann erzählt uns Jan von einem Paradies, dieses spukt in seinem Kopf herum und dieses „Jan sein Paradies“ beginnt langsam auch in Walters und in meinem Kopf Gestalt anzunehmen. Im Laufe der Zeit und wenn wir am Abend schon in unseren Kojen liegen, spinnen wir herum.
„Du fliegst von Ottawa gut zwei Stunden in nordwestliche Richtung, bin zweimal dagewesen mit einem Ami Geologen und einem kanadischen Piloten. Wir haben genaue Aufzeichnungen darueber gemacht. Hab’ sie sogar hier. Mir einfach kopiert den Lageplan. Ist natürlich nicht erlaubt sowas. Aber egal, hab’ es gemacht, weil ich irgendwann mal wieder dahin wollte. Geologisch gesehen, ist die ganze Gegend dort auch nicht uninteressant, aber diese Ecke, in die wir damals nur durch Zufall kamen, ist ein kleines Paradies, sag’ ich euch, ‚ne verdammt schöne Gegend. Da kommt sonst nicht so leicht ein Mensch hin. Vielleicht mal ein Indianer, kein Mensch sonst.“ Mit dieser Schwärmerei von Jan begann die ganze Sache.
Jan begeistert uns oft von seinem Paradies. Er lädt uns ein, wenn der Krieg mal vorbei sei und wir wieder in Freiheit, dann wolle er es uns zeigen. Mal so richtig ausspannen dort in der Freiheit der wunderbaren Natur mit seinen Seen, Inseln, Flüssen und Wäldern. Mit Walters Flugzeug könne man es machen. Schwimmer müsse das Flugzeug haben, da man auf einem See landen müsse.
Walter sieht darin kein Problem, seine beiden Flugzeuge könne man umrüsten je nach Bedarf.
Als Jan eines Abends seinen leeren Rucksack auf den Tisch wirft, den verstärkten Boden darin löst und dann noch einen Boden löst und ein flaches Paket mit Wachstuch umhüllt zum Vorschein kommt, sind Walter und ich doch recht neugierig geworden. Das Paket enthält neben einiger Bündel amerikanischer Dollarnoten, einige, scheinbar persönlicher Dokumente, den Lageplan, von dem Jan uns erzählt hatte.
Walter und ich beugen uns interessiert über die sauber angefertigte Skizze. Da sind eine Menge Seen und Flüsse. Die Seen sind alle miteinander verbunden. Große und kleine mit vielen Armen. Sich dort zurechtzufinden, scheint mir unmöglich. Aber Jan hat sie exakt eingezeichnet, so nehme ich an. Dort, wo Jan sein Paradies auf der Skizze vermerkt hat, sieht es für mich eigentlich nicht anders aus, als auch in anderen Gebieten der Skizze. Doch Walter kennt in etwa die Stelle. Er sagt, er sei dort oben bereits gewesen. Es gäbe dort in der Nähe eine Indianersiedlung, ein Reservat und die Leute dort würden von der Regierung unterstützt. Und das Interessante sei, dass sein und Margrets Transportunternehmen mit der Regierung einen Vertrag hätten, diese Indianersiedlung zeitweise mit Waren zu bedienen. Diese Flüge, manchmal auch mit einem Beamten der Indianerverwaltung, mal auch ein Arzt dabei, mache hauptsächlich Josef.
Es sollte nur eine blöde Bemerkung von mir sein, als ich sage: „Walter, dein Josef kann uns doch jetzt schon in Jan sein Paradies fliegen, hau’n wir hier einfach ab, bauen uns dort ‚ne Hütte, fangen Fische undsoweiter und leben herrlich und in Freuden bis der Krieg vorbei ist.“
„Oder bis in alle Ewigkeit,“ ergänzt Walter.
Es muss im Juli oder August 1941 gewesen sein, als ich meinen folgenschweren Ausspruch tat. Danach aber fangen wir wirklich an zu spinnen. Das Thema kommt immer wieder auf den Tisch. Vor allem Jan, der es immer wieder zur Sprache bringt. Es wird abends zur richtigen Gewohnheit, unsere Flucht in die Theorie umzusetzen. Auch wenn keiner von uns glaubt, dass es jemals gelingen könnte. Wir spinnen den Faden, es macht uns einfach Spaß, ihn immer weiter zu spinnen. Große andere Beschäftigung haben wir ja nicht. Jeder bringt seine Ideen ins Spiel. Meine allerdings sind nicht viel Wert zu dieser Zeit. Walter und Jan besitzen viel mehr Wissen über Kanada als ich. Kenne in Kanada nur ein paar Häfen, aber vom Landesinneren weiß ich so gut wie nichts. Das Hauptproblem, das wir lösen müssen, ist das Überleben in der Wildnis. Hier ist Jan der Experte. Oft genug in seiner Prospektiertätigkeit hat er sich dort bewähren müssen. Immer wohl mit Kollegen, die mehr Erfahrungen hatten, aber er lernte von ihnen. Wir holen uns Fachbücher aus der Campbibliothek und studieren Fauna und Flora Kanadas. Das Bauen von winterfesten Hütten ist meine Leidenschaft geworden. Auch über dieses Gebiet gibt es reichlich Lesestoff, wenn auch alles in englischer Sprache beschrieben ist. Meine Englischkenntnisse reichen aber aus und wenn ich etwas wirklich nicht verstehen kann, brauche ich nur Walter oder Jan zu fragen.
Wir erzählen natürlich keinem anderen aus dem Camp von unserer Spinnerei. Darüber einigen wir uns gleich am Anfang. Walter meint nämlich, dass bestimmte Leute unser Hobby falsch verstehen könnten und falsche Schlüsse gezogen würden. Wir sind ja froh, dass unsere kanadischen Aufpasser uns so viel Freiheit lassen und sollte irgendwo ein Gerücht auftauchen, dass da Fluchtpläne geschmiedet werden, auch wenn es nur ein Spiel ist, dann kann es dem gesamten Internierungscamp Schaden zufügen und aus ist es mit der laschen Bewachung und viele Vorzüge, die wir genießen, können wegfallen.
Walter ist von Anfang an mit seiner Frau in Verbindung gewesen. Er bekommt außer den monatlichen Besuchen auch regelmäßig Post von ihr. Auch Walter darf schreiben. Aber es ist wahrscheinlich, dass jeder Brief durch eine Zensur geht. Walter hat seiner Frau aber von unserem Hobby erzählt. Das natürlich mündlich und so, dass es keiner mitbekommen hat.
Es sind nur wenige unter uns, die den Naziterror in Deutschland gutheißen, den Krieg bejahen. Diese kleine Gruppe ist uns als Prahlhänse wohlbekannt und sie wird im Großen und Ganzen von den meisten von uns belächelt, aber auch von einigen Älteren in die Schranken verwiesen. Unsere Informationen, die wir über den Krieg erhalten, sind umfangreich genug, dass sich jeder ein Bild von der Lage machen kann. Allerdings gehen sie uns aus kanadischer Sicht zu. Wir sind nicht immer einverstanden mit den Berichten, es ist auch viel Hetze dabei. Doch ein einarmiger kanadischer Armee Offizier mit dem schönen deutschen Namen ‚Wellmann’, der einmal im Monat im großen Eßsaal uns Demokratie versucht einzutrichtern und von der politischen und militärischen Lage in der Welt erzählt, hat großen Einfluß auf uns alle nehmen können. Er spricht auch noch ein ganz passables Deutsch, das wir alle verstehen können. Er spricht auch von übertriebener Kriegspropaganda, der man nicht immer Glauben schenken muß und dass die Übertreibungen auf beiden Seiten der kriegsführenden Nationen geschehen.
Weihnachten 1941. Walters Frau ist wieder zu Besuch gewesen. Über das große Freßpaket, das sie mitbrachte, machen wir drei uns noch am Abend nach der Weihnachtsfeier im Eßsaal, her. Walter verteilt alles in drei gleiche Portionen. Aus der Flasche Whisky, die seine Frau ihm heimlich zustecken konnte, gießt Walter uns einen ordentlichen Schluck in unsere Blechbecher. Es ist nicht das erste Mal, dass wir eine Flasche Whisky über Margret erhalten. Aber wir sind immer sparsam mit dem Inhalt der Flasche umgegangen und wenn wir davon tranken, dann nur am späten Abend in unserer Bude.
Wir rauchen unsere Pfeifen, knabbern Kekse und Schokolade und nehmen zwischendurch immer wieder einen kräftigen Schluck aus unseren Bechern. Der Alkohol tut auch bald seine Wirkung, sind ihn ja nicht mehr so gewohnt. Ich bemerke, wie die Gesichtszüge von Jan langsam entgleisen. Sein Grinsen wird immer schräger. Ob meine Gesichtszüge auch entgleisen, vermag ich nicht zu beurteilen. Nur als Walter zu mir sagt: „Du hast ja richtig glückliche Augen bekommen, Wilhelm Bergemann,“ nehme ich zur Kenntnis, dass auch ich langsam besoffen werde. Walter sehe ich nichts an, aber das muß ich wohl meinen glücklichen und wohl auch getrübten Augen zuschreiben, die solche Feinheiten in Walters Gesichtszügen nicht mehr wahrnehmen können. Aber Regungen und Gefühlsausbrüche sind ohnedem selten bei Walter auszumachen.
Unser kleiner Yukon Ofen verbreitet angenehme Wärme in unserem vollgequalmten Raum. Draußen ist alles unter einer weißen Schneedecke begraben. Die Temperaturen sind in den letzten Tagen stark gefallen. Minus fünfzehn Grad Celsius sollen in der letzten Nacht gemessen worden sein. Walters Whisky Flasche zeigt nur noch halbvoll an. Wir reden nicht besonders viel. Mal über unsere Familienangehörigen, wie es denen wohl an diesem Weihnachten geht in Deutschland. Mal über all die Soldaten an den Fronten, wie diese wohl das Weihnachtsfest erleben mögen. Dass Walters Frau bei ihren Eltern sein wird an den nächsten Tagen. Wir reden über einen, der sich am Tag zuvor in der Turnhalle erhängt hat. Wir haben rote Köpfe von der Hitze im Raum und dem Whisky im Bauch. Die Flasche zeigt nur noch viertelvoll.
Wir stieren so vor uns hin, haben nichts Genaues in unserem Blickfeld. Erst als Walter aufsteht und zu reden anfängt, werden wir munterer:
„Ich denke, ich werde es machen, werde unseren Plan ausführen. Wie steht’s mit euch, wollt ihr mitmachen?“
Es dauert eine Weile, bis Jan und ich diese Botschaft registrieren. Mein Kopf ist nicht klar genug, um im Moment das Für und Wider abwägen zu können. Es war ja nicht wirklich Ernst gewesen, unsere Pläneschmiederei, eher ein Spiel, das uns beschäftigte in unserer Bude. Für mich war es eine großartige und interessante Sache gewesen, aus der ich viel über Kanada hinzulernte. Für mich allein solches zu planen und durchzuführen, ist mir nie in den Sinn gekommen. Wo soll ich auch hin? Kenne nicht Land und Leute, die englische Sprache reicht gerade für den Hausgebrauch.
Jan antwortet zuerst, er ist dabei auch aufgestanden, zeigt erst sein schiefes Grinsen und sagt dann: „Bin dabei, Walter, ab in die Natur und Wildnis – und du Seemann, machst du auch mit?“
Jan und Walter sehen mich an. Jan grinst schief, seine schneeweissen Zähne schimmern durch seinen dichten Bart. Walter bleibt ernst. Ich stehe nun auch auf, meine Hände stützen sich auf dem Tisch ab. Ich sage: „Habe ja nichts zu verlieren, Kollegen, mit euch beiden ist das sicher machbar. Klappt es nicht und wir werden geschnappt, geht’s eben wieder nach hier zurück oder in den Knast. Der Knast wird auch nicht so schlimm sein. Sind ja keine Ganoven, oder?“
Alle drei setzen wir uns wieder. Walter verteilt das letzte viertel Whisky in unsere Becher. Sie werden fast randvoll. Jan stöhnt und sagt: „Mannomann, Walter, wenn ich diesen Pott noch intus hab’, dann kipp’ ich aus meinen Latschen. Aber man zu. Wird schon klappen, die Sache, Walter. Ich bin dafür. War mein Traum, hab’ ihn auf den Tisch gebracht. Geht natürlich nur mit dir. Flugzeug und so. Und du, Seemann,“ Jan grinst mich schief an, „machst dann den Kapitän auf so’n Kanu, wenn wir mal so’n Ding benützen müssen.“
Jan nennt mich manchmal bei meinem Vornamen, aber in gewissen Situationen bin ich sein Seemann. Er hat wirklich keine Ahnung von der christlichen Seefahrt, der Kerl. Es ist ja keine Beleidigung, wenn er mich Seemann ruft. Ich nenne ihn manchmal Rübezahl, wegen seines wuchernden Bartes. Aber das ist nur zwischen Jan und mir so, Walter bleibt Walter. Es ist da so etwas wie Respekt, weil er der Ältere, schon beinahe Kanadier, verheiratet, große Überzeugungskraft auf Jan und mich ausübt, weltgewandter ist als wir beide, ernsthafter als wir – einfach ein Mensch, dem man sich auch unterordnen kann. Ich habe von Walter gelernt, mir vieles abgeguckt, werde auch viel in Erinnerung behalten und habe später in meinem Leben auch davon einiges umgesetzt.
Die Botschaft von Walter hat uns etwas von unserer alkoholischen Duseligkeit genommen. Ich bin nicht hellwach gewesen, aber plötzlich genügend aufnahmefähig geworden, um die Besonderheit des Augenblicks zu erfassen. Mir geht seine Frau nicht aus dem Kopf und ich erwähne es: „Walter, was ist mit deiner Frau, bringen wir sie nicht in Gefahr?“
Nach ein paar Zügen aus seiner Pfeife sagt Walter: „Es muß euch wundern, dass gerade ich nun unseren bisher so schön gespielten Ausbruch in die Tat umsetzen will. War ich doch am Anfang gar nicht mit vollem Ernst dabei. Hat aber Spaß gemacht, mit euch diesen Plan in Szene zu setzen. Margret habe ich mal davon erzählt. Sie muß viel darüber nachgedacht haben und hat dann letztenendes selber einen Plan entwickelt. Es ist also sie, die mich in letzter Zeit dazu gedrängt hat, es zu tun. Sie vermißt mich, ich sie auch. Wozu ist man denn verheiratet?“
Margret will es organisieren, hat Pläne, ohne sich selbst zu gefährden. Sie hat mit Josef gesprochen. Er wird mitmachen und sie unterstützen. Er ist zur Zeit nur noch der alleinige Pilot, der andere ist zur Air Force eingezogen worden. Es ist daher nur ein Flugzeug in Betrieb. Die andere Maschine haben sie erst mal stillgelegt. Diesen Flieger werden wir also nehmen. Walter wird sie fliegen. Bis dahin ist noch eine Menge zu tun und später, wenn wir dann in Jan‘s Paradies angekomen sein sollten, wird es zunächst schwere körperliche Arbeit für uns geben, um unsere neue Wohnstätte herzurichten und für den langen Winter, der dann garantiert folgen wird, vorzusorgen. Der Krieg wird sicher noch eine ganze Weile dauern, bis hier nach Kanada wird er wohl kaum kommen. Die Nazis können ja nicht die ganze Welt besetzen.
Das ist es also. Unsere Flucht soll Wirklichkeit werden.
Die Geheimhaltung ist oberste Pflicht, das ist selbstverständlich. Wir verhalten uns nicht anders als sonst. Wir ziehen uns nicht zurück in unsere Bude. Wir spielen weiterhin Skat, wenn der angesagt ist, aber wir machen unsere Arbeit, die der Fluchtvorbereitung zu dienen hat. Noch haben wir Zeit, der Ausbruch ist fuer Mai 1942 geplant. Ich gebe allerdings zu, dass ich nur wenig zu den Vorbereitungen beitragen kann. Diese liegen in Händen von Walter und Jan. Die haben die notwendigen Erfahrungen. Eingeweiht bin ich in alles. Immerhin kann ich mit einigen verschiedenen Bauzeichnungen für unsere zukünftige Behausung aufwarten. Welche wir dann erwählen, werden wir vor Ort entscheiden.
Walter und Jan haben eine lange Liste erstellt, die wird immer wieder vervollständigt, manchmal auch einiges wieder gestrichen. Alles muß in den Flieger zusätzlich zu uns drei noch hineinpassen und auch das Gewicht darf nicht überschritten werden. Walter fertigt eine neue Skizze an und nimmt Jan seine als Vorlage. Als Margret Ende Januar wieder zu Besuch kommt, kann Walter ihr diese zustecken und ihr sagen, dass Josef bei Gelegenheit, wenn er wieder in die Gegend unseres zukünftigen Fluchtortes fliegen muß, dann soll er Jan’s Paradies ausfindig machen, ein paar Kurven drehen und sich selber Aufzeichnungen machen.
Im Februar 1942 übergibt Margret an Walter die Aufzeichnungen von Josef. Der ist in der Region gewesen, sogar am Ort auf dem schmalen, zugfrorenen See auf Kufen gelandet, nachdem er sich vorher bei den Indianern etwas schlau gemacht hat. Einige Leute dort im Reservat kennen das Tal, das Jan sein Paradies nennt. Sie kommen so gut wie gar nicht mehr dort hin, da es mit dem Kanu schlecht zu erreichen ist, außerdem läge es außerhalb des Reservats. Josef berichtet weiter, dass das Tal nur schwer zugänglich sei. Der nicht sehr breite See darin einen sehr engen Flußzulauf hat und auf der anderen Seite des Tals der Ablauf aus dem See ebenfalls nur einige Meter breit sei. Um den See herum gäbe es teilweise lichten Fichten- und Laubwald, aber auch stärker bewaldetes Gelände, das ziehe sich über die gesamten, nicht sehr steilen Höhen des Talrandes, hin. Wie man jedoch ein Flugzeug dort verstecken könnte, damit es aus der Luft nicht sofort sichtbar sei, das wolle er beim nächsten Flug noch erkunden.
Das sind schon mal gute Nachrichten für uns und die Spannung nimmt langsam zu. Ich muß zugeben, der Aufgeregtere von uns bin ich. Ich habe gar keine richtige Vorstellung von dem Ort, den wir in absehbarer Zeit bewohnen wollen. Wird es gutgehen? frage ich mich schon mal öfters. Wir wollen drei kleine Hütten dort errichten. Für jeden eine. Walter wird dort manchmal Besuch von seiner Frau empfangen. Josef wird sie dort absetzen, wenn er in das Reservat fliegt. Das muß von Margret besonders geplant werden. Ihr Mann ist aus dem Camp abgehauen und sie läßt sich in Abständen von Josef regelmäßig irgendwohin fliegen. Das wird früher oder später irgendjemanden auffallen. Dann ist unsere Sache wahrscheinlich geplatzt. Walter ist darüber nicht beunruhigt, denn er weiß, dass seine Frau nicht auf den Kopf gefallen ist. Sie wird das schon so organisieren, damit niemand Verdacht schöpft, und im März 1942 erlebt Walter dann seine große Überraschung: Margret teilt ihm mit, dass sie ihre Fluglizenz vor kurzem erworben und bereits einen Flug in Begleitung von Josef zu unserem zukünftigen Ort gemacht hat. Da man ihr einen Piloten genommen hatte, war sie in Sorge gewesen, dass auch Josef bald folgen könnte. Dies war der Grund, sich selbst als Pilotin ausbilden zu lassen. Die Sorge war allerdings grundlos gewesen. Josef wurde als nicht tauglich eingestuft, weil ihm zwei Zehen fehlten. Die waren ihm in seiner Kindheit erfroren und amputiert worden.
Draussen machen sich schon die Frühlingsboten bemerkbar, als im April 1942 Margret die Nachricht bringt, alles sei bereitgestellt anhand von Walters Liste. Der Tag unseres Abflugs sollte der zweite Sonntagmorgen im Mai sein. Einen Tag später wollte Margret das Flugzeug dann als gestohlen melden.
Uns ist längst bekannt, an welcher Stelle wir das Camp verlassen wollen. Es muß natürlich nachts geschehen, in der Nacht zwischen Sonnabend und Sonntag. Das Camp, mit einem zweieinhalb Meter hohen Stacheldrahtzaun umgeben, hat wohl mehr symbolischen Charakter. Will einer unbedingt nach draußen, dann könnte er es tun. Entweder klettert er über den Zaun, zerreißt sich ein wenig seine Klamotten oder er buddelt sich bei Nacht unter den Zaun durch. Es ist nicht so, dass Tag und Nacht gewehrbewaffnete Wachen ihre Runden durch das Camp drehen. Das machten die Kanadier nur sporadisch am Anfang unserer Internierung. Es gibt einen Wachturm, auf dem wohl immer einer Posten schieben soll, doch meistens ist der unbesetzt. Man sitzt lieber am Haupteingang in der warmen Wachstube und wartet auf die Ablösung. Es hat bisher noch nie einen Ausbruch gegeben. Wo will er denn auch hin, der Internierte. Ihm geht es doch gut. Er hat sein gutes und schmackhaftes Essen, eine warme Bude, braucht nicht zu arbeiten und kann sich gegen Langeweile ja was einfallen lassen.
Allerdings hat es mal eine kurzfristige Episode gegeben, die sogar in den regionalen Zeitungen groß rauskam und in unserem Camp und in der Außenwelt für Lachanfälle und amüsiertes Schmunzeln sorgte und da waren denn auch einige Seeleute von meinem ehemaligen Dampfer beteiligt gewesen: Man hatte einen kanadischen Wachposten bestechen und überreden können, abends dann und wann mal für etwas Unterhaltung zu sorgen und ein paar leichte Damen einzuladen. Diese nahmen dann ihre Geschäfte im Besucherzimmer am Eingangstor war. Es ist zwei Monate gutgegangen, dann flog die ganze Sache auf und jener Wachposten durfte seinen Hut nehmen. Möglich, dass er dann an irgendeine Kriegsfront versetzt wurde, es wurde so darüber gemunkelt.
Unser Steigflug ist schon lange beendet, der Motor ist leiser geworden. Auf ebenen Kiel, wie man in meiner Branche sagt, überfliegen wir nun die Landschaft, die ich aus dieser Perspektive noch nie sah. Als Walter in eine leichte Backbordkurve geht, kann ich aus dem Fenster zu meiner Linken einen breiten Fluß erkennen. Später erfahre ich, dass es der Ottawa River war. Wälder, Seen und Flüsse wechseln sich unter uns ab. Ein laufendes Farbenspiel. Pure Natur, ohne Ansiedlungen weit und breit. Wald und nochmals Wald. Seen und nochmals Seen, kleine und große Flüsse, die in die Seen hinein- und auch wieder hinaustreten. Die Seen mal in den Farben Blau, graue und grüne Seen und einige ganz dunkel, fast schwarz.
Jan ist hinter Walter getreten. Sie unterhalten sich. Ich bleibe in meiner Position am Boden hocken, sehe mir aber jetzt interessiert das Innere des Fliegers an. Ein sehr schmaler Gang in der Mitte, von der Eingangstuer bis nach vorne, ist geblieben. Ansonsten ist nach achtern hin und an den Seiten auf den Sitzen alles vollgestaut und wie ich als Fachmann feststellen muß, auch anständig gegen das Verrutschen gelascht. Ist ja alles ähnlich wie auf einem Dampfer. Der kann zukehr gehen und im Flugzeug mag es manchmal auch recht ordentlich schaukeln. Auf See fährst du deinen Kurs und hier fliegst du den Kurs. Navigation muß der Pilot, je nach Größe seines Flugradius, wohl ebenso beherrschen, wie ich als Steuermann in der kleinen und in der großen Fahrt.
Wir haben etwas vergessen, ich fühle es jetzt, als sich bei mir Hunger- und Durstgefühl bemerkbar macht. Proviant haben wir nicht eingepackt, etwas zu trinken auch nicht. Es wäre auch kaum noch Platz in unseren vollgestopften Rucksäcken gewesen. Für Walter und mich habe ich neue Rucksäcke genäht aus organisiertem Segeltuch und aus meinem ehemaligen Seesack. Jan seinen alten Rucksack vergrößerte ich einfach ein wenig. Zu meinen Utensilien, die ich immer noch mit mir führe, gehören ein Segelhandschuh, Segelnadeln, eine Rolle Segelgarn und Bienenwachs zum Imprägnieren des Garns. Das Segelnähen ist immer noch Teil der Seemannsausbildung, auch wenn es kaum noch Segelschiffe in Fahrt gibt. Dass ich diese Utensilien einmal für Fluchtrucksäcke gebrauchen müßte, ist mir nicht mal im Traum erschienen.
Jan hat sich wieder auf seinen Platz begeben. Er macht mir Zeichen, dass wir jetzt runtergehen. Walter dreht sich zu mir rum und gibt mir ebenfalls Zeichen mit der Hand, ich solle mich festhalten. Bisher war der Flug recht ruhig gewesen, die zwei Stunden in der Luft sind mir kaum bewußt geworden.
Wir sacken, ich fühle es in meinem Bauch. Vergleichbar wie bei schwerer See im Auf und Ab in den riesigen Wellen. Unser Flieger macht einige Luftsprünge, sackt immer weiter ab. Wir sind fast unten. Ich wage einen Blick durch mein Fenster. Unter uns nur Wasser. Dann fliegen wir über Land. Ich erkenne nur grünen Nadelwald, zwischendrin ein paar Laubbäume. Felsen, die aus den Bäumen hervorstechen. Die Bäume sind jetzt ganz nah, fast berühren wir sie, kommt es mir vor. Wir sind unten, die Bäume weichen zurück, kornblumenblaues Wasser. Dann setzt unser Flieger auf. Wasser spritzt an mein Fenster. Wir hoppeln über das Wasser. Der Motor ist fast verstummt, dreht noch im Leerlauf. Jan ist aufgestanden, haut mir mit seiner Pranke auf die Schulter und sagt mit seinem bekannten schiefen Grinsen: „Das war’s, Seemann, wir sind da im Paradies. Jetzt geht’s an die Arbeit.“
Walter hat den Flieger an das Ufer manöveriert. Die Schwimmerspitzen ruhen auf weichem Sandstrand. Wir steigen aus, klettern auf die Schwimmer und springen an Land. Wie auf Kommando gehen wir drei ein paar Schritte in verschiedene Richtungen.Wir entleeren unsere Blasen. Mein Strahl geht zum Fuße eines Magriten Strauchs. Die kenne ich, meine Mutter hat die in ihrem Garten. Wie die wohl hierher gekommen sein mögen in diese Wildnis. Ich mache Jan auf die Pflanze aufmerksam. Der sagt, solche gäbe es in dieser Gegend mehrfach. Er hat sie schon öfter bemerkt.
Wir sollen erst mal das Flugzeug leermachen und die Sachen das Seeufer hochschleppen und unter Bäumen lagern, sagt Walter. Einen kleinen Imbiß könnte man vorerst auch vertragen, meint er. Das meinen Jan und ich auch. Ich bin gespannt, was Walters Frau und Josef uns wohl alles eingepackt haben mögen. Immerhin sollte in all den Packen auch etwas Eßbares sein, nehme ich an. Sonst sähe es wohl zunächst schlecht aus mit der Versorgung unserer Mägen. Verdursten werden wir kaum, Wasser ist genug vorhanden.
Unter einer riesigen Fichte verzehren wir fertig geschmierte Butterbrote, Sandwiches, wie man sie hier nennt. Kaffee dazu, wäre dann der totale Genuß eines Frühstücks geworden. Wir nehmen erst mal mit Apfelsaft vorlieb. Margret hat uns in Vorsehung unserer wichtigen Anfangsaufgaben vorbereitete Eßwaren in einer Blechbox mitgeliefert. So können wir uns zunächst auf wichtigere Dinge konzentrieren ohne uns mit der Essenszubereitung aufhalten zu müssen. Ich muß an meine Mutter denken, die uns Kinder auch immer mit einem Stapel geschmierter Brote entließ, wenn es auf einen Ausflug ging. Margret wird uns irgendwann besuchen, dann, wenn genügend Gras über die Sache gewachsen ist. Josef wird bald eine Zwischenlandung einlegen, sobald er wieder in das Reservat fliegt und wird weiteres Material anliefern. Zunächst müssen wir uns mit dem behelfen, was wir mitnehmen konnten und was Margret und Josef für uns laut Walters Liste an Notwendigem im Flugzeug verstaut hatten.
Wir befinden uns in einem Tal, mittendrin ein schmaler See, der an seinen Enden immer enger wird und zuletzt durch eine Schlucht mit steilen Felswänden, von nur wenigen Metern Breite, nach draußen führt. Beide, Ein- und Ausgang, sind schlecht passierbar. Von der einen Seite wird dem See Wasser zugeführt und auf der anderen Seite fließt es wieder ab. Es ist nur eine schwache Strömung, die hier herrscht, dennoch ein stetes, leichtes Fließen. Beide Zugänge zum See wird man aus der Vogelperspektive nicht ausmachen können. Bäume stehen auf beiden Seiten so eng gegenüber, dass sie ein fast komplettes Dach bilden. Es ist ein einmaliges Versteck für unseren Flieger, auf das auch Jan und Josef bereits früher hingewiesen hatten und Walter sich daher für Jan sein Paradies mitbegeistern konnte. Nach unserem kurzen Mahl gehen wir dann auch sogleich an die Arbeit. Das Flugzeug muß unsichtbar gemacht werden.
Walter geht mit Propellerkraft erst mal wieder in freies Gewässer, nachdem Jan und ich das Flugzeug frei von Land gedrückt haben. Langsam manöveriert Walter das Flugzeug in Richtung Seeausgang in östliche Richtung, dorhin, wo wir eingeflogen sind. Jan und ich laufen auf dem schmalen Sand- und Geröllstrand hinterher. Das Flugzeug treibt auf die Enge zu. Jan und ich sind bereits im Schatten der Bäume angelangt. Einer von uns beiden muß auf die andere Seite des Wassers. Ich entscheide mich kurzentschlossen, laufe zum Anfang der Schlucht und finde einen Übergang. Auf rutschigen Klippen, die hier aus dem Wasser ragen, gelange ich, ohne ein Bad nehmen zu müssen, auf die andere Seite und muß wieder ein Stück zurücklaufen. Dieses Ufer ist mehr mit Geröll und abgestorbenen Bäumen bedeckt und ich muß manchmal klettern, bin aber früh genug an der Stelle, wo Walter mir eine Leine zuwerfen kann. Auf der anderen Seite hält Jan bereits seine Leine in der Hand. Walter hat beide am Flugzeug befestigt. Gemeinsam ziehen Jan und ich das Flugzeug weiter bis kurz vor den aus dem Wasser ragenden Klippen. Das Vertäuen des Flugzeuges nach beiden Seiten geschieht nach meinen Anweisungen, da bin ich nun wieder der Fachmann. Bäume zum Festmachen gibt es genug. Das Flugzeug schwimmt nun so, dass es frei von beiden Ufern im Wasser liegt, über sich ein zwar nicht wasserdichtes, aber doch ein Dach hat, durch welches nur ein paar Sonnenstrahlen sich den Weg suchen.