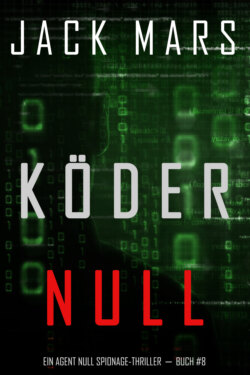Читать книгу Köder Null - Джек Марс - Страница 9
KAPITEL VIER
ОглавлениеMaria Johansson zog ihre Schlüsselkarte durch den vertikalen Schlitz in der Wand eines weißen Gangs aus Betonstein in einem Untergeschoss des CIA-Hauptquartiers in Langley. Man hörte ein lautes Summen, dann schob sich ein schwerer, elektronischer Bolzen zurück und schließlich entriegelte sich die Stahltür mit einem schweren Klonk.
Dies war nur eines der vier Untergeschosse unter dem George-Bush-Center für Geheimdienst - vier von denen sie wusste, es gab wahrscheinlich andere, die sie nicht kannte. Selbst als eine ehemalige stellvertretende Direktorin wurde sie nicht in alle Geheimnisse der Agentur eingeweiht. Sie war auch nicht naiv genug, um zu glauben, dass das jemals geschähe.
Trotzdem grenzte es an ein kleines Wunder, dass ihre Schlüsselkarte noch funktionierte. Nachdem sie letzten November die chinesische Rebellengruppe und ihre Ultraschallwaffe aufgehalten hatte, war sie von ihrem Posten zurückgetreten und hatte wieder ihr Leben als Geheimagentin aufgenommen. Sie hatten aber noch nicht den Zugang auf Geheiminformationen widerrufen, den sie in ihrer damaligen Stellung gehabt hatte.
Und sie war sich ziemlich sicher, dass sie den Grund dafür kannte.
Maria drückte die Tür hinter sich zu und nickte dem Sicherheitswärter im grauen Anzug zu, der hinter einem beigen Schreibtisch saß und eine Sportzeitschrift las. „Guten Morgen, Ben.“
„Ms. Johansson.“ Der ehemalige Agent machte keine Anstalten, sich zu bewegen, geschweige denn ihren Ausweis zu überprüfen und ihre Schlüsselkarte zu scannen.
„Sollte ich mich anmelden…?“, fragte sie nach einem Moment peinlicher Stille.
Ben grinste. „Ich glaube, ich kann mich seit letztem Donnerstag noch daran erinnern, wie Sie aussehen.“ Er zeigte mit dem Kinn in Richtung Gang. „Gehen Sie einfach nach hinten.“
„Danke.“
Die Absätze ihrer Stiefel klackten gegen den gekachelten Boden und hallten aus leeren Zellen wider, während sie auf die letzte links in dem Gang zulief. Es gab keine anderen Gefangenen in diesem Untergeschoss, es sollte eigentlich ein vorübergehender Haftraum sein, in dem man normalerweise einheimische Terroristen, Kriegsverbrecher, Deserteure und den gelegentlichen verräterischen Spion verwahrte. Es war ein kurzer Halt auf dem Weg zu viel schlimmeren Orten, wie Hölle Sechs in Marokko - oder ein einfaches Loch in der Erde.
Sie hasste es, Null anzulügen. So nannte sie ihn dieser Tage, Null. Er hatte sie letzten Monat darum gebeten, ihn nicht mehr Kent zu nennen. Es nannte ihn sowieso niemand bei seinem ehemaligen CIA-Alias, er war einfach nicht mehr Kent Steele. Und fast niemand, mit dem er regelmäßig zu tun hatte, nannte ihn bei seinem wirklichen Namen, Reid Lawson. Er war einfach Agent Null. Verdammt, selbst der Präsident nannte ihn Null. Also tat Maria es auch.
Obwohl „Papierkram“ technisch gesehen keine Lüge ist, dachte sie still bei sich. Es war ihr Codewort für „es ist ein Geheimnis und ich würde es bevorzugen, wenn du mich nicht danach fragst.“ Gerade letzte Woche hatte er selbst den Mädchen erzählt, dass er nach Kalifornien ginge. Ihr hatte er gesagt, dass er sich um etwas „Papierkram“ kümmern müsste.
Also stellte sie keine Fragen. Nun ja, sie hatte ihn an diesem Morgen ganz schön gedrängt, doch es war nicht ernst gemeint. Außerdem: was sonst hätte sie ihm sagen sollen? Seit ein paar Monaten besuche ich einen CIA-Gefangenen und Mörder und es ist mir peinlich, es zuzugeben.
Natürlich nicht. Das klang fürchterlich.
Die Zelle war dreieinhalb auf dreieinhalb Meter groß. Der Boden und die Decke waren aus Zement und die Wände waren nicht vergittert, sondern bestanden aus vier Zentimeter dickem Sicherheitsglas. Ein Bereich mit Löchern mit einem Zentimeter Durchmesser an der Seite des Ganges ermöglichte das Gespräch mit dem Gefangenen darin. Es gab keine Fenster, doch noch viel schlimmer war es, dass man keine Tür erkennen konnte. Maria war sich nicht einmal sicher, wie man in die Zelle kam. Eine versteckte Platte in einer der Glaswände wahrscheinlich, doch es war absolut nicht erkennbar. Das war ein psychologischer Trick, um dem Gefangenen zu zeigen, dass es wirklich keine Flucht gab.
Marias Herz brach jedes Mal ein wenig, wenn sie diese Glaswand sah. Obwohl außer Ben, dem Wächter, sonst niemand da war - wahrscheinlich im ganzen Untergeschoss nicht - hatte man so keine Privatsphäre. In der Zelle stand eine kleine Pritsche mit Decke und Kopfkissen, ein winziger WC-Bereich mit einem Waschbecken, einer Toilette und einem Duschkopf - alles stand offen da - und ein einzelner Stahlstuhl, der in den Boden verschraubt war.
Doch heute saß die Bewohnerin der Zelle im Schneidersitz auf dem kalten Zementboden in der Mitte der Zelle. Dies war der offenste Teil ihres winzigen Lebensraumes. Maria nahm an, dass sie sich so ein Gefühl von Freiraum verschaffte.
„Guten Morgen“, sagte Maria. Sie musste ein wenig lauter als normal sprechen, damit das Mädchen sie durch die Löcher in der Glaswand hören könnte.
„Hallo.“ Zu Beginn drehte sich Mischa nicht, um sie anzusehen. Doch so war sie, so hatte sie sich benommen, seit Maria anfing, sie zu besuchen. Sie spielte die Unnahbare, zumindest für eine kleine Weile. Vielleicht stimmte das auch nicht, sondern sie gewöhnte sich an Maria.
Das Mädchen war zwölf, blond und hatte grüne Augen. Maria fand sie hübsch, doch die ausdruckslose Fassade, die sie für gewöhnlich trug, ließ ihre Gesichtszüge flach wirken. Sie trug einen einfachen blauen Polyester/Baumwoll-Krankenhauskittel, wie eine Schwester in der Notaufnahme. Er hatte keine Taschen oder Reißverschlüsse, nichts aus Metall.
Sie war barfuß. Normalerweise war ihre Laune missmutig, sie sprach wenig und konnte einen Mann, der drei Mal so groß wie sie war, ohne großen Aufwand töten. Das letzte Mal, als Maria sie ohne eine vier Zentimeter dicke Glaswand zwischen ihnen gesehen hatte, hatte sie tatsächlich versucht, sie und Null umzubringen.
„Ich habe dir was mitgebracht”, sagte Maria auf Russisch. Sie war sich nicht sicher, woher das Mädchen ursprünglich kam, doch sie sprach Englisch perfekt akzentfrei. Während vieler Besuche hatte Maria entdeckt, dass sie ebenso gut in Russisch, Ukrainisch und Chinesisch war.
Auf der Höhe von Marias Ellenbogen befand sich eine rechteckige Klappe in der Glaswand mit einer Schlinge als Griff. Sie zog sie auf und legte das Croissant hinein, das sie zuvor aus Nulls Wohnung mitgenommen hatte. Die Klappe auf der anderen Seite - auf Mischas Seite - war so eingestellt, dass sie nicht zur gleichen Zeit geöffnet werden konnte. Nicht, dass das etwas ausmachte. Das Mädchen nahm niemals etwas von dem Essen an, das sie mitbrachte, bis Maria wieder weg war.
„Das sollte noch warm sein“, fügte sie hinzu.
„Spasiba,“ sagte Mischa, fast unmerklich. Danke.
„Bekommst du genug zu essen?“
Das Mädchen zuckte nur mit einer Schulter.
Maria schloss ihre Augen für einen Moment, um die Tränen herunterzuschlucken, die plötzlich aus ihr strömen wollten. Sie wusste nicht, warum sie bei jedem Besuch so rührselig wurde. Mindestens ein Mal bei jedem Besuch überkam sie eine Welle tiefster Traurigkeit darüber, dass ein so junges Mädchen in einer Haftzelle im Untergeschoss saß.
Mischa hatte der chinesischen Gruppe mit der Ultraschallwaffe angehört. Ihr Vormund war eine rothaarige Russin gewesen, eine ehemalige Geheimagentin namens Samara, die zu den Chinesen übergelaufen war, um einen Terroranschlag auf amerikanischem Boden zu planen, der wie ein Angriff der Russen aussehen sollte. Samara und ihre Kollegen waren jetzt tot. Nur Mischa hatte überlebt. Allerdings hatte sich kein Land der Welt wegen ihr gemeldet. Die ganze Welt stritt jede Kenntnis von ihr ab.
Der hauptsächliche Grund, warum sie weiterhin hier in Langley im Untergeschoss blieb, war sicherlich nicht, dass die CIA sie nicht ins marokkanische Geheimgefängnis gesteckt hätte. Nein, es lag daran, dass die Agentur einfach nicht beweisen konnte, dass sie wirklich ein Verbrechen begangen hatte. Niemand im Team - weder Null noch Strickland und ganz sicher nicht Maria - hatten gegen sie ausgesagt oder über ihre Handlungen gesprochen.
Sie wussten einfach nicht, was tun mit einem möglicherweise gefährlichen, hochtrainierten und definitiv tödlichen Kind, das man vermutlich einer Gehirnwäsche unterzogen hatte. Deshalb blieb sie hier.
Doch Maria konnte nichts davon sehen. Sie sah einfach nur ein Mädchen, das ihr während der letzten paar Monate gelegentlich eine Verletzlichkeit gezeigt hatte, die bewies, dass sie immer noch ein Mensch war.
„Was ist denn?“, fragte Mischa.
Maria bemerkte, dass ihre Augen immer noch geschlossen waren. Sie öffnete sie und lächelte, als sie sah, wie das Mädchen sie fragend anblickte. „Also … um ehrlich zu sein, bin ich traurig.“
„Warum.“ Es klang mehr wie eine Aussage als eine Frage.
„Ich bin traurig für dich“, erklärte Maria. „Dass du hier sein musst.“
„Ich war schon an schlimmeren Orten“, erwiderte das Mädchen.
„Das ist keine Entschuldigung dafür“, sagte Maria streng. „Du hast Besseres verdient. Du bist kein Tier. Vielleicht …“ Sie hielt inne. Vielleicht kann ich eine Zelle mit einem Fenster für dich aushandeln, wollte sie eigentlich sagen.
Aber es wäre immer noch eine Zelle.
Maria hatte begonnen, das Mädchen ein paar Tage nach ihrer Verhaftung zu besuchen. Seitdem kam sie zwei Mal wöchentlich. Während der ersten paar Besuche hatte Mischa sie nicht mal angesehen. An ein Gespräch war überhaupt nicht zu denken. Die nächsten paar Besuche danach hatte Maria damit verbracht, das Mädchen davon zu überzeugen, dass sie es nicht foltern oder quälen würde. Maria wollte keine Informationen. Sie wollte überhaupt nichts vom früheren Leben des Kindes wissen, das war die absolute Wahrheit. Die Zelle wurde sowohl durch Video- als auch Audioaufnahmen überwacht. Jegliche Erwähnung von Mischas Vergangenheit könnte Indiskretionen enthüllen, die ihr einen Flug ohne Rückfahrkarte zu einem viel schlimmeren Ort verschaffen könnten.
Maria hatte sieben Wochen gebraucht, um herauszufinden, dass die Lieblingsfarbe des Mädchens violett war, und dass sie Tootsie Rolls Süßigkeiten mochte - allerdings hatte sie auch den starken Verdacht, dass Mischa noch niemals eine andere Süßigkeit probiert hatte. Deshalb hatte sich Maria dazu entschlossen, ihr welche mitzubringen. So war es zu einem Ritual geworden, ihr ein Häppchen Essen mitzubringen und es ihr - mit der Erlaubnis des Wächters Ben - durch die kleine, rechteckige Tür in der Zelle zu schieben.
Maria wusste, dass sie beobachtet wurde, aber es war ihr egal. Sie war sich sogar ziemlich sicher, dass sie immer noch die Zugangsrechte einer stellvertretenden Direktorin hatte, weil sie das Mädchen besuchte. Solange sie dies in ihrer Freizeit tat, mussten alle anderen nur zuhören, aufpassen und hoffen, dass sich daraus Informationen ergaben.
Maria setzte sich im Schneidersitz auf den Boden direkt hinter der Glaswand, ihre Knie berührten sie fast. „Hast du Lust auf ein Spiel?“
Mischa blickte sie einen langen Moment aus ihrem Augenwinkel an. „Was denn für ein Spiel?“
„Es heißt: ,Ich habe noch nie.‘ Kennst du das?“
Das Mädchen schüttelte ein wenig den Kopf.
„Es ist ganz einfach. Halte drei Finger hoch. So.“ Maria wusste, dass das Mädchen nicht offen sprechen würde, doch sie hoffte, dass sie die Kleine dazu bringen würde, sich ein wenig zu öffnen, indem sie ein paar Fragen als ein Spiel tarnte. „Ich fange an. Ich sage etwas, das ich noch nie getan habe, doch das ich gerne tun würde. Wenn du das schon gemacht hast, dann nimmst du einen Finger herunter. Dann sagst du etwas, das du noch nie getan hast. Wenn du alle Finger heruntergenommen hast, dann verlierst du.“
Mischa starrte eine Weile auf den Boden, lange genug, damit Maria dachte, dass ihre List vielleicht doch nicht so klug war, wie sie anfänglich gedacht hatte.
Dann hob das Mädchen langsam einen Arm hoch und streckte drei Finger aus.
„Gut. Ich fange an. Äh … ich war noch nie auf den Bahamas.“
Die drei Finger des Mädchens blieben oben.
„OK“, sagte Maria, „jetzt bist du dran.“
„Ich habe noch nie …“, murmelte Mischa, „Fußball gespielt.“
Maria bog langsam einen Finger herunter. „Hast du Lust darauf?“
Mischa nickte einmal.
„Hast du andere Kinder spielen gesehen? Oder im Fernsehen?“
„Im Fernsehen. Es sah aus, als würde es…“ Sie hielt einen Moment inne, als würde sie versuchen, sich an das richtige Wort zu erinnern. „Spaß machen.“
Maria verkniff sich ein Lächeln. Das war das größte Zugeständnis, das Mischa ihr bisher gemacht hatte. „In Ordnung. Ich bin dran. Ich habe noch nie Süßigkeiten gegessen, bis mir schlecht wurde.“
Das Mädchen runzelte seine Stirn. „Warum würdest du so etwas tun wollen?“
„Na ja, ich würde das nicht wollen, stimmt. Aber manchmal übertreiben es die Leute einfach ein wenig.“
Mischas hielt weiter ihre drei Finger in die Luft. „Ich hatte noch nie eine Freundschaft.“
Maria biss sich schnell auf die Lippe, um das Keuchen zu unterdrücken, das ihr fast entfloh. Sie hatte nicht mit so viel Aufrichtigkeit gerechnet. Das traf sie unvorbereitet und erdrückte ihr Herz wie ein Schraubstock.
„Das tut mir leid“, sagte sie sanft und nahm ihren zweiten Finger herunter. „Vielleicht sollten wir aufhören.“
„Aber ich gewinne.“
Da machte sich ein ungewolltes Lächeln auf Marias Lippen breit. „Du hast recht. Das stimmt. OK. Äh … ich habe noch nie einen Garten angelegt.“
Ihre drei kleinen Finger blieben oben und Maria hielt den Atem an, gespannt über das, was sie als nächstes sagen würde.
„Ich habe noch nie meine Mutter kennengelernt.“
Maria atmete langsam aus. Das war eine fürchterliche Aussage, doch sie überraschte sie nicht sehr. Sie hatte sich schon vorgestellt, dass Mischa vermutlich ausgesetzt worden war oder verwaist war, vielleicht sogar von den Chinesen oder Samara - oder von der Gruppe, die sie trainiert hatte - gekidnappt worden war. Sie nahm ihren letzten Finger herunter und legte ihre Hände in ihren Schoß.
„Du hast gewonnen“, sagte sie. Das Spiel war ein kompletter Fehlschlag gewesen. Davon abgesehen, dass sie Fußball spielen wollte, hatte Maria nur herausgefunden, dass das Leben des Mädchens so schrecklich war, wie sie zuvor angenommen hatte. Schön wär’s…
„Mischa“, sagte sie plötzlich. „Ich kann dir nicht versprechen, dass du jemals deine Mutter kennenlernen wirst. Aber ich kann dir andere Dinge versprechen. Ich kann dir versprechen, dass du nicht für immer hier bleiben musst.“ Sie sprach schnell, als ob sie Angst hätte, dass ihr die Worte ausgingen, falls sie ihren Redefluss unterbräche. „Du wirst Fußball spielen und Freunde haben … und … und … du kannst so viele Süßigkeiten essen, bis dir schlecht wird, wenn du magst. Du kannst all das haben.“ Maria blinzelte, weil ihr Tränen in den Augen standen. Sie war überrascht über die ganzen Versprechen, die sie gemacht hatte, und bereute es sofort. Sie würde es versuchen, aber sie konnte eigentlich gar nichts wirklich versprechen. „Du solltest all diese Dinge haben.“
„Wie kann ich dir glauben?“, fragte das Mädchen.
Maria schüttelte ihren Kopf. Sie wusste, dass sie nur noch alles schlimmer machen würde, falls sie versagen sollte. „Wir fangen klein an. Lass mich dir etwas mitbringen. Nicht nur Essen. Sag mir etwas, das du gerne hättest. Eine Beschäftigung? Ein … Spielzeug oder einen Ball … oder …?“ Sie hatte keine Ahnung, woran das Mädchen interessiert sein könnte.
Mischa dachte einen Moment nach. „Ein Buch.“
„Ein Buch?“
„Dostojewski.“
Maria lachte überrascht auf. „Du willst, dass ich dir Dostojewski mitbringe -?“
„Aufzeichnungen aus dem Untergrund.”
„Wow. Na … OK. Ja. Das mache ich. Versprochen.“ Maria stand auf. „Ich komme in ein paar Tagen zurück und bringe dir das Buch.“
„Danke, Maria.“ Es war das erste Mal, dass das Mädchen sie bei ihrem Namen genannt hatte. Es fühlte sich gut an, das zu hören, aber gleichzeitig auch irgendwie fremd.
„Und Mischa? Du lagst bei einer Sache falsch. Du hast eine Freundin.“
Maria ging den Gang zurück, ihre Absätze klackten gegen den Boden und hallten vom Beton wider. Sie drehte sich nicht um, blickte nicht zurück, doch sie hörte das typische Klicken der Stahlklappe, wo das Croissant lag, und lächelte.
Sie hatte keine Ahnung, wie sie jemanden davon überzeugen konnte, Mischa freizulassen oder ihr zumindest ein wenig Privatsphäre und Raum zu geben, doch sie würde ihr Bestes geben, es zu versuchen. Das Mädchen hatte ihr die ersten deutlichen Anzeichen gegeben, dass sie nicht komplett indoktriniert, sondern immer noch einfach nur ein Kind war. Ein Mädchen, das Freunde und eine Familie wollte, das Fußball spielen wollte.
Maria würde das für sie arrangieren. Sie konnte die Versprechen, die sie so überstürzt gemacht hatte, nicht wieder zurücknehmen. Es gab keine andere Wahl: sie musste sie halten.