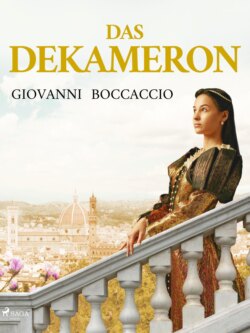Читать книгу Das Dekameron - Джованни Боккаччо - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
NEUNTE GESCHICHTE
ОглавлениеBernabo von Genua verliert durch Ambrogiuolos Betrug sein Vermögen und befiehlt, daß seine unschuldige Frau getötet werde. Sie entkommt und dient in Männerkleidern dem Sultan. Dann entdeckt sie den Betrüger und veranlaßt Bernabo, nach Alexandrien zu kommen. Der Betrüger wird bestraft, und sie kehrt, wieder im Frauengewand, mit ihrem Manne reich nach Genua zurück.
Als Elisa durch die rührende Geschichte des Grafen von Antwerpen ihre Pflicht erfüllt hatte, sann Filomena, die Königin, die schön und von schlanker Gestalt war und deren Gesichtszüge noch mehr Anmut und Freundlichkeit hatten als die der andern, einen Augenblick nach und sagte dann: „Wir müssen dem Dioneo schon Wort halten, und so will ich denn, da nur er und ich noch zu erzählen haben, meine Geschichte zuerst vorbringen, und er mag, wie er sich’s ausgebeten, der letzte sein, der für heute erzählt.“ Nachdem sie so gesprochen hatte, begann sie:
Im Volke geht das Sprichwort um: „Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.“ Dieses Sprichwort kann aber nur wahr sein, wenn es im Leben wirklich so zugeht. So ist mir eingefallen, euch, ohne mich dabei von der allgemeinen Aufgabe zu entfernen, an einem Beispiel zu zeigen, daß es auch wirklich so ist, wie man sagt. Laßt es euch nicht gereuen, meine Geschichte zu hören, aus der ihr lernen könnt, wie man vor Betrügern auf der Hut sein muß.
Es waren einmal in einem Wirtshaus zu Paris etliche italienische Großkaufleute zusammen, die um verschiedener Geschäfte willen, wie sie ihr Beruf mit sich bringt, dorthin gekommen waren. Diese begannen eines Abends nach fröhlich beendetem Essen allerlei Gespräche. Das eine brachte sie auf das andere, und so kamen sie endlich auf ihre Frauen zu sprechen, die sie daheim gelassen. Da sagte einer lachend: „Was meine tut, das weiß ich nicht. Das eine aber weiß ich wohl: wenn mir hier ein Dirnchen nach meinem Geschmack über den Weg läuft, dann lasse ich die Liebe zu meiner Frau links liegen und nehme alles mit, was ich von jener kriegen kann.“ Darauf sagte ein anderer: „Ich mach’s ebenso. Denn bilde ich mir ein, daß meine Frau sich derweil einen Zeitvertreib sucht, so tut sie’s; bilde ich’s mir nicht ein, so tut sie’s doch. Also ist es besser, man rechnet miteinander ab; wie der Esel in den Wald schreit, so schallt es wieder heraus.“ Die Meinung des dritten kam auf dasselbe hinaus, und mit einem Wort, die Anwesenden schienen alle darin übereinzustimmen, daß ihre zurückgelassenen Frauen die Zeit schwerlich ungenutzt lassen möchten.
Nur ein einziger, Bernabo Lomellino mit Namen und aus Genua, sagte das Gegenteil und versicherte, durch Gottes Gnade eine Frau zu besitzen, der alle Tugenden eines Weibes und mit wenigen Ausnahmen auch die eines Ritters oder Knappen in so hohem Maße zu eigen seien, daß sie vielleicht in ganz Italien nicht ihresgleichen habe. Denn sie sei schön von Gestalt und noch jung an Jahren, körperlich geschickt und rüstig, und es gebe keinerlei weibliche Arbeit, wie Seidenwirken und dergleichen, die sie nicht besser verstehe als jede andere. Ja überdies sei kein Knappe und kein Diener zu finden, welchen Namen er auch tragen möge, der besser und aufmerksamer als sie eine herrschaftliche Tafel zu bedienen wisse; denn in allen Dingen sei sie wohlerzogen, umsichtig und verständig. Endlich rühmte er noch an ihr, daß sie besser als ein Ritter zu Pferde sitze und den Falken halte und besser als ein Kaufmann zu lesen, zu schreiben und zu rechnen wisse. Von diesem und vielem andern Lobe kam er dann auf den Gegenstand des vorhergegangenen Gespräches und versicherte bei seinem Eide, daß keine sittsamere und keine keuschere Frau zu finden sei. Darum, fügte er hinzu, vertraue er fest darauf, daß sie sich niemals mit einem anderen Mann auf dergleichen Dinge einließe, selbst wenn er zehn Jahre lang oder immer vom Hause wegbliebe.
Unter den Kaufleuten, die also miteinander redeten, war ein junger Mann, Ambrogiuolo von Piacenza mit Namen, der über das Lob, das Bernabo seiner Frau zuletzt erteilt, überlaut zu lachen anfing und ihn höhnisch fragte, ob denn der Kaiser nur ihm vor allen andern dieses Vorrecht erteilt habe. Bernabo erwiderte nicht ohne Empfindlichkeit, Gott, der etwas mehr vermöge als der Kaiser, und nicht dieser, habe ihm solche Gnade verliehen. Darauf sagte Ambrogiuolo: „Bernabo, ich zweifle nicht daran, daß du selber die Wahrheit zu sagen glaubst. Mich dünkt aber, du hast den Lauf der Dinge nicht gehörig ins Auge gefaßt; denn hättest du es getan, so halte ich dich nicht für kurzsichtig genug, daß du nicht mancherlei wahrgenommen haben solltest, was dich veranlassen müßte, über derlei Dinge mit geringerer Zuversicht zu reden. Damit du aber einsehen mögest, daß wir, die wir uns vorhin über unsere Frauen so duldsam aussprachen, darum nicht der Meinung sind, wir hätten deren schlechtere oder anders geschaffene, als die deinige ist, will ich über diesen Punkt ein wenig mit dir reden. Ich habe immer gehört, der Mann sei das edelste unter den sterblichen Wesen, die Gott geschaffen, und erst nach ihm komme das Weib. In der Tat zeigt auch die Erfahrung, daß die allgemeine Meinung wahr und der Mann vollkommener ist. Besitzt er aber nun größere Vollkommenheit, so muß er ohne Zweifel auch mehr Festigkeit und Beständigkeit haben; denn die Weiber sind in allem veränderlicher, wofür sich mancherlei natürliche Gründe angeben ließen, die ich aber jetzt beiseite lassen will. Hat nun der Mann größere Festigkeit und kann er sich dennoch nicht enthalten, nach einer jeden zu verlangen, die ihm gefällt, geschweige denn einer, die ihn bittet, zu willfahren, kann er sich weiterhin nicht enthalten, über dieses Verlangen hinaus alles zu tun, was in seinen Kräften steht, um in ihren Besitz zu gelangen, was alles ihm nicht einmal im Monat, sondern täglich tausendmal begegnet — wie willst du von einem Weibe, das seiner ganzen Natur nach veränderlich ist, erwarten, daß es den Bitten, Schmeicheleien und Geschenken, daß es den tausend anderen Mitteln widerstehen werde, die ein erfahrener Mann, wenn er verliebt ist, anwenden wird? Glaubst du wirklich, sie könne standhalten? Wenn du es mir auch versicherst, so glaube ich dennoch nicht, daß du davon überzeugt bist. Gestehst du doch selbst ein, daß deine Frau ein Weib ist und wie die andern aus Fleisch und Bein besteht. Ist dem aber so, dann muß sie dieselben Gelüste fühlen und hat nur dieselben Kräfte wie die andern, um jenen natürlichen Antrieben zu widerstehen. Du siehst mithin: so sittsam sie auch sein mag, immer besteht die Möglichkeit, daß sie tut, was die andern tun. Etwas Mögliches soll man aber niemals so hartnäckig verneinen oder das Umgekehrte behaupten, wie du es tust.“
Bernabo entgegnete ihm darauf: „Ich bin ein Kaufmann und kein Philosoph, kann dir also auch nur als Kaufmann antworten. So sage ich denn, daß ich wohl einsehe, wie es den Einfältigen, die kein Gefühl für Scham haben, so gehen kann, wie du da beschreibst. Die Verständigen aber sind um ihre Ehre so besorgt, daß sie in diesem Punkte stärker werden als die Männer, die darin ein loses Gewissen haben. Und zu denen gehört meine Frau.“
„Wahrhaftig“, sagte Ambrogiuolo, „wenn den Weibern jedesmal, wenn sie sich auf derlei Geschichten einlassen, ein Horn aus der Stirn wüchse, das Zeugnis ihrer Tat wäre, so möchten sich wenige damit abgeben. Nun wächst ihnen aber kein Horn, und wenn sie klug sind, ist keine Spur zu finden; Schande und Entehrung entstehen nur aus dem, was offenbar wird. So tun die Weiber denn, was sie im Verborgenen tun können, oder unterlassen es nur aus Albernheit. Darum sei überzeugt: nur die ist keusch, die entweder von niemand gebeten, oder wenn sie selbst gebeten hat, nicht erhört worden ist. So genau ich übrigens aus natürlichen und anderen Gründen weiß, daß sich alles so verhalten muß, wie ich dir sage, so spräche ich doch nicht mit solcher Zuversicht darüber, wenn ich nicht schon oft und bei mancherlei Frauen die Probe gemacht hätte. Deshalb sage ich dir denn: wäre ich nur bei deiner so ausbündig tugendhaften Frau, so wollte ich sie schön in kurzer Zeit zu dem bringen, wozu ich schon so manche andere gebracht habe.“
Bernabo antwortete verdrießlich: „Dies Herumstreiten mit Worten könnte sich sehr in die Länge ziehen. Du würdest reden, und ich würde reden, und am Ende käme doch nichts heraus. Weil du aber meinst, daß jede Frau so nachgiebig und dein Geschick so groß sei, so bin ich bereit, um dich von der Sittsamkeit meiner Frau zu überzeugen, mir den Kopf abschneiden zu lassen, wenn du sie jemals dazu bewegen kannst, dir in dieser Weise irgendwie zu Willen zu sein. Gelingt es dir aber nicht, so verlange ich von dir nichts als eine Buße von tausend Goldgulden.“
Ambrogiuolo, der sich über der Angelegenheit schon erhitzt hatte, erwiderte: „Bernabo, ich weiß nicht, was ich mit deinem Blut anfangen sollte, wenn ich gewänne. Hast du aber Lust, die Probe auf das zu machen, was ich dir gesagt habe, so setze gegen meine tausend Goldgulden fünftausend andere, die dir doch wohl nicht minder wert sein müssen als dein Kopf. Dann will ich nach Genua reisen und, obwohl du mir keine Zeit vorgeschrieben hast, binnen drei Monaten, von dem Tage meiner Abreise aus Paris an gerechnet, bei deiner Frau meinen Willen erreicht haben. Und zum Zeugnis will ich dir Dinge mitbringen, die sie besonders wert hält, und dir so viele Umstände und Beweise mitteilen, daß du selbst an der Wahrheit nicht mehr zweifeln sollst. Dabei bedinge ich mir nur das eine aus: daß du während dieser Zeit weder nach Genua kommst, noch ihr irgend etwas über diese Angelegenheit schreibst.“
Bernabo versicherte, damit völlig zufrieden zu sein, und so sehr die übrigen anwesenden Kaufleute sich bemühten, die Sache zu verhindern, weil sie das große Übel erkannten, das daraus entstehen konnte, so hatten sich jene beiden die Köpfe doch so erhitzt, daß sie sich wider den Willen der andern in förmlichen, eigenhändig geschriebenen Urkunden einander verpflichteten.
Nachdem diese Verschreibung gemacht war, reiste Ambrogiuolo nach Genua, so schnell er konnte, während Bernabo in Paris zurückblieb. Jener hatte aber kaum einige Tage in Genua zugebracht und sich unter vieler Vorsicht unter der Hand nach dem Namen der Straße und nach den Sitten der Frau erkundigt, als er nicht allein das, was Bernabo ihm gesagt, sondern noch viel mehr Gutes von ihr vernahm und die Fürwitzigkeit seines Unternehmens erkannte. Nichtsdestoweniger schloß er Bekanntschaft mit einem armen Weibe, das häufig in jenes Haus zu kommen pflegte und bei Bernabos Frau besonders wohlgelitten war. Da sich die Alte zu keinem weiteren Dienste verstehen wollte, bestach er sie endlich dahingehend, daß sie ihn in einer Kiste, die er künstlich zu seinen Zwecken eingerichtet, nicht allein in das Haus, sondern in das Schlafzimmer der Frau selbst tragen ließ. Die Alte mußte nämlich vorgeben, sie wolle über Land reisen, und jener die Kiste für einige Tage zum Aufbewahren empfehlen.
Als die Kiste in dem Zimmer stehengeblieben und die Nacht gekommen war, öffnete Ambrogiuolo zu einer Stunde, wo er vermuten konnte, daß die Frau schlief, das Behältnis durch den Druck einiger Federn und betrat leise das Gemach, das von einer Lampe erhellt wurde. Nun betrachtete er die Form des Raumes, die Malereien, welche ihn schmückten, und was sonst darin bezeichnend schien, aufs genaueste und prägte alles seinem Gedächtnis ein. Darauf näherte er sich dem Bett, und da er bemerkte, daß die Frau und das kleine Töchterlein, das neben ihr lag, fest schlief, deckte er sie völlig auf und sah, daß sie nackt ebenso schön zu nennen war wie bekleidet. Doch wußte er an ihrem Körper kein anderes Zeichen zu entdecken, das er ihrem Gatten anführen konnte, als ein Mal unter der linken Brust, um das ein paar goldgelbe Härchen standen. Sobald er dies gesehen, deckte er sie leise wieder zu, so großes Verlangen sich auch beim Anblick ihres schönen Körpers in ihm regte, sein Leben daran zu wagen und sich zu ihr zu legen. Da er aber gehört hatte, daß sie in solchen Dingen so übermäßig streng und ungefügig sei, wollte er es doch nicht darauf ankommen lassen. So verweilte er den größten Teil der Nacht nach seiner Bequemlichkeit in dem Zimmer, nahm sich aus einem Schreine noch eine Tasche, ein Staatskleid und ein paar Ringe und Gürtel, tat dies alles in seine Kiste und verschloß diese, nachdem er sich selbst hineinbegeben hatte, ganz wie zuvor. Dasselbe wiederholte er in der folgenden Nacht, ohne daß die Frau das mindeste bemerkt hatte.
Am dritten Tage kam das arme Weib nach der getroffenen Verabredung wieder, um ihre Kiste abzuholen, und trug sie dorthin zurück, woher sie diese gebracht hatte. Ambrogiuolo aber stieg sogleich heraus, belohnte das Weib seinem Versprechen gemäß und kehrte mit den genommenen Sachen noch vor Ablauf der bestimmten Frist nach Paris zurück. Hier rief er die Kaufleute zusammen, die bei dem Streit und der abgeschlossenen Wette zugegen gewesen waren, und erklärte in Bernabos Gegenwart, er habe die Summe, um welche sie damals gewettet, gewonnen und ausgeführt, was er zu tun sich gerühmt habe. Zum Beweis beschrieb er das Gemach und die Malereien in demselben und zeigte dann auch die Sachen vor, die er mitgebracht und von denen er behauptete, daß sie ihm dieselben geschenkt habe. Bernabo gestand, daß das Zimmer wirklich so aussähe, wie es jener beschrieben, auch erkannte er jene Sachen als die seiner Frau; doch meinte er, Ambrogiuolo könnte leicht von einem Dienstboten des Hauses die Beschreibung des Zimmers und auf gleichem Wege auch die Sachen erhalten haben. Deshalb erachte er sich durch das Vorgebrachte, wenn jener nicht noch anderes hinzufüge, keineswegs für besiegt. Ambrogiuolo sagte darauf: „Wahrlich, du solltest dich damit begnügen; weil du aber verlangst, ich soll noch mehr sagen, so will ich es tun. Ich sage dir denn, daß Frau Ginevra, deine Gattin, unter ihrer linken Brust ein kleines Mal hat, um das wohl sechs goldgelbe Härchen herumstehen.“ Als Bernabo das hörte, war es ihm wie ein Messerstich durch das Herz, und die plötzliche Blässe seines Gesichts bekundete auch ohne Worte die Wahrheit dessen, was Ambrogiuolo gesagt hatte. Nach einer Weile sagte er: „Ihr Herren, was Ambrogiuolo berichtet, ist wahr. So hat er denn gewonnen und mag sich, wann es ihm beliebt, die Zahlung abholen.“
Wirklich wurde Ambrogiuolo schon am folgenden Tag vollständig bezahlt. Bernabo aber verließ Paris und zog voll bösen Blutes gegen seine Frau nach Genua. Als er in die Nähe der Stadt gekommen war, wollte er nicht hineingehen, sondern blieb wohl zwanzig Meilen davor auf einer Besitzung, die ihm gehörte, und sandte einen Diener mit zwei. Pferden und einem Briefe an seine Frau, in welchem er schrieb, er sei zurückgekehrt und sie solle ihm mit jenem entgegenkommen. Dem Diener aber erteilte er heimlich Befehl, die Frau ohne Erbarmen zu ermorden, sobald er mit ihr einen geeigneten Platz erreiche, und dann zu ihm zurückzukehren.
Als der Diener in Genua angelangt war, den Brief abgegeben und seine Aufträge ausgerichtet hatte, empfing ihn die Frau mit herzlicher Freude. Am andern Morgen stieg sie mit ihm zu Pferde und verfolgte den Weg nach jener Besitzung, bis sie unter mancherlei Gesprächen, die sie während des Reitens führten, in ein tiefes, einsames Tal gelangten, das Bäume und hohe Felswände rings umschlossen. Das schien dem Diener der gelegene Ort, um den Befehl seines Herrn ungefährdet ausführen zu können. Er zog sein Messer, faßte die Frau am Arm und sagte: „Madonna, empfehlt dem Herrgott Eure Seele, denn hier müßt Ihr sterben und dürft nicht mehr von der Stelle.“Als die Frau das Messer sah und die Worte des Dieners vernahm, rief sie voll Entsetzen: „Um Gottes willen, Gnade! Ehe du mich umbringst, sage mir, was ich getan habe, daß du mich morden willst?“ „Madonna“, entgegnete der Diener, „mir habt Ihr nichts zuleide getan. Worin Ihr aber Euren Gemahl beleidigt habt, davon weiß ich nicht mehr, als daß er mir befohlen hat, Euch auf diesem Wege ohne alles Erbarmen zu töten, und wenn ich es nicht täte, hat er gedroht, mich aufhängen zu lassen. Ihr wißt wohl, wieviel ich ihm verdanke und daß ich mich nicht weigern darf, zu tun, was er befiehlt. Weiß Gott, es ist mir leid um Euch; aber was soll ich tun?“ Darauf antwortete die Frau unter Tränen: „Ach, um Gottes willen, Gnade! Werde doch nicht um eines anderen willen an mir, die ich dir nie etwas zuleide getan, zum Mörder. Gott, der alles weiß, ist mein Zeuge, daß ich nichts begangen habe, um dessentwillen ich von meinem Manne solche Strafe verdient hätte. Aber lassen wir das. Du kannst dich, wenn du willst, um Gott, um deinen Herrn und um mich zugleich verdient machen; nimm hier meine Kleider und schenke mir dafür nur deine Jacke und deinen Mantel. Kehre mit den Kleidern zu meinem und deinem Herrn zurück und sage, du hättest mich umgebracht. Ich schwöre dir bei meinem Leben, das ich von dir als Geschenk erwarte, daß ich verschwinden und in ein anderes Land gehen will, und weder er noch du sollen in diesen Gegenden je das mindeste von mir hören.“
Der Diener, der sie ohnehin nicht gern töten wollte, ließ sich leicht zum Mitleid bewegen. Er nahm ihre Kleider, gab ihr seine alte Jacke und seinen Mantel, ließ ihr das wenige Geld, das er bei sich hatte, und nachdem er sie gebeten, jene Gegenden zu meiden, ließ er sie zu Fuß in jenem Tal zurück. Dann eilte er zu seinem Herrn und sagte ihm, er habe seinen Befehl nicht nur vollzogen, sondern auch mehrere Wölfe über den Leichnam herfallen sehen. Einige Zeit darauf kam Bernabo wieder nach Genua. Man erfuhr, was er getan, und tadelte ihn allgemein.
Inzwischen war die Frau einsam und trostlos zurückgeblieben und bei einbrechender Nacht, nachdem sie sich, so gut es sich tun ließ, unkenntlich gemacht hatte, in einer benachbarten Bauernhütte eingekehrt. Hier bekam sie von einer Alten, was sie brauchte, um die Jacke für ihren Körperbau passend zu machen. Aus ihrem Hemd nähte sie sich Hosen, schnitt sich die Haare ab und gab sich überhaupt das Aussehen eines Matrosen. In dieser Gestalt ging sie dem Meere zu. Da traf sie von ungefähr einen spanischen Edelmann, der Herr Encararch genannt ward und sein ihm gehörendes, in geringer Entfernung, bei Alba, vor Anker liegendes Schiff verlassen hatte, um sich an einer Quelle zu erfrischen. Mit diesem begann sie ein Gespräch, verdingte sich bei ihm als Diener und bestieg das Schiff, wo sie sich Sicurano von Finale nennen ließ. Der Edelmann versah sie nun mit neuen, besseren Kleidern. Sie aber wußte ihm in allem so gut aufzuwarten, daß der neue Diener ihm über die Maßen lieb wurde.
Nicht lange darauf schiffte der Spanier mit einer Warenladung nach Alexandrien und nahm unter anderem mehrere seltene Falken mit, die er dem Sultan zum Geschenk machte. Darauf lud ihn der Sultan einige Male zu Tisch, wurde, weil Sicurano immer mit bediente, auf dessen geschicktes Benehmen aufmerksam und fand daran solchen Gefallen, daß er ihn sich von dem Spanier erbat, was dieser, so leid es ihm tat, nicht abschlagen konnte. Sicurano gewann in kurzer Zeit durch sein gutes Betragen die Gunst und Liebe des Sultans nicht minder, als er zuvor die des Spaniers besessen hatte.
Darüber kam die Zeit heran, wo sich, wie alljährlich, zu Akkon eine große Anzahl christlicher und sarazenischer Kaufleute zu einer Art Messe versammeln sollte. Zu diesem Markt pflegte der Sultan, unter dessen Oberhoheit Akkon stand, außer mehreren anderen Beamten zur Sicherheit der Kaufleute und ihrer Waren stets einen seiner Großen und eine Anzahl Bewaffneter zu senden. Als nun diesmal die Zeit gekommen war, beschloß er, den Sicurano, der die Sprache bereits vollkommen beherrschte, mit diesem Amt zu betrauen, und wirklich führte er seinen Vorsatz aus. So wurde denn Sicurano Befehlshaber von Akkon und der vom Sultan zum Schutze der Kaufleute und ihrer Waren, dorthin gesandten Wache; und während er sein Amt auf das beste und sorgfältigste versah, wozu er aufmerksam umherging, traf er auf viele Kaufleute aus Sizilien, Pisa, Genua, Venedig und anderen Gegenden Italiens und ließ sich in der Erinnerung an sein Vaterland gern mit ihnen in trauliche Gespräche ein.
Da traf es sich unter anderm einmal, daß er in einem Kaufhause der Venezianer, welches er für einen Augenblick betrat, neben mancherlei anderem Schmuck eine Tasche und einen Gürtel gewahrte, die er schnell und voller Verwunderung als die seinigen wiedererkannte. Doch verbarg er sein Erstaunen und fragte höflich, wem sie gehörten und ob sie zu verkaufen wären. Ambrogiuolo von Piacenza nämlich war auf einem venezianischen Schiffe mit vielen Waren zu dieser Messe gekommen, trat, als er den Befehlshaber der Wache fragen hörte, wem die Sachen seien, lächelnd vor und sagte: „Herr, die Sachen gehören mir und sind nicht verkäuflich. Findet Ihr aber Gefallen daran, so mache ich sie Euch gern zum Geschenk.“ Als Sicurano ihn lächeln sah, fürchtete er schon, jener möchte seine Züge erkannt haben; doch hielt er sein Gesicht vollkommen in der Gewalt und sagte: „Du lachst wohl, daß ein Kriegsmann wie ich nach solchem Weiberzeuge fragt?“ „Herr“, antwortete Ambrogiuolo, „ich lache nicht darüber, sondern nur über die Art, wie ich zu den Sachen gekommen bin.“ Darauf sagte Sicurano: „Nun, beim Himmel, wenn nichts Unziemliches dabei ist, so möchte ich wohl, daß du uns die Geschichte erzähltest.“ „Herr“, entgegnete jener, „die Sachen, die Ihr da seht, und noch ein paar andere schenkte mir einmal eine Genueser Dame, Frau Ginevra genannt, die Gattin des Bernabo Lomellino, weil ich eine Nacht bei ihr geschlafen hatte, und bat mich, sie ihr zuliebe zu behalten. Nun mußte ich aber lachen, weil ich an Bernabos Torheit dachte, der dumm genug war, fünftausend Goldgulden gegen tausend zu setzen, daß ich von seiner Frau meinen Willen nicht erlangen würde. Sie gewährte mir aber alles, und ich gewann die Wette; und Bernabo, der lieber sich selbst für seine Dummheit als die Frau dafür hätte strafen sollen, daß sie getan, was alle Weiber tun, reiste von Paris nach Genua zurück und hat sie, wie ich späterhin vernommen, umbringen lassen.“
Als Sicurano das vernahm, verstand er den Grund von Bernabos Zorn und begriff, daß Ambrogiuolo die einzige Ursache aller seiner Leiden sei. Er sann darauf, den Betrug nicht ungestraft durchgehen zu lassen, stellte sich, als ob jene Geschichte ihm vielen Spaß gemacht, und wußte in kurzer Zeit mit Ambrogiuolo so vertraut zu werden, daß dieser am Ende der Messe zu seinem Vergnügen mit ihm nach Alexandrien fuhr. Hier richtete ihm Sicurano einen Laden ein und vertraute ihm von seinem eigenen Geld bedeutende Summen an, so daß Ambrogiuolo infolge des großen Nutzens, der ihm aus seinem Aufenthalt erwuchs, gern in Alexandrien verweilte.
Sicurano, der in alldem nichts anderes im Auge hatte, als Bernabo von seiner Unschuld überzeugen zu können, ließ nicht eher nach, als bis er durch Vermittlung einiger angesehener Genueser Kaufleute, die in Alexandrien wohnten, ihn unter allerlei Vorwänden bewogen hatte, dorthin zu kommen. Da Bernabo in ziemlich ärmlichen Umständen anlangte, ließ Sicurano ihn von einem seiner Freunde in der Stille beherbergen, bis ihm die Zeit zur Ausführung seiner Pläne günstig erschiene. Inzwischen hatte Sicurano den Ambrogiuolo schon veranlaßt, seine Geschichte vor dem Sultan zu erzählen und diesen dadurch angenehm zu unterhalten.
Als aber Bernabo angelangt war, meinte Sicurano, seine Unternehmung nicht weiter aufschieben zu dürfen. Er erbat vom Sultan die Erlaubnis, Ambrogiuolo und Bernabo vor ihn führen zu dürfen, damit in Gegenwart des letzteren Ambrogiuolo durch Güte oder Gewalt gezwungen würde, zu bekennen, wie es sich in Wahrheit mit dem verhalten habe, dessen er sich in bezug auf Bernabos Frau rühme. Ambrogiuolo und Bernabo erschienen vor dem Sultan, und in Gegenwart vieler befahl dieser dem ersten mit ungnädigem Gesicht, der Wahrheit gemäß zu gestehen, wie er von Bernabo die fünftausend Goldgulden gewonnen habe. Ambrogiuolo sah den Sicurano, auf den er am meisten baute, anwesend; doch auch dieser drohte ihm mit noch weit zornigerer Miene die größten Martern an, wenn er die Wahrheit nicht gestände. So sah sich denn Ambrogiuolo, von der einen wie von der andern Seite eingeschüchtert, ja mit Zwang bedroht, in Bernabos und vieler anderer Gegenwart genötigt, den ganzen Hergang der Sache klar und einfach zu erzählen, was ihn seiner Meinung nach nur verpflichtete, die fünftausend Goldgulden und die genommenen Sachen zurückzuerstatten. Sicurano aber wandte sich als ein vom Sultan berufener Richter sogleich an Bernabo und sagte: „Und was hast du um dieser Lüge willen deiner Frau angetan?“ Bernabo erwiderte: „Vom Zorne über das verlorene Geld und von der Scham über die Schande bewältigt, die meine Frau mir, wie ich glauben mußte, angetan hatte, ließ ich sie durch einen meiner Diener töten; und wie dieser mir berichtete, wurde ihr Leichnam von vielen Wölfen zerrissen.“
Alle diese Verhandlungen wurden in Gegenwart des Sultans gepflogen und von ihm vollkommen verstanden, ohne daß er gewußt hätte, zu welchem Zweck Sicurano dies alles veranstaltete. Dieser sprach indes folgendermaßen: „Mein Gebieter, Ihr seht nun wohl klar genug ein, was für eines Liebhabers und was für eines Mannes sich die gute Frau zu rühmen gehabt hat. Der Liebhaber bringt sie zu gleicher Zeit durch schmähliche Lügen um ihre Ehre und stürzt ihren Mann ins Unglück, und der Mann mißt den fremden Unwahrheiten größeren Glauben bei als der Wahrheit, die er durch lange Erfahrung selbst zu erkennen Gelegenheit gehabt, und läßt sie töten und von den Wölfen verschlingen. Und noch überdies ist die Liebe, die Liebhaber und Ehemann für sie empfinden, so groß, daß beide lange Zeit mit ihr Zusammenleben, ohne sie wiederzuerkennen. Damit Ihr aber in vollem Maße erkennen sollt, welche Strafe jeder von beiden verdient, so will ich, wenn Ihr mir dies als besondere Gnade gewähren wollt, daß der Betrüger bestraft, dem Betrogenen aber verziehen werde, die arme Frau selbst vor Euer Antlitz und vor jener Augen führen.“
Der Sultan, der in dieser Sache dem Sicurano allein gefällig zu sein wünschte, erklärte sich damit einverstanden und sagte, jener möge die Frau nur kommen lassen. Bernabo wunderte sich über diese Reden nicht wenig, da er seine Frau mit Gewißheit tot glaubte. Ambrogiuolo ahnte zwar schon sein Unglück und fürchtete Schlimmeres als die Erstattung des Geldes; auch wußte er nicht, was er von dem Erscheinen der Frau hoffen oder fürchten sollte; doch walteten auch bei ihm Neugier und Verwunderung vor.
Als nun der Sultan dem Sicurano seine Bitten gewährt hatte, warf dieser sich weinend vor ihm auf die Knie, gab in dem Augenblick, wo er nicht mehr als Mann gelten wollte, seine männliche Stimme auf und sagte: „Mein Gebieter, ich bin die arme unglückliche Ginevra und bin nun schon sechs Jahre lang in Männertracht durch die Welt geirrt, seit dieser Verräter Ambrogiuolo mich fälschlich, aber nur zu fühlbar beschimpft, und seit mein grausamer und ungerechter Gatte hier mich von einem seiner Diener hat umbringen und den Wölfen vorwerfen lassen wollen.“Bei diesen Worten riß sie ihr Gewand auf, zeigte ihren Busen und bewies dadurch dem Sultan und den anderen Anwesenden, daß sie ein Weib war. Dann aber wandte sie sich gegen Ambrogiuolo und fragte ihn im höchsten Zorne, wann er jemals, wie er sich gerühmt, bei ihr geschlafen habe. Ambrogiuolo erkannte sie wohl und war so beschämt, daß er schwieg, nicht anders als wäre er stumm geworden. Der Sultan, der sie immer für einen Mann gehalten hatte, geriet bei diesen Worten und bei diesem Anblick in solches Erstaunen, daß er mehrmals alles, was er sah und hörte, nicht für wahr, sondern für einen Traum halten wollte. Endlich aber legte sich sein Staunen, er erkannte die Wahrheit und zollte dem Leben, der Standhaftigkeit, den guten Sitten und Tugenden Ginevras, die bis dahin Sicurano genannt worden war, höchstes Lob. Dann ließ er ihr anständige Frauenkleider bringen, erfüllte ihre Bitte und umgab sie mit Frauen, die ihr Gesellschaft leisteten, und schenkte dem Bernabo sein verwirktes Leben. Dieser aber hatte sie kaum erkannt, als er sich weinend vor ihr niederwarf und sie um Verzeihung bat, die sie ihm denn auch, so wenig er sie verdient hatte, freundlich gewährte, indem sie ihn aufstehen hieß und ihn zärtlich als ihren Gemahl umarmte.
Darauf befahl der Sultan sogleich, daß Ambrogiuolo an einen erhöhten Platz der Stadt geführt, dort in der Sonne nackend an einen Pfahl gebunden und mit Honig bestrichen werde, um nicht eher von dort wieder losgebunden zu werden, als bis seine Gebeine von selbst aus den Banden fielen. Als dieser Befehl des Sultans vollzogen war, ließ er alles, was bisher dem Ambrogiuolo gehört, der Frau als ein Geschenk überantworten, und es fand sich, daß sein Vermögen nicht weniger als zehntausend Doublonen betrug. Dann ordnete er ein herrliches Fest an, bei welchem er den Bernabo als den Gatten der Frau Ginevra, diese selbst aber als ein Muster trefflicher Frauen ehrte und ihr an Schmuck, goldenen und silbernen Gefäßen und barem Gelde mehr denn zehntausend Doublonen an Wert schenkte. Als das Fest zu Ende war, rüstete er ein Schiff aus und beurlaubte sie, auf diesem nach Gefallen heimwärts zu reisen. So kehrten sie denn reich und froh in ihre Heimat zurück und wurden dort auf das ehrenvollste empfangen, besonders aber Frau Ginevra, die von allen tot geglaubt worden war und nun, solange sie lebte, wegen ihrer Tugenden und ihres Verstandes allgemein gerühmt ward.
Ambroguolo war noch am selben Tage an den Pfahl gebunden und mit Honig bestrichen worden und hatte nicht allein mit unsäglichen Schmerzen unter den Stichen der Fliegen, Wespen und Bremsen, deren sich in jenem Lande besonders viele finden, seinen Geist aufgeben müssen, sondern sein Leichnam ward auch bis auf die Knochen von ihnen verzehrt. So blieben die weißen Gebeine, von den Sehnen zusammengehalten, noch lange Zeit unangerührt, dem Vorübergehenden ein Zeugnis von Ambrogiuolos Bosheit, und so bewährte sich das Sprichwort: Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.