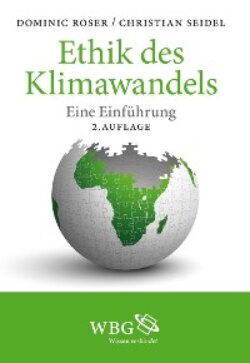Читать книгу Ethik des Klimawandels - Dominic Roser - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Darf man den Klimawandel leugnen? Eine kleine Klimaethik des Lobbyismus und Journalismus
ОглавлениеWir haben gesehen, dass es keine guten Gründe gibt, den moralischen Handlungsbedarf in Bezug auf den Klimawandel zu leugnen. Doch selbst wenn eine Meinung unvernünftig ist, so bedeutet das für sich genommen natürlich noch nicht, dass es auch verboten sein sollte, sie (etwa als Interessenvertreter) öffentlich zu äußern oder (etwa als Journalist) über diese Meinung zu berichten. Aber man kann sich doch fragen, ob an der Verbreitung von Positionen, die den Klimawandel leugnen, nicht doch etwas moralisch falsch sein könnte: Ist es nicht irgendwie anstößig, etwas in Zweifel zu ziehen, für das überwältigende wissenschaftliche Erkenntnisse sprechen? Ist es nicht gar gefährlich zu leugnen, dass der Klimawandel ein moralisches Problem darstellt, wenn dadurch entsprechende Klimaschutzmaßnahmen verzögert werden?
Von diesen Fragen nach dem moralischen Wert oder Unwert des Leugnens sind vor allem zwei Berufsgruppen betroffen: jene, die die politische Reaktion auf den Klimawandel direkt oder indirekt mitgestalten, sei es als Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, Verwaltung, Politik oder Interessengruppen; und jene, die über den Klimawandel und die Klimapolitik in den Medien berichten. In beiden Kontexten spielt die Berufung auf die Meinungsfreiheit eine ganz entscheidende Rolle: Wir sollten die Freiheit haben, selbst unvernünftige Meinungen zu vertreten und diskutieren. Wer beispielsweise glaubt, dass alle Schwäne schwarz sind, der glaubt etwas Falsches und Unvernünftiges. Aber natürlich ist es ihm nicht moralisch verboten, in der Öffentlichkeit zu behaupten, alle Schwäne seien schwarz. Die Meinungsfreiheit garantiert uns das Recht, unsere Meinungen (über Schwäne, historische Sachverhalte, politische Entscheidungen, das Verhalten von Personen oder fundamentale Werte) öffentlich zu äußern – selbst wenn diese Meinungen falsch sind. Und oft berufen sich Personen, die leugnen, dass der Klimawandel ein moralisches Problem darstellt (vor allem in der Variante, in der geleugnet wird, dass es so etwas wie den Klimawandel überhaupt gibt), auf die Meinungsfreiheit. Tun sie das zu Recht? Und wie sollte man mit der Leugnung des Klimawandels in der Öffentlichkeit umgehen?
Zunächst ist es wichtig zu sehen, dass die Meinungsfreiheit nicht grenzenlos ist. Hassreden gegen eine Bevölkerungsgruppe, das Leugnen des Holocaust oder der Aufruf zum Mord sind öffentliche Äußerungen, die nicht nur strafrechtlich verfolgt werden, sondern auch moralisch falsch sind. Offenbar stößt die Meinungsfreiheit also auf gewisse Grenzen. Nun ist es eine schwierige ethische Frage, wo genau diese Grenzen verlaufen bzw. was die Kriterien dafür sind, dass die öffentliche Äußerung einer Meinung verboten sein sollte. Es ist jedoch gar nicht nötig, an dieser Stelle einen umfassenden Kriterienkatalog für die Grenzen der Meinungsfreiheit zu entwickeln (vgl. für einen Überblick Anwander 2011), denn es scheint offensichtlich, dass das Leugnen des Klimawandels nicht auf einer Stufe steht mit einem Aufruf zum Mord oder dem Leugnen des Holocaust. Es braucht kaum Argumente dafür, dass die Leugnung des Klimawandels ein Themenbereich ist, in dem der Staat die Meinungsfreiheit nicht beschränken sollte. Wer also öffentlich die Meinung äußert, der Klimawandel finde gar nicht statt, der kann sich zunächst einmal zu Recht auf die Meinungsfreiheit berufen.
Nun ist es aber auch wichtig zu sehen, dass damit noch nicht alle Fragen beantwortet sind. Denn auch wenn es nicht darum geht, die Meinungsfreiheit in Bezug auf den Klimawandel einzuschränken und das Leugnen des Klimawandels von Staats wegen zu verbieten, so bleibt es noch immer offen, ob man von der Meinungsfreiheit, die einem in Bezug auf den Klimawandel grundsätzlich zusteht, auf richtige oder auf falsche Weise Gebrauch macht. Es verhält sich hier genauso wie mit anderen Freiheitsrechten auch: Es ist uns überlassen (und insofern haben wir die Freiheit), ob wir dem Gemeinwesen gegenüber gleichgültig sind oder uns dafür einsetzen, ob wir die musischen Talente unserer Kinder fördern oder nicht, oder ob wir mit unserem Beruf anderen Menschen oder nur unserem eigenen Geldbeutel dienen. Aber innerhalb des jeweiligen Freiheitsspielraums, der uns zusteht, gibt es bessere und schlechtere Optionen. Es ist moralisch gesehen nicht neutral, wie wir mit unserer Freiheit umgehen. Und so ist es auch in Bezug auf den Klimawandel: Wir sind frei, das eine oder andere öffentlich zu vertreten; aber vielleicht ist es besser, das eine zu vertreten als das andere. Auch wenn es von manchem Klimawandelleugner anders dargestellt wird: Es geht hier gar nicht um die Frage, ob man ein Recht hat, den Klimawandel zu leugnen oder nicht (insofern das unter die Meinungsfreiheit fällt, hat man dieses Recht natürlich). Worum es vielmehr geht ist die Frage, ob man von dem Recht auf Meinungsfreiheit richtig Gebrauch macht, wenn man den Klimawandel öffentlich leugnet.
In Bezug auf diese Frage stehen sich zwei Erwägungen gegenüber. Auf der einen Seite hat es grundsätzlich einen Wert für den Erkenntnisprozess und die Wahrheitsfindung, wenn man skeptisch und kritisch ist, einen geltenden Konsens öffentlich hinterfragt und die Gegenposition einnimmt. In dieser Hinsicht hat die Skepsis gegenüber dem Klimawandel etwas Gutes. Auf der anderen Seite liegt die Gefahr geistiger Brandstiftung nahe: Das Leugnen des Klimawandels hat negative Folgen. Es hinterlässt bei Öffentlichkeit und Politik den diffusen Eindruck, „dass das mit dem Klimawandel ja auch alles gar nicht so ganz sicher ist“ und trägt damit dazu bei, dass Klimaschutzmaßnahmen gar nicht oder erst verspätet umgesetzt werden. In dieser Hinsicht hat es etwas Schlechtes, wenn man skeptisch ist gegenüber dem Klimawandel. Wie muss man nun zwischen den beiden Erwägungen abwägen?
Unserer Ansicht nach muss man hier zwischen zwei Fällen unterscheiden: dem aufrichtigen und dem unaufrichtigen Leugnen des Klimawandels. Denn bei der ersten der genannten Erwägungen (Skepsis hat einen Wert für die Wahrheitsfindung) spielen die Motive, aus denen heraus man eine skeptische Position einnimmt, eine wichtige Rolle: Wenn man hinterfragt und den geltenden Konsens in Frage stellt, weil einen die vorgebrachten Argumente, Daten und Indizien nicht überzeugen und weil man die Wahrheit finden will, dann ist daran grundsätzlich nichts auszusetzen. Wer hingegen eine Position in Frage stellt, um sich zu gefallen, um zu provozieren oder um seine finanziellen Interessen durchzusetzen, der kann sich nicht auf den Wert berufen, den die Skepsis für die Wahrheitsfindung hat – denn um Wahrheitsfindung geht es ihm ja gar nicht. Die erste Erwägung kann also nur derjenige für sich in Anspruch nehmen, der wirklich an der Wahrheitsfindung interessiert ist. Das hat etwas damit zu tun, dass das Recht auf Meinungsfreiheit etwas ganz Bestimmtes schützt: Es ist das Recht, öffentlich für seine Überzeugungen eintreten zu können. Von einem Sachverhalt überzeugt zu sein, heißt aber, den Sachverhalt für wahr zu halten. Genau darum können sich viele der tatsächlich vorzufindenden Leugnungen des Klimawandels weder auf die Meinungsfreiheit noch auf den Wert der Skepsis berufen: Nicht selten nämlich streuen Vertreter von gewissen Interessengruppen in ihren öffentlichen Leugnungen des Klimawandels ganz gezielt ausgewählte Evidenzen gegen den Klimawandel – in vollem Bewusstsein der Tatsache, dass es sich um ausgewählte Evidenzen handelt und dass die ganze Wahrheit anders aussieht (vgl. dazu Oreskes und Conway 2010). Nicht selten nimmt manch aufmerksamkeitssuchender Wissenschaftler eine Gegenposition zum herrschenden Konsens ein und spielt den advocatus diaboli, um sich zu gefallen oder um zu provozieren. Wer aber wissentlich die Unwahrheit oder nur die halbe Wahrheit sagt, die Wahrheit verzerrt, Evidenzen gezielt manipuliert oder mit einer Äußerung etwas in Frage stellt, an das er eigentlich selbst glaubt, hält gerade nicht für wahr, was er öffentlich bekundet. Der Leugnende ist in diesem Fall selbst nicht von dem überzeugt, für das er nach außen hin eintritt; man kann hier von einem unaufrichtigen Leugnen des Klimawandels sprechen. Für diese Art des Leugnens ist die erste Erwägung (der Wert der Skepsis für die Wahrheitsfindung) also gar nicht einschlägig. Dafür sind aber einige der negativen Konsequenzen zu befürchten, die Grundlage der zweiten Erwägung (geistige Brandstiftung) sind. Wenn nämlich ranghohe Interessenvertreter oder gekaufte Wissenschaftler den Klimawandel leugnen, dann hält dies einige Menschen – und im schlimmsten Fall politische Entscheidungsträger – davon ab, den Klimawandel ernst zu nehmen und etwas dagegen zu tun; entsprechende politische Gegenmaßnahmen können so verzögert werden. Bei Abwägung beider Überlegungen ist es also falsch, von seiner Meinungsfreiheit auf unaufrichtige Weise Gebrauch zu machen. (Das gilt natürlich für jeden Interessenvertreter und nicht nur für die Vertreter der Öl-, Strom- und Industriekonzerne; auch der Lobbyist einer „grünen“ Nichtregierungsorganisation kann sich nicht auf die Meinungsfreiheit berufen, wenn er Fakten, von denen er weiß und die seinem Anliegen abträglich sind, unter den Tisch fallen lässt oder leugnet.) Natürlich gibt es auch die aufrichtigen Leugner – Menschen, die davon überzeugt sind, dass die Evidenzen für den Klimawandel nicht ausreichen und die es wirklich für wahr halten, dass es den Klimawandel nicht gibt. Und diesen Menschen kann man keinen Vorwurf der Unaufrichtigkeit machen.
Unaufrichtiges öffentliches Leugnen ist ein falscher Gebrauch der Meinungsfreiheit, aufrichtiges öffentliches Leugnen hingegen nicht. Es gibt noch eine weitere, dazu spiegelbildliche ethische Frage: Wie geht man als jemand, der in den Medien über den Klimawandel berichtet, mit Menschen um, die den Klimawandel leugnen? In diesem Zusammenhang wird manchmal davon gesprochen, es sei eine journalistische Pflicht, sowohl Befürworter als auch Gegner einer Sache zu Wort kommen zu lassen. Das ist zwar richtig, aber es ist ein Missverständnis zu glauben, dass man es dabei belassen kann, „beide Seiten der Medaille“ abzubilden oder allen Stimmen gleich viel Platz in der Berichterstattung zuzugestehen. Im Kontext des Klimawandels führt dies nämlich zu dem Eindruck, die Schar der Klimawissenschaftler teile sich in zwei etwa gleich große Lager – jene, die den Klimawandel leugnen und jene, die das nicht tun. Wie wir bereits mehrfach betont haben, ist das jedoch einfach nicht der Fall. Und das widerspricht dem Ideal, dem der Journalismus eigentlich verpflichtet ist: der Wahrheit. Als Journalist der Wahrheit verpflichtet zu sein, heißt im Fall des Klimawandels also, nicht nur zwei widerstreitende Ansichten und ihre Argumente zu Wort kommen zu lassen, sondern auch über das Gewicht und den Begründungsgrad dieser Ansichten zu informieren. Man darf in einem Beitrag über den Klimawandel natürlich darauf hinweisen, dass es auch abweichende Stimmen gibt; und man darf auch die Argumente dieser Klimawandelleugner nennen. Aber man muss dann auch darauf hinweisen, dass es sich um eine Minderheitenposition handelt und dass die Argumente der Leugner entkräftet worden sind. Doch genau das geschieht bisweilen nicht, so dass bei der Leserschaft ein falscher Eindruck zurück bleibt: der Eindruck, das Lager der Klimawissenschaftler teile sich in zwei gleich große Fraktionen. Und das entspricht eben nicht der Wahrheit.