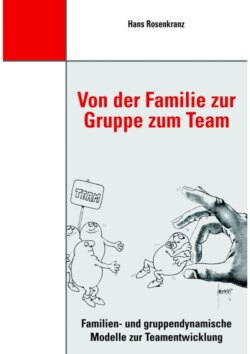Читать книгу Von der Familie zur Gruppe zum Team - Dr. Hans Rosenkranz - Страница 10
Rollenzirkel - Abwertungszirkel - Misstrauensspirale
ОглавлениеHaben wir durch die Symbiose früher Schutz und Sicherheit erfahren, so schränken wir uns jetzt selbst ein, aus einer nicht mehr zutreffenden Angst, dass uns Schlechtes passieren könnte. In einem inneren Dialog werden diese Ängste reproduziert; wir halten uns auf diese Weise selbst in einem sich weiter verstärkenden Teufelskreis: »Ich bleibe lieber passiv und zurückhaltend, weil ich Angst habe, dass etwas schief gehen kann. Es geht schief, weil ich mich zurückhalte und passiv bleibe.«
Aus mangelndem Selbstvertrauen entstehen Misstrauensfantasien. Ein solcher innerer Dialog könnte lauten:
»Ich denke, dass es unmöglich ist, dass du mir vertraust, da ich mir selbst nicht traue.«
»Ich traue mir selbst nicht, weil du mir misstraust.«
Gedanken und Gefühle verändern Physiologie und Körpersprache. Andere beobachten diese Veränderungen, interpretieren sie und reagieren darauf. Der selbstabwertende innere Dialog geht in soziale Interaktion über und wird zum Rollenzirkel. Wiederum wird die Symbiose reproduziert:
A: »Ich misstraue dir, weil ich fürchte, dass du mich nicht magst.«
Sich selbst und den anderen abwertende Signale werden durch Körpersprache oder die Melodie der Aussage kommuniziert. Als Gegenreaktion ist dann wahrscheinlich:
B: »Ich misstraue dir, weil ich von dir abwertende Signale bekomme und schütze mich davor.«
A wiederum sieht diese Misstrauenskundgebung als Bestätigung seiner ersten These und verstärkt sein restriktiv abwertendes Verhalten. In vornehmlich konkurrenzorientierten Arbeitsgruppen und Organisationen findet sich dann häufig folgende Auswirkung des symbiotischen Rollenzirkels:
A: »Ich bin nicht bereit, voll mit dir zusammenzuarbeiten, weil ich Angst habe, dass du mir vorgezogen wirst und meine Leistung dir zugeschrieben wird.«
Als Gegenreaktion ist zu erwarten:
B: »Da ich deine Signale empfange, dass du nicht bereit bist, mit mir vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, öffne ich mich nur so weit es unbedingt nötig ist und verwende meine Energie dazu, Punkte zu machen, um dir gegenüber Vorteile herauszuarbeiten und vorgezogen zu werden.«
Auf ähnliche Weise zeigt auch das folgende Beispiel von Watzlawick19, wie ein negativer Verhaltenszirkel entstehen kann:
Er: »Ich gehe ins Wirtshaus, weil du nörgelst!«
Sie: »Ich nörgele, weil du ins Wirtshaus gehst!«
und so weiter ...
Schematisch könnte eine Misstrauensspirale etwa folgendermaßen aussehen:
Beispiele, wie sich Misstrauensspiralen in der Gruppe entwickeln, finden sich in Erfahrungsberichten:20
Jetzt kann ich Rolf fragen, warum ich ihm fremd bin. Er kann mit mir nichts anfangen, findet mich weder positiv noch negativ. »Du bist neutral« sagt er. »Neutral?!« Fassungslos blicke ich ihn an und denke: »Wie kann ein Mensch neutral sein? Ich sitze hier gut sichtbar, rede und bewege mich, zeige Gefühle und du tust so, als ob ich nicht leben würde. Geh in deine Wüste! Dort ist Neutralität, da gibt es keine Menschen.« Ich habe den Eindruck, dass Klaus mir gern sagen würde, warum er mir eine grüne Fremdkarte und eine gelbe Störkarte gegeben hat, aber ich habe keine Lust, ihn zu fragen. Soll er es sagen, wenn er will - oder weiterschmoren! Manfred versteht nicht, warum ich ihm die Störkarte gegeben habe. »Zwischen uns ist doch nichts gewesen«, sagt er, »bis auf das kleine Wortgefecht, gestern oder wann das war.« »Mich hat das sehr gestört«, erwidere ich, »ich hatte das Gefühl, dass du mich mundtot machen wolltest. Auch anderen gegenüber habe ich dich als sehr ungeduldig empfunden.« Sieht er jetzt ein wenig nachdenklich aus?
In der Mittagspause fahren wir nach Ettal, zurück wollen wir zu Fuß. Klaus, Ludwig, Kurt, Franz und Manfred sind nicht dabei. Von stillem Klosterleben ist hier nichts zu spüren. Touristenrummel, Andenkenläden und Klosterlikör an jeder Ecke. Auf dem Rückweg löst sich die Gruppe nach und nach in Grüppchen auf. Rosi und ich sind die Schlusslichter. Sie erzählt mir von sich, das Gespräch bringt uns näher. Sie fragt mich, ob Stefan immer so still sei, wie hier in der Gruppe. »Nein«, sage ich, »sonst kann er schon sein Wort machen. Aber Stefan ist unter fremden Menschen anfangs immer sehr zurückhaltend.«
Zurück im Hotel. Ich sitze in meinem Zimmer auf der Bettkante und bin in Gedanken schon wieder in der Gruppe. Ich boxe in die Luft, um mir für weitere Auseinandersetzungen Mut zu machen. Aber kann man so den Ernstfall proben?
Wir reden weiter über unsere Karten. Rolf hat das Bedürfnis, mir zu erklären, dass er »neutral« nicht negativ gemeint hat: »Es ist nicht so, dass ich es schlecht finde, was du sagst. Im Gegenteil, du sagst eigentlich immer im richtigen Moment das Richtige, das meine ich mit »neutral«. Verstehst du mich?« »Nein«, antworte ich und warte gespannt darauf, was er jetzt noch aus seinem Koffer holen wird. Er läuft zum Flipchart und zeichnet eine Skala auf, die von -3 bis +3 reicht. »Du bist hier, im Bereich von 0.« Ich amüsiere mich darüber, wie er sich abstrampelt und sich selbst neu definiert. Er fragt erneut: »Hast du verstanden?« »Nein«, behaupte ich, weil es mir Spaß macht, ihn zappeln zu lassen. Und so ganz verstehe ich wirklich nicht, warum er versucht, mir auf einmal etwas Positives zu sagen. Aber das ist kein intellektuelles Problem in Bezug auf seine Worte und seine Skala. »Schluss jetzt, Rolf«, fordern einige, »du kannst hier nicht einfach neue Maßstäbe für die Karten festlegen.«
Eine andere Teilnehmerin schreibt:21
Mit den negativen Karten gings los: Erich kam auf mich zu und brachte zum Ausdruck, dass er sich gestern Abend, als ich ihn in die Ecke des Anpasser-Typs und als typisches Beispiel hinstellte, sehr abgewertet gefühlt hatte. Zumal der Begriff für ihn, so wie ich ihn gebraucht habe, nur negativ zum Ausdruck kam. »Habe ich mir sofort gedacht«, schoss es mir durch den Kopf, als Erich auf mich zukam. Da kommt eine Gegenreaktion, zumal ich Erich in der gestrigen Stimmung wirklich mehr als abwertend in diese Rolle gedrängt habe.
Die 2. negative Karte gab ich Erich wegen seines langen Plädoyers am Vortag, hinsichtlich des Anpassertyps. Ich fühlte mich dabei gut, ehrlich Gefühle und Ärger raus zu lassen.
Auch die Beziehungen von Gruppen, Organisationen, Volksgruppen, Nationen und ganzen Kulturen folgen diesem Schema der gegenseitigen Abwertung und Misstrauenspotenzierung. Antreiber in diesem Prozess sind gewöhnlich Botschaften, die wir von unseren wohlmeinenden Eltern aus der Kindheit übernommen haben.
Wie absurd sich solche Misstrauenszirkel gestalten können, erleben wir täglich. Hier ein Beispiel mit zwei Vorständen einer Bank: Der Vorsitzende hatte das Bedürfnis, der Beste zu sein. Sein Kollege respektierte dies und versuchte auf perfekte Weise, es seinem Vorsitzenden recht zu machen. Dieser legte den Perfektionismus als konkurrierendes Verhalten aus und schickte ihm misstrauische, eher abwertende Botschaften. Die wurden wiederum von dem anderen so ausgelegt, als ob er nicht perfekt genug wäre. So verstärkte der seine Anstrengungen ...
Das Verhältnis zwischen beiden wurde immer gespannter, bis sie schließlich darüber zu sprechen und zu lachen lernten.
Die Auswirkungen solcher Misstrauensspiralen reichen von ignorierender Nichtbeachtung über sich gegenseitig schädigendes und verletzendes Konkurrenzverhalten bis hin zur Katastrophe. All diesem Verhalten liegen Abwertungsstrategien zugrunde. Durch Selbst- oder Fremdabwertung rechtfertigen Personen ihre Unfähigkeit oder ihren Unwillen - seien es nun Mitarbeiter oder Führungskräfte, Trainer oder Adressaten, Therapeuten oder Patienten, Eltern oder Kinder - die volle Verantwortung dafür zu übernehmen, was sie ihrem Entwicklungsstand entsprechend angeht. In übertragenem Sinne verhalten sich Gruppen und Organisationen ähnlich.
Werden in einer Familie, einer Organisation oder einem Seminar auf Grund einer vielleicht falsch verstandenen Arbeitsteilung - z. B. Mann denkt / Frau fühlt, Chef plant / Mitarbeiter führt aus, Trainer weiß / Teilnehmer lernen - Symbiosen reaktiviert und erhalten, dann werden potentiell vorhandene Anlagen ignoriert, nicht entwickelt und dementsprechend auch nicht genützt. Das soziale System reduziert sich auf Bruchteile seiner Möglichkeiten. Und so hindern sich Personen, Gruppen und Organisationen daran, ihr gesamtes Potential zu entfalten.