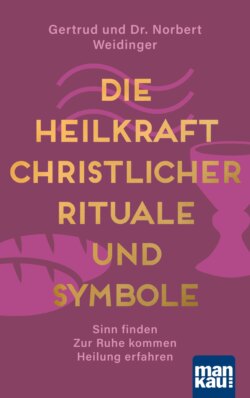Читать книгу Die Heilkraft christlicher Rituale und Symbole - Dr. Norbert Weidinger - Страница 5
ОглавлениеRITUALE UND SYMBOLE BAUEN BRÜCKEN
Rituale und Symbole begleiten uns ein ganzes Leben lang, im gesellschaftlichen wie im privaten Leben. Jeder Mensch entwickelt neben den allgemein gebräuchlichen Ritualen und Symbolen noch seine ganz eigenen, auch jede Gemeinschaft, jedes Volk und jedes Land. Sie stehen uns allen als erstes Kommunikationssystem, noch vor der Sprache, zur Verfügung. In ihrer unüberschaubaren Vielfalt verwirren Rituale und Symbole manchmal. Aber sie helfen uns gerade dann aus der Patsche, wenn uns die Worte fehlen. Ohne sie wären wir manchmal tatsächlich sprach-los. In solchen Situationen bringen Rituale und Symbole ihre heilenden Kräfte zur Geltung. Wir bezeichnen sie deshalb als Brückenbauer, die Zusammenhalt geben. Das macht sie interessant, wenn es um Suche und Sehnsucht nach Gesundheit, Wohlbefinden und innerer Ausgeglichenheit, um Heilung geht. Aus dieser Perspektive stellen Rituale und Symbole ein ergiebiges Objekt des menschlichen Forschergeistes dar – in der Philosophie, Psychologie, Psychotherapie und Soziologie, aber auch in der Theologie.
Von der Kraft allgemeiner Rituale und Symbole
Wir schreiten mit Ihnen den Horizont der vielfältigen Erscheinungsformen allgemein menschlicher Rituale und Symbole ab (lassen aber die christlichen noch beiseite) und hoffen, anhand praktischer Beispiele aus der Geschichte und dem alltäglichen Leben Ihr Interesse zu wecken.
Ein kleiner Spaziergang
Als Einstieg in diese Welt schlagen wir einen Spaziergang in drei Etappen vor, zugleich unter drei unterschiedlichen Blickwinkeln – wie bei einer Stadtbesichtigung. Wir umschreiten den Ort auf der Stadtmauer und entdecken dabei Besonderheiten wie Türme, Prachtstraßen, ein Schloss. In Gedanken umrunden wir das Thema: Wie und wozu brauchen Menschen Rituale und Symbole im öffentlichen wie im privaten Leben? Was bewirkt ihr Gebrauch? Wir wählen den Weg von außen nach innen, vom Einfachen zum Komplexeren, von der Gestalt zum Gehalt.
Der Kniefall in Warschau
Er geschah am 7. Dezember 1970, 25 Jahre nach Kriegsende. Der Krieg begann am 1. September 1939 mit dem Einmarsch deutscher Truppen in Polen. Er hinterließ über Europa hinaus Zerstörung, Vertreibung, Not und Elend, Existenzängste und Qualen sowie eine nur zu schätzende Zahl an Toten. Eine Gräueltat hat sich tief ins kollektive Gedächtnis der Menschheit eingegraben: die Räumung des Warschauer Ghettos am 16. Mai 1943. Das Denkmal der Helden des Ghettos hält die Erinnerung daran wach.
Kranzniederlegungen an Mahnmalen gehören als öffentliches Ritual zum festen Bestandteil eines offiziellen Staatsbesuches. Jedes Ritual hat einen festen Ablauf. Hier sieht er vor, dass die Staatsoberhäupter beider Länder hinter Soldaten, die den Kranz tragen, zum entsprechenden Ort schreiten. Die Staatsmänner bleiben in gemessenem Abstand stehen, bis die Soldaten den Kranz niedergelegt haben und zur Seite getreten sind. Nun geht das Staatsoberhaupt, das als Gast gekommen ist, nach vorn, berührt den Kranz kurz, glättet die Streifen, verharrt im stillen Gedenken, verneigt sich, tritt zurück und verlässt die Gedenkstätte gemeinsam mit dem Gastgeber.
Den Ablauf dieses Rituals hat Bundeskanzler Willy Brandt am 7. Dezember 1970 anlässlich der Unterzeichnung des Warschauer Vertrags zwischen Polen und Deutschland überraschend verändert. Er sank auf die Knie und verharrte schweigend etwa eine halbe Minute am Mahnmal.
Die Reaktionen auf diesen Kniefall fielen unterschiedlich aus. Viele sahen darin eine Demutsgeste. Andere eine Bitte um Vergebung für die deutschen Verbrechen des Zweiten Weltkriegs. Tatsache ist, dass noch am gleichen Tag der Warschauer Vertrag mit der Anerkennung der Unverletzlichkeit der faktischen polnischen Grenzen beiderseits unterschrieben wurde. Ein gefährlicher Schwebezustand war beendet. Heute besteht Einigkeit darüber, dass der Kniefall eine wichtige Rolle für das Zustandekommen des Vertrags gespielt hat. Allerdings zeigten sich selbst Freunde des Bundeskanzlers wie Egon Bahr oder Günter Grass damals betroffen, überrascht und besorgt. Sie befürchteten Missverständnisse und negative Auswirkungen. Aber der Spiegel-Redakteur Hermann Schreiber hielt dagegen: »Wenn dieser nicht religiöse, für das Verbrechen nicht mitverantwortliche, damals nicht dabei gewesene Mann nun dennoch auf eigenes Betreiben seinen Weg durch das ehemalige Warschauer Ghetto nimmt und dort niederkniet – dann kniet er da also nicht um seinetwillen. Dann kniet er, der das nicht nötig hat, da für alle, die es nötig haben, aber nicht da knien – weil sie es nicht wagen oder nicht können und nicht wagen können. Dann bekennt er sich zu einer Schuld, an der er selbst nicht zu tragen hat, und bittet um Vergebung, derer er selber nicht bedarf. Dann kniet er da für Deutschland« (Spiegelausgabe vom 14. Dezember 1970, S. 29 f.). Im Rückblick schreibt Willy Brandt in seinen Erinnerungen: »Immer wieder bin ich gefragt worden, was es mit dieser Geste auf sich gehabt habe. Ob sie etwa geplant gewesen sei? Nein, das war sie nicht. (…) Ich hatte nichts geplant, aber Schloss Wilanow, wo ich untergebracht war, in dem Gefühl verlassen, die Besonderheit des Gedenkens am Ghetto-Monument zum Ausdruck bringen zu müssen. Am Abgrund der deutschen Geschichte und unter der Last der Millionen Ermordeten tat ich, was Menschen tun, wenn die Sprache versagt.«1
Das politische Ritual einer öffentlichen Kranzniederlegung – mit dem ganz persönlichen, intuitiven Zusatz des Kniefalls durch Willy Brandt – zeigt, welch wertvollen Beitrag öffentliche Rituale zur Versöhnung zweier Völker haben können. Interessant bleibt, dass Willy Brandt intuitiv auf eine religiös besetzte Geste, den Kniefall, zurückgegriffen hat. Versöhnung bzw. Heilung bleibt ein Prozess, der Rituale braucht. Und: Rituale und Symbole sind interpretationsbedürftig. Stefan Zweig – lebte er noch – hätte diesen Kniefall sicherlich in sein Buch Sternstunden der Menschheit aufgenommen.
Impuls
Im Blick auf die jüngere Geschichte fallen Ihnen vermutlich weitere Beispiele ein, bei denen Rituale unübersehbare Markierungen des gesellschaftlichen Wandels und manchmal der punktuellen Heilung setzten, wie zum Beispiel der Marsch der Blackpower-Bewegung nach Washington 1963 mit Martin Luther Kings Rede I have a dream, Hungerstreiks politischer Gefangener in totalitären Regimen, die Fridays-for-Future-Aktionen oder Mahnwachen.
Retrospektive eines Psychotherapeuten
Ein Vertreter dieser Zunft, geprägt von Carl Gustav Jung, beendet seine berufliche Tätigkeit. Lorenz Wachinger blickt zurück und zieht ein Fazit in seinem Buch Wie Wunden heilen. Die Rückschau gilt nicht nur seinem Beruf, sondern auch seiner Person, dem Menschen mit seinen ganz persönlichen Kränkungen, Höhepunkten, Enttäuschungen – körperlich und seelisch. Es geht im Kern um Trauerarbeit im eigenen Leben wie in dem der Menschen, die sich ihm Hilfe und Heilung suchend anvertrauen.
Wachinger meint, es komme darauf an, dass aus dem Schmerz die Klage wird, dass sie sich äußern darf. Damit ist die Heilung schon in Gang gekommen. Die Heilung verlangt, dass der Mensch von seinen Verletzungen sein Leben verwandeln lässt. Seine Wunde schließt sich, insofern er seinen Weg geht und die Veränderung seines Lebens annimmt. Im Innersten besteht also der Heilungsprozess in einer Verwandlung.2 Da Wachinger ein Anhänger von C. G. Jung ist, spielt für ihn die Entdeckung des inneren Heilers, einer geheimnisvollen, tragenden Symbolfigur eine wichtige Rolle. Ein Weg zum inneren Heiler führt über individuelle Symbolbilder (auch in Träumen) und über Ur-Bilder der Menschheitsgeschichte. Der innere Heiler, der in jedem Verletzten wirkt, ist wichtiger als der Psychotherapeut. »Stärker als die therapeutischen Techniken ist die spontane Tendenz zur Heilung in jedem, der zu mir kommt«,3 lautet sein Resümee.
Zum Durchleben und Meistern von Krisen hält Wachinger ein großes Repertoire an Heilmitteln bereit: Übungen und Methoden wie Erinnern und Erzählen, Erschließen von Symbolen in Märchen und Heilungsgeschichten der Weltliteratur (auch der Bibel), Schweigen und Körperarbeit, Klagelieder und Klageriten, Gruppenwandern und Gruppenexerzitien, Labyrinthe begehen, zeichnen, (aus)malen und erschließen … ein ergiebiges Angebot!
In dieser Denkweise kann eine seelische Wunde heilen, wenn in einem Menschen der innere Heiler bzw. die Selbstheilungskräfte geweckt werden. Sie setzen den Prozess der Heilung oder Verwandlung in Gang und bringen ihn hoffentlich zum glücklichen Ende. Dabei spielen Rituale und Symbole eine unersetzbare Rolle. Dazu taugen auch Ur-Bilder, wie sie in der Literatur und auch in den Märchen der Völker zu finden sind.
Märchen sind mehr als Märchen
In den 1970er-Jahren gab es heftige Diskussionen über die Tauglichkeit von Märchen für Kinder. Bruno Bettelheim, geprägt vom Denken Sigmund Freuds, schaltete sich in die Diskussionen ein mit der These: Märchen sind unrealistisch, aber nicht unwahr. Es geht darin um die Wahrheit der Fantasie. Auch grausame Passagen bieten Lebenshilfe an, weil sie die Hoffnung wecken: Du kannst Bedrohliches meistern. Märchen sind mehr als Märchen; denn sie bieten beim Lesen bzw. Hören Identifikationsmöglichkeiten mit symbolhaften Gestalten wie Helden und Hexen und helfen so bei der Bewältigung von Gefühlen wie Angst und Aggression. Wir wollen dies an folgendem Märchen aufzeigen.
DIE DREI SPRACHEN
Ein Märchen der Brüder Grimm
Ein Graf war unglücklich über seinen einzigen Sohn. Er hielt ihn für dumm und schickte ihn in die Fremde zu einem Meister in die Lehre. Dort lernte der Sohn, was die Hunde bellen. Bei seiner Rückkehr fragte sein Vater: »Ist das alles?«, und schickte ihn zu einem anderen Meister. Bei ihm lernte der Sohn, was Vögel singen. Bei seiner Rückkehr fragte ihn sein Vater: »Ist das alles?«, und schickte ihn ein drittes Mal fort. Beim dritten Meister lernte der Sohn, was Frösche quaken. Als er es seinem Vater berichtete, geriet der in höchsten Zorn und befahl seinen Dienern: »Tötet ihn!« Die führten den Sohn hinaus, hatten aber Mitleid und ließen ihn gehen. Dann erjagten sie ein Reh. Mit dessen Blut täuschten sie den Grafen.
Der Grafensohn bat in einer Burg um Unterkunft. Der Burgherr gewährte sie ihm im alten Turm und warnte ihn vor den wilden Hunden dort: »Die bellen immerzu! An bestimmten Tagen fordern sie von uns ein Menschenopfer.« Alle Leute um die Burg herum bedauerten den Grafensohn. Der fürchtete sich nicht, sondern bat nur um Futter für die Hunde. Das gaben sie ihm und führten ihn zum Turm. Als er eintrat, bellte kein Hund. Sie wedelten mit ihren Schwänzen, fraßen, was er dabeihatte, und krümmten ihm kein Haar. Am anderen Morgen berichtete er dem Burgherrn: »Die Hunde erzählten mir ihre Geschichte. Sie wurden verwünscht und müssen einen Schatz hüten, solange er nicht entdeckt ist. Sie verrieten mir auch, was zu tun ist.« Da freuten sich alle. Der Burgherr versprach ihm seine Tochter, wenn er den Schatz fände. Er fand ihn. Da verschwanden die Hunde, und das Land war die Plage los. Die Tochter wurde ihm angetraut. Beide lebten glücklich.
Eine Zeit später brach der junge Graf auf nach Rom. Da geriet er in einen Sumpf, in dem Frösche quakten. Er hörte ihnen zu, wurde traurig, verriet seiner Frau aber nichts. Endlich erreichten sie Rom, wo gerade der Papst gestorben war. Die Kardinäle hatten sich soeben geeinigt: Neuer Papst könne nur der werden, an dem Gott ein Wunderzeichen wirkt. Ebenda betrat der Grafensohn die Kirche. Plötzlich flogen zwei weiße Tauben auf seine Schultern. Die Kardinäle erkannten darin ein Zeichen Gottes. Er selbst war unsicher, ob er würdig sei für dieses Amt. Doch die Tauben redeten ihm gut zu. Da er sagte: »Ja!« Damit erfüllte sich, was ihm die Frösche gesagt, ihn dadurch aber traurig gemacht hatten. Er sang die Messe und wusste kein Wort davon. Aber die Tauben flüsterten ihm alles ins Ohr. 4
Impuls
Zu diesem Märchen fallen Ihnen vielleicht folgende Fragen ein:
Was hat es mit diesen drei Sprachen auf sich?
Worauf will uns die Symbolsprache dieses Märchens hinweisen? Worin könnte die Heilkraft dieses Märchens bestehen? Kann ich mich mit einer Figur des Märchens identifizieren?
Wollen wir dieses Märchen interpretieren, können wir die gängige tiefenpsychologische Deutung nach C. G. Jung zugrunde legen:
• Dreimal muss der Sohn bei den verschiedenen Meistern in die Fremde ziehen und in die Lehre gehen. Damit beginnt eine dreistufige Wandlung. Sie vollzieht sich in ihm, während er drei Sprachen erlernt: die der bellenden Hunde, die der singenden Vögel und die der quakenden Frösche.
• Mithilfe der drei Meister wird der Sohn stufenweise vertraut mit drei Elementen: Erde, Wasser, Luft. Sie stehen für Vitalität, Unbewusstes und Geist. Er lernt die Kräfte der Natur kennen und schätzen, auch ihre Heilkraft. Er lernt, auf ihre Stimme zu hören, sie zu verstehen und ihnen zu trauen.
• Vor den bellenden Hunden zeigt er keine Angst; denn er beherrscht ihre Sprache und erfährt ihr Geheimnis: das Versteck des Goldschatzes. Damit ermutigt uns das Märchen: Lerne die bellenden Hunde in dir (Gefühle, Leidenschaften, Krankheitssymptome) verstehen. Nähere dich ihnen freundlich und nähre sie, dann wirst du erfahren, welcher Schatz dahinter verborgen ist: deine Verwandlung, dein Lebenssinn und -ziel.
• Mithilfe der Froschsprache kommt der Grafensohn mit Wasser, der Kraft des Unwägbaren und bislang Unbewussten, in Berührung. Sie eröffnet ihm jene neue Zukunft, die ihn in Rom erwartet. Noch schreckt er davor zurück: Kann er sich darauf verlassen? Welcher Verzicht verbirgt sich darin?
• Dank der Vogelsprache wird er vertraut mit den Geisteskräften. Sie geben ihm Zuversicht, Sicherheit und Inspiration in den entscheidenden Momenten auf völlig unbekanntem Terrain.
• Die dem Vater völlig unnütz und unsinnig erscheinenden Tiersprachen erweisen sich am Ende als Gewinn. Sie sind Wegweiser zum individuellen Lebenssinn. Sie führen den Grafensohn über viele Mutproben und Gefahren zu seiner eigenen Bestimmung und Vollendung.5
Märchen überzeugen durch ihre Symbolsprache. Darin verdichten sich menschliche Erfahrungen über Jahrhunderte hinweg. Heilsame Wandlungsprozesse werden verschlüsselt und doch erkennbar dargestellt. Sie laden dazu ein, sich selbst in dieser Geschichte zu spiegeln und zu erkennen. Die Symbolsprache der Märchen ist ein wohltuendes
Heilmittel für unser Innen- und Seelenleben. Das Märchen Die drei Sprachen macht trotz des grausamen Anfangs Hoffnung. Sie können sich mit dem Grafensohn identifizieren und hoffen, dass Sie aus Fehlstarts, Bedrohungen und Verwundungen heil herauskommen und Ihr Lebensziel erreichen. Die Heilkraft liegt in der Ermutigung, auf das Naturgegebene zu vertrauen, auf die innere Stimme zu hören und den Glauben an sich selbst und die eigenen Fähigkeiten nicht zu verlieren. Der innere Heiler bricht sich Bahn, spürt seine Helferinnen und Helfer auf und aktiviert sie. Verwandlung und Heilung gelingen.
Entstehung, Entwicklung und Funktion von Symbolen
Dies alles haben Entwicklungspsychologen und Psychoanalytiker für uns erforscht.6 So hat Donald W. Winnicott herausgefunden, dass dieser Entwicklungsprozess bereits ab dem sechsten Monat beginnt, sobald der Säugling unbewusst spürt, dass er nicht mehr – wie vor der Geburt – eins mit seiner Mutter, sondern ein Individuum ist. Diese Entdeckung ist die Initialzündung für das Symbolisieren, eine besondere Fähigkeit des Menschen, seine erste Kommunikationsschiene. Um die Ängste zu beherrschen, die sich durch die vom Kind erspürte Trennung regen, greift der Säugling und später das Kleinkind zu sogenannten Übergangsobjekten wie Daumen, Tuchzipfel oder Teddy. Sie vertreten die abwesende Mutter und helfen dem Säugling, seine Einsamkeit zu überwinden und das Gefühl der Geborgenheit nicht ganz zu verlieren. Welch heilsame Wirkung!
In den ersten Lebensjahren bis ins frühe Jugendalter hinein baut das Kind eine fast unzertrennlich-innige Beziehung zu seinen Übergangsobjekten wie seinem Kuscheltier auf – durch Liebkosungen, Lallen und einzelne Wörter. Der Teddybär wird von ihm gedrückt und geherzt. Übergangsobjekte bilden über Abgründe der Angst hinweg eine Brücke in die ersehnte Geborgenheit, sind Trostspender und Heilmittel schlechthin. Das Kind erlernt durch bloßes Erleben den Prozess der Symbolbildung und erfährt zugleich intuitiv deren Wirkung. Ganz wichtig ist das Lernen durch Nachahmen. Das Kind übernimmt die in der Familie gebräuchlichen Rituale wie den Austausch von Zärtlichkeiten oder Essgewohnheiten und erprobt sie spielerisch mit seinem Kuscheltier oder real mit (Groß-)Eltern und Geschwistern. So lernen Kinder auch, mit Konflikten umzugehen und sie selbst oder mit fremder Hilfe zu lösen.
Bis in die ersten Schuljahre hinein durchschaut das Kind den spezifischen Charakter von Ritualen und Symbolen nicht. Es kann nicht erkennen, dass diese über sich hinausweisen in eine andere Wirklichkeit. Deshalb kann es nicht verstehen, was Erwachsene mit übertragener Bedeutung oder Doppelsinn meinen. Wie Till Eulenspiegel bei seinen lustigen Streichen beharrt es auf dem wortwörtlichen Sinn.
Erst am Ende der Grundschulzeit durchschauen Kinder die Mehrschichtigkeit der Symbolsprache und Redewendungen. Dann regen sich Zweifel, werden Rituale und Symbole als erklärungsbedürftige Gebilde erkannt und mithilfe der wachsenden Vernunft erst infrage gestellt, dann allmählich durchschaut. Das ist der kritische Punkt, der zunächst zu Irritationen, dann über Lerneffekte zum mehrschichtigen Symbolverständnis führt. Dieser Entwicklungsprozess braucht die Unterstützung von Menschen, die dem Kind Geschichten, Märchen und Mythen vorlesen, sie nachspielen bzw. mit Imaginationsübungen und Fantasiereisen sein Symbolverständnis anregen und es den Doppelsinn und die Brückenfunktion der Symbole entdecken lassen. In dieser Phase lernen die Kinder allmählich auch, verstandesmäßig den Sinn und die Kraft von Ritualen und Symbolen zu durchschauen. Sie werden zu Entwicklungshelfern für die eigene Person und zu Verbindungselementen zwischen dem Kind und anderen Menschen.
In der Pubertät entscheidet sich, welche Funktion den Ritualen und Symbolen zukünftig beigemessen wird. Nun müssen sie auf ihre Zukunftstauglichkeit untersucht werden. Probehandeln ist angesagt, um die eigene Rolle und Wirkung in Abgrenzung zu den Eltern auszutesten: Was passt zu mir? Was nicht? Altes wird zunächst über Bord geworfen, Neues (etwa Stars und Idole) imitiert – ihre Frisur, Tattoos und Kleidung. Darin steckt aber auch eine ernsthafte Suche nach Werten und Menschen, die diese Werte verkörpern und ihnen einen Weg zeigen können. Dann ist die Frage: Setzt man sich also mit Ritualen und Symbolen auseinander, hinterfragt man sie kritisch oder ist das alles zu anstrengend? Der einfachste Weg ist, den herkömmlichen, beobachteten und gelernten Ritualen blindlings zu folgen, völlig unreflektiert. Ein anderer Weg ist, dies alles, genauso unreflektiert, aus reiner Opposition über Bord zu werfen. Der sinnvollste Weg ist, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und sie als Chance zur Persönlichkeitsbildung zu erkennen: Rituale und Symbole bieten Hilfen zur Lebensbewältigung an, zu einem neuen Selbstbewusstsein, sie sind Halt und Geländer in Krisensituationen, sind Verbindung vom Suchenden zum Ratgeber.
Rituale und Symbole erschließen
Gute Erfahrungen haben wir mit einem Modell des Philosophen und Theologen Heinrich Ott gemacht, das wir durchgängig in diesem Buch verwenden. Den Ausgangspunkt bildet die Mehrschichtigkeit von Sprache und Wirklichkeit. Sie spiegelt sich in drei Bedeutungsebenen.
Das Beispiel Brot
• Die alltäglich-reale Bedeutungsebene erschließt sich uns, indem wir Brot mit allen Sinnen betasten, sehen, riechen, schmecken, also wahrnehmen und es entdecken als Grundnahrungsmittel, das uns stärkt und gesund erhält.
• Die übertragene Bedeutungsebene begegnet uns in Sprichwörtern, Märchen, Bildworten (Metaphern). In ihnen verdichtet sich die Erfahrung vieler Menschen über einen langen Zeitraum hinweg. Nehmen Sie als Beispiel »Wess’ Brot ich ess’, dess’ Lied ich sing’.« Es verweist auf die riskante Abhängigkeit des Brot-Nehmers vom Brot-Geber und bietet dazu eine Lösung: Rede/singe ihm nach dem Mund. Alles andere ist gefährlich.
• Die religiöse Bedeutungsebene finden wir in biblischen Erzählungen vom Manna (Brot, das vom Himmel fällt) oder in der Erzählung vom Letzten Abendmahl Jesu (Brotteilen zum Abschied – ein dauerhaftes Erinnerungszeichen). Alle drei Ebenen ergänzen und durchdringen sich gegenseitig und lassen über den Entstehungsund Verwendungszusammenhang den Sinn erkennen. In der Vaterunser-Bitte um das tägliche Brot bilden alle drei Ebenen ein Ganzes. Mit den Worten Jesu dürfen wir von Gott alles Lebensnotwendige erhoffen.
Ein zweites Modell zur Erschließung haben Sie beim Märchen Die drei Sprachen kennengelernt. Es lädt ein, alle äußeren Gegebenheiten und Gestalten des Textes so zu interpretieren, dass sie die eigenen inneren Kräfte, Zustände und schicksalhaften Verknüpfungen (subjektive Variante) oder die der anderen Menschen (objektive Variante) widerspiegeln. Ich kann probehalber mich selbst oder andere Menschen damit identifizieren und so eine heilsame, neue Sicht über mich selbst oder über andere gewinnen.
Der französische Sprachphilosoph Paul Ricœur nennt dieses Vorgehen auch den Weg vom ersten zum zweiten Sinn. Dieser Weg bildet in seiner Theorie zugleich die Brücke von der ersten zur zweiten Naivität. Auch für ihn gilt: Der erste Sinn, vergleichbar der natürlichen Bedeutungsebene, ist durch möglichst eingehende Wahrnehmung sowie mehrfachen Perspektivwechsel freizulegen. Denn der zweite Sinn wohnt dem ersten inne. Das ist der springende Punkt, damit Märchen und Träume ihre heilenden Kräfte im Menschen wecken und den inneren Heiler aktivieren können. Rituale und Symbole können ihre Heilkraft entfalten, wenn sich der Mensch mit ihnen auseinandersetzt und so ihren Sinngehalt, den inneren Bedeutungsgehalt freilegt.
Was ist ein Symbol, ein Ritual?
Das erzählt uns eine alte Sage zur Erklärung des Wortes Sym-bol (griech. sym-balein = zusammenfügen): Zwei Freunde im alten Griechenland nehmen Abschied voneinander. Sie ritzen ihre Namen auf eine Tonscherbe und brechen sie in zwei Stücke. Jeder nimmt eine Hälfte mit; er weiß, dass er den Freund lange nicht sehen wird. Das Brechen von Ton und Namen drückt den Schmerz des Abschieds aus. Das sorgfältige Bewahren bringt Treue zum Ausdruck. Jede Hälfte verweist auf die Freundschaft, die gestern erlebt wurde, und ist zugleich ein Zeichen der Hoffnung auf die Freundschaft, die morgen neu erfahren werden kann. Der zerbrochene Teil der Tonscherbe (des Rings oder der Schale) ist zwar selbst nicht Freundschaft, aber er ist ein sinnliches Erkennungszeichen, das abwesende Freundschaft vergegenwärtigen, in die Gegenwart hineinziehen kann. Nach langer Zeit treffen sich die Freunde wieder: Bei einer Schale Wein setzen sie die Tonstücke zusammen. Ton und Namen ergänzen sich wieder. Sie feiern das Glück der Wiedervereinigung des Getrennten.7
Das Symbol birgt und entbirgt seinen Sinn in einem Gegenstand (Ring, Tonscherbe, Freundschafts- oder Ehering). Das Ritual übermittelt seinen Sinn in einer Handlung mit dem Symbol (Ring bzw. Tonscherbe wieder zusammenfügen, Ehering anstecken in einer Feier). Deshalb sprechen manche von Gegenstands- und Handlungssymbol (= Ritual). Ein Ritual braucht einen definierten Anfang und Schluss, eine klare Abfolge von Teilelementen und festgelegte Deute-Worte/Formeln, die den Sinn eingrenzen und festlegen. Rituale entfalten ihre Wirkung aus der Spannung zwischen Wiedererkennen und Überraschung. Ohne Überraschungsmomente, ohne Aktualisierung auf unsere Lebenssituation heute werden sie allmählich stumm, verlieren ihre (Heil-)Kraft und erstarren in totem Ritualismus.
Quellen der Heilkraft
Diese Quellen zu erkunden, verlangt nun tatsächlich etwas Zeit zum Nachdenken. Vielleicht bringt uns der Rückblick Lorenz Wachingers unter dem Motto Wie Wunden heilen auf die richtige Spur. Er resümiert: Rituale und Symbole, mit viel Fingerspitzengefühl und großer Erfahrung vom Therapeuten gezielt in den Heilungsprozess eingebracht, wirken wie ein überraschender Energiestoß. Wenn die Therapie positiv verläuft, weckt ein energetischer Impuls den inneren Heiler, setzt die gefesselten Selbstheilungskräfte, die zuvor erblindete Selbsterkenntnis frei, und bringt Erstarrtes wieder in Bewegung. Der Prozess der Verwandlung, der Heilung nimmt seinen Lauf. Und woher kommt sie? Wachinger meint, sie kommt aus der Mitte des an seiner Situation leidenden oder von Begeisterung erfassten Menschen, aus der Leben erhaltenden und fördernden Bündelung all seiner Kräfte, seiner Emotionen, seiner Vernunft und seines Geistes. Sie verbünden sich mit den Kräften des Therapeuten. Aber der Leidende oder Über-Begeisterte selbst gibt also den Ausschlag mit seiner Bereitschaft, sich der Kraft der Rituale, der Heilungsmethoden und Symbole anzuvertrauen. Aus unserer Sicht ist das jedoch noch nicht alles. Wir fragen weiter: Sind bei unseren Brückenbauern, den Ritualen und Symbolen, auch noch spirituelle Kräfte am Werk? Hier kommen Humanwissenschaften und Theologie ins Spiel.
Die Humanwissenschaften belegen durch ihre Forschung, dass der Mensch nicht auf Rituale und Symbole verzichten kann. An der Grenze zum Un-Sag-baren bleibt er auf sie angewiesen. Dazu gehören die Psychotherapien und die Hilfe von Ritualen und Symbolen, mit denen Heilerfolge erzielt werden. Das Unterscheidende zwischen Humanwissenschaften und Theologie bleibt in erster Linie der zentrale Gegenstand theologischer Forschung: die Suche nach Gott und der Glaube an Gott mit seiner Gestaltungskraft. Die Vertreter der Humanwissenschaften üben an diesem Punkt Zurückhaltung, klinken sich redlicherweise aus. Sie fühlen sich aber durchaus geachtet, wenn Theologen den erarbeiteten Zuwachs an Erkenntnissen über den Menschen, seinen Sprach- und Symbolgebrauch in den Humanwissenschaften respektvoll aufgreifen und für die eigene Arbeit fruchtbar machen. Aus Respekt vor dieser Grenze haben wir die Unterscheidung zwischen allgemeinen und christlichen Ritualen getroffen, obwohl gerade die Praktische Theologie großen Nutzen aus den Humanwissenschaften zieht: in der Seelsorge, bei der Gestaltung der Gottesdienste und bei der Erschließung des christlichen Glaubens für Menschen jeglichen Alters.
Von der Kraft christlicher Rituale und Symbole
Die Sehnsucht der Menschen nach Gesundheit und Wohlbefinden, nach Glück und Frieden ist so alt wie die Menschheit selbst. Wir betrachten diese Sehnsucht neben dem Streben nach Erkenntnis als die Kraft im Menschen, die ihn drängt, die Frage nach dem Woher und Wohin des Kosmos sowie des Menschen zu stellen. Viktor Frankl spricht aus seiner KZ-Erfahrung sogar vom Willen zum Sinn. Diese Kraft ist aus menschlicher Sicht der Ursprung der Religionen. Aus der Sicht des christlichen Glaubens ist sie allen Menschen vom Schöpfergott vom Anfang an mitgegeben und sucht deshalb ihre Erfüllung in Gott, d. h. im Bereich der Transzendenz.
Wir möchten mit Ihnen nach diesen Spuren in Ritualen und Symbolen des christlichen Glaubens suchen, wie sie uns heute begegnen und deren einende Mitte Jesus Christus bildet. Wir bleiben dabei unserem Motto treu, den Weg von der äußeren Gestalt zum inneren Gehalt zu gehen.
Kirchenschätze, Bibeltexte, Kunstwerke – ein Spaziergang
Zunächst ein ganz realer Spaziergang, nicht nur im Kopfkino mithilfe Ihrer Fantasie oder Erinnerung.
Aus dem Schatz christlicher Kirchenräume
Wir laden Sie ein, sich auf Entdeckungstour in eine evangelische oder katholische Kirche zu begeben. Es sollte eine sein, die Ihnen gefällt. Wir geben Ihnen drei Aufgaben mit.
Impuls
Aufgabe eins: Den Kirchenraum im Umhergehen aufmerksam erleben, mit allen Sinnen wahrnehmen und beobachten: Wie wirkt der Raum mit seiner Atmosphäre, seinem Baustil, den Lichtverhältnissen, der Anordnung von Altar und Bänken auf Sie (lichtüberflutet oder mystisch-halbdunkel, kühl oder warm, kahl oder überfüllt, kraftvoll oder leer, nüchtern oder einladend, erschlägt er Sie oder lässt er Sie aufatmen)? Welche Gefühle, Gedanken, Erinnerungen löst er in Ihnen aus? Lassen Sie sich Zeit dazu!
Aufgabe zwei: Welche Bilder, Figuren, Symbole, Gegenstände können Sie erkennen und benennen (Kreuz, Kreuzweg, Heiligenfiguren, z.B. Maria) und welche Vorrichtungen für rituelle Feiern (Altar oder Altäre, Kanzel, Ambo mit Bibel, Taufbrunnen, Taufbecken, Tabernakel …)? Melden sich Erinnerungen an frühere Erlebnisse? Regt sich die Sehnsucht nach mehr und engerem Kontakt oder nach mehr Distanz?
Aufgabe drei: Suchen Sie Hinweise auf eine Auseinandersetzung mit Leiden und Erlösung, Krankheit und Heilung (Kreuzwegdarstellung, Votivtafeln, Inschriften, Schriften)!
Setzen Sie sich abschließend, bevor Sie die Kirche verlassen, an den Ort, der Ihnen guttut. Genießen Sie die Stille, atmen Sie ruhig, und suchen Sie in Ihrem Innern eine neue Standortbestimmung für sich:
Der christliche Glaube und seine Symbole wirken auf mich wie …
Das möchten sie mir vielleicht geben: …
Das Ergebnis dieses geistlichen Spaziergangs bleibt Ihr persönliches Geheimnis. Wir können aber unsere Intention abschließend noch einmal verdeutlichen: Wir wollten Sie mit diesem Spaziergang ermutigen, das Potenzial des Raumes in einer christlichen Kirche zu erleben, den Raum mit allen Sinnen wahrzunehmen und seine Bedeutung für sich selbst neu zu erschließen und auszuschöpfen. Wir sind überzeugt von diesem Potenzial, dieser Energie, kennen aber auch die großen Unterschiede. Mehr als auf den Raum kommt es auf die Menschen an, die diesen Raum füllen, aktuell gestalten, ihm mit ihren lebensnahen, aussagekräftigen, den Glauben stärkenden, rituellen Feiern Faszination und Ausstrahlung geben. Traditionspflege genügt nicht. Kirchen sind keine Museen.
Aus der Fülle biblischer Erzählungen
Im Alten Testament findet sich eine Erzählung mit märchenhaften Zügen: Das Buch Tobit. Es ist benannt nach einem tiefgläubigen jüdischen Mann, der zwischen 722 und 587 vor Christus in Ninive im Exil lebt, allen Schicksalsschlägen zum Trotz an seinem Glauben festhält und sehnsüchtig auf die Rückkehr nach Israel hofft. Sein Sohn heißt Tobias (hebr. Tobija = Gott ist gut). Ein Name – ein Programm! Im Fortgang tritt ein Engel mit dem Namen Rafael (hebr. = Gott heilt) in die Erzählung ein. Ein ganzes Glaubensbekenntnis in einem Namen. Paracelsus sagt: »Die Natur heilt, der Arzt kuriert nur.« Somit konfrontiert uns diese Erzählung mit der Frage: Woher kommt die Heilkraft wirklich?
AUS DEM BUCH TOBIT
Der gesetzestreue Jude Tobit begräbt gegen den Willen des assyrischen Königs seine Glaubensgenossen und unterstützt die Armen. Ausgerechnet er erblindet und wird zum Spott der Leute, selbst seiner Frau. Er klagt Gott sein Elend.
Fern in Ekbatana lebt Raguel, ein Schuldner Tobits, mit seiner Tochter Sara, der die Männer wegsterben. Man sagt, ein Dämon wohne in ihr. Sie klagt und betet zu Gott. Da sendet Gott den Engel Rafael.
Raguel schickt Tobit mit dem Schuldschein nach Ekbatana. Rafael begleitet ihn als Beschützer, aber auch Aufgabensteller: Tobit muss unter Todesgefahr einen Fisch angeln, Galle, Leber und Herz entfernen und mitnehmen. Mit einem Teil davon vertreibt Tobit den Dämon Saras. Beide feiern Hochzeit und begeben sich auf die Rückreise.
Unglaubliches geschieht. Mit der Galle heilt Tobit mit Rafaels Hilfe die Blindheit Raguels. Rafael gibt sich als Gottes Bote zu erkennen und verabschiedet sich mit den Worten: »Alles geschah im Auftrag Gottes. Er meint es gut mit euch. Lobt und preist ihn ein Leben lang!« 8
Impuls
Es lohnt sich, diese Erzählung im Original, also in der Bibel zu lesen. Allein schon die Gebete Tobits und Saras sind es wert, die Bibel aufzuschlagen.
Um den tieferen Sinn dieser märchenhaften Erzählung zu erschließen, ist es wichtig, sich ihr historisches Alter bewusst zu machen: 700 Jahre vor Christus! Sprache und Inhalt spiegeln das damalige Weltbild und Auffassungsvermögen wider. Wir können sie nicht wortwörtlich ins Heute übersetzen. Als Christen gehen wir davon aus, dass wir Gottes Wort nur im Menschen-Wort begegnen können. Auch diese Erzählung ist Ausdruck zutiefst menschlichen Glaubens, inspiriert von Gottes Geist und trotzdem im zeitgebundenen Gewand.
Ihr Sinn kann sich erschließen u. a. mit der Ihnen inzwischen bekannten tiefenpsychologischen Methode Lorenz Wachingers:
• Der Name Rafael ist ein »altes Bekenntnis zu der Macht, die wirklich heilen kann«9.
• Wie Held und Heldin in einem Märchen müssen Tobias und Sara einen weiten, mühe- und gefahrvollen Weg mit schmerzhaften Erlebnissen meistern.
• Dennoch bleibt unübersehbar: »Alle Personen dieser Geschichte erfahren ihre Heilung«,10 gehen den Weg innerer Veränderung und Verwandlung, von materieller bzw. seelischer Not und Heillosigkeit angetrieben, kurzzeitig auch in Erstarrung festgehalten. Ihre erste Zuflucht ist das Gebet. Sie klagen und schreien zu Gott. Doch dann rührt eine Hand sie an und befreit sie.
• Ein Mensch hat eine innere Wende, eine Umkehr vollzogen. Die Berührung (samt eigentümlicher Medizin) ist angekommen, wirkt sich aus. Ein Schicksalsschlag ist verarbeitet, eine seltsame Verstrickung gelöst, die Botschaft verstanden.
• »Gewiss gibt es Unglück, das einem zustößt. Es lohnt sich aber, den (eigenen) Anteil der Angst zu sehen: Angst vor dem Neuen, vor der Macht der Triebe, Angst vor dem Fremden …
• Der Mythos legt nahe, dass das Vertrauen eine Gestalt braucht, an die es sich halten kann, eine Gestalt, die aus dem göttlichen Bereich kommt, wird (zusätzlich) zu den eigenen Kräften Mut machen können.«11
Lorenz Wachinger schließt mit einem Zitat, das Martin Buber von seiner Großmutter überliefert hat: »Man weiß nie vorher, wie der Engel aussieht.«12
Weitere wichtige Gesichtspunkte der Geschichte sind:
• Die Tobit-Erzählung erreicht uns heute nach fast 3000 Jahren über zunächst lange mündliche, dann schriftliche Überlieferung in einer völlig veränderten Welt.
• Christliche, gottesdienstliche Riten und Rituale, aber auch theologische Seminare holen die Gestalten der Erzählung immer wieder aus der Versenkung hervor und halten den Überlieferungsprozess lebendig, verhindern, dass sie zu stummem Wissen erstarren. Sie bauen tragfähige Brücken bis in unsere Zeit.
• Schon die Namen der Hauptakteure rückten die zentrale Botschaft ins Zentrum: »Gott ist gut« und »Gott heilt«. Zugleich reichen sie die Fragen »Wer ist Gott? Auf welche Weise berührt er mich?« an uns weiter.
• Gott ist für die Menschen dieser märchenhaften Erzählung eine feste Bezugsgröße, den sie preisen und loben, aber auch bitten und anklagen in Glück und Elend. Nicht an Leid und Zweifel vorbei, sondern durch beides hindurch zeigt ER sich. Auf ihn setzen Tobit, Tobias und Sara ihre ganze Hoffnung und scheitern nicht. Ihre Gebete lassen sie Schicksalsschläge ver-kraft-en. Sie begraben trotz aller Gefahren ihre Toten und geben ihnen damit ihre Würde zurück.
• Christlicher Glaube ist von Grund auf interreligiös. Judentum und Christentum sind in der Bibel unauflösbar miteinander verbunden und noch mehr in Jesus, dem gläubigen Juden, Christus, d. h. dem Gesalbten Gottes.
• Heilung geschieht aus der Dynamik dieses Gottesglaubens heraus: ER ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, der den Anfang und das Ende für alle und alles setzt und der heilt – aber nicht ohne die Menschen! Sie werden manchmal zu Engeln: »Man weiß nie vorher, wie der Engel aussieht.«
Christliche Kunstwerke – »Christus in der Dose«
Sowohl der Künstler als auch seine teils provokante Symbolsprache sind Ihnen sicher bekannt. Anfangs glaubten selbst manche Kunstkenner, es handle sich bei diesem Kunstwerk um Blasphemie. Sind auch Sie entsetzt? Es handelt sich um ein Frühwerk Joseph Beuys’ aus der Nachkriegszeit, entstanden 1949. Lassen Sie sich auf dieses Kunstwerk ein, und versuchen Sie, erst selbstständig seine Bestandteile zu sammeln und zu entschlüsseln.
© VG Bild-Kunst, Bonn 2020
Unsere Gedanken
• Da sind … eine Zigarrenkiste aus Sperrholz, links mit den alten Werbeemblemen der Firma und den dazugehörigen Schriftzügen – unverkennbar Nachkriegszeit!
• Rechts – nicht so leicht erkennbar – ein Körper, eine Figur aus knetbarem, inzwischen bröseligem Fensterkitt in Kreuzform mit einem Überbau, einer Gloriole.
• Dose steht nur im Titel. Zu sehen ist keine. Das ist also schon alles!
• Zigarren galten in der schweren Nachkriegszeit – wie heute – als Genussmittel, Geschenkartikel, Statussymbol. Wollen sie einen Hinweis geben auf die Möglichkeit, für eine Zigarrenlänge Elend und Not entfliehen zu können, alles zu unterbrechen, hinter sich zu lassen, der harten Wirklichkeit zu entfliehen …? Nach Johann B. Metz ist Unterbrechung die kürzeste Definition für Religion, deren Grundaufgabe es ist, Leiden zu unterbrechen.
• Zigarrenkistchen waren damals kostbar, darin konnte man Briefmarken, Münzen, Muscheln, Briefe sammeln. Sie waren die reinsten Schatzkästchen. Vielleicht soll uns die Kiste an mittelalterliche Reliquienschreine erinnern, in denen die Gebeine der Heiligen gesammelt und verehrt wurden … ein Schrein ohne Gold, aus Alltäglichem.
• Die Figur, geknetet aus Fensterkitt – nach eigenem Gusto, eigenem Geschmack? Christus, leicht manipulierbar und zugleich zerbrechlich?
• Nein! Denn dieser Christus in der Dose – alias: Zigarrenkiste – ergibt mit Gloriole einen Anker, der bei genauerer Betrachtung mit dem Firmenlogo korrespondiert, dem Anker auf der linken Seite: geschäftlich ein werbeträchtiges Zeichen, aber in der Realität der feste Punkt, der Halt gibt, auch noch im Sturm. Vorsicht! Die Grenze zwischen Klischee und wahrem Symbolzeichen verläuft manchmal fließend.
• Wenn es Joseph Beuys ernst meint, dann vereint er in diesem Kunstwerk Kreuz und Anker. Dann ist das Kreuz zugleich unser Anker und Christus ebenfalls – nicht an Leid und Tod vorbei, sondern mittendrin und mitten hindurch, in Solidarität mit allen Leidenden.
• Unterstrichen wird diese Annahme durch den Titel Christus in der Dose: Auch Dosen waren im Nachkriegsdeutschland etwas Kostbares, nichts zum Entsorgen im Wertstoffhof. Dosen boten Haltbares, Überlebenswichtiges an wie die Eiserne Ration im Krieg.
• Wer Augen hat zu sehen, der sehe und glaube an diesen zerbrechlichen Christus, der Halt gibt, der die eiserne Ration ist für alle Verwundeten, Leidenden, der »zu kurz gekommen« ist. »Er hat unsere Krankheiten und unsere Schmerzen auf sich genommen … durch seine Wunden sind sie, sind wir geheilt.«13
Mit der Erschließung dieses Kunstwerks haben wir zugleich das zentrale Symbol des christlichen Glaubens für uns erschlossen: das Kreuz. Mit dem Jesaja-Zitat aus den Gottesknechtsliedern ist zugleich ein Beispiel gegeben, wie Altes und Neues Testament in Jesus Christus verbunden und überbrückt werden. Diese Jesaja-Stelle bildete damals für die Jünger Jesu eine der Schlüsselstellen, um dem Kreuzestod Jesu einen Sinn abzuringen. Der Prophet Jesaja steht neben der Johannespassion im Zentrum der Karfreitagsliturgie, der jährlichen Feier der Christen zum Gedenken an Jesu Tod am Kreuz. Aber das Kreuz verweist nicht nur auf den Tod, sondern auch auf das (Weiter-)Leben, auf die Auferweckung Jesu Christi durch Gott. Christen feiern sie an Ostern. Nicht der Tod, sondern Hoffnung und Leben haben das letzte Wort. Christen glauben: Das Kreuz umspannt beide Pole. Es ist unser Anker.
Impuls
Vor einiger Zeit feierten Freunde von uns ihre goldene Hochzeit. Sie baten uns, zu diesem Anlass eine religiöse Feier mit allen Gästen mitten in der Natur zu gestalten. Dabei entstand zu einer bekannten Melodie ein Text, also ein Lied, das wir gemeinsam singen konnten. Es greift das Anker- und Netz-Symbol auf und verhilft Ihnen vielleicht zu einem tieferen Verständnis … Eine Einladung zur Meditation.
Du bist unser Leben, du bist unser Strom,
Du bist unser Grund im Ozean der Zeit.
Du bist unser Anker, Netz, das trägt und hält,
dir vertrau’n wir, wenn auch Wind und Wellen uns bedroh’n.
Mit dir gibt es keine Angst; denn du hältst uns fest.
Sei uns nahe, bleibe bei uns, Gott!
Du gibst uns den Atem, schenkst uns Raum und Zeit.
Danke für die Zeit des Miteinander-Seins,
Danke für die Menschen, die uns anvertraut.
Licht und Dunkel wechseln, doch dein Netz umfängt uns sanft.
Dank für deine Liebe, für Geborgenheit.
Danke für dein Dasein Tag und Nacht.
Du bleibst unsre Hoffnung auf dem Weg ans Ziel, für die Zahl der Jahre, die noch vor uns steh’n.
Jenseits aller Grenzen halte uns dein Netz fest zusammen im Vertrauen auf das Wiedersehn.
Schenk uns deinen Frieden, Frieden für die Welt.
Segne uns mit deiner Liebe Kraft!
Gertrud und Norbert Weidinger
Ausdrucksformen des christlichen Glaubens
Sich Jesus annähern
Wer Gott sein könnte, erahnen wir zunächst im täglichen Leben mit allen Aha-Erlebnissen und Rätseln, allen Freuden und Nöten, die uns von Tag zu Tag erwarten, sowie aus den Antworten, die wir darauf suchen und finden. Christen haben jedoch ein Vorbild für ihren Glauben: Jesus von Nazareth. Er muss in der Geschichte der Menschheit eine große Rolle gespielt haben. Wie sonst käme es zu unserer offiziellen Zeitzählung seit 2020 Jahren, die mit seiner Geburt beginnt? Wer war und wer ist er? Welches Bild haben Sie von ihm?
Schon als Zwölfjähriger nahm Jesus wie alle frommen Juden an der jährlichen Wallfahrt zum Paschafest im Tempel von Jerusalem teil. Er besuchte auch die Synagoge in Nazareth und feierte mit seiner Glaubensgemeinschaft z. B. das Laubhüttenfest mit den vorgeschriebenen Ritualen und Bräuchen. Doch mit der Taufe im Jordan durch Johannes änderte sich sein Leben. Sie muss eine tief greifende Erfahrung, eine Art Berufung für ihn gewesen sein mit einer ihn verwandelnden Kraft. Von da an zog er sich des Öfteren zum Gebet in die Einsamkeit zurück, wurde Wanderlehrer und -prediger. Er scharte Jünger, auch Jüngerinnen um sich. Jesus muss aus einer ganz einzigartigen Beziehung zu Gott gelebt haben. Die wiederum gab ihm eine kaum beschreibbare Ausstrahlung.
Als zentrale Botschaft verkündet dieser Jesus in starken Bildern das Kommen des Reiches Gottes und behauptet, dass es mit ihm angebrochen sei. Viele Leute, die ihn hören, rätseln und kommen zu dem Schluss: Er redet anders von Gott als unsere Priester. Er redet wie einer, der Macht hat.
Je mehr Leute ihn sehen und hören wollen, desto mehr gerät er in Konflikt mit der Priesterschaft, die um ihre Autorität fürchtet. Am Ende wird er vom römischen Statthalter Pilatus – gegen dessen eigene Überzeugung – als Aufwiegler unschuldig zum Tod am Kreuz verurteilt. Wie Jesu Jünger glauben wir Christen noch heute an seine Auferweckung durch Gott. Im Sturm und an Feuerzungen erkannten seine Jünger und Jüngerinnen die von Jesus verheißene Sendung des Heiligen Geistes, der Christen seither beisteht, tröstet, inspiriert und den Glauben stärkt in allem Suchen, Fragen und Zweifeln – auch in Zeiten von Krankheit, innerer Not und schicksalhaften Verstrickungen. Für Christen ist Gott dreifaltig-einer: Vater – Sohn – Heiliger Geist.
Christliche Symbolik in Jesu Worten
Auch Jesus stieß mit seiner Botschaft an die Grenze, die Schallmauer des Unsagbaren. Deshalb spricht er von Gott und seinem Reich in Gleichnissen und in Ich-bin-Worten, wenn er seinen Gottesglauben zum Ausdruck bringen will.
Um seinen Zuhörern, vor allem den Kranken und Gekränkten, Freunden und Gegnern seinen Glauben an das Anbrechen des Reiches Gottes zu verdeutlichen, erzählt Jesus Gleichnisse wie zum Beispiel: Mit Gottes Reich ist es wie …
• … mit der Saat, die der Sämann auf den Acker streut … (Mk 4,1–9)
• … mit dem entdeckten verborgenen Schatz … (Mt 13,44–46)
• … mit dem barmherzigen Samariter … (Lk 10,25–37)
• … mit dem verlorenen Schaf (Lk 15,1–10) oder dem verlorenen Sohn … (Lk 15,11–32)
Manchmal reicht ein einziger Satz, und schon erwachte in seinen Hörern und Hörerinnen eine neue, ganz andere Vorstellung von Gott und seinem Reich, und es geht uns heute noch so.
Impuls
Lesen Sie doch für sich einmal eines der Gleichnisse in der Bibel. Jedes sagt sehr viel aus über den Glauben Jesu und seine Vision von Nächstenliebe, von einer Welt, in der einer dem anderen zum Nächsten wird.
Man mag solche Gleichnisse als Metaphern, Parabeln oder Bildreden deuten. Immer beschreiben sie einen Vorgang, einen Prozess. Immer greifen sie auf alltäglich Erlebbares zurück, erzeugen so Interesse und – im positiven Fall – ein Aha-Erlebnis, eine sich plötzlich einstellende neue Einsicht. Sie bringen darunter oder dahinter Liegendes zum Vorschein, nämlich Gott als
• geduldigen Sämann, der nicht jedes Unkraut ausreißt.
• gütigen Vater, der für den verloren geglaubten Sohn ein Fest initiiert.
• guten Hirten, der seine Schafe bewacht und dem verirrten Schaf nachgeht.
Fast alle Bibelforscher kommen zum Ergebnis: Nirgends sind wir heutige Menschen der originalen Stimme Jesu so nahe wie in den Gleichniserzählungen. Jesus sprengt damit die Grenze zum Un-Vorstellbaren und Un-Sagbaren, überbrückt den Graben, der uns von ihm und seiner Zeit trennt, knüpft auch für Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen, eine neue Beziehung zu Gott, ermutigt, stiftet Vertrauen – die Grundlage jeglicher heilsamen Verwandlung oder Heilung.
Im Johannesevangelium erfahren die Gleichnisse noch eine Steigerung und theologische Überhöhung durch Jesu Ich-bin-Worte:
Ich bin das Brot des Lebens.
Ich bin das Licht der Welt.
Ich bin der gute Hirt.
Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben.
Joh 6,35; 8,12; 10,11; 10,14; 11,25; 15,5
Ohne Zweifel verweist der Evangelist damit auf den alttestamentlichen Gottesnahmen: Jahwe (hebr.: Ich bin, der ich bin). Die Ich-bin-Worte schlagen also eine Brücke vom Alten zum Neuen Testament. Sie offenbaren sowohl seine Einheit mit dem Vater als auch die radikale Hingabe seines Lebens für die Rettung der Ausgestoßenen und Verlorenen. Jesus gibt sich selbst hin für das Leben der Welt. Er schenkt seinen Jüngern die Kraft, die sie brauchen – auch uns heutigen. Er ist die Tür zum himmlischen Vater. Deshalb kann er sagen: »Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben.«14
Impuls
Beim Versuch, den persönlichen Glauben an Jesus in Worte zu fassen, entstand ein kurzes Glaubensbekenntnis, zugleich eine Überleitung zum nächsten Abschnitt. Eine Einladung für Sie zur Meditation.
Ich möchte ein Mensch werden wir du, dessen Leben und Gestalt anderen Hoffnung gibt und Halt.
Ich möchte ein Mensch werden wie du, der Einsamen zur Seite steht, mit ihnen redet, isst und geht.
Ich möchte ein Mensch werden wie du, dessen Leiden Früchte trägt und wie ein Same Wurzeln schlägt.
Ich möchte ein Mensch werden wie du.
Norbert Weidinger
Christliche Symbolik in Jesu Taten
Jesus vollzieht heilsame Zeichenhandlungen, die Zeitgenossen und Zeitgenossinnen nach damaligem Verständnis Wunder nennen. Sie haben ihre Vorgeschichte bei den Propheten. Diese verstärken durch Zeichenhandlungen die Wirkung ihrer Reden oder Visionen von drohendem Unheil, z. B. durch das Zerschmettern eines Kruges. Und wie war das bei Jesus? Ein Begriff für »Wunder im Sinne des Wider-Naturgesetzlichen findet sich in der Bibel nicht«, lesen wir im Bibellexikon. Und: »Wo wir von Wunder sprechen, spricht sie (die Bibel) differenziert von Krafttaten, Staunen erregenden Geschehnissen, Zeichen oder Heilungen … erzählt davon, dass Gott Menschen durch seine mächtige Hilfe gerettet hat.«15 Die Bibel ist in einer anderen Zeit verfasst. Die Norm, an der Wunder zu messen sind, ist nicht das Naturgesetz, sondern die Lebenserfahrung der damaligen Menschen. Sie sahen Gott am Werk.
Bei den biblischen Heilungserzählungen Jesu fallen jedenfalls drei Dinge auf:
• Jesus fragt in der Regel: »Willst du geheilt werden?« Er sucht das Ja des Hilfe suchenden Menschen.
• Er berührt den leidenden Menschen und sucht den direkten Kontakt zu ihm.
• Und schließlich folgt zum Abschluss meist der Satz: »Dein Glaube hat dir geholfen.«
Der Glaube ist das Entscheidende, damit Jesu Wirken heilsam werden kann. Wer Augen hat zu sehen und Ohren zu hören, kann wahrnehmen, mit welcher sensiblen Intensität und zugleich Vorsicht und Vorliebe sich Jesus kranken, bedürftigen Menschen zuwendet, vor allem jenen, die wegen ihrer Krankheit aus der Gesellschaft ausgestoßen sind – wie die Aussätzigen. Sie holt er zurück in die Gemeinschaft, wie zum Beispiel den Zöllner Zachäus, das »leichte« Mädchen Maria Magdalena, den blinden Bettler Bartimäus oder jene, mit denen ein frommer Jude keinen Umgang haben durfte: den römischen Hauptmann von Kafarnaum oder die phönizische Frau mit ihrer kranken Tochter, die Samariterin am Jakobsbrunnen: Ihnen allen spricht Jesus die rettende Nähe des barmherzigen Gottvaters zu, wenn sie offen dafür sind. Das ist die eigentliche Heilung aus der Sicht Jesu – ohne ihre Menschenwürde zu verletzen, ohne sie zum Objekt herabzuwürdigen. Mit diesen Menschen hält Jesus Mahl und setzt so ein Zeichen. Sie lädt er ein: »Kommt ihr Mühseligen und Beladenen, ich will euch Erleichterung und neue Lebensfreude schenken!«16 In Jesus ist dieser heilende Gott zum Greifen nah.
Impuls
Der poetische Text des deutschen Priesters und Lyrikers Wilhelm Willms hat uns geholfen, als wir vor der Frage standen: Wie können wir uns Heilungen, zeichenhafte Handlungen Jesu vorstellen? Vielleicht lässt dieser Text auch Sie erahnen, welche Art von Beziehung Jesus mit Hilfe suchenden Menschen aufgebaut und auf welche Art er ihnen geholfen hat.
IST DAS WAHR
wußten sie schon
daß die nähe eines menschen
gesund machen
krank machen
tot und lebendig machen kann
wußten sie schon
daß die nähe eines menschen
gut machen
böse machen
traurig und froh machen kann
wußten sie schon
daß das wegbleiben eines menschen
sterben lassen kann
daß das kommen eines menschen
wieder leben läßt
wußten sie schon
daß die stimme eines menschen
einen anderen menschen
wieder aufhorchen läßt
der für alles taub war
wußten sie schon
daß das Wort
oder das tun eines menschen
wieder sehend machen kann
einen
der für alles blind war
der nichts mehr sah
der keinen sinn mehr sah in dieser welt
und in seinem leben
wußten sie schon
daß das zeithaben für einen menschen
mehr ist als geld
mehr als medikamente
unter umständen mehr
als eine geniale operation
(…)
als jesus
den tauben heilte
da ist er mit dem finger
in dessen ohren gegangen
er blieb nicht auf distanz
jesus ist ganz dicht
an den tauben herangegangen
und hat gesagt ▷
komm laß mich mal an deine ohren heran
und dann hat jesus mit dem finger
in seinen ohren gebohrt
die waren nämlich total verstopft
jesus hat den gehörgang des tauben
frei gemacht
von floskeln
von lügen
von allgemeinplätzen
von vorurteilen
ganz tief drinnen17
Wilhelm Willms
Die Spuren der Transzendenz, die Symbolsprache des christlichen Glaubens sind tief verwurzelt in der Gestalt, den Worten und Taten Jesu, seinem Leben, seinen Gleichnissen, Ich-bin-Worten und Zeichenhandlungen, seiner Art zu beten, von Gott zu sprechen. So ist er für uns Vorbild geworden im Glauben, im Beten und in gottesdienstlichen Ritualen bis auf den heutigen Tag. Wir beten noch immer das Vaterunser, feiern das Abendmahl, die Eucharistie, die Taufe, die Krankensalbung. Diese Feiern sind das Wertvollste, was Jesus uns hinterlassen hat mit der Verheißung, unter diesen Symbolzeichen und Ritualen wirkmächtig und heilend gegenwärtig zu sein. Die Sakramente des christlichen Glaubens sind für Christen und Christinnen wirksame Zeichen seiner Transzendenz im Heute. Allerdings müssen sie in jede Zeit und Generation hinein neu übersetzt, nicht nur als alt-ehrwürdige Museumsstücke weitergegeben werden, sondern als wirkungsvolle Zeichen der Nähe Gottes. Ihre Wirkung schafft eine neue Wirklichkeit, wie wenn zwei Menschen sich aus ganzem Herzen zusprechen: »Ich liebe dich.« Vergleichbares geschieht, wenn Menschen zu Gott beten (z. B. das Vaterunser): Dann ist der Ich-bin-da mitten unter uns, und sein Reich wächst unter und mit uns. Auf die gleiche Weise wirkt unter Christen die Bitte um Gottes Segen heilsam.
Quellen der Heilkraft
Sehr viele Menschen – auch Christen – gehen davon aus, dass die Natur Heilkräfte in den Urelementen Wasser, Feuer, Luft und Erde birgt, auch in Heilpflanzen und Bäumen. Eine beredte und unumstrittene Zeugin dafür ist Hildegard von Bingen. Allerdings verweist sie zugleich auf einen ausschlaggebenden Unterschied: Aus dem Verständnis des christlichen Glaubens heraus verdankt sich jede natürliche Heilkraft der Schöpferkraft Gottes, eines – gemäß der Botschaft Jesu – wohl-wollenden Gottes. Auch in der Bibel (Weish 11,26) wird Gott »Freund des Lebens« genannt. Er ist die erste Quelle aller Energie und Heilkraft.
Mit dem ersten Pfingsten (Apg 2,1–42) kommt eine weitere Quelle in den Blick: der Heilige Geist, der göttliche Funke, der sich in jedem Menschen niederlässt in Taufe und Firmung. Hildegard von Bingen preist ihn mit den Worten:
»O du Feuergeist und Tröstergeist, Leben des Lebens aller Geschöpfe, heilig bist du, der du lebendig machst die Gestalten. Du Heiliger, mit deiner Salbe rettest du die Verletzten. Heilig bist du, durch deine Reinigung heilst du die eitrigen Wunden. O du Hauch der Heiligkeit, o du Feuer der Liebe, … beschütze alle, die vom Feind in die Kerker geworfen wurden, befreie, die in Banden liegen, mit göttlicher Kraft willst du sie ja retten. … Du bringst auch immer wieder die Menschen zur Einsicht, beglückst sie durch den Anhauch der Weisheit … du Freude des Lebens, du Hoffnung und mächtige Ehre, du Schenker des Lichts. Amen.«18
Impuls
Nehmen Sie sich etwas Zeit, und lesen Sie das Gebet Hildegards noch einmal langsam für sich. Streichen Sie dann jene Stellen an, die Sie berührt haben. Sie können auch eine Zeile für sich selbst ergänzen, um der christlichen Quelle der Heilkraft näherzukommen.
Wie alle Mystikerinnen glaubt Hildegard an den göttlichen Funken, Gottes Geist, in jedem Menschen. Am ersten Tag der Schöpfung schwebte er über den Wassern (Genesis). Beim ersten Pfingstfest kam er über die junge christliche Gemeinde im Sturm und in Feuerzungen (Apostelgeschichte). Diese Geisteskraft rührt das Innerste im Menschen an, stiftet eine vitale Beziehung zwischen Gott und Mensch, fördert Können und Erkenntnis in allen Bereichen der Wissenschaft und Kunst, auch der Heilkunst. Er weckt den Glauben an den dreieinigen Gott: Vater – Sohn – Heiliger Geist. Ein äußerst dynamisches Gottesbild! Ein aus gegenseitiger Beziehung wirkender Gott, der auch die Beziehung zu den Menschen sucht. Er ist die Quelle und Ursprung aller Heilkraft und Heilung.
In Ritualen und Symbolen des christlichen Glaubens bahnen sich die heilenden, verwandelnden Kräfte dieses dreieinigen Gottes ihren Weg. In ihnen dürfen Glaubende schon im Hier und Jetzt etwas von der verheißenen Lebensfülle erfahren:
• in Meditation und Gebet – in all seinen Formen und Facetten
• in Segensworten zu vielen Anlässen – im »Benedictionale«, dem Segensbuch der Kirche mit 150 Segensritualen
• in gottesdienstlich-liturgischen Feiern, einschließlich der Sakramente
Zusammenfassung
Der große Bogen ist gespannt vom allgemeinen Verständnis der Rituale und Symbole zum spezifisch christlichen: Zu Beginn hielten wir Ausschau danach, wie Menschen Rituale und Symbole ganz allgemein verwenden, nämlich als Kommunikationsmittel in Politik, Kunst, Psychotherapie sowie im ganz alltäglichen Austausch von Erfahrung und Lebenswissen. Rituale und Symbole haben ihren spezifischen, unersetzbaren Platz und bilden die Brücke zwischen Sagbarem und Noch-nicht- oder vielleicht In-Worten-nie-Sagbarem. Schon allein deshalb übernehmen sie eine enorm wichtige Funktion im Leben des Einzelnen wie im Zusammenleben aller Menschen. Diese lässt sich zutreffend mit heilsam umschreiben. Ihre Heilkraft erweist sich, wo geistig-seelische Prozesse ins Stocken geraten, gestört oder blockiert sind und wieder in Gang gesetzt werden, wo Wunden der Vergangenheit heilen sollen – im privaten, im politischen wie im therapeutischen Bereich.
Durch alle Erscheinungs-, Funktions- und Wirkungsschichten der Rituale und Symbole hindurch suchen glaubende Menschen, auch Christen, nach einem ersten und letzten verlässlichen Bezugspunkt ihres Lebens, nämlich nach Gott. Auch hierbei übernehmen sie eine unersetzbare Rolle. Das Spezifische der christlichen Rituale und Symbole ist ihre Verwurzelung in den Glaubenszeugnissen der Menschen, vor allem der Bibel. Die Bibel verstehen Christen als Gotteswort im Menschenwort. Die gleiche Qualität haben auch die in der Bibel überlieferten Rituale und Symbole, insbesondere die von Jesus Christus gestifteten. Somit werden für Christen Beten, Meditieren, Segnen und Sich-segnen-Lassen und die Sakramente zu Orten und Feiern der Begegnung mit Gott. Sie bilden die Brücke, über die sie mit Gott in Verbindung treten und mit seiner Heilkraft in Berührung kommen. Er weckt auch unsere inneren Heilkräfte und den inneren Heiler in uns.