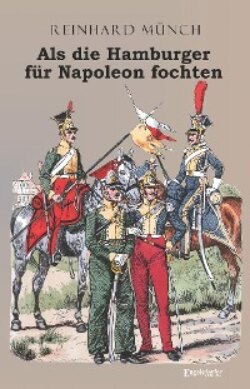Читать книгу Als die Hamburger FÜR Napoleon fochten - Dr. Reinhard Münch - Страница 7
3. HAMBURGS SOLDATEN
ОглавлениеAls Freie und Hansestadt war Hamburgs Selbstverständnis gegenüber dem Militär eher ablehnend geprägt, dies insbesondere wegen der Sozialstruktur der Mannschaften, die sich zum überwiegenden Teil aus entwurzelten Existenzen zusammensetzten. Das passte weniger in die wohlhabende und kulturell geprägte Umgebung. Aus rein praktischen Erwägungen heraus musste trotzdem eine bewaffnete Formation die Stadt schützen können. Da die Hansestadt seit dem Ende des 13. Jahrhunderts die Wehrhoheit besaß, spielten andernorts verfolgte Zwecke der Volksbewaffnung keine Rolle, wie zum Beispiel die Absicht, den Fürsten außenpolitisch kein Mittel zur Verfolgung von Machtansprüchen in die Hand zu geben. Aber auch die Hamburger schätzten es, mit dem Bürgermilitär eine Truppe zu haben, die nicht ohne weiteres vom Senat gegen die Bürger eingesetzt werden konnte.
Die Stadtsoldaten versahen ihren Dienst und waren als Bürgerwache, als städtisches Bürgeraufgebot Hamburgs, bekannt, aber eher nicht beliebt. Sie hatten eine Dienstzeit von vier Jahren und gingen alle drei Tage auf Wache. Deren Offiziere waren Hamburger und entstammten der Mittelschicht und dem Kleinbürgertum. Das Hamburger Stadtmilitär hatte um die 2000 Soldaten. Die meisten von ihnen waren angeworbene Söldner, die aber nicht kaserniert untergebracht waren. Hauptsächlich dienten die Soldaten als Grenadiere. Das war ein Regiment Infanterie mit 39 Offizieren und 1799 Unteroffizieren und Gemeinen. Dazu kamen eine Schwadron berittene Dragoner und Artilleristen mit einer Kompanie. Die Uniformen hatten noch den friderizianischen Stil. Die Hüte waren dreieckig, die Waffenröcke waren rot mit hellblauen Rabatten. Das Lederzeug war weiß.
Eine Episode während der Zeit, als Hamburg bereits französisch besetzt war, ließ jene Soldaten einmal in einem guten Licht erscheinen. Die Bürgerwehr brauchte wegen der Präsenz der Fremdtruppen den vorher üblichen Wachdienst im Stadtgebiet nicht mehr auszuüben. 1809 reichte allerdings die Zahl der Franzosen unter Waffen nicht aus, die umherziehenden Schillschen Truppen im Fall des Falles unter Kontrolle zu halten. So lag es nahe, die Dänen aus Altona um Hilfe zu bitten. Zur Erinnerung, Altona gehörte zum mit Frankreich verbündeten Dänemark. Da setzte es der bei den Franzosen in hohem Ansehen stehende Quartiermeister Brüggemann, der das Unglück, das durch die Ankunft der Dänen entstehen würde, voraussah, sowohl bei dem französischem General wie bei dem hamburgischen Bürgermeister und dem Colonelherrn durch, dass das alte hamburgische Stadtmilitär die Wälle wieder besetzte. Pünktlich, als sei erst am Tage vorher Parade abgehalten worden, erschienen alle Offiziere und Mannschaften zur Stelle, und den französischen Machthabern imponierte die hohe Zahl dieser Garnison, die stärker war als die spätere Bürgergarde, nicht wenig.
Hamburger Stadtsoldaten 1810, Dragoner, Knötel
Der Kommandeur des Regiments und der Reiter und Artillerie war Oberst Johann Jakob Gossler. Die Bürgerwache bestand bis Ende 1810 und wurde mit Beginn der französischen Verwaltung Anfang 1811 aufgelöst. Wohin mit den Soldaten? Es war natürlich kein Selbstzweck, die funktionierenden Stadtkompanien einfach zu liquidieren. Lange vorher lagen die Pläne zur Aushebung von drei Infanterieregimentern und einem Kavallerieregiment im Département des Bouches de l’Elbe vor. Also wurden aus Deutschen Franzosen und aus Hamburger Stadtsoldaten Angehörige der Französischen Armee. Hintergrund dafür war nur einer. So sind sich Historiker einig: „Das Generalgouvernement der Hanseatischen Departements wurde aber zuallererst, wenn nicht gar ausschließlich, aus dem Grund geschaffen, dass Napoleon im Oktober 1810 beschlossen hatte, Russland anzugreifen.“ Da machte es Sinn, dass Napoleon selbst an den Generalgouverneur Louis-Nicolas d’Avoût, der Marschall Davout, sinngemäß folgende Zeilen schrieb: „Ich nehme an, dass, wenn es in Frage stünde, gegen die Russen zu handeln, die norddeutschen Bataillone sicher wären und dann nützlich sein könnten.“
Drei Regimenter der Infanterie wurden gebildet, das 127. für Hamburg, das 128. für Bremen und das 129. für Osnabrück. Dazu entstand das zunächst als 30. Chasseur-Lanciers bezeichnete Regiment, also Lanzenreiter. Die unberittenen Regimenter waren auserkoren, im I. Korps, diese Bezeichnung wurde am 1. April 1812 unmittelbar vor dem Krieg vergeben, der Grande Armée als Speerspitze für den anstehenden Feldzug nach Russland zu agieren. Diese Korps, vorerst als das zur Armée d’Allemange gehörende Beobachtungskorps der Elbe bezeichnet, unterstand dem Oberkommando des zugleich als Generalgouverneur agierenden Marschall Louis-Nicolas Davout, Prinz von Eckmühl. Militär und Zivilverwaltung lagen faktisch in einer Hand.
Neben diesen mobilen Truppen wurde verfügt, drei Veteranenkompanien mit bei der Musterung für den Regimentsdienst abgelehnten Stadtsoldaten aufzustellen. Jeweils 120 Soldaten traten für Hamburg, Bremen und Osnabrück an. Diese übernahmen Aufgaben der rückwärtigen Dienste. Die 1. Veteranenkompanie blieb unter dem Kommando von Kapitän Krüger in Hamburg. Schließlich wurden die 92 Artilleristen ebenfalls weiter verwendet. Aus den Stadtsoldaten wurden Angehörige der Küstenbatterie zur Abwehr möglicher britischer Landungsversuche.
Aus Knötels Uniformkunde wurde sinngemäß, aber verkürzt, aus einer Beilage der folgende Text zur Abrundung der Stadtsoldatenbetrachtung übernommen: Die freie Reichsstadt Hamburg besaß seit dem Anfang des 17. Jahrhunderts reguläres Militär. Am 25. November 1679 beschloss man, die Soldaten mit gewisser „Liberey“ zu versehen, was bedeutete sie einheitlich zu kleiden. In jenem Jahr zählte Hamburg acht Compagnien zu Fuss, eine Abteilung Cavallerie und eine Abteilung Artillerie, Constabler und Handlanger. 1686 wurde die Truppe wesentlich verstärkt, die Infanterie in zwei Regimenter eingeteilt, die Reiter auf je zwei Compagnien Reiter und Dragoner gesetzt, die Artillerie wurde verstärkt. Vom damaligen 2. Regiment sind Sinnbilder und Sprüche entsprechend der damaligen Zeit überliefert.
1. Des Obersten Scheiter Compagnie der Spruch: Der Herr ist mein Banner und mein Schild
2. Des Oberstlieutenants Compagnie das Zeichen eines brennenden Leuchters: Ich zünde andern an
3. Capitain Schaffshausen Compagnie mit einem Löwen: Ich fürchte mich für nichts
4. Capitain Brakel mit einer auf das Meer scheinden Sonne: Geschwind und unermüdet
5. Capitain Behm mit dem Stadtwappen
Über 300 Jahre später soll es noch Fahnen jener Zeit im Bestand der Museen in Hamburg geben.
Aus dem Jahr 1688 berichtet der Chronist, dass am 8. August das Leibregiment, nachdem die Soldaten neue Uniformen in rot und blau erhalten hatten, mit den Hautboisten vor das Rathaus zog und vom Rath aus den Fenstern besichtigt wurde. Am 10. August folgte das rot und grün eingekleidete Regiment.
Überliefert ist die Zusammensetzung der Stadtsoldaten aus dem Jahr 1696 mit der Leibcomagnie unter Capitainlieutenant Busekist, des Oberlieutenants Compagnie, des Comagnien von Majoren und acht Compagnien von Capitains. Exakt aufgelistet, welche Details an den Uniformen jeweils zu verändern waren und zudem darauf zu achten, dass die kleine Montirung bei schlechter Wartung ziemlich verfiele und es daher hochmüthig sei, sie nicht nur in gutem Stand zu halten, sondern sie auch zu verbessern. So der Hinweis 1702, die Hüte und auch die Modelle von der Klinge seien so jetzunder getragen, dass sie am bequemsten sind. Der Hut mit Goldtresse und Hutband kostete zwei Drittel von dem, was für Degen mit Scheide inclusive Futter von Kalbsleder aufzubringen war. 1710 änderte sich der Schnitt der Uniformen, aber aus Kostengründen beließ man es bei den traditionellen Ringkragen, die eigentlich gegen seidene Schärpen von rot und weiss, nach den Wappenfarben, ausgetauscht werden sollten.
Knötels Beschreibung mit Bezug auf die Uniformierung der Stadtsoldaten bis 1811 endete mit der Anmerkung, dass die rothe Grundfarbe für die Infanterie und die Dragoner sich bis zur Auflösung der Stadtsoldaten erhalten hat, nur wurden die Aufschläge später hellblau. Ebenso trug die Artillerie bis zum Jahre 1811 blaue Montur.
Hamburger Stadtsoldaten um 1800, links ein Grenadier, daneben zwei Artilleristen, Knötel