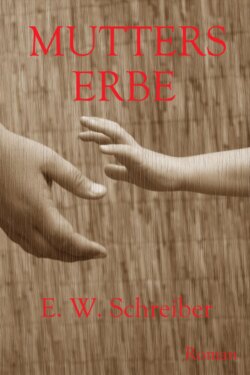Читать книгу Mutters Erbe - E. W. Schreiber - Страница 5
ISA 1
ОглавлениеMan kann Missbrauch
nur mit Dingen betreiben,
die gut sind.
Montaigne
„Leg den verdammten Hörer auf und komm endlich heim“, schrie meine Mutter lauthals lallend ins Telefon, während mein Zeuger am anderen Ende der Leitung den Bierkrug mit einem satten Platschgeräusch auf den Tresen knallte.
Ihre Füße taten ihr weh, nach dem Marsch vom Schnapsfass nach Hause.
Das Schnapsfass lag nicht unweit von ihrer kargen Behausung entfernt, in einem heruntergekommenen Bezirk in Wien, und genau dort hatte sie, so wie in den letzten Tagen auch, nicht nur ihre letzten paar Schillinge, sondern auch meinen Vater im Suff liegen gelassen.
Aus der Küche hallte ein lautes Stöhnen. Ein Schmerzensschrei durchfuhr mich wie ein Blitz, der soeben eingeschlagen hatte. Da lag ich nun. Ein Frischling sozusagen, nackt und ärmlich, und ich fror jämmerlich, während ich so auf dem kalten Fliesenboden meine ersten Atemzüge machte. Mutter kniete über mir auf allen Vieren und übergoss mich mit einer Flut wilder, abartiger Gerüche, die aus ihrem Mund kamen. Gott, war mir schwindelig.
„Wenn das die Welt war, in der ich in Zukunft leben sollte“, überlegte ich, „dann wollte ich doch besser wieder rein, da wo ich rausgekommen bin.“ Aber ich überlegte es mir schnell anders. „Hier war´s zwar kalt und grell, und Gott behüte mich vor diesen abscheulichen Gerüchen, die von oben an mir herunter strömten, aber da drin“, dann wurde mir plötzlich noch schwindeliger, „da drinnen in dieser Enge, da kippte ich in regelmäßigen Abständen um, zumindest immer dann, wenn der Nachschub aus dem Schnapsfass kam.“
Wenig später wurde mir noch kälter. Es war so arschkalt, dass ich glaubte „Hey Isa, grad ausgeschlüpft und schon wieder zum Abgang bereit.“ Doch es kam noch schlimmer. „Verdammt“, kam es mir in den Sinn. Fluchen schien schon jetzt einer meiner Stärken gewesen zu sein, „In der Schwindelarena war´s wenigstens warm, und ich konnte im Wasser darin irgendwie atmen, aber das jetzt!“ Oh, ich fror und schluckte die eisige Flüssigkeit und ich wusste, dass in der Wanne mein erstes und letztes Stündchen auf Erden geschlagen hatte.
„Mutter“, schrie ich, „Hey, wo um alles in der Welt bist du hin verschwunden, ich ersaufe hier noch in der Wanne. Und hey, weil ich grad dabei bin, kannst du mal das Fenster im Bad schließen? Oder hast du vergessen, dass wir Januar haben?“
Ich weiß nicht, wie viel Zeit verstrichen war, seit jenem bemerkenswerten Tag. Ich weiß aber, dass die Tage danach sehr öde waren. Was weiß ich, wo ich hier gelandet bin, Mutter hatte mich hierher gebracht. Zu der kalten wie erfrorenen Frau, die mich nicht mochte. Und nach einigen Tagen dachte Mutter wohl, dass es besser wäre, mich fortzubringen. Weg, nur weg von dem alten mürrischen Besen, den ich so gar nicht leiden konnte, und der Oma hieß. Fort von ihr, aus der noch kälteren, armseligen Wohnung, irgendwo anders hin, wo es vielleicht wärmer war. Doch da wo ich war, war niemand. Nicht mal Mutter war da. Die Kälte holte mich wieder ein und ich dachte nur: „Verdammt Isa, du bist nicht geschaffen für diese Eiseskälte, nicht geschaffen dafür, allein zu sein.“ Ich fühlte mich so allein, dass ich Schmerzen bekam. Oh, mein ganzer Körper schmerzte und wieder glaubte ich: „Isa, das letzte Mal hattest du Glück, aber dieses Mal ist es fünf Minuten vor zwölf, was das Sterben angeht. Es sei denn, halb am Leben und halb tot zu sein ist für diese Welt Normalzustand, an den ich mich körperlich erst gewöhnen muss.“
Ich erwachte sehr viel später mit einer Windel unten rum, aus der so allerlei glitschiges Zeug kam.
Es war ekelig. Aber wenigstens warm. „Na, das ist ja schon mal was“, überlegte ich und bemerkte, dass meine Ärmchen gewachsen waren. Ich begutachtete meine Finger. So genau habe ich die ja noch nie gesehen, so wurstig und groß, wie die sind. Viel größer, als ich sie in Erinnerung behalten habe.
Das Zimmer, in dem ich mich wiederfand, war nackt und kalt.
Die Glasscheiben rundherum störten mich. Die Leute, die daran vorüber gingen, habe ich noch nie zuvor gesehen und sie glotzten zu mir herein, als wäre ich ein außerirdischer Besucher oder ein Affe im Zoo.
Ich wusste nicht, wo ich war. Und die Frau, die ich Mutter nannte, war auch verschwunden. Sie war nicht da. Sie war nie da. Auch nicht die nächsten Monate. Ich schrie mir die Seele aus dem Leib, weil mich hier nur so selten jemand hörte. Doch ich lernte schnell, dass das hier, da wo ich war, nicht so recht funktionierte. Irgendwann bekam ich dann Besuch von einer rundlichen, sehr netten Frau um die fünfzig. Gott, wie ich sie liebte! Immer, wenn sie mich besuchte, wechselte sie das warme glitschige Schwabbelding, das meinen Hintern versteckte und gab mir Leckereien, die wie Sahne auf meiner Zunge zerflossen. Ich glaube, das was sie mir gab, nannte sich Zuckermilch. „Du hast mich wohl sehr lieb?“, fragte ich sie immer dann, wenn sie mich aus dem Stahlbett holte und mit mir einige Runden im weißen Zimmer drehte. Ich glaube aber nicht, dass sie verstand, was ich sagte. Dabei schaukelte sie mich ein wenig und sprach eigenartige Sachen zu mir, so wie „Du arme Kleine, was wird wohl aus dir werden, so ganz allein. Ich wünschte, ich könnte dich behalten. Doch alles, was ich tun kann, ist dich wieder gesund zu pflegen, mein Würmchen.“
Wen meinte sie mit Würmchen? Meinte sie mich? Und was meinte sie mit allein? Ich wusste es nicht, aber das war mir jetzt auch egal, denn ich hatte ja sie, wenn auch nur für wenige Minuten am Tag. Aber sie mochte mich irgendwie, und das fand ich sehr schön.
Ihr weißes Häubchen gefiel mir ganz besonders und immer wenn sie es trug, musste ich es haben. Ich wollte dieses Schwesternhäubchen, und ich wollte es für mich allein. Außerdem roch es nach ihr, nach dieser herzerwärmenden Schwester, die mich tief in meiner Seele berührte, wie noch keiner zuvor. Sie duftete nach Rosenblüten. Ein Geruch, der mir mittlerweile sehr bekannt und vertraut geworden war.
Eines Tages, nachdem ich lange genug um ihr Häubchen gebettelt hatte, legte sie es mir tatsächlich in mein Bett. Oh Mann, das war schön und ich kuschelte mich solange daran, bis ich einschlief. Seit jenem Tag, an dem ich die Erfüllung all´ meiner kleinen Träume in einem Rosenblütenmeer erlebte, das die ganze Nacht in meine Nasenflügel kroch, hatte ich sie nie wieder gesehen.
Einen Tag später nahm man mir ihr Häubchen weg, und packte mich in neue Klamotten. Ich erfuhr, dass ich bereits acht Monate alt war und sieben Monate in einer Isolierstation verbracht hatte. Und mit einem Schlag war ich mein warmes, weiches Bett im Krankenhaus los.
„Wohin bringt man Würmchen wie mich?“, fragte ich mich. Aber Antwort bekam ich keine. Ich zog an meinem Kautschuk-Schnuller und legte mich wieder aufs Ohr. Aber dieses Mal in einem Gefährt, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Es hatte Rollen wie mein Bett, nur größer, und es fuhr auf betonierten Straßen. Erst später erfuhr ich, dass es ein Auto war.
Ich hatte keine Ahnung, wie lange wir unterwegs gewesen waren. Doch als ich aufwachte, starrte ich in die kühlen Augen einer alten Frau vom Jugendamt, die mich nicht in den Arm nehmen wollte. Ich brüllte was das Zeug hielt, nur um ihr zu zeigen „Hey, ich will dich nicht“, sondern, „oh, diese da, die will ich haben, die, die mich so weich und zärtlich anlächelt.“ Noch immer wusste ich nicht, wo ich eigentlich gelandet war. Niemand schien mich darin einweihen zu wollen, obwohl es sich doch irgendwie, so wie es schien, um mich drehte.
Die zärtlich lächelnde Frau streckte ihre Arme aus, wohlwollend und herzlich. Das gefiel mir, und ich wusste, ich konnte das auch. Ärmchen ausstrecken. Ihre Augen leuchteten, als sie mich sah und ich glaube, sie war wohl glücklich. Meinetwegen. Also machte ich es ihr nach und streckte mich. Es funktionierte. Sie nahm mich auf den Arm, blickte mir tief in die Augen und stellte sich vor „Hallo, meine Kleine“, sagte sie sanft. „Wie sehr wir uns alle schon auf dich gefreut haben. Ich bin deine neue Mama. Willkommen!“
Wow, das war mal ´ne Ansprache, so wie man es sich wünschte. Nur, dass es alte und neue Mamas gab, war mir bis zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt gewesen. Was mich allerdings sehr irritierte, war ihr Geruch. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen, denn sie duftete fantastisch, doch konnte ich diesen Geruch nicht identifizieren. Er war neu und unheimlich betörend, Mama-mäßig.
Eine ganze Herde neugieriger Kinder stand um sie herum, die mich beäugten und abtasteten, als hätten sie zum ersten Mal ein menschliches Baby gesehen. Und sie schienen ihren hellen Spaß an mir zu haben. „Aha“, dachte ich mir, „das bedeutet also Wir.“
Ab diesem Zeitpunkt hatte ich ein Wir. Meine neue wunderbar duftende Mama und neun neugierige Geschwister. Ich war zu diesem Thema ja nie befragt worden und was ich davon hielt, ob ich ein Wir sein wollte. Aber mir sollte es recht sein. Im Kinderheim, meinem von nun an neuem Zuhause, gab es, so wie ich schnell herausfand, keine Väter, dafür hatte ich an die hundert Heimbrüder, und das war auch nicht gerade übel.
Mama hatte den Dreh schnell raus, wie sie mich beruhigen konnte, wenn ich wieder mal aus Albträumen erwachte und nach der alten Mama weinte. Ob ich nach ihr oder wegen ihr schrie, war mir allerdings nie so recht klar. Gekonnt schaukelte sie mich dann in ihren Armen und sang mir Wiegenlieder. Oh, ich liebte das Singen, und wenn ich mitsingen wollte, dachte sie anfänglich immer, dass ich Hunger hätte und päppelte mich so auf, dass ich kurze Zeit später tatsächlich einige Kilo zu viel auf die Waage brachte. Von da an wurde sie ein wenig strenger mit mir und fasste mein Geschrei als das auf, was es in Wahrheit auch war. Nämlich „Ich will Spaß haben und schenk mir Aufmerksamkeit!“
Sie meinte es gut mit mir, und ich mit ihr, deswegen gab ich mir große Mühe, ihr nicht all zu viel Last zu bereiten, damit sie mich ja behielt. Ich wollte nie wieder mit dem Auto woanders hingefahren werden, und den Duft von Vertrautem, Liebgewonnenem vermissen müssen.
Das Kinderheim lag in Kärnten, einem Bundesland in Österreich. Und ich war schneller Kärntnerin geworden als ich laufen konnte. Ich fühlte mich heimisch und war wohl angekommen.
Ich hatte ohne Zweifel den Jackpot geknackt. Ein Glückspilz sozusagen, dem das Leben etwas so Neues und Wunderbares schenkte, das man wohl Liebe nannte. Alles an Mama war wunderbar für mich. Ihr kurzes gelocktes Haar, und wie sie es spät abends vor dem Spiegel kämmte. Wenn sie nach der täglichen Hausarbeit müde, aber zufrieden in ihr Bett stieg und mich zuvor noch liebevoll drückte und küsste. Jedem ihrer Atemzüge musste ich lauschen, solange, bis mir vor Müdigkeit die Augen zufielen. Und langsam kam ich auch darauf, dass es ihre Nachtcreme war, die ihr diesen wunderbaren Duft bescherte und es möglich machte, mich immerzu in höhere Gefilde zu tragen. Kurz gesagt, wir beide waren beseelt voneinander.
Eines Tages im Winter, es war wohl an einem Samstag, hatte ich meinen dritten Geburtstag. Was dies genau bedeutete, wusste ich nicht so genau, doch erfasste ich irgendwie die Besonderheit jenes Tages, da ich erstmals mit Sue zum Einkaufen gehen durfte.
Sue war meine ältere Schwester. Und ich glaube, sie war elf. Mit Sue allein zu sein, erfüllte mich stets mit großer Euphorie, denn alles was Sue tat, hatte etwas Wildes, Originelles an sich. Sue sagte mir, dass wir heute am Nachmittag zum Skifahren gingen und ich wusste, dass es bedeutete, dass ich meine Gummistiefel anziehen und zu ihr auf die Skier steigen würde. Dabei würde sie ihre Stöcke zu Hause lassen, damit ihre Hände mich halten konnten, während wir in rasendem Tempo in doppelter Hocke den Hügel vor unserem Haus hinunterpreschten. Wir hatten das schon einige Male gemacht, aber das war topsecret. Mama wäre wohl an einem Herzinfarkt gestorben, hätte sie davon erfahren.
Sue zeigte mir beim aus dem Haus Gehen das Wäldchen am Hügel, das Achter-Wald genannt wurde, weil er an dem Haus Nummer acht angrenzte. Das Kinderheim bestand ja aus mehreren Einfamilienhäusern. Wir hatten einen Siebener-Wald, direkt vor dem Siebener-Haus und einen Sechser-Wald, der eine in etwa fünfzig Meter steile Schneise durch den Wald bis zum Ortsanfang aufwies. Sue zeigte also auf den Achter-Wald. „Von da oben“, flüsterte sie geheimnisvoll und kicherte in sich hinein, „starten wir heute.“ Ich muss ehrlich zugeben, mir schwanden die Sinne bei der Vorstellung, meinen damals bereits vorhandenen Geschwindigkeitswahn ausleben zu können.
Das Kinderheim war auf einer Anhöhe inmitten eines Ortes namens Seelenberg erbaut, das von Wald und Wiesen umgeben war. Und jedes Haus hatte seine eigene Mutter. Es war sozusagen ein Dorf im Dorf, in dem ich lebte. Es war geschützt und irgendwie abgegrenzt.
Und unser Haus lag am Rande des Dorfes, zu dem eine steile Zufahrtsstraße führte. Sue und ich stapften durch den tiefen Schnee händchenhaltend die Straße runter in Richtung Bäcker, zu dem wir mussten, um frische Semmeln zu holen. Unsere Mützen hatten wir tief ins Gesicht gezogen, während wir in eine Armada ineinander gestrickter Wollmaschen, die man Schal nannte, hinein atmeten. Immer wieder ließ ich sehnsüchtig meinen Blick auf das Wäldchen, genauer gesagt auf den Achter-Wald zurück fallen, und spürte die Aufregung in mir, des Kicks wegen, den ich heute bei der Kamikazefahrt haben würde. Ich war glücklich.
Was es bedeutete zum Bäcker zu laufen, um frische Semmeln zu holen, wurde mir erst kurz vor dem nach Hause kommen wirklich klar. Denn auf halbem Wege der steilen Zufahrtsstraße kroch mir ein wunderbarer Duft von frisch gekochtem Kartoffelgulasch durch die Nase, und als ich die Türe zu unserem Haus öffnete, durchgefroren und glücklich, wie ich war, da wusste ich, dass wir die Semmeln zum Gulaschessen brauchten.
Mama zog mir frische Klamotten über und wärmte mir mit ihren warmen Händen meine durchgefrorenen kleinen Füße.
Dann lobte sie Sue, die sich sehr verantwortungsbewusst gezeigt hatte und sorgsam mit mir umgegangen war, während wir zum Bäcker gestapft waren.
Nach dem Essen wurde ich für ein Mittagsschläfchen in mein Bett gelegt. Das Zimmer teilte ich mit Sue, was ich ganz besonders mochte, da Sue ganz anders als meine anderen Geschwister war. Sie war mir gleich. Wild, ungezähmt, aber vor allem frei.
Am Nachmittag hockten meine anderen Schwestern zusammen mit Mama in der warmen Stube und strickten. Gott, war das langweilig. Ich wollte nur raus. Ein Blick von Sue genügte und ich wusste, dass meine Zeit gekommen war. Sue steckte mich in einen dicken Overall, zog mir Haube und Schal über und schleifte mich mit Gummistiefeln bekleidet aus dem Haus.
Meine Füße mussten schnell und geschmeidig über die verschneiten und vereisten Flächen gleiten können, denn meine Pelzstiefel und Moonboots hatten zu viel Grip, und Bremsschuhe verdarben mir bloß den Spaß. Sue verstand mich wie kein anderer und unterstützte meine „Reifenwahl“, war sie es doch selbst gewesen, die mir den Trick der rasanten Besohlung beigebracht hatte.
Mama hingegen hatte meine wahren Absichten, die mit den Gummistiefeln zusammenhingen, nie wirklich verstanden, und darüber war ich sehr froh.
Der Schneepflug hatte in der Zwischenzeit für meterhohe Schneeberge am Rande der Straße gesorgt und uns Kindern den Vorteil verschafft, nicht selbst stundenlang für das Heranschaffen des Schneematerials sorgen zu müssen. Die gewaltigen Skischanzen, die dabei entstanden, ließen mein kleines Herz höher schlagen, und es bestand kein Zweifel, dass ich mit meinen Stiefeln bestückt, den Zenit jeder einzelnen besteigen oder viel mehr mit Höllentempo berasen würde, was mir letzten Endes immer ein Gefühl des Fliegens bescherte.
Auf den schneegepflasterten Straßen, die zu Skipisten umfunktioniert wurden, tummelten sich Horden von großen und weniger großen Kindern. Sue hielt mich fest und passte auf mich auf, als wäre ich ein Schatz, den sie nicht verlieren durfte, während ich wackelig mit hochrotem Gesicht auf ihren Skiern stand, und sie unser Gefährt unter ihren Füßen gekonnt zwischen den großen Jungs hindurch gleiten ließ.
Ich weiß nicht mehr, wie oft ich an jenem Tag von ihren Skiern gerutscht und hart auf dem eisigen Boden aufgeschlagen bin. Ich weiß nur, dass ich immer wieder aufgestanden bin, um mehr vom Leben und dem dazugehörigen Rausch, den mir der Spaß einbrachte, zu erfahren. Genauso wie Sue war ich hart im Nehmen und nichts, aber auch gar nichts konnte mir den Spaß, am Leben zu sein, verderben.
Kurz vor siebzehn Uhr war es dann soweit. Ich durfte die Sahne, die Mama extra für den Geburtstagskuchen geschlagen hatte, in den Schlagsack füllen und begann zu kosten. Ich saß auf dem Küchenboden und lehnte an der warmen Heizung, den Sahnesack in meinen beiden Händen haltend, den Kopf zurückgeschlagen, und die Düse hatte ich bis zum Anschlag in meinem Mund verschwinden lassen. Ich konnte nicht aufhören, so lecker schmeckte das süße Zeug. Mama erkannte das Malheur erst, als ich mich kreidebleich den Bauch haltend über den gesamten Küchenboden übergab. Gott war mir schlecht.
Etwas später stand ich in einem Kreis und um mich herum alle meine Geschwister samt Mama, die fröhliche Geburtstagslieder für mich sangen und im Takt dazu tanzten. Oh, ich konnte mich nicht im Kreis mitdrehen, so übel war mir und als Bobbi und Siggi, die ältesten und stärksten meiner Geschwister, mich an den Beinen und den Armen nahmen, um mich drei mal hochzuwerfen bis fast an die Zimmerdecke, war mir, als könnte ich fliegen und mich als wahrscheinlich erster fliegender Mensch gleichzeitig übergeben. Von dem wunderbaren Kuchen danach brachte ich keinen Bissen hinunter. Zufrieden mit mir und der Welt, aber müde von dem aufregenden Tag und dem Geschleudere von vorhin, legte mich Mama schlafen.
Ich weiß nicht mehr, was mir alles im Kopf herumgegangen war, an jenem Abend. Ich hatte noch so viel zu sortieren, so viel zu tun. Ich musste all die schönen Erlebnisse des Tages einordnen und sie noch einmal vor meinem inneren Auge durchlaufen. Und da ich einfach nicht einschlafen konnte, lauschte ich den vertrauten Stimmen, die aus dem Wohnzimmer zu mir herauf drangen.
Mama und meine Geschwister schauten fern. Es lief gerade irgendeine Show? Ich wollte sie auch sehen. Wollte runter auf Mamas Schoß, noch eine Weile kuscheln. Doch ich wusste, dass es heute keine Ausnahme geben würde, da konnte ich noch so schreien. Also blieb ich in meinem warmen Bettchen liegen und lauschte.
Ich war heilfroh, als etwas später meine Zimmertüre einen Spalt weit aufging und Siggi, mein großer Bruder, hereinlugte. „Schläfst du schon?“, wollte er wissen. Und ich erzählte ihm von meinem Schmerz, nicht gemeinsam mit ihnen zusammen sein zu können, unten beim Fernsehapparat.
Jetzt kam Siggi ganz zu mir herein und setzte sich zu mir ans Bett. Die Türe hatte er halb offen gelassen, und das brennende Licht des Vorraumes erhellte sanft mein Zimmer.
„Was hältst du davon, wenn wir beide noch etwas spielen?“, fragte er mich und lächelte. Oh, ich liebte Siggi. Nach Sue war mir Siggi der liebste Geschwisterteil. Er schaffte es immer wieder mich zum Lachen zu bringen und wenn selbst Sue sich nicht um mich kümmern wollte, ließ er mich auf seinen starken zwölfjährigen Schultern reiten und wurde dabei jedes Mal zu meinem Helden.
So war es auch an jenem Abend. Heldenhaft kam er in mein Zimmer und wollte mit mir spielen, was ich um diese Uhrzeit gar nicht mehr durfte.
„Du darfst aber Mama nichts davon verraten und wir müssen ganz leise sein, damit uns keiner hört, versprochen?“ Oh, ich versprach es. Ganz still würde ich sein und niemals würde ich unser Geheimnis, spät abends noch auf zu sein, preisgeben. Ich war ja nicht blöd.
Siggi begann mich zu kitzeln, und ich musste lachen. „Sch“, machte er und legte mir den Finger auf den Mund. „Der ist gut“, dachte ich. „Er weiß doch wie kitzelig ich bin, er soll mich einfach nicht kitzeln, dann muss ich auch nicht lachen.“ Danach spielten wir „Ich seh was du nicht siehst“. „Das ist langweilig“, motzte er und sagte: „Lass uns was anderes spielen.“
Als er mir meine Pyjamahose auszog, verstand ich nicht ganz, welches Spiel er spielte. Doch er erklärte mir gleich: „Wir spielen Arzt, in Ordnung? Und du bist krank!“
Ich ließ mich von Siggi untersuchen. Und so wie ich es ihm versprochen hatte, blieb ich ganz still liegen. Es war ein eigenartiges Gefühl so untersucht zu werden, denn er untersuchte die ganze Zeit über nur eine einzige Körperstelle, und die war zwischen meinen Beinen. Ich wusste noch nicht, wie man diese Stelle nannte. Ich wusste zwar von einem meiner Brüder, dass er nicht so aussah wie ich, wenn wir gemeinsam von Mama gebadet wurden. Aber ich hatte sie auch noch nie danach gefragt. Es war bisher nicht wichtig für mich gewesen. Aber nun wollte ich wissen, wie der Körperteil zwischen meinen Beinen hieß und fragte: „Du Siggi, wie heißt das, was du da untersuchst?“ Aber Siggi antwortete nicht. Stattdessen fuhr er fort mit dem Untersuchen und schließlich sah ich, als ich zu ihm hinunter blickte, dass er seinen Kopf dazwischen gelegt hatte. Ich war neugierig, warum er dies tat, denn soweit ich mich erinnern konnte, und ich war ja schon einige Male bei unserem Doktor im Ort gewesen, hatte mich der nie so untersucht. Also wartete ich ab. Von unten hörte ich lautes Klatschen und dann wieder die Stimme des Mannes aus dem Fernseher. „Es müssen ganz viele Menschen sein, die da klatschen“, überlegte ich und spürte plötzlich ein Gefühl zwischen den Beinen, das ich noch nie zuvor gespürt hatte. Es war eigenartig. Irgendwie angenehm. Und es war fremd. Fremde Dinge mochte ich nicht leiden, sie machten mir Angst. Deshalb sagte ich Siggi, dass ich nicht mehr spielen wollte. Siggi sah zu mir hoch und meinte, er wäre gleich fertig und dass ich kein Spielverderber sein soll. Also lag ich weiterhin ganz still mit weit gespreizten Beinen da und ließ Siggi spielen. Dann bemerkte ich, dass er irgendetwas Neues tat, das mir sofort ein noch stärkeres Gefühl bescherte, und dieses war noch fremder als das zuvor, es tat nicht weh, und er machte mir dieses Gefühl mit seinem Mund. Ich war verwundert, als ich bemerkte, dass er immer wieder seine Zunge in mich hinein steckte. Ich verstand nicht, weshalb er das tat oder vielleicht deshalb tun musste, weil er ja soeben der Doktor war, dessen Arbeit er gerade erledigte. Aber Siggi war sehr viel älter als ich, und war bestimmt schon sehr viel öfter vom Doktor untersucht worden als ich und wusste daher besser Bescheid. Er wusste ja sonst auch alles. Außerdem tat er mir nicht weh, und würde mir sowieso nie weh tun, dazu war Siggi gar nicht in der Lage. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Spiel spielte, das mir nicht erklärt wurde. Und Siggi sagte, als er mich scheinbar fertig untersucht hatte, dass wir das Spiel jetzt immer spielen werden.
Beim nächsten Mal, es war einen Abend danach, spielte er dasselbe Spiel noch einmal. Und wie zuvor war ich der Patient. Siggi erklärte mir endlich die Spielregeln. „Du weißt Isa, wir müssen ganz still sein, sonst hört uns Mama und die anderen und dann bekommst du Ärger.“ Wieder versprach ich still zu sein, denn ich wollte ja keinen Ärger haben.
Ich zog mir also dieses Mal selbst meine Hose aus, denn das waren die Spielregeln, und legte mich mit gespreizten Beinen auf das Bett. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel an jenem Abend dauerte, aber es war langweilig. Jedes andere Spiel war interessant und aufregend, weil ich was tun durfte, doch die Spielregeln waren erklärt und das Still-liegen-Bleiben war eine davon. Ich wusste nur eines, dieses Spiel mochte ich nicht leiden, aber weshalb genau konnte ich nicht sagen. Außerdem hatte ich Angst. Ich wusste ja, dass ich zu diesem Zeitpunkt zu schlafen hatte und nicht länger wach sein durfte, geschweige denn spielen.
An diesem Abend passierte etwas so Eigenartiges, das ich beim letzten Mal noch nicht erlebt hatte. Irgendwann, begann mein Körper heftig zu zucken und es fühlte sich groß an, groß und unheimlich, das Beben zwischen den Beinen. Und währenddessen es bebte, hatte Siggi seine Zunge in mich hineingesteckt. Schon wieder. Es war ein irres, zerreißendes Gefühl, das ich nicht kannte, und es war schön, irgendwie.
Siggi machte mir klar, dass ich von nun an nicht mehr aus dem Spiel aussteigen konnte. Und, dass wir es auch nachmittags oder wann auch immer Zeit dafür war, zu spielen hatten. Siggi sagte: „Ich verrate sonst Mama, dass du abends nicht schläfst, sondern spielst und ihr nicht folgst. Dann wird sie dich nicht mehr lieben und du bekommst eine andere Mama.“
Von diesem Abend an wusste ich, dass ich es von nun an immer spielen musste, wann immer Siggi es wollte. Aber was ich noch viel mehr wusste war, „Bitte keine neue Mama. Ich will nicht noch einmal eine alte Mama und an ihrer Stelle eine neue haben.“ Alles, was ich tun musste, um meine Mama zu behalten, war mitzuspielen. Und das tat ich. Ohne Meckern, ohne Weinen und ohne ein Wort darüber zu verlieren, tat ich von nun an, was Siggi von mir verlangte.
Mein Kopf schlug unaufhörlich auf mein Kissen auf. Immer und immer wieder schleuderte ich mich mit der Kraft meines Körpers Kopf voraus in mein Kopfkissen, und Mama starrte mich vor Angst und Entsetzen an, als hätte sie diesen akrobatischen Akt, der für sie scheinbar sehr brutal aussah, noch nie gesehen. Ich wusste nicht recht, weshalb sie so schockiert tat, als sie an mein Bett kam, mich mit ihren starken Armen während des Fallens auffing und mich weinend an sich drückte.
„Was ist denn nur los mit dir, mein Kind?“, schluchzte sie und küsste mich unentwegt. Ich fühlte ihre Tränen an meiner Wange, und das sie sich irgendwie nicht recht zu helfen wusste in jener Situation, abends in meinem Zimmer.
Sue sagte, dass ich das jetzt schon seit geraumer Zeit machen würde, und sie wegen meiner Anfälle nicht einschlafen konnte. Irgendwie kam mir Sue jetzt wie eine Verräterin vor. Ich riss mich aus Mamas Umarmung los, und schleuderte mein Gesicht erneut in Richtung Polster. Es war mir zu einer Sucht geworden, das Kissen mit meinem Kopf zu bearbeiten. In ihrer Angst schrie sie: „Isa, hör auf damit, hör sofort damit auf!“ Dann presste sie mich noch fester an sich und mir war, als fühlte ich so etwas wie Gefangenschaft.
Etwas später wurde ich krank. Sehr krank. Ich konnte meinen Körper nicht mehr bewegen, und mein Fieber stieg gefährlich hoch. Ich bekam Albträume, in denen ich immer wieder das Gleiche erlebte. Es waren Albträume von Wassermassen, die mich einschlossen, oder von einem großen Monster, das wie eine überdimensionale Laus aussah, die mich fressen wollte, und da ich nur ein kleines Monster war, schien ich leichte Beute zu sein. Mein einziger Fluchtweg war ein Schlüssel, den ich in einem überdimensional großen Maul trug, um damit das Licht einzuschalten. Doch es gelang mir nie. Schweißgebadet wachte ich auf, immer und immer wieder und weinte bitterlich, da ich wusste, sobald ich die Augen wieder schloss, würde es wieder kommen, das Monster, das mich fressen wollte.
Mama beruhigte mich, wenn ich schrie und meinte, dass es Fieberträume wären, die wieder vergingen, sobald ich wieder gesund wäre. Doch die Träume blieben.
Ich machte es mir zur Gewohnheit, immer erst dann mit meinem Kopf zu schlagen zu beginnen, wenn Mama zu Bett gegangen war, dann regte ich sie nicht zu sehr auf. Und ich wollte sie ja nicht aufregen. In der Zeit dazwischen, wenn die anderen Geschwister und Sue in der Stube saßen, hatte ich andere Dinge zu tun, nämlich mit Siggi spielen. Ich hatte schon Routine darin, mich jeden Abend selbstständig nackt auszuziehen, nachdem Mama mich niedergelegt hatte und mit den großen Geschwistern noch Abendprogramm in der Stube machte. Ich wusste, was von mir erwartet wurde und wartete mit gespreizten Beinen auf meinem Bett liegend auf Siggi. Er kam meistens, aber nicht immer, doch ich wartete jede Nacht. Denn, wenn ich nicht wartete und er doch käme, würde ich Probleme kriegen, und wenn ich wartete, so wie er es mir aufgetragen hatte, hatte ich ständig Angst, Mama könnte mich so sehen und dann bekäme ich ebenso Ärger. Also, egal wie ich mich entschied, es konnte für mich nur bedeuten, „Isa, du verlierst auf jeden Fall deine Mama. Also schau dazu, dass dich niemand erwischt.“
Zu dieser Zeit bemerkte ich, das Siggi immerzu versuchte, mir ein gutes Gefühl zu machen. Er versuchte es zu erzwingen. Ich wollte dieses gute Gefühl nicht haben. Es machte mir Angst, weil Siggi dann immer so gierig wurde und umso gieriger er wurde, desto härter drang er in mich. Manchmal tat er es schnell, und manchmal langsam, und immer wenn er es langsam tat, bäumte sich mein kleiner Körper auf, der nie recht wusste, was soeben mit ihm geschah. Ich konnte es nicht einordnen, dieses Beben in meinem Unterleib, und wenn ich es hatte das Beben, dann machte mein Mund Geräusche und Geräusche machen war gefährlich. Also wehrte ich mich instinktiv dagegen, und manchmal gelang es mir auch, das sich zwischen meinen Beinen nichts regte und ich das Beben meines Körpers nicht zu spüren brauchte. Doch immer, wenn es mir gelang Siggi zu besiegen, indem er mir keine Körperreaktion abzwingen konnte, bekam ich im Anschluss unsagbar höllische Bauchschmerzen. Ich wusste nicht genau wieso. Aber ich erkannte bald, dass ich immer dann unter sehr großen Bauchschmerzen litt, wenn ich gewonnen und Siggi verloren hatte. Und ich lernte sehr schnell, dass es egal war, ob er meinem Körper Gefühle entlocken konnte oder nicht. Schmerzen hatte ich so oder so.
Der wahrhaft religiöse Geist ist frei
von allen Gurus.
Krishnamurti
An einem der sonntäglichen Kirchgänge saß ich wie immer bei Mama in der linken Bankreihe. Die linke Reihe war, so wie es aussah, nur für Frauen und die rechte für Männer bestimmt, kleinere Ausnahmen ausgenommen. Siggi und Bobbi ministrierten und sahen sehr heilig aus in ihrem schönen, weißen Gewand, das ihnen bis zum Boden hing. Siggi hatte die Klingel über und läutete immer zu früh oder zu spät. Das fand ich sehr lustig, und Mama ermahnte mich streng, als ich zu kichern begann. „Wir sind hier in der Kirche, Isa, da ist man gottesfürchtig!“ Aber was das Wort genau bedeutete, verstand ich nicht.
Ich war mit Begeisterung Sängerin, und trällerte mit Inbrunst, vor allem die Marienlieder mit, da sie so wunderbar melodisch klangen. Doch heute sangen wir ein neues Lied. Zumindest hatte ich das Gefühl, das es neu war, denn ich erfasste irgendwie zum ersten Mal den Sinn des Textes, indem es hieß: „Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr, er – der nie begonnen, er – der immer war, ewig ist und waltet, sein wird immerdar.“ „So was“, dachte ich mir und wurde unendlich traurig. Ich spürte plötzlich, dass ich nicht gut war, so wie ich war, nur der Herr war es. Er war allein heilig und gut. Mir war, als würde ich kopfüber aus meinem Körper fallen, als würde ich nicht hierher gehören, so als hätte ich hier eine Strafe abzusitzen.
Und jetzt musste ich ihn suchen den Herrn, mit meinen Augen suchte ich ihn, doch ich konnte ihn, den Herrn, von dem hier gesungen wurde, und weswegen es so wie es aussah auch diese Kirche hier gab, nicht finden. Er war einfach nicht immerdar, so wie im Lied besungen, außer auf dem Kruzifix, das thronend und mächtig vor mir im Kirchenschiff hing. Irgendetwas stimmte hier nicht, „Wenn ich ihn nicht finde“, überlegte ich, „wie soll ich ihn dann fragen, wer ich bin und ob das stimmt, dass nur er gut wäre“? Das Lied wiederholte sich und ich begann bitterlich zu weinen. Mama erschrak. So hatte sie mich in der Kirche noch nie erlebt, und versuchte mich zu beruhigen. Mein Schluchzen hörte gar nicht mehr auf, so dass es Mama schon einigermaßen peinlich wurde, doch als sie die Sitznachbarin anstieß und andächtig sagte: „Das Kind ist Gott sehr nahe, der heilige Geist ist wohl in ihr Kindlein getreten“, nickte meine Mama stolz und nahm mich heulendes Elend wieder auf den Schoß.
Ich heulte weiter, und so ging es die ganze Messe durch und Mama konnte nichts dagegen machen. Ab diesem Sonntag heulte ich jedes Mal, wenn das heilige Lied ertönte, und hörte nicht mehr auf, bis die Messe zu Ende war.
Danach gab es immer gebratenes Hühnchen zu Mittag, das sie vor der Kirche ins Backrohr geschoben hatte und ich konnte es, so wie das Kartoffelgulasch am Samstag, schon auf der Auffahrtsstraße riechen. Immer, wenn Mama so wundervoll duftende Sachen kochte, und sie kochte wie eine Göttin, schwanden mir fast die Sinne. Gerüche wahrzunehmen und sie dann für mich als gefährlich oder ungefährlich einzuordnen, war mir zu einer liebgewonnenen Gewohnheit geworden. Denn überall, da wo es gut roch, fühlte ich mich wohl.
Nach langem Drängen zeigte mir Mama endlich einmal, was sie am Abend so oft in der Stube taten. Ich dachte immer, alle spielten etwas oder sahen fern, was sie wohl auch taten, nachdem ich erfuhr, was das Vorprogramm von alledem war. Es nannte sich Hauskirche.
„Also doch ein Spiel!“, dachte ich und war gespannt. Ich konnte noch nicht lesen und schreiben und das störte mich, denn jeder Einzelne, von Sue angefangen bis hin zu Bobbi und Siggi, hatten einen Text zu lesen, den sie vortragen mussten.
Mama war sehr andächtig, wie in der Kirche. Sie zündete Kerzen an, und losch das Licht. Dann versammelte sich die gesamte Familie um den großen Esstisch. Jeder saß an seinem Platz. Ich neben Mama.
Es ging um Jesus und Gott, um Verstorbene und um arme Seelen, die deshalb so hießen, weil sie zu Lebzeiten nicht an Gott geglaubt hatten. Mama erzählte, dass Jesus sie alle und natürlich auch uns selbst errettete, durch seinen Tod am Kreuz.
Mama begann eine Diskussion, in die irgendwie keiner so recht einzusteigen gedachte. Und als ich an der Reihe war zu antworten, was ich denn von Jesus hielt und ob ich an ihn glaubte, antwortete ich mit tiefster kindlicher Überzeugung, „Ich glaube alles.“ Aber, dass ich es nicht richtig fand, dass nur Jesus Gottes Sohn war und, dass nur er das Privileg hatte die Menschen zu retten, musste ich unbedingt loswerden.
Mama war einerseits erstaunt, andererseits aber auch sehr geschockt wegen meiner Antwort. „Das ist Frevel, Isa“, mahnte sie, „du kannst nicht wie Jesus sein. Nur er ist Gottes Sohn! Wir können und sollen ihm aber nacheifern.“
Da war es wieder, dieses scheußliche Gefühl, nicht wertvoll und gut zu sein. Ich fühlte es immer bei dem Heilig-Heilig-Lied, und jetzt wollte ich wissen, warum nur Jesus die Menschen retten konnte. Ich sagte Mama beleidigt, dass ich es unfair fand, und dass ich, wenn ich die Macht hätte, so zu sein wie Jesus, ohne mit der Wimper zu zucken, auch alle Menschen retten würde. Das, was er getan hatte, war meiner Meinung nach nichts Besonderes. Ich fand es als überaus normal, und dass wohl jeder, der die Möglichkeit dazu hätte, mit ihm tauschen würde. Zumindest hätte ich es getan. Es war einfach nur logisch, ganz viele Menschen retten und dafür einen sterben zu lassen. Dieses Leid würde ich ertragen können, denn ich glaubte tatsächlich, dass ein Einziger alle retten konnte, warum also gerade nur er. Mama verstand meine Rede nicht und wechselte das Thema, indem sie mit dem Rosenkranz begann. Sie betete nicht nur ein Gesetzchen, sondern gleich zehn und wir alle mussten in die Leier mit einsteigen. Gott, war das langweilig. Immer und immer wieder das gleiche Gebet aufzusagen war nicht gerade ein Spiel, das für ein Highlight in der Familie sorgte. Aber ich glaubte zu wissen, dass es Mama gut tat. Ich glaubte sogar, dass sie sich irgendwie durch die ständigen gebetsmühlenartigen Wiederholungen woanders hin manövrieren konnte, irgendwohin, in eine andere Welt, so dass sie irgendwie gar nicht mehr anwesend war. So andächtig und inbrünstig betete sie.
Am nächsten Sonntag betete ich in der Kirche zu Gott, er möge mir doch helfen, so wie Jesus zu sein, auch wenn ich nur ein Mädchen war. Ich sagte ihm, wenn er wirklich gut und gerecht war, so wie mir Mama erzählte, dann dürfte er mich nicht dafür bestrafen, dass ich es nicht richtig fand, wie er die Sache mit Jesus regelte. Aber ich bekam keine Antwort darauf. Scheinbar war er wieder nicht vorhanden, selbst wenn ich noch so fest an ihn glaubte. Das hieß für mich also, „Isa, du kannst dich anstrengen und glauben so fest du willst. Du wirst immer nur ein Mädchen bleiben und niemals so gut sein wie es ein Mann wie Jesus war.“ An jenem Tag brannte sich dieses Gefühl so tief in mich, dass ich von nun an alles und jedes in Frage zu stellen begann, was mit Heiligkeit, mit Sünde und mit Religion zu tun hatte. Ab jenem Tag wurde ich das Gefühl nicht mehr los, dass sich Gott nur deshalb nicht bei mir meldete, weil er Zeit brauchte, sich brauchbare Antworten für all meine Fragen zurechtzulegen. Doch eines Tages, das wusste ich, würde er sich vor mir nicht mehr verstecken können, irgendwann würde ich ihn aufstöbern, aus seiner hintersten Ecke und dann bräuchte er verdammt gute Antworten, um mich zufrieden zu stellen.
Gerade in dem Augenblick vielmehr,
in dem man nichts mehr zu verlieren hat,
will man ein Wagnis nicht mehr auf sich nehmen,
zu dem man in der Fülle des Lebens
sich leicht entschlossen hätte.
Marcel Proust
Wenig später bekam ich einen neuen Bruder, namens Karl. Er war etwas jünger als ich und ein Schreihals, wie ich noch nie vorher einen gehört hatte. Mama kümmerte sich aufopfernd um den kleinen Dreijährigen, der ihr ordentlich zu schaffen machte. Vor allem nachts, wenn er vor lauter Angst zu schreien begann und um sein Leben flehte. Da meine Abende fast immer mit Siggis Zimmerbesuchen voll bepackt waren, und ich erst spät einschlief, waren meine Nächte immer kurz gewesen, doch Karl schaffte es, dass sie von nun an noch kürzer wurden. Er war ein Schlafwandler und wenn er mal nicht aufschrie vor Todesangst, kam er schlafwandelnd in mein Zimmer, um mir mein Bücherregal abzuräumen. Oder er räumte mir den Kasten aus, nur um diesen im Anschluss wieder mit all meinen Kleidern vollzustopfen. Eines Nachts schrie er so laut um Hilfe, dass ich vor Schreck nicht mehr einschlafen konnte. Von da an siedelte ihn meine Mama aus dem Obergeschoss in ihr Zimmer um.
Dann bekamen wir Olli ins Haus. Einen aufmüpfigen, jähzornigen Fünfjährigen, dem ich Dreieinhalbjährige als allererstes Geschenk eine Lektion erteilen wollte, die er nie mehr vergessen sollte. Ich zog ihn also zum Apfelbaum des Nachbarhauses hinauf und schmierte ihm eine mit der Begründung, dass er niemals versuchen sollte mir meinen Platz in der Familie streitig zu machen. Olli staunte nicht schlecht, und ich hatte gewonnen, so dachte ich jedenfalls, bis sein Gesicht rot anlief vor Zorn. Seine Hand holte aus, und dann wischte er mir eine, dass ich die Sterne funkeln sah. Ab diesem Zeitpunkt liebte ich den jähzornigen Olli, da ich wusste, einen Kampfgefährten gefunden zu haben, der sich nichts, aber auch gar nichts gefallen ließ. Und tatsächlich fanden wir sehr schnell zueinander. Olli und ich. Doch immer, wenn sein Gesicht rot anlief, schaute ich, dass ich so schnell wie möglich das Weite suchte.
Warum ich in so kurzer Zeit gleich zwei neue Brüder bekommen hatte, wusste ich erst ein Jahr später, als ich Sue dabei beobachtete, wie sie gemeinsam mit Mama die Koffer packte. Ich begriff nicht, wohin Sue wollte oder ob es Mama war, die davonging. Auf jeden Fall bekam ich Angst. Höllischer Schiss überfiel mich, als ich Sue im Vorhaus stehen sah, und wie sie sich singend und lächelnd vor dem Spiegel drehte. So hatte ich Sue noch nie gesehen. Sie war happy. Und diese Art von Glück war unheimlich. Als sie mich erblickte, packte sie mich, warf mich hoch und drückte mich an sich, um sich von mir zu verabschieden. Und als es an der Türe läutete und Mama in Tränen ausbrach, begann auch Sue bitterlich zu weinen. Ich verstand die Welt nicht mehr. Was war geschehen? Soeben hatte sie noch vor Freude ein Lied geträllert und nun heulte sie sich die Seele aus dem Leib. Wenige Minuten später war Sue verschwunden und ihre Seite in unserem gemeinsamen Zimmer leer geräumt.
Aus war es mit den rasanten Schlitten- und Skifahrten, vorbei die Sommertage, in denen wir Blumen pflückten und uns stundenlang auf den Wiesen und Feldern herumtrieben, um Mäuse zu fangen. Weg war sie, einfach so, von einem Tag auf den anderen. Von da an wusste ich, dass alle größeren Geschwister Platz machen mussten, damit Geschwister wie Karl und Olli nachrücken konnten. Ich hasste die beiden dafür, Sues Platz streitig gemacht und gewonnen zu haben. „Damals, als ich Olli die Ohrfeige gab als Warnung, mir meinen Platz nicht streitig zu machen, hätte ich wissen sollen, dass es nicht der meine, sondern Sues Platz war“, dachte ich unter Tränen und sprach ein ganze Woche lang nicht mehr mit Olli. Aber es war schwer, ihm auf ewig böse sein zu können.
Ich erinnerte mich daran, dass vor Sue andere Geschwister bereits das Haus verlassen hatten, um in die Stadt zu ziehen, und dass sie an Weihnachten, Ostern und an bestimmten Tagen im Jahr immerzu zu Besuch kamen. Dieses Wissen, dass ich Sue wieder sehen würde, sollte mir dabei helfen, sie gehen zu lassen. Ich konnte mich jedoch nicht erinnern, jemals bei den anderen älteren Geschwistern, wenn sie uns verlassen hatten, je so gelitten zu haben. Geschwister waren Geschwister, dachte ich, doch erst als ich Sue gehen lassen musste, wurde mir klar, dass es einen Unterschied gab. Geschwister sind nicht gleich Geschwister, und ich konnte nicht jeden gleich lieben.
So musste es wohl auch mit mir und Olli sein, den Olli und Sue, so empfand ich, waren unter den über zwanzig Geschwistern, die ich hatte, meine einzig wahren Geschwister, die einzigen und wahren im Herzen.
An einem Abend, an dem ich Sue besonders vermisste, erinnerte ich mich daran, wie ich zum Geburtstag meiner besten Freundin eingeladen war. Mama war nicht da gewesen und eine Frau namens Gerda vertrat Mama. Wir nannten sie Tante Gerda. Tante Gerda war streng. Es war an einem Sonntag und Siggi musste auf mich aufpassen, während Tante Gerda mit den anderen Geschwistern einen Spaziergang machte, bis ich um fünf Uhr am Nachmittag endlich zur Feier gehen konnte. Die Tante warnte mich noch davor, vor der Geburtstagsfeier mein Sonntagskleid, das sie mir angezogen hatte, nicht zu beschmutzen und ich wusste, Tante Gerdas Drohungen musste man ernst nehmen, wollte man seinen Kopf nicht verlieren.
Und dann ging sie und ließ Siggi und mich allein zurück.
Ich durfte nicht nach draußen, und Siggi holte mich zu sich in die Speisekammer. Er drehte den Schlüssel im Schloss und legte mich in meinem schönen Kleid auf den kalten Speisboden. Ich war noch nie mit Siggi in der Speisekammer gewesen, und wusste daher nicht recht, was er von mir erwartete. Ich tat, was er von mir wollte und als er mir das Kleid hochzog, um sich auf mich zu legen, spürte ich einen stechenden Schmerz, der mich durchfuhr, als wäre ich soeben aufgespießt worden. Ich begann zu weinen und sah, wie Siggi sich wieder aufrichtete und mir eine Flüssigkeit auf mein Kleid spritzte. Als er fertig war mit seinem Spiel, sah ich auf mich herab und fragte ihn ängstlich, was ich der Tante sagen sollte, warum mein Kleid so verschmutzt wäre. Doch Siggi zuckte nur mit den Schultern und sagte nichts. Ich versuchte mein Kleid in der Badewanne zu säubern und wurde immer verzweifelter, weil es anstatt sauber nur klatschnass und unordentlicher wurde.
Als ich abends nach der Geburtstagsfeier wieder nach Hause kam, stand Tante Gerda bereits zornig in der Türe und wartete auf meine Erklärung. Sie zog mich ins Badezimmer hoch, deutete streng mit dem Finger auf mein Kleid und wollte die Wahrheit hören.
Ich verstand in diesem Moment zum ersten Mal, was sie bedeutete, die Wahrheit. Und die konnte ich ihr nicht geben. Was hätte ich auch sagen sollen. „Du Tante, der Siggi hat sich auf mich draufgelegt und mir mit dem Ding, mit dem er Lulu macht, weh getan. Und der Schmutz auf meinem Kleid kam aus seinem Lulu-Ding?“
Tante Gerda wurde immer roter im Gesicht. Sie war wohl zornig und wartete auf eine Antwort. Also log ich, und zum ersten Mal bewusst. Ich sagte, dass ich draußen beim Spielen gewesen war, obwohl es mir verboten war und das ich nicht gefolgt hätte.
Dann machte es Wham. Sie schlug so hart und kräftig zu, mitten in mein Gesicht, dass es schmerzte. Und dann konnte ich auf meinem rechten Ohr kaum noch etwas hören. Siggi stand daneben und schaute zu, wie sie mich ins Zimmer verbannte und mir die restlichen Tage Zimmerarrest verschrieb.
Sue hatte sich die ganze Nacht zu mir in mein Bett gelegt und mich im Arm gehalten, bis ich vor Trauer und Schmerz einschlief. Morgens lag sie immer noch neben mir und streichelte mein Gesicht. Da wusste ich, was Liebe war. Ich liebte Sue und sie liebte mich. Und plötzlich wusste ich auch, was Hass war. Seit jenem Abend hasste ich Siggi. Ich hasste ihn abgrundtief. Ich hasste ihn für seine Feigheit, dafür, dass er zusah, als ich seine Schuld auf mich genommen hatte und an seiner Stelle bestraft wurde. Aber vor allem hasste ich mich selbst. Ich verabscheute mich selbst, so feige gewesen zu sein und nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Ich hasste mich dafür, überhaupt eine Mama zu haben, die ich verlieren konnte und von da an versuchte ich mich immer mehr von ihr zu verabschieden. Mama war nicht da, und so hatte ich nur Sue, der ich etwas bedeutete und die mir noch ein schönes Gefühl vermitteln konnte.
Und jetzt war sie weg, meine Sue. Und ich wusste, sie würde nie erfahren, wie sehr ich sie seit jener Nacht in mein Herz geschlossen hatte.
Alle Geburt ist Geburt aus Dunkel ans Licht.
Das Samenkorn muss in die Erde versenkt werden
und in der Finsternis sterben,
damit die schönere Lichtgestalt sich erhebe
und am Sonnenstrahl sich entfalte.
Friedrich Schelling,
über das Wesen der menschlichen Freiheit
Den Sommer darauf fuhren alle Kinder, sobald sie die Schule besuchten, nach Italien in die Ferien. Und wir kleinen blieben zu Hause bei Mama. Da wir zu dritt waren, Karl, Olli und ich, hatte Mama alle Hände voll zu tun, da sie noch einige andere kleine Kinder in dieser Zeit zu beaufsichtigen hatte. In den Ferien also waren wir zu siebt und ich erfuhr, dass ich nicht das einzige Kind war, das sich abends im Bett hin und her warf. Auch zwei andere Kinder, ein Junge und ein Mädchen brauchten das Sich-schütteln-und-beuteln, das Kopf-in-das-Kissen-schlagen-Spiel, um einschlafen zu können. Die beiden taten dies aber auch nachmittags auf der Couch, mitten auf der Spielwiese und ich bewunderte sie, dass sie den Mut aufbrachten, ihr wildes Geschüttle so offen zu zeigen. Also machte ich mit. Kopf links, dann nach rechts und während ich meinen Kopf drehte, warf ich meinen ganzen Körper mit Schwung in die Schüttelrichtung, während ich mich selbst an mir festhielt. Mama machte jetzt nicht mehr so ein Theater, wenn mein Kopfschütteln so arg wurde, dass es mich beinahe aus dem Bett warf, denn sie hatte gehört, dass diese Art der Bewegung vor allem Kindern gut tat, die wenig bis gar keine Liebe erhalten hatten und sich daher selbst im links und rechts Drehen die Liebe gaben, die sie brauchten. Ich konnte nicht verstehen, was genau sie damit meinte, aber es war mir auch egal. Interessant fand ich nur, dass es auch andere Kinder gab, die dies taten. Ich fühlte mich daher auch nicht mehr „anders“ und absonderlicher als die anderen.
Dieser Sommer war überhaupt irgendwie etwas ganz Besonderes, denn ich lernte Matt kennen. Er war fünf und gerade eben erst ins Kinderheim gekommen. Da ich ja höllische Angst vor Wasser hatte, und das Kinder-Planschbecken, das hie und da mit Wasser gefüllt wurde, nicht zu betreten traute, fühlte ich mich immerzu ausgestoßen und allein. Wenn ich so am Poolrand traurig in der Wiese saß und den Kindern beim Baden zusehen musste. Doch vor dem Sommer hatte ich ein aufblasbares Kanu geschenkt bekommen, und dies machte mich zur absoluten Heldin des Sommers. Jedes Kind wollte mein Freund sein, des Kanus wegen, das ich allerdings nie benützte. An einem dieser heißen Sommertage führte mich Mama zum Pool und versuchte mich dazu zu überreden, doch wenigstens mit dem Kanu ein wenig Wasserspaß zu genießen und ein paar Runden zu drehen.
Mama und ich hatten nie die geringste Ahnung, weshalb ich solche Panik vor dem Wasser hatte, aber egal wie tief es war, ich schrie mir die Lunge aus dem Leib und um mein Leben, sobald ich nur in die Badewanne musste. Wie also sollte ich hier in dem Pool, der mindestens zwanzig Mal größer als die Wanne war, Spaß haben?
Aber dann sah ich Matt. Ein Junge, der am Wiesenrand hockte und interessiert, aber auch traurig die anderen Kinder beobachtete. Und ich beobachtete aus sicherer Entfernung, Matt. Ich betrachtete sein strohblondes Haar, seine zierliche Gestalt und sein warmes weiches Wesen, das hinter seiner offensichtlichen Panik vor dem Wasser, zum Vorschein kam. Ich mochte ihn sofort. Da in mir ein Draufgänger steckte, schnappte ich mir also mein Boot und trat an den Beckenrand.
Als mich die Kinder in das Kanu steigen sahen, rollten sie wie eine Flutwelle an mich heran, um mit zu dürfen. Ich wehrte alle ab. Ich hatte etwas vor und ich musste mir beweisen, dass ich etwas schaffte, was vor mir noch niemand geschafft hatte. Ich musste dem Jungen die Angst fortnehmen. Seine Traurigkeit schnürte mir die Kehle zu und ich fühlte, dass es ein Sommer werden würde, der für mich nur schwer zu ertragen wäre, würde er seine Traurigkeit nicht verlieren.
So hockte ich also in meinem kleinen Boot und hielt mich mit beiden Händen am Poolrand fest. Das Wasser war gerade mal knietief, doch Wasser war nun mal Wasser und gefährlich, es war eine Substanz, die tödlich war und wie in Trance robbte ich mich in meinem Kanu sitzend zu Matt hinüber.
Als ich ihn einlud mit mir zu fahren, winkte er verängstigt ab. Doch ich ließ mich nicht abwimmeln und drehte eine der schlimmsten Poolrunden meines Lebens. Mein Atem ging schwer, während sich mein gesamter Körper krampfartig zusammenzog, sobald ich einige Spritzer der spielenden Kinder abbekam. Als ich wieder an ihm vorbeikam, fragte ich ihn erneut und versuchte ihn in mein Boot zu locken. Doch Matt wollte nicht. Ich versuchte also etwas mehr Freude in meinem Himmelfahrtsgefährt zu erzeugen, um ihn davon zu überzeugen, dass es Spaß machte und dass er etwas ganz Besonderes versäumte, wenn er nicht einstieg. Ich rang mir ein Lächeln ab und bat ihn immer wieder.
Und irgendwann schaffte ich es tatsächlich durch meine Hartnäckigkeit, ihn in mein Boot zu holen. Und so geschah es, das Matt und ich gemeinsam in einem Boot saßen, voller Angst und Schrecken, untergehen zu können und zu sterben. Und als ich in seine dankbaren, aber auch ängstlichen, wunderschönen blauen Augen sah, erkannte ich, dass wir irgendwie zusammengehörten. Matt und ich. Wir waren nicht mehr allein mit unserer Angst. Jetzt hatten wir gemeinsam Angst, aber wenigstens waren wir nicht mehr damit allein. Wir hatten uns. Und der Sommer war gerettet.
Die Seele ist ungeboren,
uralt, immer dauernd.
Sie wird nicht erschlagen,
wenn der Körper erschlagen wird.
Bhagavadgita
Eines Tages, es war im Frühsommer, kam Siggi und sein bester Freund Garry auf Joe und mich zugelaufen. Wir spielten gerade am Parkplatz mit Steinen, Joe und ich. Joe ging noch in den Kindergarten, so wie ich. Siggi nahm mich zur Seite und sagte: „Hör zu Isa, Garry muss dir was Wichtiges sagen und du musst dich daran halten, das ist eine neue Spielregel, verstanden?“
„Also“, begann Garry. „Wir gehen jetzt alle zusammen“, er zeigte auf Joe und einen großen Mann, er war einer der großen ehemaligen Kinder, die auf Besuch im Heim waren, auf mich, Siggi und sich selbst, „da hinunter.“ Ich blickte auf die Siebener-Wiese und den Wald, der an die Wiese angrenzte. „Ja, genau da gehen wir jetzt gemeinsam hin, wir alle, und wenn du irgend jemandem etwas von unserem Spiel verrätst, ich schwöre Dir, bringen wir deine Mama um. Verstanden? Deine und Joes Mama.“ Joes Mama war mir egal, aber Joe war sie nicht egal, und da uns unsere Mamas nicht egal waren, befolgten wir die Spielregeln. Wir waren ja nicht dumm.
Dann plötzlich, es passierte wie aus dem Nichts, gerade nachdem ich die Körpergröße des schwarzhaarigen Mannes festmachen konnte, erlebte ich ein Gefühl, das ich noch nicht kannte. Ich fühlte mich wie tot. Als wäre ich nicht mehr da. Aber ich wusste, ich war noch irgendwo. Nicht, dass ich nach mir gesucht hätte, aber plötzlich war ich weg. Ich sah meinen Körper und wie er sich wie der ferngesteuerte Robotermann, den Olli zum Geburtstag bekommen hatte, fort bewegte. Bisher hatte irgendetwas in meinem Gehirn meinen Körper gesteuert, ich konnte nicht benennen, was es war, doch dieses etwas, das mich bisher lenkte, war jetzt verschwunden.
Dann gingen wir hinunter auf die Wiese zum Marterl, das nahe am Waldrand lag. Garry und Siggi hatten Angst. Sie hatten panischen Schiss vor dem großen Mann, der Siggi anwies Schmiere zu stehen und aufzupassen. Joe zappelte wild umher, als müsse er aufs Klo. Ich beobachtete ihn wie aus der Ferne, wie er nervös von einem auf das andere Bein stieg und ich bemerkte, dass ich zwei verschiedene Blickwinkel eingenommen hatte. Irgendein Teil stand oben am Hügel und blickte zu mir und den anderen herunter und ein anderer Teil von mir schaute vom Waldrand aus zu, wie der Mann den kleinen Joe anwies, seine Notdurft vor Ort bei dem Marterl zu verrichten. „Eigenartig“, dachte ich, „dass Joe das nicht zurückhalten kann.“ Ich konnte es tagelang zurückhalten, wenn ich den Drang verspürte aufs Klo zu müssen. „Aber vielleicht“, so überlegte ich, „hatte Joe ja auch schon tagelang zurückgehalten und jetzt ging es nicht mehr, weil er Bauchweh bekommen hatte.“ Und ich wusste ja, wenn das Bauchweh kam, dann half kein zurückhalten mehr.
Der Haufen, den Joe verrichtete, stank erbärmlich. Das war wohl das Warnsignal, das sich kurz als Geruch eingeschalten hatte und das mir verdeutlichen sollte, verschwinde von hier. Doch das war auch schon das Einzige, was ich empfinden konnte, denn selbst der Gestank war nur einen Bruchteil von einer Sekunde, für meinen empfindlichen Geruchssinn wahrnehmbar. Ich hatte meinen Körper nicht unter Kontrolle, so dass ich ihn hätte weglaufen lassen können. Also blieb er an Ort und Stelle.
Ich sah, wie ich ausgezogen wurde, und das ganze im Höllentempo.
Dann erblickte ich mich auf allen Vieren im Gras knien. Joe kniete vor dem Mann und es sah so aus, als würde er das Geschlechtsteil des Mannes beinah verschlucken, während dieser mit seinem Fuß auf meinen Kopf trat. Er drückte so fest, bis mein Gesicht in Joes Haufen, eingesunken war. Dann hörte ich ein tiefes, höhnisches Lachen und bemerkte Siggi, der sich unsagbar fürchtete. Garry stand Schmiere. Siggi und Joes Kopf wurden von den Händen des Mannes in seinen Schoß gepresst, was ihm scheinbar ein gutes Gefühl machte, so wie ich es bei Siggi immer tun musste. Dann riss er beide an den Haaren von sich weg. Und als ich sah, wie sich der Mann hinter mich kniete, der arme Joe an Siggi weitersaugte, und dabei würgte, als müsse er sich übergeben, verließen mich auch die beiden Blickwinkel, durch die ich noch das eine oder andere hatte wahrnehmen können.
Ich wusste nicht, wie lange das Höllenspiel gedauert hatte und wie ich wieder nach Hause gekommen war, noch, wie ich mich von den Fäkalien gesäubert, oder wie und wer mich wieder angezogen hatte. Ab diesem Zeitpunkt war ich irgendwie nicht mehr der, der ich vorher war. Irgendetwas fehlte. Und wie ich es immer tat, wenn ich etwas verloren hatte, versuchte ich es zu finden. Doch dies schien schwerer zu sein, als ich gedacht hatte. Denn wie findet man etwas, von dem man nicht weiß, was man verloren hat. Die einzige Möglichkeit, um mich nicht weiter zu quälen war, zu vergessen, dass ich etwas verloren hatte.
Wochen danach entdeckte meine große Schwester Ari, als sie zu Besuch bei uns war, und mich badete, dass mein gesamter Genital- und Afterbereich voller eigenartiger Geschwülste und Warzen war. Und unter dem Jucken und Brennen dieser eigenartigen Krankheit, die sich irgendwie dann auch noch auf meiner ganzen Haut ausbreitete, litt ich sehr lange Zeit.
Irgendwann dazwischen, an einem Sommertag, bemerkte ich, dass auch Siggis Koffer gepackt waren. Olli nahm mich zur Seite und umarmte mich. „Nah siehst du“, sagte er. „Ich wusste ja, dass du am Abend bald deine Ruhe haben wirst von ihm.“ Ich sah ihn verwundert an, aber traute mich nichts zu sagen. „Ja, ich weiß, dass er Dinge mit dir tut, die verboten sind“, sagte er. „Ich weiß das, weil ich im Nebenzimmer alles hören kann und als ich einmal nachschauen kam, hab ich´s gesehen.“ Olli sah mich merkwürdig an, und legte seinen Arm um mich. „Siggi drohte mir, dass ich niemanden etwas sagen darf. Aber, ab jetzt kann Siggi dich nicht mehr umbringen.“ Olli lächelte glücklich und drückte mich immer fester, bis mir von seiner Umarmerei schwindelig wurde.
„Ja genau“, dachte ich, „wenn er nicht mehr da ist, kann er auch Mama nicht mehr umbringen.“ Gott, war ich glücklich, dies zu wissen.
Olli und ich feierten unser ganz heimliches, stilles Siggi Abschiedsfest. Wir feierten es am Parkplatz vor unserem Haus. Wir umarmten uns und tanzten Ringelreihen. Ich sah Siggi noch nach, wie er in einem Auto verschwand, genauso wie ich hierhergekommen war. Er verschwand, leise und ohne ein Wort des Abschieds. Und irgendwann, nachdem wir fertig getanzt hatten, begann ich zu weinen. Ich weinte um Siggi. Weil auch er jetzt gegangen war. Weil auch er mich im Stich gelassen hat, und ich nicht wusste, was ich davon halten sollte, von einem Alltag ohne ihn, ohne seine starken Schultern, auf denen er mich reiten ließ, und ohne die Spiele, die zu meinem Alltag geworden waren, die nun nicht mehr sein würden. Und ich wusste nicht, was dies nun für mich bedeutete. Ich war verwirrt. Aber das konnte ich Olli unmöglich erklären. „Isa“, sagte Olli noch, jetzt kannst du Mama alles sagen, und ich bin dein Zeuge. Du musst es ihr sagen, dann wird alles gut!“ Ich blickte stumm auf den nackten Asphalt und schüttelte dabei den Kopf. Und Olli wusste, ich würde lieber sterben, als Mama davon zu erzählen.
Zu Weihnachten bekam ich eine wunderschöne, lächelnde Puppe geschenkt. Sie hatte langes, blondes Haar und als ich ihr einen Irokesen-Haarschnitt verpasste, und ihr Gesicht mit einem wasserfesten Wäschestift, den ich nie benutzen durfte, völlig entstellte, erklärte mir Mama, dass ich nie wieder eine Puppe von ihr bekommen würde, wenn ich so schlecht mit meinen Spielsachen umging. Ich wusste nicht, weshalb sie zornig auf mich war, für mich stimmte, seitdem ich sie entstellt hatte, fast alles mit der Puppe. Nur ihre Augen machten mir noch Angst, daher schnitt ich sie ihr einfach aus dem Kopf heraus. Damit war die Sache besiegelt. Nie wieder würde ich eine Puppe bekommen. Doch Ari, meine ältere Schwester, die auch gleichzeitig meine Taufpatin war, schenkte mir zu meinem Geburtstag eine männliche Puppe.
Ari war Psychologin und Psychotherapeutin, was das genau war und was sie in ihrem Beruf eigentlich tat, war mir nicht recht klar. Ari fragte mich, nachdem sie meine entstellte Mädchenpuppe gesehen hatte, weshalb ich sie zerstört hätte. Ich antwortete nur, dass ich keine Mädchenpuppe haben wollte und sie jetzt besser aussah. Ich wollte nicht zugeben, dass ich tatsächlich nicht erklären konnte, weshalb ich sie zum Zombie habe werden lassen.
Die Buben-Puppe war wohl zu jener Zeit das neueste Modell im Puppensektor gewesen. Und anfangs fand ich sie wundervoll. Ich konnte ihr in den Mund Wasser einfüllen, das danach unten herauskam. Ich fand dies spannend, doch als Ari beim nächsten Mal, als sie mich besuchen kam, die Puppe mit abgebissenem Geschlechtsteil in irgendeiner Ecke liegend entdeckte, wollte sie wissen wieso. Ich konnte ihr keine Antwort darauf geben.
Ich dachte in dem Moment an Mama und an Siggi. Und erinnerte mich, dass ich eines Tages gemeinsam mit Siggi in der Badewanne gesessen hatte. Ich rutschte dabei auf Siggis angezogenen Beinen ins Wasser und hatte großen Spaß dabei, bis Mama sagte, wir sollten uns endlich waschen. Ich war froh, als ich endlich die Namen unserer Geschlechtsorgane kannte, denn als Siggi Mama nachäffte, „Isa, wasch deine Scheide“, und genau so tat wie Mama tat, spürte ich, dass man diesen Namen nie, niemals aussprechen durfte. Genau das gleiche galt auch bei dem Namen Glied. Gott, ich hasste es, wie sie es sagte. Sie sagte es angewidert und ganz leise, so als dürfte man auch dieses Wort nicht in den Mund nehmen.
Ich traute mich Ari nicht zu erzählen, dass Mama keine rechte Freude mit der Puppe mit dem Glied hatte und als ich es weggebissen hatte, war für mich wieder alles in Ordnung. Es war überhaupt alles in bester Ordnung, wenn man Geschlechtsteile und deren Namen nie erwähnte und am besten vergaß, dass sie existierten. Danach bekam ich auch von Ari nie wieder eine Puppe und den Puppenkasten, den sie mir dazu geschenkt hatte, nahm sie für ihre kleine Tochter mit. Ich hasste sie dafür. Denn der Puppenkasten war das einzige, das jemals so richtig mir gehörte und mit dem ich ständig gespielt hatte. Ich liebte seinen Holzgeruch. Und die Türen, die so bunt bemalt und mit Äpfeln verziert waren, konnte man wunderbar auf- und zusperren. Die kleinen Kleiderhaken mit der Puppenbekleidung darauf waren wie ein Wunderding, mit dem man eine garstig aussehende Puppe verstecken konnte und dieses Spiel liebte ich. Das Zombiepuppen-versteck-Spiel.
Aber ohne Puppe keinen gut duftenden Puppenkasten. Das waren die Spielregeln.
Und obwohl Siggi schon einige Zeit nicht mehr da war, und ich das Wort Scheide seit damals nicht mehr gehört hatte, war dieser Name, vor allem aber das Gefühl, das mir dieser Körperteil Tag für Tag bescherte, wann immer ich wegen meiner anhaltenden Bauchschmerzen ein gutes Körpergefühl brauchte, um die Schmerzen zu vertreiben, für mich zu einem alltäglichen Albtraum geworden, mit dem ich nicht umzugehen verstand. Ich wusste, dass „meine Scheide“ wichtig dafür war, mein immer wiederkehrendes stechendes Gefühl im Unterleib zu beruhigen. Auch wenn sie dafür verantwortlich war, dass ich überhaupt Schmerzen bekam, so war es doch der einzige Teil von mir, der es schaffte, für eine beruhigende Entspannung in meinem Unterleib zu sorgen.
Die Erwachsenen begehen eine barbarische Sünde,
indem sie das Schöpfertum des Kindes
durch den Raub seiner Welt zerstören,
unter herangebrachtem, totem Wissensstoff ersticken
und auf bestimmte, ihm fremde Ziele abrichten.
Bertrand Russel
Olli und Karl waren Zündler der Extraklasse. Wenn Karl was ausgefressen hatte, wurde stets der Ältere, also Olli beschuldigt. Auch wenn er nichts dafür konnte. Ich hielt zu Olli, wann immer es nur ging, stand ich für ihn ein. Und Olli für mich. Und mit Olli an meiner Seite, was sollte mir da noch groß passieren? Olli war bereits über acht Jahre alt und ich gerade mal sieben.
Tante Gerda war wieder da und vertrat Mama, die einige Wochen in Urlaub gefahren war. Die Holzspielhütte vor unserem Haus war relativ neu und von irgendwelchen netten Leuten gespendet worden. In dieser spielten wir Kinder immer Mutter-Vater-Kind. Und als Joe einmal darin Arzt spielen wollte, veranlasste ich Olli, die ganze Bude anzuzünden. Oh, wie ich sie hasste, diese Arztspiele. Olli ließ sich das nicht zweimal sagen. Er stachelte Karl an, der ohnedies ständig Blödsinn machte, und ich hockte mich auf die Schaukel vor der Spielhütte. Ich schaukelte so wild, dass ich mich darauf fast überschlug. Das Schaukeln gab mir immer das Gefühl eines Höhenrausches und fliegen zu können. Und wenn ich im Höhenflug meine Arme ausbreitete, gab mir das Schwindelgefühl, das meinen Körper überfiel, stets die Hoffnung, eines Tages vielleicht doch im Himmel zu landen. Und dieses Gefühl war genial. Olli und Karl stopften also die kleine Holzhütte mit trockenem Heu voll, das sie von der Siebener-Wiese geholt hatten. Der nette Bauer im Ort hatte mich vor kurzem auf seinem Traktor mitgenommen, als er es mit dem Mähwerk geschnitten hatte, und nun war es von der Sonne so ausgedörrt, dass es bereit zur Ernte war. Mein Hintern tat mir noch immer weh, weil ich mir auf dem Metallsitz, der sich seitlich des Traktors befand, in der Höllenhitze den Allerwertesten verbrannt hatte.
Olli befahl mir, Schmiere zu stehen auf der Schaukel, damit uns Tante Gerda nicht erwischte, und ich tat dies mit Hochgenuss. Währenddessen klatschte ich in die Hände vor Vorfreude und ließ meine Brüder noch mehr von dem Stroh und Heu sammeln. Schneller, schneller musste es gehen. Alles musste rein in die Hütte. Und dann holte ich Tante Gerdas Feuerzeug. Tante Gerda war Raucherin und ich wusste, wo sie ihre Sachen aufbewahrte.
Dann funkte es und ich lief zurück auf die Schaukel, auf der ich das Höllenspektakel freudig mit ansah, und während ich Olli und Karl dabei anfeuerte, noch mehr Stroh in die lodernden Flammen zu werfen, rief und johlte ich wie eine Verrückte. Doch als die Flammen dem Nachbarhaus gefährlich nah kamen, bekam ich es mit der Angst zu tun. Karl und Olli liefen vor Angst in den Wald und versteckten sich. Später erkannte ich, dass sie sich vor Tante Gerda versteckt hatten, die hinter unserem Haus hervor gerannt kam, und sich wild schreiend die Hände auf den Kopf schlug. Dann stoppte sie meine Schaukel, auf der sie mich aufgeregt zappelnd beobachtet hatte und knallte mir eine, dass ich die Sterne funkeln sah. In der Zwischenzeit waren bereits viele Leute mit Eimern und Kübeln herbeigelaufen, um das Feuer zu löschen. Doch die Hütte war bereits komplett nieder gebrannt. Mir brummte der Schädel von ihrer Ohrfeige, während Tante Gerda mich nach Mittätern ausquetschte. Aber ich verriet niemanden. Weder Olli noch Karl, die feige in den Wald gelaufen waren, um sich vor der drohenden Strafe zu verstecken. Danach hatte ich zwei Wochen lang Hausarrest. Olli verpasste sich selbst zur Verwunderung von Tante Gerda ebenso Hausarrest und verbrachte die gesamte Zeit bei mir. Und das fand ich sehr anständig von ihm.
In der Schule hatte ich eine Lehrerin, die mich mochte und die Lehransätze vertrat, von denen Mama sagte, sie wären schlecht für mich. Auswendiglernen fiel mir ganz besonders schwer. Ich sah keinen Sinn darin, irgendetwas in mein Gehirn zu hämmern, um es, nachdem ich darüber abgeprüft worden war, wieder zu vergessen. Aber diese Lehrerin versuchte mir all das Wissen, das sie in meinen Kopf bringen musste, über Materialien, die ich in die Hand nehmen konnte, nahezubringen. Und so lernte ich bis zum Ende der ersten Klasse, das Schule und Lernen etwas Schönes sein konnte.
Ich verstand nicht, weshalb sie nach der ersten Klasse die Schule verlassen musste und an ihrer Stelle der Direktor der Schule meine Klasse übernahm.
Doch verstand ich zum ersten Mal in meinem Leben, das Mensch nicht gleich Mensch war.
Es gab die Erste-Klasse-Menschen, zu denen sich Direktor Kahlschädel, so nannte ich ihn, weil ich ihn nicht leiden mochte, zählte und es gab Menschen der zweiten Klasse, und zu denen gehörten wir Heimkinder. Und als Vietnamesen-Kinder in unser Heim kamen, gab es selbst unter uns Heimkindern eine Unterteilung zwischen Erste- und Zweite-Klasse-Kinder. Insgesamt also erlebte ich, dass es drei Klassen von Menschen gab und ich war in der letzten.
Im Kinderheim waren wir Kinder bisher immer alle gleich gewesen und nun, da die Vietnamesen-Kinder da waren und die Vermischung zwischen den Seelenberg- und Heimkindern fortschritt, wurde der Alltag sehr schwierig für mich.
Direktor Kahlschädel war schon sehr alt. Er war riesengroß und hatte eine Glatze, die ein schneeweißer Haarkranz zierte. Wann auch immer der Kaugummiautomat vor der Schule geknackt wurde, es waren wir Heimkinder. Wann auch immer irgendetwas im Schulhaus geschah, dass nicht den Regeln entsprach und der Schuldige nicht gefunden werden konnte, waren es wir, die Heimkinder. Und eines Tages sagte er uns vor der gesamten Klasse, dass wir Heimkinder im zweiten Weltkrieg, in dem er als Nazi diente, als allererstes deportiert worden wären. Ich verstand das Wort deportieren nicht. Niemand verstand es. Doch er machte der gesamten Klasse verständlich, was er damit meinte, wenn er uns als minderwertig und als nicht lebensberechtigt ansah. Und diese Ansicht verbreitete sich wie ein Lauffeuer bei jenen Schülern, die nun ihre Chance gewittert hatten, Unterdrückung und Macht über uns auszuüben.
Mama hatte Angst vor ihm und auch der Heimleiter war nicht gerade ein Hilfe, wenn es darum ging, Kinder gegenüber einem Lehrer, einem Arzt oder Pfarrer zu unterstützen und beizustehen. Es gab diese Regel, dass Lehrer, Ärzte und Priester in der Hierarchie ganz oben standen und Frauen sowie Kinder ganz unten. Das Kinderheim wurde also von einem scheinbar netten, aber ängstlichen Patriarchen geführt, dem unsere Mamas gehorchten und unhinterfragt die Führung überließen.
Aber ich hatte Glück, denn ich hatte Heimfreunde, vier an der Zahl, die in meinem Alter und in meiner Klasse waren. Niemand konnte uns trennen und unsere Zusammengehörigkeit wuchs, umso düsterer und menschenverachtender unser Alltag wurde.
Im Heim fühlten wir uns frei. Wir konnten laufen und uns bewegen, wie wir es brauchten und wollten. So kam es auch, dass der obere Bereich des Kinderheimareals besiedelt werden sollte, und dafür musste ein großer Teil des Achter-Waldes abgeholzt werden. Die großen Kinder bauten aus den Holzstämmen Panzer und andere hüttenähnliche Gebäude, in die sie immer wieder uns kleinere kommen ließen.
Olli und ich waren fast immer unter jenen Kindern, die mit heruntergelassenen Hosen den Älteren, die in einer Reihe vor uns standen ein gutes Gefühl machen mussten. Ich kannte das Spiel schon und Joe kannte es auch. Doch Olli und viele andere kannten es noch nicht. Ich wusste, und das versuchte ich Olli zu erklären, dass es kein Entkommen mehr gab, sobald wir das erste Mal im Panzer waren. Wir konnten nicht alle Ewigkeit im Haus verbringen, vor allem darum nicht, weil uns Mama ja ständig hinaus ins Freie schickte, damit wir uns austoben konnten. Und sobald wir im Freien waren, schnappte uns schon eine Bande Älterer und zerrte uns nach oben zu den Panzern. Manchmal kam es auch vor, dass die Älteren, die zu Besuch nach Hause kamen, sich bei den Panzerspielen beteiligten. Dann veränderte sich immer die Hierarchie innerhalb der Panzergruppe, die oft über zehn Kinder dazu brachte, zuerst den Großen ein gutes Gefühl zu machen, indem sie sich gegenseitig etwas in den Körper stecken mussten. Die mittelgroßen Kinder kannten scheinbar die Vorlieben der Großen noch, als diese in ihren Häusern wohnten und befolgten ohne zu murren ihre Befehle. Ich war bei den Kleinen, und ich wusste, wenn ich ihre Gesichter vergesse, dann würde ich es überstehen, ich würde nicht umgebracht werden, nicht von den großen und auch nicht von Olli, so wie mir angedroht wurde und Olli müsste nicht so sehr unter der Drohung leiden, mir weh tun zu müssen. Also hatte auch er einen Weg gefunden, nicht so sehr unter den Panzerspielen zu leiden, wenn er es mir nachmachte, das Vergessen der Gesichter.
Und Olli verstand, dass ich Recht hatte. Auf diese Weise würden wir beide überleben. Auch, wenn wir uns voneinander immer mehr entfernten und uns nach und nach immer öfter gegenseitig die Köpfe einzuschlagen drohten.
Peppi, der Große, war ein ganz besonderer Junge von vierzehn Jahren. Wenn ich den anderen zuhörte, wurde er der Sadist genannt. Ich wusste zwar nicht, was ein Sadist war, da ich das Wort nur im Zusammenhang mit dem großen Peppi kannte. Peppis Mama mochte ich, abgesehen von meiner eigenen, am liebsten leiden. Denn immer, wenn ich Fernsehverbot bekam und Mama war oft streng, ließ sie mich, auch die für mich immerzu verbotenen Programme angucken, sobald ich mit Kim, ihrer Tochter, ankam. Ich fand Kims und Peppis Mama einfach cool. Ihrer Zeit weit voraus, was vor allem das Thema Religion anbelangte, und sie hatte eine lockerere Art, ihre Kinder zu erziehen. Mit Peppi hatte sie nicht gerade das große Los gezogen, und sie wusste schon lange nicht mehr, wie sie den Burschen zügeln konnte.
Es war tiefer Winter und Peppi ließ meine sieben Freunde und mich in einer Reihe aufstellen.
Zuerst stellte er Olli in die Reihe, danach das Nachbarmädchen Hilde, nach ihr kamen noch fünf weitere, wobei Kim direkt neben mich gestellt wurde. Dann stellte er sich, mit einem Stock ausgerüstet, vor uns hin und befahl uns, uns gegenseitig ins Gesicht zu schlagen. Kim dachte nicht lange darüber nach und knallte mir eine, damit er endlich Ruhe gab. Ich versuchte großen Schmerz vorzutäuschen, denn Kims Ohrfeige war nicht sehr hart ausgefallen, doch Peppi bemerkte meine Lüge und das konnte nur noch mehr Strafe bedeuten.
Ich betrachtete die in der Reihe stehenden Kinder, allesamt meine Freunde, und wie sie zitterten vor Angst und Kälte. Dann rieb er einen nach dem anderen so hart mit Schnee ein, dass ihre Gesichter rote Flecken und Schürfwunden aufwiesen. Mich selbst drückte er mit dem Gesicht voraus so tief in einen Schneehaufen, bis ich kaum noch atmen konnte, ließ die anderen mich auslachen und mit den Fingern auf mich zeigen. Dann befahl er Kim, mich in die Schneeburg zu bringen, die bereits mehr einer Eisburg glich, nachdem er sie tagtäglich mit Wasser übergossen hatte. Ich kauerte also darin und sah dabei zu, wie es immer dunkler darin wurde, weil meine Freunde mich darin einbauen mussten und mich vor dem Abendessen nicht nach draußen lassen durften. Und jetzt war es kurz nach eins am Nachmittag.
Ich weiß nicht, wie Kim es geschafft hatte, die Flucht nach vorne anzugreifen und ihn übers Ohr zu hauen. Ich weiß nur, dass sie ihre Mama zur Hilfe holte, die mich dann mit Kim gemeinsam aus dem Eishaus ausgrub. Seit jenem Moment wusste ich, dass Peppi nicht gerade der Hellste war, und dass es möglich sein musste, ihn irgendwie einmal eines auszuwischen.
Diese Chance ereilte mich im Frühling, als er uns zu viert auf einen hohen Baum hinauf scheuchte und uns auftrug, sobald wir oben wären, herunter zu springen. Ich wusste aber, sollte ich hier springen, würde ich mich mit Sicherheit schwer verletzen, und meine Freunde ebenso. Peppi stand unten Schmiere und bellte an uns hoch, keine solchen Feiglinge zu sein.
Dann hatte ich eine Idee. „Peppi“, rief ich, „du musst uns schon zeigen, was du genau meinst, mit runterspringen.“ Peppi verstand meine Anforderung an ihn nicht recht und kläffte wie ein alter Köter zu mir nach oben. „Du Göre, tust jetzt was ich sage und springst da runter.“ Mit dem Finger zeigte er auf den Abhang, der sich unter dem Baum auftat. „Peppi“, erwiderte ich mich dumm stellend, „von welchem Ast genau müssen wir springen?“ Und er antwortete nur, von dem da drüben und zeigte mit seinen fleischigen Fingern darauf. „Ich weiß nicht, welchen Ast du genau meinst? Zeig uns doch, von welchem wir springen sollen und zeig uns auch, wie wir aufkommen müssen, damit wir uns nicht das Bein brechen.“ Dem Peppi wurde meine Fragerei zu blöd und er stieg tatsächlich zu uns hoch. Träge und behäbig sah er aus, wie er sich zu uns nach oben robbte. „Ich zeig dir gleich den Ast und dann springst du, verstanden?“ Ich beobachtete ihn genau. Und wie er sich bewegte, ließ für mich nur einen Schluss zu: „Der große fette Kerl war viel zu langsam für mich.“ Dann fasste ich mir zwischen die Beine und zappelte nervös umher. „Peppi, ich muss mal. Ganz dringend. Ich lauf mal schnell aufs Klo und du wartest derweil auf mich, bis ich zurück bin, denn ich will das ja sehen, wie du da so mutig runter springst.“ Peppi schnaufte wie ein Walross und setzte sich erst mal auf den erstbesten Ast, um eine Verschnaufpause einzulegen und sagte: „Ja renn, aber du kommst sofort wieder oder es gibt Dresche.“
Ich wusste, dass er springen musste, denn das Herunterklettern würde ihm noch schlechter gelingen, als das auf den Baum klettern. Außerdem würde er, mutig wie er immer tat, sich niemals vor uns Kleinen die Blöße geben wollen, zu viel Angst zu zeigen und nicht springen. Ich hoffte darauf, dass er es tatsächlich tun und sich die drei, vier Meter in den Abhang hinunterfallen lassen würde. Ich hoffte und stellte mir vor, wie er sich dabei das Bein brach. Dann gab ich den anderen ein Handzeichen und diese kletterten von den verschiedensten Ästen, auf denen sie verängstigt hockten, tiefer nach unten, direkt an dem dummen Peppi vorbei. Kim klopfte ihm auf die Schulter und zeigte nach oben. „Schau, wir machen unserem Anführer jetzt Platz. Du bist unser Chef, unser Anführer, und jeder Anführer muss als erstes springen, oder?“ Peppi sagte kein Wort. Irgendwie schien er nervös zu sein und hielt sich klammernd am Baumstamm fest. Ich freute mich, weil Kim so schlau war, und rieb mir dabei die Hände.
Dann lief ich, was das Zeug hielt den Hügel hinunter, um nach Hause zu kommen, und Hilfe zu holen. Doch während ich lief, drehte ich mich noch einmal zu den anderen um, die allesamt vom untersten Ast gesprungen waren und nun Peppi anfeuerten, es von ganz oben zu tun.
Dann sah ich nur noch, wie er fiel und mit ihm ein Haufen kleinerer Äste, an denen er sich festzuhalten versuchte. Dann hörte ich noch einen Schrei und schon liefen alle in weitem Bogen auseinander. Ich wunderte mich noch, weil Peppi ihnen nicht hinterdrein war, um sie allesamt zu verdreschen, so wie er es angedroht hatte. Und etwas später hörten wir die Rettung, wie sie mit Blaulicht daher gebraust kam und den verletzten Peppi mitnahmen.
Einige Tage später, als ich an Kims Haus vorbeikam, sah ich ihn dann, humpelnd mit Gipsbein. Ich blieb keck vor ihm stehen und zeigte ihm die Zunge. Er ballte sogleich seine Faust und mir war klar, dafür würde ich büßen müssen. Aber dieser Tag war nicht heute, und wenn er seinen Gipsfuß noch eine Weile tragen musste, auch nicht morgen. Alles weitere interessierte mich zu diesem Zeitpunkt einen Dreck. Daher trat ich noch näher an ihn heran und beleidigte ihn mit Schimpfwörtern, die ich normalerweise nicht in den Mund nahm, es aber nun tun musste, um meine Rache an ihm auskosten zu können. Sein Drohen und Zetern wurde immer schlimmer und versetzte mich doch einigermaßen in Angst. Dann setzte er zum Laufen an, doch kam dabei nur ein gehetztes Humpeln heraus, und unter seinem zornigen Gegröle wirkte er auf mich wie ein dicker dummer Zwerg, der meinen flinken Füßen niemals folgen konnte. Ich wünschte mir lauthals schreiend, dass er ein für alle Mal aus meinem Leben verschwinden sollte, und als ich ihn so toben sah, vor Zorn, weil er mich nicht erwischen konnte, wurde mir klar, dass ich ihm auch den kaputten Fuß regelrecht gewünscht hatte und nicht viel später mein Wunsch in Erfüllung gegangen war. Seine Drohungen, mich kurz und klein zu hauen, konnte der sadistische dumme Peppi nie wahrmachen, denn bereits am nächsten Tag wurde er abgeholt und kam nicht wieder. Ab jenem Zeitpunkt, als mir klar wurde, dass ich etwas bewegen und gewisse Begebenheiten zu meinen Gunsten steuern konnte, begann ich mir verschiedene Dinge zu wünschen und beobachtete, ob und wie schnell sie sich erfüllten. Nicht alles funktionierte sofort, doch erkannte ich, dass es bei meiner Wünscherei, sollte sie in Erfüllung gehen, immer um tiefe Wünsche gehen musste, die ich in meinem Herzen fühlen konnte. Konnte ich den Wunsch nicht fühlen, so ging er auch nicht in Erfüllung.
Von da an wusste ich insgeheim, ich war eine Hexe. Und eine gute noch dazu. Doch das durfte ich niemanden sagen, und erst recht nicht Mama, die mich dann als Sünderin ausgeschimpft und zur heiligen Beichte geschickt hätte.
Irgendwann im Herbst starb Mamas Mutter. Aufgereiht in Reih und Glied stand Mama und die anderen Geschwister im Wohnzimmer, während Mama abwechselnd betete und weinte. Ich stand einfach nur da und wunderte mich, weshalb alle so traurig waren. Ich verstand den Tod nicht, wie ihn Mama und die anderen verstanden. Er schien für sie alle sehr schmerzhaft zu sein, doch ich konnte nichts Leidvolles am Tod erkennen. Für mich war der Tod gleichgesetzt mit dem Licht, das ich immer wieder sah, wenn ich abends nicht einschlafen konnte. Dieses Licht rotierte in weiter Ferne vor mir her, und wann immer ich es vor meinen inneren Augen erblickte, hatte ich das Gefühl, dass es mich mitnehmen wollte in eine Welt voller Liebe und Glück. Und als ich so dastand und meiner Familie beim Weinen zusah, begann auch ich zu weinen. Es war ansteckend, wie eine Krankheit, das Leid und das Weinen, und ich weinte einfach mit, ohne zu wissen warum.
Versuche stets,
ein Stückchen Himmel
über deinem Leben freizuhalten.
Sören Kierkegard
Olli steckte den Kopf aus dem Türrahmen und sagte: „Hey Isa, was packst du alles ein für Caldonazzo?“ „Mama packt meine Koffer“, entgegnete ich kurz, während ich ebenso wie er meinen Kopf aus dem Zimmer streckte. „Ich freu mich schon so, vor allem auf den Zug.“
Olli nickte mit dem Kopf „Ja, das wird ein Erlebnis, wart´s nur ab.“ Beide grinsten wir wie Honigkuchenpferde, die auf und davon in die Sommerferien galoppierten. Hinein in den Sommer, ab in den Süden, wo alle Heimkinder aus dem ganzem Land hinfuhren, und das für ganze sechs Wochen lang. Nur Mama fuhr nicht mit. Sie hatte Urlaub zu dieser Zeit. Urlaub von uns Kindern und wir wohl auch von ihr, irgendwie.
Von den großen Kindern hörte ich immer: „Entweder du liebst Caldo oder du hasst es. Ein dazwischen gibt es nicht.“ Und ich liebte es jetzt schon. Ich hatte Zigeunerblut in mir, ein Halbblut also, genauso wie mein Vater, den ich allerdings nicht kannte.
Was konnte es für mich schöneres geben als mit dem Zug in ein fremdes Land zu fahren, eine andere Sprache zu hören, die Fremde zu erleben, wie ich sie nur gemeinsam mit meinen Freunden und Gleichgesinnten erleben konnte. Was um alles in der Welt konnte schöner und erfüllender sein, als meinen Körper im Überangebot an Sport, den es dort gab, zu fühlen, meinem Ehrgeiz, bei den Veranstaltungen zu gewinnen, zu frönen, und mich am Caldosee am Strand zu vergnügen. Ich konnte es nur lieben, allein die Vorstellung reichte völlig aus, und ich wusste, ich würde dem Paradies begegnen.
So hockten wir alle Heimkinder aus Seelenberg, die alt genug waren, um mit zu können, so auch Karl, Olli und ich, in den mittleren Reihen des Busses, der uns zum Zug nach Klagenfurt bringen sollte.
Mama und die anderen Mütter, die zurückblieben, standen auf dem Parkplatz und winkten uns zum Abschied. Ich fühlte mich frei und war voller Vorfreude, als ich ganz plötzlich bitterlich zu weinen begann. Mama kam an meine Fensterscheibe gelaufen und winkte mich noch einmal zu sich heraus. Ich lief noch einmal zu ihr, drückte sie und küsste sie ein letztes Mal, und begab mich dann wieder an meinen Sitzplatz. Ganze sechs Wochen würde ich sie jetzt nicht mehr sehen.
Die Betreuer waren Fremde für mich, doch ich mochte sie sofort gut leiden. Besonders Luis, ein groß gewachsener starker Mann mit Dreitagebart, hatte es mir sofort angetan. Und so wie es aussah, ich auch ihm. Ich liebte es, wenn er mich mit seinen starken Armen aufhob und auf seine muskulösen Schultern setzte, um mit mir einige Runden zu drehen. Und umso schneller er mit mir umherlief, desto schwindeliger wurde mir, was mir immer ein Gefühl von „am Leben zu sein“ vermittelte.
Kim und ich liebten Fußball. Und da es für Mädchen keine eigene Fußballmannschaft gab, gründeten wir eine. Schon bald hatten sich auch andere Heime mit dieser Idee angefreundet und dann spielten wir Meisterschaften gegeneinander. Einige Heime hatten allerdings zu wenige Mädchen in der Mannschaft, sodass Kim und ich ständig dazu eingeladen wurden, in ihren Mannschaften als Stürmerinnen zu agieren und den gegnerischen Torfrauen das Fürchten zu lehren. Ich war wild und ungezähmt, so wie Kim und meine anderen Freundinnen.
Das Seelenberger Heim war unter den über dreißig anderen Heimen, die im Caldo-Camp waren, als „Sportnation“ bekannt. Schwer zu besiegen und schnell wie die Wiesel waren wir, und dies bestätigte sich immer wieder, sobald es um sportliches Miteinander-Messen ging.
Das große gepachtete Areal, welches an den Caldosee angrenzte, säumte eine Armada von Zelten und Bungalows. Die Leute aus dem Krankenbungalow kannten mich gut, wegen meiner ständigen Verletzungen, die ich mir beim herumtoben zuzog. Wegen meiner permanenten Bauchschmerzen ging ich nur einmal ins Krankenbungalow. Dass ich an einer Blinddarmreizung litt, um die ich mich, wenn ich wieder zu Hause wäre, kümmern müsste, wurde mir erst am Ende der Ferien mitgeteilt.
In diesem meinem ersten Jahr in Caldonazzo erfuhr ich, was es hieß, schwimmen zu können, denn ich lernte es im Eiltempo, gemeinsam mit Matt. Ich lernte, dass barfuß Laufen beim Lagerfeuer sehr gefährlich und schmerzhaft sein konnte, vor allem dann, wenn man, so wie ich, auf eine glühende Eisenstange trat und sich dabei die gesamte Fußsohle bis aufs Fleisch verbrannte. Ich erfuhr abends, wenn wir in unseren Schlafsäcken lagen und Geistergeschichten hörten, dass es einen Yeti gab, der oben am Weinberg sein Unwesen trieb.
Ich erlebte, was es bedeutete, bei den Schwimmmeisterschaften Erste zu werden, und dass meine panische Angst, der Teufel wäre hinter mir her, daran schuld war, mich zu Höchstleistungen anzutreiben. Und außerdem erfuhr ich, was es bedeutete, wenn ich Siebenjährige gegen Zehn- und Zwölfjährige schwamm und haushoch gewann, weil ich die Angst, sterben zu können, zu meinem Freund habe werden lassen, den ich Tod nannte. Diesen Vorteil schöpfte ich aus, egal ob es sich um Leichtathletik oder Völkerball handelte, denn ich brauchte den Kampf und den Genuss des Sieges über mich selbst. Dass ich dabei ständig die Anderen besiegte, war nur ein Nebenprodukt meiner Gier, meinen Körper und meine Seele fühlen zu können. Für all meine Siege wurde ich hoch gelobt und gefeiert, was mir bestätigte, dass es im Leben nur darum zu gehen schien, wer gewann und wer nicht. Und dass sich danach die Allgemeinheit ein Bild davon machte, ob man ein Gewinner oder ein Verlierer war. Dass ich in meinem Innersten verloren hatte, und mein Schmerz mich dazu brachte, meinen Körper zu Höchstleistungen zu treiben, interessierte niemanden, auch mich selbst nicht, da es bedeuten würde, wieder auf der Verliererseite zu landen, zumindest in den Augen der Anderen.
Tante Greta, meine Betreuerin lehrte mich, was es bedeutete, wenn einem mit einer Mittelohrentzündung ins Ohr geschrien wurde, so dass ich danach aus meinem Ohr blutete. Auch erfuhr ich, was es hieß, vor allen anderen Kindern nach Läusen durchsucht zu werden und das tatsächlich siebzehn Stück von diesen Viechern aus meinem langen dunkelblonden Haar gekämmt wurden. Dass ich mir die Zahl siebzehn zum ersten Mal erst vorstellen und begreifen konnte, nachdem ich die siebzehn Läuse vor mir aufgeknackt auf dem Klopapier liegen sah, erfüllte mich mit solchem Stolz, weil es mir in der Schule nie gelungen war. Und ich erfuhr, dass es Mädchen in meiner Gruppe gab, die so wie ich ihre Stockbetten verhängten, damit sie nicht dabei gesehen werden konnten, wenn sie abends ihren Körper hin und her wiegten und dabei den Kopf von der einer auf die andere Seite schleuderten.
Ich erfuhr von dem Kick, den ich dabei hatte, wenn ich die noch grünen und unreifen Früchte, die auf der Apfelplantage hinter unserem Bungalow wuchsen, plünderte, und als Strafe dafür drei Tage lang an Durchfall litt. Und was es bedeutet, so starkes Heimweh zu haben, dass ich dachte sterben zu müssen, wenn ich nicht Olli oder einen meiner Freunde gehabt hätte, die mich in den Arm nahmen, wenn es mal wieder vorkam, die Sehnsucht nach Mama, und das konnte durchaus mehrere Male in der Woche sein.
All dies hinterließ in mir ein Gefühl, den Himmel auf Erden gefunden zu haben. Denn Caldo machte mich frei. Frei im Denken, in meinen Gefühlen und in meinen körperlichen Handlungen, die ich mehr als irgendwo sonst in so hohen Maßen sportlich ausleben konnte.
Im Jahr darauf kam nur wenig hinzu. Doch dieses Wenige zeigte mir, dass selbst der Himmel auf Erden nicht vollständig und voll Liebe war. Das ehemalige Heimkind Herold, der bereits erwachsen war und mit seiner Frau und seinen Kindern das Camp für einige Wochen besuchte, brach in meine Idylle ein und zerstörte sie. Mit jedem Mal, wenn er uns Mädchen im Wasser jagte und keine Gelegenheit ausließ, uns zwischen den Beinen nach oben zu heben, um wollüstig seine Finger in unsere Körper zu schieben, starb ein Stück meines Paradieses, und mit ihm auch ein Stück Hoffnung auf ein Leben ohne Angst. Ich erkannte, dass es auf Erden wohl nirgendwo einen Platz für mich gab, an dem ich mich restlos sicher fühlen konnte. Aber von nun an wusste ich auch, dass ich nicht mehr alleine war mit der Wahrnehmung, dass es nicht richtig war, was Herold tat.
Mit diesem Zeitpunkt erlebte ich einen Bewusstseinsschub, der mir erlaubte zu verstehen, dass auch das Ständige-in-der-Reihe-Knien und Gute-Gefühle-machen-zu-müssen nicht richtig war. Aber mir war auch bewusst, dass mein Leben genauso weitergehen würde wie bisher. Denn niemanden schien dies zu interessieren. Selbst, als sich zwei der älteren Jungen, vor einigen anwesenden Kindern gegenseitig ihr Geschlechtsteil in den Mund des anderen steckten und dabei Grimassen zogen, und dies die Betreuer erfuhren, wurde laut gelacht. Beide Jungen wurden ausgelacht, auch von den Kindern, die sichtlich angeekelt umherstanden und während sie alle peinlich berührt lachten, hörte ich die Worte „Ja, ja! Die zwei waren noch nie die hellsten und sind auch jetzt nicht ganz richtig im Kopf.“ Mit diesen Worten wurde mir klar, dass es auch für mich nur ein Lachen geben würde.
Das nach Hause kommen von Caldo war immer etwas ganz Besonderes. Mama hatte dann immer das gesamte Haus blitzblank geputzt. Obwohl sie schon immer eine besonders reinliche Frau war und auf Sauberkeit großen Wert legte, gab sie unserem zu Hause im Moment des Heimkommens eine ganz besondere Note. Es roch dann immer nach Bonawachs-Paste und nach Möbelpolitur, die nach Bienenhonig duftete. Unsere Betten waren wunderbar gerichtet, und bereit in ihnen zu versinken.
Und beinahe jedes Jahr bekam Mama ein und dasselbe Hallo-Geschenk, in Form eines selbstgefertigten Tonaschenbechers, obwohl sie doch strikte Nichtraucherin war. Es war die leichteste Übung, der Aschenbecher, und da ich nicht besonders geschickt war im Tonbasteln und Modellieren, kreierte ich im Bastelzelt des Camps, wie meine anderen Geschwister in den Jahren zuvor, ein neues Modell eines Glimmstängelhalters.
Mama besaß bereits mehr als zwanzig Stück davon. Doch sie hatte sich nie darüber beklagt, sondern mir immerzu ihre absolute Freude darüber zum Ausdruck gebracht, dass ihr etwas Selbstgemachtes als Geschenk am meisten Freude bereitete, denn es bedeutete, ich hatte mir Zeit genommen, um mich mit ihr zu beschäftigen und ihr etwas Schönes, aus dem Herzen kommend, gebastelt. Was es letztendlich war, schien ihr völlig gleichgültig zu sein. Und das fand ich immer besonders schön, weil sie mir dadurch immer das Gefühl vermittelte, dass ich ihr wichtig war und dass es Bedeutung hatte, was auch immer ich für sie in Liebe tat.
Das „Wie“, die Methoden, die Systeme,
sie alle sind Erfindungen des Denkens,
daher sind sie begrenzt,
daher taugen sie nichts.
Wenn Sie das aber verstehen und die Wahrheit erkennen,
dass kein System jemals den Geist befreien kann,
dann ist die Freiheit augenblicklich da.
Krishnamurti
Die Erstkommunion, ein katholisches Ritual für Kinder, stand bevor. Es bedeutete, dass man Gott oder Jesus in Form einer Oblate in den Mund gesteckt bekam, hinunterschluckte und dadurch Gott in seine Seele einlud. Die Religionslehrerin und Mama machten aus der Vorbereitung dazu ein wahres Spektakel. Der ganze Ort war Wochen zuvor in fieberhafter Vorbereitung für dieses heilige Szenario, das weder ich noch meine Klassenkammeraden wirklich verstehen konnten.
Stattdessen freute ich mich darauf, als Vorsängerin in der Kirche zu agieren. Und da ich meiner schönen Singstimme wegen, wie man mir versicherte, mit zwei anderen Kindern dazu auserwählt wurde, stimmte mich das Wissen darum einigermaßen aufgeregt.
Doch bevor man die Oblate in den Mund gesteckt bekam, was einem Privileg ausnahmslos für Christen gleichkam, hatte man sich auf die heilige Beichte vorzubereiten.
Mama versuchte mir immerzu den Sinn der Beichte klarzumachen und legte mir nahe, meine Sünden auf einem Blatt Papier nieder zu schreiben, da ich sonst alle meine Unfehlbarkeiten vergessen würde und diese nicht verziehen werden konnten.
Natürlich überprüfte sie, was ich mir notierte, und gab mir den einen oder anderen Anhaltspunkt, was ich angestellt hatte und ich empfand diese Tortur immerzu als demütigend. Ich empfand mich selbst nicht als Sünderin, sondern fühlte mich als Kind unschuldig, aber auch unfrei. Vielleicht, so dachte ich, lag meine Unfreiheit in irgendeiner Sünde verborgen, die ich irgendwann einmal begangen hatte. Doch ich konnte mich an keine Tat erinnern, die derart böse gewesen wäre, dass ich diese Freiheitsstrafe und den Entzug von Lebensenergie verdient hätte.
So kam es, dass ich mich bei meiner ersten heiligen Beichte nicht an das Blatt Papier mit den üblichen Fehlbarkeiten hielt, sondern log, was das Zeug hielt. Ich wurde sozusagen mitten im Beichtstuhl ganz bewusst zu einer Diebin, einer von Rache und Hass getriebenen Sünderin und Schlägerin, die ständig ihre Brüder verprügelte. „Was für ein Schwachsinn“, dachte ich mir und musste dabei lachen, als ich erkannte, dass mir der Pfarrer jedes meiner Worte anstandslos glaubte. Ich hatte also mitten im Beichtstuhl das Lügen gelernt.
Zur Strafe Gottes hatte ich im Anschluss drei Vater-unser zu beten und drei Ave-Maria und abends sollte ich noch zwei Gesetzchen Rosenkranz beten. Von da an wusste ich, weshalb Mama ständig in die monotonen Wiederholungen des Gebetes hinein kippte.
Denn an diesem Abend fühlte ich mich, während ich so das Gebet aufsagte, als würde ich in andere Gefilde getragen. Weit, weit weg, in einer anderen mir sehr bekannten Welt existierte ich, in reinem Nichts, in unendlichem Sein. Das dieses Gebet eine Art Tor zu einer inneren Welt war, die ich ja bereits bestens kannte, und für das Betreten derselben ich dieses Tor jedoch noch nie gebraucht hatte, wurde mir Mamas Glaube etwas verständlicher. Und ich erinnerte mich plötzlich daran, dass genau dieses Gefühl dasselbe war, für dessen spüren und leben ich immerzu ausgeschimpft wurde, sobald ich in der Schule abwesend auf irgendeinen Punkt im Raum oder aus dem Fenster blickte.
„Isa!“, wurde ich dann immer abgemahnt, „wo bist du schon wieder mit deinen Gedanken und sei endlich bei der Sache.“ Aber gerade das war es ja, ich war in keinem Gedanken, sondern ganz frei, ohne Gedanken, die mich marterten und mich für die Zeit, in der ich mich in diese freie Welt zurückzog, etwas erholen konnte.
Ich wusste an diesem Abend, ich hatte etwas Wichtiges entdeckt. Und dass die Grenze, die ich immer zwischen der Religion meiner Mama und mir spürte, gar nicht existierte. Zumindest nicht für mich. Es war dieselbe Sache, derselbe Seelenzustand. Nur wurde der Zugang, den ich dazu hatte, als böse und Sünde angesehen, und das religiöse christliche Gebet hochgehalten, als der einzige erlaubte Zugang zu Gott.
Langsam begann ich die Religion als das zu verstehen, was sie im eigentlichen auch war. Eine Möglichkeit dorthin zu gelangen, wo andere Menschen, so wie ich, ohne religiöse Verbote und Mahnungen hingelangen konnten.
Und wenn das, was ich in dieser „anderen“ Welt, die niemand mit seinen Augen sehen konnte, als Freiheit und Unendlichkeit fühlen konnte, Gott war, so musste ich erkennen, dass ich Gott nie verloren hatte, sondern das Gott in mir war. Das ich selbst Gott war, denn in diesem Gefühl gab es niemanden, der mich strafte oder sich ober mir platzierte und mir Vorschriften machte. Es gab keine andere Existenz neben mir, sondern nur alle Existenzen in mir. So verbunden mit allem was ist, erfuhr ich was es hieß, alles was ist, zu sein.
Ich war also nicht von Gott getrennt, kein schlechter sündiger Mensch, wie ich durch die Kirche gelehrt wurde. Und mein Verstand konnte zum ersten Mal verstehen, was es heißt, in Sünde zu leben. In Sünde zu leben und das was damit gemeint war, war das Gefühl, von allem getrennt zu sein, außerhalb dieser Ebene der Unendlichkeit. Genau das musste die Sünde sein, von der mir erzählt wurde. Doch in dieser, meiner anderen Welt, frei von Gedanken und Bestimmungen, konnte nichts Böses existieren. Und da ich die reale, sichtbare Welt großteils aus diesem Bewusstsein heraus betrachtete, erlebte ich immer, wenn ich aus meiner heilen Welt zurückkam, hinein in die Welt der Gedankenfluten und Kopflastigkeit, dass es eine reale Welt war, in der Gut und Böse einfach existierten und ich darin irgendwie überleben musste. Doch dies war nur zu schaffen, wenn ich meine Auszeiten in der anderen, friedlichen und unendlichen Welt hatte, in der kein Gut und Böse existierte.
Ich war aufgeregt an jenem Tag der Erstkommunion. Die Kirche im Ort war zum Bersten voll. Stolze und weniger stolze Eltern, weil sie weniger heilig und andächtig taten als die üblichen Kirchgänger, drängten sich um die besten Plätze ganz vorne im Kirchenschiff. Und als ich ganz allein, zitternd das Mikrophon haltend, zu singen begann, war ich schlagartig wieder in den Seelenzustand geglitten, den ich Himmel nannte und in dem mich niemand mehr erreichen konnte.
Später erzählte mir Mama voll Stolz, dass ich einige Leute zum Weinen gebracht hatte mit meinem Gesang, und dass sie sich im Anschluss des Festes an sie gewandt hatten, um ihr davon zu erzählen.
Doch dass ich mein schneeweißes Kleid am Ende des Festes von oben bis unten mit Kakao bekleckerte, und sich auf dem teuren Seidenstoff eine Spur der Verwüstung breitmachte, war für mich der absolute Höhepunkt des Geschehens.
Angela, ein Mädchen, das neben mir beim Kuchentisch saß und das ich bis zu jenem Zeitpunkt noch nicht kannte, beschüttete sich zeitgleich mit mir. Wir lachten und lachten und hielten uns die Bäuche, so sehr schüttelten uns Lachkrämpfe, bis uns die Tränen in die Augen schossen. Am abschließenden Gemeinschaftsfoto, in denen wir Kinder alle herausgeputzt wie kleine heilige Engel aussahen, wurden Angela und ich in die letzte Reihe gestellt. Des Ungemachs wegen, welches sich auf unseren Kleidern wie ein Schandfleck präsentierte.
Mama sagte mir, dass ich und das Mädchen neben mir so glücklich aussahen auf dem Foto, und das uns wohl der Heilige Geist besucht hätte, an jenem Tag, da wir die einzigen waren, die über das ganze Gesicht strahlten. Doch dass mich die Fotokamera über das ganze Gesicht grinsend gemeinsam mit Angela ablichten konnte, war nicht die Schuld des Heiligen Geistes gewesen, sondern ganz einfach unser Missgeschick und der Zufall, dass es uns gleichzeitig passiert war.
Seit jenem Tag war Angie, so nannte ich sie von nun an, mein Lichtblick an jedem Morgen vor der Schule und in den Pausen dazwischen. Und so wie es aussah war auch ich ihre Offenbarung, denn mit mir hatte sie, wenn sie vom oberen Stock des Schulgebäudes nach unten kam, eine Freundin an ihrer Seite, die nicht nur ihren Humor, sondern auch ihre sportlichen Interessen teilte. Für mich war Angie aber noch mehr gewesen, nämlich der erste Freund außerhalb meiner kleinen Welt des Kinderheimes.
Durch sie erfuhr ich, was es bedeuten konnte, ein Leben mit beiden Elternteilen zu haben, und wie sich ein Traum von Freiheit anfühlen könnte, indem sie mit ihrem Pferd ihre tagtäglichen Ausritte in den Wald machte und mir davon erzählte. Sie weckte meine Neugierde zum Leben, außerhalb meiner eigenen Welt. Angie war frei und zügellos, so frei wie ein Kind nur sein konnte. Zumindest glaubte ich, einen solchen Menschen endlich gefunden zu haben.
So war es auch kein Zufall, dass wir gemeinsam für zwei Wochen ins gleiche Krankenhaus kamen, um unsere Leistenbrüche operieren zu lassen. Wir lagen im selben Zimmer, Angie und ich. Und da ich das Krankenhaus ohnedies liebte, weil mich dort immerzu das Gefühl von Schutz und Geborgenheit einholte, erlebte ich ein völlig neues Gefühl Von-am-Leben-zu-sein. Ich weiß nicht was es war, das uns so zusammenschweißte, doch wir brauchten uns nur anzusehen, schon brachen wir in Lachkrämpfe aus, und das war nach unserer Operation nicht gerade angenehm. Wir konnten kaum gehen, ohne Schmerzen dabei zu fühlen. Und ob es nun das Kittelchen mit dem langen Schlitz war, das unser Hinterteil entblößte, wenn wir die Stoffenden nicht zusammenhielten, oder einfach nur der schlurfende Gang aufs Klo, es war uns unmöglich, uns nicht in Lachkrämpfe zu verwickeln, und währenddessen uns vor Schmerzen den Bauch zu halten, bis die Wunde wieder aufriss und wir erneut operiert werden mussten.
Eine Woche nachdem ich das Krankenhaus wieder verlassen hatte, kletterte ich auf meinen Lieblingsbaum. Und da ich noch etwas schwach auf den Beinen war, und mich selbst Mama, meines Bewegungsdranges wegen, nicht im Haus halten konnte, fiel ich, ungestüm wie ich war, ungebremst zwischen eine Astgabel und brach mir dabei die Nase.
Am Tag danach musste ich Direktor Kahlschädel mein Mitteilungsheft übergeben, indem Mama erklärte, dass ich am nächsten Tag die Schule nicht besuchen könnte, meiner gebrochenen Nase wegen, die im Krankenhaus gerichtet werden müsste. Mein Gesicht tat mir weh und unter meinen Augen hatten sich über Nacht dunkle blutunterlaufene Ergüsse gebildet. Meine Nase konnte ich nicht rümpfen und auch sonst fühlte ich mich hundeelend. Direktor Kahlschädel schlug sich die Hände auf seinen kahlen glänzenden Schädel und schrie aus Leibeskräften: „Du dummes Kind, noch nie habe ich ein dümmeres Kind gesehen, und jetzt komm an die Tafel!“ Mit gebeugtem Kopf, zitternd vor Angst, schlurfte ich nach vor. Dorthin, wo mich jeder sehen konnte. Direktor Kahlschädel nahm drohend den Tafelstab und richtete das ein Meter lange Ding in meine Richtung. Dann trat er auf mich zu, nahm mich am Kinn und drückte meinen Kopf nach oben, so dass mir jeder ins Gesicht blicken konnte. „Damit ihr alle seht, wie ein Dummkopf aussieht!“, rief er meinen Klassenkammeraden zu und begann mich auszulachen.
Er lachte höhnisch und mir schossen die Tränen in die Augen. Ich wusste nicht, was ich getan hatte, außer, dass ich mich verletzt hatte. Zu guter Letzt ging er zwischen den Bänken meiner Klassenkammeraden hindurch und wies jeden Einzelnen an, mit dem Finger auf mich zu zeigen und mich auszulachen. Einige taten wie ihnen befohlen, doch meine Heimfreunde lachten nicht. Sie weigerten sich und ich war froh, bis der Direktor ihnen mit dem Stab drohte. Dann lachten sie alle und ihre Finger zeigten auf mich, als wäre ich eine Aussätzige, derer man sich schämen musste. Erniedrigt von der Tortur der totalen Erniedrigung schwor ich mir, nie wieder in vollem Bewusstsein eine derartige Attacke gegen mich hinnehmen zu wollen. Und ich entschied, niemals wieder einem Menschen so viel Macht über meinen Seelenfrieden zu überlassen, dass er diesen mit seinem Gift, das er mir injizierte, beschmutzen konnte. Mir wurde klar, mich in Zukunft nur auf eine Weise zur Wehr setzen zu können, damit mich niemand zerstören konnte. Und ich entschloss, mich von nun an in mich zurück zu ziehen. Dorthin, wo man mich niemals finden konnte, dort wo es kein Gut und Böse, keine Getrenntheit und keine Schuld gab. In eine Welt, die nicht von dieser Welt war, und wo nur der Zutritt bekam, der so wie ich diese Welt verstand und wertschätzte, als das was sie war. Eine Welt der Wahrheit, eine Welt des Friedens und des liebevollen Umgangs mit allen Lebewesen, die frei von Angst und voller Liebe in mir existierte. Und genau diese Welt musste ich mir erhalten. Meine Anderswelt.
Die Sommerferien kamen im Höllentempo daher und ich konnte, wie jedes Jahr, meine Ungeduld endlich wieder nach Caldonazzo zu kommen, kaum zügeln.
Die Einteilung, welches Mädchen in welche Gruppe kam und ob man mittlerweile schon zu den Großen gehörte, war jedes Mal aufs Neue eine Aufregung wert. In diesem Jahr wurde ich für die mittlere Mädchengruppe eingeteilt, was so viel bedeutete wie, man durfte noch nicht in die Bungalows in die Stadt Caldo ziehen, sondern blieb im Camp am See.
In diesem Jahr wurde mir und meinen Freundinnen eine neue Betreuerin zugeteilt. Sie hieß Katrin und war Medizinstudentin. Ich mochte sie sofort gut leiden. Katrin hatte schwarzes, halblanges Haar und sah sehr hübsch aus, im Gegensatz zu der Betreuerin im Vorjahr, die in ihrer strengen altmodischen Art mehr einer Gouvernante glich.
Katrin war überaus sportlich und spornte uns bei sportlichen Wettkämpfen immerzu an. Sie fand immer sehr viel Lob für uns Mädchen und eroberte auf diese Weise mein Herz in Windeseile. Eines Tages jedoch erkannte sie eine meiner anderen Qualitäten, die sie sehr erschreckte. Eine meiner Freundinnen wurde wüst von einem älteren Mädchen aus dem Nachbarheim beschimpft. Sie konnte sich nicht wehren und sah mich bittend an, ihr zu helfen. Ich zögerte nicht lange und nahm Anlauf. In dem Moment kam Tante Katrin, wie wir sie nannten, um die Ecke gebogen und sah wie ich von hinten auf das viel größere Mädchen wie eine Löwin hinaufhechtete, um sie umzureißen. Sofort war eine Horde Kinder herbeigeeilt, die mich anfeuerten und anspornten, ich sollte es der blöden Kuh endlich zeigen und sie aus unserem Revier jagen. Und das tat ich. Zuvor hatte es wie aus Eimern gegossen und große tiefe Wasserpfützen standen auf dem von der Hitze ausgedörrten Boden. Ich nahm sie in den Würgegriff, während ich meine langen, durchtrainierten Beine um ihren Bauch schlang. Dann rollte ich mit ihr gemeinsam in eine der Pfützen und platzierte mich über sie. Tante Katrin versuchte mich von ihr herunter zu zerren, doch es gelang ihr nicht. Noch nie hatte sie mich in solchem Zorn gesehen, der sich jetzt an dem Mädchen aus dem Nachbardorf entlud.
Im Anschluss daran hatten wir Duschprogramm. Und völlig verdreckt wie ich war, schnappte mich die Tante und platzierte mich in der Gemeinschaftsdusche direkt neben sie. Noch nie zuvor hatte ich mit anderen zusammen geduscht, geschweige denn einen nackten Erwachsenen gesehen. „Was ist nur los mit dir, Isa?“, fragte sie mich verwundert, während sie nackt neben mir unter der Dusche stand. Ich hatte panische Angst. Ich schämte mich dafür, dass sie mich sah so wie ich war, schämte mich für meinen Körper und meine Situation in die ich soeben geraten war, völlig entblößt, unbedeckt und ihren Fragen hilflos ausgeliefert. Die anderen Mädchen schienen sich durch ihr eigenartiges Benehmen ebenso für ihre Nacktheit zu schämen und bedeckten mit den Händen ihren Unterkörper. Tante Katrin blickte durch die Runde und was sie sah, erschreckte sie so sehr, dass sie ihre Frage an uns alle richtete. „Mädchen“, sagte sie sanft, und ich blickte mit Ekel und Neugierde geradewegs auf ihr nacktes Hinterteil. „Was ist nur los mit euch allen? Habt ihr euch noch nie nackt gesehen, habt ihr noch nie eine nackte Frau gesehen?“ Und ich wusste, was in diesem Moment alle dachten, weil auch ich es dachte. „Oh Gott, sie hat das Wort gesagt, sie hat nackt gesagt.“ Und diese Nacktheit, von der sie sprach, war in diesem Moment überaus real.
Meine Freundinnen kicherten verlegen, als sich Tante Katrin wieder zu mir umdrehte und ich ihre nackten Brüste anstarrte. „Oh Gott“, dachte ich beschämt und spürte wie mir das Blut in den Kopf schoss. Ich verspürte Ekel, Angst und gleichzeitig Bewunderung. Sie war schön, und anmutig, daran war kein Zweifel. Doch da mir dieses Gefühl unbekannt war, wusste ich nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und weil sie begonnen hatte, mir mein langes Haar zu waschen, drehte ich mich verlegen, mein Hinterteil ihr zu gewandt, in die Ecke.
„Ich bin Ärztin, Kinder“, sagte sie dann nachdenklich. „Ihr solltet vor mir keine Angst haben.“
Und ab diesem Zeitpunkt wusste sie, dass mit uns allen irgendetwas nicht recht stimmte.
Im Außenlager, das sich auf irgendeinem Berg befand, gesellte ich mich zu den größeren Mädchen. Ich fühlte den brennenden Wunsch in mir, zu sein wie sie. Dreizehnjährig, frech und freier als ich es war, da mir Katrin immer hinterher war, um auf mich und die Mädchen in meiner Gruppe aufzupassen. Doch dieses Mal war sie mit den anderen im großen zwanzig Mann Zelt verschwunden, um das Nachtlager zu richten. Ich witterte also meine Chance und ging ans Lagerfeuer zu den Großen.
Zwei der Mädchen hockten nahe einem Gestrüpp im Mondlicht und drehten sich gerade eine Zigarette. „Isa“, riefen sie mir zu und verhielten sich sehr seltsam. „Isa, komm her! Du musst Schmiere stehen, damit uns niemand beim Rauchen erwischt!“ Das war meine Chance. Ich stand also Schmiere und fühlte mich sehr erwachsen dabei. „Das hast du prima gemacht, Isa!“, lobten mich die beiden, nachdem sie fertig geraucht hatten und als sie mir auch eine Zigarette anboten, sagte ich nicht nein, und verschwand mit dem Glimmstängel zwischen den Fingern hinter dem Gebüsch. Ich keuchte und schwitzte, weil ich von dem Qualm kaum Luft bekam, und zwischen leisem Flüstern und Lachen der Mädchen wurde ich streng ermahnt, nicht so laut zu sein. Danach schlich ich mich unbemerkt in das große Zelt zurück und beide Mädchen, für die ich Schmiere gestanden hatte, lockten mich kichernd zu sich. Sie zeigten mir den Schlafplatz zwischen ihnen und sagten: „Isa, du darfst heute zwischen uns schlafen. Denn jetzt gehörst du zu uns Großen!“ Ich war stolz wie nie, und schlief in der Nacht den Schlaf der Seligen.
Einige Tage danach erfuhren wir, dass Herold mit seiner Familie wieder anzureisen gedachte, was uns Mädchen sofort dazu veranlasste, uns eine neue Strategie auszudenken, wie wir ihn von uns und unseren Körpern fern halten konnten, sollte er uns so wie im letzten Jahr wieder zu nahe kommen. Aber so wie im letzten gab es auch in diesem Jahr für keine von uns ein Entrinnen vor seinen ekelerregenden Spielen im Wasser und seinen Händen.
Die Sonne lehrt alle Lebewesen
die Sehnsucht nach dem Licht.
Doch es ist die Nacht,
die uns alle zu den Sternen erhebt.
Khalil Gibran
Noch in den Sommerferien, nachdem ich aus Caldonazzo zurückgekehrt war, quälten mich solch starke Bauchschmerzen, dass ich für zehn Tage das Landeskrankenhaus aufsuchen musste. Die Ärzte fanden keine körperliche Ursache, die meine Beschwerden erklären konnten und entließen mich wieder, ohne eine Diagnose erstellt zu haben.
Als ich wieder zu Hause war, bekam ich plötzlich einen anderen Familiennamen und ich wusste, dass Mama nicht meine leibliche Mutter war. Ich fragte mich ab jenem Tag im Krankenhaus, als man mir Blut entnommen hatte, wer sie wohl sei, diese alte verschwundene Mutter, von der mir nie jemand erzählte. Ich musste sie finden, diese Frau. Musste herausfinden, wer sie war, damit ich herausfinden konnte, wer ich in Wirklichkeit war, denn ich konnte unmöglich der sein, für den mich alle gehalten hatten. Irgendetwas stimmte hier nicht und ich glaubte, dass ich wahrscheinlich einfach nur verwechselt wurde. Irgendwann, bevor ich hierher kam. „Meine Mutter“, begann ich zu denken, „ist eine Königin, irgendwo, und sucht mich.“ Daher wünschte ich mir inbrünstig, meine Mutter kennenzulernen. Ich wünschte mir, meinen Eltern zu begegnen, wie ich mir noch nie zuvor in meinem Leben etwas gewünscht hatte. Und Mama, die mein Sehnen erkannte, versuchte verzweifelt durch die Heimleitung an Informationen zu gelangen. Doch alles was sie hörte war, das man meine Mutter nicht auffinden konnte.
Meinen ersten Brief schrieb ich an die Queen. Sie war die einzige Königin, von der ich wusste, dass es sie tatsächlich gab. Ich schrieb ihr, dass sie mich hier im Kinderheim finden würde und dass ihre Suche nach mir endlich ein Ende hätte. Doch da ich keine Adresse und kein Geld für eine Briefmarke hatte, erreichten meine sehnsuchtsvollen Zeilen die Queen von England nie.
Dafür erreichte die Heimleitung, nur wenige Wochen nach meinen in den Himmel geflehten Wunsch, ein Brief, in dem geschrieben stand, dass mich mein Vater und einer meiner Onkel besuchen kommen wollten. Wann genau dies geschehen sollte, wurde mir nur soweit mitgeteilt, dass es noch im Sommer sein würde.
Ich war außer mir vor Freude. Von nun an verbrachte ich meine Freizeit damit, auf dem Parkplatz vor unserem Haus, auf der Parkbank zu sitzen und zu warten. Jedem fremden Auto, das sich auf das Heimareal verirrte, maß ich besondere Aufmerksamkeit zu, und war jedes Mal bitter enttäuscht, wenn es ohne meinen Vater auszuladen, wieder weg fuhr. So vergingen die Wochen in flehender Sehnsucht, der Tag, mich in ihm erkennen zu können, sollte der heutige sein, traurig wartend und mit dem entsetzlichen Gefühl der immer größer werdenden Leere und Einsamkeit in mir.
Mama versuchte mich immerzu aufzumuntern. Doch ich bemerkte ihre Sorge, die wie mein Gefühl, unwichtig und unnütz zu sein, immer stärker fühlbar wurde. So zog der Herbst ins Land und als es zu schneien begann, fror ich zu sehr, um weiterhin auf der Parkbank wartend ausharren zu können. Ich gab also meine Hoffnung auf und fühlte mich in meinem Gefühl bestätigt, da mein Vater, wie er es versprochen hatte, einfach nicht daherkam, unnütz und unwichtig zu sein.
Die Zeiten, in denen ich mich in meine Anderswelt zurückzog, wurden immer länger. Und irgendwann, mitten im Winter fragte mich Mama, während ich mich auf dem Fußboden hockend an der Heizung wärmte, wohin ich mich verabschiedet hätte, da sie mich nie mehr lachen, aber auch nicht mehr weinen sah.
Ich antwortete nicht sofort, da ich, während sie mich zärtlich in ihren Armen hielt und liebevoll mein langes Haar küsste, bemerkte, wie sehr ich sie fühlen konnte. Ich spürte ihre große Sorge, ihre unendliche Traurigkeit und ihren Wunsch, mir dorthin folgen zu können, wo auch immer ich gerade war.
Aber Mama sah die Sache falsch. Ich befand mich nicht irgendwo, weit weg von ihr. Mama hatte den Zugang zu meiner Welt längst entdeckt, nur wusste sie das nicht. Sie hielt mich im Arm und ich genoss jede Minute, die ich in dieser innigen Umarmung mit ihr erleben durfte. Ich spürte sie in beiden Welten. In diesem Moment erkannte ich, dass es möglich war, die Welten miteinander zu vereinen, und dass die Einsamkeit, die ich so oft in mir spürte, nur daher rührte, dass ich diese Welten mit niemandem auf ganzer Ebene teilen konnte. Aber Mama konnte es, sie konnte und tat es in diesem Moment. Und da Mama bei ihrer Frage nicht bedacht hatte, dass es in dieser Welt keiner Worte mehr bedarf, bekam sie auch keine Antwort in Form von Worten von mir, sondern eine Umarmung, die uns beide glücklicher machte, als alles mir bisher Bekannte. Mama und ich schafften es, die Liebe und die Freiheit aus der anderen Welt in die Welt der Härte und der Grausamkeit zu bringen. Zumindest für diesen Moment war ich wohl der glücklichste Mensch auf Erden.
Ich erlebte, was es bedeuten konnte, wenn die andere heile Welt im Menschen die harte grausame Welt außerhalb des Menschen zu befruchten begann. Und ich erkannte, dass alles Gute und alles Schöne in dieser Welt nur aus der angstfreien, liebevollen und begrenzungslosen Welt heraus entstehen konnte, und nicht umgekehrt. Ich erkannte, dass die Welt im außen Begrenzungen unterlag und daher die Menschen diese Begrenzung als real und unverrückbar ansahen. Doch das genaue Gegenteil war zwischen Mama und mir soeben geschehen. Wir hatten unsere Begrenzungen für einen kurzen Moment aufgehoben. Und unsere Welten miteinander in Liebe und in Harmonie vereint.
Diese Entdeckung hatte ab jenem Zeitpunkt eine so große Bedeutung für mich, dass es in mein Bewusstsein drang, damit zu beginnen, auf die vielen Möglichkeiten im Leben zu achten, wie Gedanken in materielle Form gebracht werden konnten. Das Entscheidende an den Gedanken aber war, ob es ein liebevoller aus der Anderswelt stammender Gedanke war, der seinen Ursprung in der Liebe hatte. Ich spürte, dass ich von nun an auf der Suche danach sein würde, wie ich diese Entdeckung mit anderen teilen konnte. Die Entdeckung, das alles real war, was auch immer ich fühlen konnte, ganz gleich in welcher Welt es existierte, in die äußere Welt zu bringen und in dieser sichtbar und fühlbar zu machen. Dies schien mir wichtiger zu sein, als alle Begrenzungen dieser Welt als gegeben und unumstößlich zu betrachten und danach zu leben.
Ich wusste, alles war möglich. Alles. Einfach alles, was auch immer ich mir vorstellen konnte, und wenn es sich der Andere ebenso vorstellen konnte, so würde es die Realität verändern. Und das alles konnte man bewusst steuern. Je nachdem, was man gerne erleben wollte. Und ich wollte in meiner Realität Mitmenschlichkeit und Liebe gemeinsam mit anderen erfahren, wie ich sie sonst nur tief in mir, für mich allein fühlen konnte.
Eines Abends lag ich in meinem Bett und starrte in das Licht, das mich wieder einmal besuchte. Es kam aus dem Nirgendwo und hüllte mich so sehr in eine Wolke der Unendlichkeit ein, bis ich meinen Körper nicht mehr fühlen konnte. Und dann sah ich sie.
Ich sah Mamas verstorbene Mutter und wie sie mir zuwinkte, mit ihrer blauen Schürze mit den Blümchen dran. Ich empfand keine Angst und kein Unbehagen, das mir sagte „Isa, das darf jetzt nicht sein. Das gibt es nicht. So etwas wie Gespenster sehen ist reiner Unfug.“ Stattdessen riss mich Mama aus meinem tranceähnlichen Zustand.
Mama riss die Türe auf, und polterte wie von Sinnen zu mir herein. Sie war völlig außer Atem und sie lachte, während sie abwechselnd weinte. Sie schlug sich die Hände vors Gesicht und rang nach Luft. „ Isa“, hechelte sie und setzte sich zu mir ans Bett. „Du kannst dir nicht vorstellen, was ich soeben gesehen habe.“ Aber ich konnte Mamas Gefühle spüren und ich konnte ihre Gedanken sehen und ich wusste, dass sie soeben Großmutter begegnet war.
„Du kannst dir nicht vorstellen wie glücklich sie aussah, während sie mir zuwinkte“, sagte Mama und begann wieder vor Freude zu weinen.
Ich nahm sie in den Arm und beruhigte sie. „Ja, ich weiß Mama. Ich glaube dir. Es geht ihr gut!“
„Sie wollte sich von mir verabschieden und deshalb winkte sie. Ich glaube, sie war noch die ganze Zeit über im Fegefeuer. Isa, und jetzt holt sie Gott zu sich.“
Was das Fegefeuer anging, wusste ich nichts Gescheites darauf zu sagen, und als Mama weiter sprach, das Großmutter ihre blaue Haushaltschürze mit den Blümchen dran anhatte, war mir nicht mehr ganz klar, ob ich tatsächlich Großmutters Geist gesehen oder aber Mamas Erfahrung telepathisch wahrgenommen hatte. Doch scheinbar hatten wir beide zeitgleich dieselbe Wahrnehmung. Und Mama sagte mir noch, während sie mich zudeckte: „Wohin hätte ich gehen sollen, außer zu dir, Isa. Niemand, außer dir, würde mir glauben. Aber du weißt, wovon ich rede.“
Ich wusste zwar nicht, woher Mama so viel über mich in dieser Sache wusste, und wie sie darauf kam, dass gerade ich sie verstehen konnte und ihr Glauben schenken würde. Aber sie hatte Recht. Ich verstand sie und ich glaubte ihr. Ich glaubte ihr nicht nur, sondern wusste mit Bestimmtheit, dass sie die Wahrheit gesprochen hatte. Und nicht verrückt geworden war.
Einige Wochen später bekam ich neue Geschwister. Genau genommen waren es drei. Sie wurden aus einem entfernten Kinderheim in unser Heim gebracht, und es begann ein neuer, rauer Wind in meinem zu Hause zu wehen. Das jüngste der Geschwister war elf, also zwei Jahre älter als ich, und ihrer dreizehnjährigen Schwester wie ein Sklave untertan. Der Junge war zwölf und den konnte ich am wenigsten leiden. Sie alle waren irgendwie von einem anderen Schlag, verlogen, hinterhältig und gemein. Aber es half alles nichts. Gemeinsam mit den beiden Mädchen musste ich von nun an mein Zimmer teilen.
Mama war irgendwie geschockt über den plötzlichen Zuwachs, der ihr so gar nicht recht war.
Eigentliche hätte sie zwei kleine Geschwister im Alter von drei und vier Jahren erwartet, zumindest hatte man uns alle dies glauben lassen, denn für zwei kleine war sie eingerichtet. Und nun war alles anders. Olli und Ramona konnten sich nicht ausstehen und stritten sich den ganzen Tag um nichts, während die jüngere Nadia mich ständig bestahl, und wenn sie was ausgefressen hatte, immerzu mir die Schuld in die Schuhe schob. Mama nahm mich dann immer zur Seite und sagte: „Isa, du bist die Gescheitere, geh auf sie zu und versöhne dich wieder mit ihr!“ Was ich dann auch immer wieder tat, auch wenn Nadia mir dann immer ihre Macht zu spüren gab und mir den Rücken zuwandte, um mir hochmütig „Nein, mit dir versöhne ich mich nicht“ entgegen zu schleudern. Danach wandte sie sich immer stolz von mir ab und ließ mich gedemütigt stehen, wobei sie dann immer hämisch grinste. Und zu alledem musste ich jetzt auch noch mit beiden musizieren, was mir besonders missfiel.
Musik war immer schon ein wichtiger Teil meines Lebens gewesen, weil sie mich beruhigte und mir eine Art kreatives Ventil war, wenn ich mich körperlich nicht austoben konnte.
Seit Jahren schon spielte ich Flöte und ich war gut darin. Und nun musste ich mit Ramona und Nadia tagtäglich üben, was mir den Spaß an der Musik gründlich verdarb. Und wenn wir dann unsere Flöten tauschten, weil ich nicht nur Block, sondern auch Tenor und Altflöte spielen konnte, ekelte mir immer so sehr von den angespuckten und völlig schlabbrig abgekauten Mundstücken. Und am meisten ekelte es mir, wenn ich bemerkte, dass aus der unteren Öffnung des Instrumentes deren Spucke heraus floss und das direkt auf meinen Schoß.
An einem der bitterkalten Winterabende sahen wir fern und es liefen die Nachrichten. Olli, Karl, Kevin, einer meiner großen Brüder, die neuen Geschwister, Mama und ich saßen alle am großen Esstisch beisammen, als die Nachricht eines Kindesmissbrauchs, welcher sich über Jahre in einem anderen Land abgespielt hatte, über die Flimmerkiste ausgestrahlt wurde. Das damalige Mädchen war mittlerweile eine erwachse Frau geworden und hatte ihren Vater öffentlich des sexuellen Missbrauchs und des Inzests beschuldigt, was enormes mediales Interesse ausgelöst hatte.
Es herrschte eine eisige Stille in unserem Wohn-Esszimmer, was mir aber die Möglichkeit gab, über das soeben gehörte nachzudenken. Sofort kam mir Siggi in den Sinn, und Olli, der neben mir saß, stieß mich von der Seite aus an.
Ich starrte ihn an, als wollte ich ihn stillschweigend fragen: „Was ist? Was soll ich tun?“
Doch in diesem Moment wurde mir nur eines klar. Siggi war nicht mehr da, und so wie es aussah, konnte er auch nicht erfahren, wenn ich Mama endlich die Wahrheit über ihn sagen würde. Er hätte also keine Möglichkeit, Mama weh zu tun und sie mir zu nehmen, so wie er es mir geschworen hatte, sollte ich jemals etwas über die Spiele, die er mit mir so lange veranstaltete, verraten.
Und als Olli mich noch mal in die Seite stieß, sagte ich laut und deutlich, so dass mich jeder der am Tisch saß hören konnte. „Das hat Siggi auch mit mir gemacht!“
Ich sagte nur diesen einen Satz. Es war mir zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst, was ich mit nur diesem einen Satz auslöste, denn Mama starrte mich entsetzt an, während Ramona lauthals loslachte und Kevin in ihr Gelächter mitnahm. Mama starrte, als hätte sie einen Geist gesehen, durch mich hindurch und es war mir, als wäre sie soeben in einer anderen Welt verschwunden.
Ramona lachte mich aus und tippte sich mit dem Zeigefinger auf die Stirn. „Du musst dich immer wichtig machen“, schleuderte sie mir entgegen und zeigte mir weiterhin den Vogel, während Kevin immer lauter zu lachen begann. Ich wusste nicht, weshalb er so schallend lachte und Ramona bestätigte, dass ich nur auffallen wollte, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. „Erzähl nicht solche Lügengeschichten“, schnalzte er mir über den Tisch zu und ich blickte verzweifelt zu Mama, die schon in weite Ferne abgedriftet war. Plötzlich stand Olli auf. Sein Gesicht war rot angelaufen vor Zorn und ich wusste, jetzt war es an der Zeit, dass sich Kevin und Ramona besser verziehen sollten, denn wenn Olli rot anlief, würde er vor Zorn sicher über den Tisch zu den beiden hinüber springen, um ihnen an den Kragen zu gehen.
Aber er tat es nicht. Stattdessen stand er da, ganz starr, direkt neben mir.
„Meine Schwester lügt nicht!“, platzte es aus ihm heraus, und ich sah, dass er Tränen in den Augen hatte. „Ich habe alles gesehen“, schrie er, „und wenn ihr niemand glaubt, ich weiß es! Ich habe alles gesehen!“
Mama erhob sich schweigend von ihrem Stuhl, ihr Blick war starr. Und wie ein Roboter, völlig ferngesteuert, ging sie aus dem Raum.
Damit war der Abend gelaufen und ich ging ins Bett. Ich sah Mama erst am nächsten Morgen wieder. Sie nahm mich nur in den Arm, und sagte nichts. Kein Wort sagte sie. Sie drückte mich an sich und ich wusste nicht, was los war mit ihr, und weshalb sie mich so fest drückte. Die ganze Sache war mir irgendwie schleierhaft, bis Olli daherkam und mir sagte: „Ich hab es dir versprochen, weißt du noch? Ich hab dir versprochen eines Tages dein Zeuge zu sein, damals beim Siggi Abschiedsfest. Weißt du es noch?“ Doch ich verstand mit meinen neun Jahren noch immer nicht, was eigentlich passiert war. Vor allem aber, wohin ich seit jenem Abend selbst abgedriftet war. Ich erfuhr nur, was es hieß, plötzlich das Leben wie durch einen dichten Schleier zu erleben, durch den kein Tageslicht mehr dringen konnte, das mir meine Situation, in die ich scheinbar geraten war, erklären konnte, um Licht in meine plötzlich aufgetretene Dunkelheit zu bringen.
Von jenem Tag an schaffte ich es nicht mehr, mich in meine Welt der Liebe und Verzückung zurück zu ziehen. Es war, als würde eine dicke Mauer meinen Weg in die Anderswelt versperren.
Danach kam ein oder zwei Mal die Woche immer ein netter Mann zu mir, der mit mir Sand spielte oder mir das Hantieren mit einer Supermarktkasse mit Plastikgeld zeigte. Er beobachtete jede meiner Bewegungen und schrieb dann immer irgendetwas auf ein Stück Papier. Ich wusste nicht, weshalb er nur zu mir und nicht zu den anderen Kindern kam. Ich empfand es nur als Privileg und fühlte mich immer, wenn mich Mama in den Spielraum brachte, den ich nur betreten durfte, wenn er da war, als etwas Besonderes. Denn ein Mann im Kinderheim war selten anzutreffen und gerade ich durfte Zeit mit ihm verbringen. Außerdem fand ich, sah er umwerfend gut aus mit seinem dunklen Haar und seinem Dreitagebart, und nicht zuletzt roch er so fantastisch wie ich es zuvor noch nicht gerochen hatte. Ich wusste, das war der Geruch eines Mannes, der anders war als die, die ich von der Ferne her kannte. Ein Mann, der nett und freundlich zu mir war, der sich nur mit mir beschäftigte und mir dabei keine Angst einjagte, dass mir dabei das Blut in den Adern gefror.
Am Sportfest des Kinderheimes, das jedes Jahr im Frühsommer veranstaltet wurde, und mich jedes Mal aufs neue in Ekstase geraten ließ, sah ich ihn dann mit seiner Frau und seinen Kindern. Und ab diesem Zeitpunkt erkannte ich, was Eifersucht bedeutete. Ich ging nie wieder zu ihm.
Wie jedes Jahr kam für einen Nachmittag eine Horde wild aussehender, aber netter Kerle mit ihren Motorrädern ins Heim, um uns Kinder auf ihren Feuerstühlen durchs gesamte Areal zu führen. Und da ich ein außerordentlich gutes Gedächtnis besaß, was nette Gesichter merken anbelangte, schnappte ich mir immer den gleichen Mann, mit langem zottigen Bart und zerzauster Frisur. Ich erkannte ihn sofort, wann immer er mit seinem Feuerross daher geritten kam. Ich war wild und hungrig auf einen Adrenalin-Kick, und da er sich ebenso wie ich jedes Mal an mich erinnern konnte, hatte er seine helle Freude daran, mich auf sein Motorrad zu setzen und mit mir einige Runden zu drehen, die so rasant waren, dass mir vor Verzückung der Schnelligkeit wegen und dem Rausch der Geschwindigkeit, den ich erlebte, fast mein Herz stehen blieb. Ich mochte ihn aber auch deshalb gut leiden, weil er sich auf meine Wünsche einstellte und mich ernst nahm, in meiner Gier nach Schnelligkeit. Er verstand mich ganz einfach und dies tat mir gut.
Mama holte mich dann, wann immer sie erkannte, dass ich mich zu oft von ihm mitnehmen ließ, immer zurück nach Hause, da sie es nicht gerne sah, wenn ich mich zu sehr für einen Mann interessierte. Mama ermahnte mich dann immerzu, dass ich mich als Mädchen nicht so freizügig wie ein Flittchen an die Männer heran werfen dürfte. Aber ich verstand nicht recht, was sie damit meinte. Ich kannte das Wort Flittchen nicht. Ich wusste nur „Die Motorradfahrer waren eingeladen worden, um uns Kindern Freude zu machen und ich hatte Freude.“ Was um alles in der Welt also hatte ich Böses getan?
Was ein Flittchen war, wollte ich natürlich wissen und sagte es eines Tages zu einem älteren Mädchen im Heim, worauf ich sofort eine geschmiert bekam. Von da an wusste ich, dass es wohl besser für mich wäre, dieses Wort nicht mehr zu gebrauchen. Geschweige denn, irgend jemanden so zu nennen.
Ich hätte gerne eine Welt, in der das Ziel der Erziehung
geistige Freiheit wäre
und nicht darin bestünde, den Geist der Jugend in eine Rüstung zu zwängen,
die ihn das ganze Leben lang vor den Pfeilen objektiver Beweise schützen soll.
Die Welt braucht offene Herzen und geistige Aufgeschlossenheit,
und das erreichen wir nicht durch starre Systeme,
mögen sie nun alt oder neu sein.
Bertrand Russel
Angie stand an der Straße und winkte mich zu sich hinüber. Mittlerweile war ich zwölf und besuchte gemeinsam mit ihr die Hauptschule des Ortes. Wir waren die besten Freundinnen und saßen in der Schulbank nebeneinander. So wie ich, war auch Angie eine Niete in Mathe. Doch das lag wohl mehr an der furchterregenden Lehrerin, der Gouvernante der Schule, Frau Tschingels.
Angie winkte mich also zu sich auf die andere Straßenseite und gemeinsam schlenderten wir den langen Weg in Richtung Schule hinauf. Dann hörten wir Frau Tschingels mit ihrem Mann, der auch an der Schule unterrichtete, hinter uns daherkommen. Wie fast jeden Tag in der Früh konnte man die beiden entweder händchenhaltend oder stocksauer aufeinander den Schulweg entlang schreiten sehen. Wir wussten dann immer sofort, was uns blühte, an jenem Tag, wenn die Tschingels ihren Mann weit von sich fern hielt, und der wie ein geprügelter Hund immer einige Schritte hinter ihr daher trabte.
Und heute war kein so guter Tag für uns. Und in der ersten Stunde hatten wir Mathe.
Angie und ich saßen in der ersten Bankreihe. Die Tschingels hatte uns direkt vor ihr Lehrerpult platziert, damit sie uns besser im Auge hatte.
Und wie jedes Mal, wenn sie unsere Klasse betrat, rümpfte sie angeekelt die Nase, stieß einen Seufzer aus und während sie genervt auf das Lehrerpult zuschritt, plärrte sie: „Fenster auf! Hier stinkt´s! Das hier ist ein Schweinestall sondergleichen!“ Ich konnte nichts Ekelhaftes riechen und mein Geruchssinn war auch in der Klasse bekanntlich einer der feinsten. Wir standen alle wie die Zinnsoldaten aufrecht vor unseren Bänken und trauten uns nicht zu rühren, bis sie so laut zu schreien begann, irgendjemand sollte doch endlich das gottverdammte Fenster öffnen, weil wir ihr die Luft zum Atmen nahmen. Sie beobachtete jeden Handgriff desjenigen, der gerade dabei war Frischluft einzulassen, und wenn die Handlung nicht schnell genug ausgeführt wurde, konnte man sich darauf gefasst machen, als allererstes vor der gesamten Klasse seine Hausaufgaben präsentieren zu müssen. Diese Tortur wurde für jeden, der gerade dran war, immer zu einem völligen Desaster und artete letztendlich immer in der völligen Entmündigung und dem Gefühl aus, bloßgestellt und erniedrigt zu sein. Frau Tschingels war schlimmer als die letzten Jahre zusammengezählt mit Direktor Kahlschädel, denn durch eine Furie wie sie, die sich ständig an den Schwächsten unter uns ausließ, bedeutete Mathe die Hölle auf Erden.
An jenem Tag war ich dran mit dem Fenster öffnen, und da ich ihr nicht schnell genug war, schnalzte sie mir sogleich meine Schularbeitszettel auf den Tisch, schrie aus Leibeskräften meinen Familiennamen und wies mich an, sofort zu ihr ans Lehrerpult zu kommen. Ich zitterte am ganzen Körper und ich spürte wie ich kaum noch Luft zum atmen bekam. So stand ich also zitternd vor ihr. Im nächsten Moment sah ich wie aus der Ferne, weil ich soeben irgendwie aus meinem Körper geschlüpft war, wie sie meine Schularbeitszettel in weitem Bogen durch die Luft in die Klasse hineinwarf. Meine Mitschüler wollten sie aufheben, um mir zu helfen, doch die Tschingels krähte mit hochrotem Gesicht, ich sollte verdammt noch eins meine Schmierzettel gefälligst selbst aufheben. Ich ging also hinein in die Klasse, zwischen die Bänke meiner Mitschüler hindurch und hob ein Blatt nach dem anderen wieder auf. Dann kehrte ich an mein Pult zurück. „Wie immer ein Nicht Genügend“, plärrte sie. „Aber ich habe mir von dir nichts Besseres erwartet. Also ordne deinen Schund gefälligst in die Mappe ein, und das Dalli, Dalli.“
Da hockte ich in meiner Bank, neben mir Angie, die noch mehr zitterte als ich selbst, und versuchte meine Zettelwirtschaft in die Mappe einzuordnen. Frau Tschingels bückte sich weit zu mir nach vor, während sie sich mit einem Kugelschreiber ihren Dutt am Kopf kratzte. Ihr Atem ging schnell. „Vielleicht“, so dachte ich, „hing das mit dem viel zu eng geschnürten Oberteil ihres Dirndlkleides zusammen. Denn es machte den Anschein, dass ihre großen Brüste, die sich gefährlich auf und ab bewegten in ihrer zornigen Erregung, jeden Moment das Dekolleté zu sprengen drohten. Dann wurde ich jäh aus meinen Gedanken gerissen, denn plötzlich schlug sie so hart mit ihrer flachen Hand auf die meine, dass es schmerzte „Schneller“, sag ich, „schneller.“ Mein Atem setzte kurzweilig aus und ich spürte wie mir kalter Schweiß über die Haut rann. Mein Herz raste, bis ich dachte, es zerfetzt mir in meiner Brust. Und nachdem sie mir auf die Hand geschlagen hatte, ließ ich die Schularbeitsblätter los, worauf diese wieder auf den Fußboden fielen. Ich war froh, dass sie mir bloß auf die Hand geschlagen, und nicht wie Simon, einem Klassenkammeraden, der letztes Mal mit dem Fensteröffnen dran war, mit dem Zirkel in die Hand gestochen hatte.
Ich wusste von Mama, dass sie Lehrer hatte, die in den vierziger und fünfziger Jahren ihre Schüler so behandelten. Und Mama in ihrer Angst vor ihnen kaum zum Lernen in der Lage gewesen war. Doch wir waren in den achtziger Jahren, in der gerade die Neu-Deutsche-Welle angerollt kam mit Nena, Peter Schilling und Major Tom an der Spitze der Charts.
Und ich dachte daran, wie die Tschingels als streng gläubige Katholikin jeden Sonntag wie die heilige Mutter Maria, nur mit ihrem Dutt am Kopf und ihrem üppigem Busen, der wie eine Flutwelle drohend aus ihrer weit ausgeschnittenen Bluse quoll, in der Männerreihe in der Kirche saß und zu Gott betete. Und wenn ich sie dabei sah, wie sie vor dem Beichtstuhl wartete, dachte ich mir immer: „Wenn ich die Tschingels wäre, würde ich auch so oft zur Beichte müssen.“
Bald darauf bekam ich einen Nachhilfelehrer, der jeden Tag zu mir nach Hause kam. Er unterrichtete nicht nur mich, sondern auch andere Kinder des Heimes. Er hieß Peter und hatte langes Haar, hörte die Stones und Eric Clapton, und kam fast immer mit seiner Kawasaki angerollt. Und schon bald bemerkte ich, dass ich starke Gefühle für ihn entwickelte, die ich nicht so recht einordnen konnte. Jeden Morgen freute ich mich, ihn nach der Schule den ganzen Tag bei mir zu haben.
Und manchmal kam es vor, dass er mich, nachdem ich meine Hausaufgaben schnell und gut erledigt hatte, mit seinem Motorrad auf eine kleine Spritztour um die Seelenberger Teiche mitnahm. Er legte sich dann immer so scharf in die Kurve, dass ich meine Hände noch fester um ihn legen musste, bis mir die Geschwindigkeit fast den Atem raubte.
Ich war gut in Mathe, aber nur zu Hause. In der Schule bei der Tschingels versagte ich jedes Mal jämmerlich. Peter wusste sehr bald, was mich in die missliche Lage gebracht hatte und erklärte der Heimleitung, dass mein Problem in der Angst vor der Lehrerin begründet lag.
Dann bekam ich eine neue Klassenlehrerin als Karenzvertretung. Sie war jung, gerade mal dreiundzwanzig. Und wie die Jungs in der Schule liebte auch ich sie heiß und innig. Wir nannten sie klammheimlich Stone. Und ich machte Witze über sie, so wie alle anderen Kinder, die sich hinter den Witzen vor ihren Gefühlen für sie versteckten. Ich fühlte dieselben Gefühle für sie, wie die, die ich zu Peter hatte. Stone hatte ich in Deutsch, und ich liebte Deutsch. Ich liebte die Stone, ich liebte ihren Geruch, ihre lockere lässige Art, ihr sportliches Auftreten, ihre dunklen braunen glasklaren Augen, die nicht lügen konnten, ihre locker lässige Kleidung und ich liebte es, mit welcher Würde und Achtung sie mich behandelte. Ich wusste, dass sie mich mochte. Und an den außerschulischen Volleyball-Turnieren, bei denen Angie und ich als einzige der Schule teilnahmen, weil wir mittlerweile von einem Sportscout für die Liga entdeckt wurden, kam sie gemeinsam mit unserem Sportlehrer, den ich ebenso sehr mochte, immer wieder mal mit, um uns anzufeuern. Im Anschluss brachte uns immer einer der beiden mit seinem Auto nach Hause, was ich besonders schön fand.
Und nach nur einem Semester war sie wieder weg.
Meine Schultage wurden immer angstbesetzter und die Nächte gestalteten sich mit stundenlangem Musik hören, um meiner Einsamkeit zu entfliehen, immer kürzer. Jeden Tag, an dem ich Mathe hatte, und ich hatte fünf Mal die Woche Mathe, ging eine Nacht voraus, in der ich jeden einzelnen Schritt, den ich am nächsten Morgen bis hin zum Ende der Mathestunde tun musste, bis zur Erschöpfung im Geiste durchging. Ich musste vorbereitet sein auf die Tschingels. Vorbereitet auf den Schulweg, und auf ihre oft bösen Bemerkungen, die sie schon am Schulweg fallen ließ. Ich brauchte die innere Sicherheit, zu wissen, was zu tun war, sollte sie mich wieder in die Mangel nehmen. Und da ich meine innere Welt, die mich jahrelang vor Überfällen der besonders bösen Art geschützt hatte, nicht mehr hatte, sie nicht mehr erreichen konnte, es sei denn, ich hörte stundenlang Musik, in die ich hineinkippen konnte, hatte ich keine andere Wahl, als absolute Kontrolle über jede nur mögliche Situation zu üben.
Zur Tschingels kam auch noch eine weitere Lehrerin hinzu, die ich in Biologie genießen durfte. Sie fühlte sich als überaus besonders, und ihrer Tochter, die im selben Alter wie ich war, konnte ohnedies keiner von uns das Wasser reichen. Ich fragte mich immer, wenn sie ihre spitzen Bemerkungen unserer mangelnden Klugheit wegen an den Tag legte, wieso sie den Beruf des Lehrers überhaupt ausübte, wenn sie ihn und ihre Schüler doch so sehr hasste. Und diesen Hass, vor allem auf uns Heimkinder, erfuhr ich immer besonders dann, wenn ich einen Vortrag oder ein Referat vor der gesamten Klasse zu halten hatte. Und obwohl ich, meines Nachhilfelehrers wegen, ohnedies gut darauf vorbereitet sein musste, fand sie immer einen Punkt, der ihr nicht gefiel. An dem nörgelte sie so lange herum, bis ich vor Angst und Scham nicht mehr sprechen konnte. Dies war dann immer der Moment, in dem sie mich als das dümmste Geschöpf, das je auf Erden wandelte, bezeichnete und mich völlig gebrochen und beschämt an meinem Platz zurückschickte. Das ich dann immerzu ein Nicht Genügend bekam, ließ nicht nur mich, sondern auch Peter verzweifeln, der ja wusste, dass ich die geforderten Lerninhalte beherrschte.
Die Englischlehrerin hatte ich glücklicherweise nur für ein Jahr. Immer, wenn sie die Klasse betrat und wir von unseren Sitzen zum Gruß aufgeschnellt waren, mussten wir sie mit Frau Magister anreden. Ich wusste nicht, was ein Magister war, aber ich wusste, dass sie neben dem Unterrichten auf eine Universität ging und so wie meine Schwester Ari Psychologie studierte. Mario aus unserer Klasse, ein frecher Junge und einen Kopf kleiner als ich, hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, den Mädchen in der Schule ständig zwischen die Beine zu fassen. Am häufigsten machte er das im Englischunterricht, weil die Lehrerin immer eine U-Form der Tische anordnete und Mario dabei fast unbeobachtet zwischen Sally, ein Mädchen aus dem Heim, und mir saß. Sally und ich versuchten uns ständig gegen seine Handgreiflichkeiten zu wehren. Doch was auch immer wir versuchten, es half alles nichts. Also sagte ich eines Tages zu Sally: „Ich werde Mama davon erzählen.“ Aber Sally hatte Angst und meinte nur, dass ich es besser lassen sollte, weil wir bestimmt Ärger bekommen würden. Doch ich erzählte es Mama. Und die war außer sich vor Wut und erzählte dies dem Heimleiter. In der Schule holte mich die Frau Magister zum Pauseläuten zu sich nach vor. Und während alle Kinder den Pausengang stürmten, zerrte mich die Lehrerin am Arm in den Gang und rief Mario herbei. Sofort kamen eine Horde Kinder herbeigelaufen, die die Lunte natürlich rochen, dass es jetzt ein großes Theater geben würde. Und ich war froh, dass Mario jetzt endlich mit dem Zwischen-die-Beine-fassen aufhören musste. Da stand ich nun, gemeinsam mit Mario und der Frau Magister, inmitten eines neugierigen Menschenkreises. Dann schrie sie wie wild geworden vor aller Augen und Ohren auf mich ein, was ich mir überhaupt erlauben würde, solche Geschichten zu erfinden, niemand, und schon gar nicht in ihrer Stunde, würde mir in den Schritt fassen. Sie starrte mich mit hochrotem Kopf an und schimpfte, dass wenn ich auf Mario stehen würde, und daran hätte sie keinen Zweifel, ihn nicht solcher Gemeinheiten bezichtigen dürfte. Ich spürte, wie mir die Tränen in die Augen schossen und wie es mir die Kehle zuschnürte, weil ich Sally bettelnd ansah, mich zu unterstützen. Doch Sally dachte nicht daran, sondern schlich sich feige davon, um nicht wie ich, vor allen als Lügnerin da zu stehen. Mario grinste hämisch in sich hinein, und wurde in die Klasse zurück geschickt. Ich bekam eine Strafarbeit zu schreiben, für die ich zwei Tage lang nachsitzen musste. Am Ende hatte ich die geforderte Litanei beisammen, die einige hundert Mal denselben Satz beinhaltete. Vor der gesamten Klasse musste ich also meine Strafe verlesen und begann zu stottern: „Ich darf keine Lügen erzählen, da diese nicht nur mir, sondern auch anderen Schaden zufügen.“
Im Anschluss danach musste ich mich bei Mario entschuldigen, worauf ich mich strikt weigerte. Zu Hause erzählte ich Mama davon, und einige Monate später verließ die Frau Magister, die mittlerweile Psychotherapeutin, so wie meine Schwester Ari war, unsere Schule.
Ich begann mich im Sport immer ungezähmter und wilder zu verhalten, was mir beinahe nach jeder Meisterschaft einen Knochenbruch einbrachte, bis ich auch Volleyball völlig aus meinem Leben streichen konnte, der Schmerzen wegen, die ich dann immerzu fühlte.
Da mein Körper naturgemäß immer weiblicher wurde und ich niemanden hatte, mit dem ich ohne Scham über die Veränderungen an und in mir sprechen konnte, wurde mir nach und nach die Sinnlosigkeit meines Lebens immer bewusster.
Die Musik war als einzige freie Welt für mich stehen geblieben. Eine Welt, in die ich allerdings nur noch eintauchen konnte, wenn der Dezibel-Pegel auf Einhundert stand. Diese Tatsache vereitelte mir nun auch immer öfter den Zutritt zu mir selbst und meinem Innersten, weil Mama den Lärm, den meine Stereoanlage veranstaltete, nicht ertragen konnte.
Mit dem Flöte spielen hatte ich schon lange aufgehört und wollte nichts lieber als Saxophon oder Klavier lernen. Doch Mama sagte nur streng: „Isa, du ziehst nichts durch, und deshalb darfst du diese Instrumente nicht lernen!“ Dass ich das Flöte spielen sechs lange Jahre praktiziert habe, und bereits kleine Konzerte auf privaten Feiern gespielt hatte, war ihr wohl entfallen. „Aber wozu etwas durchziehen, wenn ich es nicht mochte“, überlegte ich, „wenn ich es nicht liebte, wenn es mir den absoluten Widerwillen in die Adern treibt.“
Also begann ich leidenschaftlich zu malen, was Kim, dem Nachbarsmädchen, das mittlerweile zu einer meiner besten Freundinnen geworden war und mir zur liebsten Freizeitbeschäftigung wurde.
Und die Zeit kam, an dem ich meinen Schulabschluss zu machen hatte, mich um meine weitere Zukunft kümmern und einen Plan entwerfen musste, was ich weiterhin nun tun wollte.
Eine weitere Schule zu besuchen, kam für Kinder, die wie ich schlechte Noten nach Hause brachten, nicht in Frage. Und mein Berufswunsch, den ich seit meiner frühesten Kindheit hatte, Krankenschwester zu werden, musste daher auf der Strecke bleiben. So blieb mir nur noch der Beruf als Köchin, als Friseurin oder als Verkäuferin übrig. Nichts von alledem wollte ich jemals werden, doch der psychologische Berufstest sagte wohl etwas anderes. Ich sollte wegen meines besonderen Geruchssinnes wegen Koch lernen.
„Wenn schon nicht Krankenschwester, dann wenigstens etwas Kreatives“, überlegte ich mir. Und ohne dass Mama davon wusste, hatte ich mit Kim über ein Jahr lang den Plan entwickelt, gemeinsam in die Grafikschule nach Wien zu gehen. Dazu benötigte ich eine Aufnahmeprüfung, ein positives Abschlusszeugnis und eine Mappe mit verschiedensten Zeichnungen, die ich einzusenden hatte. Und nachdem Peter, mein Nachhilfelehrer, nun selbst mit der Tschingels gesprochen und ihr, so wie er mir sagte, die Leviten gelesen hatte, setzte sie mich an meiner alles entscheidenden Schularbeit etwas weiter von ihr entfernt in eine andere Sitzbank. Ich schrieb die zweitbeste Arbeit der ganzen Klasse, und dies verdankte ich dem Umstand, dass sie mir nicht währenddessen ständig auf die Finger schauen und ich mich angstfrei auf die geforderten Rechnungen, die ich sehr gut beherrschte, konzentrieren konnte.
Kim erzählte mir einige Wochen später, dass sie die Aufnahme in die Grafikschule geschafft hatte und im kommenden Herbst nach Wien übersiedeln würde. Von Mama und der Heimleitung wurde mir mitgeteilt, dass ich die Aufnahmeprüfung gar nicht erst schaffen würde und deshalb gar nicht erst zu machen brauchte, und dass es für mich sowieso nur einen Weg gab, nämlich den zur Übersiedelung in die Mädchenwohngemeinschaft nach Klagenfurt. Ein anderer Weg kam für mich schon deshalb nicht in Frage, weil ich Beobachtung nötig hatte. Was mir so viel sagte wie: „Isa, wir vertrauen dir nicht, und du brauchst einen Anstandswauwau, der dich überwacht.“
Dass mich Mama nur nicht fortlassen wollte, weil sie mich nicht loslassen konnte, gab sie nicht zu. Also gab es für mich nur einen Weg, den nach Klagenfurt und diesen schlug ich alsbald auch ein. Zuvor jedoch wurde mir nahegelegt, noch ein Jahr eine Haushaltungsschule zu besuchen, damit ich besser für mein Leben gerüstet wäre und mich eines Tages besser in die Rolle der Frau einfügen konnte. „Die Rolle der Frau? Was war das, die Rolle der Frau?“, fragte ich mich verwundert und wusste nur eins, ich will keine vorgefertigte Rolle spielen, nur weil es andere, so wie Mama, tun mussten oder gerne taten. Und da ich Hauswirtschaft, Klostermauern und Nonnen, ja alles, was die katholische Kirche anbelangte, meiden wollte wie der Teufel das Weihwasser, erkannte ich, „Isa, wenn du jetzt nicht kämpfst, dann wirst du in ´nem Nonnenkloster sterben.“ Und genau das versuchte ich Mama zu verklickern, in dem ich sagte: „Mama, ich dreh mich heim, ich bringe mich um, wenn du mich zu den Klosterschwestern schickst. Ich hasse stricken, nähen und all diese Weibersachen, diese Rolle will ich in meinem Leben nicht spielen.“ Stur und felsenfest davon überzeugt, dass meine Drohung Wirkung zeigen würde, sagte ich es. Und dies tat es auch. Daher besuchte ich ab dem darauf folgenden Herbst eine Berufsvorbereitungsschule in der Stadt und zog auch gleich in der Mitte des Jahres in die Mädchenwohngemeinschaft nach Klagenfurt um.
Du hast deine Kindheit vergessen,
aus den Tiefen deiner Seele wirbt sie um dich.
Sie wird dich solange leiden machen,
bis du sie erhörst.
Herman Hesse
So wie alle Mädchen in meinem Alter interessierte auch ich mich für Jungs. Und so hatten unsere Betreuer ihre liebe Not, die vielen Freier von dem Mädchenwohnhaus, in dem insgesamt vierzehn Mädchen zwischen vierzehn und achtzehn Jahren wohnten, fern zu halten. Es gab Regeln, an die man sich halten musste, und eine der ersten Regeln, in die mich einige Mädchen gleich zu Beginn meines Einzugs einwiesen, war die, wie ich am Telefon zu reagieren hätte, sollte der „Stöhner“ wieder anrufen. Der „Stöhner“, so nannten die Mädchen den Mann, der sich immer wieder in bestimmten Abständen wie ein läufiger Hund bei uns meldete und in den Telefonhörer hinein stöhnte, um Obszönitäten von sich zu geben. Ich sollte mich also nicht zu sehr erschrecken, gleich wieder auflegen und mich auf keinen Fall auf ein Gespräch mit ihm einlassen. Außerdem, so erzählte man mir, war die Polizei bereits auf seiner Spur, um ihm das Handwerk zu legen.
Die Pubertät hatte schon beizeiten bei mir wie eine Bombe eingeschlagen, und ich fühlte mich wohl und geborgen als Jüngste unter einer Horde junger Frauen. Die Schule überstand ich mehr schlecht als recht und begann danach eine Lehre als Koch in einem Landgasthaus, nicht weit von meinem neuen Zuhause entfernt.
Ich arbeitete viel und hart, für wenig Geld, das ich allerdings auch nie zu Gesicht bekam. Und als ich eines Tages endlich nach monatelangem Bitten und Betteln mein erstes selbst verdientes Geld in meinen Händen hielt, kaufte ich einer bekannten Rockband, die ihr Studio in einem der angrenzenden Räumlichkeiten des Gasthofes hatte, einen Synthesizer ab, mit dem ich zu Hause endlich meinen Musik- und Komponiergeist ausleben konnte.
In der Arbeit wurde es zunehmend schwieriger, mich den gestellten Aufgaben zu widmen und produktiv zu arbeiten, weil mich Ängste zu quälen begannen, die mir fremd waren. Ich schlief miserabel, und wenn ich endlich einschlafen konnte, hatte ich Albträume, die mich bis in den Tag hinein verfolgten. Die immer wiederkehrenden Angebote an mich, durch Stammgäste, die sich mehrmals am Tag an meinen Arbeitsplatz in der Küche verirrten, wehrte ich gekränkt und verstört ab. „Na, komm schon, Kleine. Eintausend Schilling, wenn du mir um die Ecke am Klo einen bläst“, waren noch die geringsten Anspielungen, mit denen ich mich herumschlagen musste. Und als mein Chef mir erklärte: „Damit musst du im Gastgewerbe einfach leben, Isa, da hilft alles nichts!“, war bei mir der Ofen aus. Ich war gerade mal fünfzehn und fühlte mich bedrängt, gedemütigt und wie ein Stück Fleisch von den Männern behandelt, die mir wie eine Horde Affen hinterher waren und einen Altersdurchschnitt von fünfundsiebzig aufwiesen.
Nach wenigen Monaten, mitten im Jahr, verließ ich den unseligen Arbeitsplatz. Und mir war, als wäre ich gerade noch der Hölle entkommen.
Noch im Sommer fuhr ich gemeinsam mit acht anderen Mädchen und Hellena, der Leiterin der Mädchenwohngemeinschaft, in Urlaub. Nach Italien sollte es gehen. Und ich war aufgeregt. Noch nie hatte ich das Meer gesehen.
In aller Herrgottsfrühe startete Hellena also unseren knallgelben VW-Bus, in dem wir Mädchen brav und mit einer ordentlichen Portion Urlaubsfieber ausgerüstet, auf unseren Plätzen hockten, und dem lockenden Süden entgegenfieberten.
Ich saß zwischen Tina und Silvia, den beiden ältesten Mädchen der Gruppe. Beide waren schon fast achtzehn und hatten ihre liebe Not, uns neugierige Fünfzehnjährige vom Hals zu halten. Doch noch am Vorabend, den wir durchgemacht hatten vor Aufregung, holte mich Tina zu sich und sagte: „Isa, Silvia und ich sitzen ganz hinten im Bus und du darfst zwischen uns sitzen, aber du musst versprechen, uns beim Schlafen nicht zu stören, okay?“
Es war ein Privileg zwischen den Ältesten zu sitzen, und weil ich beide mochte irgendwie, weil sie mich auch stets vor den Betreuern in Schutz nahmen, wenn ich wieder einmal länger als erlaubt mit ihnen gemeinsam fernsah, war ich stolz, auf den mir zugewiesenen Platz.
Wir fuhren den halben Tag, bis wir am Sporn angekommen waren und Doris auf einen Strandabschnitt zeigte, der ihr zu gefallen schien. „Mädchen“, sagte sie erfreut, „wie sieht´s aus, gefällt es euch hier?“ Oh, und wie es mir gefiel. Da brauchte sie nicht zwei Mal zu fragen. Den anderen schien es gleich zu gehen, was uns alle automatisch dazu veranlasste, uns aus unseren völlig verschwitzten Klamotten zu schälen.
Im Inneren des Busses herrschte Aufbruchsstimmung, während wir uns schoben und kniffen im Gedränge, um uns unsere Bikinis und Badeanzüge über zu ziehen.
Mia, ein Mädchen, das zur selben Zeit wie ich das Mädchenwohnheim bezogen hatte, war so wie ich fünfzehn, und schon bald verband uns eine sehr tiefe Freundschaft. Mia hatte strohblondes schulterlanges Haar, einen so üppigen Busen, wie ich noch nie einen gesehen hatte, geizte nie mit ihren Reizen, weswegen sie immer einen Rattenschwanz Jungs hinter sich herzog, was auch uns zu Gute kam, und war ein Mädchen von der Was-kostet-die-Welt-Sorte.
Mia zog sich, wie konnte es auch anders sein, nur ihr Bikinihöschen über, und flitzte halbnackt über den feinkörnigen heißen Sandstrand, immer geradeaus, dem verlockenden Meer entgegen. Ich sah ihr lächelnd nach und wie sie in den Fluten verschwand.
Dann hörte ich sie johlend vor Freude irgendwo in den Wellen „Isa, Isa, komm endlich, du musst jetzt unbedingt rein!“ rufen. Und noch ehe ich mein Glück fassen konnte, fühlte ich wie meine Füße blitzschnell über den heißen Sandstrand stoben. Meine Fußsohlen brannten, während ich lief und ich fühlte das Leben in mir pulsieren, als wäre ich im Paradies gelandet.
Nie wieder wollte ich hier weg. Ich lief einfach weiter, direkt hinein in die Fluten des Mittelmeeres, und als ich erschrocken aufrief, während ich mir meine salzigen Lippen leckte, „Hey, wieso schmeckt das Wasser hier so eigenartig?“, wurde mir beim Gelächter der Mädchen mit einem Mal bewusst „Ja klar, Isa, das Meer ist tatsächlich salzig.“
Ich fühlte mich wie neugeboren, wie ein kleines Kind, das seine ersten Schritte machte und eine völlig neue Realität vorfindet, in der es nichts als pure Lust und Freude am Leben gab. Alles, was ich über das Meer je gelesen und gehört hatte, schnalzte mir in mein Bewusstsein zurück, in dem Moment, in dem ich erworbenes Wissen endlich auch fühlen, schmecken und in der Praxis des Lebens am eigenen Körper erleben durfte.
Gott! War ich froh am Leben zu sein!
Ungestüm erregt tauchte ich zu Mia hinüber, dorthin wo die Wellen sich brachen, und surfte sie mit meinem Körper.
Noch zuvor, als wir die Küste mit dem Bus entlang gefahren waren und Hellena das Fenster öffnete, hatte ich ihn in der Nase, diesen Geruch, den ich bis dahin noch nicht kannte und einzuordnen vermochte. Doch nun stand ich da, mitten in den Fluten, meine Arme wie Flügel ausgebreitet und atmete den Duft des Meeres. Und ich wusste mit einem Mal, dass ich ihn liebte, den salzig anmutenden, mit Sonnenöl geschwängerten Geruch von Freiheit. Alle meine Sinne standen in Erlebnisbereitschaft, zu genießen und anzunehmen, was soeben an Eindrücken daherkam. Es war herrlich.
Nach dem erfrischenden Bad machten wir uns also auf die Suche nach einem Quartier. Doch Hellena meinte nur fröhlich erregt, nachdem sich für heute Nacht für uns zehn nur ein geschützter Parkplatz vor einer abgelegenen Pension, die wir erst ab Morgen beziehen konnten, auftat, „Was soll´s Mädchen, dann schlafen wir heute Nacht eben im Bus und auf unseren Sonnenliegen im Freien.“
Doch noch waren wir inmitten des Küstendorfes, und da wir Hunger hatten, aufs Klo mussten und keine Dusche weit und breit zur Verfügung stand, parkte Hellena unseren auffälligen Bus zur allgemeinen Belustigung direkt am Dorfplatz.
Es dauerte nicht lange und eine Menge Schaulustige umringten uns wuselnde Mädchenbande, um das fröhliche Treiben zu beobachten. Es war uns klar, dass sich unser Ankommen scheinbar in Windeseile im Dorf herumgesprochen hatte, und nun auch einige rassige, charmante Italiener angezogen hatte.
Hier wollten wir bleiben. Das stand außer Frage.
Mit Handtüchern bestückt, die wir uns gegenseitig zum Schutz vor lüsternen Blicken vor die Körper hielten, versuchten wir unsere Klamotten zu wechseln. Einige von uns standen schon an den Seitenspiegeln des Busses Schlange, um sich für den Abend herauszuputzen und die Wimpern zu tuschen. Unter Gelächter, unserer lustigen Situation wegen, bemühten wir uns, etwaig auftauchende Schamgefühle mit Kichern und Toben Herr zu werden, was allerdings nur noch mehr neugierige Schönlinge anlockte.
Keuchende „Bella Signorina“-Rufe waren wohl die ersten italienischen Worte, die ich noch vor Ort zu verstehen lernte.
Auf dem Weg in eine nahegelegene Pizzeria, zu der uns Hellena als Anführerin lotste, folgte uns eine noch größere Horde liebestoller, schwarzhaariger Frauenschwärmer. Ein Adonis jagte den nächsten und bei dem Liebeswerben und heißem Geflüster wie „Bella Matta, chi vediamo domani in spiaggia“, was wohl so viel bedeutete wie „Schönes Mädchen, sehen wir uns morgen am Strand?“, fühlten wir uns wie eine Meute streunender Katzen, die um Mitternacht bei Vollmond von läufigen Katern belagert und umworben wurden. Das plötzliche Erscheinen zehn junger, sich im besten Alter befindender, blonder Österreicherinnen in einem abgelegenem Küstenkaff bot ein wahres Schauspiel auf offener Straße. Und genau das sollte es auch. Wir waren die Attraktion und wir waren happy.
Am Morgen reckten wir unsere steifen Glieder, die nach dem unruhigen Schlaf in den Liegen Muskelverspannungen bei jeder Einzelnen hervorgerufen hatte. Zum Frühstück hockten wir amüsiert um unseren VW-Bus und aßen Nudelsalat mit Plastikgabeln.
Mit Nadja, dem gemeinen Mädchen, welches mit mir in einem Haus im Heim aufgewachsen war, verstand ich mich abwechselnd mal recht, mal schlecht. Im Urlaub aber waren wir uns zweifelsohne recht.
Nadja hatte Bärenhunger, wie wir alle, und schaufelte ihren Nudelsalat in sich hinein, als wäre sie kurz vor dem Verhungern. Dann sah ich, wie sie sich etwas auf ihr Besteck gabelte, das mir so gar nicht nach Nudelsalat aussah, und schob sich die ganze undefinierbare Sache in ihren Mund. Erst als Mia angeekelt aufschrie, ließ Nadja die Gabel fallen und wie sich herausstellte, hatte die Gute in ihrem Hunger um ein Haar einen knapp drei Zentimeter großen Käfer, samt Fühler und Flügel verspeist. Wir lachten alle und hielten uns die Bäuche, doch musste ich feststellen, dass mir der Appetit verloren ging und angewidert ließ ich das Frühstück sausen.
Dann traf ich mich am Strand mit Nino. Nino war zwanzig, braun gebrannt, hatte langes schwarzes Haar, das er im Wind wehen ließ und außer „Amore, Amore“ kein anderes Wort zu mir sagte. „Wahrscheinlich“, so erklärte Mia scherzend, „kennt er keine anderen Worte“, und ich musste lachen. Und am Tag darauf traf ich mich mit Francesco, ebenso schwarzhaarig und wunderschön anzusehen, mit nur einem Unterschied. Er versuchte nicht wie Nino, mir gleich am selben Tag stolz sein Gemächt zu zeigen und mich hinter den Dünen zu verführen.
Hellena ließ uns laufen. Wir hatten ja Urlaub. Alles, woran wir uns zu halten hatten war, mindestens zu zweit zu bleiben und um die ausgemachte Zeit an einem bestimmten Platz zu erscheinen, den wir vereinbart hatten.
Abends gingen wir gemeinsam in die Dorfdisco, in der wir fast ausschließlich die einzigen Gäste waren. Wir waren froh, wenigstens abends unsere Ruhe von den Männern zu haben und unter uns selbst zu bleiben. Eine Ausnahme allerdings kam uns immer wieder in die Quere. Besser gesagt ein heißer Verehrer von Hellena, von dem sie seit einer Woche geradezu observiert wurde. Er ließ sie niemals aus den Augen, und an einem Abend in der Disco sagte sie ihm, da sie dachte, ihn damit endgültig vertreiben zu können, dass wir allesamt ihre leiblichen Kinder wären. Hellena brauchte unsere Hilfe, das stand außer Frage, und wir machten mit bei dem Spiel und hockten uns aufgestapelt der Reihe nach auf ihren Schoß, um Einigkeit und Familienzusammengehörigkeit zu demonstrieren. „Mama“, plärrte die eine und kuschelte sich an Hellena, und wieder eine andere meckerte wie streng unsere Mama doch war.
Doch von diesem Abend an ließ er nicht mehr von ihr ab, sondern quälte sich dabei, Hellena mit seiner inbrünstigen Liebe endlich doch noch erobern zu können. Scheinbar beflügelte ihn die Vorstellung, dass die immer verzweifelter werdende Hellena eine so gebärfreudige potente Frau war, die auch ihm sicherlich noch eine Schar Kinder würde schenken können. Und zu alledem glaubte er durch unsere kindische Inszenierung nun tatsächlich, dass Hellena sogar als Erzieherin eine ganz passable Erscheinung abgab. Schließlich sah man nicht alle Tage so gut erzogene Gören. Der Schuss, den Hellena also auf ihn abgefeuert hatte, war zu unserer aller Belustigung nun nach hinten losgegangen.
Wir suchten uns neue Buchten, die wir noch nicht kannten und blieben die letzten zwei Wochen ausschließlich an einem Strand, der von Klippen und hohen Felsen eingesäumt war. Wir kletterten halbnackt wie junge Steinböcke die Felsen hoch, nur um dann kopfüber in schwindelnder Höhe wie Klippenspringer ins kühle Nass zu köpfeln.
Und als wir nach den herrlichen Wochen, müde und erschöpft von der langen Reise, wieder zu Hause ankamen, erschrak Hellena so heftig, weil sie ihren Verehrer vor unserer Haustüre auf sie warten sah. Ich staunte nicht schlecht, denn Hellena hatte uns erklärt, dass er ihr sicher hin und wieder mal eine Postkarte schreiben, sie aber ansonsten wohl in Ruhe lassen würde. So weit wie der Urlaubsort von unserem zu Hause entfernt war, und wir fuhren fast dreizehn Stunden in eine Richtung, würde er von ihr und seiner unerfüllten Liebe wohl Abstand nehmen.
Doch Hellena hatte sich geirrt.
Und nun stand er da, mit einem Strauß Rosen und hoffte, dass sich Hellena über sein Liebeswerben freuen würde. Doch da hatte er sich geirrt.