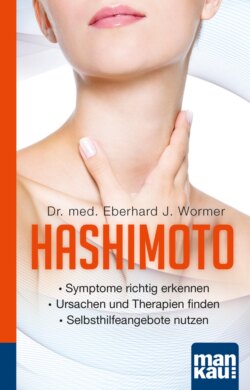Читать книгу Hashimoto. Kompakt-Ratgeber - Eberhard J. Wormer - Страница 5
ОглавлениеEinführung
Der japanische Arzt Hakaru Hashimoto berichtete erstmals 1912 über das feingewebliche Erscheinungsbild dieser Erkrankung: ein Entzündungszustand der Schilddrüse (Thyreoiditis). Fehlfunktionen und Beschwerden werden aber nicht von der Schilddrüse selbst verursacht, sondern sind das Ergebnis einer Immunstörung: Das Immunsystem attackiert fälschlich die eigene Schilddrüse, was den Entzündungsprozess auslöst und schleichend oder schubweise zum Verlust von funktionsfähigem Schilddrüsengewebe führt. Die Hashimoto-Thyreoiditis gilt demnach als Autoimmunerkrankung wie Typ-1-Diabetes, rheumatische Erkrankungen, die Weißfleckenkrankheit Vitiligo oder Morbus Addison (Nebennieren-Erkrankung). Fest steht: Bei all diesen Erkrankungen greift das Immunsystem aus bislang unbekannten Gründen körpereigenes Gewebe an.
Das größte Problem ist die Tatsache, dass die Erkrankung sowohl in der breiten Öffentlichkeit als auch bei der Ärzteschaft zu wenig bekannt ist – ein klassisches Informations- und Kommunikationsproblem. Und das vor dem Hintergrund, dass bis zu 10 Prozent der Bevölkerung betroffen sind.
Das zweite Problem betrifft die Medizin, die sich mit Hashimoto äußerst schwertut. Das hat viele Gründe. Das innersekretorische System (Endokrinium) ist kompliziert und beansprucht überdurchschnittliches Vorstellungs-vermögen. Darüber hinaus sind Erkrankungen unbekannter Ursache aus naheliegenden Gründen für die Medizin problematisch: Die Behandlung ist schwierig, oftmals frustrierend oder gar erfolglos. Zudem werden neue Erkenntnisse häufig zu langsam in die praktische Medizin umgesetzt. Im Fall der Hashimoto-Thyreoiditis betrifft dies vor allem die Bewertung von Laborbefunden, etwa den TSH-Wert: Sind die Schilddrüsenwerte normal, ist für den Arzt die Diskussion beendet – obwohl manche Patienten unübersehbar an Beschwerden leiden. Betroffene landen dann rasch in der Schublade »eingebildete Kranke«, »Hypochonder« oder »Psycho« – einmal mehr sind es überwiegend Frauen, die so abgefertigt werden. Gibt es gute Nachrichten? Ja. Es gibt in Deutschland eine sehr aktive Gemeinde von Betroffenen, die sich bevorzugt via Internet um eine Verbesserung der Information über diese Erkrankung bemüht (www.hashimotothy-reoiditis.de). Hier findet man in Diskussionsforen und Selbsthilfegruppen wertvolle Hinweise auf Problemlösungen.
Erfreulich ist auch, dass die Mehrheit der Patienten relativ gut mit der Erkrankung zurechtkommt und ein fast normales Leben führen kann. Etwa ein Fünftel der Betroffenen leidet allerdings unter teilweise anhaltenden und mitunter schweren Symptomen. Hier besteht ein dringender Handlungsbedarf.
Was die Hashimoto-Therapie betrifft, gibt es gleichfalls gute Nachrichten – vorausgesetzt, man nimmt das Management der Erkrankung in die eigene Hand. Je besser informiert, desto größer das Erfolgserlebnis! Auch der kritische Blick auf ärztliche Befunde ist empfehlenswert. Das betrifft vor allem die Diskrepanz von normalen Schilddrüsenwerten und vorliegenden Beschwerden sowie die Anwendung von Schilddrüsenhormonen. Nur die individuelle und auf den Stoffwechsel abgestimmte Hormontherapie ergibt einen Sinn.
Das Beste zum Schluss: Es mehren sich Hinweise darauf, dass ein gesunder Lebensstil, der insbesondere auf ein starkes Immunsystem abzielt, wirksam dazu beiträgt, dass man die Schilddrüsenfunktion langfristig günstig beeinflussen und ein weitgehend beschwerdefreies Leben mit Hashimoto erreichen kann. Ernährung, Bewegung, Entspannung, Antioxidantien und die Beachtung von Risikofaktoren spielen eine Rolle. Deshalb ist die frühzeitige Diagnose von großer Bedeutung. In jedem Fall können Sie selbst die Bedingungen für ein normales Leben mit Hashimoto-Thyreoiditis schaffen.