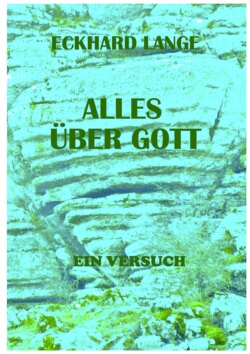Читать книгу Alles über Gott - Eckhard Lange - Страница 3
I. WIE ES ANFING - VIELLEICHT
ОглавлениеAlles über Gott – tatsächlich alles? Natürlich nicht. Was weiß man denn schon wirklich über ihn, wo man doch nicht einmal so richtig weiß, ob es ihn denn überhaupt gibt. Und wenn ja – wo er lebt, wie er aussieht, wer er ist. Alles unbekannt, alles nur Vermutungen, alles nur Bilder und Geschichten, von Menschen für Menschen.
Und genau dies ist das Besondere an Gott: Was man erkennen kann, ist stets nur ein Bild, eine Vorstellung. Ist – ja, Fantasie! Was man meint, von ihm zu wissen, kann man nur in Geschichten verpacken, in Gleichnissen erzählen, und das heißt: auf dem Umweg über Menschlich-Allzumenschliches wiedergeben. Also auch hier ist Fantasie angesagt und notwendig. Aber das sagt noch nichts darüber aus, wer oder was er nun wirklich ist – und auch dieser Satz ist zweideutig. Man kann ihn so verstehen: Wir können überhaupt nichts über ihn sagen. Doch wir könnten ihn auch anders auslegen: Es lässt sich nur das über Gott sagen, was im Bereich unserer Vorstellung bleibt. Denn das soll dieses merkwürdige Wort „Gott“ ja eigentlich ausdrücken: Etwas, was letztlich jenseits all dessen bleibt, was wir in Worte fassen können. Ein definierbarer Gott wäre ein Widerspruch in sich selbst.
Wir machen uns also auf die Suche nach etwas, was wir – streng genommen - gar nicht finden können. Und doch hat der Mensch, sobald die Evolution ihn aus dem bloß tierischen Dasein entlassen hatte, nach eben diesem Undefinierbaren, diesem unbeschreiblichen und jenseitigen Etwas gefragt, es als Wirklichkeit außerhalb aller Realität vermutet, geglaubt, und manchmal auch existentiell erfahren. Also müssen wir tatsächlich bei Adam und Eva anfangen, oder – entsprechend dem augenblicklichen Stand unserer Forschung – bei Selam und Lucy, beziehungsweise, im nüchternen Sprachgebrauch der Paläoantropologen, bei DIK 1-1 und AL 288-1. Und es ist vielleicht kein Zufall, daß beide Funde weiblich sind, denn nicht Adam, sondern Eva steht am Anfang, ist alleinige mütterliche Gen-Geberin aller nach ihr existierenden menschlichen Lebewesen – bis hin zu jenem in diesem Augenblick irgendwo auf der Welt geborenen Säugling. Adams Rippe war dafür nicht nötig. Das mag männlichen Stolz verstören, ist aber wahr.
Doch war ein Gott dafür nötig? Das werden wir klären müssen, allerdings erst irgendwann später. Jetzt geht es erst einmal darum, ob diese ersten Menschenwesen (falls man sie schon so nennen darf) Gott für ihre Existenz nötig hielten. Jahrtausende lang lässt sich diese Frage nicht beantworten. Bis unsere Vorfahren zwei recht unterschiedliche Dinge entdeckten: die Kunst und die Bestattung. Denn daraus lassen sich erste Schlüsse ziehen.
*****
Beginnen wir mit der Kunst, obwohl sie später kommt. Wir wollen dabei dem Fachwissen aus dem Internet, genannt „Wikipedia“ Glauben schenken. Danach ist menschliche Kunst vor vierzig Jahrtausenden erstmals greifbar – als bildende Kunst. Da hören wir dann von kleinen Figürchen, geschnitzt aus Elfenbein, von Flöten als allerersten Instrumenten, mit denen man musizieren konnte, und vor allem von den Malereien an den Wänden so mancher Höhle. Das erste, was der Steinzeitmensch da geschaffen hatte, ist das Abbild seiner selbst, genauer: ist die Darstellung des prallen weiblichen Körpers. Die Forscher nennen sie gerne „Venus“, doch ob die Figurinen etwas Göttliches darstellen, bleibt im Ungewissen. Jedenfalls aber war es wohl das Staunen über das Wunder des Lebens, das sie damit zum Ausdruck brachten – die Ehrfurcht vor dem Geheimnis der Geburt, die Verehrung der Fruchtbarkeit. Aber wohl noch nicht der Sexualität.
Daneben fanden sich noch andere Figuren – ungewiß, ob männlich oder weiblich, aber dafür eindeutig Mensch und Tier in eins: menschliche Körper mit dem Kopf eines Löwen. Auch hier lässt sich vieles hineinlegen und nichts wirklich beweisen. Waren es Darstellungen eines Zauberers, der sich mit dem Löwenfell in dieses gefürchtete und mächtige Tier verwandeln konnte, waren es schon jenseitige Wesen, so wie viel später in Ägypten und anderswo Götterstatuen mit Tierköpfen aufgestellt wurden? Jedenfalls aber entstanden hier Figuren, die etwas außerhalb der erfahrbaren Wirklichkeit abbildeten – etwas, was furchterregend und geheimnisvoll war, was man beschwören und besänftigen mußte. Wir begegnen, so will mir scheinen, zumindest einer Ahnung von transzendenter Macht – ob nun schon im „Himmel“ angesiedelt oder irgendwo in der Welt um diese Menschen herum.
Aus der gleichen frühen Zeit – und ebenfalls in Höhlen entdeckt – stammen mehrere Flöten, meist aus Vogelknochen. Der Steinzeitmensch machte also auch Musik! Aber welche und wozu? Einfach nur aus Spaß an dieser neuen Art, Töne zu erzeugen? Oder um Beute zu imitieren und damit anzulocken? Oder um sich danach im Tanz zu bewegen? Und wenn – um bloßer Lebenslust Ausdruck zu verleihen, oder doch eher, um sich in Trance zu versetzen, um so dem Jenseitigen zu begegnen oder ihm gar damit zu gefallen? Auch hier können wir nur rätseln. Doch daß der Mensch jener Zeit etwas Zweck-loses tat, l’art pour l’art sozusagen, vermag man sich schwer vorzustellen. Etwas so Geheimnisvolles wie eine Melodie zu erzeugen, das wird auch dem Geheimen, also letztlich dem Göttlichen, gewidmet sein.
Der umfangreichste und aufregendste Teil der Kunst jener frühen Tage des Menschseins jedoch sind zweifelsohne die vielen Malereien an den Wänden von Höhlen – Tiere, Symbole, auch der Vulva, finden sich dort im Dunkel unterirdischer Verliese. Man hat die Tierbilder oft als Abbildungen für eine Art Jagdzauber gedeutet, und das mag gelegentlich auch zutreffen, obwohl es vielfach bestritten wird. Aber es gibt ebenso – in der Grotte von Chauvet etwa – Bilder, die wir Heutigen vielleicht Paradies-Vorstellungen nennen würden: Es sind keine Jagdtiere dargestellt, sondern eher die Feinde des Menschen – Löwen, Bären, Panther, Nashörner oder Hyänen zum Beispiel – und sie scheinen friedlich beieinander zu stehen, einander zugewandt. Ein Bild der Hoffnung? Oder doch eher dazu bestimmt, den Feind durch irgendeinen Zauber versöhnlich zu stimmen? Oder soll die gewaltige Kraft dieser dem Menschen weit überlegenen Wesen durch das Bild übergehen auf den Betrachter?
Denn im Grunde war dieser aufrecht gehende Zweibeiner mit seiner nackten Haut das armseligste unter allen Säugetieren: Die einen waren größer und stärker, um unangreifbar zu wirken, die anderen konnten schneller sprinten und weiter springen, um ihr Opfer zu jagen; die einen hatten ein furchterregendes Gebiß, um ihre Beute zu reißen, die anderen krallenbewehrte Tatzen als Waffen; die einen konnten ausdauernder laufen, um dem Feind zu entkommen, die anderen hatten wenigstens einen mit Hörnern bewehrten Dickschädel, um einem Angreifer Paroli zu bieten. Der Mensch dagegen mußte das alles ersetzen durch das, was sein Verstand ihm eingab. Denn er war schon damals kein dumpfer Primitiver, unfähig zu komplexen Denken. Seine Synapsen wären durchaus in der Lage gewesen, die komplizierten Schaltkreise selbst einer künstlichen Intelligenz zu entwickeln. Was ihm fehlte – noch fehlte, war allein die Erfahrung, war das in Tausenden von Generationen angesammelte Wissen, um seine Welt besser zu verstehen und gründlicher zu nutzen.
Es sind unendlich viele bemalte Flächen entdeckt worden, und sie stammen aus unterschiedlichen Jahrtausenden, wie sollte da nur eine einzige Deutung gelingen? Aber daß man sie meist in die abgelegensten Winkel der Höhlen gemalt hat, erhöht nur ihr geheimnisträchtiges Dasein. Auch die Darstellung der Vagina – und nicht eines Phallus, lässt die Höhle als Abbild des Uterus erscheinen. Daß Leben durch Gebären entsteht, das war für jeden sichtbar und darum einsichtig – welchen Anteil der männliche Samen dabei hat, blieb wohl noch im Verborgenen. Im Schoß von Mutter Erde konnten sich auch jene Dinge vollziehen, die eigentlich Unsagbares möglich machten. Wir sprechen dann von Kulthandlungen, von Ritualen – und also vom Umgang mit etwas Göttlichem, so vage diese Aussage auch bleiben muß. Nur das wird man sagen können: Am Anfang des menschlichen Bewusstseins, des Nachdenkens über sich selbst und die Welt steht die Religion – als erstes Erklärungsmuster des Unerklärlichen. Die Frage ist nur: Erfüllt sie diese Aufgabe auch heute noch, in unserer aufgeklärten Zeit?
Und es bleibt ebenso die Frage, welcher Art die religiösen Vorstellungen waren. Eines scheint jedoch sicher: Personifizierte, überirdische Gottheiten wird es damals nicht gegeben haben, die geheimnisvollen Kräfte, die man täglich erlebte, sie offenbarten sich in dem, was sichtbar war, in der Potenz der Tiere, in allem, was wuchs, im Wandel des Mondes dort oben, der zu- und abnahm nach einem geheimnisvollen, aber erkennbaren und sogar berechenbaren Gesetz – und auch im Geborenwerden und Sterben des Menschen. Die Welt, die den Menschen umgab, war eine von mächtigen Kräften durchwebte Welt – sie bestimmten und erhielten das Leben, aber sie bedrohten es auch, mussten und konnten also beschworen werden.
Über viele Jahrtausende hinweg begegnet uns dabei eine Farbe – auf den Figurinen der Frauen, auf den Körpern der Toten, an den Wänden der Höhlen: Ocker – rot wie Blut und damit wie das Leben. Versagen wir uns all die schönen Theorien, die Menschen unserer Tage für den Glauben, die Ängste und die Hoffnungen unserer Vorfahren erdacht haben; versagen wir uns auch den Vergleich mit den wenigen noch heute als Jäger und Sammler herumstreifenden Menschengruppen – was ist daran Wahrheit, was Fantasie, was unerlaubter Rückschluß! Wir werden es niemals entschlüsseln, weil wir unsere Welt niemals wirklich mit den Augen eines menschlichen Wesens am Anfang aller Kultur sehen können. Doch eines ist wohl unbestreitbar: einen Gott, wie wir ihn kennen, kannte die Steinzeit nicht, wohl aber eine geheimnisvolle Geistigkeit in allem, eine Beseeltheit der Natur, und ihr mußte man sich stellen, man mußte sie besänftigen, weil man sie zu fürchten hatte, man mußte sie achten, weil von ihr alles Leben abhing.
*****
Lassen wir uns jetzt endlich zu jenem anderen Phänomen führen, das fast hunderttausend Jahre vor dieser ersten kulturellen Blüte der erwachenden Menschheit erschien und das den Menschen wohl erstmals wirklich vom Tier unterschied: Er sorgte sich nicht nur um die Lebenden, denen er verbunden war und auf die er zum Überleben angewiesen war – er sorgte sich auch um die Toten.
Wir wissen heute, daß auch Tiere trauern können, daß sie den Abschied empfinden, wenn ein nahes Wesen gleicher Art oder auch ein ihnen nahestehender Mensch dahingeht. Aber den Leichnam des Artgenossen bestatten, ist wohl allein menschlich. Eine gefühlte Ewigkeit, bevor unser Urahn das erste Samenkorn in den mühsam aufgeritzten Boden legte, vertraute er eben diesem Erdboden seine Toten an. Und was uns so selbstverständlich erscheint, ist dennoch voller Rätsel: Warum tat man das, welche Gründe hatten diese Menschen schon in der ältesten Steinzeit, dem Leichnam eines Artgenossen einen Ort zu geben, ihm eine Würde zuzugestehen, obwohl er doch ohne alles Leben war? Oder stimmt das nicht? Lebte etwas von ihm weiter, bliebe Leben mächtiger als das, was man den Tod nennt?
Auch hier bewegen wir uns im Dunklen, in Vermutungen, weil wir überhäuft werden mit den vielfältigen Vorstellungen der zahllosen Jahrtausende danach, weil wir es gelernt haben, die Auferstehung der Toten zu bekennen und das Leben in der zukünftigen Welt – selbst wenn wir es nicht mehr glauben können. Und doch – etwas davon ist tiefer in der Menschheit verwurzelt als alles Bekenntnis zu einem Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Oder so ähnlich. Was den Menschen erst Mensch werden ließ, das war sein Bewusstsein, und es lehrte ihn die Erkenntnis, daß er vergänglich ist. Zugleich aber versetzte es ihn in jenes tiefe Erschrecken darüber, daß die Kräfte des Lebens ihm nicht auf ewig zur Verfügung stehen. Seitdem der Mensch denken konnte, mußte er auch den Tod denken. Und damit hatte er das Paradies verloren, indem er unschuldig, aber eben auch gedanken-los leben konnte. Also mußte er sich auf die Suche machen nach etwas, was ihm den Tod erträglich machen könnte. Und diese Suche war der Beginn aller Religion. Oder sagen wir es so: Das Bewusstsein, das den Menschen vor allen anderen Lebewesen auszeichnet, ist von Anfang an ein religiöses Bewusstsein, in einem ganz weiten und allgemeinen Sinn.
Wohin nun hat ihn diese Suche geführt? Zu einem Grab, zur Bestattung, zur Zeichenhaftigkeit des Abschiednehmens – und vielleicht zu einer Hoffnung, die zwar jenseits seiner Vorstellungskraft lag, aber eben dennoch Hoffnung war. Folgen wir ihm also bei dieser Suche, indem wir nach den Spuren suchen, die er uns hinterlassen hat. Auch wenn wir sie nicht immer deuten können.
Es gibt Gräber, darin ist der Tote in einer Art Hockerstellung beigesetzt, und sie erinnert – wenigsten uns heute – an die Haltung des Embryos im Mutterleib. Sowohl der Neandertaler als auch der Cro-Magnon-Mensch bestatteten so ihre Verstorbenen. Und immer wieder begegnet uns auch der rote Ocker auf deren Überresten – die Farbe des Lebens, dem Toten mitgegeben. Was es auch immer sein mochte – man erwartete etwas für die Zeit jenseits des Sterbens, weil man sich nicht damit abfinden wollte, daß Tod einfach Ende bedeutete.
Der Mensch jener fernen Tage erlebte ja seine gesamte Umwelt als etwas durchgeistigtes, durchwebt von den geheimnisvollen Wirkmächten des Lebens. Warum sollte also nicht auch er selbst, nachdem er sich als Ich, als unverwechselbares Individuum inmitten der Welt entdeckt hatte, teilhaben an dieser Lebenskraft – auch über das sichtbare Lebendigsein hinaus? Dann aber war es keinesfalls gleichgültig, was mit seiner Körperhülle, mit den sichtbaren Überresten geschah, dann war sie als Wohnplatz für seine Seele (auch wenn er dieses Wort vielleicht noch gar nicht erfunden hatte!) wohl noch nach dem Sterben von Bedeutung.
Und wieder rätseln die Gelehrten über das, was den Steinzeitmenschen bei seinen Bestattungsritualen bewegt haben mochte: Fürchtete er die Seele des Verstorbenen, wenn er ihr nicht die nötige Ehrerbietung erwies, mußte er sich also schützen vor den Geistern der Toten? Oder waren die Ahnen Teil des Lebens auch in der Gemeinschaft ihrer Nachkommen, mußte und konnte man sie beteiligen am Geschehen, verliehen sie den Nachgeborenen gar geheimnisvolle Kräfte? So könnte man es deuten, wenn in jener Vorzeit der Schädel eines Toten vom Körper getrennt wurde, einen besonderen Ort bekam.
Warum aber wurden vielfach die Leichen offener Verwesung preisgegeben oder auch den Vogeln zum Fraß angeboten, um dann ihren bloßen Knochen ein würdiges Grab zu bereiten? Warum blickten in anderen Gräbern die Toten stets nach Osten, der aufgehenden Sonne entgegen? Uns bleiben nur Vermutungen, eine Antwort werden wir nicht finden. Nur eines scheint sicher zu sein: Die Hoffnung auf ein weiteres, anderes, neues Leben ist älter als aller Glaube an jenseitigen Gottheiten. Dabei bleibt die erhoffte Art dieses Weiterlebens im Dunkel der Geschichte verborgen: Zwar gab es auch Dinge, die man den Toten mit ins Grab legte, aber sie lassen sich nicht deuten als notwendige Hilfe für dieses andere Leben, als Wegzehrung oder als Gegenstände, die dem Wohlbefinden, der Existenz dort dienlich sein konnten. Dieser Brauch, einen Verstorbenen mit allem auszustatten, was er für ein Leben im Jenseits benötigt, stammt aus weit späteren Epochen der Menschheitsgeschichte.
*****
Es wird aufgefallen sein: Das Wort „Vermutung“ bleibt die Konstante innerhalb der ganzen Recherche. Kein Wunder: Wer von uns modernen Menschen kann sich denn wirklich hineinversetzen in unsere Vorfahren, die da zur Zeit der Neandertaler gelebt haben, ihr Empfinden nachempfinden, ihre Denken nachvollziehen, gar ihrem Glauben auf die Spur kommen, ohne daß es belastbare Erkenntnisse für das gibt, was sie damals gedacht, geglaubt und empfunden haben könnten. Die wenigen Funde, die uns archäologische Forschung beschert hat, helfen da auch nicht wirklich. Das muß noch einmal deutlich gesagt werden.
Gibt es noch einen anderen Weg zurück in die Vergangenheit? Einer schien sich aufzutun. Ein schmaler Pfad nur, aber immerhin gangbar, so meinen manche: Noch bis ins vorige Jahrhundert hinein gab es ja in abgelegenen Regionen unseres Globus urtümliche – einige sagen auch: primitive – Gruppen, die sich in vielem kaum von Steinzeitmenschen unterschieden, für die Geisterglaube und Ahnenkult als Sinndeutung genügte. Ist es also erlaubt, ja zielführend, ihre religiösen Vorstellungen mit jenen aus grauer Vorzeit gleichzusetzen? Ja – und Nein. Dort nach Parallelen für manche Vermutung zu suchen, kann sicher nicht schaden. Aber anzunehmen, über zehntausende von Jahren hinweg hätte sich nichts verändert, nichts entwickelt – das scheint doch ziemlich verwegen zu sein. Belassen wir es also lieber bei der Erkenntnis, keine gesicherten Erkenntnisse zu besitzen.
Wir halten fest, was wir vermuten können: Der Mensch der älteren Steinzeit – ob nun Neandertaler oder Homo sapiens - kannte wahrscheinlich noch keine personalisierte transzendente Gottheit. Für ihn war die ganze Welt beseelt und voller Lebenskraft. Aber er verfügte wohl schon über Rituale, um sich diese Kräfte anzueignen. Der eigenen Vergänglichkeit bewusst, sucht er nach Wegen, sich diese Lebenskräfte auch über den Tod hinaus zu sichern.