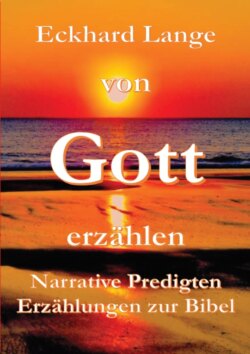Читать книгу Von Gott erzählen - Eckhard Lange - Страница 5
2. PERSPEKTIVISCHE ERZÄHLUNG
ОглавлениеZur Form
An die Stelle des "objektiven" Erzählers kann auch ein subjektiver treten: Ich lasse eine Person aus der Geschichte, die ich erzählen will, selbst erzählen. Dabei kann es sich um jemand handeln, der vom Geschehen selbst betroffen, an ihm beteiligt ist. Oder eine Randfigur, die nur stumme, mitempfindende Zuschauerin war, schildert ihre Beobachtungen: einer aus dem Kreis der Jünger, aus der umstehenden Volksmenge - vielleicht auch jemand, den ich selbst erst in die Geschichte einführen muß, der meiner - kontrollierten und zielorientierten - Fantasie entsprungen ist (etwa wenn die biblische Vorlage außer den Protagonisten keine Zeugen bereithält).
Wer auch immer - ich muß diese erzählende Person dann zunächst einführen:
• Entweder erläutere ich mit kurzen Worten vorweg, daß ich diesen Erzähler oder diese Erzählerin selbst zu Wort kommen lassen will: Ich stelle sie dem Hörerkreis vor - und ich stelle mir damit vor, wie er oder sie nun berichten wird. Erst dann folgt die Erzählung in Ich-Form.
• Oder ich führe meine Gewährsperson erzählend ein, indem ich ihr in einer Rahmengeschichte einen Zuhörerkreis schaffe, um sie dann dort sprechen zu lassen. Dann kann ich gegebenenfalls auch diesen Zuhörern Reaktionen, Anfragen, Zweifel in den Mund legen und so meinem Erzähler die Möglichkeit zu unterschiedlichen Antworten geben.
• Einfacher, aber in gleiche Richtung zielend, ist es, zwar formal "objektiv", also von außen her auf die Geschichte blickend, aber doch ganz von einer bestimmten Person her zu erzählen. Die Perspektive tritt dann nicht in der Erzählweise (als Ich-Erzählung) zutage, wohl aber inhaltlich, indem ich mir Standpunkt und Sichtweise einer bestimmten Person zu eigen mache.
Wie auch immer: Es geht nicht um stilistische Kunstgriffe, sondern die Erzählung, die ja eben Predigt ist und bleibt, gewinnt eine bestimmte und gewollte Perspektive: Die Sicht eines Betroffenen macht auch mich betroffen; die Zweifel eines Fernstehenden nehmen auch meine Zweifel auf; das Zeugnis eines Zeugen zielt auf mein Vertrauen - wobei unter "Ich" nicht nur der Prediger, sondern auch der Predigthörer zu verstehen ist.
Beispiel 1: Johannes 4, 46 - 54
Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs; dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war, und ging hin zu ihm und bat ihn, herabzukommen und seinen Sohn zu heilen; denn der war todkrank. Da sprach Jesus zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte sprach zu ihm: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt! Jesus spricht zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt! Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und während er noch hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten: Dein Kind lebt. Da fragte er sie nach der Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm: Gestern um die siebente Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es zu der Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam.
Eine schwierige Geschichte ist das. Vielleicht verstehen wir sie eher, wenn wir sie nicht von außen betrachten - kritisch abschätzend über die Jahrhunderte hinweg, wenn wir sie nicht als Lehre über etwas hören, sondern wenn wir uns selbst hineinbegeben in diese Geschichte. Ich lade Sie darum ein, diesen einen Tag im Leben eines Vaters mitzuerleben - mitzuempfinden, was er empfunden, gefühlt und gedacht haben mag. Ich will die Geschichte dieses Vaters erzählen als meine - als unsere Geschichte:
Und dies ist das erste Stück jenes einen Tages - unseres Tages als königlicher Beamter aus Kapernaum:
Es war ein Mann im Dienste des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, daß Jesus aus Judäa nach Galiläa gekom. men war, und er ging zu ihm.
Dreißig Kilometer sind es mindestens
von Kapernaum hinauf in die Berge bis nach Kana.
Und dort ist dieser Jesus.
Eigentlich ist es Wahnsinn, was ich da mache -
in jeder Beziehung.
Zu Hause liegt mein Sohn, krank - sterbenskrank,
und ich lasse ihn allein, um Hilfe zu holen.
Weiß ich denn, ob wir rechtzeitig zurück sind?
Weiß ich, ob er überhaupt mitkommen wird?
Ich werde ihm ein Reittier kaufen, damit es schneller geht.
Aber wird er es annehmen?
Wie lang dieser Weg wird!
Ich bin in Schweiß gebadet - nein, nicht von der Hitze,
oder von der Hast, mit der ich reite...
Ich sehe immer nur sein Gesicht vor mir,
das Gesicht meines Jungen, fiebrig und eingefallen.
Mit großen Augen hat er mich angeblickt:
Hilf mir doch, Vater!
Er konnte nicht reden,
aber ich habe es gespürt in seinem Blick:
So laß mich doch nicht sterben, Vater! Hilf mir!
Ich habe seine Hand gehalten, stundenlang.
Ich habe seine Stirn gekühlt,
und dabei liefen mir die Tränen über das Gesicht:
Mein Kind stirbt!
Und ich sitze dabei, hilflos, verzweifelt.
Kann ich denn garnichts tun?
Irgendeinen Arzt muß es doch geben, der Hilfe weiß,
eine Kapazität... vielleicht eine Wundermedizin...
irgendetwas...
Nun reite ich schon stundenlang über staubige Bergpfade,
und zu Hause liegt mein Kind und ringt mit dem Tode.
Mein Junge...
Nein, er soll nicht sterben! Ich will es nicht!
Hört ihr mich, ihr Mächte des Himmels?
Hörst du mich, Gott?
Ich will nicht, daß er stirbt, ehe er noch hat leben können.
Mein eigenes Leben würde ich ihm schenken,
aber ich kann es nicht.
Ich kann nur dieses Wahnsinnige tun:
diesen Wunderarzt holen -
wenn er denn einer ist.
Stirb nicht, mein Kind! Ich bitte dich:
Stirb nicht, bis ich wieder daheim bin an deiner Seite.
Wie endlos ist dieser Weg!
Die Berge flimmern in der Hitze.
Wirst du langsamer, mein Esel?
Los, lauf zu! Wir müssen es schaffen, hörst du?
Es darf nicht geschehen. Es darf nicht!
Das zweite Stück jenes Tages - unseres Tages:
Da sagte Jesus zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht!
Was sagst du da?
Du willst nicht kommen - habe ich das richtig verstanden?
In meinem Hirn wirbeln die Gedanken.
Kein Wort bekomme ich heraus.
Wenn du wüßtest, wie es in mir aussieht,
wenn du meine Ängste, meine Gedanken lesen könntest...
Oder kannst du es etwa?
Da stehe ich vor dir, stumm und verzweifelt,
und du hast nichts als diesen Vorwurf.
Du schweigst und schaust mich nur an.
Wie hart bist du doch, Herr!
Siehst du denn nicht, wie demütig ich vor dich getreten bin,
obwohl du nur ein Wanderprediger bist
und ich eine Position einnehme - eine hohe Position...
Ich weiß, das spielt jetzt keine Rolle. Entschuldige.
Aber daß ich so verzweifelt bin, das mußt du doch sehen!
Gut. Wenn du etwas nicht schaffst, das will ich verstehen.
Aber warum versuchst du es erst garnicht?
Du wirfst mir vor, daß ich ein Wunder erwarte?
Ja, das tue ich!
Was bleibt mir denn noch übrig,
als auf ein Wunder zu hoffen!
Du bist doch von Gott - oder?
Wer also soll denn noch Wunder vollbringen,
wenn nicht du?
Ich leide - siehst du das denn nicht?
Du mußt mir helfen -
du mußt einfach, wenn du von Gott bist!
Ich möchte es am liebsten herausschreien
und kriege kein Wort über die Lippen.
Wie lange stehe ich nun schon vor diesem Jesus?
Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit.
Herr, bitte! Wenn du mir jetzt hilfst, diese eine Mal,
dann verspreche ich dir: Ich will mich ändern.
Ich will ein neues Leben beginnen.
Alles will ich tun für Gott. Bestimmt - ich schwöre!
Du siehst mich so merkwürdig an, Herr.
Ich lese es in deinen Augen: Du läßt dich nicht bestechen.
Ja, ich weiß: Gott können wir nichts versprechen.
Gott können wir nichts abringen.
Unsere Bitten sind keine Waffen gegen dich.
Ich kann dich nicht zwingen. Du bist...
du bist der Herr, auch über mein Leben,
über das Leben meines Kindes.
Aber dann beweise es doch auch, wenn ich glauben soll!
Wenn du nicht hilfst, wenn du stumm bleibst...
wenn du mich allein läßt,
wenn du nicht mit mir gehst zu meinem Kind...
dann bist du nicht Gott!
Ich möchte es dir ins Gesicht schreien.
Du schweigst. Immer noch.
Worauf wartest du?
Ich spüre, wie meine Gedanken plötzlich zerrinnen,
meine Argumente sich in Nichts auflösen...
Nein, ich kann dich damit nicht treffen.
Du läßt dich nicht erpressen.
Du bist... du bist der Herr.
Ich verstehe... ich beginne jedenfalls zu verstehen:
Ich habe immer nur meine Verzweiflung vor Augen.
Ich bin immer noch ganz bei mir selbst.
Wie soll ich dich da erreichen?
Vielleicht bitte ich ja um das Falsche.
Ich möchte so gerne, daß mein Kind leben soll.
Aber was ist denn Leben?
Ist nicht bei dir das Leben?
Hast du - ein anderes Leben zu verschenken,
als ich es hoffe?
Meinst du das mit Glauben:
daß wir dir solches Leben zutrauen?
Es ist schwer, Herr, das zu begreifen,
wenn man so verzweifelt ist.
Ich bitte dich, laß mich jetzt nicht allein.
Ich stehe nun ganz mit leeren Händen da.
Ich weiß jetzt: Ich bin nichts vor dir.
Lehre mich doch den Glauben,
der dich wirklich ganz ernstnimmt, Herr -
und verzeih mir, wenn ich trotzdem bitte:
Komm und hilf meinem Kind - so wie du es willst.
Das dritte Stück jenes einen Tages im Leben dieses Beamten aus Kapernaum – unseres Tages mit Gott:
Jesus sagte zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin.
Wieder die Berge um mich her, die Hitze, die Einsamkeit.
Ich möchte den Esel antreiben,
und doch zögere ich, heimzukommen.
Ich komme ja mit leeren Händen. Ich komme allein.
Und doch bin ich ganz ruhig.
Er hat ja gesagt: Dein Kind lebt. Und das genügt.
Wenn ich so darüber nachdenke auf diesem staubigen Weg,
wenn ich meine Gedanken sammle...
wenn ich ehrlich bin, dann weiß ich nicht:
Was wird mich erwarten, wenn ich nach Hause komme?
Nur eins ist sicher: Mein Kind lebt.
Es wird SEIN Leben sein,
und das ist vielleicht anders, als ich es mir vorstelle,
als ich das gehofft hatte in meiner Verzweiflung.
Ja, ich möchte gern, daß der Junge gesund wird,
daß ich noch viele Tage und Jahre
mit ihm zusammen sein kann.
Ich möchte ihm erzählen von dieser Begegnung,
ihm und allen andern zu Hause.
Aber ich weiß nicht, ob es so sein wird.
Ich weiß nur:
Du wirst Leben finden, mein Kind, gottgeschenktes Leben.
Er, der Herr, hat es gesagt.
Und er hat Leben. - Er ist das Leben.
Wenn du... tot sein wirst bei meiner Heimkehr,
dann will ich nicht um dich weinen, mein Sohn.
Ein wenig vielleicht -
aber nicht so verzweifelt wie heute morgen noch.
Ich weiß, daß SEIN Wort auch dann noch gültig ist.
Wenn du aber wieder gesund wirst,
dann will ich dankbar sein.
Aber auch das wird eine andere Freude sein,
als ich sie mir heute morgen noch ausmalte
in den Träumen meiner Hoffnung.
Ich will dir dann erklären, was Leben ist, so gut ich es kann:
daß dein und mein Leben nur dann etwas bedeuten,
wenn wir es annehmen als Gottes Geschenk.
Daß dein und mein Leben mehr sind
als bloß dieses Dasein auf dieser Erde -
weil es Gottes Leben ist, an dem wir teilhaben können.
Ja, das will ich dir erklären, mein Sohn,
dir und all den andern auch.
Warum bleibt der Esel stehen?
Schau: eine Staubwolke in der Ferne.
Da kommen mir Leute entgegen.
Jetzt erkenne ich sie: Es sind meine Knechte.
Sie winken. Sie lachen.
Ich weiß... - ich weiß es ja schon: Mein Kind lebt.
Wann war das, als das Fieber verschwand?
Ja, das stimmt. Es war die Stunde, als ER es gesagt hat.
Ein Wunder, sagt ihr?
Ach - was sind Wunder! Die sagen nichts.
Aber ein Hinweis - das ist es schon. Für mich jedenfalls.
Ich will versuchen, euch das zu erklären,
so gut ich es jetzt schon kann.
Ihr seid ihm ja nicht begegnet,
ihr habt nicht erfahren können, daß er der Herr ist.
Aber ich will es euch erzählen,
damit ihr ebenso das Leben findet.
Kommt, laßt uns heimwärts reiten.
Nein, nicht wie früher,
als ihr nur Knechte wart und ich euer Herr.
Reitet doch jetzt neben mir, als meine Freunde.
Und ich werde euch sagen,
wie Gott den Menschen begegnet,
wie wir Leben finden können -
in Jesus, meinem... eurem, unserem Herrn.
Ihr müßt nur nach den Zeichen suchen.
Es gibt sie ja auch in eurem Leben.
Nein, nicht ihr allein für euch -
gemeinsam wollen wir es tun, wir alle zusammen -
als seine Knechte.
Als seine Freunde.
Und so begann das letzte Stück jenes Tages - als der Anfang für viele Tage, für ein neues Leben:
Und er glaubte mit seinem ganzen Hause
Kommentar:
Drei Vorentscheidungen haben die Form dieser Predigt bestimmt:
1. Ich verstehe diese Wundergeschichte im johanneischen Sinne als "Zeichen". Darum liegt mir daran, das Bekenntnis des Evangelisten zu Jesus als dem Herrn des Lebens loszulösen von der Beweishaftigkeit der Fernheilung. Andererseits will ich nicht eine abstrakte Theologie verkünden, sondern das in der Geschichte enthaltene personale Geschehen in den Mittelpunkt stellen.
2. Diesen - paradigmatischen - Lernprozeß des um Hilfe bittenden Vaters will ich anschaulich und damit nachvollziehbar machen. So entsteht die Idee, die innere Bewegung des Vaters ganz aus seiner Sicht heraus erzählend darzustellen, ihn also selbst sprechen zu lassen, und zwar nicht im Nachhinein reflektierend, sondern gerade im Prozeß seines Verstehens mit all seinen Facetten und auch Irrwegen. Dafür ist allerdings nötig, dies in einer kurzen Einleitung vorauszuschicken.
3. Dabei soll der Verlauf des Geschehens durch kurze Textzitate erkennbar bleiben und zugleich gegliedert werden. Insofern folge ich der Form der Homilie. - Im Textbild der Predigt habe ich das durch Schriftwechsel markiert. In der gesprochenen Predigt muß das sprechtechnisch abgesetzt werden (Ein Lektor für diese Einschübe wäre mir seinerzeit lieb gewesen).
So sind dann also diese Monologe des Königlichen Beamten entstanden als Zwiegespräch mit sich selbst und mit seinem Gegenüber. Damit wurde alle Dramatik ganz in seine eigenen Gedanken und Gefühle hineingelegt. Damit meine ich, der Gemeinde eine Möglichkeit geschaffen zu haben, den Weg eines langsam wachsenden Glaubens nachzuvollziehen - weg von der Hoffnung auf Wundergeschehen hin zu der Erkenntnis, daß Leben aus Gott anders und größer ist.
Die Beschwörungsformeln und die subtilen Erpressungsversuche, mit denen wir Gott oft genug zum Werkzeug unserer Wünsche und Lebenserwartungen machen möchten, sollen in der Gedankenwelt des Vaters ebenso stellvertretend vorkommen wie die Verzweiflung, die uns befällt, wenn wir hilflos dem Sterben zuschauen müssen. Aber wir können auch seine Erfahrungen mit Jesus miterleben, der ihm den Blick öffnet für ein neues Verständnis dessen, was Leben sein kann.
Beispiel 2: Johannes 20, 1 – 18 (gekürzt)
Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem andern Jünger, den Jesus liebhatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus, und sie kamen zum Grab. Und Simon Petrus ging hinein in das Grab und sieht die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte, nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der als Erster zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Da gingen die Jünger wieder zu den anderen zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Und sie wandte sie sich um sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir: Wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni!, das heißt: Meister! Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: »Ich habe den Herrn gesehen«, und was er zu ihr gesagt habe.
Was Ostern geschehen ist, darüber läßt sich kein Beweis führen. Die Osterbotschaft hat ihren Grund allein in dem, was Menschen erlebt haben - an jenem dritten Tage nach dem Tod Jesu, aber auch später immer wieder. Sie haben erfahren, daß Jesus - daß Gott nicht am Ende ist. Sie haben an sich selbst erlebt, daß Neues geschehen kann - daß ihnen Freude und Hoffnung geschenkt wurden: Unerwartete Freude mitten in Trauer und Verzweiflung; überraschende Hoffnung auf Leben mitten in der Begegnung mit dem Tod.
Aber das kann man eigentlich gar nicht so allgemein sagen. Es würde blaß und nichtssagend bleiben. Nicht umsonst wird im Neuen Testament von Ostern erzählt: Geschichten von dem, was Menschen erlebt haben. Und nicht umsonst sind gerade diese Ostergeschichten des Neuen Testaments sehr unterschiedlich - ja, auch widersprüchlich: Weil eben verschiedene Menschen unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben - mit der Freude und mit der Hoffnung.
Ich möchte darum heute auch nicht über Ostern reden, sondern von Ostern erzählen - einfach nachempfinden, nacherzählen, was diese eine Frau, was Maria aus Magdala erlebt hat: Wie es für sie Ostern wurde. Vielleicht kann uns ihre Freude auch anstecken; vielleicht finden wir auch plötzlich eigene, ähnliche Erfahrungen von Freude und Hoffnung in unserem eigenen Leben, ganz anders und doch ebenso befreiend; denn Ostern geschieht - wie damals, so auch heute. - Hören wir also, was Maria aus Magdala widerfahren ist:
Sie war dabei gewesen, als ihr Meister gekreuzigt wurde.
Sie hatte ihn sterben sehen.
Sie wollte bei ihm bleiben.
Dann hatten sie ihn herabgenommen und in ein Grab gelegt
Da war sie zu den andern gegangen -
seinen Freunden, seinen Jüngern.
Sie hockten hinter verschlossenen Türen.
Keiner sagte etwas, jeder starrte vor sich hin.
Die ganze Nacht und den ganzen Tag
hatten sie so dagesessen, wie gelähmt.
Am Abend hielt Maria es nicht mehr aus.
Sie ging hinaus in die Dunkelheit.
Sie irrte durch die menschenleeren Gassen der Stadt.
Nun war sie wieder allein: So allein, wie früher einmal.
Und dann war es ihr,
als ob jene schreckliche große Traurigkeit
wieder in ihr Herz zurückkehrte:
Jene Krankheit,
unter der sie früher einmal so furchtbar gelitten hatte, bis -
ja, bis sie Jesus begegnet war.
So war das gewesen, damals:
Sie war sehr krank, und niemand konnte ihr helfen.
Sie war einfach traurig, tod-traurig.
Sie konnte nicht mehr arbeiten, mochte nicht mehr essen.
Sie lag nur auf dem Bett,
zusammengekrümmt und bewegungslos.
Und wenn jemand zu ihr sprach, ihr Mut machen wollte,
dann fing sie an zu schreien und zu weinen.
Es war, als ob etwas Fremdes von ihr Besitz ergriffen hätte,
damals. Sie war nicht mehr sie selbst.
Bis Jesus kam. Jemand hatte ihn geholt.
Er sah Maria an - lange, ernst und zugleich freundlich.
Und plötzlich fühlte sie: Er kennt mich.
Er kennt meine Traurigkeit; er versteht sie.
Da faßte sie Jesus bei der Hand, ganz sanft -
und es war, als zöge er all ihre Traurigkeit in sich hinein.
"Maria," sagte er leise und lächelte sie an.
Und da - da konnte sie auch wieder lächeln,
zum ersten Mal seit langem.
Die Traurigkeit war fort, vergangen wie ein böser Traum.
Da ist sie mit ihm gegangen, damals.
Aber jetzt - jetzt war es wieder so wie damals.
Sie wußte nicht, wohin sie ging in ihrer Traurigkeit.
Sie irrte umher, bis sie plötzlich vor dem Stadttor stand.
Der Wächter ließ sie hinaus.
Sie kam in den Garten, wo sie ihn begraben hatten.
Es war ein kleiner Park mit hohen Bäumen,
der an einer hohen Felswand endete,
in die man eine Höhle geschlagen hatte.
Dort hatten sie den toten Meister hineingelegt.
Sie hatten ihn bestattet, wie es die Sitte vorschrieb:
ganz in weiße Tücher gehüllt.
Und dann hatten sie den großen runden Stein davor gewälzt
und den Eingang verschlossen. Für immer.
Langsam ging Maria näher.
Sie wollte bei ihm sein, auch wenn er tot war -
so dicht wie möglich.
Da erkannte sie im ersten Morgendämmern
die dunkle Öffnung des Grabes.
Sie erstarrte: Der Stein war fort, zur Seite gewälzt.
Der Eingang stand offen.
Voller Schrecken lief sie davon,
hastete durch die leeren Straßen,
kam an das Haus, wo die anderen waren,
hämmerte gegen die Tür:
"Das Grab ist leer," stieß sie weinend hervor.
"Sie haben Jesus weggenommen!"
Etwas anderes konnte sie nicht mehr denken, nur dies eine:
Sie haben ihn weggenommen.
Nicht einmal den toten Jesus lassen sie mir.
Petrus und Johannes waren gleich losgelaufen.
Sie wollten nachsehen.
Langsam ging Maria hinterher.
Als sie den Park betrat, kamen ihr die beiden entgegen.
"Er ist wirklich fort," sagte Petrus.
"Aber die Tücher liegen noch da."
Da fing Maria an zu weinen.
Johannes sah sie an: "Vielleicht...
vielleicht braucht er es nicht mehr, das Gewand des Todes."
Er sagte es zögernd, so als wollte er etwas erklären,
was er selbst nicht recht verstand.
Maria begriff es nicht.
Sie fühlte nur die tiefe Traurigkeit in sich,
diese schreckliche Krankheit in ihrem Herzen.
Sie lehnte sich an den Eingang,
drückte die Stirn gegen den harten Felsen.
Ihr Gesicht war naß von Tränen.
Inzwischen war die Sonne aufgegangen.
Da spürte Maria auf einmal, daß jemand im Garten war.
Sie hatte niemand kommen hören:
keine Schritte, kein Rascheln.
Er war einfach da. Sie sah ihn im Garten stehen.
Sie fühlte, daß sie ihn kannte -
etwas Vertrautes war da, etwas, das sie berührte -
und doch: Nein, sie wußte nicht, wer dort stand.
Es muß der Gärtner sein, dachte Maria.
Da sprach er sie an: "Du bist traurig. Warum weinst du?"
Es klang fast ein wenig vorwurfsvoll.
Aber sie merkte es nicht.
"Sie haben meinen Meister fortgebracht," stieß sie hervor.
"Weißt du nicht, wo er ist?
Bitte, wenn du ihn weggetragen hast, sag es mir!
Ich will zu ihm. Ich will ihn holen."
Da sagte der andere: "Maria!"
Ganz leise, ganz sanft - und sie spürte, daß er dabei lächelte.
Es klang... ja, es war genau wie damals,
als Jesus zu ihr kam und sie heilte von ihrer Krankheit,
von ihrer Traurigkeit.
Es stand ihr wieder vor Augen.
Und auf einmal war Maria nicht mehr traurig.
Sie war fort, diese Hoffnungslosigkeit,
diese Angst vor allem.
Es war sein Wort, was sie hörte - wieder hörte, wie damals.
Er rief sie bei Namen - wie damals.
Er nahm ihr die Traurigkeit.
Auf einmal wußte sie es genau: Ja, er hilft mir - auch jetzt!
Maria lachte, breitete die Arme aus vor Freude:
"Meister," rief sie, "lieber Meister!"
Und sie wollte zu ihm, ihn umarmen, ihn festhalten.
Alles war jetzt gut, denn es war doch so wie damals.
Alles sollte wieder so sein wie früher: so gut, so schön!
Sie würde wieder mit ihm ziehen, auf sein Wort hören,
zu seinen Füßen sitzen.
Aber er trat einen Schritt zurück.
"Nein," sagte er. "Du mußt es erst ganz begreifen.
Ich gehöre zu Gott, zu meinem Vater.
Geh und sag das den anderen.
Sie sind doch meine Freunde. Sie sind meine Brüder.
Darum ist mein Vater auch ihr Vater - wirklich.
Er liebt euch alle - so wie ich.
Ihr sollt zu ihm gehören, so wie ich.
Verstehst du? Ich habe es euch doch immer gesagt.
Aber nun... nun gilt es wirklich."
Da wußte Maria:
Nein, es wird nicht wieder so sein wie früher.
Sie wird nicht wieder zu seinen Füßen sitzen,
nicht wieder mit ihm ziehen.
Sie wird allein sein - sie und all die anderen Jünger.
Aber es machte ihr keine Angst.
Sie wußte: Es ist gut. Seine Liebe ist da.
Sie bleibt. Niemand kann sie mir nehmen.
Gott ist da, ganz nahe bei mir:
für immer ist er da, nichts kann mich von ihm trennen -
keine Angst, keine Traurigkeit,
keine Verzweiflung, keinTod.
Sie war auf einmal ganz sicher.
Da kam eine große Freude über sie:
Alles, was der Meister je erzählt hatte
von der Liebe Gottes - es ist wahr!
Alles, was er getan hat an Güte und Barmherzigkeit -
es bleibt, es gilt für uns, für alle!
Der Tod hat es nicht zerstört.
Gott ist stärker - Gott, der das Leben ist.
Da lief sie los, so rasch sie konnte.
Was sollte sie nun noch am Grab!
Sie hatte nichts mehr verloren am Ort des Todes.
Sie eilte zurück, hin zu den anderen,
sie lachte und weinte zugleich vor lauter Freude:
"Es ist wahr," rief sie ihnen zu,
"Jesus ist nicht bei den Toten! Er ist bei Gott -
und bei uns, denn - Gott ist bei uns!"
Und sie umarmte sie alle,
wie sie so dastanden und sie anstarrten -
so, als wollte sie sie anstecken mit ihrer Freude.
Jesus hatte ihre Traurigkeit besiegt - endgültig.
Nun war da nur noch Freude -
soviel Freude, daß sie davon nur noch verschenken konnte,
so, wie der Meister einst Freude geschenkt hatte.
In seinem Namen tat SIE es nun, sie selbst.
Maria von Magdala hatte erfahren, was Ostern ist.
Und jeder kann es erfahren - auch heute.
Kommentar
Diese recht lange Perikope enthält im Grunde mehrere (ursprünglich wohl auch unabhängig voneinander erzählte) Ostergeschichten. Eigentümlich ist ihnen das merkwürdig Schwebende und Mehrdeutige, das noch zu entschlüsselnde Geheimnis des Osterwunders. Einerseits sind gerade die johanneischen Auferstehungsberichte voll realistischer Details, andererseits entfalten sie eine Symbolsprache, die nur Zug um Zug zu entschlüsseln ist. Das ist exegetisch wichtig, aber ich möchte gerade am Ostermorgen der Gemeinde nicht mit theologischen Erklärungen kommen, sondern sie in die Osterfreude hineinnehmen.
Darum habe ich mich entschlossen, diese Geschichte ganz aus der Sicht der Maria zu erzählen - und sie damit auch auf die Erfahrungen der Maria einzugrenzen. Petrus und der Lieblingsjünger spielen also in der Erzählung kaum eine Rolle, deshalb habe ich auch die Textlesung im ersten Teil der Perikope möglichst gekürzt (Die Verse 1-10 und 11-18 werden ja auch als zwei getrennte Predigtexte angeboten). Auch V. 11b-14a - sicher ein späterer Einschub nach Matth. 28,5ff - lasse ich fort, denn dieser Passus unterbricht nicht nur den Erzählvorgang, er nimmt ihm auch seine Stringenz.
In den Mittelpunkt meiner Erzählung möchte ich den Übergang von der Trauer zur Freude stellen. Dazu greife ich auf die synoptische Tradition zurück, die Maria aus Magdala nicht nur zu den Jesus begleitenden Jüngerinnen zählt und ebenfalls als (zum Teil erste) Zeugin der Auferweckung nennt, sondern auch berichtet, Jesus habe sie von "sieben Dämonen" befreit (Mark. 16,9 u. ö.), also vermutlich von einer psychisch bedingten Erkrankung.
Indem ich ihre Traurigkeit also nicht nur als Trauer anläßlich eines Todesfalles schildere, sondern als latente psychische Disposition - ähnlich einer Depression, die ja auch eine Art fremdbestimmter Trauer ist -, möchte ich den Gemeindegliedern offenhalten, eigene Traurigkeiten unterschiedlichster Art einzubringen.
Ebenso soll der "Lernprozeß," den Maria nach dem Johannesevangelium ja durchmacht, bis sie zum richtigen Verständnis des Ostergeschehens gelangt, für den heutigen Hörer nachvollziehbar werden: Die Überwindung von Trauer und Verzweiflung geschieht nicht in der - rückwärtsgerichteten - Wiederherstellung eines früheren Zustandes, sondern im Geschenk von etwas überraschend Neuem, in der Befreiung für eine andere Zukunft, in der Chance eines festen Vertrauens, in der Freude über die erfahrene und erfahrbare Nähe Gottes. Diesem Zielgedanken ordne ich das vorgegebene Erzählmaterial unter, auf ihn hin ist auch die "frei erfundene" Schilderung in der Rückblende auf Krankheit und Heilung sowie des erneuten "depressiven Schubs" angelegt.
Ostern ist für mich eine Erfahrung, die nicht nur die Auferstehungszeugen von damals gemacht haben, sondern die nacherlebbar bleibt innerhalb unseres eigenen Lebensbereiches. Das soll gerade im Miterleben dieser Geschichte vergegenwärtigt werden, und dazu ist die Erzählung ein geeignetes Medium - eine Erzählung ganz aus dem Blickwinkel dieser einen Person heraus, die ihre Erfahrung damit gleichsam als ein Modell anbietet, Ostern zu erleben.
Auch bei dieser Erzählpredigt habe ich eine längere Einführung vorweggestellt, um die Gemeinde auf die eigentliche Erzählung hinzuführen. Natürlich hätte ich auch mehr oder weniger direkt mit der Geschichte selbst einsetzen können, aber die Rücksicht auf Menschen, die vielleicht erstmals einer solchen Form von Predigt begegnen, schien eine ausdrückliche Hinführung doch nahezulegen.