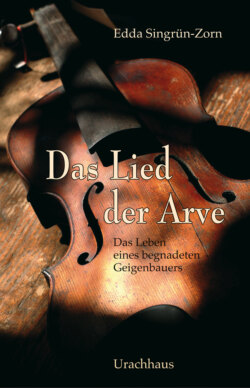Читать книгу Das Lied der Arve - Edda Singrün-Zorn - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wo überall die Musik wächst
ОглавлениеSechs Jahre war Ambrosius jetzt alt und ein Schulbub. Jeden Tag, sobald die Morgenhelle über den östlichen Bergen aufschien, weckte ihn die Mutter, und wenn er seine Morgensuppe gelöffelt, wanderte er den schmalen, steilen Pfad hinab. Dieser Morgengang war ihm das Liebste. Der Tau hing noch in den Gräsern, Schmetterlinge flatterten, taumelig von der Nachtkühle, hie und da huschte ein Salamander ins feuchte Moos, die Lerchen stiegen in einen Himmel, blankgeputzt und rein wie am Schöpfungstag. Bei diesen Gängen tat sich die Seele des Buben weit auf, und so sehr ihn auch das Geschaute beglückte, noch mehr regte ihn das Gehörte an. Alles hatte für ihn eine Stimme, selbst die glitzernden Tautropfen streuten ein Lied über die Wiesen. »Wie die Schneesterne im Winter«, dachte Ambrosius, »nur voller Sonne, ein gläsernes Sonnenlied.«
Wenn die Schule zu Ende war, lief Ambrosius meist rasch nach Hause, denn zum ersten hungerte ihn und außerdem sehnte er sich nach der Mutter. Nur manchmal kehrte er in der kleinen Dorfkirche ein. Er mochte den schlichten, hohen Raum, still war es hier, die Ampel mit dem ewigen Licht schaukelte leicht hin und her, ab und zu knarzten die altersdunklen Betbänke, es hörte sich an, als seufzten sie. Was mussten sie auch alles aufnehmen an Sündhaftem und Sorgenvollem, da konnte einem schon das Seufzen ankommen. Überall hing der Geruch von Weihrauch und abgebrannten Wachsstöcken. Dies alles nahm Ambrosius wahr und noch viel mehr. Voll fiel das Mittagslicht durch die bunten Fenster und malte rote und blaue Tupfen auf die Stufen und den großen Palmbuschen, der neben dem Altar stand, denn es war kurz vor Ostern. Und weil alles so schön und nun auch bald Ferienzeit war, ging dem Ambrosius das Herz über und er begann zu singen. Hell und glockenrein hob sich seine Stimme über das Gestühl bis hinauf ins Gewölbe. Andächtig sang er, den Blick auf das Altarbild gerichtet, als eine Stimme hinter ihm frug: »Ambrosius Schneehauser, wir haben keinen Gottesdienst und es ist auch kein Kirchenlied, was du singst; was also ist es?«
Erschrocken fuhr das Kind herum und stotterte: »Ich … ich hab’ … ich hab’ das Taulied gesungen. Ich dacht’ mir, die Himmelmutter mag es gerne, wo doch der Tau daher kommt, wo sie jetzt ist.«
«So, so, das hast du gedacht. Und wer hat dich das Taulied gelehrt? Der Lehrer oder die Mutter?«
Da lächelte der Bub und antwortete: »Der Tau natürlich, Hochwürden, niemand kann doch das Taulied besser als der Tau selber. Heut morgen, als ich den Steig herunterkam, hat die ganze Tauwiese gesungen und da hab’ ich mir’s halt gemerkt.«
Lange schaute der Pfarrherrdas Kind an, seine Gedanken gingen zurück zu dem Wintertag, als die Magdalen in seiner Stube gestanden, und er glaubte deutlich zu hören: » … und zweitens ist er ein Besonderer, er ist ein Hollenkind aus dem goldenen Brünndel.« – Behutsam nahm er die Kinderhand in die seine, zusammen verließen sie die Kirche und erst als sie vor dem Pfarrgarten unter dem Kätzchenbaum standen, um den der Bienenchor summte, sprach der Mann wieder: »Sag einmal, hast du bloß das Taulied gehört oder singen auch andere Dinge für dich?«
»Alles kann singen, Vater Winfried, und jeder kann es hören, alle Menschen haben doch Ohren.«
»Das stimmt, aber du hast andere Ohren, ganz andere.«
Ambrosius stutzte, dann fasste er sich an seine Lauscher und lachte: »Nein, Vater Winfried, meine sind genau wie Eure, nur kleiner, und der Vater hat dieselben, und die Mutter, die Vroni, der Joseph und alle, die ich kenne.«
»Die Ohren meine ich nicht, Ambrosius«, sagte der Pfarrer und zog ihn am Ohrläppchen, »ich meine die Ohren, die man nicht sehen kann, die in einem Menschen drin sind, die inwendigen Ohren, und die hat nicht jeder.«
Zweifelnd schaute ihn das Kind an: »Ist das wahr? Dann seid Ihr aber arm dran, Hochwürden, wenn Ihr soviel Schönes net hören könnt«, und plötzlich trat ihm ein glückliches Leuchten in die Augen und breitete sich über das ganze Gesichtchen: »Ich weiß, was ich mach’, ich sing euch immer vor, was mir die Stern’, der Regen, die Wolken und alles vorsingt, und mich, mich könnt ihr doch hören, ja?«
»Das machst, Ambrosius, und jetzt marschier’, es läutet bald Mittag.« Ambrosius stob davon und Vater Winfried schaute ihm nach, bis er zwischen den Feldern verschwand.
Es war ein warmer Maitag, Ambrosius kam mit seinem Rucksäckchen auf dem Rücken vom Dorf, wo er für die Mutter eingekauft, da trieb ein Klang mit den Mittagswolken, dass er stehen bleiben musste. Vorsichtig Fuß vor Fuß setzend, ging er den Tönen nach, und da sah er den alten Schäfer am Rain sitzen, den Georg. In seinen Händen hielt er ein Stöckchen, blies hinein und entlockte ihm das zarteste Lied, das man sich denken konnte. Ambrosius blieb vor Staunen der Mund offen – ein Holzstöckchen, das singen konnte, was es für Wunder gab. Er griff neben sich ins Gebüsch, brach ein Reislein ab und blies ebenfalls hinein. Er blies, bis ihm die Backen wehtaten. Puterrot wurde er dabei, aber nichts geschah, er entlockte dem Stöckchen keinen Ton. Langsam schob er sich näher heran, bis er vor Georg stand. Der blickte auf: »Grüß dich Ambrosius, bist auf dem Weg heim?« Ambrosius stand stumm, seine Augen fest auf das geheimnisvolle Stöckchen gerichtet: »Wie machst du das, Georg, warum kann dein Stecken singen und meiner net? Schon einen ganz wehen Kopf hab’ ich vom Hineinblasen, aber es kommt kein Lied heraus. Hast du ihn verzaubert, deinen Stecken?« Gutmütig lachte der Alte: »Da ist kein Zauber dabei, Bub, das ist wie ein Handwerk, das man lernen kann. Ich hab’s von meinem Vater, der konnte die besten Weidenpfeifen schneiden im Tal.«
Ambrosius Gesicht war eine einzige Begehrlichkeit: »Georg, lehrst du mich eine Pfeife schneiden, ich schenk dir auch mein Stück Sonntagskuchen.«
»Behalt deinen Kuchen, du brauchst ihn nötiger als ich, lehren tu ich dich’s auch ohne Geschenk. Nur ein gutes Messer zum Schneiden, das wirst brauchen, ohne das geht nichts.«
Da sank beim Ambrosius die Freude in den Keller, ein Messer, woher sollte er so was Wertvolles nehmen. Zu seinem Geburtstag waren es noch viele Monate und zum Christfest noch länger. »Kannst du es mich auch ohne Messer lehren, Georg, denn es möcht’ eine Weile dauern, bis ich eines hab’.«
»Das kann ich wohl, musst nur ein bissel Zeit mitbringen, denn es ist nicht leicht, bis man’s kann.« Ein Seufzer der Erleichterung war die Antwort, und nach einem Gruß stapfte Ambrosius den Berg hoch.
Seitdem erschien er bei Georg, so oft er konnte, ob dieser seine Herde durchs Tal trieb oder dem Gebirge zu, Ambrosius fand ihn immer, und der Schäfer zeigte ihm die Kunst des Pfeifenschneidens von allem Anfang an.
»Zweijährig und darunter sollt’ die Weide sein, net älter. Und früh am Morgen musst du sie schneiden, vor Sonnenaufgang, da ist der Saft am besten. Der Saft ist Leben, und Leben, das soll sie doch haben, deine Pfeif’n.«
Ambrosius nickte: »Ohne Leben gibt’s gar nichts, gell Georg, keine Weiden, keine Schafe und Lämmer, keine Lieder, einfach überhaupt nichts gibt’s ohne das Leben.«
Georg gab keine Antwort, er war bei der schwierigen Arbeit des Ausklopfens. »Das Mark musst ausklopfen, das ist eine Arbeit für ruhige Hände, und still soll man dabei sein, damit man das Holz reden hört.«
»Was sagt es, das Holz?«
»Es sagt dir, was du tun musst und wann du es tun musst, damit es eine gute Pfeife gibt.« Und nun zeigte Georg dem Buben, Stück für Stück, wie so ein Pfeiflein entsteht. Zum Schluss fügte er das Kernstück ein, leicht ließ es sich auf und nieder schieben, und als der Schäfer die Pfeife an den Mund setzte, flog eine einfache Melodie durch die Luft, leicht wie ein Vogellied. Ambrosius schaute in den Himmel, wo flockenweiß ein paar Mittagswolken segelten und ihm war, als habe er nie etwas Schöneres gehört.
Einige Tage später sprang er am frühen Morgen über den Bach, atemlos blieb er vor Georg stehen: »Ich hab ein Weidenstöckchen, die Sonne war noch nicht überm Zacken, da hab ich’s gebrochen. Bitte, Georg, leih mir dein Messer, ich will auch ganz bestimmt Acht geben drauf.«
»Ja hast du denn keine Schule heut?«
»Aber Georg, Ferien sind, das weiß doch jeder !«
»Woher soll ich das wissen, meine Schafe machen nie Ferien, die brauchen mich immer. So, setz dich her und zeig, ob du gut zugeschaut hast.« Langsam, wie ein Kleinod, schälte Ambrosius das Weidenstöckchen aus der Tiefe seines Hosensackes, beschaute es, hielt es ans Ohr, klopfte daran – und fing an zu schneiden. Bedächtig aber sicher führte er das Messer, nichts musste Georg verbessern, nie brauchte er helfend eingreifen, schon bald wurde ihm klar, dass er hier einen kleinen Meister vor sich hatte, einen, der etwas besaß, was man in keiner Werkstatt der Welt erlernen konnte. Mit hochroten Backen arbeitete das Kind, es hatte alles ringsum vergessen, immer wieder horchend, immer wieder klopfend, brachte es sein Werk zu Ende. Vorsichtig schob es das Kernstück ein und dann begann es zu blasen. Klar und rein schwangen die Töne über die blühende Wiese, das ganze Tal schien eingeschlossen in das Liedchen aus der ersten Weidenflöte des Ambrosius.
Nachdem er geendet, wandte er sich zum Schäfer: »Hab ich’s recht gemacht, Georg, bist du ein bissel mit mir zufrieden?« Unbeholfen strich der ihm durch die dunklen Locken und, indem er sinnend über ihn hinweg gegen die Berge sah, antwortete er: »Ich kann dich nichts mehr lehren, du kannst mehr als ich. Du hast gesegnete Hände, Ambrosius Schneehauser, und ganz besondere Ohren. Hüte beides, sieh zu, dass nichts Unrechtes damit geschieht und schaff etwas, das uns allen Not tut.«
»So ähnlich hat der Vater Winfried neulich auch gesagt, als ich in der Kirche für die Gottesmutter das Taulied gesungen hab’.«
»Du hast was gesungen?«
»Das Taulied. Ich hab gedacht, wenn die Maria die ganze Woche so allein beim Altar steht, nur am Sonntag, wenn wir singen, das bissel Musik und, wenn der Herr Lehrer die Orgel schlägt, ich weiß net so recht …«, sein Gesicht verzog sich schmerzlich, »da hab ich gedacht, sie möchte‘ sich freuen, wenn ich ihr den Tau in die Kirche bringe, denn sie selber darf doch net weggehen, sie muss da stehen bleiben, und das seit über zweihundert Jahren, hat der Vater erzählt. Denk dir Georg, so lang auf einem Fleck stehen, das ist arg.« Es schüttelte ihn förmlich bei der Vorstellung.
»Was du dir so ausdenkst. Wirst mir auch einmal das Taulied singen?«
Ernsthaft nickte das Kind: »Ja gern, aber ganz in der Früh muss das sein, der Tau singt nur ganz in der Früh, wenn die Sonne ihm ›Grüß Gott‹ sagt.«
»Und was war das vorhin, was du auf deiner Pfeife gespielt hast?«
»Das war das Wiesenlied, das kommt von den Blumen, und, weißt‘ Georg, die Glockenblumen singen am schönsten. Hochwürden sagt, net alle Menschen hören so was, kannst du es hören? Hast du inwendige Ohren?«
Georg wiegte den Kopf zweifelnd hin und her: »Vielleicht, ich bin mir net sicher.«
»Aber ich mein, du musst mehr hören als die andern, wenn du doch deine Schaf‘ und Lämmer verstehst und den Hund. Die reden auch net unsere Sprache und du weißt trotzdem, was sie sagen. Ich mein, der liebe Gott hat jedem die Ohren gegeben, die er braucht.«
»Wohl, wohl, das wär’gut zu glauben. Und jetzt nimm deine Pfeifen und trag sie heim, denn eine Weidenpfeife, Ambrosius, hat nur ein kurzes Leben, du wirst noch viele schneiden müssen, bis du groß bist.«
So sehr Ambrosius seine Pfeife liebte, so sehr er stolz war auf das Lob der Eltern und Geschwister, dieser letzte Satz des Schäfers haftete in seinem Gedächtnis und ließ ihn nicht mehr los. Eine ungewisse Sehnsucht befiehl ihn, ein Wunsch trieb ihn um, der Wunsch, etwas zu schaffen, was singen konnte gleich einer Pfeife, aber langlebiger war als sie. Auch wenn er nicht jeden Tag an diesen Wunsch dachte, so hielt er ihn doch wie ein stetiges Flämmlein am brennen.
Das Jahr neigte sich, die Nebel stiegen aus den Bächen und wallten um die Felsen, morgens lag Reif auf Feldern und Wegen, und in den ersten Novembertagen zogen die Dörfler auf den Kirchhof, die Gräber zu pflegen und mit Kerzen zu bestecken. Auch Ambrosius zog mit an der Hand der Mutter. Sie schmückten den Hügel der Schneehauser mit den Zweigen der Arve, als besonderen Gruß von dem Haus am Berg, und als die Mutter einen Wachsstock entzündet, zog Ambrosius den Stummel einer Altarkerze aus seiner Joppentasche: »Der ist für den Ahn, nach dem ich heiß’. Vater Winfried hat mir den Stumpen geschenkt, weil ich beim Hochamt so schön gesungen hab’.« Und für sich bat er: »Lieber Ahn, mach, dass ich am Ambrosiustag, was mein Geburtstag ist, ein Schnitzmesser krieg’. Ich will dir auch ein Lied pfeifen, ganz für dich allein.«
Als sie den dämmerdunklen Friedhof verließen, wandte Ambrosius sich noch einmal, da sah er seine Kerze leuchten und ihm war, als müsste ihr Schein hinter die Wolken reichen, dem unbekannten Ahn zum Gruße und ihm selbst zum Trost, denn Trost hatte er nötig. Je näher der 7. Dezember rückte, umso unruhiger wurde er. Nichts deutete darauf hin, dass auch nur einer seinen sehnlichsten Wunsch bemerkt oder gar danach gefragt hätte. Dabei hatte er sogar einmal gewagt, von einem Schnitzmesser zu reden, aber die Mutter hatte ihn angeschaut, den Kopf geschüttelt und gemeint: »Bub, wo denkst du hin, ein Schnitzmesser ist viel zu teuer, von dem, was das kostet, könnt’ ich für uns alle eine Woche Krapfen backen.« Da hat er geschwiegen und ist still hinaus zur Arve gegangen. Drin in der Stube aber war es plötzlich hell und warm, denn der Barthel und die Fränzi lachten sich fröhlich an.
Und dann war er endlich da, der Ambrosiustag. Er fiel in diesem Jahr auf einen Sonntag, und Ambrosius wurde acht Jahre alt. Schon am frühen Morgen weckte ihn eine ungewohnte Unruhe. In der großen Stube huschte und kicherte es durcheinander und von der Küche her zog der Duft von Gebackenem durch das Haus. Ambrosius lag im Bett vergraben, denn ihn fror vor lauter Aufregung. Als er den schweren Schritt des Vaters auf der Treppe hörte, presste er die Augen zu und stellte sich schlafend. Leise knarzte die Kammertür, auf Strümpfen schlich sich der Vater an sein Bett, strich ihm über den Kopf und sagte: »Aufstehen, Ambrosius, Geburtstag ist, fahr’ schnell in die Hosen, wir warten alle auf dich.«
Zitternd machte er sich fertig, zitternd betrat er die Stube, licht war es hier, als brennten hundert Kerzen, dabei war es nur eine, aber ihre Flamme tanzte und funkelte auf etwas, was da neben seinem Teller lag. Ihm wurde heiß und kalt und von weit her drang die Stimme des Vaters zu ihm: »Ambrosius, net träumen, nun nimm es schon, es ist dein.«
Da griff er danach, seine Finger schlossen sich darum, als wollten sie es nie wieder loslassen, sein Schnitzmesser, das Erste, das Ersehnte! Als er zu den Eltern aufblickte, ihnen Dank sagen wollte, konnte er kein Wort herausbringen, weil ihm der Hals zugeschnürt war, nur seine Augen strahlten sie an. Nun hatte er ein Messer, aber kein Weidenstöckchen, denn im Winter war das Holz gefroren. Doch das Messer war da, das Messer war unruhig und wollte schnitzen. Jetzt fiel ihm ein, was die Mutter vom Ahn Ambrosius erzählt, und dass der eine Muttergottes geschnitzt hatte. Eine Maria? Nein, das getraute er sich nicht, aber vielleicht könnte er der Mutter eine Schaufel schnitzen für das Mehlfass und dem Vater eine Schale für die Sackuhr, damit sie ihren Platz hatte und nicht überall herumlag.
So verging die Adventszeit mit heimlicher Arbeit, und noch nie hatte sich Ambrosius so auf das Fest gefreut wie in diesem Jahr, war es doch das erste Mal, dass er den Eltern etwas Richtiges schenken konnte.
Einmal in der Woche fuhr ihn der Vater des Nachmittags mit dem Hörnerschlitten hinab ins Dorf, weil Lehrer und Pfarrherr sich etwas Besonderes ausgedacht. Die Schulkinder sollten zur Christnacht in der Kirche alte Marienlieder singen und der Gesang des Engels auf den Hirtenfeldern, der Gesang musste das Schönste werden von allem.
»Ambrosius du singst uns den Hirtenengel. Traust du dich, vor allen Leuten allein zu singen?«
Ruhig blickte das Kind zum Pfarrer auf: »Aber Hochwürden, ich sing doch einen Engel, da muss ich doch keine Angst haben.«
»Recht hast, war eine dumme Frage von mir. Aber jetzt schau her, ich will dich was lehren.« Umständlich klaubte er ein Heft aus seiner Schublade und legte es vor Ambrosius hin: »Weißt du, was das ist?«
»Es sieht aus wie lauter Wetterfahnen. Zu was malt einer soviel Wetterfahnen und alle gleich?«
»Das sind keine Wetterfahnen, Bub, das sind Noten. Das sind Buchstaben zum Musikmachen. Weißt du, wie man Buchstaben braucht zum Geschichtenlesen, so braucht man auch Buchstaben zum Musizieren. Und die nennt man Noten.«
Ungläubig schaute Ambrosius auf die vielen schwarzen Punkte und Zeichen und zweifelnd fragte er: »Und wenn man die alle lesen kann, dann wird da ein Lied draus?«
»So ist es. Das was du hier siehst, ist das Lied vom Hirtenengel, den du singen sollst.«
Nun musste Ambrosius doch lachen, glucksend brach es aus ihm heraus: »Vater Winfried, ich glaub euch viel, alles, was ihr in der Betstunde erzählt. Aber dass die Wetterfahnen ein Lied sind, das glaub ich euch net. Wo ist denn der Engel? Ich muss doch einen Engel schauen, wenn ich ihn singen soll.«
Seufzend klappte Hochwürden Winfried das Heft zu, nahm das Kind bei der Hand und sagte: »Komm mit in die Kirche zur Orgel, damit du hörst, dass ich keine Lüg’ erzähl.« Und dort auf der Orgelbank erlebten die beiden eine Überraschung, jeder auf seine Weise. Ambrosius vernahm voller Staunen, wie aus den Wetterfahnen das Lied des Hirtenengels wurde. Und Vater Winfried? Ja, dem sanken die Hände von den Orgeltasten, denn nachdem er geendet, trat Ambrosius an die Brüstung der Empore und, den Blick fest auf den geschnitzten Engel gerichtet, der vom nächsten Pfeiler zu ihm her sah, sang er das Engellied, fehlerlos, keine Pause war zuviel, keine zu wenig. Klar und rein schwang die Knabenstimme durch den Kirchenraum. Doch als der Pfarrer die letzte Notenseite umgeschlagen, sang Ambrosius weiter, er sang ein Halleluja so schön, als käme es geradewegs aus dem Himmel. »Wo nimmst du denn das Halleluja her, das steht nicht in meinem Buch?«
Stumm deutete Ambrosius auf den Engel und antwortete: »Ich hab Euch doch gesagt, Hochwürden, ich muss einen Engel schauen, wenn ich ihn singen soll.«
Als sie über den verschneiten Kirchhof zum Pfarrhaus stapften, meinte der Pfarrer: »Ja, Ambrosius, was wird jetzt aus meinen Notenköpfen?«
»Ich werd’ sie lernen, Euch zuliebe, Vater Winfried, aber zum Singen, da brauch ich sie net.«
Als am Abend der Pfarrherr in seinem Brevier las, gingen ihm vielerlei Gedanken durch den Kopf und ein paar davon hat er sich aufgeschrieben.
In der Christnacht war die kleine Kirche voll bis zur letzten Ecke. Wunderschön hatten die Kinder gesungen, nur die Predigt des Pfarrers, die war ungewöhnlich, nie zuvor hatte die Gemeinde dergleichen von ihm gehört. Über die Geburt des Heilands sprach er, die alten, bekannten Texte las er, die allen vertraut waren von Kindheit an, dann machte er eine Pause: »Und jetzt lasst mich ein bissel erzählen, auch ein Pfarrer hat manchmal eigene Gedanken, und als ich mit euren Kindern in den letzten Wochen hier gesungen hab’, da ist so allerlei aufgestiegen in mir. Alle die Buben und Dirnlein, alle kenn ich sie, alle hab ich sie getauft, alle hab ich sie unterwiesen in der Heiligen Schrift, aber wenn sie anfingen zu singen, da schien plötzlich etwas herein, was ich nicht kannte, was ich noch nie an ihnen wahrgenommen. Und da hab ich mir zum andernmal Gedanken gemacht über die Geburt, nicht über die Geburt des Gotteskindes, sondern über die Geburt der Menschenkinder. Es ist schon ein eigen Ding mit uns und unserm Hiersein, mit dem, was wir waren vor dieser unserer Geburt, und von dem, was sein wird nach unserm Tod. Manches bringen wir mit und manches nehmen wir mit. Ein echtes Erinnern daran ist uns nicht vergönnt, aber eine Ahnung, was sein könnte, die befällt uns hin und wieder. Und, wenn uns jetzt zum Schluss der Engel singen wird, wie er vor bald zweitausend Jahren den Hirten gesungen hat auf den Feldern, vielleicht werdet ihr dann ein bissel begreifen, was ich mit meinen armen Worten sagen wollte, und mit mir einen Blick tun in das Geheimnis der großen Schöpfung.«
Ruhig verließ er die Kanzel und setzte sich auf seinen angestammten Platz. Leise präludierte die Orgel und dann klang es von der Empore herab: »Fürchtet euch nicht, denn siehe ich verkündige euch große Freude …« Weich und voll flog die Stimme bis hoch hinauf unters Kirchendach – das war kein Kind, was hier sang, das war der Engel selber.
Nach dem Halleluja verhielten sich alle so still, dass man nichts hörte als das feine Pfeifen des Windes um den Turmhahn und das Knistern der Kerzenflammen. Später in der Sakristei stand Vater Winfried vor Ambrosius, blickte ihn lange sinnend an und sagte dann: »Bub, Bub, was Schöneres hab ich nie gehört.«
Der strahlte und antwortete: »Gell, Hochwürden, Ihr habt auch gemerkt, dass gar net ich gesungen hab’, sondern der Engel, denn so kann ein Mensch net singen.«
Feierlich tauchte da der Pfarrherr seine Hand in den Weihbrunnen, malte das Kreuzeszeichen auf die Stirn des Kindes und sagte: »Gott segne dich, Ambrosius Schneehauser, und erhalte dir deine Bescheidenheit.« Und diesen Segen hat Ambrosius sein Leben lang nicht vergessen.
Das Frühjahr zog ein, zuerst schüchtern, mit feinem Tropfen von den Dächern und verstecktem Rieseln unter der Eisschicht des Baches. Doch dann orgelte es in den Lüften, der Fön raste übers Gebirge und ließ die Lawinen donnernd und krachend zu Tal fahren. Überall schwollen die Bäche und Flüsschen und die ersten Blüten reckten sich in die Sonne, zartblättrige Anemonen und pelzige Kuhschellen.
In dieser Zeit wanderte ein Mann aufs Dorf zu. Seine Füße steckten in derben Stiefeln, aber sein dunkles Obergewand wies ihn als Geistlichen aus. Auf seinem Rücken hing ein Sack mit dem Nötigsten und in der Hand trug er einen schmalen, schwarzen Holzkasten. Plötzlich blieb er stehen und horchte. Den Steig herunter klang ein Lied, frei und leicht, als hätte jemand den Frühling wie ein Bild in Tönen gemalt. Kurz darauf erschien Ambrosius, erblickte den Fremden, blieb stehen und schaute ihn an, neugierig und abwartend zugleich. Der trat ein paar Schritte näher und frug: »Gehörst du ins Dorf?«
Ambrosius schüttelte den Kopf und deutete in die Richtung, aus der er gekommen.
»Kannst du mir trotzdem den Weg zum Pfarrhaus zeigen?«
Ambrosius nickte. »Merkwürdige Leute, sind stumm wie die Fische, aber singen wie die Lerchen«, dachte der junge Mann.
Die beiden trabten nebeneinander her, der eine beunruhigt durch das Schweigen des andern, den seltsamen Holzkasten nicht aus den Augen lassend, bis der Fremde die Stille nicht mehr ertrug: »Ich bin der neue Kaplan.«
Ambrosius schaute kurz hoch und nickte.
»Und wie heißt du?«
»Ambrosius.«
»Ambrosius, da heißt du sicher nach dem Kirchenvater?«
»Nach dem Ahn, dem Ahn überm Berg, der konnt’ eine Gottesmutter schnitzen, wie’s schöner keine gibt, und aus allem hat er ein Lied gemacht, sagt die Mutter.«
»Dann war es deiner Mutter Ahn?«
Ambrosius nickte wieder. Danach war außer den Schritten auf dem steinigen Weg nichts zu hören, das mühsame Gespräch erstarb abermals. Je mehr sie sich dem Pfarrhaus näherten, desto langsamer ging Ambrosius. Wenn er jetzt nicht frug, würde er vielleicht nie erfahren, was in dem geheimnisvollen Kasten war. Einmal hatte er so einen Kasten gesehen, nur war der ein wenig größer gewesen und weiß. Darin hatte das jüngste Kind vom Kronenwirt gelegen, als man es auf den Kirchhof trug. Aber er konnte sich kaum vorstellen, dass ein geistlicher Herr eine Kindsleiche mit sich herumschleppte. Was also war drinnen? Er blieb stehen, zog seinen Begleiter vorsichtig am Ärmel und als der sich erstaunt umwandte, stotterte er verlegen: »Bitt’ schön, was … was ist in dem Kasten?«
Unwillig ob soviel Neugierde wollte der Mann auffahren, da sah er die Augen des Kindes und die waren groß und von einer Tiefe, als hinge das Leben von einer Antwort ab. Warm stieg es in ihm auf, dass er sich hinneigen musste zu dem Knaben: »Da, Ambrosius, ist eine Geige drinnen, und wenn wir zwei uns besser kennen, werde ich dir darauf was spielen.« Ein Leuchten flog über das Bubengesicht: »Dann kann man mit einer Geige Musik machen?«
Der Kaplan nickte.
»Musik, Hochwürden, ist das Schönste, was es gibt, drum wünsch’ ich mir, dass wir uns bald gut kennen – und hier wohnt der Herr Pfarrer.« Darauf reichte er dem Überraschten die Hand und stob davon. Er musste jetzt alleine sein, um seine Gedanken in Ordnung zu bringen. Es gab also noch eine Musik, die man bei sich tragen konnte wie die eigene Stimme und die Weidenpfeife, eine Musik, die nicht festgewachsen war an einem Ort, wie die Orgel in der Kirche.
Am Abend saß Ambrosius unter der Arve, die ersten Sterne zogen auf und der Wind brachte den Baum zum Singen, da flüsterte das Kind seiner Freundin zu: »Hast du gewusst, dass es eine Geige gibt? Richtige Musik kann man mit ihr machen, der Kaplan hat’s gesagt. Weißt du, aus was so eine Geige gemacht ist?« Leicht streiften die tiefhängenden Äste sein Haar, als der Baum ihm ein dürres Zweiglein zuwarf.
Von Stund an suchte Ambrosius die Nähe des jungen Geistlichen, wann immer es möglich war. »Mir scheint, Ihr habt Euch einen kleinen Freund gewonnen«, meinte eines Tages der Pfarrherr zu dem Jüngeren. Der lächelte und antwortete: »Das gilt nicht mir, Vater Winfried, das gilt einzig meiner Geige, die hat es ihm angetan. Ein merkwürdiges Kind.«
»Und ein hochbegabtes dazu. Geht mir vorsichtig mit der Kostbarkeit um, Bruder!« Und er erzählte dem Kaplan das Erlebnis mit der Weihnachtsmusik.
Ostern lag in diesem Jahr spät, die Sonne hatte im Tal den letzten Schneeflecken weggeleckt und Georg war mit seinen Schafen eingezogen aus dem Winterquartier. Ambrosius schlenderte über die Wiese daher und setzte sich zu Füßen des Alten. Obwohl mitten in der Woche, war eine friedliche Stille. Nichts hörte man als das Grasen der Tiere und hin und wieder das helle Blöken der Lämmer.
»Georg, hast du schon einmal eine Geige gesehn?«
Der nickte. »Aber so richtig erinnere ich mich nimmer, das ist zu lange her.«
»Du weißt also net, wie sie ausschaut?«
»Ja, ein bissel so ungefähr.« Georg zeichnete ein paar Bogen in die Luft. »Der Kaplan hat eine, er will sie mir zeigen, wenn wir uns gut kennen. Sag’ Georg, dauert es immer so lang bis man sich kennt?«
Georg wiegte den schweren Kopf: »Mei, Bub, du hast Fragen! Woher soll ich denn das wissen? Musst halt den Kaplan abfragen, das ist ein Studierter.«
»Georg, den kann ich doch net fragen, um den geht’s doch.«
»Dann frag Vater Winfried, aber net mich, ich kenn meine Schafe, und die kenn ich gut, aber sonst – ich denk lieber, als ich red’.«
»Vielleicht frag ich die Mutter, die weiß viel.«
Und so kam es, dass Ambrosius die nächsten Tage der Mutter nicht vom Rock ging, bis die meinte: »Nun sag’ schon, was willst du denn?«
»Ich will gar nichts, nur wissen möcht’ ich, wie lang es dauert, bis zwei Leut’ sich gut kennen.«
»Warum in aller Welt willst du denn so was Schwieriges wissen?«
»Es ist wegen dem Kaplan, der hat eine Geige und die darf ich sehen, wenn wir uns gut kennen. Denk dir Mutter, eine Geige! Aber es dauert so lang, das Kennen lernen, und ich möcht’ doch die Geige so gern sehen.«
»Musst halt geduldig sein, Ambrosius, er wird dich schon nicht vergessen.« Und im Stillen nahm sie sich vor, dem geistlichen Herren ein wenig aufzuhelfen, beim nächsten Kirchgang.
Es war am Tag von Johanni, die Burschen im Dorf hatten Holzscheiben geschnitten und mit Pech bestrichen, um sie als Feuerräder ins Tal zu rollen. Auf dem Anger draußen liefen die Kinder und schichteten Holz zu einem Stoß. Eben schleppte Ambrosius mit dem Kaplan einen schweren Klotz herbei, als der Ältere meinte: »So Ambrosius, das war der Letzte, jetzt haben wir zwei uns eine Pause verdient. Und weißt du, was wir machen? Wir gehen zu mir nach Hause und ich zeige dir meine Geige.« Kein Wort konnte das Kind sagen vor Glück. Zutraulich schob es seine Hand in die des Mannes und löste sich erst, als sie in der Stube standen. Schräg fiel die Abendsonne durchs Fenster, beinahe feierlich nahm der Kaplan den schwarzen Kasten, öffnete unter leichtem Knacken den Verschluss, schob ein samtenes Tuch beiseite – und da lag sie, die Geige, braungolden und glänzend im letzten Licht des Johannitages. Gerade wollte er sie hochnehmen, da spürte er die Kinderhand auf seinem Arm: »Noch net, Herr, erst muss ich wissen, wie Ihr heißt, denn jetzt kennen wir uns doch gut, da kann ich nicht immer ›Herr‹ zu Euch sagen, da muss ich Euren Namen wissen.«
Verblüfft wandte der Kaplan sich um, immer wieder erstaunte ihn dieses Kind, und darum antwortete er auch ernsthaft, wie man einem Gleichgesinnten antwortet: »Man hat mich Johann Sebastian getauft, das war ein berühmter Musiker, den mein Vater sehr verehrte. Aber gerufen hat man mich einfach Sebastian, und so magst du es auch halten. Nenne mich einfach Bruder Sebastian.«
»Danke«, entgegnete Ambrosius glücklich. Was für ein Tag, eine Geige sehen dürfen und einen großen Bruder geschenkt bekommen. Nie aber hat Ambrosius die vertraute Anrede vor Dritten gebraucht, auch hier bewahrte er sich ein sicheres Gefühl, ein Gefühl, das man nicht erlernen kann.
»Nun will ich aber mein Versprechen einlösen«, meinte der junge Geistliche, hob die Geige auf, stimmte sie, spannte den Bogen und begann zu spielen. Es war eine schlichte Melodie, weich und warm schwang sie durch den Raum. Ambrosius stand mit geschlossenen Augen und ließ sich davontragen. Längst war der letzte Ton verklungen, aber der Bub rührte sich nicht. »Ambrosius, aufwachen, wir wollen doch heute noch zum Johannifeuer gehen.« Da hob das Kind den Kopf, von weit her kam sein Blick und leise sagte es: »Ich kann jetzt net zum Feuer gehen, Bruder Sebastian, ich muss jetzt allein sein. Bitte seid net böse, wenn ich lieber in die Kirche gehe.« Sachte, kaum hörbar verließ er das Zimmer und zog die Tür hinter sich zu.
Während man sich draußen auf dem Dorfanger um den Holzstoß scharte, saß Ambrosius auf den Altarstufen und hielt ein langes Gespräch mit dem geschnitzten Pfeilerengel: »Du weißt doch viel, so viel mehr als wir Menschen, du weißt ganz sicher, dass es eine Geige gibt. Weißt du aber auch, wie man sie baut und wo man das lernen kann?« Aufmerksam schaute er in das Gesicht des Engels, doch unbeweglich blickte der herab, stumm blieb sein hölzerner Mund. »Bitte gib mir doch eine Antwort«, bat Ambrosius, doch es blieb still, nur das leise Summen einer Fliege war zu hören. Da wurde die Kirchentür geöffnet und herein schloff ein altes Weiblein, mühsam bog es das Knie – da entdeckte es Ambrosius.
»Ja, was treibst du denn jetzt in der Kirche, Bub, wo doch alle draußen auf der Wiese sind?«
»Ich hab’ den Pfeilerengel was gefragt, aber er antwortet mir nicht.«
»Die Engel reden net mehr mit uns, seit vielen hundert Jahren net mehr, aber sie schicken uns ein Zeichen, wenn wir’s ehrlich meinen. Musst halt geduldig sein und Augen und Ohren aufsperren, dass dir nichts entgeht. Und jetzt verhalt dich ruhig und lass mich beten.«
Die Alte hatte die Kirche verlassen, die Dunkelheit schluckte das letzte Quentchen Licht und noch immer hockte Ambrosius und wartete. Da flog plötzlich ein Feuerschein in den Himmel, denn draußen hatten sie den Holzstoß entzündet und sein Flackern fiel durch die Fenster und breitete sich auf der Gestalt des Engels aus. Staunend sah Ambrosius, wie zuerst das Gesicht zu leben begann, wie sich dann die goldenen Flügel bewegten, und zuletzt war ihm gar, als lächele der Engel ihm zu. »Das ist sicher das Zeichen, von dem die Ahnin vom Moosbauern gesprochen hat«, dachte Ambrosius, »nur, eine Antwort auf meine Frage ist das nicht.« Doch jetzt hörte er’s, klar und deutlich kamen die Worte durch die Nacht:
»Du Feuer in meiner Hand,
leucht weit hinaus ins Land,
dass Fried und gute Erntezeit
der Herrgott heuer uns verleiht,
Jesus, Maria und Joseph in Ewigkeit
über mein Haus dein Mantel breit,
dass uns koa Feuer net schad’,
und koa Vieh net versterbt.
Heiliger Peter und Paul,
seid’s mit der Fürsprach net faul.«
Es war der alte Feuerspruch und der Lehrer war’s, der ihn sprach. Der Lehrer – das war das Zeichen, auf das er gewartet. Der Lehrer war klug, der konnte raten und helfen. Als er hochblickte, stand der Engel vom roten Schein umflossen auf seinem Sockel, da bekreuzigte sich Ambrosius und flüsterte: »Danke«, bevor er die Kirche verließ.
Weitab von den Dörflern lehnte das Kind an einem Baum, schaute dem Flammenspiel zu und schickte seine Gedanken mit den Funken zu den Sternen. Einer aber hatte ihn entdeckt. Unbemerkt löste sich der Kaplan aus der Menge und trat unter den Baum: »Na, Ambrosius, hast du mit dem Engel gesprochen?«
»Woher wisst Ihr?«
»Ach, Bub, ich kenn’ dich doch langsam.«
Da strahlten des Ambrosius Augen und er sagte leise: »Er hat mir ein Zeichen geschickt, der Engel.«
Leicht legte Bruder Sebastian seinen Arm um die Schulter des Knaben: »Das ist was ganz Großes, wenn ein Engel uns ein Zeichen schickt, und darum werden wir zwei jetzt miteinander über das Feuer springen, denn heute ist doch ein besonderer Tag für uns beide.«
Und so kam es, dass der Bruder Sebastian seinen kleinen Freund unterfasste und mit ihm über das Feuer flog, zum Verwundern aller Leute, die das gar nicht verstehen konnten. Nur die Fränzi und der Barthel drückten sich ganz fest die Hand. Als sie dann spät in der Nacht nach Hause gingen, meinte der Barthel: »Da hast aber heut eine große Ehr’ erlebt, Ambrosius, mit dem Kaplan übers Feuer springen dürfen, das ist schon was.«
Das Kind blickte hoch, deutete nach hinten, wo die Geschwister schlaftrunken neben der Mutter hertappten, legte den Finger auf den Mund und flüsterte: »Denk dir Vater, er ist mein Freund, ich darf Bruder Sebastian zu ihm sagen. Aber ich tu’s nur, wenn niemand dabei ist. Und wir haben ein Geheimnis, der Kaplan, der Pfeilerengel und ich.«
»So, so, was denn für ein Geheimnis?«
»Aber Vater, wenn ich’s dir sag’, dann ist’s doch kein Geheimnis mehr.«
»Recht hast«, brummte der Vater, in ihm drin aber war eine kleine Enttäuschung. Nun stand etwas zwischen ihm und seinem Kind, ein Vertrauter, der kein Schneehauser war, und das tat weh. Er fasste die Hand des Knaben fester, als müsse er im Körperlichen binden, was sich im Geistigen schon zu lösen begonnen. Da kam es durch das Dunkel: »Musst nicht traurig sein, Vater, du sollst der Erste sein, dem ich’s sag, wenn es an der Zeit ist.« Heiß stieg es in Barthel auf und trieb ihm das Wasser in die Augen. Das Kind hatte ihm in die Seele geschaut trotz der Stockfinsternis ringsumher. Was hatte ihm der Herrgott da nur in die Wiege gelegt.
»Es scheint, als hätt’ die Magdalen Recht, und er ist wirklich aus dem goldenen Brünndel«, dachte der Mann, und in die Dankbarkeit die ihn befiehl, mischte sich die Sorge um die Zukunft.
Und diese Sorge blieb, je älter Ambrosius wurde. Immer häufiger betrachtete Barthel seinen Sohn gedankenvoll, und immer wieder geschah es, daß er ihm unbegreiflich und fremd war, obwohl er ihn doch so sehr liebte. Woher kam dieses Kind? Wann hätte je ein Schneehauser solche Hände gehabt? Ernsthafte Menschen waren sie wohl alle gewesen, der aber hatte eine Ernsthaftigkeit ganz anderer Art. Eine Ernsthaftigkeit, die hinter die Dinge sah, ohne zu grübeln, und mit einer Leichtigkeit begabt, die dem schwerfälligen Schneehauserblut fremd war.
So ging die Zeit dahin, und als Ambrosius ins elfte Jahr kam, erschien eines Morgens im Frühsommer der alte Pfarrer zur Betstunde. »Der Herr Kaplan ist nach Hause gefahren, er wollte seine Eltern besuchen und kommt erst wieder, wenn die großen Ferien zu Ende sind. Jetzt müsst ihr eben mit mir fürlieb nehmen bis dahin.« Schneebleich war da Ambrosius geworden, und nach dem Unterricht wartete er vor dem Schultor. Umständlich verschloss Vater Winfried die Türe mit dem großen Schlüssel, dann entdeckte er das Kind. »Na, Ambrosius, was hast denn auf dem Herzen?«
«Kommt er wirklich wieder, Hochwürden?« Zuerst begriff Winfried die Frage nicht, doch dann erinnerte er sich, dass Ambrosius die ganze Religionsstunde lang wie abwesend in seiner Bank gesessen, und plötzlich empfand er die Angst des Kindes, als wäre es seine eigene. »Aber freilich kommt er wieder, oder glaubst du, er wird einfach in die Welt fahren, ohne seinem Freund Ambrosius ›Lebe Wohl‹ zu sagen? So was musst du vom Bruder Sebastian nicht denken.« Und mit einem feinen Lächeln beugte er sich zu dem Jungen und fügte leise hinzu: »Außerdem hat er mir was verraten, der Herr Kaplan, aber, das darf ich dir nicht sagen. Musst halt geduldig sein bis zum September.«
»Das ist lang«, antwortete Ambrosius mit einem tiefen Seufzer, »aber ich helf einfach der Mutter bei der Arbeit, dann vergeht die Zeit schneller.« »Das machst; Bub, und jetzt renn, daheim warten sie mit dem Essen.«
So lang war Ambrosius noch kein Sommer geworden wie dieser, auch die viele Arbeit, die auf dem Schneehauserhof anstand, half nicht ganz über die Unruhe weg, die ihn immer wieder befiel. Wenn er es gar nicht mehr aushielt, schlich er sich in den Abendstunden unter die Arve. Den Kopf gegen ihren Stamm gelehnt, schaute er in den Himmel. Er sah die Sterne kreisen, der große Bär stapfte über die Berge, auf seinem Rücken das Reiterlein, und, wenn er hinaustrat auf den Weg und hinter sich blickte, schwangen sich die Sternenvögel, der Schwan und der Adler in die Dunkelheit. Das schönste aber von allen Bildern war für ihn die Krone. Die stand mit ihrem hellsten Stern auf dem Wipfel der Arve. »Wie der Christbaum schaust du aus«, flüsterte er ihr zu und war stolz auf seine Freundin, als hätte er sie selber geschmückt, und getröstet konnte er danach schlafen gehen.
Dann war endlich September, noch nie hatte Ambrosius das Ende der Ferien so sehnlich erwartet. Es war schon kalt oben in den Bergen, und über dem Steig und den Wiesen lag der erste Raureif. Ambrosius störte das nicht, als er mit dem Joseph und der Vroni der Schule zulief. Er mochte es, wenn ihm die Kälte in die Nase und die Backen kniff, und vor allem liebte er es, wenn die Sonne Tausende von Lichtern auf Feldern und Gebüsch ansteckte. »Jetzt sind wir Könige und laufen über lauter Edelsteine«, sagte er zu den Geschwistern. »O Ambrosius, das ist gefrorenes Wasser, hat der Lehrer gesagt«, Joseph schüttelte den Kopf, »bist du dumm.« Ambrosius lächelte still vor sich hin: »Ich weiß, was ich weiß«, war seine einzige Antwort. Außerdem konnte ihn heute gar nichts ärgern, denn heute musste Bruder Sebastian zurücksein, und so hätte selbst beim schlimmsten Regen für Ambrosius die Sonne geschienen.
Und da stand er tatsächlich, als wäre er nie fort gewesen. »Grüß euch, ihr Drei«, und zu Ambrosius: »Siehst du, ich bin pünktlich wieder da, wie ich es versprochen habe.« Da schlug dem Ambrosius die Röte ins Gesicht, musste denn Vater Winfried alles ausplaudern? »Ich hab ja nur Angst gehabt«, murmelte er. »Ist schon gut, ich verstehe dich. Und, wenn du in den nächsten Tagen Zeit findest, schau einmal bei mir herein. Und jetzt, grüßt die Eltern, wenn ihr heimkommt.«
Die Woche ließ Ambrosius verstreichen, denn plötzlich war ihm wieder eingefallen, dass der Pfarrherr von etwas gesprochen hatte, was er nicht verraten dürfe, und da wollte er doch nicht aufdringlich sein und gleich hinrennen. Er war eben auch darin nicht wie andere Kinder, die sich schwer tun mit dem Gedulden. Aber am Samstag nach der Schule lief er zum Pfarrhaus, klopfte, und als die Hauserin öffnete, sagte er: »Der Herr Kaplan hat mich bestellt. Ist er da?«
»Aber sicher, der wartet doch schon auf dich.« Und dann stand er in der Stube, wie damals am Johannitag, und ihm war beinahe so zumute wie an jenem Abend, denn wieder lag ein Holzkasten auf dem Tisch, nur ein kleinerer. »Komm her, ich hab dir was mitgebracht von daheim.« Und wie vor Jahren hörte Ambrosius das Knacken des Verschlusses, sah den Kaplan ein Tuch zurückschieben – da lag eine Geige. Wie immer, wenn die Freude übermächtig wurde, bekam er kein Wort heraus. Was hatte Bruder Sebastian gesagt: »Ich hab dir was mitgebracht von daheim.« Sollte das heißen, dass diese Geige für ihn war? Das konnte nicht sein, so was gab’s doch gar nicht! Ungläubig schüttelte er den Kopf. Von ganz weit her kam die Stimme von Sebastian: »Na, was ist, Ambrosius, nimm sie und hab sie recht lieb. Es war meine erste Geige und ich war gerade so alt wie du, als ich sie zum Christfest bekommen habe.« Heiß und kalt überlief es Ambrosius und in seinem Kopf schwirrte alles durcheinander. Zum einen konnte er vor Glück kaum denken – eine eigene Geige! –, zum andern fiel ihm schwer auf die Seele, dass er noch immer nicht mit dem Lehrer gesprochen, und zum dritten: Wie sollte er Bruder Sebastian beibringen, ohne ihn zu kränken, dass er sich mehr wünschte eine Geige zu bauen, denn auf ihr zu spielen? Darum blieb er wie festgewachsen stehen und starrte auf das braunglänzende Ding. »Ambrosius, freust du dich denn gar nicht?« Da brach’s aus ihm heraus und die Tränen schossen ihm über die Backen: »Ich will doch eine bauen lernen!«
Bestürzt neigte sich Sebastian hinunter, bestürzt und betroffen von diesem wilden Schmerz, und so nahm er seinen kleinen Freund fest in den Arm und sagte tröstend: »Schau, Ambrosius, wenn man eine Geige bauen will, muss man sie zuerst gut kennen. Und um sie zu kennen, sollte man lernen, sie zu spielen, und das werde ich dich lehren. Drei Jahre musst du noch zur Schule gehen, also drei Jahre haben wir beide noch Zeit, und die Zeit, die wollen wir nützen.«
Ganz still hatte Ambrosius zugehört, dann fragte er leise: »Und Ihr seid net böse oder traurig, weil ich kein Geigenspieler werd?«
Da lachte Sebastian und es klang warm und herzlich: »Bestimmt nicht, Ambrosius«, und indem er die Bubenhand in die seine nahm, sprach er weiter: »Wem der Herrgott solche Hände mitgegeben hat, dem hat er was Besonderes geschenkt. Dir aber hat er auch noch inwendige Ohren beschert. Weißt du, was das bedeutet? Dass du in dich hineinhorchen musst, damit du vernimmst, was Gott von dir will. Ganz sicher wissen wir es selten, aber etwas können wir erlauschen, was er uns für einen Auftrag gibt, wenn wir genau hinhören.«
»Hat er Euch den Auftrag gegeben, dass Ihr Pfarrherr werden sollt?«
»Ja, das hat er. Und wenn wir erkannt haben, welchen Weg er uns weist, dann müssen wir diesen Weg auch gehen und wenn er noch so herb ist, und wir dürfen uns von keinem Menschen abhalten lassen.« Der Blick des Mannes ging in die Ferne und Trauer lag auf seinem Gesicht. Beklommen schaute ihn Ambrosius an und dann sagte er: »Bruder Sebastian, ich werd’ dafür beten, dass Ihr wieder fröhlich seid. Und wenn Ihr mich lehren wollt, ich komm’ gern und dank Euch.«
Voller Verwunderung dachte Sebastian: »Was für ein Kind!«, und er entsann sich der Worte von Vater Winfried: »… geht mir vorsichtig mit der Kostbarkeit um, Bruder.« Und so schob er alle Trübnis beiseite. »Jetzt werden wir nach einem Riemen suchen, damit du den Kasten auf den Rücken binden kannst. Und dann ab mit dir, sonst wird daheim die Suppe kalt.«
Je näher Ambrosius dem Elternhaus kam, umso langsamer wurde sein Schritt. Seine ganze Glückseligkeit war zu einem Punkt zusammengeschrumpft und dieser Punkt hieß »Vater«. Was wird er zu der neuen Hausgenossin sagen? Man konnte kein Holz mit ihr spalten, keinen Stall mit ihr säubern, sie konnte kein Unkraut jäten, kurzum sie war unnütz, zu nichts zu gebrauchen, was dem Vater wichtig war. Aber für ihn war sie wichtig, denn sie war Musik, und ohne Musik …? »Nein, nein, nein«, murmelte er eigensinnig, als er die Klinke niederdrückte. Das Herz klopfte ihm bis zum Hals – sie saßen alle um den Tisch, obenan der Vater. »Warum kommst denn gar so spät, uns hungert«, voller Vorwurf sagt’s der Joseph, der Vater aber schaute nur auf den Kasten – und da musste er reden: »Es ist die Geige vom Herrn Kaplan, das Christkind hat sie ihm beschert, da war er so alt wie ich, darum ist sie auch so klein – und jetzt gehört sie mir, hat er gesagt.«
Es war mäuschenstill in der Stube. »Jetzt kommt das Donnerwetter«, dachte Ambrosius, aber da erlebte er die zweite Überraschung an dem Tag. Vorsichtig zog ihm der Vater den Kasten vom Rücken, so vorsichtig, als griffe er nach etwas ganz Wertvollem, Zerbrechlichem. »Eine Geige«, sagte er ehrfürchtig, »Bub, Bub, weißt du auch was du da hast? Das ist ein Himmelsgeschenk. Mein ganzes Leben lang hab’ ich mir eine gewünscht, so gern wollt’ ich lernen, Musik zu machen. Aber es ging net, für eine Geige hatten wir kein Geld und zum lernen war keine Zeit. – So, und nun wollen wir endlich essen, reden können wir danach.«
Es gab Gerstensuppe und die mochte Ambrosius eigentlich gar nicht, heute aber war ihm alles gleichgültig, er merkte nicht einmal, was er aß, immer wieder musste er zum Vater hinschauen. Nie hätte er geglaubt, dass der Vater die Musik liebte. Und so froh er war, irgend etwas in ihm schmerzte und er kämpfte mit den Tränen. Ihm war, als sähe er seinen Vater zum ersten Mal, den gebeugten Rücken, die dunklen Locken, durch die schon die ersten grauen Strähnen zogen, und die Hände, die so fest zupacken konnten und doch vorhin fast zärtlich den Geigenkasten umfasst hatten. Und was für hässliche Gedanken hatte er gehabt, sogar mit einem Donnerwetter hatte er gerechnet. Und dabei war es doch der Vater gewesen, der ihm das Schnitzmesser geschenkt, obwohl er selber nie das durfte, was er sich sehnlichst wünschte. Ganz rote Backen bekam Ambrosius, so sehr schämte er sich. Da blickte der Vater vom Teller auf, sah ihn an – und lächelte. Und dieses Lächeln war so gütig und der Glanz seiner Augen so warm, dass der Kloß in Ambrosius Hals riesengroß wurde, er konnte keinen Bissen mehr hinunterbringen. Da legte er den Löffel weg und zog leise die Türe hinter sich zu. Draußen rannte er unter die Arve, warf sich auf den Boden und weinte bitterlich. Drinnen in der Stube sahen sich die Eltern an, dann nickte der Barthel, stand auf und schloss genau so leise wie sein Sohn die Türe. Er lief zur Arve, wusste er doch genau, wo er seinen Buben fand. Still setzte er sich auf die Erde, nahm das Kind auf den Schoß und wiegte es ruhig hin und her. »Mein Großer«, dachte er, »wir sind doch alle gleich. Wenn uns was wehtut, sind wir klein, nackt und bloß, wie frisch geboren.«
Eng drängte sich Ambrosius an den Vater, langsam wurde das Schluchzen weniger und weniger und jetzt fragte Barthel: »Bürschel, sag schon, was hast denn für ein Kümmernis? So zu weinen an solch einem schönen Tag.«
»Es ist, weil du nie durftest, was du dir gewünscht hast und ich es einfach darf, und weil ich geglaubt hab, du schimpfst – deshalb, weil ich so schlecht von dir gedacht hab’, das ist schlimm.«
Barthel schwieg eine ganze Weile, dann antwortete er: »Du hast also gemeint, ich erlaub net, dass du was lernst, was ich net lernen durft’, dass ich darum gram, gar neidisch bin?« Das Kind nickte. »Schau her, Ambrosius, wenn man jemand gern hat, wünscht man ihm alles Gute der Welt, und wenn er’s kriegt, dann freut man sich, als wär’s einem selber geschenkt. Und gerade so ist mir’s gegangen, als ich die Geige auf deinem Buckel gesehen hab. Und nun wollen wir nachdenken, wie das weitergehen soll, denn eine Geige will doch Musik machen, und das muss dich ja irgendwer lehren.«
»Der Bruder Sebastian hat an alles gedacht, Vater, er will mich’s lehren, und vom Stundengeld hat er gar nichts gesagt.« Ganz eifrig wurde Ambrosius, endlich konnte er dem Vater eine Freude machen, denn er wusste doch, wie rar das Geld war.
»Da werd’ ich wohl einmal mit dem Herrn Kaplan reden müssen, denn so leicht lässt sich ein Schneehauser nichts schenken«, sagte der Barthel stolz.
Am Abend, als die Kinder in der Kammer schliefen, saßen die Eltern noch beisammen. »Wenn ich nur wüsst, was die beiden geistlichen Herren mit unserm Ambrosius vorhaben, sie machen doch net mit jedem Kind solche Umständ’.«
»Barthel, es ist auch net jedes Kind ein Ambrosius«, entgegnete die Fränzi, »und weißt du was, frag doch den Herrn Kaplan einfach beim nächsten Kirchgang, wenn du ihn sowieso sprechen willst wegen der Geigenstunden.«
Und so kam es, dass am Sonntag die Fränzi allein mit ihren Kindern den Steig hochging, während Barthel vor dem Pfarrhaus auf den Kaplan wartete. Eine wohlgesetzte Rede hatte er sich in seinem Kopf zurechtgelegt, aber als dann der junge Mann zu ihm trat und in seiner frischen Art fragte: »Na, Vater Schneehauser, was haben Sie auf dem Herzen?«, da war alles wie weggewischt und er konnte nur antworten mit einer Frage: »Was, bitte schön, Herr Kaplan, habt Ihr mit unserm Buben vor, denkt dran, er ist ein Holzbauernkind, was soll bloß aus ihm werden, mit den Händen und so eigen, wie er ist. Oder wollt Ihr einen geistlichen Herrn aus ihm machen?«
Da lachte der Jüngere, und es war ein fröhliches Lachen: »Aber Schneehauser, das wäre ja der reine Jammer, wenn man solch einen Menschen in den Chorrock steckte.«
Fassungslos starrte ihn der Barthel an. War er übergeschnappt, der Kaplan, etwas Höheres als ein Priester konnte man doch gar nicht werden. »Ja, was soll dann aus ihm werden, wenn er selbst für’s geistliche Amt zu besonders ist?« Kopfschüttelnd und völlig verwirrt stand der Mann da. Jetzt wurde der Kaplan ernst und antwortete: »Kommt Schneehauser, wir besprechen uns auf meiner Stube.« Und dort, als sich die beiden gegenüber saßen, begann Sebastian: »Jetzt tu ich etwas, Vater Schneehauser, was ich als Priester nicht tun darf, ich verrate ein Geheimnis. Aber ich tu es für den Ambrosius, der uns beiden so wert ist, darum mag mir’s verziehen werden. Seht, Euer Bub hat einen Wunsch, der ihn umtreibt seit seinem neunten Jahr, er will ein Geigenbauer werden. Das ist ein ehrsames Handwerk. Allein der Pfeilerengel und ich wissen darum und jetzt auch Ihr. Nur dürft Ihr Euch nichts anmerken lassen, denn ich glaube, er will es Euch selber sagen, wenn es an der Zeit ist. Ihr müsst wissen, Euer Ambrosius ist ein ernsthafter, selbstständiger Bursch, der die Dinge gerne von Grund auf regelt, und ich meine, das hat er von Euch.«
Ganz warm wurde dem Barthel bei diesem Lob, und deshalb hatte er auch den Mut, die leidige Geldfrage anzusprechen. »Erst einmal möcht ich Euch vielmals danken, dass Ihr meinem Kind die Geige gegeben, ich kann Euch nur dank sagen, denn bezahlen könnt’ ich sie net. Aber wie ist das mit den Stunden, die kann ich net auch noch geschenkt nehmen.« »Warum könnt Ihr das nicht? Wenn ich es gerne tu und es mir Freude macht – Ihr werdet mir doch die Freude nicht vergällen? Vater Winfried hat einmal über Ambrosius zu mir gesprochen, und wollt Ihr wissen, was er gesagt hat? ›Ein hochbegabtes Kind ist er. Geh mir vorsichtig mit der Kostbarkeit um, Bruder.‹ Seht Ihr, Schneehauser, genau das will ich tun, und darum meine ich, für eine solche Kostbarkeit sollten wir dankbar sein und nicht über’s Geld reden.«
»Das fällt mir schwer, wir sind eben arg stolz, wir Schneehauser, aber dem Buben zulieb muss ich wohl nachgeben, sonst kündigt Ihr ihm am End’ noch die Freundschaft auf.«
»Ihr habt ja Humor, Vater Schneehauser!«
»Den braucht man auch, wenn man dort oben überleben will. Und jetzt kann ich nur noch einmal danke sagen für alles, und über die Woche werd’ ich ihn zur ersten Stunde schicken.«
Als Barthel den Berg hochstieg, voller Freude, was für eine frohe Botschaft er Ambrosius heimbrachte, da fiel ihm jene Johanninacht ein, und ihm war, als liefe der Bub neben ihm her und er hörte ihn sagen: »Musst nicht traurig sein, Vater, du sollst der Erste sein, dem ich’s sag’, wenn es an der Zeit ist.«
Und so erschien Ambrosius jeden Samstag nach der Schule und bekam seine Geigenstunde. Viel Mühe hatte Sebastian nicht mit ihm, denn zum einen war er fleißig im Üben, und zum andern so voll Musik, dass er begriff ohne viel Erklärungen. Was Sebastian nicht wusste, war, dass Ambrosius seine Geige genau untersuchte. Einen Bindfaden hatte er sich bei der Mutter erbeten, mit dessen Hilfe vermaß er das Instrument in Höhe, Länge, Breite und war immer wieder erstaunt, was für eine Harmonie dieses kleine Gebilde aufwies. Er nannte es nicht so, er meinte nur einmal zum Vater: »Bei meiner Geige ist nichts zu lang oder zu kurz, da ist alles wie es sein soll.«
An einem Nachmittag trug er sie hinaus in die Sonne, linste in die Schalllöcher und machte dabei eine Entdeckung, die ihn beunruhigte. In der nächsten Stunde zeigte er mit dem Finger auf das Schallloch und sagte: »Bruder Sebastian, ich hab’s sicher nicht hineingesteckt das Stöcklein, der Mann, der die Geige gebaut hat, muss es vergessen haben. Was machen wir denn jetzt?«
»Was für ein Stöcklein?«
»Hier drinnen im Bauch ist’s, wenn die Sonne hineinscheint, sieht man’s ganz deutlich.«
Sebastian musste lachen: »Das ist kein vergessenes Stöcklein, Ambrosius, das ist die Seele der Geige, das ist der Stimmstock. Wenn er nicht wäre, könnte die Geige nicht klingen.«
»Dann muss man ihn aber in Ruhe lassen, den Stimmstock, denn ohne Seele sind wir gar nichts, hat Vater Winfried gesagt, und bei der Geige ist’s gerade so. Hab’ ich’s recht begriffen?«
»Ja, das hast du ganz recht begriffen, Bub.«
Dann kam der Tag, an welchem Bruder Sebastian ein Notenblatt vor ihn hinstellte. Ambrosius lachte: »O je, die Musikbuchstaben.«
»Kennst du denn Noten?«
»Schon lang, Vater Winfried hat sie mich gelehrt, damals, als ich den Hirtenengel gesungen hab. Aber ich verrat Euch was, ich hab sie nur gelernt, damit Hochwürden net beleidigt sind, denn zum Singen hat man sie net nötig.«
»Aha, zum Singen hat man sie nicht nötig. Und wie ist das mit den Liedern, woher nimmt man die?«
»Die kommen von allein, der Bach singt sein Lied, die Blumen, die Gräser und unsre Arve, die singt wunderschön.«
»Ambrosius, wenn du schreiben willst, brauchst du Buchstaben, wenn du lesen willst auch.«
»Aber zum Reden brauch ich keine, und Singen ist wie Reden.«
Tief schnaufen musste Sebastian – auf was hatte er sich da eingelassen! »Komm’ her, Ambrosius, setz dich zu mir. Was machst du denn, wenn dir nichts mehr einfällt?«
»Mir fällt immer was ein. Die Lieder kommen und gehen, das ist wie beim Wind, jetzt ist er da, dann ist er weg, aber es kommt immer wieder ein neuer.«
Sebastian stützte den Kopf in die Hand und dachte nach. Dann fuhr er fort: »Hör zu, Ambrosius, weißt du noch, wie wir uns das erste Mal begegnet sind?« Ambrosius nickte.
»Du kamst den Steig herunter und hast ein Lied gesungen.«
»Ja, das war das Lenzlied.«
»Fein, dass du es noch weißt. Und nun bitte ich dich, dass du mir’s noch einmal singst.«
»Genau das Gleiche?«
»Ja, genau das Gleiche, weil es besonders schön war.«
»Das kann ich net, da müsst Ihr warten, bis es wieder lenzt.«
»Und wenn es wieder lenzt, singst du mir ein anderes Lied, ist es so?«
»Ja, das kann wohl sein.«
»Siehst du, und deshalb gibt es Noten, damit Musik, wenn sie so schön war wie dein Lenzlied, nicht verloren geht.«
»Und wie kriegt man die Musik in die Notenköpfe hinein?«
»Das, Ambrosius, sollst du neben dem Geigenspiel bei mir lernen, willst du?« Anstatt einer Antwort gab Ambrosius seinem großen Freund die Hand, und das war soviel wie ein Ja.
An diesem Abend lief er zur Arve. Es war sternenklar und der Baum hatte sich bereits die Krone ins Haar gesteckt. Ein leichter Wind kam von den Bergen her – und die Arve fing an zu singen. Ambrosius wurde ganz wirr vor Nachdenken. Warum nur brauchten die Menschen diese dummen Noten, die Bäume brauchen doch auch keine. Ob ihm die Arve eine Antwort wusste? »Ich hab versprochen zu lernen, wie ein Lied in die Notenköpf’ hineinkommt, aber ich weiß immer noch net richtig, warum ich so was Unnützes lernen soll. Weißt du es?« Er stand und lauschte – der Wind blies stärker und die Arve sang und sang, so schön, wie sie Ambrosius noch nie gehört, voll und dunkel klang ihre Stimme. »Sag doch was.« Die Arve sang und sang – das Arvenlied, war das die Antwort? Wie schön sie heute sang, das musste er Bruder Sebastian erzählen in der nächsten Geigenstunde. Und der wollte dann das Arvenlied hören; und er, könnte er es singen? Er könnte schon ein Arvenlied singen, aber eben ein anderes, nicht das Nachtlied, was so wunderbar geklungen. Außerdem, hatte nicht Vater Winfried gesagt, dass nur wenige Menschen inwendige Ohren haben, vielleicht hatte Bruder Sebastian nur die angewachsenen, die man sehen konnte. Wenn das so war, dann brauchte der Freund ihn, und er – er brauchte die Notenköpfe. So einfach war das, und die Arve hatte es gewusst. Dankbar strich Ambrosius über den Stamm, ehe er ins Haus ging.
Nun fieberte er der nächsten Geigenstunde entgegen, und bevor er noch die Geige unters Kinn genommen, fragte er: »Wie schnell kann man lernen, aus einem Lied Notenköpf’ zu machen?«
»O, Ambrosius, das dauert schon eine Weile, warum hast du es denn auf einmal so eilig?«
»Weil die Arve jetzt noch die Sternenkrone trägt, und die Sternenkrone ist ein Sommerbild, hat der Vater gesagt, im Herbst und im Winter geht sie hinters Gebirge. Und weil die Arve nie so schön singt, wie wenn sie die Sternenkrone aufhat.«
»Wenn ich dich recht verstehe, willst du das Lied der Arve in Noten schreiben.«
»Ja, weil ich möcht’, dass Ihr es hört, aber net weiß, ob Ihr inwendige Ohren habt.«
»Gut, Ambrosius, packen wir’s an, und wenn du so eifrig bist wie beim Geige üben, könnte uns die Zeit hinreichen.«
Und Ambrosius lernte. Er lernte die Noten schreiben und setzen mit derselben Hartnäckigkeit, mit der er sich zuvor dagegen gesträubt. An einem Abend im späten Sommer, ging er mit einem leeren Notenblatt hinaus zur Arve. Es war die Stunde, in welcher der Wind wach wurde und von der Bergspitze ins Tal flog. Auf diesem Weg kam er beim Schneehaus vorbei und brachte die Arve zum Singen. Ambrosius wusste das und wartete auf ihn. Dabei ging ihm allerlei durch den Sinn. Es war doch seltsam, dass keiner etwas konnte ohne den andern: Er konnte nicht geigen ohne Bruder Sebastian, dieser das Lied der Arve nicht hören ohne ihn, die Arve konnte nicht singen ohne den Wind, und selbst der musste irgendwo dagegen blasen, damit Musik daraus wurde. Mitten hinein in seine Gedanken fing der Baum an zu summen, erst leise, wie im Traum, und dann immer weiter, weicher, schwingender, eine herrliche Melodie. Und Ambrosius sang, was er hörte, die Töne flossen in seine Hände, wurden zu Noten … Und er schrieb und schrieb, bis das Blatt voll war, und der Wind weiter gewandert, hinaus in die Nacht.
Kurz vor Ambrosius‘ Geburtstag rief ihn Vater Winfried zu sich: »Ambrosius, ich möcht dieses Jahr noch mal die Weihnachtsmusik aufführen in der Christnacht. Willst du mir wieder den Hirtenengel singen?«
Ambrosius lachte: »Wollen tät ich schon, Hochwürden, aber eine Freud’ wär’s bestimmt keine beim Zuhören. Meine Stimme klingt so komisch manchmal. Erst ist sie hoch, dann wieder tief, und ich kann nichts dran tun, es geschieht einfach. Der Joseph sagt, es klingt, als hätt’ ich ein Reibeisen verschluckt. Und ich mein’, es klingt wie die Bergdohlen, wenn sie schreiend um den Kirchturm fliegen.«
Bekümmert schaute ihn der Pfarrherr an: »Oje, Ambrosius, wie alt bist?«
»Dreizehn werd’ ich zu Ambrosi, was mein Geburtstag ist.«
»Also Stimmbruch, was machen wir denn da?«
»Nehmt doch den Joseph, der kann grad so gut singen, und wenn’s Euch recht ist, begleit ich ihn mit der Geige.«
»Recht ist mir’s schon, aber arg find’ ich’s trotzdem, deine schöne Stimme …«
»Irgendwann krieg ich wieder eine, hat die Mutter gesagt, nur eben eine andre.« Ambrosius nahm das Ganze nicht so schlimm und der Pfarrherr musste sich zufrieden geben.
Einen Tag nach seinem Geburtstag erschien Ambrosius im Lehrerhaus.
»Ja,Ambrosius, was willst denn du? Komm herein.«
Und drinnen, umgeben von hohen Regalen voller Bücher und alter Landkarten, fing Ambrosius an zu reden: »Gestern war ich dreizehn und in einem Jahr komm ich aus der Schule, dann muss ich was lernen und das will ich auch. Nur, ein Holzbauer will ich keiner werden, dafür taug ich net, sagt der Vater.«
»Hast du denn einen Wunsch, was für ein Handwerk du erlernen möchtest?«
»Ja, den hab ich schon lang. Ich möcht’ ein Geigenbauer werden.« Jetzt war’s heraus, und es war erst einmal still in der Stube. Lange schwieg der Mann. Bald vierzig Jahre war er Lehrer im Dorf, aber noch keiner seiner Schüler hatte solch einen Beruf gewählt. »So, so, ein Instrumentenbauer willst du werden, und, was soll ich dabei tun?«
»Ihr wisst so viel, hab ich gedacht, da wisst Ihr vielleicht auch, wo man das Geigenmachen lernen kann, denn hier herum baut keiner Geigen.«
»Ich hab’ einmal gelesen, dass es in Italien eine ganze Stadt gibt, die Geigen baut, seit vielen hundert Jahren, Cremona heißt sie und ihre Geigen sind berühmt.«
»Italien, das ist doch himmelweit hinter den Bergen!« Ordentlich erschrocken war Ambrosius. »Die reden dort net wie wir, wie soll das zugehen, wenn ich die Sprache net kann.«
»Lass mir ein paar Tage Zeit, Bub, ich muss nachdenken, mag sein, dass ich noch was anderes finde für dich, komm in der nächsten Woche wieder.«
Langsam mit gekrauster Stirne, stapfte Ambrosius den Steig hoch. Italien, so weit musste er fort, ganz allein, und keiner würde ihn da verstehen; der Berg, den er vor sich sah, war höher und steiler, als der, den er hinaufstieg. Etwas später ging er zum Vater und sagte: »Kommst du mit mir zur Arve, ich muss dir was sagen.«
Als sie dann nebeneinander saßen, die Dämmerung kam vom Tal her, auf den Bergen lag ein roter Schein und überm Felszacken stand der Abendstern, da seufzte Ambrosius: »Das alles hier nimmer sehen, die Arve verlassen und euch, das ist hart.«
»Warum sollst du uns denn verlassen, du gehörst doch hierher wie das Haus und die Arve?«
»Weißt du noch, damals, an Johanni, hab’ ich versprochen, dass du der Erste bist, dem ich mein Geheimnis verrat, das ich mit dem Kaplan und dem Pfeilerengel hab. Jetzt ist’s soweit, jetzt kann ich reden. Vater, ich will lernen, Geigen zu bauen, wenn die Schule zu Ende ist übers Jahr. Ich will ein Geigenbauer werden.«
Eine ganze Weile fiel kein Wort, und dann antwortete der Vater: »Ambrosius Bartholomäus Schneehauser, das ist ein guter Entschluss und ich bin stolz auf dich.« Noch nie hatte ihn der Vater bei seinem vollen Namen genannt, und er war stolz auf ihn, ganz feierlich war ihm zumut, ordentlich warm wurde ihm vor Freude.
Der Vater stand auf, legte ihm fest den Arm um die Schulter und meinte: »Auf jetzt, hinein in die warme Stube, die Mutter wird warten und neugierig sein, was wir so lang in der Kälte treiben.«
Als sie beisammen saßen, sagte der Vater: »Weißt, Fränzi, was unser Großer werden will? Ein Geigenbauer will er werden.« Da schoss der Fränzi die flammende Röte ins Gesicht vor Freude: »Ambrosius, Bub, so was Schönes willst du werden«, doch dann stockte sie und frug: »Aber wer soll dich lehren, hier versteht’s keiner, und der Ahn, der’s vielleicht gekonnt hätt’, ist lang tot.«
Leise antwortete Ambrosius: »Das ist ja, was so schlimm ist, in Cremona bauen sie Geigen, und das ist in Italien, hat der Lehrer gesagt.«
Vor Schrecken konnte die Mutter gar nichts sagen, da fuhr Ambrosius fort: »Aber der Herr Lehrer hat auch gesagt, er wird sich umtun, ob es auch bei uns einen Geigenmacher gibt.« Ein bissel beruhigte sich die Franziska zwar, aber trotzdem lastete ihr ein großer Stein auf der Seele.
Während sich die Franziska noch mit schweren Gedanken plagte, ging ein Brief vom Lehrerhaus in die große Stadt an einen alten Schulfreund, und als der Briefbote die Antwort ins Dorf brachte, rief der Lehrer den Ambrosius zu sich: »Sag dem Vater, er möcht’ mit dir bei mir hereinschaun, ich habe eine Nachricht aus der Stadt, ich denk, das wird euch freuen.« Kein Tag verging und die beiden Schneehauser standen im Lehrerhaus. Umständlich kramte der Lehrer einen Brief vor und reichte ihn dem Barthel: »Da lest selber, Vater Schneehauser«, und der Barthel begann, und je länger er las, desto heller wurde seine Miene. Als er geendet, reichte er den Brief zurück und meinte: »Ja, Ambrosius, ich denke damit können wir leben. Was meinst du, wo sie bei uns Geigen bauen, und das seit dreihundert Jahren? In Mittenwald!«
»In Mittenwald, das ist ja grad über den Bergen, und dort reden sie wie wir.« Einen tiefen Seufzer musste er tun, und dann sagte er gar nichts mehr, die Freude hatte ihm die Sprache genommen.
Das Weihnachtsfest war vorüber, Joseph hatte den Hirtenengel gesungen und Ambrosius ihn auf der Geige begleitet. Es war ein schöner Gesang gewesen, denn Joseph hatte eine kräftige, glockenhelle Stimme, aber als der Pfarrherr wie vor Jahren mit Ambrosius nach der Mette über den verschneiten Kirchhof ging, meinte er: »Nichts gegen den Joseph, er hat schön und sauber gesungen, aber dein Hirtenengel war es nicht. Du hast mit deiner Geige mehr den Engel gespielt, als ihn der Joseph gesungen hat.« Ambrosius blieb stehen, und indem er den Kopf hob und hinaufschaute in den bestirnten Himmel, sagte er langsam und sehr ernst: »Ich weiß auch net was das ist, Vater Winfried, aber wenn ich sing oder spiel’, dann hol ich die Musik nicht aus mir heraus, sondern ich spür’, wie sie von oben in mich hineinfällt. Das war schon immer so, das ist wie ein Geschenk, das von den Sternen kommt. Darum müsst Ihr dem Joseph net gram sein, er kann doch nichts dafür, dass die Stern’ ihm nichts schenken, wie ich nichts dafür kann, dass sie’s bei mir tun.«
Still schaute der Pfarrer vor sich hin und ihm war, als fiele vom Gesicht dieses Jungen ein heller Schein in den Schnee.
»Ihr redet gar net, Hochwürden, hab’ ich was Unrechtes gesagt?«
Da legte Vater Winfried seinen Arm um die Schulter des Buben und antwortete: »Bestimmt nicht, ganz bestimmt nicht, ach, Schneehauser Ambrosius, was bist du nur für ein Mensch.«
Und diese Antwort konnte Ambrosius überhaupt nicht verstehen.