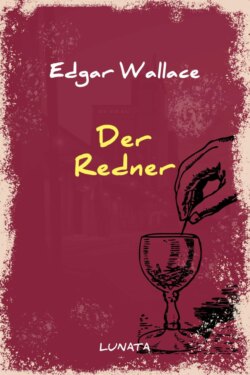Читать книгу Der Redner - Edgar Wallace, Edgar Wallace - Страница 7
Die Gedankenleser
ОглавлениеEs gibt keine Polizei auf der Welt, die einen wirklich intelligenten Verbrecher mit Erfolg bekämpfen könnte«, schrieb Len Witlon in einem Artikel, der in den hervorragendsten Zeitungen Amerikas erschien. »Man kann ihn unmöglich fassen, wenn er seine Pläne ernst und vorsichtig vorbereitet und sie rücksichtslos zur Ausführung bringt.«
Len Witlon beherrschte fünf Sprachen und hatte Freunde und Verbündete in wenigstens einem Dutzend europäischer Gefängnisse. Er selbst war zwar schon in Untersuchungshaft gewesen, aber noch niemals verurteilt worden.
In Paris konnte man ihn in der American Bar des Hotels Claridge und in anderen vornehmen Lokalen treffen. Gelegentlich machte er eine Kur in Vichy oder in Baden-Baden, auch besuchte er berühmte Moorbäder in der Tschechoslowakei. Er war eitel, trat sehr elegant auf und war ängstlich darauf bedacht, seinen Ruf als Kavalier zu wahren.
»Um Einbrüche erfolgreich durchzuführen, muß man psychologisch denken können. Es genügt nicht, die drohenden Gefahren zu kennen, man muß vor allem auch die Gedankengänge der Gegner verstehen. Das ist das wichtigste bei solchen Unternehmungen. Der Erfolg kann auf die Dauer nur einem Mann treu bleiben, der ein tüchtiger Organisator ist und seinen Verbündeten unverbrüchliche Treue hält.«
Chefinspektor Rater las diesen interessanten Artikel so oft durch, daß er ihn beinahe auswendig wußte. Er schnitt ihn auch aus und klebte ihn in ein Buch, um sich daran zu erinnern, wenn Len Witlon eines Tages seine Tätigkeit in England aufnehmen sollte.
»Sagen Sie Ihrem Freund«, bemerkte er eines Tages zu einem Vertrauten des großen Verbrechers, »wenn er sich hier in London sehen läßt, stecken wir ihn ohne Gnade und Barmherzigkeit ins Loch. Dann findet er vierzehn Jahre lang keine Gelegenheit mehr, sich von Zeitungsleuten interviewen zu lassen.«
Eines schönen Tages nahm Len diese Herausforderung an ...
Gemächlich ging Polizist Simpson auf seinem Patrouillengang über den Burford Square zur Ecke der Canford Street. Er hatte sich für elf Uhr mit seinem Kollegen Harry verabredet, der den benachbarten Bezirk überwachte, um mit ihm die unterbrochene Unterhaltung über seinen Schwager fortzusetzen. Dieser Mann war nämlich nach Kanada gegangen und hatte seine Frau mit ihren drei Kindern einfach sitzenlassen.
Ungefähr zu gleicher Zeit kamen die beiden am Treffpunkt an, und das interessante Thema wurde sofort wieder in Angriff genommen.
»Ich habe meiner Schwester immer gesagt, daß sie eigentlich selbst daran schuld ist, und daß ...«
Simpson brach ab, denn plötzlich gellten furchtbare Schreie durch die Stille der Nacht. Sie kamen aus einem dunklen Haus in der Nähe.
»Mord ... Mord!«
Die beiden Beamten eilten zu dem Gebäude, so schnell sie konnten. Auf den Stufen zu Nr. 95 stand ein junges Mädchen. In dem schwachen Schein einer entfernten Straßenlaterne sahen sie ihr weißes Nachthemd.
»Hilfe ...! Ach, Gott sei Dank, daß Sie kommen!«
Sie trat vor den beiden durch die offene Tür in den dunklen Flur.
»Ich hörte, wie sie miteinander kämpften und wie er um Hilfe rief«, berichtete sie atemlos und verstört. »Und ich versuchte, in sein Zimmer einzudringen ...«
Sie tastete nach dem elektrischen Schalter und drehte das Licht an. Eine große Lampe an der Decke verbreitete gelbliches Licht.
»Was ist denn los? Welches Zimmer meinen Sie denn?« fragte Simpson schnell.
Sie zeigte mit zitternder Hand die Treppe hinauf. Ihre Züge zeigten eine auffallende Blässe, aber sie war sehr schön.
»Häng doch der Dame einen Mantel um, Harry«, sagte Simpson und deutete auf einen Ständer in einer Nische, an dem Hüte und Kleider hingen. »Sie müssen uns das Zimmer zeigen«, wandte er sich dann an sie.
Aber sie schüttelte den Kopf und starrte die beiden entsetzt an.
»Nein, nein, das kann ich nicht ... Es liegt am ersten Treppenabsatz – nach vorne hinaus. Man kann von dort aus auf den Platz sehen –«
Die Polizisten stürzten die Stufen hinauf, und als sie auf dem Podest ankamen, leuchtete die Deckenlampe auf. Wahrscheinlich befand sich der Schalter hierzu auch unten, denn oben konnten sie keinen entdecken. Sie standen vor einer Mahagonitür mit vergoldeten Schnitzereien und einem schönen Griff.
Simpson, dessen Schwager nach Kanada durchgebrannt war, drückte die Klinke herunter. Die Tür war aber von innen verschlossen.
»Öffnen Sie!« rief er und rüttelte heftig daran.
Aber niemand kam der Aufforderung nach, und als er aus Versehen die Klinke wieder berührte, gab die Tür plötzlich nach.
Sie traten in einen weiten Raum, der die volle Breite des Hauses einnahm. Ein Kristallkronleuchter brannte, und Simpson sah einen großen Mahagonischreibtisch vor sich. Dahinter zeigte sich ein kostbarer Marmorkamin, der elektrisch geheizt wurde. Als sie um den Schreibtisch herumgingen, entdeckten sie auf dem Boden einen Mann. Er war in Abendkleidung und packte mit einer Hand krampfhaft die Ecke des Kamins. Die andere war halb erhoben, als ob sie einen Schlag abwehren wollte.
»Er ist tot – erschossen ... Sieh doch hin!«
Harry zeigte auf den Blutfleck über dem Herzen des Mannes.
Simpson starrte auf ihn nieder. Es war das erste schwere Verbrechen, das er im Dienst erlebte, und sofort durchzuckte ihn der Gedanke, welch große Bedeutung das für ihn und seine Karriere haben könnte. Dadurch geriet er jedoch in große Verwirrung; außerdem erinnerte er sich im Augenblick nur noch dunkel daran, wie man sich als Polizist unter solchen Umständen zu verhalten hatte.
»Niemand darf ins Zimmer kommen«, sagte er heiser und sah sich weiter um. Die große Glastür zum Balkon stand offen. Er trat hinaus und leuchtete mit seiner Taschenlampe das Geländer ab.
Ein Strick war um die Handleiste geschlungen und reichte bis nach unten zu den Treppenstufen vor der Haustür. Er mußte erst nach ihrem Eintritt ins Haus angebracht worden sein, sonst hätten sie direkt dagegenstoßen müssen.
»Der Täter ist entwischt, während wir mit der Dame sprachen«, erklärte Simpson. »Komm, wir wollen wieder nach unten gehen.«
Sie eilten wieder in den Flur hinunter, aber von der jungen Dame war nichts mehr zu sehen. Sie mußte auf ihr Zimmer gegangen sein. Das Haustor war verschlossen. Simpson drückte die Klinke herunter, aber die Tür bewegte sich nicht. Er versuchte es ein zweites Mal mit Gewalt, aber sie war mit schweren Stahlschienen beschlagen und rührte sich nicht von der Stelle.
»Sie ist doppelt gesichert. Das muß die junge Dame getan haben. Rufe sie doch und lasse dir den Schlüssel von ihr geben.«
Harry versuchte die nächste Tür – sie war auch verriegelt, ebenso eine zweite. Nur die dritte, die in den hinteren Teil des Hauses führte, ließ sich öffnen. Er kam in die Küche, und beim Schein seiner Taschenlampe sah er eine Tür, die nur angelehnt war. Er vermutete, daß es sich um die Garage handelte. Das große Tor zur hinteren Straße stand weit auf, und die beiden Flügel pendelten im Nachtwind.
Harry ging zu seinem Kollegen zurück.
»Warte hier«, befahl Simpson, der der Dienstältere war, und rannte zur hinteren Nebenstraße.
Mit zitternden Fingern zog er die Trillerpfeife heraus und pfiff schrill. Dann rannte er um das Gebäude herum und kam gerade vor der Haustür an, als zwei Polizisten und ein Mann in Zivil herbeieilten.
Chefinspektor Rater war zu einem bestimmten Zweck in die Gegend gekommen, aber als er das laute Alarmsignal horte, verfolgte er seine eigenen Pläne nicht weiter, sondern wandte sich der neuen Aufgabe zu.
Atemlos erzählte der Polizist, was vorgefallen war, während er mit dem Chefinspektor in die hintere Nebenstraße zurückkehrte.
»Schon gut«, sagte der Redner ungeduldig. »Einer von den Leuten bleibt vor der Haustür und rührt sich nicht von der Stelle.«
»Wo ist die junge Dame?«
Harry hatte weder etwas von ihr gesehen noch gehört. Er äußerte aber die Meinung, daß sie wahrscheinlich ohnmächtig geworden sei. Als Familienvater wußte er aus Erfahrung, was Frauen zustoßen kann, wenn sie sich zu sehr aufregen.
Der Chefinspektor war schon halb die Treppe hinaufgestiegen und hörte nicht mehr, was Harry zur Erklärung vorbrachte.
»Das ist das Zimmer«, rief Simpson.
Der Redner drückte die Türklinke herunter.
»Verschlossen«, sagte er kurz, bückte sich und schaute durch das Schlüsselloch.
Er konnte sehen, daß die Glastür zum Balkon weit offenstand, wandte sich um und stellte eine Frage.
»Ja, ich habe sie aufgelassen. Am Geländer war ein Tau angebunden. Der Täter muß auf diese Weise entkommen sein.«
»Helfen Sie mir«, erwiderte der Redner.
Mehrmals stießen die beiden gleichzeitig mit ihren kräftigen Schultern gegen die Füllung. Plötzlich brach das Schloß, und die Tür sprang auf ...
»Na, wo ist denn der Tote?«
Simpson starrte bestürzt auf den Boden, aber an der Stelle, wo der Ermordete noch eben gelegen hatte, war nichts mehr zu sehen. Das Zimmer war vollkommen leer!
Mr. Rater schaute erst auf den Polizisten, dann auf den Boden und schließlich zum Fenster hinaus. Im gleichen Augenblick dachte er an das Haus des Marquis Perello, das auf der anderen Seite des Platzes lag. Aus zwei Gründen dachte er daran. Erstens war Len Witlon in London, und zweitens befanden sich drüben in einem nicht allzu sicheren Safe vier Päckchen geschliffener Smaragde, die erst vor ein paar Tagen aus Argentinien angekommen waren. Die Steine sollten an eine hohe Persönlichkeit in Italien abgeliefert werden. Der Marquis hatte die Polizei benachrichtigt, und der Redner hatte deshalb einen Polizeiposten vor und hinter dem Hause aufgestellt. Er kannte die Namen der beiden Beamten und lehnte sich über das Geländer.
»Ist Walton hier?«
»Jawohl.«
»Martin auch?«
»Jawohl!« ertönte eine zweite Stimme.
»Ich möchte nur wissen, warum ausgerechnet Sie hierhergelaufen sind! Sie sollten doch drüben auf Ihrem Posten bleiben!«
Mr. Raters Schrecken war nicht gering, denn er wußte, wie schnell Len Witlon arbeitete. Er wartete nicht erst, bis die Haustür geöffnet werden konnte, sondern ließ sich an dem Tau auf die Straße hinunter. Fünf Minuten später klopfte er an der Haustür des Marquis Perello. Aber er mußte lange warten. Der Marquis war mit seiner Frau im Theater, die drei Dienstmädchen hatte man im oberen Geschoss eingeschlossen, und der Hausmeister, der mit geladener Pistole den Safe bewachen sollte, lag im Wohnzimmer bewußtlos auf dem Boden. Er war mit einem stumpfen Gegenstand niedergeschlagen worden. Und der Safe stand offen.
»Len hat mit vier Leuten gearbeitet«, erklärte der Redner mit philosophischer Ruhe.
Len Witlon arbeitete stets auf diese Weise. Also hatte Mr. Rater keine große, neue Entdeckung gemacht. Wenn ein Streich gelungen war, trennten sich die Komplicen und verließen das Land auf verschiedenen Wegen.
Len machte niemals den Fehler, auf althergebrachte Weise vorzugehen; seine Methoden waren originell und einzigartig. Niemand außer Len hätte ein möbliertes Haus am Burford Square gemietet, um dort mit vieler Mühe einen Mord vorzutäuschen. Dadurch versammelte er die ganze Polizei der Gegend an dem vermeintlichen Ort des Verbrechens und lenkte ihre Aufmerksamkeit von dem anderen Haus ab, in das er einbrechen wollte.
Eine genaue Durchsuchung des Gebäudes brachte nichts Neues an den Tag, nur fand man im Kamin des Speisezimmers eine Anzahl verkohlter Papiere und einen kleinen roten Zettel, der nur halb angebrannt war. Die Aufzeichnungen darauf handelten offenbar von Reisewegen, Berechnungen von Fahrpreisen und dergleichen mehr. Mr. Rater steckte ihn sorgsam in die Tasche und zog möglichst viele Erkundigungen ein. Der einzige Anhaltspunkt wurde am nächsten Morgen von einem Polizisten geliefert, der an der Ecke der Queen Victoria und der Cannon Street den Verkehr regelte. Er hatte einen Wagen mit einer Dame beobachtet. Ganz sicher war er allerdings nicht, daß es sich wirklich um eine Frau gehandelt hatte. Aber er nahm es an. Sie schlüpfte gerade in ein Kleid, als er sie sah, und Kopf und Oberkörper waren davon verdeckt.
Die Nachforschungen auf dem Bahnhof Cannon Street blieben erfolglos, denn dort war während der fraglichen Zeit keine Dame in einem Auto angekommen. Sie mußte also weiter nach Osten gefahren sein.
Der Redner war ein guter Psychologe und kannte auch den Charakter des Verbrechers. Witlon war gegen Damen stets zuvorkommend und hatte sich bestimmt davon überzeugt, daß seine schone Verbündete in Sicherheit war.
Polizist Simpson war vollständig niedergeschmettert, daß sich sein erster Mordfall wieder in Dunst und Nebel aufgelöst hatte. Der Redner fragte ihn nach der Dame, die um Hilfe gerufen hatte.
»Sie sprach mit einem fremden Akzent«, erwiderte Simpson.
»Ich will jedes Wort hören, das sie Ihnen gesagt hat.«
Der Polizist dachte intensiv nach und rieb sich eifrig seine Stirn, um seinem Gedächtnis nachzuhelfen. Aber er hatte die Unterredung vollkommen vergessen.
»Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Es ist mir nur aufgefallen, daß sie trotz allen Stöhnens und Seufzens nach ihrer Armbanduhr sah. Das habe ich zweimal genau beobachtet.«
»Es war doch gegen elf?«
Der Polizist meinte, es wäre etwas später gewesen.
»Die Sache ist mir jetzt vollkommen klar«, sagte Mr. Rater.
Als Simpson gegangen war, zog der Redner einen kleinen Briefumschlag mit dem halbverbrannten roten Zettel aus der Tasche und rekonstruierte die Aufzeichnungen ...
Ein britischer Torpedobootzerstörer sichtete eines Morgens im Golf von Biskaya den Passagierdampfer »Emil«. Bald holte er ihn ein und signalisierte dem Kapitän zu stoppen. Es war ein Vergnügungsdampfer, der eine Reisegesellschaft nach Marokko und Madeira bringen sollte. Von London war er um Mitternacht abgefahren, kurz nach dem Einbruch im Hause des Marquis Perello.
Die hübsche Spanierin Avilez, die sich auch unter den Passagieren befand, wurde von allen als Schönheit bewundert. Erst im letzten Augenblick war sie an Bord gekommen. Sie protestierte heftig gegen ihre Verhaftung und hätte bei dem Versuch, ein kleines Paket über Bord zu werfen, beinahe das Tintenfass über ihr Tagebuch geschüttet.
Das war recht seltsam, denn das Päckchen enthielt siebzehn geschliffene Smaragde, von denen keiner unter zehn Karat hatte.
Kurz nach ihrer Ankunft in London verhörte Mr. Rater die Gefangene. Alle seine Fragen beantwortete sie mit einem Hochmut, wie man ihn nur bei Spanierinnen findet.
Am nächsten Morgen erschien in der Londoner Presse eine Mitteilung, die der Redner selbst sehr sorgfältig ausgearbeitet hatte. Schriftlich drückte er sich etwas ausführlicher aus als mündlich.
Ein Teil der Beute aus dem Einbruch bei Marquis Perello ist bei der Verhaftung einer gewissen Inez Avilez gefunden worden. Der Leiter der Bande, die den überaus schlau durchdachten Plan zur Ausführung brachte, hat dieser jungen Dame offensichtlich einen Weg zur Flucht angegeben, den man leicht verfolgen konnte. Dadurch hat er sich selbst in Sicherheit gebracht. Wahrscheinlich wollte er sie nur als Lockvogel benützen, um die Aufmerksamkeit von sich selbst abzulenken.
Und einen Tag nach der Verurteilung der schönen Spanierin brachten die Zeitungen eine zweite, wohlberechnete Notiz, die ebenfalls der Redner verfaßt hatte.
Diese Frau wurde kaltblütig von dem Mann geopfert, der den Einbruch plante, und sie muß nun die Strafe für sein Verbrechen büßen.
»Ich habe Witlon jetzt so gut wie sicher«, berichtete der Redner kurz.
Seine Vorgesetzten wußten jedoch, daß nicht die geringsten Anhaltspunkte vorlagen, um Len Witlon mit diesem Verbrechen in Zusammenhang zu bringen. Im Gegenteil, er hatte ein vollkommenes Alibi und konnte Zeugen dafür benennen, daß er sich zur Zeit des Einbruchs in Frankreich aufgehalten hatte.
»Auch ich bin ein Gedankenleser«, erwiderte der Redner, als sie ihn um Auskunft fragten. »Gerade in diesem Moment weiß ich, was Witlon sagt und plant. Und was er gerade in dieser Minute über mich äußert, ist so gemein, daß ich mich noch im Grabe umdrehen könnte. Aber glücklicherweise bin ich noch nicht tot.«
Mr. Len Witlon hatte einen hervorragenden Helfer, einen gewissen Mr. John B. Stimmings, der ihn auf seine Aufforderung hin in Aix besuchte. Stimmings ahnte allerdings nicht in welcher Gemütsverfassung sich sein Herr und Meister befand.
»Die Sache mit Inez ist sehr unangenehm«, meinte er, als er in das prachtvoll ausgestattete Wohnzimmer trat und die Tür schloß. »Sie ist allerdings tüchtig und gerissen, und ich möchte wetten, daß Rater sie nur durch einen Trick gefangen hat. Sie ist in eine Falle gegangen.«
»Dazu ist der Mensch doch viel zu dumm«, entgegnete Len erregt. Sein sonst so hübsches Gesicht war von Wut und Ärger entstellt. »Den Redner nennen sie ihn? Na, ich werde ihn schon zum Reden bringen! Sehen Sie sich einmal das an!«
Er warf zwei Zeitungsausschnitte auf den Tisch.
»Mir konnte er selbstverständlich nichts anhaben. Die Geheimpolizei ist am nächsten Morgen bei mir gewesen, aber ich lag friedlich in meiner Villa in Auteuil im Bett.«
»In Paris erzählt man sich, daß Sie bald aus Frankreich ausgewiesen werden sollen –«
»Das ist doch purer Blödsinn. Die wissen ganz genau, daß ich in Frankreich nichts anrühre. Aber ich werde nach England gehen und mir diesen Redner einmal vornehmen!«
Mr. Stimmings sah ihn bestürzt an.
»Da mache ich aber nicht mit«, erklärte er sofort. »Für mich lösen Sie keine Fahrkarte, und für sich brauchen Sie kein Retourbillett zu nehmen. Ich glaube, Sie sind verrückt!«
Die Andeutung, daß sein Plan nichts taugte, entlockte Len nur ein verächtliches, mitleidiges Lächeln.
»Sie kennen mich doch, Stimmings. Ich weiß genau, was dieser verfluchte Kerl denkt. Ich sehe direkt, wie es in seinem Kopf aussieht. Erinnern Sie sich noch, daß ich seinerzeit die Perlenkette der Infantin stahl und vier Tage später nach Madrid zurückfuhr? Hat mich da jemand erkannt? Ich will dem Redner einmal zeigen, was ich kann. Jetzt kommt mein Meisterstück – Sie werden staunen!«
Er hätte auch noch hinzusetzen können, daß es ein häßlicher Racheplan war, denn in einer schlaflosen, unruhigen Nacht dachte er ein Verbrechen aus, wie er es bisher noch nicht begangen hatte.
Eine Woche später kam ein älterer Engländer in London an, der sich in einem der besten Hotels als Oberst Pershin einschrieb. Er besaß einen britischen Reisepass und war offenbar ein nervöser, leicht reizbarer Herr, der keine besondere Beschäftigung hatte. Er wohnte im Wheetam-Hotel, das einerseits sehr abgelegen und ruhig, andererseits sehr elegant war. Mit besonderem Eifer las er die Zeitungen.
Ein paar Tage nach der Ankunft Pershins erhielt der Redner einen parfümierten Brief, der von einer Dame geschrieben sein mußte. Die Unterschrift lautete: »Eine, die es weiß.«
Wenn Sie wissen wollen, wo sich der Rest der gestohlenen Smaragde des Marquis Perello befindet, kann ich es Ihnen sagen. Da ich weiß, daß Sie als Polizeibeamter ein solches Versprechen nicht geben können, darf ich Sie auch nicht darum bitten, mir etwas darüber zu schreiben. Ich komme am Sonnabend um acht Uhr abends nach Scotland Yard. Werden Sie dann in Ihrem Büro sein?
Der Redner las diese Mitteilung mehrmals durch. Wenn Frauen die Hand im Spiel hatten, erschien ihm nichts unmöglich. Trotzdem hatte er den Eindruck, daß der Brief von Mr. Witlon oder in dessen Auftrag geschrieben worden war.
Lange Zeit stand er an seinem Fenster, sah auf das Themse-Ufer und den Fluß hinunter und versuchte, sich in die Lage seines Feindes zu versetzen.
Zu jener Zeit regierte in Scotland Yard ein sehr unbeliebter Abteilungsleiter, der den Redner nicht leiden konnte. Es war Major Dawlton, der seine frühere Dienstzeit bei der indischen Polizei zugebracht hatte. Er war ein unverbesserlicher Theoretiker und besaß außerdem die schlechte Eigenschaft, die ihm unterstellten Beamten bei der Ausübung ihrer Pflichten zu hindern.
Eines Tages ließ er den Redner zu sich ins Büro kommen.
»Hören Sie einmal, Mr. Rater«, begann er etwas von oben herab, »das kann aber nicht so weitergehen. Sie packen die Sache wieder ganz verkehrt an. Es ist doch unerhört, daß diese wertvollen Smaragde direkt unter der Nase der Polizei gestohlen worden sind – um so mehr bedauerlich, als Sie vorher gewarnt waren und den besonderen Auftrag hatten, den Eigentümer zu schützen. Haben Sie die Morgenzeitungen schon gelesen?«
»Ich kann keine Zeitungen lesen«, erwiderte der Chefinspektor müde und machte eine lange Pause, so daß sein Vorgesetzter vor Wut beinahe einen Schlaganfall bekam. »Ich meine, wenn ich etwas anderes zu tun habe.«
»Es ist ein Skandal, Mr. Rater! Wirklich, ich schäme mich schon vor meinen Freunden im Klub. Die erkundigen sich bereits, warum wir denn keine Privatdetektive einstellen. Und ich muß unter diesen Umständen beinahe glauben, daß sie recht haben.«
»Um Len Witlon zu fangen, brauchen Sie keine Privatdetektive. Dazu brauchen Sie Gedankenleser.«
»Was für ein Blödsinn!« entgegnete der Major heftig.
An diesem friedlichen Sonnabendnachmittag war es in Scotland Yard so heiß, daß die Doppelfenster offenstanden. Die verlassenen Werften und Lagerhäuser, die das südliche Ufer der Themse begrenzen, lagen im prallen Sonnenschein.
Die Straßenbahnen waren mehr oder weniger leer, und am Ufer gingen Männer mit ihren Frauen und Kindern spazieren.
Chefinspektor Rater nahm mit einem Seufzer den Klemmer ab, faltete den Brief, den er noch einmal gelesen hatte, und steckte ihn wieder in den Umschlag. Nachdenklich sah er durch das offene Fenster. Ein Schlepper zog eine Reihe von Kähnen, die mit Bauholz hoch beladen waren, langsam den Strom hinauf. Am Ufer lehnten ein paar Leute am Geländer.
Der Redner wandte sich um, als sich die Tür öffnete und Major Dawlton hereinkam. Ohne ein Wort zu sagen, reichte er seinem Vorgesetzten das Schreiben. Der Major klemmte das Monokel ins Auge, las und lächelte dann höhnisch.
»Da haben wir es wieder. Wenn heutzutage in Scotland Yard überhaupt noch etwas herauskommt, dann hat man es Zwischenträgern und Spitzeln zu verdanken. Ich möchte die Frau sehen.«
»Wenn sie kommt«, erwiderte der Redner gelassen.
»Sie glauben, daß es sich um einen dummen Scherz handelt? Der Ansicht bin ich durchaus nicht. Wahrscheinlich ist es eine eifersüchtige Verbündete, die schlecht behandelt worden ist. Solche Briefe sind täglich nach Scotland Yard gekommen, solange ich hier bin.«
»Ganz recht, sie sind gekommen, solange ich hier bin – also seit siebzehn Jahren.«
Der Major war wütend über diese anzügliche Bemerkung, sagte aber nichts darauf.
»Sie wird nicht kommen, aber er«, meinte der Redner nach einer kurzen Pause.
»Sie meinen Len Witlon? Unsinn! Wir wissen doch genau, daß er in Frankreich ist. Diese gemeinen Kerle tragen ihre Haut nicht so leicht zu Markt. Und sollte er tatsächlich kommen, dann haben wir genügend Beweismaterial, um ihn des Einbruchs und des Diebstahls zu überführen. Heute Abend um acht bin ich hier.«
»Kommen Sie lieber eine Viertelstunde später«, entgegnete der Redner giftig und sah seinen Vorgesetzten böse nach.
Major Dawlton saß vor dem Schreibtisch und gähnte.
»Sie hat Sie versetzt!« bemerkte er.
»Ich sagte Ihnen ja gleich, daß Sie nicht um acht kommen sollten.« Der Redner lehnte mit dem Rücken an der Wand und sah düster auf seinen Vorgesetzten herunter.
Der Major zog die Uhr.
»Eine Viertelstunde will ich noch zugeben –«
Im gleichen Augenblick summte ein Geschoss an ihm vorüber. Er fühlte es an dem scharfen, kurzen Luftzug und wandte sich erschrocken um. Das Glas einer gerahmten Fotografie splitterte, und die Scherben fielen klirrend zu Boden.
Einen Abschuss hatte man nicht gehört.
In der nächsten Sekunde sprang der Major auf und eilte ans Fenster.
Ein zweites Geschoss schlug in das Fensterbrett ein, prallte ab und riß Stuck und Putz von der Decke.
»Ich würde von dem Fenster weggehen«, warnte der Redner liebenswürdig. »Ich habe gehört, daß Len Witlon ein Scharfschütze ist. Allerdings dachte ich, er würde das Feuer von einem gegenüberliegenden Haus eröffnen. Die Sache mit dem Boot ist tatsächlich eine glänzende Idee!«
Dawlton war kreidebleich.
»Was, der Kerl schießt?« rief er. »Und dazu noch auf mich!«
»Die Kugeln galten mir«, erwiderte Mr. Rater nachdenklich. »Ich hoffe nur, daß unsere Beamten ihn fassen.«
Noch während er sprach, beobachtete er, wie zwei Motorboote der Strompolizei aus ihren Verstecken am Ufer in den Fluß glitten. Sie steuerten auf ein einzelnes Fahrzeug in der Mitte des Stromes zu.
»Es hat geklappt«, erklärte der Chefinspektor. »Jetzt haben wir wenigstens einen schwerwiegenden Grund, um ihm den Prozeß zu machen.«
»Nach mir zu schießen – unerhört!« beschwerte sich der Major, aber seine Stimme klang ängstlich.
»Ich habe Ihnen ja geraten, nicht zu kommen«, entgegnete der Redner. Der vergnügte Ausdruck seines Gesichts stand in krassem Gegensatz zu dem teilnehmenden Ton, in dem er sprach.
»Die Sache war gar nicht so schlecht ausgedacht«, berichtete Mr. Rater dem Polizeipräsidenten. »Witlon kannte meine Vorliebe für frische Luft. Er muß die Gegend vorher genau ausgekundschaftet und dabei entdeckt haben, wie leicht es ist, vom Fluß aus durch die offenen Fenster in mein Büro zu sehen. Daß er in England war, wußte ich natürlich – einer meiner Leute hat ihn erkannt, als er mit dem Dampfer von Le Havre in Southampton ankam.«
Der Polizeipräsident sah ihn durchdringend an.
»Aber Sie haben sich doch wohl nicht träumen lassen, daß er in Ihr Büro schießen würde? Sonst hätten Sie doch sicher dem Major nicht gestattet, daß er zu Ihnen kam?«
Der Redner seufzte tief und antwortete erst nach kurzer Überlegung.
»Ich glaube nicht«, sagte er dann langsam.