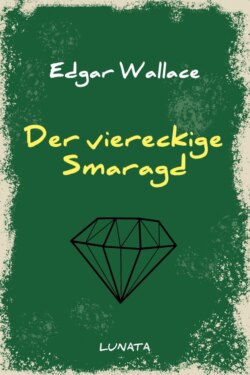Читать книгу Der viereckige Smaragd - Edgar Wallace, Edgar Wallace - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
Оглавление104 Several Street, Lambeth
Sehr geehrte Miss Maughan,
ich habe Unterkunft unter der obigen Adresse gefunden. Die Gegend ist nicht gerade die beste, aber das Zimmer ist ganz gut, obwohl meine Wirtin ein abstoßendes Frauenzimmer ist. Außerdem sind noch sechs Kinder hier im Haus, das jüngste ist erst einige Monate alt, das älteste ist ein Mädchen von acht Jahren. Daraus geht schon hervor, daß Mrs. Inglethorne, welche Fehler sie auch sonst haben mag, ihrem Vaterland durch reichlichen Nachwuchs gedient hat (sie trinkt Schnaps und hat ein feuerrotes Gesicht wie spanischer Pfeffer). Ich kaufe mir einen neuen Anzug und hoffe, daß ich in ein paar Tagen melden kann, daß ich vorwärtskomme ...
Leslie Maughan fand diesen Brief am folgenden Nachmittag, als sie von ihrem Büro nach Hause kam.
›Der Fall Dawlish‹, wie ihn Mr. Coldwell bezeichnete, obwohl sie selbst dieser Angelegenheit einen ganz anderen Namen beilegte, nahm im Schlafen und Wachen alle ihre Gedanken in Anspruch. Es war ihr erster größerer Fall, denn sie hatte sich früher noch niemals selbständig mit der Aufklärung einer Sache befassen können. Sie hatte allerdings schon mehrere aufsehenerregende Ereignisse miterlebt. Sie hatte Coldwell geholfen, den Mord im Kent-Tunnel aufzuklären. Als erste hatte sie damals den Eindruck gehabt, daß der Hauptzeuge, der der Polizei über die Tat berichtete, zu viel von der Tragödie wußte, um nicht selbst an dem Verbrechen beteiligt zu sein. Das führte später zur Klärung des ganzen Falles. Sie war es auch bei einer anderen Gelegenheit gewesen, die beim Durchsuchen der Taschen eines Gefangenen einen Flecken von unauslöschlicher Tinte auf einer Silbermünze fand. Auf diesen kleinen Anhaltspunkt hatte sie eine Theorie aufgebaut, die zu der Verhaftung der Flack-Bande und zur Auffindung der Druckmaschine führte, mit deren Hilfe die Verbrecher ganz Europa mit gefälschten Tausend-Franc-Scheinen überschwemmt hatten.
Leslie Maughan besaß eine außerordentliche Begabung für die Aufgaben eines Polizeidetektivs, und ihr feiner Instinkt für die Hintergründe einer Sache hatte ihre Vorgesetzten schon oft in Erstaunen und Bewunderung versetzt.
Und nun stellte sie wieder eine Theorie auf, allerdings auf schwachen Fundamenten, darüber war sie sich klar – auf einem kleinen Gedichtband, den sie in einem Landhaus in Cumberland gefunden hatte.
Wieder nahm sie ihn aus ihrem Bücherregal. Es war ein dünnes Buch mit Gedichten von Elizabeth Browning. Auf der ersten leeren Seite standen in hübscher Handschrift acht Zeilen in Gedichtform. Es waren ganz freie Verse, die nicht einmal besonders gut waren. Sie las sie wohl schon zum fünfzigsten Male. Dann legte sie das Buch wieder fort und ging zu ihrem Schreibtisch zurück. Dort saß sie eine halbe Stunde lang, stützte ihr Kinn in die Hände und schaute gedankenverloren auf die gegenüberliegende Wand. Sie konnte im Augenblick nichts mehr für Peter Dawlish tun, doch ihre Gedanken kehrten immer wieder zu ihm zurück.
Sie nahm aus einer Schublade die Zigarettenschachtel, die sie ihm am vorigen Abend angeboten hatte, und betrachtete sie zerstreut. Sie hatte ganz London abgesucht, um diese besondere Sorte ägyptischer Zigaretten zu bekommen, und hatte sie schließlich an einer Stelle gefunden, wo sie es am wenigsten erwartet hatte – in Scotland Yard. Der Polizeipräsident selbst, früher Offizier in Ägypten, ließ sie für sich von dort kommen.
Sie schloß die Schachtel wieder, packte sie ein und adressierte sie an ›Peter Dawlish Esq., 104 Several Street, London‹. Es war fast schon dunkel, als Lucretia ihr den Tee hereinbrachte.
»Heute Abend gehen Sie doch nicht mehr aus, Miss?« fragte sie. Leslie bejahte. »Aber dann nehmen Sie mich doch wenigstens mit?«
Leslie lachte durchaus nicht.
»Ich kann mir nur nicht vorstellen, wie Sie sich in einem Nachtklub ausnehmen, Lucretia.«
»Ich kann ja draußen warten«, bestand Lucretia energisch. »Ich würde es mir auch nicht im Traum einfallen lassen, in einen Nachtklub zu gehen – nach allem, was ich in den Zeitungen darüber gelesen habe. Ich habe gestern Abend eine Gesellschaft aus einem Auto steigen sehen – es waren Damen! Aber, gnädiges Fräulein, ich hätte ihre ganzen Kleider in meiner kleinen Handtasche unterbringen können. Ich kann so etwas nur schamlos nennen!«
Leslie lachte.
»Sie müssen verstehen, Lucretia, daß keine Dame glaubt, sie sei zu einer Abendgesellschaft richtig angezogen, wenn sie sich nicht entsprechend ausgezogen vorkommt – aber werden Sie nur nicht gleich ohnmächtig!«
»Ja, die Frauen sind nicht mehr das, was sie früher waren«, seufzte Lucretia.
Leslie war sich noch nicht ganz klar darüber, welche Taktik sie anwenden sollte. Mr. Coldwell hätte sie schon oft wegen ihres Glückes geneckt, aber ihr ›Glück‹ bestand eigentlich in ihrer außergewöhnlichen Begabung, und sie fühlte jetzt wieder, daß etwas Schicksalschweres in der Luft lag. Sollte sie Lady Raytham noch einmal besuchen und ihr diesmal nicht nur Andeutungen machen, sondern in ganz verständlichem, klarem Englisch zu ihr sprechen? Das würde sie keine besondere Anstrengung kosten, denn sie war vollständig frei von irgendwelchen Hintergedanken. Sie hatte sich heute morgen erkundigt, ob Lady Raytham ihre Drohung ausgeführt und sich schriftlich an den Polizeipräsidenten gewandt hatte. Aber anscheinend hatte sie ihre Absicht nicht ausgeführt. Hätte Peter Dawlish ihr von dem Überfall berichtet, der auf ihn gemacht worden war und der ihn auf so überraschende Weise in das Haus von Mrs. Inglethorne führte, so wäre sie schon früher nach Berkeley Square gegangen. Aber Peter hatte sich darüber ausgeschwiegen, und Leslie erfuhr erst am nächsten Tag von seinem Erlebnis.
Sie ging in ihr Schlafzimmer und zog sich um. Sie wollte an diesem Abend mit Mr. Coldwell bei Ambassadors speisen, das manchmal von Uneingeweihten als Nachtklub bezeichnet wurde, in Wirklichkeit aber ein Mittelpunkt des vornehmen Londoner Lebens war. Sie wählte ein durchbrochenes Spitzenkleid, das Lucretia nur mit moralischem Abscheu betrachtete, dann nahm sie ihren schweren Pelzmantel um und zog ein paar Überschuhe über ihre leichten, eleganten Abendschuhe. Schließlich schickte sie Lucretia fort, um ein Taxi zu holen. Um Viertel nach sieben klingelte sie am Haus Nr. 377, Berkeley Square. Die Tür wurde sofort von einem Diener geöffnet.
»Haben Sie eine Verabredung mit Mylady?« fragte er, als er die Tür hinter ihr schloß.
»Nein, sie hat keine Verabredung mit Mylady!«
Leslie drehte sich erstaunt um, als sie die laute, raue Stimme hinter sich hörte. Es war Druze, der durch eine Tür unter der Treppe in die Eingangshalle getreten war. Sein sonst blasses Gesicht war rot und aufgedunsen, sein Haar ungeordnet, und er hatte einen großen Flecken auf seinem weißen Vorhemd. Mit unsicheren Schritten kam er auf sie zu. Er war betrunken und in diesem Zustand ein ganz anderer als sonst.
Der Charakter des Mannes schien völlig verändert zu sein. Früher war er immer achtsam, geräuschlos und rücksichtsvoll gewesen, jetzt aber war er laut, unangenehm und aufdringlich.
»Sie können machen, daß Sie fortkommen – packen Sie sich, wir können Sie hier nicht gebrauchen!«
Er ging drohend auf Leslie zu, aber sie bewegte sich nicht. Der zweite Diener hatte sich zurückgezogen und beobachtete aus dem Hintergrund mit unterdrückter Schadenfreude das merkwürdige Betragen seines Vorgesetzten.
»Können Sie nicht hören, was ich sage? Scheren Sie sich fort, wir dulden hier keine herumspionierenden Polizistinnen!«
Es sah so aus, als ob er Gewalt anwenden wollte, um sie hinauszuwerfen, aber er hatte seine Hand kaum erhoben, als sie mit leiser Stimme etwas zu ihm sagte – es war nur ein Wort. Plötzlich senkte sich die große fleischige Hand wieder, das Rot wich aus seinem Gesicht, und er sah sie bestürzt an. Als Leslie Maughan nach oben schaute, bemerkte sie Lady Raytham an der Treppe.
»Kommen Sie bitte herauf.«
Ihre Stimme klang hart und metallisch, es lag nichts Herzliches und Liebenswürdiges in dieser Begrüßung. Aber Leslie hatte das auch nicht erwartet. Sie stieg hinauf. Bevor sie aber das obere Treppenpodest erreichen konnte, hatte sich Lady Raytham schon umgewandt und ging ihr voraus in den anstoßenden Salon. Leslie trat ein und bemerkte, daß Jane nicht allein war. Vor dem Kaminfeuer stand eine ihr bekannte große, stattliche Dame mit kurzgeschnittenem Haar und Monokel, die sie mit einem durchdringenden, fast feindlichen Blick musterte.
Der Unterschied zwischen den beiden Frauen war verblüffend. Lady Raytham hatte niemals schöner, lieblicher und eleganter ausgesehen als in diesem Augenblick. Auch sie war in Gesellschaftskleidung und wollte ausgehen. Sie trug ein prachtvolles Kleid aus altgoldenen Spitzen, und um ihren Hals hing eine Kette von herrlichen Smaragden, die ihren Abschluss in einem Anhänger fand, einem einzigen, viereckigen Stein, der allein ein Vermögen gekostet haben mochte. Anita Bellini trug ein feuerrotes Kleid. Es war von einer flammenden, grellen Farbe, die kaum einer anderen Frau gut gestanden hätte, sonderbarerweise aber sehr gut zu ihr paßte. Dicke Armbänder aus Jade und ein Halsschmuck aus Rubinen umgaben sie mit einer fast barbarischen Pracht.
»Es tut mir leid, daß Sie sich hierherbemüht haben, Miss Maughan – es ist in doppelter Weise unangenehm. Hätte sich Druze nicht so empörend gegen Sie benommen, so hätte ich Sie nicht empfangen. Aber unter diesen Umständen fühle ich mich verpflichtet, mich wenigstens bei Ihnen wegen seines ungebührlichen Benehmens zu entschuldigen.«
Leslie nickte leicht mit dem Kopf. Was sie zu sagen hatte, konnte sie nicht vor dieser großen Frau mit dem harten Blick erklären, die mit dem Rücken gegen den Kamin gelehnt stand, die unvermeidliche Zigarette zwischen den Lippen hielt und sie aus dem blitzenden Monokel ansah.
»Wenn es möglich ist, möchte ich Sie allein sprechen, Lady Raytham.«
»Es gibt nichts, das Sie mir nicht auch in Gegenwart der Prinzessin Bellini sagen könnten.«
Anita klopfte die Asche ihrer Zigarette in das Kaminfeuer, ohne ihr Gesicht abzuwenden.
»Vielleicht möchte Miss Maughan nicht in Gegenwart einer Zeugin sprechen«, sagte sie dann mit ihrer harten Stimme. »Wenn ich an Lady Raythams Stelle wäre, würde ich Sie wegen der gestrigen Vorkommnisse bei Ihrer vorgesetzten Behörde angezeigt haben, so daß Sie Ihre Stelle im Polizeipräsidium verloren hätten.«
Leslie lächelte schwach.
»Wenn Sie Lady Raytham wären, würden Sie noch viele andere Dinge tun, Prinzessin, so daß dieser Schritt vollständig überflüssig wäre.«
Anita sah sie unentwegt an. »Wie meinen Sie das?«
Wenn sie erwartet hatte, die junge Dame durch diese Frage zu erschrecken, so wurde sie enttäuscht, denn Leslie lächelte nur.
»Wir sind jetzt so weit gekommen«, sagte sie gutgelaunt, »daß ich nicht vor Zeugen sprechen möchte – obwohl ich vielleicht eines Tages vor mehr Zeugen spreche, als Sie in einem doppelt so großen Raum wie diesem unterbringen können. Ich könnte vor so vielen Zeugen auftreten, Prinzessin, wie in dem großen Gerichtssaal von Old Bailey Platz haben.«
Sie sagte dies, ohne ihre Stimme besonders zu erheben, und jetzt war Anita Bellinis innere Erregung zu erkennen. Das Monokel fiel aus ihrem Auge, sie fing es geschickt auf und klemmte es umständlich wieder ein. Der große, harte Mund öffnete sich ein wenig, aber sie fing sich gleich wieder.
»Das klingt fast so, als ob Sie mir drohen wollten«, erwiderte sie heiser. »Miss Maughan, ich glaube, Sie werden Ihre Stelle doch verlieren.«
»Bevor ich meine Stelle verliere, Prinzessin, werden Sie auf eine große Einnahmequelle verzichten müssen«, antwortete Leslie schlagfertig. Sie wartete nicht auf Antwort, sondern wandte sich an Lady Raytham.
»Kann ich allein mit Ihnen sprechen?«
Janes Stimme zitterte ein wenig, und sie schien sehr verwirrt zu sein, als sie jetzt atemlos erwiderte:
»Ich habe Sie empfangen, um mich bei Ihnen wegen Druzes Betragen zu entschuldigen, und Sie haben die Gelegenheit benutzt, um meine Freundin zu beleidigen, eine Dame, die –«
Ihre Stimme wurde heiser, und sie hielt inne.
Leslie erkannte, daß sie nichts weiter ausrichten konnte, wenn sie ihre Fragen nicht in Gegenwart der Prinzessin Bellini vorbringen wollte. Aber sie hatte ja gerade die Absicht, vor dieser Frau alles geheimzuhalten. Sie hatte ihren Mantel geöffnet, als sie die Treppe hinaufgestiegen war. Lady Raytham sah ihr mauvefarbenes Spitzenkleid. Prinzessin Anita Bellini lächelte, sie hatte eine Schwäche für Pariser Modelle.
»Sie scheinen bei der Polizei sehr gut zu verdienen, meine junge Freundin«, sagte sie boshaft. »Wer ist denn der Glückliche, der Ihre Kleiderrechnungen bezahlen darf?«
»Mein Rechtsanwalt – bis ich fünfundzwanzig Jahre alt geworden bin«, erwiderte Leslie prompt.
»Ein glücklicher Rechtsanwalt – wer ist es denn?«
Leslie lächelte.
»Sie müßten ihn eigentlich sehr gut kennen, er hat Sie damals bei Ihrem Konkurs vertreten.«
Mit diesem letzten Trumpf verließ sie den Raum.
Eine halbe Stunde später entfaltete Mr. Coldwell seine Serviette und schüttelte ernst den Kopf.
»Das war unvorsichtig von Ihnen. Wann haben Sie denn eigentlich entdeckt, daß die Prinzessin Bankrott gemacht hat? Ich muß gestehen, daß mir das neu ist.«
Leslie lachte ein wenig verlegen.
»Ich lese eben Amtszeitungen. Ich kann mir nicht helfen, aber ich finde sie interessanter als die besten Liebesnovellen, die irgendein junges Mädchen geschrieben hat. Dieser Bankrott wurde vor zehn Jahren so lautlos und ruhig wie möglich abgewickelt. Die Prinzessin nahm ihren Wohnsitz in einem kleinen Landstädtchen, bevor sie ihre Zahlungsunfähigkeit bei Gericht anmeldete, und es ist doch so leicht, Vorgänge, die sich in der Provinz abspielen, aus den Londoner Zeitungen fernzuhalten. Damals hatte sie auch ihren hochtönenden Titel abgelegt und bezeichnete sich nur als Mrs. Bellini. Es gibt kein Gesetz in diesem Lande, das dazu zwingt, fremde Titel zu gebrauchen.«
»Außerordentlich tüchtig«, sagte Mr. Coldwell halb zu sich selbst. »Und sie hat Sie nicht gelyncht, als Sie ihr das sagten?«
»Sie war ein wenig betroffen«, erwiderte Leslie. »Aber Druze – der ist aus der Rolle gefallen! Das beunruhigt mich.«
»Ich wüßte nicht, warum Sie sich deshalb Sorgen machen sollten.« Mr. Coldwell winkte einem Kellner.
Als er ihm seinen Auftrag erteilt hatte, sprach er weiter.
»Wissen Sie, daß Sie mich dauernd überzeugen möchten, daß etwas Großes hinter diesem geheimnisvollen Fall Dawlish steckt? Ich meine damit nicht die eventuelle Entdeckung, daß Druze selbst der Fälscher ist. Ich glaube auch nicht, daß wir das jemals beweisen können.«
In diesem Augenblick erschien eine große Dame in dem Speisesaal und schaute sich um. Sie trug eine Hornbrille mit verhältnismäßig starken Gläsern. Ihr Gang war aufrecht, ihre Gestalt schlank, und eine Fülle weißen Haares rahmte ihr Gesicht ein. Etwas Strenges und Herbes lag über ihrer Erscheinung. Sie grüßte Mr. Coldwell durch ein kurzes Nicken und ging dann auf den Geschäftsführer zu.
»Das ist die Mutter«, sagte der Chefinspektor.
»Wessen Mutter?«
»Ihres interessanten Sträflings.«
»Margaret Dawlish?« Leslie war erstaunt. »Hier hätte ich sie kaum erwartet.«
»Sie speist jeden Abend hier, und ich glaube auch den Grund dafür zu kennen.«
Leslie betrachtete Peters Mutter. Das eckige, harte Kinn, die dünnen Lippen, die tiefliegenden Augen – alles stimmte so ganz zu dem Bild, das sie sich von ihr gemacht hatte.
»Wissen Sie, was ich täte, wenn Sie nicht hier wären?« fragte sie schließlich.
»Tun Sie es ja nicht, was es auch sein mag«, sagte Coldwell.
Sein Verhältnis zu Leslie war recht merkwürdig. In vergangenen Tagen war er der erste Assistent Mr. Maughans gewesen. Obwohl er damals nur den Rang eines Sergeanten hatte, wurde er von diesem hochbegabten Polizeibeamten doch ganz ins Vertrauen gezogen und brachte das Wochenende fast immer in dem Landhaus seines Vorgesetzten zu. So kam es, daß er der mutterlosen Tochter Mr. Maughans gegenüber allmählich die Stelle eines Erziehers und Schutzengels einnahm. Solange sie sich darauf besinnen konnte, hatte Josiah Coldwell stets eine große Rolle in Leslies Leben gespielt. Er war einer der fähigsten Gehilfen ihres Vaters, sein bester Freund, und es war nur natürlich, daß er ihr Anwalt und Beschützer wurde, als sie sich entschloß, den Detektivberuf zu ergreifen.
Es dauerte nicht lange, bis er seine Einwilligung gab. Zuerst freilich hatte er ihr Vorhaben abweisend behandelt. Als sie festblieb, war er sehr ernst und dann traurig geworden, aber sie setzte ihren Willen doch durch.
»Wenn Sie mir nicht gestatten, Onkel Josiah, in Scotland Yard Dienst zu tun, so gehe ich zu einem Privatdetektiv.«
Mit dieser Drohung hatte sie natürlich sofort gewonnenes Spiel, denn Privatdetektive waren in den Augen dieses guten Beamten ganz verächtliche Leute. Später war er sehr stolz darauf, daß es ihr gelang, in Scotland Yard vorwärtszukommen. Und, um die Wahrheit zu sagen – er wäre sehr niedergeschlagen gewesen, wenn sie jetzt müde geworden wäre und sich in das Privatleben hätte zurückziehen wollen.
Er sagte ihr dies nicht – sie hatte es schon längst selbst herausgefühlt; aber er brachte die Unterhaltung auf eine andere Sache, die ihn schon seit langer Zeit beunruhigte. Als die Kapelle mit einem schnellen Fox begann, wozu sie sich aufmunternd erhob, seufzte er und stand auch auf.
»Ich wäre sehr froh, Leslie, wenn Sie einen jungen Mann fänden, der nach diesen verteufelt modernen Jazzmelodien mit Ihnen tanzt. Wie können denn die vornehmen Verbrecher Londons noch Respekt vor mir haben, wenn ich öffentlich auf dem Tanzboden mit Ihnen erscheine?«
Mr. Coldwell war trotz seiner sechzig Jahre an diesem Abend der beste Tänzer; aber er liebte es, von seiner ›Gebrechlichkeit‹ zu sprechen.
»Ich scheine nicht ganz normal veranlagt zu sein«, meinte Leslie, als er sie durch die Reihen der Tische auf ihren Platz zurückführte. »Junge Männer machen auf mich wenig oder gar keinen Eindruck.«
Mr. Coldwell schaute auf sie herunter.
»Gehören Sie auch zu diesen modernen jungen Damen, die sich nichts aus der Liebe machen?« fragte er ernst. »Ich kann mir das kaum vorstellen.«
Leslies Blicke schweiften in dem Raum umher und blieben schließlich wieder auf Mrs. Margaret Dawlish haften, dieser Frau mit den harten, unbeugsamen Gesichtszügen. Wie merkwürdig war doch die Vorstellung eines Durchschnittsmannes von einer Durchschnittsfrau. Die übliche, sanfte, milde Mutter, die immer bereit war, alles zu ertragen und ihren Kindern alles zu verzeihen, gab es auch in Wirklichkeit, sie war kein Phantasiegebilde. Aber die Ausnahmen waren zahllos. Leslie hatte, so unglaublich es auch klingen mochte, eine Mutter gesehen, die in ihrer Wohnung tanzte, während ihr Kind in einem Krankenhaus, ein paar Straßen entfernt, im Sterben lag. Sie kannte Mütter, die von ihren Töchtern nicht sprechen konnten, ohne in Zorn und Wut zu geraten. Und dies war nun der vierte Fall, daß eine Mutter ihren einzigen Sohn einfach aus dem Leben und dem Dasein strich, als ob er überhaupt nicht existierte, weil er sich vergangen hatte – nicht einmal gegen sie, sondern gegen das Gesetz, das die menschliche Gesellschaft aufgestellt hatte.
Mrs. Margaret Dawlish saß allein und aufrecht an einem kleinen Tisch. Wenn der Geschäftsführer sich ihr verbindlich lächelnd näherte, fertigte sie ihn mit einigen Worten ab, hob dann ihre Lorgnette und beobachtete die Tänzer.
»Diese Frau hat ein Herz aus Granit«, sagte Leslie, als die Kapelle zu spielen aufhörte.
»Meinen Sie Mrs. Dawlish? Ja, ich glaube, sie ist hart und unerbittlich. Es bedeutet sehr viel für sie, daß sie sich hier überhaupt sehen läßt. Sie haßt diese Gesellschaft und dieses Lokal, aber seit Jahren, seitdem ihr Sohn ins Gefängnis kam, speist sie hier zu Abend.«
Leslie nickte.
»Das ist doch nur eine trotzige Geste. Sie will sich eben sehen lassen. Ach, diese Leute der vornehmen Gesellschaft! Sie wagen nicht, ein Zimmer zu verlassen, aus Furcht, daß jemand hinter ihrem Rücken über sie sprechen könnte.«
Es war gegen elf Uhr, und Mr. Coldwell hatte eben um die Rechnung gebeten, als er ans Telefon gerufen wurde.
»Ich nehme an, der Anruf kommt vom Amt – entschuldigen Sie mich einen Augenblick, Leslie.«
Er bahnte sich einen Weg durch die tanzenden Paare und blieb etwa zehn Minuten fort. Als er wieder zurückkam, sah sie, daß er die Stirn runzelte.
»Die Kingston-Station glaubt, eine Spur dieser schrecklichen Autobanditen gefunden zu haben.«
Er meinte damit eine Bande, die zu jener Zeit die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Es waren drei Leute, die in gemieteten oder gestohlenen Autos den südlichen Teil Londons unsicher machten, einsam gelegene Villen oder Wohnhäuser überfielen, die überraschten Einwohner mit vorgehaltenen Pistolen in Schach hielten und alles irgendwie transportfähige Gut raubten, das ihnen in die Hände fiel.
»Ich werde Sie nach Hause begleiten«, sagte er, als er die Rechnung bezahlt hatte, »und dann will ich selbst nach Kingston fahren. Ich wünschte bei Gott, daß diese eifrigen Beamten ihre Entdeckungen zu einer besseren und angebrachteren Stunde machten.«
»Ich möchte mit Ihnen gehen, ich bin nicht im mindesten müde, und es ist eine so schöne Mondnacht!«
Er sah sie etwas zweifelnd an.
»Ich weiß nicht, ob Ihr Kleid gerade das richtige Kostüm für diesen Anlass ist. Aber wenn Sie durchaus wollen, können Sie mitkommen. Ich habe einen Wagen von der Polizeidirektion bestellt, er wird in einigen Minuten hier sein.«
Sie ging zur Garderobe, um eine wollene Strickjacke überzuziehen, die sie vorsorglich mitgenommen hatte; darüber zog sie dann ihren Mantel an. Sie hatte die Wahrheit gesprochen – sie war vollständig wach. Irgendwie war sie an einem toten Punkt angekommen und freute sich, noch ein wenig dienstliche Arbeit zu tun, bevor sie sich zur Ruhe legte, obgleich sie von vornherein wußte, daß sie nur die Rolle eines Zuschauers spielen würde.
Die Fahrt versprach, um so interessanter zu werden, weil sie gerade heute die Personalien von drei vorbestraften Männern durchstudiert hatte, die im Verdacht standen, mit den Autobanditen identisch zu sein. Es waren keine besonderen oder außergewöhnlichen Menschen. Die erstaunlichste Erfahrung, die Leslie in Scotland Yard gemacht hatte, war, daß die Verbrecher meistens mittelmäßige und bedeutungslose Leute waren – arbeitslose Fabrikarbeiter, Chauffeure, Handlungsgehilfen, manchmal auch ein Handwerker. Eigentlich zeichneten sich nur die Frauen durch größere Individualität aus. Fast alle Verbrecherinnen hatten etwas Romantisches an sich. Ihre Schicksale waren sehr verschieden voneinander – und ihr Unternehmungsgeist und ihre Erfindungsgabe waren manchmal faszinierend.
Leslie trat durch die Drehtür auf die Straße. Die Nacht war bitter kalt, der Himmel klar und mit Sternen übersät. Der helle Mondschein, den sie erwartet hatte, war allerdings nicht vorhanden, aber sonst waren alle Bedingungen für eine schöne Nachtfahrt gegeben.
Ein Sportkabriolett mit vielen Wolldecken auf den Sitzen war vorgefahren. Schnell fuhren sie durch Kensington, über die Hammersmith-Brücke, und in unglaublich kurzer Zeit sausten sie Kingston Vale hinunter. Der Chauffeur hielt vor der Polizeiwache hinter einem großen, leeren Auto, und sie stiegen aus.
Im Dienstzimmer fanden sie den Inspektor im Gespräch mit einem Mann von mittleren Jahren, der offenbar der Besitzer des Wagens vor der Tür war.
»Es tut mir leid, daß ich Sie hierher bemüht habe, Mr. Coldwell«, sagte der Beamte, »aber die Geschichte, die ich hier soeben höre, klingt ganz so, als ob sie auf das Konto dieser Autobanditen käme.«
Der fremde Mann war der Eigentümer eines kleinen Autoverleihs. Am Nachmittag war ein anscheinend anständiger Mann zu ihm gekommen und hatte ihn gebeten, nach London zu fahren, um dort mit ihm wegen einer größeren Fahrt zu verhandeln. Der Besitzer der Garage hatte zufällig in der Stadt zu tun und hatte den anderen später in einem kleinen Restaurant in der Brompton Road getroffen.
»Es schien alles in Ordnung zu sein«, fuhr der Mann in seiner Erzählung fort. »Erst als ich nach Hause zurückkehrte, kam mir ein Verdacht. Er bat mich nämlich, ihn am Ende von Barnes Common in der Nähe der Wimbledon Road heute Abend gegen genau um ein Viertel nach zehn abzuholen. Von dort sollte ich ihn dann nach Southampton fahren. Er verlangte einen geschlossenen Wagen, aber ich sagte ihm, daß ich über keinen solchen Wagen verfüge, der eine so lange Fahrt machen könne, und daß ich den Auftrag ablehnen müsse. Als er mir dann aber den doppelten Preis anbot, den ich unter gewöhnlichen Umständen verlangt hätte, und mir die Hälfte der Summe im voraus zahlte, willigte ich ein.«
»Haben Sie ihn denn gefragt, warum er zu einer so ungewöhnlichen Zeit nach Southampton fahren wollte?«
»Das war sogar das erste, was ich in Erfahrung brachte. Er erzählte mir, daß er mit einigen Freunden zu Abend speisen wollte und deshalb den Schnellzug, der in Verbindung mit den Kursdampfern steht, nicht erreichen könnte – die ›Berengaria‹ fährt morgen früh um fünf Uhr ab, und alle Passagiere müssen schon während der Nacht an Bord sein. Es war nicht das erste Mal, daß ich eine solche Fahrt gemacht hatte, und deshalb war ich auch nicht erstaunt. Das einzig Merkwürdige an der ganzen Sache war nur, daß ich ihn nicht bei einem bestimmten Haus abholen sollte, sondern ausgerechnet am Barnes Common. Aber er wußte meine Einwände zu beschwichtigen, indem er sagte, seine Freunde sollten nicht erfahren, daß er schon am nächsten Tag abreise. Auf jeden Fall habe ich mich dazu bereit erklärt, aber als ich mir dann die Sache überlegte, wurde ich argwöhnisch und setzte mich mit der Polizei in Verbindung.«
»Wie sah denn der Mann aus?« fragte Leslie.
»Er war von mittlerem Alter«, entgegnete der Mann, der ein wenig erstaunt schien, daß sich die Dame an der Unterhaltung beteiligte. »Es fiel mir auch auf, daß er ein wenig besoffen – betrunken war, wollte ich sagen. Aber das kann ja schließlich einmal vorkommen. Er war gut gekleidet, glattrasiert, hatte ein feistes Gesicht und trug einen weichen Filzhut.«
Coldwell wandte sich zu Leslie.
»Paßt diese Beschreibung auf einen der Leute, die wir verfolgen?« fragte er.
»Nein«, sagte sie, »aber sie paßt eigentlich gut auf Druze.«
»Auf Druze?« meinte er ungläubig. »Sie vermuten doch nicht etwa, daß Druze zu der Bande gehört?«
»Ich vermute gar nichts«, erwiderte sie und biß sich nachdenklich auf die Lippen. »Haben Sie seine Hände gesehen?«
»Jawohl, meine Dame. Ich sah sie, als er die Handschuhe auszog, um mich zu bezahlen. Sie waren auffallend weiß.«
Sie schaute Coldwell bedeutungsvoll an.
»Das stimmt wieder.«
»Sind Sie denn zu dem verabredeten Platz hingefahren?«
»Nein, der Inspektor nahm meinen Wagen und fuhr mit ein paar Polizisten hin.«
»Er muß Verdacht geschöpft haben«, meinte der Beamte. »Ich habe um Viertel nach zehn niemand dort gesehen. Und doch hat er darauf bestanden, daß sich der Wagen genau um diese Zeit dort einfinden sollte. Er hat ausdrücklich gesagt: ›Wenn ich fünfundzwanzig Minuten später noch nicht dasein sollte, warten Sie nicht auf mich.‹ Und das klingt doch sehr merkwürdig. Aus diesem Grund glaubte ich, daß die Autobande hinter dieser Sache steckt, Mr. Coldwell. Es ist ein alter Trick von diesen Leuten, ein Auto zu mieten, das sie an irgendeinem ruhigen Platz aufnehmen soll.«
Im Nebenzimmer läutete das Telefon, und der Inspektor eilte zu dem Apparat. Er blieb etwa fünf Minuten fort.
»Die Autobanditen haben auf der anderen Seite von Guildford um neun Uhr ein Haus geplündert«, berichtete er. »Ihr Wagen wurde in einem Graben zertrümmert und zwei von ihnen wurden von der Surrey-Polizei verhaftet.«
Coldwell kräuselte die Lippen.
»Das erledigt also Ihre Theorie«, sagte er.
Auf der Rückfahrt über Kingston Vale verbreitete sich Coldwell über sein Lieblingsthema, das man etwa überschreiben könnte: ›Keine Mühe ist verschwendet, wenn man sich mit Verbrechern befaßt.‹
»Viele Leute würden recht ungemütlich werden, wenn sie mitten in der Nacht durch eine Falschmeldung aus dem Haus geholt würden. Aber schließlich kann man aus der kleinsten Tatsache etwas lernen, selbst aus einer fortgeworfenen Kondensmilchbüchse, die auf dem Kehrichthaufen gefunden wird. Wenn nun der Mann, der das Auto gemietet hat, tatsächlich unser Freund Druze war –«
»Er war es ganz bestimmt.«
»Nun gut, dann haben wir doch wenigstens etwas erfahren«, fuhr Coldwell fort. »Wir tragen gewissermaßen seinen Namen auf eine neue Liste ein, er gehört also zu den Leuten, die merkwürdige Dinge tun, und das sondert ihn von der Menge der gesetzliebenden Bürger ab.«
Sie fuhren schnell die Roehampton Lane hinunter, die kleine Anhöhe zur Eisenbahnbrücke hinan und erreichten die Mitte des Platzes. Mr. Coldwell war noch eifrig in sein Thema vertieft. Leslie sah in dem Augenblick die Schlusslichter eines großen Wagens, der von der Seite der Straße fortfuhr.
»Man soll selbst die kleinsten Fälle nicht verachten«, begann der Chefinspektor wieder, »weil sie –«
Plötzlich wurden die Bremsen gezogen, und der Wagen hielt.
»Was ist denn los?« fragte Coldwell scharf. Auch er hatte den Wagen gesehen, der vor ihnen fuhr, und sein erster Gedanke war, daß der Chauffeur einen Zusammenstoß hatte vermeiden wollen.
Der Chauffeur wandte sich um.
»Entschuldigen Sie, ich stutzte plötzlich – haben Sie nicht auch einen Mann auf dem Gehsteig liegen sehen?«
»Nein – wo denn?« fragte Coldwell, dessen Interesse sofort erwachte.
Der Chauffeur ließ den Wagen langsam nach rückwärts fahren. Sie sahen eine schwarze Gestalt in der Dunkelheit, und als das Auto noch etwas weiter zurückgefahren war, erkannten sie im Scheinwerferlicht, daß es ein Mann war.
Coldwell stieg langsam aus.
»Er sieht wie ein Betrunkener aus«, sagte er ablehnend. »Sie bleiben besser im Wagen, Leslie.«
Aber er hatte kaum die Straße betreten, als sie ihm folgte.
Mr. Coldwell wußte sehr wohl, daß es sich um keinen Betrunkenen handelte. Die charakteristische Haltung, die ausgestreckten Arme und die leicht übereinanderliegenden Beine sagten ihm, daß er einen Toten vor sich hatte, schon bevor er die kleine Blutlache auf dem Gehsteig bemerkte.
Einen Augenblick lang starrten sie beide auf die bemitleidenswerte Gestalt nieder.
»Es ist Druze«, sagte Leslie ruhig. »Irgendwie hatte ich das ja erwartet.«
Es war wirklich Druze, und er war tot. Der schwere Mantel war vollständig zugeknöpft, nirgends war ein Hut zu sehen. Seine Hände, die keine Handschuhe trugen, waren verkrampft. Als Leslie genauer hinschaute, sah sie ein sonderbares grünes Glitzern im Licht der Scheinwerfer.
»Er hält etwas in seiner linken Hand«, sagte sie leise.
Coldwell kniete nieder und brach die Hand auf. Der Gegenstand fiel mit einem leisen Geräusch auf das Pflaster.
Coldwell nahm ihn auf und betrachtete ihn neugierig. Es war ein großer, viereckiger Smaragd in Platinfassung. An einer Ecke war etwas von der Fassung abgebrochen, als ob er mit Gewalt von einem größeren Schmuckstück entfernt worden wäre.
»Äußerst merkwürdig«, meinte er.
Sie nahm den Stein aus seiner Hand und sah ihn näher an. Sie erkannte jetzt, daß sie sich nicht geirrt hatte – es war der Anhänger der Halskette, die Lady Raytham heute Abend getragen hatte.