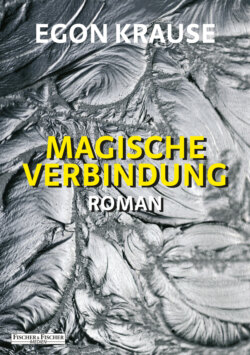Читать книгу Magische Verbindung - Egon Krause - Страница 5
Оглавление»Es gibt für mich nichts Erstaunlicheres als mich selbst.«
Honoré de Balzac
Wenn man den Zeitraum um den 6. Juli 1993 als Beginn des Erzählens wählt, kann man nicht umhin festzustellen, dass der gesunde Menschenverstand allenthalben abhandengekommen ist. Mensch und Verstand sind keine untrennbare Einheit. Jeder möge sich die Ereignisse selbst in Erinnerung rufen. Das Abhandenkommen dieser Verbindung wird sehr deutlich sichtbar, wenn ein Mensch in eine Institution eintritt. Dann wandelt sich sein gesunder Menschenverstand zum politischen Verstand und kommt damit also abhanden.
Es ist dies nicht die einzige negative Allgemeinerscheinung unserer Zeit. Die visuellen Medien sind die Pest unseres Zeitalters, da ihre Berichterstattung zuerst eine Tendenz festlegt und allein dazu passende Fakten präsentiert, damit aber die Tatsachen selbst, wenn sie überhaupt berichtet werden, verwässern. Diese Art von Berichterstattung wird von den meisten Zuschauern unreflektiert konsumiert.
Im Übrigen ändert der Informationsgewinn den Menschen ohnehin nicht: Philippe de Commynes schrieb 1447: »Man muss also feststellen, dass weder die natürliche Vernunft noch unser Verstand noch die Gottesfurcht noch die Nächstenliebe uns davor bewahrt, gegeneinander heftig zu sein, den anderen etwas vorzuenthalten oder ihm auf jede mögliche Weise etwas wegzunehmen. Durch vieles Wissen werden nämlich die Schlechten schlechter und die Guten besser.« Commynes Wissensbegriff kann man heute durch Information ersetzen. Eigentlich verständlich, dass der Mensch sich im Laufe der Geschichte nicht ändert – wir können unseren Genen nicht entkommen. Eigenschaften wie »gut« und »böse« könnte man in Zukunft vielleicht physisch lokalisieren. Sie sind als Anlagen auf Genen positioniert, die wiederum aus Teilchen zusammengesetzt sind, diese verhalten sich wie in der Quantenmechanik, will man sie genau bestimmen, fallen sie der Unschärfe anheim und werden, je nach ihrer Anlage, außerdem noch geprägt von der Umgebung. Den humanistischen Gedanken vorbehaltlos in die Tat umzusetzen, scheint nicht möglich, vor allem für jene, die gesellschaftlich legitimiert wären, dies zu tun.
Zur Durchführung eines Experiments muss man Teilchen oder Welle (böse, gut) wählen, aber in Kauf nehmen, dass das Ergebnis allenfalls näherungsmäßig zu werten ist. Man entnimmt die denkbaren Variablen oder Bestimmungsstücke unbedenklich dem klassischen Modell und erklärt jedes Stück für direkt messbar. Daraus ergibt sich eine statistische Verteilung. Die Messungen müssen sehr oft wiederholt werden. Der klassische Begriff des Zustandes geht verloren, indem sich höchstens wohlausgewählten Hälften eines vollständigen Satzes von Variablen bestimmte Zahlenwerte zuordnen lassen. Wenn in keinem Augenblick ein klassischer Zustand besteht, kann er sich auch nicht verändern. Was sich verändert, sind die Statistiken oder Wahrscheinlichkeiten, stellt Schrödinger fest. Einstein hält dagegen: »Gott würfelt nicht«, natürlich nicht, er kann nicht würfeln, denn er existiert nur als Konstrukt.
Es ist möglich, Erinnertes im Stil einer Gebrauchsanweisung zu verfassen und alle prekären Situationen etwa so darzustellen wie in der Fliegerei beispielsweise: »If you exceed 100 to 110 degrees of bank or 60 to 70 of pitch, then the attitude indicator will tumble and become inaccurate«, auf gut Deutsch, man gerät in einen gefährlichen Zustand. Ein Instrument, vom Menschen entwickelt, übertrifft ihn an Urteilsvermögen, der Mensch wähnt sich in einer normalen Situation, das Instrument aber belehrt ihn, dass dies nicht zutrifft. Wenn es auch nicht den Weg weist, beschreibt es so doch eine augenblickliche Situation. Eine subjektive Position kann durch eine Apparatur korrigiert werden. Die Technik hilft uns einerseits, die Grenzen zu erkennen, reizt uns andererseits zu versuchen, sie zu überschreiten. Die Würdigung der Instrumentenanzeige führt so zu einer gültigen Betrachtung der augenblicklichen Situation, doch das Weitere muss noch entschieden werden. Es gibt ungezählte Varianten im Denken und Handeln, oft genügen wenige Grade der Abweichung, um den einen mit dem zu schockieren, was den anderen erfreut. Der Umgang mit Erotik ist ein solches Beispiel, wie ist eine Beurteilung möglich und von Heuchelei zu trennen, wo gibt es einen Maßstab, die Ethik? Eine Definition ist zweifellos unmöglich.
Schlehmil versteckt sich, weil andere bemerken, dass ihm sein Schatten fehlt, da nützt kein Goldsäckel, der Makel ist untrennbar mit ihm verbunden. Ohne Makel kann der Graue tun, was er will. Mögliches und Erwünschtes. Also lieber einen Schatten wie alle, man fällt nicht auf. Eine Abweichung von der Norm genügt schon zur Verurteilung.
Auch Wissen zu vermitteln wäre möglich, Wissenschaft ist zu viel gesagt, Wissen kann ein Laie sich aneignen, Wissenschaft kann nur ein Fachmann verwerten. Ein Zwischenträger, der Wissenschaftsjournalist, um Wissenschaft zu promovieren?
Bescheiden könnte ich über Wissenschaft nur in der Medizin reden, da auch nur in der Chirurgie, darin wiederum nur in der einen speziellen Disziplin. Da die Chirurgie so eine Art Kunsthandwerk ist, frage ich mich, ob ich überhaupt über Wissenschaft reden könnte.
Ich kann aber vielleicht über das reden, was Wissen schafft.
Erinnertes zu erzählen ist wohl sinnvoll, aber wie kann man den Leser interessieren?
Man sollte beim Erzählen Spannung erzeugen, Erwartungen wecken, von mehreren Seiten auf einen Brennpunkt zusteuern, die Charaktere von Personen darstellen, indem man sie dramatischen Situationen aussetzt, ihren Instinkten, mit denen sie in Konflikte geraten können, freie Hand lässt, ihre Reflexionen in Widersprüche geraten lassen, die weitere Reflexionen erzeugen.
Die Chronologie mit Rückblenden versehen, mit unerwarteter Wortwahl im Stil von A. Schmidt und lautähnlichen Zweideutigkeiten, auch mal märchenhaft, in Analysen sachlich akribisch, ordinär sein, wenn es treffen soll, Facetten kaleidoskopisch im Bewusst-Unbewussten schillern lassen, resignierend, melancholisch von allen Seiten betrachtend wie Proust oder eine assoziative, hintergründige Gedankenflucht wie bei J. Joyce könnte ein Rezept sein, aber das ist nicht mehr zeitgemäß. Originalsätze aus Briefen, Überschriften aus Zeitungen kommentieren (Dos Passos), das wirkt zuweilen ungemein direkt, die notierten Einfälle verwenden, viele Absichtserklärungen. Es wird mir nicht gelingen, zur Entschuldigung ein Wort von Paracelsus: Wie Balzac durchschaut auch Paracelsus sich nicht vollständig.
»Wie mein wunderliche Weis zu verstehend sey merket also, von der Natur bin ich nit subtil gespunnen, ist auch nit meines Landts Art …, befehle also dem Papier, was mein Maul nicht vollenden mag.« Bombast, bist du mein Verwandter?
N.: Was für ein Gefasel und Paracelsus als Entschuldigung, du meinst, es seien wohl tiefe Gedanken, die du auftischst, du solltest dir erst einmal die Definitionen einiger Philosophen zu eigen gemacht haben, um unter die Oberfläche zu tauchen, ehe du dich äußerst, hast du eigentlich das, was die oben Erwähnten schrieben, auch erfasst?
E.: Du alter Miesepeter, ich schreibe doch! Ein Schubladengedächtnis habe ich zum Glück nicht, das bewahrt mich davor, negativen Eklektizismus zu betreiben und die Fähigkeit zur Synthese nicht verloren zu haben und damit kreativ sein zu können.
N.: Uii, diese fatale Überheblichkeit.
E.: Es macht sich immer gut, mit einer Geschichte zu beginnen, bei der man einer Fiktion hinterherläuft. Mit siebzehn hätte ich beinahe ein vielleicht fünfzehnjähriges Mädchen kennengelernt, eine lange Blonde, sie war wohl schon, bevor ich sie sah, in meinem Kopf entstanden, synthetisiert aus Bildern, ich war wie vom Blitz getroffen, als ich sie erblickte, und verfolgte sie auf der Straße, die Jagd nach einer realisierten Fiktion, als ich nun wirklich hinterherlief, war sie plötzlich aus meinen Augen, ich konnte sie nicht mehr aufspüren, somit keine Bekanntschaft machen mit ihren kaum angedeuteten Brüsten, den langen Beinen und der blonden Mähne. Ich hatte allerdings auch keine Praxis in der Verführungskunst und wäre womöglich kläglich gescheitert, denn Rivalen waren mir bei ihrem Schönsein sicher zuvorgekommen, nicht wie Herr G. Casanova, den ich bewundere, vor allem darin, mit welcher Aufrichtigkeit er jedes Mal von Neuem liebte und die Begehrlichkeit immer damit zu paaren wusste. Manchmal hat er etwas nachgeholfen mit einer kleinen Bestechung oder Erpressung, die die Damen nachher nicht bereut zu haben scheinen, ich denke unter anderem an die kleinen Hannoveranerinnen, und wenn seine Liebestaten Folgen hatten, dann sorgte er dafür, dass sich seine Auserwählte kurz hinterher verheiratete, wozu er Hilfestellung leistete, zuweilen fiel es ihm auch schwer, sich zu trennen, aber immer siegte die Begierde nach etwas Neuem.
Jedenfalls war sie verschwunden, meine Fiktion, (später fand ich bei Proust eine Stelle über die Liebe: »Das furchtbare Täuschungsmanöver der Liebe besteht ja darin, dass sie uns nicht mit einer Frau der äußeren Welt in Gedanken spielen lässt, sondern mit einer unserem Hirn entsprungenen Marionette, dem einzigen Bilde, das wir immer zur Verfügung haben, das wir besitzen und das die Willkür unserer Erinnerung fast ebenso unumschränkt, wie die der reinen Imagination, ebenso verschieden von der wirklichen Frau gestaltet haben kann, wie es das wirkliche Balbec von dem Erträumten war, einer künstlichen Schöpfung also, der wir ganz allmählich zu unserer Qual an die wirkliche Frau gewaltsam anzugleichen suchen.« Sie ist heute sicher nicht mehr das ätherische Wesen, es ist mir unerklärlich, wie sie mir entkam. Ich sehe noch heute ihre länglichen Waden vor mir, wie bei so blonden »Ziegen«, die Patellae ein wenig protrudisch, lange Beine, mit einer Fortsetzung – wenn ich mit meinen heutigen Kenntnissen weiterdenke –, wie sie uns Hamilton so schön demonstriert. Man könnte die Fiktion auch weiterverfolgen, Dornröschen erwecken und erzählen, wie zum Beispiel Nabokov, der, das Begehren in den Vordergrund stellend, ans Ziel gelangte, lieber keine Phantasien.
N.: Du Lügner, es stimmt ja gar nicht, was du schreibst.
E.: Was weißt du denn, warst du dabei?
N.: Natürlich, du hattest nur den Mut verloren, es wäre leicht gewesen, sie einzuholen.
E.: Verleumder!
Ich streue immer ein, was mich im Augenblick des Schreibens beschäftigt, was ich lese und reflektiere, ich liebe die Inkohärenz der Gedankengänge.
N.: Was nennst du reflektieren?
E.: Was du nicht kannst, nämlich das Für und Wider erörtern und zu einem Resultat kommen. Negative Kritik ohne einen darauf bezogenen positiven Vorschlag verachte ich.
N.: Damit willst du mir einen Maulkorb verpassen, denkste. Kennst du eigentlich die Bedeutung von Kohärenz und Inkohärenz?
E.: Natürlich. Deine Kritik ist inkohärent und meine Erzählung kohärent, der Inkohärenz zum Trotz.
N.: Diese Bedeutung meine ich nicht, vielmehr die in der Quantenphysik.
E.: Nun, diese kenne ich auch, Kohärenz wäre die Fortführung der Superposition und Dekohärenz die Zerstörung derselben, du bist ein Dekohärent.
N.: Das ist meine Absicht, dich in dieser Welt zu halten.
E.: Auch Sterne nachzuahmen wäre eine Hybris, sein geniales hintergründiges Geschwätz lädt ein, immer weiter zu lesen, einerseits in der Hoffnung, dass doch noch etwas herauskommt, andererseits neugierig, was weiter für skurrile Gedanken ausgebreitet werden. Tristram Shandy (der traurige Verrückte), Dr. Muschstreikos, Dr. Kunastrokius. Die Nasen, die Knebelbärte. Onkel Toby, ein konvertierter Krieger? Es ist viel Mittelalterliches in den Kommentaren, anschließend die Gedanken über Zeit, Raum und Existenz. Und Weisheiten: »Warum wir uns, meine liebe Jenny und ich, so gut wie alle Welt auch, ewig und drei Tage um nichts und wieder nichts zanken, sie schaut auf ihr Äußeres, ich auf ihr Inneres, wie sollten wir uns dann über ihren Wert einigen können.«
Oder: »Mit einem Esel aber kann ich in alle Ewigkeit Konversation treiben.« Hintergründig, es fällt einem sofort Priapus ein.
Was es mit Priapus und dem Esel auf sich hat, wird genau berichtet im »Gründlichen mythologischen Lexikon«, Benjamin Hederich, 1770.
Dazu kenne ich einige unartige Rätsel.
1. Beim Opfern auf einem Altar kam aus diesem ein Phallus und schwängerte die Opferwillige. Wer war sie? aisercO
2. Wen brachte Priapus bei dem Vergleich seiner Männlichkeit mit der des anderen aus Wut um? lesE ned.
3. Hat Leda gelogen, als sie ihrem Gatten weismachte, Jupiter habe sich in einen Schwan verwandelt und sie verführt? War sie in Wirklichkeit von ihrem Liebhaber schwanger, war der Ehemann gar nicht beteiligt an Pollux und Helena, nur an Kastor, geschweige denn Zeus? aJ.
Habe ich nun einen Anreiz geschaffen, Tristram kennenzulernen, oder sollte man besser von schwarzen Löchern reden?
Einstein (1879–1955) war dagegen, aber nur in der Theorie, das hob schon ihr Gewicht auf. Apropos Gravitation, darin (in den Löchern) hat sie ihren Höhepunkt, nur weiße Zwerge konnten den Löchern entgehen. Sind weiße Zwerge – man denkt unwillkürlich an Schneewittchen – menschliche Wesen? Nein, nur eine Metapher. Was für ein Vergleich, wie kann man sie Zwerge nennen, wenn sie 1,4-mal so groß sind wie die Sonne! (Übrigens – waren die Zwerge die Ersten, die Schneewittchen verführt haben?) Hier kommt die Relativität zu Wort, für das Universum sind sie eben Zwerge. Wir denken jetzt universal. Was sind dann aber wir? Quark? Und wie sie, ich meine die Löcher, den Raum verbiegen in ihrer Nähe, ein Prokrustesbett, das einen so lang zieht, bis man nicht mehr ist.
Ich bin schon zu weit gegangen, wir kennen nicht einmal unsere nähere Umgebung. Wie ist es mit Venus, sie hat, soweit man weiß, keinen Bezug zu schwarzen Löchern, oder doch? Die Planeten Merkur und Venus lassen sich von der Sonne bescheinen, heute würde man sie mit Lichtschutzfaktor 20 einreiben, sie wandern mit der Erde, auf der immer noch Mars regiert, angestiftet durch Jupiter, dessen Vater Saturn ihn beobachtet, jedoch nicht mehr verschlingen kann, weil er zu groß ist, auch wacht sein Großvater Uranus über ihn. Neptun steigt triefend aus dem Ozean und Pluto aus der Unterwelt.
Esel, die über die Brücke gehen, sind doch nützliche Tiere.
Wenn wir schon dabei sind:
Kopernikus (1473–1543), ohne den die Erkenntnis nicht möglich wäre, ein Deutscher oder Pole, nun gut, deutschsprachiger Pole, sehr vorsichtig mit seinem Wissen (doch dann, armer Ptolemäus), wurde von Rheticus aus Wittenberg zur Veröffentlichung getrieben, doch Luther (1483–1546) tat all dies als Unsinn ab: »Der Narr will die ganze Kunst Astronomiae umkehren! Aber wie die Heilige Schrift anzeigt, so hieß Josua die Sonne stillstehen und nicht das Erdreich.« Paradoxe Feststellung? Nein, die Sonne, die sich nach dem Almagest um die Erde drehte, sollte stillstehen, wie recht hatte Josua, sie folgte ihm.
Und wieder Kopernikus: »Das Wort der Alten gilt: Was dem Volke gefällt, verstehe ich nicht, was ich verstehe, gefällt ihm nicht, wir sind geschieden.« Ja, über neunzig Prozent Dumme.
»De revolutionibus« erschien 1543 zu Nürnberg.
N.: Was ist dumm? So einfach kannst du nicht verurteilen.
E.: Dumm nenne ich diejenigen, die nicht reflektieren, was sie erfahren. Nicht alle Dummen sind auch unbedingt gefährlich, schon eher die Reflektierenden. »Lob der Torheit«, Erasmus, lies das nach. Außerdem, Dumme ärgern sich nicht über ihre Fehler.
N.: Dann also lieber dumm?
E.: So ganz unrichtig ist das nicht. Einfältig wäre besser, da entfällt das Böse. Aber weiter, ich bin kein Philosoph.
Johannes Kepler, Elliptiker, der aber noch nichts von Gravitation wusste, Newton, der Genialste.
Wie geht man nun bei der Suche nach schwarzen Löchern vor, wieso schwarz?
Na ja, sie lassen kein Licht entkommen, aber an ihren Rändern, die Rotverschiebung. Sie haben eine große Anziehung und stehen in Beziehung zu einem Doppelsternsystem der Milchstraße, ihre Ränder pulsieren, wenn man über ihre Klippen gerät, ist man verloren. Braucht man dazu Einstein? Manchen reicht Newton und die Thermodynamik, jedenfalls entkommt man ihnen nicht. Wieder etwas gelernt. Wie will man dann wissen, wie es drinnen ist? Man muss hinein- und herauskommen. Das treibt Spekulationen ins Uferlose.
N.: Physikalische Sinnlichkeit, Schurke, was soll eigentlich all das Hingeworfene – Kopernikus, Kepler, Luther, Rheticus, Newton, Einstein, Thermodynamik?
E.: Siehst du, wenn du nur ein wenig Allgemeinbildung hättest und dich nicht nur der Mikrokosmos interessierte, könntest du damit etwas anfangen!
Soll ich ein wenig nachhelfen?
Kopernikus kennt jeder, nur dass später Herr Kepler dessen Kreise zu Ellipsen formte, war wichtig für die Bahnberechnung, Luther, der Bibeltreue, dem Rheticus in seiner Ansicht nicht folgte und der »De Revolutionibus Orbium« zum Druck verhalf, Newton, dem der Apfel auf den Kopf fiel (der berühmte kleine Schlag auf den Hinterkopf ) erinnerte sich an den Riesen (Hooke) und stellte anhand einer mit der Geometrie konstruierten Integralrechnung, den Fluenten, die Gravitationsgesetze auf, und so einfach ist die Thermodynamik:
1. Hauptsatz:
Rühren (mechanische Energie) erzeugt Wärme. (Der erste Hauptsatz, ist er nicht ulkig? Wie ist es mit dem geistigen Rühren?)
N.: Wieder so was.
E.: Wie meinst du das? Da ist doch nichts mit Hintergedanken.
N.: Du weißt es ganz genau, Scheinheiliger, ich sag es nicht.
E.: 2. Entropiesatz:
Ohne Zutun von außen wird Wärme stets von heiß nach kalt transportiert. Eine Wiederherstellung des Ausgangszustandes ist ohne Veränderung in der Umgebung nicht möglich.
N.: Auch das ist, wie du schon bemerktest, ulkig.
E.: Jetzt machst du mich doch neugierig, ich meine es rein physikalisch.
N.: Von wegen des Ausgangszustandes, die Wirkung der Brown’schen Ratsche.
E.: Jetzt komme ich gar nicht mehr mit.
N.: Na, Mann, der Molekülmotor, zum Beispiel beim Aufladen der Tastkörperchen, braucht Wärme (vom Reiben).
E.: Eine Verknüpfung von Physis und Physik, bravo, jetzt hab ich’s.
3. Die Entropie von Reinstoffen im Gleichgewicht strebt mit sinkender Temperatur gegen Null.
N:. Gut, wie du das darstellst, doch viel anfangen kann man ohne meine Bemerkungen damit nicht. Übrigens, celestium hast du vergessen.
E.: Apropos Einstein: Der Cagliostro in der Physik oder auch ein St. Germain, die wollten mit Täuschungen Gold machen, er das Golden Goal in der Physik schießen, seine reale Leistung, die Formulierung des fotoelektrischen Effekts und das auch nur auf Grundlagen anderer (Lenhard), seine ART, wenn man heute danach flöge, käme Frank Tipler auf Umwegen vielleicht zum Omegapunkt. Und dann die Hybris: Einstein bittet Newton um Verzeihung, dass seine Begriffe durch andere ersetzt werden müssen, nämlich seine. Die Idee mit der nicht zu überschreitenden Lichtgeschwindigkeit hatte Albert wohl von Zenon, Achill und der Schildkröte? Genauso weit entfernt von der Realität.
Man sollte besser sagen, »Einsteins Utopien«, denn mit unserer Wirklichkeit haben seine Ideen nichts zu tun. Die »Spezielle«, ein Denksport, das Äqualitätsprinzip, ein schöner Vergleich. ART, die Krümmung des Lichtes wäre auch nach Newton verständlich, Photonen sind Teilchen, angeblich haben sie keine Masse, stimmt nicht, sie haben Impulsmasse, sonst würden sie nicht durch die Gravitation beeinflusst, Raumzeit-Krümmung, warum etwas postulieren, was nicht nachweisbar ist? Wie gesagt, wunderschöner Denksport. Die Möglichkeit der Geschwindigkeitsänderung der Photonen ist eigentlich schon der Beweis für ihre Masse, sonst wäre das Licht unbegrenzt in seiner Geschwindigkeit, wie die Gravitonen. Dann die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit, angeblich bewiesen am Beispiel einer schnellen Rakete, deren ausgestrahltes Licht, wenn es ausgestrahlt würde, wegen der Eigengeschwindigkeit der Rakete schneller als Licht sein sollte. Übrigens mag ich den Alten gern, schon weil er im Sternbild Fische geboren ist, alle Fische sind herzlich, es ist ein Glück für ihn, dass man ihn in der Realität nicht braucht, man ist jedoch erstaunt darüber, wenn man konventionell etwas prüfen kann, festzustellen, dass es auch mit seiner Rechnung übereinstimmt. Vielleicht ist die Beschleunigung im Äquivalenz-Prinzip doch die Gravitation und wir sind dauernd beschleunigt, Hubble.
N.: Wenigstens ein Quantum von Einsicht. Da kann man mal sehen, wie einer reagiert, wenn er es nicht kapiert, du bist ja noch schlimmer als die oberflächlichen Zeitungsschreiber, die den Interessierten wissenschaftliche Ergebnisse nahebringen wollen, die sie selbst nicht verstehen. Seine Theorien gelten für Geschwindigkeiten, die wir nicht erreichen, darum Theorien. Die Theorie heißt relativ, wenn du weißt, was das bedeutet. Der eine sieht es von seinem Standort anders als der andere.
E.: Gut, ich sehe es nur von meinem, apropos sehen, das ist die Krux, darauf baut die Theorie, wenn wir beim Sehen keine Zeit brauchten, eben die Zeit, die die Photonen brauchen, wäre alles hinfällig.
N.: In der Realität ist es aber so, du Irrealist.
E.: Er hat so lange mit seinem Füllfederhalter Zahlen und Konstanten variiert, bis er die newtonschen Gesetze variiert hatte.
N.: Nicht variiert, sondern geändert, wie es wirklich ist.
E.: Es ist aber nicht wirklich so. Die Einsteiner haben die ganze Theorie nicht reflektiert, einer schreibt vom anderen ab, nimmt ihn als Prämisse und vertritt ihn dann, wenn es ihm in den Kram passt. Das Tödliche an Einsteins SRT ist, dass er die Subjektivität vor die Objektivität stellt. Natürlich sind zwei Ereignisse gleichzeitig, auch wenn sie an verschiedenen Orten stattfinden, nur erkennt man es subjektiv nicht.
Alle Berechnungen der Raumfahrt gehen nach Newton, auch die der Astronomie, wer hat schon eine gekrümmte Entfernung gemessen, selbst nicht bei Milliarden von Lichtjahren. Die Berechnung der Anziehung in einem Mehrkörpersystem ist eben nicht so einfach; den Mittelpunkt der Massen nehmen oder den Massenpunkt dazwischen berechnen, dem sollten sich die klugen Mathematiker widmen. Die Uhren gehen bei Beschleunigung langsamer, der eine Zwilling ist schulpflichtig, während der andere sich noch in ein Spermazoon zurückverwandelt hat, wenn er zurückkehrt. Man stelle sich vor, wie dick der sein müsste bei der Beschleunigung und seinem Alter und wie klein das Spermazoon. Welcher ist denn beschleunigt, wenn der eine im Kasten von einer Stelle davonfliegt, das ist nicht relativ im Sinne Einsteins, letztendlich ein Eigentor, er benutzt einen festen Ort für den zuhause Gebliebenen; wenn nicht, müsste der Rückstoß auch ihn beschleunigen. Die Zeit schrumpft und krümmt sich (vor Schmerz über das, was man ihr antut), man meint, er hätte in Hogwarts (School of Witchcraft and Wizardry) studiert. Und wie wurde gemessen, mit der Uhr? Die Uhr in den Zellen wird nicht berücksichtigt!
N.: Bei niedrigen Geschwindigkeiten wäre es so, aber bei Lorentz nicht, Mößbauer konnte es beweisen und auch im Satelliten gehen die Uhren langsamer.
E.: Bei Mößbauer war es nur die Frequenz, die größer geworden ist, kein Ding, und was heißt Uhr, ist die Uhr ein objektiver Zeitmesser?
N.: Atomuhren sind genau.
E.: Und womit wird gemessen? Mit unserer Uhr!
N.: Und wie ist es mit einzelnen Myonen einer Menge, die uns erreichen, obwohl sie es bei ihrer mittleren Zerfallszeit nicht dürften, mit ihrer hohen Geschwindigkeit, ihre Lebensuhren gehen langsamer, sie leben länger – aber wie viel, berechnet mit der SRT?
E.: Die Myonen, sie müssen ja unheimlich dick sein bei ihrer Geschwindigkeit. Wie dick sind sie denn in Ruhe? Wie ist es mit der Berücksichtigung der Messung, der Unschärfe der Quantentheorie?
Na, so leicht kannst du mir das nicht erklären, es spielt da sicher auch die mittlere Zerfallszeit eine Rolle, es gibt nach beiden Seiten einen Unterschied.
N.: Du bist unbelehrbar. Übrigens, im CERN haben sie es auch nachgewiesen, das mit der Lebensverlängerung. Aber wer will das denn auch wissen? Ein Leser sicher nicht, man müsste einen Kommentarband dazulegen.
E.: Warte mal ab, bis die klassisch-wissenschaftlichen Partisanen aus dem Untergrund die Behauptungen Einsteins torpedieren. Im CERN haben sie die Teilchen vorbeifliegen sehen, da war ihre Masse angewachsen, sie waren gleichzeitig verjüngt und geschrumpft, die Masse wird größer, das Teilchen schrumpft, interessant, sich ein geschrumpftes Teilchen vorzustellen, wo es doch sowieso wie ein Pünktchen berechnet wird. Ist der Ring nicht gleich lang und die Zeit je nach Geschwindigkeit auch? In Realität ist das Teilchen gleich groß geblieben, die Strecke gleich lang und die Zeit mit der Uhr gemessen. Lass dich mit deiner Uhr mal kräftig beschleunigen damit du länger lebst. Aber wäre es dann ein Nutzen für die Menschheit, ich stelle mir vor, wie du in der Länge oder Breite schrumpfst, da ist schon wieder der logische Widerspruch, wenn du liegst, der Länge nach, ein Pykniker, wenn du stehst, in der Breite: Giacometti und wenn du schräg im Raum stehst, wie siehst du dann aus, wie ein Picasso. Und deine Gedanken so verlangsamst wie die Bewegungen eines Faultiers. Wenn es nach A. ginge, wäre es so. Der Dicke läuft und wird beschleunigt, er schrumpft und lebt länger, das stimmt mit der klinischen Medizin überein, einer, der Gewicht verliert, wird dünner und lebt länger, wohl das Einzige, worin Medizin und Einstein übereinstimmen. Bleib mal unbeschleunigt.
N.: Das ist deine Ironie. Du bist giftig.
E.: Und weiter, die Zweiweltentheorie, da lob ich mir die Surrealisten, Dali konnte zum Beispiel die Zweiweltentheorie besser vermitteln in seinen »Lebensaltern« und der »Büste von Voltaire« als ihr, auch so ein spekulatives Thema der theoretischen Physiker.
N.: Mit dir lässt sich trefflich streiten, zum Beispiel nehmen die Protonen an Masse zu, wie man es relativistisch berechnen kann.
E.: Und wie konnte man das messen?
N.: Man muss die Magneten verstärken, um mehr Kraft zu haben, sie auf ihrer Bahn zu halten.
E.: So teure Magneten. Das soll der Beweis sein? Wer hat es gesehen? Komisch, wozu braucht man so lange, runde Beschleuniger?
N.: Natürlich um die Geschwindigkeit zu erreichen. Irgendwie hast du intuitiv recht, du bist doch ein Einsteiner, ganz oben in der Geschwindigkeit lassen sie sich nur schwer beschleunigen, es reicht natürlich eine gewisse Geschwindigkeit aus, dass Teilchen zersplittern.
E.: Und so ein teures CERN. Übrigens, mir fällt gerade das Beispiel mit dem Ballspieler in einem fahrenden Zug ein, der meint, wenn er den Ball auf den Boden fallen lässt, geschieht das genauso wie in einem nicht fahrenden Zug. Richtig. Derjenige, der das von außen betrachtet, für den bewegt sich der Ball nach vorn, richtig. Wenn nun der Boden im Zug aus Glas wäre und der Ball durch ein Loch im Glas fiele, wie sähe es der Außenstehende und der im Zug? Für beide fliegt der Ball nach hinten, komisch, es sind doch zwei Feststellungen, einmal bewegt sich der Ball nach vorn, einmal nicht, jetzt sind die Bewegungen für jeden Beobachter gleich, vom außenstehenden Beobachter gesehen nach hinten, vom Beobachter im Zug beobachtet auch. Es gibt keine Relativität, wenn man klar sieht, das Loch macht die Objektivität, das Objektiv.
N.: Von diesem Trick habe ich noch nie gehört.
E.: Nun sehen beide subjektiv objektiv, nämlich real.
Hier, ein Original-Brief an mich:
Lieber, wie geht es Ihnen, wir haben schon gedacht, Sie fensterln bei uns in der Nacht, besuchen Sie uns einmal in der Nacht, Ihre A., I., E., Ag.
N.: Stimmt nicht, Mann! Der war an mich gerichtet!
E.: Entschuldige, manchmal verwechsele ich dich mit mir, das rührt von einer Art geistiger Verschränkung her.
N.: Es sei dir verziehen. Hast du das doch aus der Quantenmechanik verstanden, o Wunder.
E.: Ich bin jetzt 65,5 Jahre alt, 1,75 m lang, um die 73 kg schwer, kurz nach dem Ende meines chirurgischen Lebens, das Ende eine Katastrophe? Mitnichten, könnte man salopp sagen, wohlgefällige Rückschau? Auch nicht, Bewusstsein einer jetzt unabhängigen Existenz, Freiheit pur. Wieso, existierte ich früher nicht? War ich so unfrei? Egozentrische Gedanken, die mir vorher nicht in den Sinn kamen. Rückschritt in gesellschaftlicher Beziehung? Reaktion auf einen erzwungenen Altruismus, von außen, von innen, positioniert auf einem Gen, gesteuert durch Erziehung?
Fruchtlose Gedanken. Ich trete in eine andere Welt ein. Eine Welt getrennt von der vorherigen, die angefüllt war mit Handlung und Gedanken in einer isolierten Sphäre, ausgerichtet auf Diagnose, Therapie und Fortschritt, Gedanken ohne rechts und links. Jetzt, am Ende, ein Weltall voller Möglichkeiten, Gedankenfreiheit pur. Aus verstaubter Kiste den Pegasus befreien, der sich allmählich ans Fliegen gewöhnt.
Allerdings körperlich etwa dreißig Prozent weniger leistungsfähig als mit dreißig, geistig wie schon immer etwas träge, mit relativ schlechtem Gedächtnis, dies ist nichts Neues. Ich habe meine Arbeit so getan, wie es mir möglich war, habe keine Hochleistungen erbracht, mir ist nicht klar warum.
N: Ich weiß warum, sei ein wenig objektiv. Warum? Einfach zu faul!
E.: Vielleicht zu wenig Ehrgeiz, oder es hat mich eine innere Hemmung davon abgehalten, eine eigenartige Haltung, wenn ich einen Vorteil hatte, habe ich ihn bewusst nicht genutzt, ich hätte mich geschämt. Ich habe nie etwas gefordert, immer gewartet, bis es mir zugestanden wurde. Selbst wenn ich Macht hatte, habe ich sie nie genutzt.
N.: So eine schöne Selbstcharakterisierung habe ich selten vernommen.
E.: Trotz alldem sind die Vorstellungen in Erfüllung gegangen, die meiner Mutter.
N. : Alle?
E.: Eine Frage, die ich mit Ja beantworte, alle aus der in der Zeit möglichen Vorstellungen.
Und deine?
N.: Nicht alle, es war das, was zu erreichen war, die Vorstellung war immer mehr.
E.: Die Hemmschwelle zum Lügen habe ich bis heute nicht überwunden.
N. : Mit Ausnahmen? Im Übrigen bin ich deiner Meinung.
E.: Oh! Wir werden sehen.
Ich habe entdeckt, es ist von Vorteil, die Wahrheit zu sagen, die glaubt nicht ein jeder, weil er meint, der andere lüge. Außerdem erspart man es sich im Lügennetz zu verheddern.
In einer Ecke des Bildschirms ein Icon, mein Großvater, der mich ermahnte, nie verbotene Dinge anzufassen, »ansehen und sich wundern«, ist das eine Erklärung? Ich habe danach gehandelt und soll meine Hände dabei auf den Rücken gelegt haben. Diese Zurückhaltung bestimmte mein ganzes Dasein. Ich kam ihm wohl ein wenig fremd vor, mein Großvater konnte, wie ich merkte, meinen Blick nicht lange ertragen, der vielleicht, wie ich auf späteren Bildern von mir entdeckte, zu provokativ erschien. Eine weitere Feststellung, ich habe mich immer für unwichtig gehalten, als Mensch in meiner Aufgabe und damit das Problem der Unentbehrlichkeit nicht gekannt.
N.: Schönen ist wohl deine große Gabe?
E.: Genug der Selbstanalyse. Objektiv? Eigne Objektivität sieht der andere als subjektiv an, Objektivität des anderen ist auch Subjektivität. Was ist nun objektiv? Objektivität nur durchs Objektiv? Auch das kann täuschen. Aber woher kommt die Subjektivität? Vom Bewusstsein, woher kommt das Bewusstsein? Da sind wir bei der Neurophysiologie, woher kommt die Neurophysiologie, wer hat der Neurophysiologie auf die Sprünge geholfen, die Computerentwicklung.
N.: Was ist das für eine Behauptung, das Physiologische bestand lange vor der Elektronik.
E.: Der Computer simuliert das Gehirn mit Speicher, neuronalen Verbindungen und multiplen Weichen. Wir werden mit leeren Speichern geboren, die wir dann sukzessive subjektiv mit unseren Sensoren füllen, daraus erwächst unsere Subjektivität, ihr werden wir uns bewusst, sozusagen mit dem Resultat unserer Wahrnehmung. Die Gene liefern den Prozessor, der unsere Wahrnehmung in Programmen zusammenstellt, vernetzt und ausführt. Entwicklungsgeschichtlich entwickelt sich aus dem Ektoderm das Gehirn und auch die Haut, unsere Grenze zur Umwelt, logisch, dass sie der Kontakt zur Umwelt ist und dem Gehirn in der Entwicklung so nahe steht. Vor vier Milliarden Jahren nahmen die Einzeller erstmals mit ihrer Umhüllung die Umgebung wahr, wenn sie etwas berührten. Evolutionär war es die Haut der Lebewesen, die gezwungenermaßen immer differenzierter die Reize verarbeiten musste, was dann mit der Entwicklung des Gehirns dazu führte, die Wahrnehmung zu verfeinern. In Zukunft werden uns Computer mit gespeicherter Ethik, den Antworten auf alle wichtigen Fragen und einem schnellen Zugriff auf all das in der Urteilsfähigkeit voraus sein. Aber was soll das, es fiel mir gerade ein.
N.: Das sind schon wieder solche Ausreißer, die Philosophen haben andere Vorstellungen, mehr Geist. Wie entstehen gute oder böse Handlungen, wer stellt die Weichen?
E.: Unsere Wahrnehmung, und wieder Commynes: »Man muss also feststellen, dass weder die natürliche Vernunft noch unser Verstand noch die Gottesfurcht noch die Nächstenliebe uns davor bewahrt, gegeneinander heftig zu sein, den anderen etwas vorzuenthalten oder ihm auf jede mögliche Weise etwas wegzunehmen.« Auf einen Nenner gebracht: Verhalte dich so, dass du den anderen nicht beeinträchtigst. Da sich aber die Wege unseres Gehirnlabyrinths stetig ändern und damit unsere Absichten, ist die Entscheidung für Gut oder Böse nicht sicher, sozusagen verschränkt.
Ich habe gerade frühere Notizen von mir gefunden, darin auch den eigentlichen Titel meiner Geschichte: »Navigation, kein technisches Buch«, ein wenig naiv? »Die Kunst, jederzeit die Position eines Schiffes oder eines Flugzeuges zu bestimmen und seine direkte Bewegung von einer Stelle zur anderen zu bewerkstelligen«, »The American Peoples Encyclopedia«, Vol. 13, Grolier Inc.1968. Die Definition ist klar, die Ausführung mit Hilfsmitteln heute möglich, aber noch immer nicht leicht. Früher zum Beispiel die Jagd nach der Bestimmung des Längengrades.
N.: Manchmal hast du recht.
E.: Es war in der Zeit als ich mein IFR-Rating absolvierte, 1980, der Artikel in »Flying« passte genau auf meine Situation, »Tears on the Cowling« von Herrn Collins, einem Flying-Redakteur, er hatte selbst ein Flugzeug gebaut, die »Melmoth«, Weltenwanderer, mit großer Reichweite, es wurde später nach seinem Flug um die Welt auf dem Boden von einem anderen gerammt und zerstört. Er hatte auch mal den Propeller verbogen. Und ich war nun auch auf dem Bauch gelandet, in St., die sanfteste Landung, die ich je fertiggebracht habe, schnurgerade auf der Centerline mit der kürzesten Landestrecke. Der Prop war an beiden Enden umgebogen, das Bodenblech verdünnt, sonst nichts. Mein Freund R. neben mir hatte immer auf die Bodenberührung gewartet, die erst sehr spät kam. Ich hatte vor lauter Konzentration auf das ILS (Instrument landing system) das Fahrgestell vergessen, das Warnhorn war nicht zu überhören, es hatte mich nicht gestört. Mein ohnehin geringes Selbstbewusstsein geriet nach dem Vorfall ins Schwanken, es dauerte sehr lange, bis es sich wieder stabilisierte Es tröstete mich nicht: »Die einen haben es hinter sich, die anderen noch vor sich.« Arme Mooney, obwohl ich sie so misshandelt hatte, nahm sie mir es nicht übel. Doch muss ich, um bei der Wahrheit zu bleiben, etwas hinzufügen: Um ruhiger zu sein, als ich zum ersten Mal allein ein ILS herunterturnte, hatte ich einen Tranquilizer eingenommen, trotz Verbotes in der Luftfahrt, so störte mich offensichtlich das Warnhorn nicht, es ist keine Entschuldigung, nur eine Ergänzung.
N.: Das war einigermaßen subjektiv-objektiv.
E.: Es wurde auch fotografiert.
Oder doch lieber »Irgendjemand« als Buchtitel.
N.: Du Hinterhältiger, dann wärst du mich losgeworden.
E.: Da wäre nicht viel verloren. Mit Absicht habe ich meine zusammengewürfelten Notizen einfach so hingeschrieben. Dann steht hier noch: M., du bist der Größte, das rührt daher, dass wir eine Karte von ihm, dem Griechenfreund, bekamen, darauf stand: »I okay in Ithaka!« Kurz und bündig und unvergessen, Michele.
Weiter folgt: Einen Traum realisiert, was für ein Traum? Siehe oben.
N.: Zur Vollendung hat dir der Mut gefehlt.
E.: Ich meine es auch sublimiert.
Mir träumte einst von wildem Liebesglühn, von hübschen Locken, Myrten und Resede, von süßen Lippen … und:
Mir träumte von einem Königskind mit nassen bleichen Wangen … und:
Ich halte dir die Augen zu und küss dich auf den Mund …
N.: Na, endlich eine Tat.
E.: H. H., einmal so, einmal so.
N.: Wie meinst du das?
E.: Nun, man kann Schönes in der nächsten Sekunde zerstören, H. H. war der Meister darin.
E.: Ein anderes Märchen sollte so beginnen:
Es war einmal ein nicht mehr so junger Mann von zweiunddreißig Jahren, der sah ein Mädchen mit pechschwarzem Haar, kohledunklen Augen, einer Stimme, samtweich, verführerisch wie die der Loreley, aber alles zu seiner Zeit!
N. : Es ist noch lange hin, so willst du nur zum Weiterlesen deines Gefasels ermuntern.
E.: Schubert-Jahr, 31.1.1797–19.11.–1828, zweihundert Jahre, ich fand sein Zitat so resignierend: »Nur da, wo du nicht bist, dort ist das Glück.«
N.: Nun mal keine Melancholie, du kannst es nicht auf dich beziehen.
E.: Dem Glück hinterherlaufen und blind sein, wenn man es eingeholt hat?
Alfred Brendel interpretiert Schuberts Klavierstücke manchmal ein wenig zu piano.
Hin und her in der Zeit, 1928 war ein Jahr ohne Bedeutung, abgesehen von dem Ereignis, dass ich das Licht der Welt erblickte. Ich kann mich an den ersten Lichtschein nicht erinnern, die Augen gehen einem wohlweislich nicht gleich auf. Die Geburt eines strammen Jungen, angezeigt in der Zeitung – wen das interessierte, mit Datum vom 18.3.28., ein Fische-Kind, an einem Sonntag, Sonntagskinder haben die Sonne des Lebens gepachtet, so dachte wohl auch meine Mutter, gegen 12 Uhr mittags, »High noon«, war auch keine barbarische, nachtschlafende Zeit.
N.: Das brauchte ich nicht zu berichten, aber es ist vielleicht interessant zu erfahren, was vor meiner Zeit war.
E.: Jetzt merke ich, dass ein Teil meiner Erzählung offensichtlich dem Computer zum Opfer gefallen ist, natürlich mit meinem Zutun. Ein tückischer Druck mit dem Ballen aufs Keyboard und wie bei einem Zauberer ist alles verschwunden, nur der Kenner zaubert es wieder hervor, weil es gar nicht weg ist, mir gelingt es nicht.
N.: Das geschieht dir ganz recht, alter Dummkopf, ehe man einen Knopf oder eine Taste drückt, überlegen!
E.: Nun muss ich all das, was ich so schön (meiner Meinung nach) …
N.: Die Einschränkung ist nötig.
E.: … verfasst habe, aus dem Gedächtnis graben, schade. Es war ein Jahr ohne Bedeutung. Ich ärgere mich doch über den Verlust meiner Schreiberei, zum Teufel! Während ich darüber grübele, fällt mir immer mehr ein, es war ein ganz schön langer Bericht.
N.: Du tust mir richtig leid.
E.: Ob ich ihn so gut …
N.: Gut ist wirklich naiv.
E.: … wieder hinkriege? Was nützt der Ärger?
N.: Natürlich nichts.
E.: Dieser blöde Kerl regt mich auf mit seinen ständigen Kommentaren, statt selber einmal etwas von sich zu erzählen. Ich muss den Anschluss finden, aber dann werde ich mich rächen.
Mein frühes Dasein muss kaum Dramatik enthalten haben, denn ich kann mich nur an Weniges erinnern, Bemerkungen meiner Mutter und Bilder könnten es ergänzen. Ein Bild: Ich ohne Haar.
N. : Das habe ich mir erspart.
E.: Im Kinderwagen mit meinem Kindermädchen und Bob, einem Boxer, der auf einem anderen Bild mit dem Hut meines Onkels Männchen macht. Ein Bild meiner Mutter mit meinem Vater im »New Look« (schönes deutsches Wort) der Zwanzigerjahre vor ihrem Auto. Mein Vater kam erst in mein Bewusstsein, als ich sechs Jahre alt war, denn meine Eltern wurden früh geschieden. Woran aber erinnerte ich mich, jedenfalls noch nicht an Ereignisse, die mir meine Mutter berichtete. Mein Großvater nahm mich öfters mit auf Spaziergänge und als er einmal eine Humme fertigte, spielte ich an einem Mühlbach und muss wohl hineingefallen sein, ein Junge zog mich zu meinem Glück oder Unglück heraus, meine Mutter hat es ihm nie vergessen, ich war nass, mein Großvater bleich, seit dieser Zeit war Wasser nicht mehr mein Element, dem Tierkreiszeichen zum Trotz.
N.: Das war ein Glück, sonst könnte ich dich nicht korrigieren.
E.: Wie macht man eine Humme.
Humme, Humme, Wiedchen, Saft, Saft siedchen …
Man klopft leicht rund um ein Stück einer jungen Weidenrute auf die Rinde, sie lässt sich dann vom Holz abziehen. Der gebildete Saft zwischen Holz und Rinde macht es möglich. Jetzt hat man ein mehr oder weniger dickes Rohr der Rinde. Auf einem Zentimeter befreit man es von der äußeren Schicht und wenn man diese Lippen ein wenig aufeinanderdrückt, vibrieren sie wie die Lippen eines Fagotts, wenn man hineinbläst. Die Dünnen erzeugen hohe, die Dicken tiefe Töne. Das ist eine Humme.
Ein andermal war ich mit meiner Großmutter im Garten, als mein Onkel väterlicherseits kam und mich, wie man fachmännisch sagt, kidnappte, er hatte ein Faible für englische Autos und ich fuhr wohl mit ihm stolz in seinem 6-Zylinder zu meinem Vater nach H. Meine Mutter hatte alle Mühe, mich unter Polizeischutz zurückzuholen, ich war wohl sehr wertvoll. Alles berührte mich überhaupt nicht. Berichten zufolge muss ich ein sehr artiges Kind gewesen sein, zur Strafe in eine Ecke gestellt, blieb ich so lange stehen, bis man mich wieder holte, vor begehrenswerten Dingen stehend, hatte mich mein Großvater, wie schon gesagt, gelehrt: »Ansehen und wundern, nicht anfassen«, ich richtete mich danach.
N: Wie abscheulich eigenlobig!
E.: Wann dachte der kleine Junge einmal etwas: Als ich in den Mühlbach fiel. Gar nichts, von dem Bewusstsein einer Lebensgefahr ist nichts in Erinnerung, es mussten erst einmal die Speicher gefüllt werden, die Vernetzung geschieht dann durch Erfahrung, durch das Verhalten anderer Menschen, deren Reaktionen, die Korrektur des eigenen Verhaltens durch andere, auch Angst wird erfahren und erst später kurzgeschlossen durch Abwehr der Gefahr ohne Beteiligung des Großhirnes.
Zur Einschulung ein Brief meines Onkels O., dem Bruder meiner Mutter:
Stuttgart, den 16.3.34
Meine lieber E.,
zu deinem Geburtstag und zum Schulanfang habe ich dir heute einen ersten Ranzen zugeschickt. Hoffentlich gefällt er dir. Was du an Büchern und Tafel benötigst, schreibst du, dann schicke ich dir das Geld, du kaufst es dort in A. Zu deinem Geburtstag wünsche ich dir vor allem Gesundheit und dass du in allem deiner Mama immer schön folgsam bist. Wenn du mal ein großer SA-Mann werden willst, dann musst du jetzt schon anfangen und nie ungezogen werden. Wer kommt denn alles zum Geburtstag? Schreib mal darüber. Ich selbst würde gern mitfeiern, doch da muss ich wohl bis Ostern oder Pfingsten warten, hier muss ich arbeiten, dass ich Geld verdiene und habe so wenig Zeit.
Grüße Opa, Oma, Mama, Tante L., Orschi, Horst und alle, die zum Geburtstag kommen.
Bleib schön gesund, es freut sich auf das Wiedersehn dein Onkel und Pate O.
Er war weit herumgekommen, wie man so schön sagt, auch in Amerika, von wo er mir einen kleinen Totempfahl mitbrachte. Er starb am Hodgkin-Sarkom im Alter von achtunddreißig Jahren einen qualvollen Tod, heute könnte man die Erkrankung fast vollständig heilen. Die brennenden Kerzen am Kopfende seines Sarges sind mir noch deutlich in Erinnerung, sie ließen sein bleiches Gesicht noch weißer erscheinen und sie verbrannten auch die geschlossenen Tulpen, die dort standen. Ich mag Tulpen nur, wenn sie weit aufgeblüht sind.
Wann hatte ich zum ersten Mal eine emotional gefärbte Meinung?
N.: »Schööön definiert.«
E.: Ich erinnere mich daran, mit sechs oder sieben Jahren. Wir, aber wer es war, weiß ich nicht mehr, gingen den holprigen, kopfsteingepflasterten Kirchrain hinunter, die Schule war gegenüber dem Kirchhof, der Lehrer S., er war ein massiger Mann mit einem gutmütigen Gesicht, hatte uns die Nibelungensage wohl recht dramatisch erzählt. War Hagen von Tronje ein Bösewicht? Wir konnten uns über seine Gemeinheit nicht beruhigen, aber auch Siegfried war nicht integer, er hatte einen Meineid geschworen. Wie konnte Hagen nur so genau treffen, natürlich nur aus dem Hinterhalt und mithilfe der aufgestickten Markierung, ein Lindenblatt war schuld daran, Siegfried hatte es nicht gemerkt, als er im Drachenblut badete. Wenn er es gemerkt hätte, wäre es ihm nicht möglich gewesen, es zu entfernen – und wenn er ein Affe gewesen wäre?, lächerlicher Einfall, Stirnhirn! Jedenfalls hat Kriemhilds Rache noch viele Opfer gefordert. Ist eigentlich schon einmal jemand bei Worms getaucht? Schliemann in der Taucherglocke. Alerich hätte ihn sicher harpuniert. Die Siegfriedquelle sprudelt noch heute am Felsenmeer im Odenwald, man könnte meinen, Gunther habe von hier den Stein nach Island zu Brunhilde mitgenommen. In Xanten ist nichts mehr von Siegfried übrig geblieben, obwohl er doch sicher auch im Dom beigesetzt worden wäre!
N.: So solltest du die Leute nicht auf den Arm nehmen, du Simpel!
E.: Nach der Erzählung ist es nicht ganz klar, wie Siegfried für Gunther Brunhild endgültig gewann. Hatte Siegfried Kriemhild in einer schwachen Stunde die Wahrheit erzählt, so musste man annehmen, dass er es war, der Brunhild zum ersten Mal nicht nur besiegte, oder hatte er gelogen. Brunhild büßte hiernach all ihre Kraft ein. Gunther war wohl nichts anderes übrig geblieben, denn Brunhild hatte sich in der Hochzeitsnacht mehrmals erfolgreich gewehrt, ihn gefesselt und mit ihrem Gürtel über Nacht an einen Nagel gehängt. Die Sage lässt viel Spielraum für die Fantasie.
N.: Eine erotische Hintergründigkeit passt nicht zu Teutonen.
E.: Vielleicht interessiert sie dich doch.
Wie war es wirklich? Kein Augenzeuge, die Augen, die dann ihre Lust haben könnten, die Tarnkappe fehlte. »Was schad das, was du lernest, was dich deine Augen lernen, was dich die Expierienz lernet, müssen nicht solche Ding also gelernet werden durch die Augen? Und die Augen, die dann in der Erfahrenheit ihre Lust haben. Dieselbichen seint deine Professoren, denn dein eigen Fantasieren und dein eigen Speculieren mag dich dahin nicht bringen.« Paracelsus, kluger Bombast.
Wie war es wirklich? Nach dem Hochzeitsgelage waren Gunther und Brunhild kaum in ihrer Kammer, als Gunther natürlich seine Braut, die sich ins Bett geflüchtet hatte, auch besitzen wollte. Er zog schnell seine Kleider aus und legte sich zu ihr. Geübt war er schon im Verführen und Zwingen von Mägden, aber anstatt willfährig zu sein, begann die jungfräuliche Brunhilde, die stärker war, einen Ringkampf. Seine geschickten Finger und die strotzende Auferstehung an seinem Leib, die die Jungfrau zum ersten Mal wahrnahm, ließen sie im Gerangel kurz nachgeben, Gunther meinte schon gesiegt zu haben, doch er hatte sich verrechnet. Es gelang ihr, ihn mit ihrem Gürtel zu fesseln und an einen Haken zu hängen. Sie betrachtete den Wehrlosen und verstohlen das nun auch Machtlose. Er hatte natürlich ihr Interesse bemerkt und ermunterte sie, trotz seiner misslichen Lage, es näher zu erkunden. Spöttelnd »Ich will sehn, wie kräftig es ist!«, fasste sie es und konnte sich von seiner Härte überzeugen. Doch auch dies half ihm nicht, sie gelüstig zu machen. Er erzählte dies Siegfried, der sich erbot, ihm am nächsten Abend zu helfen. Die Tarnkappe war schnell herbeigebracht und so gingen beide in die Kammer, in der Brunhilde vor ihrem Spiegel saß. Sie drehte sich um und sagte spöttisch: Soll ich dich noch mal an den Haken hängen? Gunther näherte sich ihr unterwürfig und bat: Sei doch nicht so grausam, lass uns doch nur zusammen schlafen, ich will weiter nichts von dir, was sollen sonst die anderen denken. Nahe genug bei ihr streifte er ihr das Gewand von den Schultern, dass ihre prallen spitzen Brüste heraussprangen. Jetzt wollte sie ihn wieder fassen, doch Siegfried hielt ihre Hände so fest, dass sie Gunther nicht abwehren konnte, der sie ganz entkleidete. Siegfried drängte sie ans Bett, sie ließ sich nicht auf den Rücken zwingen und wehrte sich, wand sich hin und her, er fasste sie mit aller Kraft, sie strauchelte, bot das unbeschützte Ziel dar und so wurde die kampfeslustige Jungfrau mit seiner Lanze durchbohrt. Ein Schrei, wieder wollte sie entkommen, doch das hohe Bett verhinderte es, er hielt sie an den Hüften, die weiteren heftig geführten Stöße erschütterten den kräftigen Körper, es dauerte lange, bis ihre Abwehr ganz erlahmte; als die kräftigen Salven ihr Innerstes trafen, gab sie ermattet nach. Beim zweiten Ansturm überwältigte sie der Kitzel vollends und danach hatte es Gunther leicht, das Spiel fortzuführen, bis sie sich nicht mehr rührte. Kaum hatte sie sich erholt, wurde sie wieder geschwächt. So erstürmten viele kleine Recken ihre Festung. Am nächsten Morgen war ihre Kraft gebrochen. Seit dieser Zeit war Brunhilde ihrem Gatten untertan. Am Ende hatte Siegfried als Beute Gürtel und Ring Brunhildes mitgenommen, was später zu den unseligen Morden führte.
E.: Haben denn deine Augen keine Lust beim Zusehen? Das Herz aber reicht ja aus nach Saint-Exupery.
Eine andere Erinnerung, sommersonntagfrühnachmittags war alles still, auch auf der Hauptstraße. Ich saß auf der Treppe vor unserem Haus in der hellen Sonne und träumte vor mich hin, die weißen Tauben des Nachbarn pickten auf der Straße, da kam ein großer, offener schwarzer Mercedes mit unverminderter Geschwindigkeit daher, ich höre noch die klatschenden Töne der Reifen auf dem Blaubasalt, weiße Federn flogen plötzlich umher, ich meinte, die Insassen des Autos jubelten auch noch, vielleicht aber auch nicht, ich lief schreiend ins Haus, seitdem kann ich keinen Mercedes mehr leiden.
N.: Du bemühst dich als Psychoanalytiker, Dilettant!
E.: Das hat mit Psychologie nichts zu tun.
Du musst mir mit der Psychologie kommen, der Wissenschaft, die beansprucht, therapeutisch tätig sein zu können mit ihrem Geschwätz. Was für Versprechungen kann sie denn machen, um zu trösten – keine! Christentum dagegen ist als Psychotherapeutikum vertretbar. Es verspricht mit seiner infamen Lüge wenigstens die Wiederauferstehung und das Wiedersehen mit den Lieben, der Islam das Paradies. Dagegen ist die Psychotherapie wirkungslos.
Wann habe ich überlegend gehandelt, so mit sechs, sieben Jahren? Das kindliche Versteckspielen, immer noch ein beliebter Sport heute, wie ich merke, war auch für uns lange Zeit eine nimmermüde Beschäftigung, einer hielt sich die Augen zu und zählte bis zehn, der andere rannte, so schnell er konnte, sich zu verstecken. Die Begrenzung war ein Häuserblock. Start vor unserem Haus. Anstatt mich aber statisch zu verbergen, lief ich mit höchster Geschwindigkeit um den Block, sodass ich den Sucher bald von hinten sah, der mich immer vorn suchte. So war ich meistens der Gewinner.
N.: Du warst doch nur bauernschlau, Kerlchen!
E.: Ansonsten war das sogenannte »Köppen« ein beliebter Sport, welche Größe von Ball uns auch in die Hände fiel, er wurde benutzt. Das Tor, die Bürgersteigbreite, der Abstand circa drei Meter. Der Ball wurde nicht sehr hoch geworfen und mit einer seitlichen Schleuderbewegung des Kopfes mit möglichst großer Beschleunigung ins gegnerische Tor gestoßen, natürlich meist in die unteren Ecken. Ich brachte es hier auch zur Meisterschaft und verlor selten.
Im Winter kamen die Schlitten zur Geltung, man konnte selbst auf der Straße fahren, denn Autos gab es wenig. Die Großen gingen abends auf den Pf. Berg und wenn die Straße glatt war, fuhren sie bis zum unteren Bahnhof, es war für sie ein Riesenspaß, denn sie saßen immer sehr eng. Um nicht durch Bremsen, was zum Steuern einzelner Schlitten nötig war, Geschwindigkeit zu verlieren, wurden die Schlitten miteinander beweglich verbunden, sodass zuweilen eine lange Schlange entstand. Wehe, wenn ein Schlitten kippte, alle anderen fielen dann auch um. Wir, die Kleineren, hatten andere Strecken, kürzer und steiler, zum Beispiel die Hohle oder das Möllwerchen runter. Während andere gemeine Davosschlitten oder »Jippen« hatten (es waren einfache, aber stabile, kastenförmige Gebilde mit Eisenkufen, auf denen man meist liegend fahren musste) hatte ich einen Rennschlitten, wohl noch von meinem Vater gekauft, mit trapezförmig ausgestellten Kufen, oben schmaler vorn höher als hinten, mit Gurtsitzen, hinten nur zwanzig Zentimeter hoch, und zwei Hörnern, an denen man hinter sich greifend lenken und sich festhalten konnte. Am unteren Ende der steilen Strecke stand quer ein Hindernis in Form einer natursteinernen Scheunenwand, die umfahren werden musste, um über die Hauptstraße den Kirchrain wieder hinaufzukommen. Die Schnelligkeit konnte man daran ermessen, wie weit der Fahrer den Kirchrain heraufgekommen war. Nicht wenige scheiterten an der Mauer oder ließen sich vorher vom Schlitten fallen. Ich kam aufgrund meines besseren Materials immer am weitesten.
N.: Sieh einer an, was für ein Angeber!
E.: Es waren alle Jungen ohne Unterschied der Klassen dabei, mir war nicht bewusst, dass es sie gab, erst später mit zehn Jahren ließen sie mich den Unterschied spüren. Mein bester Freund K. wohnte bei seinen Großeltern in, wie mir gar nicht klar wurde, ärmlichsten Verhältnissen, er war ein uneheliches Kind, die Mutter arbeitete in K. Mir sind noch seine grünen Schneidezähne in Erinnerung, sie wurden nie geputzt. Unsere Nachbarn mit ihren Kindern waren fast alle Arbeiter in Zeche und Tongruben, grundehrliche Menschen mit einwandfreiem Charakter. Ich habe weder von meinen Großeltern noch von meiner Mutter abfällige Bemerkungen über sie gehört, im Gegenteil, sie haben sie sehr geschätzt.
N.: Na ja, die sollten ja auch bei ihnen kaufen.
E.: Ich wusste damals noch nicht, wo ich herkam, dass mein Großvater ein »richer« Mann war und damit auch seine Tochter und ich, obwohl mein Vater und sein Bruder mit einer Fabrik in Konkurs gegangen waren.
Meine sommerlichen Fahrerlebnisse begannen mit einem vom Stellmacher handgemachten Handwagen, er war angeschafft worden, damit ich, wenn es erforderlich war, Brot und Brötchen der Bäckerei meines Großvaters den Kunden brächte, besonders viel Spaß machte es mir, wenn die Steigerfamilien beliefert werden mussten. Es war einfacher, bergab zum Ostbahnhof zu fahren, als ihn den Berg hinaufzuziehen und durch den Wald dorthin zu gelangen, denn es führte eine Seilbahn von den Gruben zum Ostbahnhof, die dort die Kohle und den Ton auf Güterwagen weitertransportierten. Die leeren Loren fuhren zurück. Es gruselte mich immer, wenn ich die steilen Treppen der Seilbahnstation unter dem lauten Gepolter der Eisenloren hinaufkletterte, die mit für mich großer Geschwindigkeit in den vorn offenen und hoch über dem Boden gelegenen Schlund befreit vom Zugseil heranrasselten und, geschickt von den von mir bewunderten Männern gebremst, ihren Inhalt auf schräge Ebenen, die zu den Güterwagen führten, kippten. In gleichem Abstand wurden sie dann aufgerichtet, umgelenkt und gefesselt am Seil wieder auf die Reise nach oben geschickt. Da rein kamen dann die Brote und Brötchen, ich sah sie mit Grausen über dem Abgrund schweben.
N.: Wie ich weiß, hast du bis heute das Grausen vor Abgründen nicht überwunden.
E.: Der Bursche mischt sich auch überall rein!
Das war die nützliche Seite meines Wagens, es gab aber eine noch viel schönere. Man konnte im Wagen, vorn sitzend, die Deichsel zwischen die Füße nehmen und damit lenken, auf dem Basaltpflaster rutschten die eisenbewehrten Räder bei jeder Kurve so, dass, heute bezeichnet man es als powerslide, die hinteren Räder nach außen gingen, der Wagen übersteuerte und so um die Kurve schlidderte, ein Heidenspaß, die steile Straße hinab. Bremsen gab es nicht, um zum Stillstand zu kommen, war dieselbe Taktik im übertriebenen Zustand notwendig, indem man den Wagen quer zur Fahrtrichtung stellte. Auf der Ebene sich fortzubewegen war ebenfalls möglich, man saß hinten im Wagen, mit dem Rücken zur Fahrtrichtung, stieß sich mit den Füßen abwechselnd ab und da die Deichsel nach hinten geschlagen war konnte man den Wagen auch lenken. Alles in allem ein großes Vergnügen, das man den ganzen Tag betreiben konnte. Es wurde immer mehr gewagt, selbst der steile, nicht befestigte Weg den Schw. Berg runter wurde im höchsten Tempo genommen. Übrigens war der Wagen grün gestrichen und hielt alles aus, so gut war seine Qualität.
N.: Noch heute hält dich dieser Spleen gefangen.
E.: Ich lebte eine Zeit lang in M. bei meinem Onkel und ging auch dort zur Schule in einem Haus, das damals schon im Garten einen Swimmingpool hatte, in dem ich mit einem Floß, es bestand aus einer Holzbohle, herumpaddelte und schwamm.
N.: Du hast ganz vergessen, dass du einen großen Wasserkäfer erschlagen hast, du Tierfreund.
E.: Du bist so gemein, mich daran zu erinnern, ich leide heute noch unter dem Anblick – seine im Tod gespreizten Flügel. So was solltest du nicht tun.
N.: Meine Bosheit ist mit mir durchgegangen, aber nur für den Bruchteil einer Sekunde, ich bin betrübt.
E.: Außerdem stand mir ein Damenfahrrad zur Verfügung, ich fuhr wild auf den Gartenwegen, möglichst schnell und, zum Ärger der Hauswirtin, die Rasenecken abschneidend. Die Wege waren mit rundem Kies gestreut und so konnte ich meinen powerslide auch auf zwei Rädern unter Bremsen des Hinterrades ausführen.
N.: Wenn das einer heute in deinem Garten täte, oh weh!
E.: Ich war der »Saupreiß« in der Klasse und musste mich gegen mancherlei Angriffe der »Bazis« wehren. Aber bald kämpften wir mit gleichen Waffen, ich hatte auch einen Hirschfänger in der Seitentasche meiner bayerischen Lederhose, auf dessen Klinge wir immer mit den typischen Gesten anzeigten, wie weit der Spaß ging. Ich muss wohl auch bald ein Bayerisch gesprochen haben, was mich dann nicht mehr von den anderen unterschied, in der Gefolgschaft hatte ich August und wir zwei waren nicht mehr angreifbar.
N.: Wie immer tapfer mit dem Maul.
E.: Die Würm war ein klares Flüsschen, wenn auch flach, hier wurden die ersten grundlegenden physikalischen Versuche gemacht, V = Weg / Zeit, mit Holzstücken unter der Brücke hindurch.
N.: Viel mehr verstehst du heute auch nicht von der Physik.
E.: Dieser unverschämte Bube, warte, später zahle ich es ihm heim. Ein wertvolles Geschenk meines Onkels war ein Schuco-Auto, offen, weiß, mit Gangschaltung, auch ein Lotsenboot, schraubenlos, mit einem pulsierenden Rückstoß-Dampfantrieb, praktisch einem gepulsten Antrieb, ein flacher Kessel im Boot wurde mit einer Flamme erhitzt, der obere Teil des Deckels war eine Metallmembran, die durch den Dampf, aus angesaugtem, erhitztem Wasser erzeugt, angehoben und gedehnt wurde und die dann aufgrund ihrer Eigenelastizität in ihre Ausgangslage zurückfederte und den gepulsten Dampf durch zwei unter dem Wasser liegende Auspuffrohre ausstieß und so den Vortrieb bewerkstelligte. Ich habe dieses Prinzip bis heute noch nicht wieder gesehen.
An zwei Begebenheiten erinnere ich mich noch deutlich, denen ich entnehmen kann, dass ich nicht wusste, dass es zwei Religionsrichtungen gab. Ich blieb immer im katholischen Religionsunterricht sitzen und hörte mir an, was der Pater alles Schönes erzählte. Er malte einen Kelch an die Tafel, schwungvoll und in Farbe, Heilige, Brot und andere Dinge, um den Kindern das Erklärte auch bildlich nahezubringen. Ich nahm schon einige Zeit an diesem Unterricht teil, als ich plötzlich aus der Klasse gewiesen wurde, ich war Protestant. Ich nehme an, Kelch, Brot und anderes waren wohl unterschiedlich in den Konfessionen. Im Übrigen faszinierte mich nur die illustrierte Geschichte, den religiösen Hintergrund habe ich damals und auch später nicht begriffen.
N.: Typisch Atheist von klein auf.
E.: Das geht dich überhaupt nichts an, und übrigens, euer sogenannter Glaube ist auch keiner, Superquantler der Unsterblichkeit im Omegapunkt, vielleicht könnten dir die Gammas besser weiterhelfen mit ihrer Fähre (Sphäre) anstelle der sich selbst reproduzierenden Individuen, die mit 0,99-facher Lichtgeschwindigkeit den Kosmos erobern wollen. Tipler ist ein typischer Beweis dafür, welchen Unsinn man mit Formeln treiben kann.
Und wie hältst du es übrigens mit dem Gefühl in deiner Quantenwelt?
N.: Ganz einfach, kennt man seinen Ort (Ursache), so kann man seinen Weg nicht verfolgen, verfolgt man seinen Weg (die Entwicklung) ist es nicht zu orten. So nach Heisenberg, man kann es auch nach dem Tao auslegen, nennt man, fasst man, begreift man es, will man es denkend unterscheiden oder in ihm Unterschiede sehen, es wendet sich zurück ins Nichtsein. Es erblickend, sieht man nicht sein Gesicht, ihm nachfolgend, sieht man nicht seinen Rücken.
E.: Bravo! Du lebst immer unscharf und komplementär.
Ich geriet auch ins politische Fahrwasser, Herr Hitler war auf dem Höhepunkt seiner Beliebtheit, sein alter Kampfgenosse und Fahrer Herr Schreck wohnte in einem schönen Bayernhaus um die Ecke. Ein großes schwarzes Mercedes-Cabriolet stand oft vor der Tür und wir Buben waren begeistert, Herrn Schreck, der es pflegte, dabei, wenn auch nur symbolisch, zu helfen. Der »Führer« besuchte ihn öfters, als er einmal auf der Veranda stand, konnte ich ihn mit erhobenem Arm begrüßen, was er lächelnd erwiderte.
N.: Ich hab es ja immer geahnt, wie leicht du zu verführen bist.
E.: Einmal war ich auch mit meinem Onkel bei einer Flugschau, ich glaube, es war das Oberwiesenfeld, ich müsste nachsehen. Ernst Udet war da und Elly Beinhorn, die holpernde Curtis von Udet auf dem Rasen ist mir noch in Erinnerung, ich meine, vielleicht auch nur in meiner Fantasie, es könnte aber auch wirklich gewesen sein, ich bin zum ersten Mal mitgeflogen im Tiefdecker von Elly Beinhorn.
N.: Da haben wir’s, bei dir vermischen sich Fantasie und Realität.
E.: Als ich wieder nach Hause kam, muss ich ein so abscheuliches Bayerisch gesprochen haben, dass mich die Hessen nicht verstanden, aber auch das verlor sich.
Mein Betragen war, wie ich aus meinen Zeugnissen sehe, immer gut. Grundschule in Gr.:
Erstes Schuljahr Religion, Rechnen, Deutsch, Heimatkunde und Musik, 1934/35, alles ziemlich gut.
Der Klassenlehrer ist mir noch gegenwärtig, mit einem vollen gutmütigen Gesicht, wie der junge Hindenburg, es war der mit den Nibelungen. Rektor H. trug eine Mähne gewellten, grauen Haares, er verfasste ein Heimatspiel, das zu jedem Heimatfest aufgeführt wurde. Es handelt von der berühmten Zeit der Glasbläser, »Die Waldgläsner«, ein Heimatspiel auf geschichtlicher Grundlage, in sechs Bildern von A. H.:
»Jörje, Jörje, bist du’s wirklich, Kerl, alter Kerl, wo hat’s dich dann hin verschlagen, hab dich so manches Jahr nit gesehen, seit wir bei unserem Meister F. G. am H-Berg vorm Ofen gestanden.« Es handelt sich um meine Vorfahren, von der Beschränkung des Handwerks der mächtigen Glasbläserzunft, Gläsnergericht 1557.
N.: Du tust grad so, als wenn es nur deine gewesen wären, so viel Gene wie du von ihnen hast, habe ich auch.
E.: Wissenschaftlich gesehen ja.
In der städtischen Mittelschule fielen meine Noten ab, alles befriedigend, bis auf Turnen gut, Religion, Deutsch, Englisch, mangelhaft, Geschichte, Erdkunde, Rechnen, Biologie, Zeichnen, Musik, Handschrift mangelhaft, 24.3.39.
Mein Klassenlehrer, Herr B., ist der einzige Lehrer geblieben, der mich nicht mochte. Das kam so, er hatte damals eine chronische Pyodermie im Bereich seines Bartes, die ohne Erfolg therapiert worden war, ich muss wohl, mir nicht mehr erinnerlich, eine Bemerkung darüber gemacht haben, die er nie vergaß, ich kann ihn heute verstehen.
N.: Du bist schon immer ein bisschen giftig gewesen, wie ich höre.
E.: Der sportliche Direktor Herr H. fiel leider im Krieg. Weil ich auf die höhere Schule gehen wollte, hatte ich privaten Lateinunterricht, es war Herr Pfarrer S., der mir die Anfangsgründe beibrachte, es gab keine Noten.
N.: Er muss voll Altruismus gewesen sein, so einem Ungläubigen etwas beibringen zu wollen.
E.: Eine wilde Zeit, in der ich mit D. weit durch die Wälder streifte, die Tongruben nach Arbeitsschluss besuchte, die mächtigen, rasiermesserscharfen Beile der Tonhacker ausprobierte. Einmal traf das Ende des Beiles den prallen hellbraunen Oberschenkel meines Freundes, heraus sprang zu unserem Entsetzen ein großer Rubin, die Narbe zeigt er mir noch heute. Küchenmesser richteten wir so her, dass man damit werfen konnte, das hieß, ihre Klingen beiderseitig anzuschleifen, wozu eine handbetriebene Schleifscheibe gekauft wurde. Sie steckten gezielt in den Baumstämmen. Unsere Mutprobe bestand darin, sich auf die schmalen Träger der hohen Seilbahnmasten zu stellen und uns zuzuwinken.
N.: Ist das wahr, bei deiner Angst vor einem Abgrund, du hast doch Angst, von einem Hochhaus oder einer Klippe herunterzuschauen.
E.: Im Winter konnten wir Schlittschuh laufen, wenn nicht auf den hart gefrorenen Bürgersteigen, so dann auf den kleinen Seen der Tagebauten. Karl May war unser beliebtester Schriftsteller, von dem D. und seine Brüder fast alle Bände besaßen.
N.: Da warst du sicher Old Shatterhand in deiner Einbildung.
E.: Der lässt wirklich kein gutes Haar an mir.
Zur Abwechslung ein Portrait meines Großvaters, geboren im September 1864, er hat mir nicht viel aus seinem Leben erzählt, ich bin auf andere Quellen angewiesen, die folgende mag ihn charakterisieren:
Mein Großvater und die beleidigte Stadtverwaltung.
Er war eine stadtbekannte Persönlichkeit, er entstammte einer alten Gläsner- und Töpfersippe, die schon seit dem 17. Jahrhundert den Beinamen Humme führte. Er war von gedrungener Figur, ein Paar helle kluge Augen im Kopf, ein sparsames, oft listiges Lächeln spielte um den herben Mund. Er erlernte bei seinem Vater das Bäckerhandwerk, schon sein Großvater war Bäcker gewesen. Vom 9. August 1893 datiert ein Beschlussprotokoll des Stadtrats folgenden Inhalts:
Betrifft: Antrag des Bäckermeisters zu G. auf Erteilung des Ortsbügerrechts daselbst betreffend.
Beschluss: Der Bäckermeister F. G., da hier geboren am 4. September 1864, wird hierdurch zum Ortsbürger hiesiger Stadt aufgenommen, wofür derselbe 1,50 Mark Bürgergeld, 3 Mark für einen Feuerlöscheimer und 75 Pfennig für einen veredelten Obststamm zur hiesigen Stadtkasse einzuzahlen hat.
Rüppel.
F. G. war nun ein wohlbestallter Ortsbürger seiner Heimatstadt. Bei seiner leichten Auffassungsgabe und dem schnellen Erfassen der wesentlichen Dinge war er ein wertvoller und anerkannter Mitstreiter bei der Beratung gemeinsamer Anliegen. Daneben ging aber auch sein Temperament mit ihm durch, wenn seine Vorschläge nicht den erhofften Beifall fanden und der harte Hummenschädel nicht nachzugeben und einzusehen imstande war. Er hat es zu einem wohlhabenden Bürger gebracht. Es genügt demnach nicht, dass man nur Handwerker zu sein braucht, um Vermögen zu erwerben, es gehört auch eine gewisse Intelligenz und ein Geschick dazu, mit dem Erarbeiteten nach kaufmännischen Grundsätzen umzugehen und den Erwerb zu verwalten.
Ich füge hinzu, er hatte auch manchen Fehlschlag zu verzeichnen und machte zuweilen Minus, wenn er, wie meine Großmutter zu sagen pflegte, den » Bankier« spielte. Ich erinnere mich, dass ich einmal mit meiner Mutter, die er immer ausschickte, das Geld einzutreiben, in Magdeburg war, um Geld abzuschöpfen, wie es so schön heißt, der Gläubiger hatte ein Café und eine Konditorei inmitten der Stadt, alles lief auf den Namen seiner Frau, wir haben nur ein Kaffeekännchen aus Porzellan mitgenommen, sozusagen als Andenken.
Der in Jahrhunderten in der Sippe genährte und streng bewahrte Handwerkerstolz war ihm bis ins hohe Alter geblieben und nur so ist es zu verstehen, dass er dem inzwischen mächtig gewordenen Polizei- und Verwaltungsapparat seinen traditionsbewussten Berufsstolz entgegensetzte. Er hatte ein Gesuch an den Stadtrat um das Ausschankrecht von Wein und Bier eingebracht. Der Stadtrat hatte aber dem nicht entsprochen. Das hat den standesbewussten Bäckermeister schwer gefuchst. Gerade hatte er erst vierzig Mark Steuern an die Stadtverwaltung gezahlt, für das Jahr 1903 eine schöne Summe. Da kam ihm ein Einfall. Flugs fertigte er zwei Pappen, die auf beiden Seiten des Geschäftsschilds angebracht wurden (das Schild bestand aus einer schwarzen Tafel, die durch einen Schlitz vom Hausflur aus nach draußen geschoben werden konnte, über einen Meter lang, sie wurde mit Kreide beschriftet und enthielt allerlei Bekanntmachungen, die Bäckerei und Konditorei betreffend und folgende Ankündigung trugen: Bitte umseitig lesen, einer sage es dem anderen. Auf der anderen Seite: Hier kann man vorläufig noch kein Bier und keinen Wein trinken, aber guten Kaffee, Tee und Schokolade. Das hatte nun wirklich einer dem anderen gesagt und wie ein Lauffeuer ging dieser Ulk von dem durch die Ablehnung schwer Gekränkten durch die Stadt. Ein Stadtpolizist wurde geschickt und berichtete dem ebenfalls in Harnisch geratenen Bürgermeister von diesem Bürgerstreich. Schnell wurde die amtliche Erregung zu Papier gebracht und dem unerschrockenen Bäcker zugestellt.
Die Polizeibehörde
| I Nr. 1099 | G., den 28. März 1903 |
Wie mir amtlich gemeldet worden ist, haben Sie an Ihrem Haus ein Schild angebracht mit der Aufschrift: Hier kann man vorläufig noch kein Bier und keinen Wein bekommen, aber guten Kaffee und Kakao. Auf der Rückseite des Schildes steht geschrieben: Auf der einen Seite lesen und den anderen sagen. Die erstere Aufschrift ist nichts weiter als eine unbotmäßige und höhnische Bemerkung gegenüber der hiesigen Polizeibehörde und dem Magistrat, da Ihnen bekannt ist, dass Ihr Antrag auf Erteilung der Erlaubnis zum Ausschank von Wein und Bier diesseits nicht befürwortet werden konnte.
Ich verbiete Ihnen deshalb hiermit, das fragliche Schild mit obiger oder einer ähnlichen die Behörde verletzenden Bemerkung auszuhängen.
Sollten Sie diesem Verbote dennoch zuwiderhandeln, so wird auf Grund des § 132 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 eine Geldbuße von 60 Mark, an deren Stelle, wenn sie nicht beizutreiben sein sollte, eine Haftstrafe von einer Woche tritt, gegen Sie festgesetzt werden.
Der Bürgermeister.
So massiv die Drohungen auch angezeigt waren, einen Hummenschädel konnte das nicht erschüttern. Noch am gleichen Tag konterte er mit dem folgenden Schreiben:
| An die löbliche Polizeibehörde dahier! | G., den 28. März 1903 |
Auf Ihr heutiges Schreiben, wonach Ihnen eine amtliche Mitteilung gemacht worden ist betreffs der Aufschrift auf meinem Schild, so muss ich darauf aufmerksam machen, dass Ihnen die Aufschrift des Schildes nicht richtig angebracht worden ist. Ich werde das Schild noch auf etliche Tage so belassen, damit der Betreffende es richtig lesen möge, um dann die richtige Lesart nach dorten zu melden.
Auf die weitere Anmerkung, dass die Aufschrift des Schildes eine unbotmäßige und eine höhnische Bemerkung gegenüber dem Magistrat und der Polizei darstelle und eine Anspielung daraus zu erblicken sei, weil mein Gesuch um Genehmigung von Ausschank von Bier und Wein von hier aus nicht befürwortet werden konnte, kann ich nur mitteilen, dass die Aufschrift des Schildes viel früher angebracht war, ehe nur daran gedacht war, um Genehmigung von Bier-, Wein- etc. -ausschank einzukommen. Irgendwelche Verletzung der erwähnten Behörde liegt mir durchaus fern und Unbotmäßiges kann ich daran nicht finden. Ich kann mich sonach nicht damit einverstanden erklären, die Aufschrift zurückzuziehen. Ich bin Geschäftsmann und suche auf ehrliche und redliche Weise mein Brot und dieses bezweckt die Aufschrift des Schildes. 40 Mark habe ich als Steuer geopfert und suche solche zu verdienen. Man wolle also dorten die Sache von der guten Seite betrachten und das gute Einvernehmen wohl erhalten.
Stets dem Wohle der Stadt dienend zeichnet gehorsamst …
N.: Da kannst du dir ein Beispiel nehmen, das war noch ein Mann aus echtem Schrot und Korn.
So empfindlich reagierten um die Jahrhundertwende Polizei und Behörde bei einer so harmlosen Missfallensäußerung. Der Fall ist aber typisch für jene Zeit. Heute würden kein Hahn und kein Huhn danach krähen.
E.: Während meine Mutter sich um meine Erziehung kümmerte, damit einmal etwas aus mir werde, hatte mein Onkel, der Lehrer, zu ihrer Enttäuschung einmal geäußert: »Er«, er meinte mich, »hat das Pulver nicht erfunden.«
N.: Hihihi, wie recht er hat.
E.: Sie ließ sich nicht entmutigen.
Es war meine Großmutter, die mich bemutterte. Ihre Fürsorge hat sich tief in meiner Erinnerung verankert und meine Achtung und Sorge um alte Leute geprägt, so auffällig für manche, dass mir einmal zu Weihnachten von meiner Station eine Puppe, die eine alte Dame vorstellte, geschenkt wurde, mit einem gehäkelten Einkaufnetz, in dem Medikamente waren. Die vielen Äpfel, die sie mir schälte, der gekühlte Hagebuttentee mit Zitrone, den ich, durstig von meinen Abenteuern, bekam, ihr Verständnis für meine Taten, die meiner Mutter nicht immer recht waren, zeugten für ihre Güte. Sie war vielleicht dafür verantwortlich, dass ich nie Prügel bezog, selbst einmal, als ich nicht pünktlich nach Hause kam und meine Mutter drauf und dran war, mich zu bestrafen. Dabei war es diesmal nicht einmal meine Schuld. Eine Begebenheit, die ich meiner Mutter und auch sonst niemandem erzählte.
Ich hatte ein Fahrrad bekommen, Marke Panther, funkelnagelneu, am Ostbahnhof befand sich, von der Straße durch eine, heute würde man sagen, Leitplanke abgegrenzt, ein Abhang mit einer darunter befindlichen Mauer, vielleicht mehr als zwei Meter hoch. Ein schmaler Pfad war noch hinter der Planke, also zwischen Planke und Abhang. Ich sollte nun beweisen, ein Freund oder mehrere waren mit mir, dass es mir möglich sei, auf diesem schmalen Pfad zu fahren. Ich verlor die Balance, erreichte mit meinem Fuß wegen der auf dem Herrenfahrrad vorhandenen Längsstange und dem abfallenden Hang nicht den Boden, fuhr und stürzte samt Fahrrad den Abhang hinab zu der Mauer.
N.: So kommt Hochmut vor dem Fall!
E.: Hier ist Spott wirklich nicht am Platz, du Ekel.
Als ich zu mir kam, war niemand mehr zu sehen, ich nahm mein Rad, es lenkte sich so eigenartig und ich bemerkte, dass es auf den Lenker gefallen und dieser nun auf einer Seite verbogen war. Jahrelang bin ich mit diesem Fehler gefahren, der mich immer an das Ereignis erinnerte. Aus der Sicht meiner heutigen Kenntnisse kann ich durchaus einige Zeit bewusstlos gewesen sein und glücklicherweise war das Rad nicht auf mich gefallen, der ich auch nicht unglücklich gestürzt war. Aber ich kam eben zu spät nach Hause, was mir meine Mutter übel nahm.
N.: Ich hab es ja immer gesagt, du bist auf den Kopf gefallen, eine Erklärung für vieles.
E.: Mein Onkel A., ein Stiefbruder meiner Mutter, kam in den Ferien nach A. Es war immer ein Ereignis für mich, da ich ja keinen Vater kannte, nur meinen Großvater hatte, der jedoch durch den Altersunterschied sich nicht so adäquat mit mir und meinen Belangen beschäftigte. Onkel A. war anders, sein Sohn, drei Jahre älter, kam nicht immer mit und blieb meist in K. mit seiner Mutter bei seinen Onkeln. Bei Spaziergängen lauschte ich gespannt seinen erfundenen oder nicht erfundenen Erzählungen mit seinem Pferd, der Blackfatty. Er war im Ersten Weltkrieg als Husar im Feld, unter dem alten Generalfeldmarschall Mackensen. Wenn ich auch die Abenteuer nicht mehr in Erinnerung habe, so doch, dass ich gespannt an seinen Lippen hing. Er war es auch, der mich sozusagen, wie ich heute weiß, auf das Hören von Klavierstücken trainierte. Er sagte zu mir: »Komm, wir gehen in die kalte Pracht.«, und meinte damit das gute Zimmer meiner Großeltern, das nur an Festtagen benutzt wurde und in dem das Klavier stand. Er konnte Liszt bravourös spielen, vom Blatt zuweilen, und ich bewunderte die zahlreichen, streng ausgerichteten schwarzen Reihen, wie Soldaten, denen er folgte, eilig, auf und ab. Es trieb mich auch an, die Biografie über Liszt mit Begeisterung zu lesen.
Meine Bewunderung stieg ins Unermessliche, wenn er noch zum Klavierspiel sang: »Tom, der Reimer saß am Bach …« Schlager und Walzer gingen ihm leicht von den Fingern, obwohl Klassik seine Stärke blieb. Er spielte in einem Quartett in S., daher seine Fertigkeit. Der modernen Musik war er abgeneigt, noch heute benutzen wir seine Bezeichnung dafür: »Es ist, wie wenn einer in einen Strumpf sch… und ihn die Treppe hinunterwirft.«
N.: Da siehst du, was für ein Banause du bist, von neuer Musik verstehst du überhaupt nichts.
E.: Mein Großvater vererbte jedem seiner Kinder ein Haus, eines davon bewohnte mein Onkel später, in einem Lloyd kam er ums Leben auf der Rückfahrt von einer Chorleitung, als er die Vorfahrt nicht beachtete.
N.: Ich hab es immer gewusst, in einem zusammengeklebten Pappkarton ist man sehr gefährdet.
E.: Er muss doch überall klugsch…
Aus dem alten Schulheft des Jahres 1939, in Sütterlinschrift, 27. Brachet, Juni 1939, ein Diktat:
Zigeuner
Auf der Wiese machten die Zigeuner Rast, ihr Haus führten sie mit sich, denn es ging auf Rädern. Es war ein schöner bunter Wagen mit hellen Fensterchen. Der Zigeunervater saß im grünen Grase neben den Frauen und spielte die Geige im Sonnenscheine. Er hatte langes schwarzes Haar, goldene Ringe in den Ohren und einen roten Gürtel um den Leib. Zu seinen Füßen saß ein kleiner brauner Junge, während eine ganze Schar anderer brauner Kinder sich in den Blumen tummelte, Frösche fing oder gar die kleinen silbernen Wellen des Flusses zu haschen suchte.
Gut 6.7.39
N.: Oben Brachet und unten Zigeuner, schizophren in der Zeit.
E.: Wie romantisch. Vielleicht aber auch ein Zeichen, wie weit wir von der Realität entfernt waren, wie behütet vor den Unbilden der Politik, die in unserer Familie nie einen Platz hatte. Ich meine, in der Umgebung meines Großvaters und meiner Großmutter, in der ich mich befand, denn meine Mutter arbeitete in der Kreissparkasse, der Direktor war ein Mann in brauner Uniform, ein »Goldfasan«, so nannte man die Funktionäre der Arbeitsfront. Er bedrängte meine Mutter, in die Partei einzutreten, sie hat sich erfolgreich dagegen gewehrt und wurde stattdessen Mitglied des Roten Kreuzes.
Ab dieser Zeit wird die Erinnerung schon farbiger, in der Schule war Sport großgeschrieben. Es machte mir Spaß, in allen Disziplinen konnte ich mithalten. Besonders erinnere ich mich an den »Völkerball«, zwei Mannschaften in einem geteilten Feld, wobei man mit dem Ball einen anderen Spieler der Gegenseite treffen musste. Wenn dieser den Ball nicht fing, war er draußen. Es kam immer dazu, dass zwei übrig blieben, Hansi und ich, es entwickelte sich ein heftiger Kampf unter dem Geschrei der Zuschauer, ich glaube, wenn man alles zusammennimmt, blieb es in den vielen Spielen unentschieden.
N.: Ob das stimmt?
E.: Ein anderer Wettkampf war es, wer am schnellsten die rohrförmigen Kletterstangen hinauf konnte, da war ich nicht der Schnellste. Es waren gemischte Klassen und allmählich interessierten uns natürlich unsere Mitschülerinnen.
Es war nicht die Anziehungskraft des Weiblichen, mehr machten wir uns über ihr Äußeres lustig. R. war ein großes Mädchen und unterschied sich damit von den anderen. Ihre Brüste hoben das dünne weiße Turnhemd, nur von den Trägern gehalten, ausdrucksvoll ab und aus der kurzen schwarzen Hose kamen kräftige Beine hervor. Schnell hatte sie den Namen weg, Milchkuh, Kinder sind grausam.
N.: Kinder, da muss ich kichern!
E.: Einen sexuellen Reiz hatte dies für uns nicht. Es kam ihr zu Ohren, denn wir wurden zu dritt vor den Rektor zitiert und gefragt, ob wir es gesagt hätten. Zögernd gaben wir es zu und versprachen, es nicht wieder zu tun.
N.: Wieder diese Gemeinheit – erst zögernd zu dem stehen und dann scheinheilig versprechen, es nicht wieder zu tun.
E.: Kurz vorher, ich weiß nicht wieso, war ich zum Vertrauten unseres Gesellen geworden, der mir seine schlanke, schwarzhaarige, siebzehnjährige Freundin zeigte, mir kam sie schon recht alt vor, und mich aufklärte, was es bedeutete, sich zu lieben. Er zeigte mir die Stelle, wo er es getan hatte und was nötig war, um zu verhüten, dass Kinder entstehen. Wenn das geschähe, würden die Brüste mit Milch gefüllt, aber bei R. sei es eine normale Entwicklung, ich hatte ihm unser Vergehen erzählt und ihm R. gezeigt, er meinte, sie seien schon ungewöhnlich groß für das Alter. Ich machte mir keine weiteren Gedanken darüber, hatte aber auch keine Schwierigkeiten, dies alles zu verstehen.
N.: Das meinst du heute!
E.: Das erinnert mich an die Spiele mit meiner Freundin L., ich war vielleicht acht, sie neun Jahre alt und wir erkundeten unter anderem den kleinen Unterschied in unserem Versteck. Es bestand aus zwei kleinen Räumen unter der Bodentreppe des Nebengebäudes, ehemals der Hühnerstall, der eine war zu ebener Erde, der andere konnte nur über eine Leiter erreicht werden, sie waren mit Bänken ausgestattet, die aus Brettern auf Backsteinen gemacht waren, und ausgelegt mit alten Decken. In der Tür oben war ein kleines Fenster. Wenn wir nicht gestört werden wollten, zogen wir die Leiter ein. Wir waren im Laufe unserer kindlichen Spiele darauf gekommen, als wir uns mit Salben, die ich meiner Mutter heimlich weggenommen hatte, an allen möglichen Stellen einrieben. Jedenfalls brachte sie es fertig, die Manschette zu lösen und was dazu nötig war, ich kann mich jedoch an ein entsprechendes Gefühl bei ihrem Bemühen nicht erinnern. Meine Untersuchung bei ihr ist mir noch erinnerlich, zwei Wülste widersetzten sich einer weiteren Besichtigung, weil sie sich immer wieder aneinanderlegten. Offensichtlich hatten die Eltern von L. etwas gemerkt und wir konnten nicht weiterforschen.
N.: Es ist nicht schicklich, dies zu erwähnen, übrigens warst du keine Ausnahme, Doktorspiele sind unter Kindern üblich.
E.: Jetzt spielt er den Moralischen, warte. Ein anderes für uns hübsches Mädchen mit einem schmalen Gesicht und einer fein geformten Nase interessierte meinen Freund und mich, sie war unnahbar, die Tochter eines Arztes, vielleicht war hier schon mehr Interesse am Weiblichen vorhanden, es gelang uns nicht, ihre Aufmerksamkeit zu erlangen, so suchten wir unsere Neugier auf anderem Wege zu stillen. Sie wohnte in einer Villa unterhalb eines Abhangs, von dem man, hinter Büschen verborgen, in den Garten schauen konnte. Wir legten uns dort mehrere Male auf die Lauer, um mehr zu sehen, vielleicht sie auch mal im Badeanzug, denn sie erschien nie im Schwimmbad. Kurios, es war die Stelle, die mir unser Geselle gezeigt hatte. Es blieb unser Traum. Nicht lange Zeit danach kam sie in ein Internat.
N.: Jetzt frag ich mich, was euch dazu getrieben hat?
E.: Neugier natürlich, du Kommentator.
Etwa zur gleichen Zeit hatte ich ein Erlebnis. Bei einem Kletterstangenwettbewerb muss man sich mit den Beinen festklammern, in dem Augenblick, in dem man sich mit den Armen hochzieht. Als ich fast oben war, überwältigte mich ein Gefühl, das ich noch nie gehabt hatte, und zwar so, dass ich beinahe die Kletterstange losgelassen hätte. Ein Verlangen danach bildete sich aber erst später aus. Einige weitere, halb unschuldige Begebenheiten verschweige ich lieber, sie könnten Anstoß erregen.
N.: Es könnte Anstoß erregen, es hat Anstoß erregt!
E.: Du alter Heuchler, warte nur, bis herauskommt, was du gemacht hast!
Moralische und unmoralische Neugier.
Die Neugier, die die Moralisten nicht zu den Leidenschaften zählen wollen, ist eine schöne Eigenschaft des Geistes, wenn sie sich lobenswerterweise mit der Natur beschäftigt; nihil dulcius quam omnia scire, nichts ist so süß, wie alles zu wissen. Dabei gehört die Neugier zum Bereich der Sinne, denn sie kann nur den Wahrnehmungen und Eindrücken entspringen. Aber sie ist ein Laster, wenn man in die Angelegenheiten anderer eindringen will, ob sich nun der Neugierige direkt oder indirekt Kenntnis darüber verschaffen möchte oder ob er einen Menschen ausfragt, um einem anderen mit dem Erfahrenen nützlich zu sein, vielleicht auch, um es zum eigenen Nutzen auszuwerten; Neugier ist immer verwerflich oder krankhaft, weil der Geist eines von Natur aus Neugierigen stets unruhig ist. Ein erschlichenes Geheimnis gleicht einem Diebstahl. Ich meine nicht jene Art von Neugier, die mit Hilfe der abstrakten Wissenschaften die Zukunft oder Dinge, die nicht in der Natur liegen, zu enthüllen bestrebt ist. Giacomo Casanova.
N.: Na, da hast du deine unmoralische Neugier.
E.: Das muss gerade der sagen.
Diese Ereignisse in meiner frühen Jugend führten keineswegs zu erotischen Gefühlen oder Handlungen, man war noch immun. In der Erinnerung werden sie dann aus der Gefühlswelt eines Erfahrenen heraus dargestellt, der die Dinge durchschaut.
N.: Du Unschuldiger.
E.: Inzwischen war ich in das Jungvolk gekommen, wie viele meiner Mitgenossen völlig ahnungslos, was dies bedeutete. Eine Uniform, braunes Hemd, ein schwarzes Tuch, das durch einen geflochtenen Lederknoten gezogen, getragen wurde, schwarze Hose aus festem Stoff. Im Winter darüber eine dicke Jacke im Uniformstil.
Im sogenannten Heim wurde gesungen, es wurde marschiert und es wurden Geländespiele durchgeführt, in denen die Roten und die Grünen (nicht wie heute die Blauen) sich bekriegten. Wenn man einen Gegner abklatschte, war er aus dem Spiel. Es machte natürlich Spaß, sich im Gelände zu verstecken, alles in der heimischen Umgebung, besonders die Wälder waren mir vertraut. D. und ich hatten sie jahrelang durchstreift. Im Heim wurden auch Geschichten erzählt und die waren auf mich gemünzt, das heißt, auf meinen Großvater.
K., der Geselle meines Großvaters, hatte auch die Aufgabe, in unseren vier Gärten Äpfel zu pflücken, als ich älter war, musste ich ihm helfen. Es gab nur Holzleitern, handgemacht und, wenn sie lang waren, schmal. Er stieg geschickt auf die Äste und füllte einen Sack, der mit einem Seil an zwei Zipfeln befestigt ihm über der Schulter hing. Eine Sorte war recht grün und schmeckte etwas sauer, die wurden zu einer Kelterei gebracht, die Apfelsaft daraus herstellte, der im Café angeboten wurde. Die anderen, Gravensteiner, Rauhäpfel, Boskop und Goldparmäne, wurden in großen Regalen im Keller, einem kunstvoll in Sandstein gehauenen Gewölbe, aufbewahrt. Meist war ich derjenige, der abends mit einer Kerze, Taschenlampen waren etwas Besonderes, dort hingehen musste, um sie meiner Großmutter zu bringen, die sie schälte und als Leckerbissen (er war es auch) servierte. Tagsüber stand es mir frei, so viel davon zu essen, wie ich wollte.
Ich muss meinen Bericht unterbrechen.
Erinnerung an Anka. Mir kommen Tränen.
N.: Was soll das denn?
E.: Wenn du jetzt dazu deinen Kommentar gibst, schlage ich dich windelweich, meine Gefühle gehen dich nichts an.
Nach langem Zögern will ich nun von Neuem beginnen. In der Zwischenzeit hatten andere Gedanken mein Denken gelähmt, es war nicht möglich zu schreiben. Es musste erst eine Zeit vergehen, aber auch jetzt kann ich meine Tränen nicht zurückhalten, wenn ich daran denke, dass, wenn ich hinuntergehe, mich kein aufmerksamer Blick mehr empfängt, dass das Köpfchen nicht erwartungsvoll gehoben wird und ich nicht mehr darauf antworten kann, indem ich es in die Hände nehme und streichele. Für mich bleibt das Vergangene körperlich gegenwärtig, sie sind noch alle da, eine meiner Fähigkeiten, mit den Dingen fertig zu werden. Sie sitzt neben mir, wartet auf H., wenn sie mit mir oben ist, ungeduldig, wieder nach unten zu können, an einer Bewegung merkt sie, jetzt ist es so weit und sie stürzt die Treppe hinunter zur Haustür, mit übermütigen Sprüngen, die Bewegung ihres ganzen Körpers zeigt die Freude, springt in den Garten zur Begrüßung. Es ist auch jetzt keine Schwierigkeit für mich, sie in die Arme zu nehmen, ihr Fell, ihre Muskeln zu spüren, wie sie sich wild losmachen will und mich dabei leicht in die Nase beißt. Wir haben sie beide unermesslich lieb, sie ist so schön, die Geschichte, Schweinchen Dick, ich sehe dich auf dem Brett, damit ihr nicht über die gefährliche Straße müsst, deine Mutter Lilly und du, auf der schiefen Ebene zu unserem Eingang mit einer Intensität heraufspringen, direkt in mein Herz, Lilly, ihre Mutter, hatte uns zuerst entdeckt, als wir wieder im Haus waren, du sechs Wochen alt, gucktest neugierig, wohin sie lief, mit gebogenem Rücken, die Hinterbeine zwischen den vorderen. Eine Liebe auf den ersten Blick. Jetzt hatte ich Angst, denn ohne dich konnte ich mir die herbe, liebliche Landschaft nicht vorstellen. Wir haben lange gezögert, es endlich gewagt, mit wie viel heimlich unterdrückten Tränen, die Rückbank der Mooney leer, kein Schnüffeln beim Landeanflug auf Ajaccio, kein freudiger Trott auf dem Flugplatz, alle vermissten dich, bis ich meinen Schmerz überwand, du bist noch immer dabei, dein Halsband in der Flugtasche. Dass du uns siebzehn Jahre lang Glück gebracht hattest, merkten wir auf dem Rückflug, das ist eine andere Geschichte.
N.: Ich bitte dich um Entschuldigung! Ich weiß um deine tiefe Liebe zu Tieren, zu deinen Hunden, du möchtest selbst einer Fliege nichts tun.
Du isst kein Fleisch. Tiere töten ist für dich Mord. Du verachtest die »Kadaverfresser« und bist machtlos gegenüber den übrigen 98 %.
E.: Meine Mutter hatte ein Faible, mich unkonventionell einzukleiden, ich trug bis über die Waden reichende braune Schnürstiefel, wie sie die Engländer bevorzugten. Außerdem wurden mir Knickerbocker und Weste mit vorn spitzen Enden aus lila Stoff mit Streifen geschneidert. Ich hatte auch so etwas, was man heute eine Gang nennt, eine treue Gefolgschaft, die mit anderen im Streit lag, harmlos damals, was mir so auffällt, wir lieferten uns Kämpfe, ohne dass wir uns körperlich nahe kamen, immer auf Distanz, so, wenn wir uns auf dem Holzboden, eine Etage hoch an der Hofseite, verschanzt hatten und die anderen uns zu erobern suchten. Wir wehrten sie ab, indem wir die gespaltenen Holzstücke, die dort lagen, als Wurfgeschosse benutzten, aber nie auf »den Mann » zielten, sondern vor die Füße, wir hingegen wurden von unten beworfen, hatten uns aber hinter den zu einer Mauer aufgestapelten Scheiten gut geschützt. Wegen der hohen Schnürstiefel die ich trug, wurde ich beneidet und »der lange Engländer« genannt. Während mir ein Klassenunterschied nicht bewusst war, bestand er wohl bei anderen, das merkte ich spätestens, als ich mit zehn Jahren im Jungvolk aufgenommen war. Um mich zu provozieren, erzählten sie Geschichten, Thema Erdbeerklauen in Hummens Garten. Sie waren köstlich, die sonnenwarmen Beeren, die man nach Anheben der Blätter entdeckte, heute ist mir verständlich, dass sie sie begehrten. Meine Großmutter hatte sie gepflegt, wie auch die Stachelbeeren; die Moosröschen in ihrer herben Schlichtheit hatte sie besonders gern, wie auch den Flieder, weiß und blau, den ich zum Sonntag schneiden musste. Humme war der Spitzname der Familie meiner Mutter, Mutzenkrause der meines Vaters und dann meiner, sie machten Anspielungen auf meines Vaters und seines Bruders Vergangenheit, die eine Fabrik besessen hatten, ihre Väter hatten dort gearbeitet. Als Gemeinstes ließen sie mich gegen einen wesentlich Stärkeren boxen, der mir entsprechend zusetzte, dass mir vor Wut die Tränen liefen, ich aber dann übermäßige Kräfte entwickelte und ihm die Nase blutig schlug. Trotz der »Schulung« in der sogenannten Hitlerjugend ist mir die Ideologie nie bewusst geworden, ich habe sie nicht verstanden. Mein Großvater unterhielt sich hinter verschlossener Tür in der Backstube am Abend öfters mit dem »Uhrenpuster«, einem kleinen listigen Männchen mit randloser Halbbrille, ich hörte nur einmal, was mir in Erinnerung geblieben ist, die Wendung »Kommunismus im Zylinder«, was auf Hitlers Regime gemünzt war. Sonst war Politik kein Thema in der Familie. Unser Geselle K., den meine Mutter sehr mochte – er fiel, wie man verbrämt sagte, im Polenfeldzug, von ihm lernte ich das Apfelpflücken, das Heu wenden in Schöpchensgraben, er machte mich auch zu seinem Vertrauten in Liebesangelegenheiten, zeigte mir das Mädchen, mit dem er ging, wo er sich mit ihm vergnügt hatte, ich weiß heute noch die Stelle, oben erwähnt, so einen Eindruck muss es auf mich gemacht haben.
Im Brockhaus meines Onkels fand ich unter Kryptografie allerlei Vorschläge, die ich, wie ich mich jetzt erinnere, nachmachte, ich bastelte zum Beispiel verschiebbare Streifen mit Buchstaben, eine drehbare Scheibe und mehr. Bis heute ist sie für mich interessant, die Enigma, Einwegverschlüsselungen mit Modulen und Primzahlen, abgesehen von Vigenère und der Würfelverschlüsselung, als Doppelwürfel nicht zu knacken.
Dennoch hat mich alles wohl nicht sehr beeindruckt, bis heute scheint vieles von mir abzuprallen, doch einiges dringt durch.
Antworten von mir lassen meist mehrere Deutungen zu, manchmal wusste man nicht, war es Spaß oder Ernst. Zuweilen weiß ich es selbst nicht. So perlte wohl auch der Nationalsozialismus an mir ab.
Wissensdurst: Nach Mord ist Liebe, wenn nicht Liebe, dann Sexualität am einprägsamsten. Ich erinnere mich noch sehr genau, wie ich mit L. den im wahrsten Sinne des Wortes kleinen Unterschied erkundete, wenn wir auch damit nichts anzufangen wussten, ist er mir noch gegenwärtig, ein vollkommen wissenschaftliches Unternehmen zum damaligen Zeitpunkt, ohne Gedanken dahinter. Da ich aufgeklärt war, konnte ich nun auf alle Fragen meiner Schulkameraden überlegen antworten und dachte mir, ob damals bei R. vielleicht nicht doch Milch drin gewesen wäre.
Ich lese Bücher parallel, durch die sich ein roter Faden zieht, den ich verfolge. Das philosophische Lehrbuch von Jaspers hin und wieder, es sind mir zwei Dinge aufgefallen, einmal zu Augustin, über den J. schreibt, er überschreite den innersten Seelenpunkt, ich kann damit wenig anfangen, eher schon das über Kant Gesagte, der mit seinem Denken das natürliche Denken überschreite. Für mich ist es nicht möglich, mit Denken das Denken zu überschreiten, es ist genauso, als wolle ein Mensch sich selbst überschreiten. Er meint vielleicht, Kant sei mit seinem Denken in Regionen gelangt, die ein anderer noch nicht erreichte. Herr Lederman bringt die Dinge wesentlich plausibler und es lohnt sich, zwischendurch zu Hawkins und Poundstone, Nomen est Omen, zu kommen, es ist manchmal mehr als ein Pfundstein, was sie bieten. Manchmal habe ich auch meine Vorurteile, Menschen, die mir unsympathisch sind, deren Ansichten lehne ich von vornherein ab.
N.: Vorurteile waren immer schon dein Laster.
E.: Und wie soll man ohne Vorurteile zu einem Urteil kommen, frage ich dich, du Besserwisser.
»Wilhelm Meisters Lehrjahre« ist mal etwas anderes, ich hätte nicht so viel Verstecktes erwartet, vom großen Dichter.
Seine geliebte M. hatte er unverständlicherweise verlassen. War er sich der Folgen bewusst, die seine Zuneigung zu M. hatte? Der Df. hatte wohl einige Gewissenskonflikte, was er einem moralischen Publikum zumuten konnte, ohne selbst unmoralisch zu erscheinen. Derbe, anzügliche Szenen hatte er so verfremdet, dass keine Gefühle dabei aufkommen konnten, er hätte es gewagt, sie bei anderer Gelegenheit zu präsentieren.
Heutzutage kann ein Romancier auch die erotischen Erlebnisse schildern, wobei das Wie seine schriftstellerische Qualität zeigt. Ich wage es einfach, es mag Vermessenheit sein, die Decke der Heuchler wegzuziehen und die Ereignisse zu schildern, wie sie wirklich waren. Hinter der Schilderung der Bekanntschaft W.s mit der späteren Frau M. verbirgt sich weitaus mehr. Er berichtet: Ich sah sie zum ersten Mal auf dem mit Stroh bedeckten Bauernwagen, ein junges Mädchen, eskortiert von grobschlächtigen Soldaten, was ihre Anmut besonders hervorhob, den daneben sitzenden Jüngling in Ketten nahm ich nur so nebenbei wahr. Vielleicht handelte es sich um ein Diebespaar, das man gefangen hatte, war mein erster Gedanke. Meine Neugier wurde erregt, als ich ihre bis über das Knie entblößten Beine sah und ihr junges Gesicht von wirren Haaren umrahmt. Ich erkundigte mich nach den Ursachen ihrer Gefangennahme, es gelang mir, wie bekannt ist, ihr wenigstens aus dieser Situation zu helfen. Beim Abendessen im Gasthaus, in das ich sie mitnahm, zu ihren Eltern wollte sie nicht, erzählte sie mir Einzelheiten dieser unverschuldeten Situation. Das Paar hatte sich in der Nacht vor ihrer Flucht heimlich verlobt, sie wollten den Unannehmlichkeiten entgehen, die ihnen ihre Familie bereitete, ihre Stiefmutter gönnte ihr den Jüngling nicht, auf den sie selber ein Auge geworfen hatte. Ihre rührende Hilflosigkeit, die zierliche Figur mit einem Busen, dessen verlockende Rundung ich wahrnahm, wenn sie sich zuweilen darbot, erweckten in mir ein verständliches Verlangen. Der Wein lockerte ihre Anspannung, ich forschte in den braunen Augen, um zu ergründen, wie viel Sympathie sie mir entgegenbrächte. Als ich sie die Treppe hinaufbegleitete, wagte ich es, sie zu umfassen, sie erwiderte meine Küsse überraschend leidenschaftlich. Der Abschied an meiner Zimmertür dauerte länger, denn ich merkte, wie ihr angespannter Körper sich unter meinen Händen lockerte. War es ein Verlangen, das sie kaum hatte stillen können, als man sie brutal aus dem Bett gerissen und verhaftet hatte? Ich zog sie in mein Zimmer. Allmählich erwachten ihre Sinne unter meinen Liebkosungen, die durch die Ereignisse völlig darniedergelegen hatten. Die nächsten zwei Tage war Herr Me. noch immer in Haft, so hatten wir Gelegenheit, unseren Leidenschaften zu huldigen. In der ersten Nacht war sie, wie ich merkte, fast noch jungfräulich, ich machte sie erst richtig zur Frau.
Ein halbes Jahr später traf ich sie mit einem schwellenden Bäuchlein, verheiratet mit Herrn Me. Inzwischen war ich mit Phi. sehr vertraut, was Frau Me. gar nicht gefiel. Dann erschien Mi. auf dem Plan, ein junges Mädchen mit kohlschwarzem Haar, nicht voll entwickelt, aber mit kräftigen Gliedern, deren Geschichte wir von einem jungen Mann der Seiltanzgruppe erfahren werden. Diese trat im gleichen Ort auf wie die unsrige. Ich sah, wie der Prinzipal das Mädchen misshandelte, weil es nicht auftreten wollte, schritt ein und kaufte es kurzerhand. Das Mädchen gehörte mit ihrem Vater zu dieser Truppe, er war vor kurzem gestorben. Sie war von dem Prinzipal im Eiertanz ausgebildet, bei dem sie mit verbundenen Augen zwischen ausgelegten Eiern, ohne sie zu zerbrechen zu der Melodie einer Geige tanzen musste.
Der Prinzipal, ein vierzigjähriger athletischer Mann mit schwarzem Bart und lockigem Haar, benutzte zu ihrer Ausbildung eine Peitsche, mit der er zuweilen ihre Schenkel unter dem Röckchen strich. Als sie den Tanz beherrschte, nahm er sie zur Belohnung in den Arm. Es blieb nicht dabei. Sie bemerkte, dass sie bald Macht über ihren Lehrer bekam. Seine Frau vergnügte sich mit dem hübschen Seiltänzer, sodass er sich Mi. ungestört widmen konnte, die, von ihrem Temperament hin- und hergerissen zwischen Begierde und Abneigung, sich ihm ab und zu verweigerte. Er wurde eifersüchtig auf den jungen Tänzer der Truppe, von dem er annahm, dass Mi. ihn gern hatte. Letztendlich verweigerte sie einmal den Eiertanz, worauf der Prinzipal böse geworden war.
Mi. schien mich zu verehren. Sie traute sich jedoch nicht, sich zu offenbaren. Einmal, als ihr Kopf in meinem Schoß ruhte, spürte ich, wie ihr Mund meine Männlichkeit berührte, die sogleich Kontur annahm. Durch die dünne Seidenhose musste sie es deutlich wahrnehmen. Sie fing an zu zittern. Mir kam der Gedanke, dass ihr der Vorgang vertraut sein musste, und hob sie auf meinen Schoss, neugierig, das Gleiche bei ihr zu bewirken.
Die Reaktion blieb nicht aus. Dabei hatte ich erkundet, dass sie trotz ihrer Jugend schon Bekanntschaft mit dem gemacht haben musste, was sie bei mir gefühlt hatte. Ich war nicht in der Lage, ihr offensichtliches Verlangen zu stillen, denn jeden Augenblick konnten wir gestört werden. Am Abend bei einer Feier biss sie mich in den Arm, weil ich mich Phi. widmete. Es dämmerte mir, dass sie eifersüchtig sei und war nicht erstaunt, ihren biegsamen Körper und ihre festen Brüstchen später in meinem Bett zu finden. Ich löschte das in Flammen stehende Juwel mehrere Male zu ihrem Frohlocken.
Der Gesellschaft blieb unser Tun lange Zeit verborgen, Mi. verstand sich so zu verhalten, dass alle sie als wunderlich bezeichneten.
Die Geschichte vom jungen Seiltänzer erzählt.
Ich war seit einem Jahr bei der Truppe und kannte auch den schwarzen Teufel, den Vater von Mi., der als Feuerfresser und -spucker großes Aufsehen erregte, Degen verschluckte und seine Tochter dabei durch brennende Reifen Salti schlagen ließ. Nachdem er gestorben war, nahm sich der Prinzipal des Mädchens an und lehrte sie den Eiertanz. Ich jonglierte mit Bällen, Reifen, Tellern und Gläsern beim Tanz auf dem Seil und erntete großen Beifall bei jungen Mädchen und Frauen in Stadt und Land, die mich nach den Vorstellungen oftmals einluden. Die Mädchen waren meist sehr jung und doch keine Jungfrauen mehr, wie ich merkte, denn wiederholt endete das Treffen mit Liebeleien. Ab und zu traf ich doch mal eine, die ihre Jungfernschaft mehr oder weniger gern hergab. Natürlich warf ich auch ein Auge auf Mi., die mir bezaubernd schön erschien. Sie hatte auch Interesse am Seiltanz, so dass ich sie lehrte, wie man am besten die Balance hält, und bewunderte hierbei ihren geschmeidigen Körper mit den Rundungen, die heranzureifen begannen. Dem Prinzipal blieb dies auch nicht verborgen, als er jedoch einmal im dämmrigen Flur unter ihren Rock griff, entschlüpfte sie ihm geschickt. Was er beabsichtigte, war mir klar, darum passte ich nun auf wie ein Luchs. Beim nächsten Mal hielt er sie so fest, dass es ihm gelang, was er wollte. Als sie nach anfänglichem Sträuben still hielt, wusste ich, dass er sein Ziel gefunden hatte, er lockerte seinen Griff und schon entkam sie ihm wieder. An eine Verfolgung war nicht zu denken, denn drinnen und draußen waren die anderen. Alles dies machte mich eifersüchtig. Zu wagen, was er versucht hatte, traute ich mich nicht. Einmal, als ich es nicht mehr aushalten konnte, klopfte ich an ihre Kammer, nannte meinen Namen und sie ließ mich ein, es war schon spät, ein Öllämpchen brannte, sie saß im Hemd vor dem Waschtisch und band ihre kohlschwarzen Haare zusammen, sie wollte gerade auf ihr Bett, einen Strohsack, der weiß bezogen und mit Decken versehen war. Hinter einem Vorhang waren ihre Kleider. Als ich sie so verlockend da sitzen sah, überkam mich das Verlangen, sie zu liebkosen, aber im Gegensatz zu meiner sonst forschen Art fehlte mir der Mut, obwohl die Gelegenheit da war und ich bei unseren Übungen zuweilen vermutete, dass sie nichts dagegen habe. Als ich noch überlegte, klopfte es an die Tür, die Stimme des Prinzipals ertönte: »Mi.!«. Sie erstarrte, sah mich erschrocken an und antwortete nicht. Ich hatte keine Lust, von ihm hier überrascht zu werden und flüchtete hinter den Vorhang in die Kleider. Wieder kam seine Stimme etwas lauter, sie antwortete mit »Ja« und öffnete die Tür. Er trat ein und musste sie gleich gefasst haben, denn ich hörte sie vor Anstrengung keuchen, als wenn sie sich wehrte, der Stuhl wurde umgestoßen und seine Stimme ertönte: »Komm schon, ich will dich doch nur wieder ein bisschen kitzeln.« Das brachte mich so auf, dass ich beinahe hinter dem Vorhang hervorgestürzt wäre, doch im letzten Augenblick siegte die Vernunft, dem Bären wäre ich unterlegen gewesen und meine Stelle los. Hier entkam sie ihm nicht. Durch einen Schlitz sah ich ihn, den Rücken mir zugewandt, wie er Mi. festhaltend, ihr Hemd bis über die Hüften gestreift, streichelte. Sein Körper verdeckte sie bis auf ihre rechte Seite, nur ihr schwarzes Haar war über seiner linken Schulter sichtbar. Mit seinem Bein hatte er die ihren ein wenig auseinandergezwungen. Sie ließ es geschehen. Wie mir meine Erfahrung sagte, konnte sie nicht lange ruhig bleiben, bald bewegte sich ihre Hüfte unruhig hin und her, dann versagten die Beine den Dienst. Er ließ nicht locker, bis sie tief seufzte, ihr Kopf drehte sich von einer Seite zur anderen, es schüttelte sie die Lust, sie ließ sich danach wie betäubt auf das harte Bett legen. Enttäuscht von ihrem Verhalten dachte ich, sie ist auch keine Jungfrau mehr. Schnell hatte er sich seiner Sachen entledigt, man sah bei ihm, was er beabsichtigte und wieder überkam mich eine Wut. Behutsam, um sie nicht aus ihrem Traum zu reißen, streifte er ihr das Hemd hoch, sodass man die kleinen Kegel der Brust mit den rosa Pfeilspitzen und ihrer schwellenden Basis sah. Er fasste vorsichtig ihre Beine, um besser zum Ziel zu kommen. In diesem Augenblick öffnete sie die Augen, erkannte die Situation und sprang auf. Er ergriff sie, legte sie, die ihn mit den Beinen trat und mit den Händen von sich hielt, wieder hin, er hatte große Mühe, sie zu kreuzigen. Es kam mir der Gedanke, dass es ihr Spaß bereitete, ihn zu reizen, wie ich es bei manchen Damen erlebt hatte. Nach wenigen Minuten hörte das Geplänkel auf. Sie lag ohne Regung, die Augen geschlossen da, er neben ihr und begann von neuem mit dem was vorher zum Erfolg geführt hatte. Diesmal ergab sie sich ihrer Lust. In der Ruhe danach, er musste wohl, von ihr unbemerkt, vor ihrer Pforte stehen, führte er aus der Ruhe heraus seinen blitzschnellen Stoß, bei ihrem unterdrückten Schrei konnte man annehmen, dass einer Jungfrau die erste Liebe eingeimpft wurde. Sein Balsam linderte wohl ihren Schmerz, es ging weiter und schon sah ich, wie sie ihre Beine aufstellte und sich zaghaft mitbewegte. Neben seinem hörbaren Atem kamen dann auch ihre immer höheren Töne, die sich wiederholten, bis er mit einem Krächzen abebbte. Kaum merklich bewegte er seinen Triebling in ihr weiter, Mi.s Körper schauderte eine ganze Weile. Dann half er ihr auf die Beine, es waren weder von ihm noch von ihr die erwarteten Spuren zwischen den Schenkeln zu sehen. Offensichtlich hatte sie der dicke Knüppel nur durch seine Dehnung erschreckt. Auch jetzt ragte der Bezwinger mit noch voller Spannkraft aus seinem schwarzen Gehege. Dies entging ihr nicht. Er setzte sich auf den Stuhl, zog sie auf seinen Schoß und fasste ihre Brüstchen von hinten. Sie stützte eine Hand auf seinen Schenkel, mit der anderen bewerkstelligte sie die Pfählung. Ihr Gesicht spiegelte zuerst die in dieser Sitzung ungewohnte Fülle wider, erst vorsichtig bewegte sie sich auf und ab, wurde dann mutiger, bis er sich streckte und ihren Lohn tief in sich in Empfang nahm. Sie blieb im Sattel, sank ein wenig zusammen und wenn überhaupt nötig erholte er sich schnell, um dann ihr endgültig so zuzusetzen, dass sie sich nicht mehr halten konnte. Alles bewies mir, dass das Häutchen schon länger zerrissen worden war und sie in der Sache Bescheid wusste. Ich hatte eine halbe Stunde voller Qualen erlebt. Er drehte sie zu sich, mit seinem gekräuselten schwarzen Pullover kitzelte er ihre Brüstchen, sie richtete, wenn auch erst nach einiger Zeit, das auf, was sie umgebracht hatte und bot ihm verführerisch ihr glitzerndes rotes Paradies an. Sie geriet außer Rand und Band, ich musste voller Neid anerkennen, wie er sie so geschickt überzeugte. Beide waren erschöpft und schienen einzuschlafen. Die Gelegenheit nahm ich wahr, heimlich hinauszuschleichen. Beim Eiertanz am nächsten Morgen war sie nicht so glücklich und zerbrach ein Ei, er beschimpfte sie nicht. Sie war mit ihren Reizen freigiebiger als gewöhnlich, zeigte nicht nur ihre Brüstchen, sondern, wie zufällig, mehr. Wenn sich das herumsprach, nahm er an, kämen noch mehr Zuschauer.
Ich war eifersüchtig und rächte mich, indem ich die Prinzipalin, die mich mochte, noch öfters besuchte. Wenn er mit Mi. beschäftigt war, hatten wir auch das Vergnügen.
Ich erzählte ihr alles, die natürlich ihre Rachsucht an mir ausließ, wie ich an ihr.
Abends war ich neugierig, ob er Mi. besuchte, dann konnten wir uns ungestört lieben. So ging es einige Zeit. Manchmal horchte ich an Mi.s Tür, einmal machte sie sich lustig über sein Unvermögen, kurz darauf jedoch sang sie in den höchsten Tönen. Trotz des Vorwurfs, dass er mit Mi. schlafe, einigten sich Prinzipalin und Prinzipal. Er wusste sicher auch von unserem Verhältnis. Die Prinzipalin wurde schwanger, eine heikle Sache, denn sie hatte sich ihrem Mann verweigert. Mich wurmte die Neugier, wer denn wann Mi. defloriert hatte, konnte es aber weder ahnen noch herausfinden. Der Prinzipal jedenfalls nicht..
Bewundernswert für mich, Herr Balzac, wie kann man nur so viel Wissen gut verwebt vermitteln. Katharina von Medici, Karl IX., der Dachhüpfer, die Zeitläufte, die Ortskenntnisse haben mich gefesselt. Zuweilen allerdings braucht er ein ganzes Buch, um am Ende eine Modeste um ihre Jungfräulichkeit zu bringen, bewundernswert ist die akribische Beschreibung von Vätern, die ihre Liebe zu Töchtern oder zur Alchemie in den Ruin getrieben hat, und von exzentrischen Malern und Musikern.
N.: Daran solltest du dir ein Beispiel nehmen, wie man den Charakter der Personen zeichnet, ihre Gefühle offenlegt und damit ihre Handlungen rechtfertigt, sie gegenüberstellt und sie dadurch Konflikten aussetzt, die Spannung erzeugen, um sie mit einer Katastrophe oder einem Happy End zu lösen.
E.: Ich bin nicht so vermessen, mich Schriftsteller zu nennen, um diesem Anspruch gerecht zu werden, fehlt mir die Fähigkeit und die Neigung zur Weitschweifigkeit. Viele, die sich so nennen, stellen wirklich nur die Schrift.
N.: Sag doch einfach: Dir fehlt das Talent!
E.: Wenn du Recht hast, hast du Recht. Was ist der Unterschied zwischen Fähigkeit und Talent? Aber was treibt dich, mir zu folgen?
N.: Ich will dich nicht enttäuschen, einer muss es ja lesen.
E.: Ganz vergessen habe ich alles, was in der Bäckerei und Konditorei so um mich war, einige Dinge sind mir unvergesslich, so die kleinen Holzkisten, die, mit fettundurchlässigem Papier ausgeschlagen, Nougat enthielten, von dem ich, wenn es zur Herstellung feiner Torten und Schnitten gebraucht wurde, immer etwas abbekam, ebenso die Kistchen mit den in Lagen geschichteten kandierten Früchten, die ich noch heute wahnsinnig gern esse, die dicken Sultaninen, die ich den Korinthen vorziehe, natürlich auch die besten Pralinen, die von den Vertretern zum Probieren gereicht wurden. Mein Weg durch die Backstube wurde immer belohnt, K. nahm die Spritztüte, die, mit Sahne gefüllt, gerade zur Torte gebraucht wurde, und ich bekam einen Mund voll davon.
Auch erinnere ich mich daran, wenn mein Großvater ohne Fluchen, doch sehr betroffen, Brötchen aus dem Ofen förderte, die aus Pompeji zu kommen schienen, weil man nicht aufgepasst hatte, sie im rechten Moment herauszuholen. Ein großer Verlust.
Meine jährlich wiederkehrende Aufgabe war es, den weißen gefüllten Flieder aus dem M.-Garten zu holen, der immer höher auf seinen gedrehten Ästen wuchs, und natürlich den violetten, ein paar Meter davon entfernt, so viel ich fassen konnte. Außer Reichweite, eine Leiter hatte ich nicht, waren die Röschen des Rotdorns, die ich so gern hatte, so gern wie Proust den Weißdorn. Die Liebe meiner Großmutter galt den Moosröschen, deren schüchterne Blüten in Moos verpackt waren, im Gegensatz zu den protzigen Großen.
Die Mittelschule war für mich eine Pflichtübung, der ich keinen besonderen Wert beimaß, im Gegensatz zu meiner Mutter, die immer darauf achtete, dass »mal etwas aus mir werde«, am besten Arzt. Unterbewusst habe ich wohl auch danach gestrebt, es gab aber wichtigere Dinge. Ab 1939 schienen ihr meine Anstrengungen nicht mehr zu genügen, sie meinte mich in einem Internat besser aufgehoben und sie sah sich nach einem geeigneten um.
Mein Zeugnis für die Zeit Ostern 1940 bis Herbst 1940.
Verhalten in der Schule: gut
Beteiligung am Unterricht: E. muss lebhafter mitarbeiten.
Religion:
Deutsch: ausreichend
Französisch:
Lateinisch: ausreichend
Geschichte: befriedigend
Erdkunde: ausreichend
Rechnen: befriedigend
Raumlehre: ausreichend
Biologie: befriedigend
Algebra:
Physik: befriedigend
Zeichnen: ausreichend
Musik: befriedigend
Handschrift: ungenügend (Kommentar später: nicht lateinische und deutsche Buchstaben mischen.)
| Aden 15. November 1940 | |
| Der Rektor | Der Klassenlehrer |
| K. | G. |
(Der Klassenlehrer war mir nicht wohlgesinnt, aus verständlichen Gründen, wie ich erwähnte.)
Gesehen: F. G.
Ihre Wahl fiel auf die Franckeschen Stiftungen, in die ich mit zwölf Jahren kam. Eine vollkommen neue Welt. Zur Vorbereitung auf die Oberrealschule FOR musste ich jedoch erst noch einmal die Mittelschule der Stadt Halle besuchen, ein Bild in der Zeitung zeigt mich in einem Bericht über die Sommerferien dort auf der Schulbank.
Beim Abschied von meiner Mutter vergoss sie Tränen, sie ahnte wohl, dass ich endgültig G. den Rücken gekehrt hatte und schon so jung zur Selbstständigkeit erzogen wurde. Der Schnellzug mit den imposanten Lokomotiven sollte nun für Jahre die einzige Verbindung zu ihr bleiben. Eichenberg – Halle a. d. Saale. Die Franckeschen Stiftungen, mit einer Mauer umgeben, jedoch mehr ein Schutz nach außen als ein Pferch für uns, waren mir ohne Befremden sogleich vertraut.
Ich machte mir keine Gedanken, wer August Hermann Francke gewesen war, meine Mutter hatte wohl den Prospekt studiert.
»Das Anstaltsgelände beträgt 73 Morgen, ferner befinden sich im Eigentum der Franckeschen Stiftungen: 2 Güter, 2 Gärtnereien, 150 Morgen Streuländereien, Buchdruckerei (gegr. 1710), Verlag (gegr. 1701) v. Cansteinsche Bibelanstalt (gegr. 1710), Apotheke (gegr. 1698).
Unter anderem wird in diesem Prospekt auch ein Erziehungsziel genannt:
Charakterbildung, gegründet auf den Grundsätzen des Nationalsozialismus und auf dem evangelischen Christentum.
Deshalb:
1. Erziehung zur Gemeinschaft in Stubengruppen durch Ämterverwaltung und Kameradschaftspflege. Wer befehlen soll, muss zuvor gehorchen lernen.
2. Alle Heimschüler und -schülerinnen gehören zu den Gliederungen der Hitlerjugend, Dienst auf den stiftischen Sportplätzen in den stiftischen Turnhallen und den von den Stiftungen besonders eingerichteten Räumen. Dienstzeit angepasst an die Heimordnungen usw., offensichtlich ein kluges Alibi.
Es hat wohl nicht funktioniert mit der Hitlerjugend in den Räumen und Anlagen der Stiftungen, denn wir wurden in verschiedene Einheiten in der Stadt integriert, gingen nie zum Dienst und wenn einmal unter Drohungen, dann in Zivil, gefragt, warum wir keine Uniform anzögen, sagten wir, unsere Eltern hätten kein Geld, sie zu kaufen. Einmal, als es wohl dem Gebietsführer zu bunt wurde, kündigte er an, mit dem Motorrad zu kommen und uns zu holen. Als er vorfuhr, wurde ihm das Eisentor vor der Nase zugeschlagen, im obersten Stock des Pädagogiums hatten wir uns an den Fenstern platziert und riefen im Chor: »Schweine-Ernst raus!« Es wurde nach einiger Zeit geraunt, die Stiftungen sollten zu einer Napola umgewandelt werden, was daran richtig war, weiß ich nicht. Unsere Motivation zur Opposition ist mir damals nicht klar geworden, heute meine ich, es war der Geist der Institution, unauffällig auf uns übertragen von unseren Lehrern und Erziehern.
Eine Schizophrenie bestand insofern – oder war es eine Tradition im Sinne des alten Mackensen, des Husarengenerals des Ersten Weltkriegs? –, dass sich die meisten freiwillig zum Dienst in Marine oder Luftwaffe meldeten. Irgendwie steckte es an, wenn ein Fliegerleutnant oder Kapitän der Marine, ehemalige Senioren, uns besuchten. In diesem Sinne waren wir militaristisch beeinflusst, unter dem Motto »Verteidigung des Vaterlandes«.
Ich bewarb mich jedoch für die Laufbahn eines Marinesanitätsoffiziers. Um es vorwegzunehmen, als es 1945 so weit war, galt dies nicht mehr, man wollte Kämpfer und so wurde ich zur Prüfung zum Seeoffiziersanwärter einbestellt.