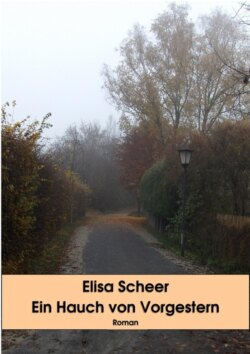Читать книгу Ein Hauch von Vorgestern - Elisa Scheer - Страница 2
Samstag
ОглавлениеIch weiß, wenn ich diese Geschichte jemals außerhalb meines Bekanntenkreises erzähle, lande ich in der Psychiatrie oder werde behandelt wie jemand, der behauptet, von einem UFO entführt worden zu sein. Aber irgendjemandem muss ich das alles erzählen, sonst platze ich noch.
Das Ganze begann am zehnten November. Draußen war es kalt und neblig, es hatte am Vortag sogar ein bisschen geschneit. Es war Samstagvormittag und wie meistens am Wochenende war ich bei Sebastian. Ich freute mich auf ein gemütliches Wochenende, das schlechte Wetter schrie ja geradezu nach Kuschelrock. Diese dämliche alte Seminararbeit vom letzten Semester konnte ich zwischendurch fertig schreiben, alles Nötige hatte ich schließlich in der Tasche. Danach müsste ich für meine Magisterprüfung keinen einzigen Schein mehr machen, hatte ich nach sorgfältigem Sortieren und Abheften der bisherigen Beute festgestellt.
Sebastian kam ins Wohnzimmer, wo ich faul auf dem Sofa lag und wenig überzeugend so tat, als läse ich mir einen kopierten Artikel über die Schleswig-Holstein-Krise 1865/66 durch.
„Na, Schatz?“ Er setzte sich auf die Sofakante und küsste mich flüchtig. Ich lehnte mich genießerisch an ihn. Sebastian roch immer so gut, ein bisschen nach Rasierwasser, ein bisschen nach Äpfeln und ein bisschen nach sich selbst.
„Nachher schaut der Willi auf einen Sprung vorbei, ist das okay?“
„Natürlich“, antwortete ich erstaunt. Das war doch Sebastians Wohnung, und er konnte einladen, wen er wollte! Außerdem neigte ich nicht zu zänkischem Verhalten, nicht wie Sissy, eine Kommilitonin von mir, die ihren Freund so lange gepiesackt hatte, bis er mit ihr Schluss gemacht hatte. Das konnte man wohl nicht zur Nachahmung empfehlen, lieber pflegte ich weiter mein friedfertiges Image. Sebastian verließ das Zimmer wieder und ich wandte mich unlustig meinen Kopien zu. Wenn ich den Quatsch nicht noch fertig schreiben müsste... Wenn dieser doofe Willi nicht käme (natürlich war es mir nicht recht, er nervte mich immer und ging ewig nicht wieder)... Wenn Sebastian später nicht Fußball gucken müsste... – dann könnten wir ein wirklich heißes Wochenende verbringen, wie schon länger nicht mehr. Was stand da? So ein Blödsinn, na, das könnte man wenigstens in der Arbeit genüsslich in der Luft zerreißen! Ich arbeitete etwa eine Stunde, zwar nicht glücklich, aber doch recht zufrieden mit der Situation, als es klingelte. An der dröhnenden Stimme im Flur erkannte ich schon, dass Willi da war.
„Alter Schwede!“ Immerzu schlug er Sebastian auf die Schulter, der Prolet. Ich verzog auf meinem Sofaplatz das Gesicht und hörte weiter zu.
„Na, das Leben noch frisch? Ist heute stille Häuslichkeit angesagt? Wir müssten mal wieder richtig einen draufmachen!“ Eine Plattheit an der anderen, und jetzt kamen bestimmt die glorreichen Erinnerungen an noch nicht allzu weit vergangene Megaräusche.
„Weißt du noch, damals im Hacke & Dicht? Junge, waren wir breit! Scharfer Abend, was?“
Von Sebastian kam nur undeutliches Protestgemurmel. Ich grinste still vor mich hin. Sebastian hatte mir die Geschichte erzählt: Er war zwar ziemlich abgefüllt gewesen, aber den guten Willi hatte die Polizei mitgenommen, weil er wildfremden Leuten weinend um den Hals gefallen war und weder irgendeinen Ausweis bei sich hatte noch sich erinnern konnte, wie er hieß. Außer Django zahlt nicht, Django hat Monatskarte war aus ihm nichts mehr herauszubringen gewesen, und was das mit dem Heulkrampf zu tun haben sollte... Mir wäre es ja peinlich gewesen, immer wieder auf einen derartigen Totalausfall angesprochen zu werden, aber Willi war ungemein stolz darauf. Willi, die gute Seele, wie Mama sagen würde – wenn sie jemals von ihm gehört hätte – so ein Trottel, aber im Bedarfsfall ein durchaus guter Freund. Wie er Sebastians Umzug geregelt hatte... Okay, bis auf die Sache mit dem Geschirr, aber Sebastian hatte ohnehin mal neues gebraucht.
Die beiden kamen herein. Sebastian ein kleines bisschen verlegen, wie immer, wenn Willi so herumdröhnte, Willi selbst in strahlender Laune. „Hallo, kleine Maus!“
„Hallo“, grüßte ich etwas kühl zurück. Ich war weder klein noch eine Maus, aber was sollte ich schon sagen? Dass einem die coolen Sprüche auch immer erst hinterher einfielen! Willi plumpste schwer in einen Sessel und zog eine Havanna aus der Tasche. Das war so typisch: Ohne zu fragen, qualmte er einem die Bude voll, aber er war auch begeistert bei der Sache, wenn diese Bude dann frisch gestrichen werden musste. Ein herzensguter Trampel eben.
Sebastian bemerkte wohl mein etwas unglückliches Gesicht – oder er wollte mit Willi etwas besprechen und mich loswerden, jedenfalls druckste er etwas herum und fragte dann: „Sagt mal, Kirsten, könntest du mir nicht schnell zwei Druckerpatronen besorgen gehen? Einmal schwarz, einmal bunt?“
Ich erhob mich gehorsam. „Wenn du das möchtest... Im Uni-Lädle?“
„Nein... da kosten sie fast zehn Mark pro Stück mehr als in der Stadt. Wenn es dir nichts ausmacht...?“
Klar machte es mir was aus, durch Kälte und Nebel zur U-Bahn, durch das Samstagsgewühl in der Stadt, hinauf in den obersten Stock zur Kleinelektronik, Schlange stehen... Und ich brauchte eigentlich gar nichts in der Stadt! Wie immer lächelte ich aber freundlich. „Kein Problem. Brauchst du sonst noch was?“ Es gelang mir nicht einmal, der Frage einen wenigstens leicht drohenden Unterton zu verleihen.
„Also, wenn du schon so fragst... Für diese Exkursion nächste Woche, einen Stadtplan von Magdeburg. Und blaue Füllerpatronen!“
„Drucker, Tinte, Stadtplan“, rekapitulierte ich dienstfertig und nahm zweihundert Mark entgegen. Immerhin erwartete er nicht, dass ich die teuren Druckerpatronen auch noch auslegte! Aus dem Augenwinkel registrierte ich Willis verblüfftes Gesicht, als ich das Zimmer verließ, um den Mantel anzuziehen und nach meiner Umhängetasche zu greifen. Was schaute er denn jetzt wieder so blöde?
Draußen war es noch kälter, als ich gedacht hatte, und ich ärgerte mich, dass ich keine Handschuhe dabei hatte. Die Hände tief in den Manteltaschen vergraben, schritt ich flott aus, Richtung U-Bahn. Schon auf der Rolltreppe sah ich, wie die U-Bahn einfuhr und galoppierte die Treppe hinunter. Fast hinunter, ein eng umschlungenes Pärchen versperrte mir den Weg. Alles höfliche Räuspern nützte nichts, sie verließen die Rolltreppe in aller Seelenruhe, weiterhin engumschlungen, und wandten sich der anderen Bahnsteigseite zu. Ich hechtete in Richtung der ersten offenen Tür, aber da wurde ich barsch aufgefordert, zurrrückzubleiben, bitte! Mitten im Sprung bremste ich ab, diese Schaffner brachten es ja womöglich fertig, einen in der automatischen Tür einzuklemmen.
Die Türen glitten zu, der Zug surrte aus dem Bahnhof und ich plumpste ärgerlich auf einen der Drahtgeflechtsitze neben der Fahrplanvitrine. Mist! Blöde U-Bahn! Blöder Samstag! Blöder Willi!
Quatsch: blöde Kirsten! Warum trabte ich wie eine brave Magd in die Stadt? Warum setzte Sebastian mich an die Luft, bloß um mit diesem Willi von alten Besäufnissen zu schwärmen? Obwohl – das war Willi allein, Sebastian selbst hatte eigentlich kein Bedürfnis, nostalgisch daran zurückzudenken.
Und heute fuhr sie auch nur alle zehn Minuten! Das Liniennetz kannte ich auswendig, das musste ich nicht schon wieder betrachten. Ich stand auf und schritt den Bahnsteig auf und ab, zunächst die Fliesen zählend, dann guckte ich den Mäusen zu, die auf den Gleisen wohnten. Immer noch ärgerte ich mich, vor allem über mich selbst: dass ich mich hatte wegschicken lassen, dass es mir nicht gelungen war, dieses Pärchen von der Rolltreppe zu schubsen, dass ich überhaupt – was war? Zu nachgiebig? Friedfertig? Lahmarschig? Harmoniesüchtig? Endlich fuhr die nächste Bahn ein und ich ergatterte wenigstens einen Stehplatz. Alle Welt fuhr schon mal nach Weihnachtsgeschenken gucken, so schien es wenigstens. Mit allen Massen wälzte ich mich in der Innenstadt aus der U-Bahn, die Rolltreppe hinauf, auf den Marktplatz und ins Kaufhaus.
Im fünften Stock ging es zu, als gäbe es etwas umsonst. Es dauerte alleine zehn Minuten – ungelogen! – bis ich mich zu dem Regal mit den Druckerpatronen durchgekämpft hatte. Schwarz gab´s reichlich, in Bunt hing nur noch eine da, und als ich gerade danach greifen wollte, wurde über meine Schulter hinweg eine Hand ausgestreckt und pflückte die Verpackung vom Haken. Empört drehte ich mich um, aber der Arm samt Patrone und zugehörigem Rest war schon auf dem Weg in die Kassenschlange. Arschloch, dachte ich mir, anstatt es laut zu sagen, und reihte mich mit der anderen Patrone ebenfalls in die Schlange ein. Würde Sebastian von mir erwarten, dass ich noch andere Läden abklapperte, um eine bunte Patrone aufzutreiben? War ich denn wahnsinnig, darüber auch nur nachzudenken? Nachher kosteten sie anderswo nur mehr! Endlich konnte ich meine Patrone der Kassiererin vorlegen und zückte die Geldbörse, als ich beiseite geschubst wurde.
„Ich hab´s eilig!“ An mir vorbei wurden drei preisreduzierte CDs vor die Kassiererin geschoben, die ganz verdattert den Scanner darüberzog. Ich starrte den Kerl – mittlere Jahre, Dutzendgesicht, speckiger Trenchcoat – mit offenem Mund an. Zu sagen wusste ich nichts, wie immer.
Er zahlte, bemerkte dann meine Verblüffung, sagte „Mach den Mund zu, es zieht“, und schob sich grob an mir vorbei. ich versuchte noch ihn zu treten, aber er war schon weg. Dieses Mal murmelte ich das Arschloch wenigstens hörbar, aber nur die Frau hinter mir in der Schlange hörte es und konterte mit Sackgesicht.
„Weiß Gott, ja“, antwortete ich erfreut, „so schön war Mr. Wichtig nun wirklich nicht.“ Ich zahlte, nickte der mitfühlenden Seele freundlich zu und kämpfte mich wieder zur Rolltreppe durch. Schreibwaren, Stadtplan.... im Erdgeschoss, ganz weit weg von den Rolltreppen. Ganz unten fiel mir das ein, was mir an dieser Stelle immer – und immer zu spät – einfiel, nämlich, dass man auch den Lift nehmen und viel Zeit sparen konnte.
Tinte gab´s, natürlich, den Stadtplan aber nicht: Alles war da, nur Magdeburg war aus. Das würde Sebastian nie glauben, also trabte ich noch in die Buchhandlung gegenüber und kaufte den Stadtplan dort. Im Vorbeigehen sah ich zwei reizvolle romantische Romane, aber ich beherrschte mich eisern. Weniger aus Geiz, wenn ich ehrlich war, aber der Gedanke, dass ich nur wegen Sebastian und auch nicht das kleinste bisschen für mich selbst diese Tortur in der Stadt auf mich genommen hatte, gab mir das Recht, mich edel zu fühlen und mir auch reichlich selbst Leid zu tun. Ich kehrte zu Fuß in die Emilienstraße zurück – noch mehr Elend, denn mein linker Schuh hatte ein Loch – und bedauerte mich mit Hingabe. An einer Ampel wäre ich noch beinahe von einer rabiaten Mutter mit ihrem Zwillingskinderwagen überfahren worden, an der nächsten ignorierte mich ein Rechtsabbieger. Als er schließlich doch noch bremste, kehrte ich demonstrativ auf meine Straßenseite zurück und signalisierte ihm, dass ich ihm nicht traute. Kopfschüttelnd fuhr er wieder an und ich musste in einer Pfütze warten, bis die Ampel wieder auf Grün umsprang.
Manchmal war ich schon recht dämlich, musste ich zugeben, als ich in Sebastians Straße einbog. Niemand fühlte sich angesichts meines Leids schuldbewusst, sie fanden mich höchstens seltsam. Hoffentlich ging es Sebastian nicht auch so! Wie sollte ich gucken, wenn ich in die Wohnung kam? Vergnügt nach einem erfrischenden Spaziergang? Stoisch angesichts seiner Ansprüche? Verärgert über Willis Zigarrenqualm? So, als wäre gar nichts gewesen?
Die Entscheidung wurde mir abgenommen, denn die beiden hörten mich nicht hereinkommen. Ich vernahm zwar die Stimmen aus dem Wohnzimmer, aber die Unterhaltung lief einfach weiter.
Einen Moment lang stand ich im Flur und versuchte etwas zu verstehen, aber während Willis Äußerungen so deutlich zu hören waren, als halte er sich ein Megaphon vor den Mund, kam von Sebastian nur unverständliches Gemurmel. Leise hängte ich meinen Mantel auf und arrangierte meine Einkäufe auf der Kommode im Flur.
„Ich verstehe bloß nicht, wie du das aushältst“, dröhnte Willi.
Ein undefinierbares Geräusch war die Antwort.
„So spannend wie eingeschlafene Füße!“
Erneute gedämpfte Laute. „Der reinste Fußabtreter, finde ich. Etwas mehr Pep wäre dir ja schon zu wünschen!“
Wovon sprachen die denn eigentlich? Die Sache begann mich zu interessieren. Wenn es mir gelang, ungehört in die Küche zu kommen, konnte ich das vielleicht herausbekommen. Ich schlich mich durch die Tür; jetzt war nur noch eine dünne Wand zwischen mir und dem Männergespräch, das mich genau genommen gar nichts anging. Aber neugierig war ich eben doch.
„... eben so!“, beendete Sebastian gerade seinen Satz.
„Und damit willst du dich abfinden? Sie ist ja ganz nett soweit, aber hat sie dir schon jemals widersprochen?“
Die sprachen doch nicht etwa von mir? Das wäre ja wohl die Höhe! Ich schichtete das überall herumstehende Geschirr völlig lautlos ins Spülbecken und sperrte weiterhin Riesenlauscher auf. „Nein“, gab Sebastian gerade zu.
„Eben! So kann man doch keine Diskussionen führen! Willst du eine Partnerin oder eine Sklavin?“
„Ein bisschen mehr Selbstbewusstsein wäre mir schon ganz Recht“, gab Sebastian tatsächlich zu, und ich sammelte den Müll in die diversen Tüten, während ich innerlich schäumte, mehr als das Spülmittel, weil ich ja das Wasser nicht aufdrehen konnte, ohne dass sie mich hörten.
„Und richtig munter im Bett ist sie wohl auch nicht, was?“
Jetzt wurde Willi aber wirklich unverschämt! Das ging ihn doch gar nichts an! Na, Sebastian würde mich schon verteidigen und ihm sagen, dass er seine Nase nicht in unsere Beziehung zu stecken hatte!
„Da hast du leider auch Recht“, hörte ich ihn – so viel zu seiner Verteidigung! Ungläubig lauschte ich weiter. „Etwas passiv ist sie tatsächlich, und ich weiß nie so genau, ob sie eigentlich auch ihren Spaß hat. Sie sagt ja nichts! Was soll ich denn tun?“
Das Aller-allerletzte! Er holte sich bei dieser Schiffssirene, diesem Riesentrampel, Ratschläge in Liebesdingen? Was war plötzlich in Sebastian gefahren? Und was ging es diesen lauten Lümmel an, ob ich im Bett auf meine Kosten kam? Meistens war das nicht der Fall, musste ich im Stillen zugeben. „Weiß ich auch nicht. Vielleicht ist sie nicht die Richtige für dich. Für mich wär sie´s jedenfalls nicht. Was sollte ich mit so einem Fußabtreter?“
Sebastians Antwort darauf blieb mir erspart, denn in diesem Moment fiel mir einer der Teller scheppernd ins Spülbecken, und drüben wurde es still. Ich drehte zornig das Wasser auf und begann abzuspülen. Als die Küchentür sich öffnete, konzentrierte ich mich krampfhaft auf den Schaumberg vor mir und schrubbte die tagealten Teller mit möglichst großem Aufwand an Lärm und Kraft.
„Kirsten, du bist schon da?“ Klang das wenigstens ängstlich? Hoffte er, ich hätte nicht gehört, wie er mich verraten hatte? Sprach mit diesem unsäglichen Willi übers Bett!
„Ja. Deine Aufträge hab ich so weit möglich erfüllt, alles liegt auf der Kommode.“
„Und was hast du für dich gekauft?“ Ideal, das war das Stichwort! Ich setzte eine Miene bescheidenen Erstaunens auf und drehte mich um. „Für mich? Nichts, warum sollte ich?“
„Aber wenn du schon in die Stadt fährst?“
„Ich brauchte doch gar nichts, ich war nur wegen deiner Patronen in der Stadt. Übrigens, in Farbe waren sie leider aus.“ Er musterte mich mit ratlosem Gesicht, Hatte er das Gefühl, mir bitter Unrecht getan zu haben (hoffentlich!) oder überlegte er bloß, ob Willi Recht hatte, wenn er riet, mich abzustoßen (hoffentlich nicht!). Ich erwiderte seinen Blick und wusste auch nicht genau, was ich fühlte. War ich sauer? Verletzt? Hatte ich Angst, dass er Schluss machte? Er war doch eigentlich ein netter Kerl, nur Willi verleitete ihn immer, Willi, der Arsch! Wut wallte wieder in mir hoch, aber ich wollte sie Sebastian nicht zeigen. Willis Taktik wurde mir plötzlich sonnenklar: Ich sollte toben und keifen, und dann konnte er Sebastian raten, sich eine weniger lästige Person zu suchen, wetten?
„Danke“, antwortete Sebastian unentschlossen.
„Keine Ursache. Übrigens, ich müsste nachher doch die Seminararbeit fertig schreiben, mir ist vorhin eingefallen, dass sie nächste Woche schon fällig ist. Du bist sicher nicht böse, wenn ich nach dem Abspülen nach Hause fahre, oder? Willi ist doch noch da, oder?“ Sehr subtil – so hatte ich gleich gezeigt, dass ich nichts gehört hatte. Und ich konnte gleich gehen und mich in Ruhe über diese miesen Kerle ärgern!
„Ja, der sitzt drüben“, antwortete Sebastian erstaunt, „aber ich finde es schon schade, dass du nicht bleiben kannst. Morgen kommst du aber wieder – oder heute Abend?“
Ich stellte den letzten Teller ins Trockengestell, zog den Stöpsel aus dem Becken und zuckte bemüht lässig die Schultern. „Weiß ich nicht, das hängt davon ab, ob ich mit dieser Arbeit fertig werde.“
„Hast du was?“ Jetzt sollte ich ihm deutlich sagen, worüber ich mich so geärgert hatte, dass ich erst einmal alleine sein musste, aber wie immer konnte ich das nicht. Was, wenn ich zu toben und zu keifen anfing? Das hatte ich zwar noch nie getan, aber so, wie es in mir brodelte, konnte man nie wissen. Also schluckte ich alles herunter.
„Nein, nur eben diese dämliche Arbeit. Mein letzter Schein vor dem Magister! Und mit der Magisterarbeit sollte ich auch allmählich anfangen... Viel Spaß euch beiden noch, und sauft nicht zuviel!“
Ich ergriff meine Tasche und machte mich auf in Richtung Tür. Sebastian sah mir kopfschüttelnd nach, bemerkte ich, als ich mich noch einmal umdrehte.
Kaum stand ich auf der Straße, wallte die Wut wieder in mir hoch, dieses Mal auf mich selbst. Wieso hatte ich nicht sagen können Ich verbitte es mir, dass ihr über mein Verhalten im Bett diskutiert? Nein, ich schlich wie ein geprügelter Hund davon. Willi hatte eigentlich Recht, ich war ein Fußabtreter, der für Sebastian Besorgungen machte, seine Küche aufräumte und ihm nachts zu Willen war. Was hatte ich eigentlich von dieser Beziehung?
Blöde Frage! Wollte Sebastian eigentlich, dass ich mich so verhielt? Seinen kaum verständlichen Äußerungen zufolge eher nicht. Aber er konnte sich doch keine Szenen wünschen! Ich trottete die Emilienstraße entlang und schlenkerte meine Tasche, in der sich in Wahrheit alles befand, was ich für diese Seminararbeit brauchte. Ich wollte gar nicht nach Hause. Das miese Wetter – der Nebel wurde immer dichter – entsprach so genau meiner Stimmung, dass ich beschloss, erst einmal ein bisschen spazieren zu gehen und dabei meinen Ärger abzureagieren.
Ich vermied die Straßen mit den schönen Läden und passierte in der Katharinenstraße die nebel- und regenfeuchte Hinterfront der Uni, in der heute auch keiner war – die Bibliotheken hatten um ein Uhr geschlossen. Überhaupt war alles leer, es gab sogar freie Parkplätze. Hinreißend trübsinnig, fand ich, fast die richtige Szenerie für Totensonntag, aber da waren es noch zwei Wochen hin. Und der Nebel war mittlerweile so dicht, dass man kaum noch die rote Ampel an der Kreuzung zur Graf-Tassilo-Straße sehen konnte. Zauberhaft! Meine üble Laune verflog allmählich – wenigstens so lange, bis mir wieder einfiel, warum ich an einem freien Samstag im November alleine durch die Straßen strolchte, anstatt mit Sebastian auf dem Sofa zu liegen, fernzusehen und ein bisschen herumzuknutschen. Man müsste diesen unsäglichen Willi im Nebel in den Prinzenbach schubsen, überlegte ich, das würde ihn endlich mal zum Schweigen bringen! Hatte er für Sebastian schon eine tollere Frau an der Hand, oder warum sonst war er so scharf darauf, uns auseinander zu bringen? Schöner Freund, wirklich! Und ich hatte ihm nie etwas getan!
Prinzenbach... der Prinzenbach floss natürlich quer durch den Prinzenpark. Dort musste es heute besonders gespenstisch sein, gerade die richtige Szenerie für meine Weltuntergangsstimmung! Ich überquerte die Straße, nachdem ich die Fußgängerampel mühsam in den Nebelschwaden ausgemacht hatte, und bog zum Prinzenpark ab. Interessante neue Optik – entgegenkommende Fußgänger, viele waren es ohnehin nicht, tauchten erst ganz spät plötzlich vor einem auf, als materialisierten sie sich plötzlich vor einer Wand. Zuerst erschrak ich ein paar Mal, dann gewöhnte ich mich daran und studierte das Phänomen interessiert.
Tatsächlich betrat man den Prinzenpark, als schreite man in einen Ballen grauer Watte hinein. Unscharf waren die nassen, kahlen Zweige der Bäume zu sehen, die im Herbst, bunt belaubt, noch einen so hinreißenden Anblick geboten hatten, dass die Touristen sie begeistert fotografiert hatten. Ich schlenderte langsam dahin, immer in Richtung auf das Palais Leopold, das am hinteren Ende des Parks stand, und bedauerte, dass ich keinen Fotoapparat dabei hatte. Das vergammelte Schlösschen im Nebel – ein wunderbares Motiv müsste das sein, schade!
Kein Mensch war zu sehen. In einem Gruselfilm müsste jetzt etwas Unaussprechliches auf mich zukommen, aber Halloween war glücklicherweise schon vorbei, und allen bösen Buben war sicher das Wetter zu schlecht. Persönlich kannte ich ohnehin keine Schurken – anders als meine arme Schwester.
Anna hatte es im Sommer fertig gebracht, sich in einen echten Sadisten zu verlieben, der noch dazu Handlanger eines Verbrecherkönigs war. Wenn ihre beste Freundin Xenia und deren Freund Magnus – ach, heirateten die nicht ausgerechnet heute? – nicht fleißig hinter den Verbrechern her geschnüffelt hätten, wer weiß, ob Anna dann überhaupt noch lebte? Sie hatten sie so ziemlich im letzten Moment gefunden, und Anna war seitdem erheblich gedämpfter als früher, wo sie eher als durchgeknallte femme fatale aufgetreten war. Sie sah zwar überhaupt nicht fatal aus, blond, schmal und sportlich, ähnlich wie ich, aber sie hatte einen gewaltigen Männerverschleiß gehabt. Xenia mit den wilden dunkelroten Locken und der eindrucksvollen Statur wirkte viel gefährlicher und war dabei völlig harmlos, was Männer betraf. Und nett, fand ich. An Annas Krankenbett hatten wir uns gut verstanden. Hatte ich eigentlich -? Ja, ich hatte zur Hochzeit gratuliert und ihnen etwas geschenkt. Zuerst hatte ich an eine Kinder-Detektiv-Erstausstattung gedacht (karierte Kappe, Riesenlupe und so), um die beiden zu ärgern, aber mich dann doch, Xenias Wunsch entsprechend, an eine Kleinigkeit von der Liste gehalten. Das Fest sollte nächsten Samstag sein, wenn ich es richtig aufgeschrieben hatte.
Wie war ich denn jetzt auf Anna, Xenia und Magnus gekommen, überlegte ich, als der marode Säulenvorbau des Palais Leopold sich aus dem Nebel schälte. Ach ja, geheimnisvolle Szenerie – Verbrecher. Ich schob diese Gedanken beiseite und näherte mich dem Palais. Hinter dem Säulenvorbau konnte man jetzt auch die ehemals rosafarbenen Mauern erkennen, der Putz war allerdings größtenteils abgeplatzt und zeigte das nackte Mauerwerk. Hier müsste man mal renovieren... Wem gehörte die kleine Bruchbude eigentlich? Der Stadt? Der ehemaligen Herrscherfamilie? Der Schlösser- und Seen-Verwaltung? Und konnte man daraus nichts machen? Es war doch jammerschade darum!
Ich stand eine Zeitlang vor der entzückenden Fassade und umrundete das Schlösschen dann langsam, weil ich noch nie die Rückseite gesehen hatte. Wahrscheinlich gab sie gar nichts her... Nein, sie war ebenso reizend, mit einer verwitterten Terrasse und den entsprechenden bodentiefen Fenstern, leeren Oleanderkübeln, einigen zerbrochenen Steinstufen, die von der Mitte der Terrasse in den dahinter liegenden Parkteil führten, großen, offenbar mächtig ins Kraut geschossenen Bäumen, bei deren Anblick mir leider wieder Willi einfiel, und einem kleinen, ziemlich ausgetrockneten Teich. Hier musste es vor etwa zweihundert Jahren im Sommer doch traumhaft gewesen sein – wenn man nicht gerade zum Personal gehörte oder auf dem Weg ins Armenhaus hier vorbeihumpelte (Hauptseminar Sozialstruktur des 18. und frühen 19. Jahrhunderts, letztes Wintersemester).
Ich setzte mich auf die steinerne Terrasseneinfassung; kaputtzumachen war hier ohnehin nichts mehr. Morgen würde ich mit der Kamera hierher zurückkommen, ganz bestimmt. Durch die kahlen Bäume hörte man ganz leise das Rauschen der Autos auf der Kirchfeldener Landstraße, die erst weiter nördlich nach Kirchfelden abbog, aber dieses diskrete Geräusch fiel einem nach wenigen Minuten gar nicht mehr auf.
Still war es hier, von dem leisen Surren abgesehen, nur ab und zu tropfte etwas kondensierter Nebel von den Zweigen. Mein Hinterteil fühlte sich allmählich kalt an, aber die Szene gefiel mir so gut, dass ich sitzen blieb, bis ich mich wirklich ganz steifgefroren fühlte. Dieser Mantel war wirklich nicht mehr warm genug!
Mühsam stand ich schließlich auf und umrundete das Schlösschen wieder. Vor der Fassade stand jemand. Noch ein Nebel-Spaziergänger? Ich ging auf ihn zu und wollte zurück auf den Spazierweg, der zum Ausgang Graf-Tassilo-Straße führte, aber ich musste ihn fasziniert betrachten: Hatte der einen tollen Mantel an! Fast bodenlang, mit drei Schulterkragen übereinander, darunter wurden blank polierte Stiefel sichtbar. Ein bisschen, als sei er einem Roman von Georgette Heyer entsprungen – zumindest kannte ich solche Mäntel nur daher.
Der Mann trug keinen Hut und die kurzen hellen Locken passten zu diesem Mantel, fielen aber nicht so auf wie dieser, der Frisur fehlte diese eigenartige historische Nuance. Ein Fan von Kostümfilmen vielleicht, oder ein Statist, der den Drehort nicht fand – oder jemand, der nicht bedacht hatte, dass der Fasching offiziell erst morgen begann. Mir fiel noch eine vierte Möglichkeit ein, die allerdings besser nach Wien gepasst hatte, wo man überall auf Kniehosenträger traf – vielleicht warb er für ein Museum, ein Konzert oder sonst ein kulturelles Ereignis und hatte sich entsprechend kostümiert. Mir konnte das ja auch ziemlich gleichgültig sein, überlegte ich, als ich an ihm vorbeischritt.
„Verzeihung“, sprach er mich in diesem Moment an, und ich blieb stehen und sah ihn misstrauisch an. Ein Triebtäter, bei diesem Wetter? Vielleicht hatte er auch zu viele Edgar-Wallace-Filme gesehen, und der Nebel törnte ihn noch an? „Ja?“
„Darf ich Sie etwas fragen, mein Fräulein?“ Huch, wo hatten sie den denn rausgelassen?
„Ja, bitte?“ Auf einen Vortrag zum Thema Frau oder Fräulein hatte ich jetzt keine Lust – und wie üblich auch nicht den Mut. „Wo sind wir hier?“
Ich sah ihn etwas verwundert an. Der schien ja ordentlich von der Rolle zu sein! Hatte man ihn hier ausgesetzt? „Im Prinzenpark natürlich, direkt von dem Palais Leopold.“
Er nickte und sah befriedigt aus. „Das dachte ich mir. Das Palais scheint mir freilich in einem recht traurigen Zustand zu sein.“
„Naja, es ist schon ganz schön alt, und die Stadt oder wem immer es gehört, hat anscheinend noch keinen sinnvollen Verwendungszweck dafür gefunden“, verteidigte ich das arme Schlösschen. Eigenartig, ich hatte doch gerade selbst über diese Frage nachgedacht! „Wird es denn nicht bewohnt?“
Seltsame Vorstellung! „Wer sollte es bewohnen? Wahrscheinlich sind die Installationen aus dem 18. Jahrhundert, wem kann man das denn heute zumuten? Und dann ist es sicher so schlecht isoliert, dass man ein Vermögen verheizen würde. Nein, es steht leer, ich denke mal, schon seit dem Ende des Ersten Weltkriegs.“
Darüber schien er nachzudenken, kam aber offenbar zu keinem vernünftigen Ergebnis, im Gegenteil, er sah ziemlich ratlos drein. Wollte er das Schlösschen renovieren? Darin wohnen? Ich konnte ihm auch nicht sagen, an wen er sich da wenden sollte, und ob man überhaupt als Privatperson mitten in einem städtischen Park wohnen durfte.
Nein, er wechselte das Thema. „Wären Sie so freundlich, mir das heutige Datum zu nennen?“
Langsam fand ich ihn schon befremdlich. War er vielleicht lange krank gewesen? War er ein Entführungsopfer, das man eben erst frei gelassen hatte?
„Heute ist der zehnte November“, antwortete ich also etwas reserviert.
„Ja, das ist mir bekannt“, erwiderte er, „aber in welchem Jahr befinden wir uns?“
Ich starrte ihn an. Er sah gut aus, sogar sehr gut, edle Gesichtszüge, graue Augen, sorgfältig frisierte dunkelblonde Locken, ein weißer Kragen, der dunkle Mantel... irgendwie kam er mir vage bekannt vor. Er war hochgewachsen und schlank und in der rechten Hand hielt er ein Gerät, das wie ein etwas altmodischer, großer Kompass aussah und das er, als er meinen Blick bemerkte, schnell in die Manteltasche schob.
„Zweitausendeins natürlich“, sagte ich schließlich etwas herablassend. Ich kam mir vor wie in einem schlechten Film. Gab es da nicht mal einen, wo sich ein Kerl im Zweiten Weltkrieg hatte einfrieren lassen und dann in unserer Zeit wieder aufgetaut wurde, woraufhin er die Welt nicht mehr verstand? Aber das konnte es ja in Wirklichkeit gar nicht geben, diese Einfriertechnik gab es nur im Kino und in Science Fiction-Romanen. Sebastian müsste sich damit auskennen, der liebte solche Schmöker.
„Zweitausendeins...“ wiederholte er nachdenklich und starrte einen Moment lang ganz leer vor sich hin. „Erstaunlich!“
„Warum?“, fragte ich verblüfft. „Welches Jahr haben Sie denn bitte erwartet?“
Er winkte ab – aber dass man mir meine Fragen nicht beantwortete, war ich ja nachgerade gewöhnt.
„Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, gnädiges Fräulein. Mein Name ist Gützingk, Johann Christoph von Gützingk.“
„Kirsten Börner“, antwortete ich mechanisch und musste dann kichern. „Sie klangen eben wie Mein Name ist Bond. James Bond. War das Absicht?“
„Wohl kaum“, antwortete er, „ich habe noch nie von diesem Herrn Bond gehört. Ein Engländer, nehme ich an? Auf der Grand Tour?“
Wie bitte? Das Kostüm musste ihm aufs Hirn geschlagen sein. Ich konnte ihn aber schlecht fragen, ob er durch ein Wurmloch oder wie diese Dinger hießen direkt aus dem 18. Jahrhundert in den Prinzenpark von heute gereist war, dann hielte er mich ja für bekloppt!
„Nein, ein Geheimagent aus dem Kino. Die Grand Tour ist mittlerweile etwas aus der Mode gekommen“, formulierte ich vorsichtig.
„Immerhin ist sie noch allgemein bekannt“, insistierte er und sah mich von der Seite an.
„Na, ich weiß ja nicht. Ich bin sicher, wenn Sie die nächsten zwanzig Passanten fragen, hat vielleicht einer den Begriff schon mal gehört oder in einem historischen Roman davon gelesen.“
„Woher wissen Sie denn dann davon?“
Ich lachte. „Ich studiere Geschichte, und die Zeit zwischen 1700 und 1850 ist eines meiner Spezialgebiete. Außerdem lese ich auch gerne historische Romane, wenn sie schön kitschig sind. Ich glaube, die Grand Tour ist schon zur Zeit Napoleons aus der Mode gekommen, es war ja immerzu Krieg, wer schickte da schon seine Söhne auf Bildungsreisen!“
„Da haben Sie gewiss Recht, gnädiges Fräulein.“
„Sagen Sie doch nicht immer gnädiges Fräulein zu mir“, entgegnete ich leicht gereizt.
„Wie darf ich Sie denn dann anreden?“
„Sagen Sie einfach Kirsten. Fräulein sagt kein Mensch mehr, das ist altmodisch und total diskriminierend.“
„Tatsächlich?“ Er fragte nicht nach, warum, vielleicht war ich ihm schon zu oft über den Mund gefahren. Ich war überhaupt reichlich kess für meine Verhältnisse, stellte ich im Nachhinein fest, aber er erzählte auch zuviel Blödsinn!
„Mir wird langsam kalt“, konstatierte ich und fröstelte in meinem abgeschabten Mantel.
„Oh, das bedaure ich, ich wollte Sie nicht über Gebühr inkommodieren.“
„Haben Sie gar nicht“, musste ich ihn sofort beruhigen, „nur – müssen wir hier vor dem Schlösschen stehen bleiben? Wenn wir ein bisschen spazieren gehen, wird uns sicher wärmer. Oder warten Sie hier auf jemanden?“
„Aber nein. Ich würde mich geehrt fühlen, wenn ich mich Ihnen zu einer Promenade anschließen dürfte.“
Diese gestelzte Sprache! Ich fragte mich wieder, wo sie diesen Irren losgelassen hatten – und ob ich nicht mindestens genauso irre war, mit ihm spazieren zu gehen. Was, wenn er mich irgendwo ins Gebüsch zerrte? Nein, so sah er eigentlich nicht aus. Andererseits sahen Triebtäter zwar auf den Phantomzeichnungen immer echt krank aus, wirkten in natura aber wahrscheinlich ganz normal. Trotzdem, ich hielt ihn für harmlos. Durchgedreht, aber harmlos. Vielleicht war er Schauspieler – schön genug war er dafür – und versuchte, sich in seine Rolle in einem Kostümfilm so richtig einzufühlen? Echte Stars sollten ja schon in den Knast gegangen sein, um für ihren nächsten Film zu recherchieren!
Wir spazierten wieder Richtung Parkmitte.
„Sie studieren also Geschichte?“, fragte er nun, um das Gespräch wieder aufzunehmen.
„Ja, Geschichte, Politik und Englisch, für den Magister. Nächstes Jahr müsste ich fertig sein.“
„Interessant. Dann sprechen Sie gut Englisch?“
„Natürlich. Aber das kann doch praktisch jeder, schließlich ist es in jeder Schulform Pflicht. Haben Sie es nicht in der Schule gelernt?“
Er schüttelte den Kopf. „Ich habe vor allem die alten Sprachen studiert. Und natürlich Französisch. Englisch fand mein Lehrer nicht so wichtig, scheint es mir.“
„Ihr Lehrer? Sie hatten Hausunterricht? Dann waren Sie als Kind wohl lange krank? Ansonsten ist das, glaube ich, gar nicht mehr erlaubt. Aber ich kenne mich da nicht so aus.“
Er gab einen unbestimmten, aber vage bejahenden Laut von sich und blieb dann verblüfft stehen. „Was ist das?“
Mein Blick folgte seinem ausgestreckten Zeigefinger, und ich atmete tief durch. „Ja, das ist eine Sünde und Schande. Unglaublich, was? Die schrecken doch vor gar nichts mehr zurück, Werbetafeln mitten im Prinzenpark, und dann noch eine so unglaublich dämliche Werbung!“
So hatte ich mich schon lange nicht mehr aufgeregt, aber mussten sie hier zwischen den Bäumen schon wieder für diese aufdringliche Versicherung werben?
„Werbung...“ murmelte er, wieder so gedankenverloren. „Wie wurde dieses Gemälde geschaffen? Es sieht ungewöhnlich lebensecht aus.“
Ich zuckte die Achseln. „Das ist doch bloß ein ganz gewöhnliches Foto. Ich glaube nicht, dass das jemand gezeichnet hat.“
„Foto...“ Er schien bestimmte Wörter zu sammeln, aber wozu? Waren das alles Begriffe, die er nicht kennen durfte, solange er so verkleidet war? Gehörte das zum Einleben in diese Rolle? Ich sah ihn vorsichtig von der Seite an, und er schien meinen etwas misstrauischen Blick zu bemerken, jedenfalls lächelte er verlegen und zeigte dabei ein ganz entzückendes Grübchen neben dem rechten Mundwinkel. Er gefiel mir, aber ich hielt ihn trotzdem für einen Spinner.
„Kirsten... Sie haben mir ja erlaubt, Sie so anzusprechen, nicht wahr?“
Ich nickte. „Mir wird allmählich auch ein wenig kalt. Gibt es hier so etwas wie ein Gasthaus oder eine Poststation? Ich würde Ihnen gerne ungestört erklären, warum ich so seltsame Fragen stelle. Wahrscheinlich werden Sie es mir nicht glauben können, weil es so unvernünftig klingt, aber ich möchte es wenigstens versuchen. Wären Sie dazu bereit oder fürchten Sie, kompromittiert zu werden?“
„Kompromittiert? Das nun wirklich nicht! Also, eine Poststation gibt es hier nicht, fürchte ich, aber gleich gegenüber dem Parkausgang in der Katharinenstraße ist ein kleines Café. Nicht besonders gut, fürchte ich, aber man kann es dort aushalten.“
„Ein Kaffeehaus? Eine vorzügliche Idee!“ Er bot mir galant den Arm. Stammte er vielleicht aus Wien? Kaffeehaus? Diese altmodische, überhöfliche Art? War das eine Sonderform des Wiener Schmähs?
Wir näherten uns dem Parkausgang und kamen schließlich zur Kreuzung Katharinen-/Graf-Tassilo-Straße. Menschenleer, es dämmerte bereits. „Wozu dienen diese bunten Lichter, und wie werden sie erzeugt?“, fragte er nun und deutete auf die rote Fußgängerampel. Respekt, der fiel wirklich nie aus der Rolle! Er müsste im Film sehr glaubhaft rüberkommen, überlegte ich mir. Sollte ich ihm jetzt ernsthaft erklären, wozu eine Ampel diente? Na, wenn es ihn glücklich machte... Ich hatte noch kaum damit angefangen – und befürchtete schon, dass ich das Prinzip der Elektrizität bestimmt nicht hinkriegen würde, daran war ich vor Urzeiten schon in einer Physik-Schulaufgabe kläglich gescheitert – als er fast einen Satz machte. „Um des lieben Himmels willen, was ist das?“
Oh, gut, er hatte daran gedacht, sich über das einzige Auto weit und breit zu wundern! Gott, musste das anstrengend sein!
„Das“, ich lächelte ihn freundlich an, um zu zeigen, dass ich bereit war, mitzuspielen, „ist ein Auto. Korrekter gesagt, ein Automobil. Das kommt teils aus dem Griechischen, von das heißt selbst, und teils aus dem Lateinischen, denn mobilis heißt beweglich. Ein Fahrzeug, das sich von selbst bewegt, oder, wie man es zur Zeit seiner Entstehung gerne nannte, eine Kutsche ohne Pferde oder eine Benzinkutsche. Zufrieden?“
Nein, natürlich nicht. „Wie kann es sich ohne Pferde bewegen?“
Himmel, war das hier etwa eine Mischung aus Versteckte Kamera und Wer wird Millionär? Einer wird ausgeschickt, um sich von harmlosen Passanten die Welt erklären zu lassen und nachher im Fernsehen die peinlichen Schnitzer zu zeigen? Ich konnte mir schon vorstellen, wer so etwas lustig fand: Annas kindliche Detektiv-Freunde – aber die mussten doch heute mit dem Standesbeamten beschäftigt sein?
Ich holte tief Luft. „Also, stark vereinfacht: Man füllt Benzin hinein, das wird irgendwie da drin verdichtet, also zusammengepresst, und dann durch einen Funken entzündet. Beim Explodieren dehnt es sich aus, drückt einen Kolben nach oben – oder was weiß ich – und dadurch entsteht Bewegung. Die wird auf die Räder übertragen und das Auto fährt.“
Er schauderte. „Gut, dass es davon nicht viele gibt!“
Ich lachte. „Wer sagt das? Hier vielleicht, am Samstagnachmittag – aber schauen Sie sich doch mal die Kirchfeldener Landstraße am Freitagmittag an – stadtauswärts, da stehen sie zu hunderten im Stau! Es gibt verdammt zu viele Autos, und sie verpesten die Luft. Aber was soll´s, jeder schimpft, aber jeder fährt.“
Ich erntete einen konsternierten Blick. „Sie führen eine recht kräftige Sprache, für eine junge Dame.“
„Tatsächlich? Was hab ich denn gesagt? Und wer sagt, dass ich eine Dame sein will?“
„Sie haben – hm – verdammt gesagt.“
„Wenn´s weiter nichts ist... Heute sind die Frauen nicht mehr so zimperlich. Und eine Dame zu sein, bedeutet nur, dass man sich tadellos benehmen muss, was keiner oder besser keine will. Apropos kräftige Sprache – kennen Sie zufällig Götz von Berlichingen, von Goethe?“
Er dachte nach. „Ja, ich glaube schon. Nicht unbedingt das Allerneueste, aber – doch, es steht in meines Vaters Bibliothek, glaube ich. Warum?“
„Nun, wenn Sie die erste, skandalträchtige Fassung haben, dann wissen Sie auch, was Götz dem Hauptmann anempfiehlt – oder stehen in ihrem Text nur drei Sternchen?“
„Sagen Sie es mir doch bitte, ich weiß es nicht mehr.“
„Nein, es ist wirklich etwas unfein. Ich zeige Ihnen bei Gelegenheit mal den Text. Kommen Sie, bei Grün dürfen wir die Straße überqueren.“
Er folgte mir, dem Auto – einem kleinen rostigen Japaner, der langsam die glitschige Straße entlang schlich – ängstlich nachblickend. „Haben Sie auch so ein – hm – Auto?“
Ich sah ihn erstaunt an. „Sicher. Hat fast jeder. Womit fahren Sie denn durch die Gegend?“
„Das erzähle ich ihnen später“, versprach er und sah sich in der Katharinenstraße neugierig um. Viel war im Dämmerlicht nicht zu sehen, hauptsächlich unbeleuchtete Schaufenster, einige finstere Kneipen, ein wildes Durcheinander alter und neuer Fassaden, hässlicher Tiefgarageneinfahrten und melancholischer Einblicke in Hinterhöfe. Dazu vergessene Mülltonnen, wie immer einige weggeworfene Verpackungen von McDonald´s, bunte Plakate an allen Flächen, die man bekleben konnte – immer direkt neben dem Schild Bekleben verboten. Tagsüber tobte hier, direkt hinter der Uni, das Leben, es war bunt und üppig – aber jetzt verströmte die Szenerie hauptsächlich Tristesse.
„Ist das hier eine übel beleumundete Gegend?“
„Nein, nur das Univiertel. Ohne Studenten wirkt es nicht, Sie müssen am Montagmittag mal vorbeischauen, dann sieht es hier viel lebendiger und schöner aus. Und bis dahin ist der Müll auch hoffentlich abgeholt worden.“
„Gut, ich werde es mir noch einmal betrachten. Ist es schwierig, ein solches Auto zu fahren?“
„Nicht besonders. Gut, in der ersten Fahrstunde hat man schon Angst, aber das gibt sich rasch.“
„Fahrstunde?“
„Man braucht eine Genehmigung, um fahren zu dürfen, und für den Führerschein muss man Stunden nehmen. Das machen die meisten Leute, kurz bevor sie achtzehn werden, ab achtzehn darf man fahren.“
„Dürfte ich auch einmal -?“
„Wenn Sie mir vorher Ihren Führerschein zeigen? Sonst nicht. Ohne ist es verboten. Hier ist das Café.“
Tatsächlich saß keiner darin, aber es hatte geöffnet. Ich führte den immer noch etwas verschreckt wirkenden Johann Christoph (ein reichlich altmodischer Name, wie aus dem achtzehnten Jahrhundert) an den hintersten Tisch, wo wir auch beim größten Andrang ungestört blieben. Er setzte sich und studierte hilflos die Karte.
„Ich kann das kaum lesen, und die meisten Dinge kenne ich nicht. Was ist ein Cappuccino? Oder ein Espresso?“
„Milchkaffee oder starker schwarzer Kaffee. Was können Sie denn nicht lesen?“
Er zeigte auf eine völlig normale Zeile. Ich las sie ihm vor und sah ihn dann erstaunt an. „Wo lag jetzt das Problem? Ist es die Schrift oder der Inhalt?“
„Die Schrift.“
„Sie sind aber nicht zufällig – äh, also haben Sie eine Leseschwäche oder überhaupt Probleme mit dem Lesen und Schreiben, das soll ja auch heute manchmal noch vorkommen, also, was ich meine, ist, sind Sie vielleicht - “ ich holte verlegen Luft, „Analphabet?“
Er sah beleidigt drein. „Natürlich nicht. Das mag ja bei Bauern und Dienstboten verbreitet sein, aber doch nicht in den gebildeten Ständen. Nein, die Schrift ist nur so eigenartig, ich kenne sie nur aus fremdsprachigen Zitaten.“
„Antiqua? Sind Sie an Fraktur gewöhnt?“
„Ja“, antwortete er erleichtert, „das kennen Sie noch?“
„Aus alten Quellen. Aber das ist schon ziemlich lange nicht mehr üblich, weil es im übrigen Europa niemand lesen kann. Wir schreiben auch alle lateinisch. Also, was möchten Sie?“
„Am liebsten einen ganz normalen Kaffee. Gibt es das?“
„Klar. Einen Kaffee, einen Tee, bitte!“
Das Gewünschte wurde umgehend gebracht, die Bedienung hatte ja ohnehin nichts anderes zu tun gehabt als sich die Nägel zu polieren. Er trank einen Schluck, nickte befriedigt und lehnte sich dann zurück.
„Ich bin mir sicher, dass Sie mir nicht glauben werden, aber ich versuche es trotzdem.“ Er angelte etwas aus seiner Manteltasche. Ach ja, das kompassartige Ding von vorhin! Er legte es vorsichtig auf den Tisch. „Können Sie sich vorstellen, was das ist?“
„Ein Kompass?“, riet ich. Er schüttelte den Kopf. „Nein, nicht direkt. Ich habe es selbst gebaut, weil ich mich sehr für physikalische Experimente interessiere. Es ist eine Zeituhr.“
„Eine Zeituhr?“ Ich rührte in meinem Tee herum. „Aber jede Uhr misst doch die Zeit – oder sollte es wenigstens.“
„Nein, keine solche Zeituhr. Man kann eine bestimmte Zeit einstellen und sich dann zu diesem Moment begeben, also – ach, ich kann das nicht wirklich erklären, fürchte ich.“
„Eine Zeitmaschine? Um in der Zeit zu reisen?“ Der verscheißerte mich doch!
Er strahlte auf. „Das kennen Sie?“
„Ja, aus Büchern und Filmen“, grollte ich, „aber das funktioniert nicht in Wirklichkeit. Jedenfalls hab ich noch nie davon gehört, und wenn das jemand geschafft hätte, wüsste es am nächsten Tag doch die ganze Welt.“
„Mir ist es aber gelungen. Allerdings nicht ganz, ich wollte zwanzig Jahre in die Zukunft reisen und nicht zweihundert, wahrscheinlich habe ich beim Einstellen der Zielzeit eine Unachtsamkeit begangen.“
„Oder das Raum-Zeit-Kontinuum gestört“, murmelte ich in Gedanken an Zurück in die Zukunft.
„Bitte? Jedenfalls wollte ich nur einen Moment lang sehen, wie diese Stadt im Jahre 1821 sein wird. Die Welt von 2001 erschreckt mich ziemlich.“
„Uns erschreckt sie manchmal auch, weil wir nicht alle Entwicklungen im Griff haben“, gab ich zu.
„Erzählen Sie mir mehr von sich.“ Dabei musste er doch einen Fehler machen? Wer hatte mir bloß diesen Spinner auf den Hals gehetzt? Aber er sah wirklich faszinierend aus. Sogar seine Zähne waren in Ordnung, und das war für mich schon ein Zeichen, dass das alles erlogen war – damals waren die meisten Leute mit Ende zwanzig doch schon recht zahnlos?
Er überlegte. „Sie glauben mir?“
„Das habe ich nicht gesagt“, antwortete ich vorsichtig.
„Nun, ich werde es wohl dennoch versuchen. Ich heiße Johann Christoph von Gützingk, bin geboren am 24. Mai 1774, also bin ich siebenundzwanzig Jahre alt, habe in Göttingen studiert, auf Wunsch meines Vaters die Rechte und, meinen eigenen Neigungen folgend, ein wenig die Naturwissenschaften. Meine Eltern besitzen ein Gut in der Nähe der Stadt, bei Leiching. Ich würde gerne einen Blick darauf werfen, wie es heute aussieht, und ob meine Nachfahren noch dort leben. Meine Eltern wünschen, dass ich im nächsten Jahr, sobald mir eine Anstellung bei Hofe sicher ist, Anna Christina von Herrnberg heirate, die einen Teil des Nachbargutes erben wird, aber weder Anna Christina noch ich sind von diesen Plänen sonderlich enthusiasmiert. Ich glaube, sie hat ihr Herz schon einem anderen geschenkt.
Ich wollte gerne einen Blick in die Zukunft tun, auch um zu sehen, wie sich die Pläne Bonapartes weiter entwickeln und ob diese Pläne auch das Leben hierzulande berühren werden, aber, wie gesagt, ich habe offenbar recht unachtsam die Zeit eingestellt und bin zu weit gereist. So finde ich mich nun in einer völlig fremden und recht erschreckenden Welt wieder. Ich bin nur froh, dass ich sofort einen so reizenden Cicerone gefunden habe.“
Er zog meine Hand an seine Lippen, und ich verbiss mir angesichts seiner gestelzten Sprache und seiner altväterischen Manieren mühsam das Kichern. „Kirsten, möchten Sie mir nicht ein wenig von sich erzählen? Sie sind noch sehr jung, das sehe ich, aber ungewöhnlich gebildet. Woher kommt das?“
Nun musste ich doch lachen.
„Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Erstens, ich bin vierundzwanzig, also nach Ihren Maßstäben nicht mehr allzu jung, zweitens, jeder Mann und jede Frau, die das Gymnasium absolviert haben, haben diese Art Bildung, sofern sie ihre Schulzeit genutzt haben. Wie gesagt, ich studiere Geschichte, Politik und Englisch und weiß noch nicht, was ich nach dem Examen beruflich machen werde. Ich wohne an der Kirchfeldener Landstraße, arbeite neben dem Studium gelegentlich in verschiedenen Büros, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen und – was soll ich noch sagen?“
„Warum ist eine so entzückende Person wie Sie nicht verheiratet? In Ihrem Alter?“
Ich verdrehte die Augen. „Heutzutage heiratet man erst später, die meisten so mit Ende zwanzig. Man möchte es ja vorher im Beruf zu etwas gebracht haben!“
„Aber Sie sind doch eine Frau? Wäre es nicht Sache ihres Gemahls, sich um einen Beruf und den notwendigen Lebensunterhalt zu kümmern?“
„Nein, heutzutage arbeiten meist beide. Naja, wenn die Kinder noch klein sind, bleibt meistens die Mutter ein paar Jahre zu Hause und versaut sich ihre Karriere damit, weil die meisten Männer sich mit dummen Ausreden davor drücken.“ Er schüttelte den Kopf. „Seltsame Gepflogenheiten. Und es fällt den Menschen nicht schwer, so lange zu warten?“
„Worauf zu warten? Auf einen Berg schauriger Hochzeitsgeschenke?“
„Nein, ich meine – ach, das sollte ich vor einer Dame eigentlich nicht erwähnen, verzeihen Sie bitte.“
Seine Wangen färbten sich rosa. Wie niedlich, er genierte sich! Ich grinste frech. „Ich verstehe, was Sie meinen. Aber darauf wartet doch keiner bis zur Hochzeit, warum auch?“
„Ich dachte an die Schande...“
„Welche Schande? Erstens können wir heute verhindern, dass ein Kind zur falschen Zeit kommt, und zweitens sind nichteheliche Kinder keine Schande mehr. Hier in der Stadt gibt es bestimmt genauso viele allein erziehende wie verheiratete Eltern, wobei die verheirateten nicht immer mit dem anderen Elternteil des Kindes verheiratet sein müssen.“ Er schüttelte wieder den Kopf. „Was sagen denn die Kirchen dazu?“
„Sie mahnen. Aber es hört ja fast keiner mehr auf sie. Möchten Sie etwas essen? Ein Stück Kuchen vielleicht?"
Er suchte sich ein Stück Teekuchen aus, vielleicht war das das einzige, was es zu seiner Zeit schon gegeben hatte. Zu seiner Zeit? Ich fing doch hoffentlich nicht an, ihm seine Geschichte abzukaufen? Sie war zwar in sich logisch, aber die Prämisse war Unsinn, denn Zeitreisen gab es nicht in der Wirklichkeit.
„Sie werden also nicht kompromittiert, wenn man uns hier sitzen sieht?“, fragte er noch einmal, als die Bedienung den Kuchen vor ihn hinstellte. „Aber nein! Mein Privatleben geht niemanden etwas an. Gut, ich habe meinem Freund erzählt, ich müsste nach Hause, um einen Essay zu schreiben. Aber das hab ich nur gesagt, weil ich ziemlich böse auf ihn war. Sollte er uns sehen, stört mich das gar nicht, er soll sich ruhig ärgern!“
„Sie sind sehr mutig, Kirsten.“
„Ich?“ Ich hätte mich fast an dem faden Tee verschluckt. „Ich bin bekannt für meine Feigheit. Ein Freund meines Freundes hat mich erst kürzlich als Fußabtreter bezeichnet. Allerdings wusste er nicht, dass ich es hören konnte.“
„Eine Unverschämtheit! Ich würde Sie nie so bezeichnen. Und mir scheint auch, dass Sie sehr durchsetzungsfähig sind.“
„Ja, weil sie mich mit den Häschen aus Ihrer Zeit vergleichen!“, murrte ich in meinen Tee.
„Häschen?“
„Eine abfällige Bezeichnung für Frauen, die sich den Männern unterwerfen.“
„Gestatten Ihnen Ihre Eltern denn diesen Lebensstil?“
„Ich bin seit sechs Jahren volljährig! Was sollten sie machen? Außerdem führe ich ein sehr braves Leben, nach heutigen Maßstäben. Ich treibe mich nicht herum, ich habe einen festen Freund, studiere fleißig und verdiene meinen Lebensunterhalt selbst. Sie sind recht zufrieden mit mir.“
„Eine komische Welt ist das. Woher kommen diese Veränderungen?“
Ich seufzte. „Ich bin zwar Historikerin, aber wenn ich Ihnen jetzt alle wichtigen Ereignisse der letzten zweihundert Jahre aufzählen sollte... Können Sie nicht einfach ein Geschichtsbuch lesen? Da steht doch dann alles drin, für Schüler, also leicht verständlich.“
„Woher bekomme ich so etwas?“
„Tja, gute Frage. Ich müsste selbst noch eins haben, aus meiner Schulzeit. Die Werke fürs Studium sind für Ihre Zwecke zu detailreich, fürchte ich. Wenn ich Sie einlade, mit zu mir zu kommen, fassen Sie das aber nicht falsch auf, oder?“
„Gewiss nicht. Sie sind doch meine Führerin durch diese bizarre Welt!“
„Nicht bizarrer als mir wahrscheinlich das Jahr 1801 erscheinen würde.“ Mittlerweile hatte ich es aufgegeben, meinen Unglauben zu signalisieren. „Kommen Sie?“
Er beobachtete interessiert, wie ich bezahlte, sagte aber nichts dazu. Draußen freilich entschuldigte er sich. „Selbstverständlich habe ich genügend Barschaft eingesteckt, bevor ich mich mit meiner Zeituhr vor das Palais Leopold begab – aber ich bin noch zu unsicher. Darf ich Ihnen den Betrag wenigstens erstatten?“
„Wenn es Ihnen Recht ist, regeln wir das zu Hause. Ich glaube nämlich nicht, dass Sie über Geld in einer gültigen Währung verfügen.“
Er fügte sich und ich staunte über mich selbst – für meine Verhältnisse schlug ich einen direkt herrischen Ton an! Sebastian und der dämliche Willi hätten mich so mal hören sollen! Wir schlenderten die Katharinenstraße entlang nach Norden, und bei jedem Auto, das an uns vorbeifuhr, zuckte er zusammen.
„Wie werden Sie genannt?“, fragte ich, auch um ihn von den Schrecknissen des Straßenverkehrs abzulenken. „Johann Christoph ist doch ein bisschen lang, oder?“
„Ich muss Ihnen zustimmen. Außerdem heißt mein jüngerer Bruder Johann Gottfried. Unsere Mutter ruft uns Christl und Friedl, aber das ist uns ein wenig unangenehm.“
„Kann ich Christoph sagen?“
Er blieb stehen und verneigte sich leicht. „Es wäre mir eine Ehre, gnädiges Fräulein.“
„Wollten Sie das mit dem Fräulein nicht lassen? Damit handeln Sie sich bei fast allen Frauen Ärger ein.“
„Es ist doch ein Ehrentitel?“
„Ja, ich weiß schon. Mein schönes Fräulein, darf ich wagen, meinen Arm und Geleit Ihr anzutragen? - Bin weder Fräulein, weder schön, kann ungeleitet nach Hause gehn. Das haben wir alle in der Schule gelesen.“
„Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht recht folgen, Kirsten“, gestand er verlegen, „obwohl der Tonfall vertraut klingt.“
„Goethe, Faust I? Nie gelesen?“
„Nein, ich muss es gestehen. Ich habe noch nicht einmal davon gehört, obwohl sich mein Vater fast alle Neuerscheinungen senden lässt und im Familienkreis gerne darüber berichtet.“
„Oh, vielleicht ist es erst nach 1801 erschienen. Ich gucke zu Hause nach. In diesem Fall könnten Sie ja gar nichts dafür. Wie waren wir noch mal auf Faust gekommen?“
„Über die Anrede Fräulein, soweit mir erinnerlich ist.“
Ich kicherte. „Sie sprechen so hübsch. Richtig gepflegt!“
„Altmodisch, meinen Sie?“
„Naja, ein bisschen schon. Aber das ist nett, finde ich. Also Fräulein ist eine Verkleinerungsform und die Anrede für eine unverheiratete Frau – gewesen, sind Sie soweit einverstanden?“
„Eine unverheiratete Frau von Stand. Eine Bürgerstochter würde ich nicht so anreden, hier wäre wohl Jungfer oder Demoiselle am Platze.“
„Dann sollten Sie lieber Demoiselle zu mir sagen, ich bin doch nicht von Adel. Aber das interessiert heute auch keinen mehr. Zurück zum Thema – wieso komme ich heute dauernd davon ab? Also impliziert die Anrede Fräulein, dass eine Frau ohne Ehemann nur eine kleine Frau, quasi eine halbe Frau ist - und wenn das keine Unverschämtheit ist?“
„Nach der Auffassung Ihrer Zeit ganz offensichtlich. Wie werden Sie dann tituliert? Es übersteigt meine Einbildungskraft, dass Sie sich wirklich mit Demoiselle anreden lassen.“
Ich kicherte wieder und hielt ihn am Ärmel fest, damit er nicht bei Rot über die Ampel trabte. „Da haben Sie Recht. Wer mich nicht Kirsten nennen darf, sagt eben Frau Börner. Stopp jetzt! Wenn Sie unbedingt weiterlaufen wollen, können wir nachher Ihre Reste vom Asphalt kratzen. Sie sehen doch, dass da ein rotes Männchen leuchtet, oder?“
Er würde sich doch nicht überfahren lassen, nur um mir zu beweisen, dass seine alberne Zeitreisegeschichte echt war? „Doch, meine Augen sind ausgezeichnet. Wären Sie so freundlich, mir dieses Zeichen zu deuten?“
„Es will sagen, dass die Fußgänger in dieser Richtung stehen bleiben müssen, weil jetzt die Autos kreuzen.“
„Aber da kommt ja gar kein Auto!“
„Himmel, das weiß doch die Ampel nicht!“, erklärte ich ungeduldig, „Sie schaltet eben alle paar Minuten um. Schauen Sie, jetzt kommt ein grünes Männchen, jetzt dürfen wir.“
Ich musste ihn fast hinter mir herzerren, weil er sich erst auf die Straße traute, als der einsame Golf in der Katharinenstraße an der Ampel stehen geblieben war. Auf der anderen Seite deutete er auf ihn.
„Diesem Auto zeigt sich jetzt also ein rotes Symbol?“
„Richtig. Sie lernen es schon noch. Ich wohne dort drüben.“ Ich wies auf das gigantische Appartementhaus neben dem Glasturm. Schön waren die winzigen Wohnungen nicht, aber ziemlich preiswert. Ich wusste für mein bei JobTime sauer verdientes Geld etwas Besseres, als es einem gierigen Vermieter in den Rachen zu werfen.
„So hoch! Wie kann man so bauen, ohne dass es einstürzt?“
„Stahlbeton“, antwortete ich knapp und hoffte, er würde nicht genauer nachfragen, ich hatte schließlich auch keine Ahnung. War Stahlbeton Beton mit Stahlträgern innen oder ein Beton, den man mit Stahl vermischt hatte? Das hatte mich bis jetzt noch nie interessiert. Was man plötzlich alles wissen sollte! Ich stieß mit Christoph im Schlepptau die Haustür auf, fischte meine Post aus dem Briefkasten und rief den Aufzug. Während wir warteten, entschuldigte ich mich schon. „Sie dürfen sich nachher nicht zu genau umsehen, meine Wohnung ist ziemlich klein, und ich bin gestern nicht zum Aufräumen gekommen.“
Bevor er antworten konnte, öffneten sich die Aufzugtüren und ich zog ihn hinein. Er sah sich neugierig um. „Wirklich sehr klein. Fühlen Sie sich da nicht beengt? Unordnung sehe ich allerdings keine...“
„Seien Sie nicht so albern, das ist der Aufzug. Oder hätten Sie in den zehnten Stock laufen wollen?“
„Aufzug?“
„Der zieht uns mit Motorkraft hoch“, erklärte ich vage und drückte auf die Zehn. Christoph hielt die Luft an, bis der Aufzug wieder zum Stillstand gekommen war. Ich sah ihn spöttisch an, als sich die Türen wieder öffneten. „Keine Angst, der stürzt schon nicht ab.“
„Was ist ein Motor?“, fragte er und folgte mir zu meiner Wohnungstür.
„So was wie in einem Auto, es kann mit Benzin arbeiten oder mit Strom. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, was Strom ist, platze ich! Das hab ich in der Schule schon nicht gekonnt.“
„In Verlegenheit möchte ich Sie natürlich nicht bringen. Das ist nun wirklich ihre Wohnung?“
„Ja. Klein, verschlampt, aber mein. Naja, gemietet. So was kauft man nicht.“ Ich schloss auf und erschrak. Hatte ich am Freitag wirklich einen derartigen Verhau hinterlassen? Mit dem Fuß schob ich die unsortierte Schmutzwäsche hinter die Wohnungstür und lud ihn ein, näher zu treten. Er folgte der Aufforderung und sah sich neugierig um. Ich seufzte. „Ich sehe schon, mir steht eine Stunde hausfraulicher Betätigung bevor. Kommen Sie mit ins Wohnzimmer!“
Er folgte mir weiter und blieb stocksteif stehen, als ich das Licht anknipste. „Das geht auch mit Strom“, erklärte ich nebenbei und bat ihn aufs Sofa, auf dem glücklicherweise nicht der übliche Schotter herumlag. „Möchten Sie einen Kaffee?“ Ich knipste die Stehlampe an, das hässliche Vieh, das mein Vormieter hinterlassen hatte.
„Wenn es Ihnen keine Mühe macht, gerne.“
„Und hier habe ich ein Geschichtsbuch, noch von der achten Klasse. Sehen Sie, hier ist das Zeitalter Napoleons – am besten fangen Sie da an zu lesen, dann erfahren Sie schon mal was über die Industrialisierung. Die Dampfmaschine von James Watt ist Ihnen ein Begriff?“
„Natürlich, aber man wird sie nie nutzbringend - “ Er stockte, als er mein breites Lächeln sah.
„Man wird, seien Sie versichert. Der Wirkungsgrad wurde laufend verbessert. Lesen Sie ein bisschen, hier sind Papier und Bleistift, dann können Sie sich aufschreiben, wozu Sie Fragen haben. Ich werde Kaffee kochen und die Küche ein bisschen aufräumen. Möchten Sie Musik dazu hören?“
Er sah sich suchend um. „Sie haben ein Piano? Ich kann es gar nicht sehen.“
„Hab ich nicht und könnte ich nicht spielen. Ich dachte bloß an das Radio.“
Ich schaltete es auf dem Weg in die Küche ein und begann, das überall herumstehende schmutzige Geschirr in der Spüle zu stapeln. Hatte ich das heute nicht schon einmal gemacht? In Zukunft konnte Sebastian seinen Kram selber sauber halten. Allerdings, wenn ich ehrlich war, musste ich zugeben, dass er mich nie darum gebeten hatte. Ich hatte wohl nur seine Küche aufgeräumt, um mir noch mehr Leid zu tun. Zwischendurch warf ich einen Blick auf Christoph, der auf dem Sofa saß, stocksteif, und nicht etwa las, sondern lauschte.
„Was ist denn?“
„Wer spricht da?“
Ich hörte kurz zu. „Ach, das sind die Nachrichten. Es ist gerade sechs Uhr. Der Mann spricht in einem Gebäude in der Innenstadt, und das wird zu jedem Gerät übertragen. Fragen Sie mich bitte nicht, wie, ich treibe schon noch einen Physiker auf, der kann das richtig erklären.“
„Jeder hört das jetzt?“
„Wenn er das Radio anhat und nicht einen anderen Sender hören will, ja. Es gibt noch viel erstaunlichere Sachen, warten Sie´s nur ab! Gleich kommt der Wetterbericht und dann wieder Musik, da können Sie sich besser auf das Geschichtsbuch konzentrieren.“
„Wetterbericht? Man kann das Wetter vorhersagen?“
„Nicht wirklich“, grinste ich, „aber es wird immer wieder versucht. Manchmal stimmt´s, manchmal nicht, manchmal nur woanders.“
Er rutschte unruhig auf dem Sofa hin und her, was mich auf eine vielleicht dringend notwendige Idee brachte. Ich zeigte ihm also das Badezimmer, das auch in traurigem Zustand war, hängte, während er zaghaft die Mischbatterie betätigte, schnell ein weniger angegrautes Handtuch hin und erklärte ihm, wie eine Wasserspülung funktioniert, was der Aufkleber Treffen oder Setzen! innen im Klodeckel bedeutete und wo er die Seife finden konnte.
Peinlich – einem so auf feine Manieren bedachten Herrn klarzumachen, dass er gefälligst nicht daneben pinkeln sollte! Allmählich hatte ich mich offenbar mit der Idee der Zeitreise abgefunden, so schwachsinnig die Vorstellung auch war – jedenfalls überlegte ich ständig, was er schon wissen konnte und wo ich nicht von Vorkenntnissen ausgehen konnte. Das Alltagsleben im Jahre 1801 war mir trotz meines Studienschwerpunkts nicht so gut gegenwärtig. Während Christoph im Bad zugange war, raffte ich schnell die Schmutzwäsche zusammen und stopfte sie in den Schrank zurück, dann spülte ich hastig ab und setzte die Kaffeemaschine in Gang.
Schließlich kam Christoph zurück und setzte sich wieder.
„Ein solches Badezimmer hätte ich auch gerne“, stellte er dann versonnen fest. „Man müsste keine Pots de chambre mehr ausleeren, keine Wannen mit Zinkkannen füllen, kein Schmutzwasser wegtragen lassen. Sehr nützlich! Diese neue Welt beginnt mir zu gefallen. Die Bedienten hätten es viel leichter. Diese Lampen muss man auch nie putzen, nicht wahr?“
„Nein, nur ab und zu abstauben und neue Birnen einschrauben, wenn die alten kaputt sind. Und Öfen muss ich auch nicht heizen, durch die Heizungsrohre wird heißes Wasser geleitet – oder so ähnlich. Das Leben bietet heute schon einigen Komfort. Vielleicht liegt es auch daran, dass man die Frauen nicht mehr zu Hause halten konnte. Was soll man in einem solchen Haushalt den ganzen Tag tun?“
„Das ist nicht von der Hand zu weisen“, pflichtete er mir höflich bei.
Ich bereitete etwas zu essen vor, nur eine Suppe und überbackenen Toast dazu, und räumte währenddessen das Zimmer auf, das heißt, ich zerrte die Tagesdecke über das ungemachte Bett und stapelte die herumliegenden Bücher und Zeitschriften in einer Ecke auf.
Christoph aß hungrig, nachdem er das Kapitel über die Industrialisierung gelesen hatte. Wir sprachen beim Essen ein wenig darüber, und ich versprach ihm, mich morgen mit einem technisch begabten Menschen in Verbindung zu setzen, der ihm all das erklären konnte, was er bis jetzt nicht verstanden hatte. „Haben Sie eigentlich irgendeine Form von Ausweis?“, fragte ich dann, weil mir einfiel, dass man ihn kaum alleine herumlaufen lassen durfte.
„Nein... nur ein Säckchen Geld und einige Briefe, die an mich adressiert sind.“
„Das nützt nicht viel, fürchte ich. Heute muss jeder Bürger jederzeit durch ein amtliches Dokument seine Identität nachweisen können.“
„So wie bei einem Pass, wenn man das Land verlässt?“
„Genau. Haben Sie so etwas?“
„Nein. Ich wollte ja nicht das Land verlassen, sondern nur meine eigene Zeit. Da hielt ich es für unnötig, mir einen Pass ausstellen zu lassen.“ Stimmte ja, damals galten Pässe nur für eine Reise, nicht wie heute für zehn Jahre...
Den Bullen durfte er nicht in die Hände fallen, die würden ihn sofort in der Nervenklinik abliefern! Und mich auch, wenn ich diese wilde Geschichte bestätigte. Konnte ich überhaupt Anna, Xenia und Magnus einweihen? Die würden ihn nicht verraten, da war ich mir sicher. Mein Handy piepte, und ich holte es aus der Tasche. Unter Christophs konsterniertem Blick meldete ich mich. „Kommst du mit deiner Arbeit gut voran, Schatz?“
Ach, Sebastian! Den konnte ich jetzt wirklich nicht so gut gebrauchen.
„Nein, nicht besonders“, log ich also, „ich habe zwar zwei sehr gute Quellen gefunden, aber die sind wirklich problematisch, an denen muss ich wohl noch heute und morgen herumtüfteln.“
„Schade“, fand er, „ich dachte, wir könnten uns mal wieder schön ein Video angucken und ein bisschen kuscheln.“
Ich seufzte anstandshalber. „Das wäre mir auch lieber, aber es geht leider nicht. Ist denn Willi nicht mehr da?“
„Nein, der musste dann auch noch in die Stadt, wegen Weihnachtsgeschenken. Ich bin ganz alleine und sooo einsam!“ Ich kicherte. „Und kuscheln könntest du mit ihm auch nicht so recht. Hast du gar nichts zu arbeiten?“
„Äh – na gut, für das Repetitorium. Aber morgen Abend kannst du dir vielleicht etwas Zeit nehmen, oder?“
„Ich werde es versuchen, Schlaf gut, mein Schatz, und arbeite fleißig!“
Ich trennte die Verbindung. Christoph sah mich großäugig an. Er hatte wirklich wunderschöne Augen – oder lag das nur daran, dass er sie pausenlos erstaunt aufreißen musste?
„Halte ich Sie jetzt von Wichtigerem ab? Sie müssen noch etwas arbeiten, oder?“
„Ja, nachher, ein bisschen. Ich habe eben etwas geschwindelt, das war mein Freund.“
Er nickte. „Wie nennt man dieses Gerät?“
Ich zeigte es ihm. „Das ist ein Mobiltelefon, im Volksmund als Handy bezeichnet. Ein Telefon - wie war das gleich wieder? Ach ja – wandelt Schallwellen, also wenn jemand spricht, in elektrische Schwingungen um, transportiert diese weiter und wandelt sie am anderen Ende wieder in Schallwellen um. So kann man sich mit Menschen unterhalten, die ganz woanders sind.“
„Faszinierend. Wie weit darf man dafür entfernt sein?“
„Das ist egal, solange man sich nicht in einer Gegend befindet, wo ein so genanntes Funkloch ist. Da geht dann das Handy nicht. Im Prinzip kann ich mit jemandem telefonieren, der in Australien ist, oder in Hongkong oder in New York.“
Er schüttelte den Kopf. „Unglaublich. Werde ich das noch erleben?“
„Vielleicht die allerersten Telefone. Aber Handys nicht, die kamen erst vor etwa zehn Jahren auf. Macht es Ihnen etwas aus, noch ein bisschen zu lesen? Dann kann ich wirklich etwas an dieser Arbeit tun.“
„Aber bitte, ich weiß doch, welche Belästigung das alles für Sie darstellen muss!“
„Unsinn. Ich finde das alles sehr interessant, aber die Arbeit muss nächste Woche abgeliefert werden, sonst bekomme ich den Schein, also das Zeugnis dafür nicht.“
„Interessant? Aber Sie glauben mir noch nicht so ganz, oder?“
„Naja... es kommt mir alles so unwahrscheinlich vor. Aber ich verdränge diese Frage einfach. Kann sein, Sie sind durch die Zeit gereist, kann sein, Sie haben sich das aus irgendeinem Grund ausgedacht. Ist das wichtig? Ich glaube nicht, dass Sie damit irgendwelche finsteren Zwecke verfolgen. Zu klauen gibt es hier nichts, und sonst fällt mir nichts ein.“
„Klauen – Sie meinen stehlen? Woher haben Sie dieses Rotwelsch? Das habe ich bisher nur einmal gehört, und zwar in einer ungemein zweifelhaften Taverne in Göttingen, während des Studiums. Das Bier dort war auch schlecht“, fügte er finster hinzu.
„Rotwelsch? Das sagt mittlerweile jeder. Außerdem habe ich ja gemeint, dass ich Ihnen das nicht zutraue, Sie müssen also nicht beleidigt sein.“
Er lächelte, und sein Grübchen brachte mich fast um den Verstand. Wie konnte jemand, der über zweihundert Jahre alt war, so hinreißend aussehen? Nun, er wäre heute 227, im Moment war er nur siebenundzwanzig, und ich konnte nicht umhin, Anna Christina von Herrnberg kurz zu beneiden. Ach nein, die wollte er ja nicht! „Ich bin nicht beleidigt, und ich kann es verstehen, wenn Sie meine Geschichte nicht glauben wollen. ich werde jetzt noch ein wenig dieses Buch studieren. Faszinierend, wie sich diese Industrie entwickelte! Besitzen Sie auch den Folgeband?“
Ich fischte ihm das Buch für die neunte Klasse aus dem Regal. In beiden stand peinlicherweise vorne noch der Eigentumsstempel des Lortzing-Gymnasiums – warum hatte ich die eigentlich nie abgegeben? Na gut, jetzt konnte ich darum froh sein.
Ich fuhr meinen Rechner hoch, betete, dass ich nicht erklären musste, wie ein Computer funktionierte und wozu er diente (vom Internet ganz zu schweigen), und begann, meine Notizen zu tippen, soweit sie schon einigermaßen brauchbar waren, dann las ich endlich diesen Artikel über die Schleswig-Holstein-Krise fertig und überlegte, wie ich den aufgeregten Briefwechsel kurz vor der österreichischen Kriegserklärung am besten einfügen konnte.
Zwischendurch gingen meine Gedanken immer wieder Richtung Sofa. Was sollte ich bloß mit ihm machen? Reiste er zum Schlafen in seine Zeit zurück? In ein Hotel konnte ich ihn nicht schicken, nicht ohne gültiges Geld und keinesfalls ohne Papiere. Und die Kaschemmen, die ihn ohne Ausweis aufnehmen würden, brächten ihn doch nur in Schwierigkeiten, da geriet er womöglich noch in eine Schlägerei oder Messerstecherei, und vielleicht war er ja auch bewaffnet und mischte munter mit? Seine Zeitgenossen duellierten sich doch noch? Ich hatte keine Lust, verärgerten Polizisten das Blaue vom Himmel herunter vorzulügen, um ihn wieder aus dem Knast zu holen. Wie machte das der Highlander in der Serie eigentlich? Ließ er sich falsche Papiere drucken? Und wieso kannte ich niemanden, der so etwas machte? Warum kannte ich nur nutzlose Leute? Und warum kümmerte ich mich nicht endlich wieder um die Schleswig-Holstein-Krise?
So ein Schwachsinn, ich konnte ihm doch keine falschen Papiere besorgen – spielte ich hier denn in einem schlechten Film mit? Energisch tippte ich weiter und kramte auch noch meine älteren Aufzeichnungen hervor. Da hatte ich mir ja schon eine ganz brauchbare Theorie ausgedacht, fand ich. Ich fügte sie ein, bewies sie anhand der Quellen und durch Verweise auf die neuere Forschung – wie es eben so üblich war – und fand, dass es für heute reichte. Dann druckte ich das bisher Geschaffte aus. Christoph legte sein Buch beiseite – er war tatsächlich schon bei der Reichsgründung angekommen! – und kam gucken.
„Wie von Geisterhand!“, staunte er, als der Drucker Blatt um Blatt ausspuckte.
„Wie das funktioniert, erkläre ich Ihnen morgen“, wehrte ich sofort ab, weil es mir für heute reichte. „Übrigens passt das Thema zu dem, was Sie gerade gelesen haben, es geht um den Ausbruch des preußisch-österreichischen Krieges 1866, Bismarcks Vorarbeiten zur Reichsgründung.“
„Ich kann gar nicht glauben, was ich bis jetzt gelesen habe. Es wird tatsächlich einen deutschen Nationalstaat geben?“
„Sie könnten sich das alles merken und dann zu Hause als Prophet auftreten“, flachste ich, aber er blieb ernst.
„Das glaubt mir keiner. Und dann gerate ich noch in Konflikt mit den Behörden, weil ich gegen die angestammten Herrscherhäuser agitiere. Nein, es ist wohl besser, nicht zu erzählen, was ich hier gelernt habe.“
„Sie könnten das Ganze auch als Zukunftsroman verpacken. Auf eine Distanz von zweihundert Jahren kann sich doch kein Herrscher mehr bedroht fühlen.“
„Wer weiß… Aber diese Idee gefällt mir schon besser. Gibt heute auch noch ein deutsches Reich?“
„Jein, es heißt anders, Bundesrepublik Deutschland. Kaiser und Könige gibt es nicht mehr, nur noch in wenigen Staaten Europas, und da haben sie nicht viel zu sagen.“
„Kaum vorstellbar. Kirsten... sind Sie für heute schon fertig mit ihrer Arbeit?“
„Ja. Wenigstens habe ich keine Lust mehr. Ich möchte Ihnen noch etwas zeigen, auch weil ich mich selbst schon darauf gefreut habe. Gehen Sie gerne ins Theater?“
„Leidenschaftlich gerne! Aber das Stadttheater spielt nur so selten etwas wirklich Sehenswertes. Diesen Kotzebue kann ich wirklich nicht mehr aushalten. Wollen wir ins Theater gehen?“
„Nein, nicht so kurzfristig. Sehen Sie diesen Kasten da? Darin kann man Filme sehen, das ist so ähnlich wie Theater, oft sehr spannend, oft auch furchtbarer Blödsinn, aber es gibt immer verschiedene Angebote. Warten Sie, ich sehe nach, was es heute gibt. Ui, James Bond – den hatte ich ja schon erwähnt, nicht? Möchten Sie mal reinschauen?“
Er nickte vorsichtig, und ich lachte. „Wenn es Ihnen nicht gefällt, sagen Sie es einfach, dann suchen wir uns etwas anderes. Zur Not hab ich irgendwo auch noch Kabale und Liebe.“
„Von Herrn Schiller? Als – wie heißt das? Film?“
„Ja, man hat eine Aufführung einfach aufgezeichnet.“ Das stimmte nicht so ganz, aber ich hatte keine Lust, ihm zu erklären, was eine Fernsehfassung war.
Tomorrow Never Dies überforderte ihn nach wenigen Minuten, wie unschwer zu erkennen war, also stoppte ich den Film und setzte ihm tatsächlich nach einigem Herumsuchen Kabale und Liebe vor. Gebannt verfolgte er das Schauspiel, das er offensichtlich schon kannte, und seufzte, als nach Ferdinands und Luises Gifttod Wurm ankündigte, er wolle „Geheimnisse ausplaudern“, gerührt auf. Danach sah er mich erwartungsvoll an. Ja, war ich jetzt für die komplette Regelung des Alltags zuständig? Offensichtlich schon.
„Ich sehe für Ihre Übernachtung nur zwei Möglichkeiten“, begann ich. „Entweder kehren Sie für die Nacht in Ihre eigene Welt zurück -“
„Ich fürchte, das wird nicht möglich sein“, unterbrach er mich sanft, „die Zeituhr ist nicht für so häufigen Gebrauch eingerichtet. Bis morgen hätte ich sie keinesfalls wieder so weit präpariert, dass ich zu Ihnen zurückkehren könnte, und ich bin viel zu wissbegierig, was diese Welt betrifft, um diese Gefahr auf mich zu nehmen.“
Himmel, war das eine schöne Sprache! „- oder Sie übernachten hier auf dem Sofa. Ich hab noch einen Schlafsack, warten Sie, der müsste im Kleiderschrank – oder nein, ich glaube, der ist im Keller. Ich werde ihn gleich holen.“
Ich griff schon nach dem Schlüssel, als seine nächsten Worte mich aufhielten.
„Das ist ebenso unmöglich. Schließlich kann ich doch nicht bei einer unverheirateten jungen Dame von untadeligem Ruf die Nacht verbringen! Bedenken Sie, dass Ihr – hm – Freund es erfahren könnte. Ich werde in eine Herberge gehen, so etwas muss es doch auch in der Zukunft geben?“
Ich setzte mich wieder hin. „Natürlich gibt es Herbergen, besser gesagt Pensionen, Hotels und so weiter. Die nehmen Sie auch sicher gerne auf, gegen gutes Geld und Vorlage eines gültigen Ausweises.“
Das hatte gesessen! Er sah trübsinnig vor sich hin. „Diese Sache mit dem Ausweis stellt mich natürlich vor Schwierigkeiten, in dieser Hinsicht sind Ihre Argumente leider recht überzeugend. Aber ich verfüge über genügend Geld!“
„Zeigen Sie mal her!“
Er kramte aus seinen fast hautengen Pantalons mit Mühe ein kleines Säckchen und schüttete den Inhalt auf den Couchtisch, wo er zwischen Kerzenleuchtern, Fernsehzeitung und einem Teller Mandarinen hin und her rollte.
Ich nahm eine der Münzen in die Hand. „Wahnsinn! Ist das echtes Gold?“
„Selbstverständlich. Sie dürfen gerne hineinbeißen, wenn Sie es nicht glauben.“
„Nein, danke.“ Wer wusste schon, welche urzeitlichen Viren daran klebten! Ich glaubte es auch so. „Wunderschön, aber kein gültiges Zahlungsmittel. Sehen Sie her, so sieht unser Geld heute aus, wenigstens bis Ende des Jahres noch.“
Ich kippte den Inhalt meiner Geldbörse auch auf den Tisch und zeigte ihm Münzen und Scheine. „Nur damit können Sie überall zahlen, oder mit Kreditkarten. Ich könnte Ihnen natürlich meine Kreditkarte geben, aber dann wollen die auch Ihren Ausweis sehen, weil die Karte nicht auf Ihren Namen lautet. Wir können am Montag zur Bank gehen und einige Ihrer Goldmünzen verkaufen, dann haben Sie das richtige Geld. Heute Nacht können Sie damit jedenfalls kein Hotel bezahlen. Sie werden wohl hier bleiben müssen.“
Er seufzte. „Das ist mir wirklich äußerst unangenehm. Was soll Ihr Freund denken?“
„Das geht ihn gar nichts an, und er würde ohnehin nicht glauben, dass ich ihn betrüge. Das habe ich im Übrigen auch gar nicht vor!“ Ich sah Christoph streng an. Ein solcher Blick war mir Sebastian oder gar Willi gegenüber sicher noch nie gelungen.
„Selbstverständlich nicht!“, entgegnete er entrüstet. Ich warf ihm einen prüfenden Blick zu, aber es schien ihm mit seinem moralischen Edelmut ernst zu sein. Umso besser! Ich holte den Schlafsack aus dem Keller und hängte ihn im Bad über die Heizung, damit er nicht mehr so klamm war. Christoph saß weiterhin auf dem Sofa und verfolgte mein Herumwuseln mit Anteilnahme und Erstaunen.
„Hat heutzutage niemand mehr Bediente?“
Ich lachte. „Nur wirklich steinreiche Leute. Das ist einfach zu teuer, und das meiste erleichtern unsere technischen Geräte ja doch, Sie werden es noch erleben. Möchten Sie ein Bad nehmen? Ich nehme nicht an, dass Sie frische Kleidung mitgebracht haben, aber im Schrank liegen noch einige Sachen von Sebastian. Er hätte wohl nichts dagegen, wenn Sie sie ausleihen. Die Größe müsste stimmen, denke ich.“
„Ich soll Kleidung Ihres Freundes tragen? Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass er damit einverstanden wäre.“
„Na, was schlagen Sie dann vor? Frische Wäsche brauchen Sie auf jeden Fall, und sonntags können wir nichts kaufen. Hier!“ Ich reichte ihm Boxershorts, ein etwas schäbiges Sweatshirt und ein paar Socken, obendrauf ein Paar Jeans. „Für morgen! Ein Nachthemd oder einen Schlafanzug besitze ich leider nicht für Sie, Sebastian trägt so etwas nicht.“
Er warf mir einen schrägen Blick zu und verzichtete offenbar nur mit Mühe auf die Frage, was Sebastian denn dann im Bett trüge. Für mich fand ich gerade noch ein altes Sleepshirt, denn ich war eigentlich auch nicht an Nachthemden gewöhnt, wollte den armen Christoph aber nicht noch mehr schockieren, er hatte heute wirklich schon genug durchgemacht. „Kann ich auch morgen früh ein Bad nehmen?“
„Natürlich. Eine Reservezahnbürste habe ich auch für Sie, und sogar Rasierzeug.“
Er sah mich verzagt an. „Zahnbürste? Und ich habe mich noch nie selbst rasiert.“
Was für ein Baby! „Macht das Ihr Diener?“
Das musste er zugeben. „Auch während des Studiums?“
Er nickte.
„Ganz schön unselbständig, was?“
„So ändert sich eben der Zeitgeist“, wich er aus. Ich schleppte ihn ins Bad und zeigte ihm, wie man eine Zahnbürste benutzte, dann zerrte ich das Sofa auseinander und richtete ein einigermaßen erträgliches Nachtlager darauf her. Sobald er sich - „im Hemd“ - ausgestreckt und sich mit dem mittlerweile angewärmten Schlafsack zugedeckt hatte, schlüpfte ich ins Bad, wusch mich und zog das alberne Sleepshirt an. Als ich meine Tagesdecke von dem ungemachten Bett zerrte, schlief Christoph offensichtlich schon. Er hatte es sicher nötig! Ich auch, dachte ich noch kurz und schlief dann ebenfalls ein.