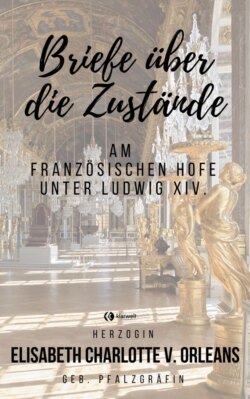Читать книгу Briefe über die Zustände am französischen Hofe unter Ludwig XIV. - Elisabeth Charlotte v. Orleans - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort
Оглавлениеie wird man den Charakter einer Zeit leichter und richtiger erkennen können als aus Briefen und unmittelbaren Mitteilungen urteilsfähiger Menschen. Keine wissenschaftliche Untersuchung, keine langatmige Schilderung vermag so lebendige Bilder aus vergangenen Jahrhunderten so schnell und anschaulich zu entrollen wie ein Scherz, ein lachend Wort, der kurze Bericht selbsterlebter, oft auch beweinter Ereignisse. Dem Vorzuge ihrer lebhaften Sprache, in der die als deutsche Pfalzgräfin geborene und erzogene Herzogin Elisabeth Charlotte von Orleans über die Sitten und ihre Beobachtungen und Erlebnisse am Hofe des Sonnenkönigs plaudert, verdanken es ihre Briefe ganz besonders, daß sie immer wieder von den Geschichtsschreibern, wie Ranke, Schütz, Menzel u. a. m. um Rat befragt wurden und auch heute noch als unversiegbare Quelle historischer Wahrheit in Anspruch genommen werden. Wohl melden sich hier und da Zweifler, die manches Urteil von Antipathie beeinflußt wähnen oder es auf leichtfertige Zuträgereien und Hofklatsch zurückführen möchten, besonders wo es sich um Frau von Maintenon handelt. An der subjektiven Wahrheit der Briefe aber zweifelt niemand, und ihre Reichhaltigkeit und frische, natürliche Sprache ließ schon oft den Wunsch erstehen, sie im Auszuge auch dem großen Publikum in allgemeinverständlicher Form zugänglich zu machen. Diesem Gedanken entsprang die Anregung zu dem vorliegenden Auszuge der Briefe, deren chronologische Anordnung nur durch die Einschaltung wichtiger Dokumente späterer mitteilsamerer Jahre aus den bisher nur einmal gedruckten Briefen an die Prinzessin von Wales, Gemahlin des nachmaligen Königs Georg II. von England, unterbrochen wurde. Bei möglichster Wahrung der ursprünglichen Orthographie wurden, jedoch meist in Klammer [ ], einige Modernisierungen und Übersetzungen eingestreuter französischer Worte vorgenommen; das Verständnis erleichternde Zusätze erschienen ebenfalls häufig geboten.
Bei der Auswahl der Briefstellen, die inhaltlich bis zum Beginn der Witwenschaft der Briefschreiberin (1701) reichen, war die Absicht maßgebend, nicht so eigentlich ein Lebensbild Elisabeth Charlottes als gleichsam in Tagebuchblättern der an der Quelle politischer und kulturhistorisch wichtiger Zeitströmungen lebenden klugen und hochgebildeten Frau einen Beitrag zur Sittengeschichte des französischen Hofes zu geben, dessen tiefe, häßliche Schatten und schaudervolle Nachtseiten sich in dem tugendklaren, fleckenlosen, treuen, wahrhaften und reinen Charakter der deutschen Fürstin deutlich abspiegeln. Ein zu inniger Teilnahme zwingendes Lebensbild der Herzogin entwickelt sich daneben ganz von selbst.
Um die in den Briefen berührten Beziehungen leichter verständlich zu machen und die Person der Briefschreiberin wie die Persönlichkeit der Adressaten überhaupt dem Leser näher zu bringen, scheint eine kurze Einführung wohl angebracht.
* *
*
„Habt Acht, Lisette, daß Ihr es nicht wie gewöhnlich macht und Euch so verlauft, daß man Euch nicht finden kann! — Liselott! Ihr müßt nicht so wild sein!“ Wie oft mögen wohl diese und gleichartige Ermahnungen dem übermütigen, am 27. Mai 1652 geborenen Töchterchen Elisabeth Charlotte des Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz zu teil geworden sein. Eine „wilde Hummel“ war die kleine schmächtige, nicht gar schöne Prinzessin, wenn sie im Heidelberger Schloß herumtollte, so recht wie ein wilder Junge. „Ich bin mein Lebtag lieber mit Degen und Flinten umgegangen als mit Puppen; wäre gar zu gern ein Junge gewesen“ und „In meiner Jugend bin ich sehr lustig gewesen. Davon ist mir der Name: Rauschenplattenknecht überkommen“ schreibt sie noch in ihrem Alter und denkt mit Wehmut an ihre schöne, goldige Jugend.
Von größerer Wichtigkeit für ihre Erziehung und Charakterbildung als die Spiele in Heidelberg wurde für Liselotte der Aufenthalt am Hofe ihrer Tante Sophie, der Fürstin von Hannover, wo sie bis zu ihrem 9. Lebensjahre blieb, und der Einfluß des strengen, aber liebevollen Fräuleins von Uffeln, der späteren Frau von Harling. Herbeigeführt wurde diese Übersiedelung durch die nicht glücklichen Verhältnisse, die am Heidelberger Hofe herrschten, seit der Kurfürst dort neben seiner Gemahlin Charlotte, einer gebotenen Prinzessin von Hessen-Kassel, sich die Baronesse Marie Luise von Degenfeld zur linken Hand hatte •antrauen lassen. Die Raugräfinnen Luise und Amalie Elisabeth und der Raugraf Karl Ludwig, an die viele von den nachfolgenden Briefen gerichtet waren, sind die Halbgeschwister Liselottes aus dieser zweiten Ehe ihres Vaters, der im ganzen 13 Kinder entsprangen.
Was für eine wichtige Rolle Frau von Harling und ihre Tante Sophie in dem Leben Liselottes spielten, wird aus den Briefen selbst deutlich hervorgehen. Ihr Herzblut gäbe sie gern für ihre Tante, und von ihrer „herzlieben Jungfer Uffeln“ schreibt sie wiederholt: „Was ich Gutes und Rühmliches besitze, das verdanke ich ihr und meiner guten Tante.“
Ein goldiges Gemüt hatte die junge Pfalzgräfin und einen lauteren, festen Charakter, dessen Stärke sich auch bis zu ihrem Tode darin zeigte, daß sie allzeit, unter allen Umständen und in allen Lebenslagen wahrheitsliebend und natürlich war, alle Heuchelei und Künstelei vom Grunde ihrer Seele haßte; und dieser Haß der Lüge erstreckte sich auch, soweit sie am Hofe Ludwigs XIV. über sich selbst verfügen konnte, auf die vielleicht in jener Zeit noch mehr als sonst mächtigen kleinen weiblichen Eitelkeiten in der Kleidung, der Frisur und dem Schmuck. Nie wollte sie etwas anderes scheinen, als was sie war.
Tiefe Wahrhaftigkeit ließ die kaum 18jährige Liselotte auch an zwei Freier, den Herzog von Kurland, um dessen Liebe zu der Prinzessin Maria von Württemberg sie wußte, und den Markgrafen von Durlach, vor der offiziellen Werbung, aber in wünschenswertester Deutlichkeit Körbe austeilen. Ein unglückseliges Geschick zwang sie kurz darauf, im Jahre 1671, ohne Liebe, die sie unter diesen Umständen überhaupt wohl nie in ihrem Leben gefühlt hat, den Bruder Ludwigs XIV., den Herzog Philipp von Orléans, zu heiraten — in höherem politischem Interesse. Ohne Murren und ohne den Versuch eines Widerspruchs gehorchte sie mutig ihrem geliebten Vater, der durch diese Verbindung mit dem mächtigen Herrscher Frankreichs die Zukunft seines Landes sichern wollte. Ludwig XIV. aber wollte sich gerade mit dieser Heirat die rechtliche Grundlage zu dehnbaren Ansprüchen auf deutsche Länder schaffen.
„Hätte mich mein Herr Vater so sehr geliebt, als ich Ihro Gnaden, hätten sie mich nicht in ein so gefährliches Land geschickt, wie dieses, und wohin ich wider Willen aus purem Gehorsam gegangen bin.“ Aus purem Gehorsam, ohne Liebe, ja ohne Sympathie zu empfinden für den ihrem schlichten, deutschen Wesen so ganz und gar nicht ähnlichen Gatten, ohne auch bei ihm Freundschaft zu erwecken, lebte sie nur wenige Jahre mit ihm in ehelicher Gemeinschaft, trotz allen Beleidigungen und trüben Erlebnissen stets bemüht, durch Freundlichkeit ein erträgliches Zusammenleben zu ermöglichen. Drei Kinder gebar sie ihrem Gatten in diesen ersten Jahren der etwa 30 Jahre währenden Ehe. Was sie aber in dieser an Bitternissen und Gelegenheiten zur Selbstüberwindung und Verzweiflung reichen Zeit gelitten hat, selbst ihren vertrautesten Freundinnen, denen sie sonst in langen Briefen ihr Herz auszuschütten pflegte, teilte sie es erst später mit und verhehlte es in opferfreudigem Zartgefühl mit Fleiß, solange ihr Vater lebte, um ihm den Schmerz und die Reue darüber zu sparen, daß er die Tochter seinen Plänen geopfert habe.
Mit der Aussicht, jemals glücklich werden zu können — an dem ausschweifenden Hofe von Versailles war ein glückliches Leben für die keusche, edle, wahrhaft vornehm denkende deutsche Fürstin an der Seite eines Sodomiten und Spielers von vornherein ausgeschlossen — hatte Liselotte bei dem Betreten französischen Bodens auch ihr Vaterland, das sie nie wiedersehen sollte, und, durch den Übertritt zur katholischen Kirche, ihre Religion verloren; freilich nur äußerlich. In ihrem Herzen blieb sie ihrem calvinistischen Glauben ebenso treu, wie sie bis zu ihrem letzten Atemzuge deutsch gedacht, deutsch gefühlt und, wenn immer möglich, (in jedem Sinne) gut deutsch geredet hat. „Ich habe nie französische Manieren gehabt, noch annehmen können, denn ich habe es jederzeit für eine Ehre gehalten, eine Deutsche zu sein und die deutschen Manieren zu behalten, welche hier selten gefallen“, bekennt sie einmal. Ihre Ehrlichkeit und derbe, deutsche Aufrichtigkeit, ihr Standesbewußtsein, das sie zu jeder Zeit und jedermann gegenüber ihre Gedanken aussprechen ließ, machten sie beim auch bald zum enfant terrible des Hofes, bis sie die schlimmen Erfahrungen, namentlich mit den schamlosen Günstlingen ihres rückgratlosen Gatten und der von ihr ehrlich gehaßten Madame de Maintenon, der allmächtigen Beherrscherin Frankreichs, des Hofes und des Königs, veranlaßten, soweit es die Hofetikette irgend gestattete, das Leben einer Einsiedlerin zu führen.
Daß sie an diesem aller Ehrbarkeit baren Hofe allein stand, gereicht der deutschen Fürstentochter zu höchster Ehre. Sie wußte im übrigen, daß sie die Sympathien der Hofgesellschaft nicht hatte. „Ich tue mein Bestes, wie einer, der allein geigt,“ schreibt sie einmal. Nur dem König selbst war sie zugetan, und Ludwig XIV schätzte die kluge und humorvolle Liselotte sehr hoch, wenn er es auch nicht gleichmäßig und immer zu erkennen gab oder zeigen durfte. Auf seinem Sterbebette bat er sie noch um Verzeihung für alles, was er ihr angetan hatte.
Langeweile aber kannte Elisabeth Charlotte trotz des Mangels an willkommenem Verkehr nie; dazu war sie zu geistvoll. Sie hätte mit Recht sagen können — insbesondere in dem damaligen Paris —, daß sie sich, wenn sie allein sei, in der denkbar besten Gesellschaft befinde. Sie lernte in der ihrem Herzen immer fremden Umgebung die Einsamkeit liebgewinnen, und ihre Sammlungen von Münzen und Kupferstichen, ihre Bibliothek und ihre Hunde gaben ihr immer angenehme Beschäftigung.
Den größten Teil der Zeit, welche die Herzogin für sich hatte, verbrachte sie aber mit Gedanken an ihre Lieben in der Ferne, ihre Tante in Hannover und Frau von Harling, ihre Halbgeschwister (in späteren Jahren die Prinzessin von Wales und vorübergehend Leibniz) und andere, denen sie, da es mündlich nicht geschehen konnte, fast täglich in langen Briefen alles vertraute, was ihr begegnete, was sie dachte und erlebte, glaubte und fühlte, hoffte und fürchtete. Daß die Pfälzerin Liselotte in diesen Briefen oft auch derbe Ausdrücke gebraucht, jedes Ding bei seinem rechten Namen nennt, entspricht ihrer Natürlichkeit. In der oft beliebten Erzählung pikanter Geschichten aus dem Leben der leichtlebigen, üppigen, sinnlichen Hofgesellschaft überschreitet sie wohl kaum die flüchtige Grenze, die intime Freundinnen, denen nichts Menschliches fremd ist, in ungestörten Plauderstunden zu beobachten pflegen, zumal in der damaligen derben Zeit. Die morsche Sittenlosigkeit der Hofgesellschaft ließ sich überdies nicht verleugnen. Für Dritte oder gar für die Öffentlichkeit waren diese Briefe auch gar nicht bestimmt. Ihren Vertrauten aber teilte sie alles mit, ohne lange zu überlegen, unmittelbar und ungefärbt. Dadurch gerade wirken ihre Briefe und „menschlichen Dokumente“ so ergreifend und so ursprünglich.
Oft schrieb Liselotte sechs bis zehn lange Briefe hintereinander, bis ihre müde Hand den schnellen, lebhaften Gedanken nicht mehr zu folgen vermochte. Jeder Brief, den sie empfing, wurde pünktlich an bestimmten Tagen erwidert und lag neben ihr, wenn sie ihn beantwortete. Die Antwort war aber nie der eigentliche Zweck des Schreibens. „Schreibt man denn nur an seine guten Freunde und Verwandten, um etwas Artiges und Lustiges daher zu machen? Ich meine, es sei vielmehr, um zu erweisen, daß man fleißig an sie denkt, und daß, weil man nicht mündlich mit ihnen reden kann, so erweist man doch den Willen, sein Vertrauen zu vollführen, indem man aufs Papier setzt, was der Mund nicht sagen kann. Also, ist man lustig, müssen die Briefe lustig sein, ist man traurig, desgleichen, damit unsere Freunde teilnehmen können an allem, was uns betrifft. Wenn Ihr wissen solltet, wie alles hier ist, sollte es Euch gar kein Wunder nehmen, daß ich nicht mehr lustig bin. Eine andere an meinem Platz, so nicht aus dem Grund lustig gewesen wäre, würde vielleicht vor Kummer längst gestorben sein.“
In der Tat gibt jeder einzelne von den zahllosen Briefen der Herzogin einen tiefen Einblick in ihr Leben, und immer spärlicher fließt mit den Jahren der Humor, mit dem sie andere und sich selbst oft zum besten hält. Am schmerzlichsten berührte die gemütvolle, ehrbare deutsche Frau die Sittenlosigkeit ihres Gatten und ihrer Umgebung, die deutsch empfindende Mutter die Ohnmacht, auf die Erziehung ihrer Kinder und ihre Verheiratung irgendwie einwirken zu können, und die rechtlich denkende, edle, an ihrer Heimat hängende deutsche Fürstin die Wahrnehmung, ihren Namen schnöde mißbraucht zu sehen zur Verwüstung ihres geliebten Vaterlandes. „. . So ist das erschreckliche und erbärmliche Elend in der armen Pfalz angegangen; und was mich am meisten daran schmerzt, ist, daß man sich meines Namens bedient, um die armen Leute ins äußerste Unglück zu stürzen. . . Sollte man mir aber das Leben drüber nehmen wollen, so kann ich doch nicht lassen, zu bedauern und zu beweinen, daß ich sozusagen meines Vaterlands Untergang bin und überdies alle des Kurfürsten, meines Herrn Vaters sel. Sorge und Mühe auf einmal so über einen Haufen geworfen zu sehen . . Alle Nacht, sobald ich ein wenig einschlafe, deucht mir, ich sei zu Heidelberg oder zu Mannheim und sehe alle die Verwüstung. Und dann fahr’ ich im Schlaf auf und kann . . nicht wieder einschlafen. Dann kommt mir in Sinn, wie alles zu meiner Zeit war, in welchem Stand es nun ist, ja in welchem Stand ich selber bin. Und dann kann ich mich des Flennens nicht enthalten.“
Es erscheint ausgeschlossen, daß Elisabeth Charlotte trotz ihrer Widerstandskraft und Energie allen Schmerz und Kummer, alles Unglück und alle Veranlassungen zur Verzweiflung hätte ertragen können, wenn sie nicht eine gute Christin gewesen wäre und als solche ihr Unglück aus der Hand Gottes zu empfangen geglaubt hätte. Sie glaubte nach der Lehre der Calvinisten, die ihr empfängliches Jugendherz in der Heimat unaustilgbar in sich aufgenommen hatte, fest an die Prädestination und trotz mancher Zweifel an die Liebe und Gnade, Allmacht und Güte ihres himmlischen Vaters. Darum empört sie auch die Aufhebung des Ediktes von Nantes, und grenzenloses Mitleid empfindet sie mit den Gesinnungstreuen, Glaubensfesten, die darunter zu leiden hatten.
Nach dem Tode ihres Gatten und Ludwigs XIV. trat an die Stelle der persönlichen und gesellschaftlichen Unannehmlichkeiten oder zu diesen hinzu noch die Sorge um Ihren Sohn Philipp, den Regenten, dem auch aus politischen Verwickelungen viele Gefahren drohten. Niemals aber mischte sie sich auch nur vorübergehend in Staatsangelegenheiten. „Warum ich mich in nichts mischen will? Ich bin alt, habe mehr Ruhe vonnöten, als geplagt zu sein. Ich mag nichts anfangen, was ich nicht wohl zu Ende bringen könnte. Regieren habe ich nie gelernt; ich verstehe mich weder auf Politik noch auf Staatssachen und bin viel zu alt, ’was so Schweres zu lernen. . . Dieses Königreich ist zu seinem Schaden durch alte und junge Weiber regiert worden. Es ist einmal Zeit, daß man die Mannsleute gewähren läßt . . . Ich begehre nichts als Friede und Ruhe . . ., muß nur sehen, so zu leben, daß ich ruhig sterben kann, und es ist schwer, in großen Weltgeschäften ein ruhiges Gewissen zu behalten.“
Friede und Ruhe begehrte Liselotte, und bis zu dem Tage, an dem sie in die Ewigkeit abberufen wurde, brachte jeder Tag ihres ereignisreichen Lebens neue Aufregungen. Die letzten schaffte sie sich selbst dadurch, daß sie sich zur Krönung Ludwigs XV. nach Reims begab, trotzdem die Ärzte der von Tag zu Tag schwächer werdenden Fürstin abredeten. Sie schrieb damals im festen Vertrauen auf Gottes Allmacht: „Den Weg zum Himmel kann man zu Villers-Coterets, zu Reims oder auch gar auf dem Wege finden; also mag ich nur in Gottes Namen meine Reise treten . .“ Zwei Tage nach ihrer Rückkehr aus Reims verschied Elisabeth Charlotte — zu St. Cloud am 8. Dezember 1722. Am 10. Dezember wurde sie in der Königsgruft zu St. Denis beigesetzt, und der Geistliche sprach die wahren Worte: „Hier ist ein Fürstenleben, von dem man ohne Furcht den Schleier wegziehen darf.“
Sie selbst hat es getan, denn ihre Briefe1 sind nichts als ihres edlen Frauenherzens Überwallen!
Stuttgart, September 1902.
Rudolf Friedemann.
_______
L i t e r a t u r.
Briefe der Herzogin Elisabeth Charlotte von Orleans. Herausgegeben
von Eduard B o d e m a n n (Hannover), — H o l l a n d (Lit.
Verein Stuttgart), — Wolfgang M e n z e l.
Anekdoten vom Französischen Hofe aus Briefen der Madame d’Orléans
Charlotte Elisabeth. Zusammengestellt vom Geh.-Rat v. Praun.
Straßburg 1795.
N a n k e, Französische Geschichte.
Schütz, Leben und Charakter der Elisabeth Charlotte . . . Leipzig 1820.
B o d e m a n n und Ö l s n e r in dem Raumer’schen historischen Taschenbuch.
Wörterbücher von Grimm, Frisch, Wander und Schneller.
1 Um ein leichtes Lesen dieser Briefe zu ermöglichen, wurden die oft wiederkehrenden Briefanfänge und -schlüsse mit ihren Höflichkeitsformeln meist fortgelassen. Auch erschien aus dem gleichen Grunde eine Modernisierung der in den ersten Briefen beibehaltenen Orthographie geboten. Nur sehr selten wurden Ausdrücke und das Verständnis besonders erschwerende Formen in gutes Deutsch übersetzt, doch ist durchweg sorgfältig darauf geachtet worden, daß die Briefe dadurch ihren eigentümlichen Charakter keineswegs verloren.