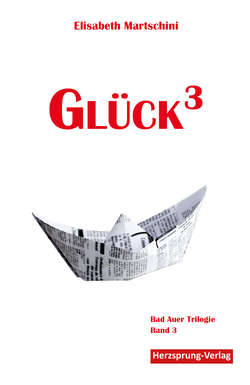Читать книгу Glück3 - Elisabeth Martschini - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kirschen, Kuchen und Kolleginnen
ОглавлениеDas Gymnasium in Bad Au schien nicht zur Ruhe kommen zu wollen. Zu Beginn der großen Ferien, die jetzt freilich schon ein gutes oder eher schlechtes halbes Jahr zurücklagen, der von manchen lang ersehnte, wiewohl doch sehr unerwartete Weggang des seit Jahren pensionsreifen Direktor Dippelbauer. Dann der mindestens genauso unerwartete, hingegen von niemandem, nicht einmal dem unmusikalischsten Schüler ersehnte Unfalltod des Musiklehrers Eckart Glück, dicht gefolgt von den Aufregungen um die neue Direktorin Bettina Glaunigg-Althoff. Und, vorläufiger Schlusspunkt, deren nur scheinbar unmotiviertes spurloses Verschwinden kurz vor Ende des Wintersemesters. Das war ganz schön viel für den Lehrkörper, der doch irgendwie das Wesen einer Schule ausmachte, in der die Schüler wechselten, selbst wenn einzelne Exemplare sich alle Mühe gaben, bis zu zehn Jahre am selben Gymnasium zu verbringen. Ob das für die Atmosphäre einer Schule sprach, sei dahingestellt.
Nach all den Aufregungen hatte kurz vor den Semesterferien auf beinahe allgemeinen Wunsch der Kollegen Alfred Kuntz interimsmäßig die Leitung des Bad Auer Gymnasiums übernommen. Weil solch eine Schule auch oder gerade in Krisenzeiten einer starken Hand bedurfte, damit sich das Wissen nicht am Ende unkontrolliert unter den Schülern ver- beziehungsweise auf ihnen ausbreitete und sie unter sich begrub.
Alfred Kuntz also, Anglist und Geograf, der durch die Übertragung dieser ehrenvollen Aufgabe seine Power zurück und neuen Aufwind bekommen hatte. Das tat ihm sichtlich gut. Nach einem langen Wintersemester, während dessen seine Haare ihre karottenrote Farbe und der ganze Mann seine Kraft verloren zu haben schienen, strotzte Herr Kuntz jetzt wieder vor Energie. Herr Direktor Kuntz, wie seine zum Teil langjährigen Kollegen ihn scherzhaft anredeten, wenn sie sich nicht gar zu einem Herr Direktor Fred verstiegen. Der auf diese Weise Angesprochene wehrte sich ebenso scherzhaft gegen die übertriebene Ehre, was nichts daran änderte, dass die Schmeicheleien runtergingen wie Öl. Da lief das Werkchen, genannt Psyche, einfach besser als mit dem Sand, den die alte neue Direktorin so gern in sein Getriebe gestreut hatte.
„Fred“, sagte da ganz unverblümt Kuntz’ junge Kollegin beziehungsweise Untergebene Maria Liliencron und riss den interimsmäßigen Direktor damit aus seinen Gedanken. „Fred“, sagte sie noch einmal, da der Angesprochene nicht sofort reagierte, „hast du einen Moment für dich?“
Diese Frage war ein bisschen seltsam. Nicht in erster Linie deshalb, weil die Formulierung normalerweise eher eine Einleitung zu einer Bitte denn eine Frage darstellte, sondern seltsam vielmehr deswegen, weil Maria Liliencron sie tatsächlich so gestellt hatte – einen Moment für dich.
Diese Merkwürdigkeit schien Alfred Kuntz jedoch überhört zu haben. Als Direktor einer Mittel- und Oberschule hatte man so viel um die Ohren, dass man unmöglich allem und allen Gehör schenken konnte, zumal man mit Geschenken in dieser Position ohnehin sparsam umgehen sollte. Damit das Personal, also besonders der Lehrkörper, nicht unverschämt wurde.
Deshalb wunderte Alfred Kuntz sich nicht über die Worte der Kollegin, sondern beantwortete deren seiner Meinung nach rhetorische Frage mit einer Gegenfrage. „Was kann ich für dich tun, Maria?“
Das war nett gemeint vom interimsmäßigen Herrn Direktor, aber nett gemeint ist bekanntlich das Gegenteil von nett und nett ist sowieso ... Aber lassen wir das, zumal sich das Sprichwort genau genommen ohnehin auf das Adjektiv gut bezieht. Das erste jedenfalls.
Maria Liliencron sah oder vielmehr hörte aus dieser Frage heraus, dass der liebe Herr Direktor ihr nur ungenügend zugehört hatte, weshalb es einer Korrektur und Konkretisierung bedurfte.
„Für dich, lieber Fred“, sagte sie darum, „nicht für mich.“
Da zogen sich nun doch ein paar Falten oder besser Runzeln durch das ansonsten verjüngte Gesicht unter der leuchtend roten Haarpracht. Obwohl Haarpracht vielleicht doch ein wenig übertrieben war, da der interimsmäßige Herr Direktor den Haarschnitt der Bedeutung seines Amtes angepasst hatte und die von Natur aus eher wirren Wirbel und Kringel akkurat gestutzt und streng frisiert trug. Was nichts an ihrer Farbe änderte. Und noch weniger an den Runzeln, in die Kuntz’ Stirn sich bei den Worten der Kollegin gelegt hatte.
„Warum für mich?“, wollte er wissen. „Ich bin nicht Direktor geworden, damit ich Zeit für mich habe. Dafür fehlt sie mir sowieso. Die Schule geht vor. Außerdem“, fügte er hinzu, „schaue ich eh auf mich.“
Auf ihn schaute auch Maria Liliencron, allerdings ein bisschen skeptisch. Was in gewisser Weise wieder einen Gleichstand herbeiführte, weil somit jeder der beiden Kollegen den anderen mit Skepsis beäugte. Quasi unentschieden.
Entscheidend war aber, dass Maria Liliencron sich nicht mit der Antwort des lieben Herrn Direktor Fred zufriedengab und sogar noch eine dritte Person ins Spiel brachte. „Bist du sicher, Fred, dass du genug auf dich schaust? Auf dich und vor allem auch auf die Claudia?“
Claudia war Alfred Kuntz’ Lebensgefährtin, die in den vergangenen Monaten allerdings kaum noch lebendig, weil schwer depressiv gewesen war. Alfred Kuntz hatte das, wahrscheinlich, zu ändern versucht und war gescheitert, hatte sogar gedroht, selbst aus einer depressiven Verstimmung heraus in eine Depression abzurutschen. Daraufhin hatte Maria Liliencron versucht, die Situation beider gefährdeter Lebenspartner zu ändern und war ... nun, genau das wollte sie wissen.
„Claudia geht es gut“, gab Alfred Kuntz sofort bereitwillig Auskunft. „Die war gleich nach Neujahr bei dieser ... dieser ... Psychotan...“
„Frieda Hirschhauser“, half Maria Liliencron ihm weiter.
„Richtig, danke. Also bei dieser Hirschhauser. Und die hat sie zu einem anderen Psych...“
„Zu einem Psychiater, meinst du?“, unterbrach ihn die Kollegin.
„Ja, richtig. Dort ist sie hingegangen und hat endlich Tabletten bekommen und jetzt läuft’s wieder“, sagte Alfred Kuntz hörbar erleichtert, wobei er offen ließ, ob das apostrophierte s als sie oder es zu denken war. Damit wollte er das Gespräch ... nun, vielleicht nicht abwürgen, aber doch in eine andere Richtung lenken, denn er sagte ein paar floskelhafte Worte zu Maria Liliencron, die ein näheres Interesse an ihrem Befinden vermitteln sollten.
Die junge Kollegin hatte jedoch noch nicht genug erfahren, nicht genug von dem, was sie tatsächlich und aufrichtig interessierte. Ihr lag noch eine Frage auf der Zunge, die allerdings dort liegen bleiben musste, weil in diesem Moment eine andere Kollegin das Büro betrat und darum bat, mit dem Herrn Direktor sprechen zu dürfen.
„Maria, sei so lieb ...“, wandte Alfred Kuntz sich an sie.
„Bin schon weg“, sagte Maria Liliencron und verließ den Raum, bevor sie bei ihrer Liebe noch zu etwas anderem aufgefordert wurde. „Manche Dinge ändern sich nie“, dachte sie, als sie die Tür des Büros hinter sich schloss. Wie der Umstand, dass man mit der Schulleitung kein vernünftiges Wort wechseln konnte. Wobei sie mit dieser Glaunigg-Althoff, Freds Vorgängerin, zugegeben wenig zu tun gehabt hatte, weil sie den größten Teil von deren Amtszeit im Krankenstand verbracht hatte.
Auf dem Gang begegnete sie Ernst Braunsfelder, der zielstrebig auf den Kaffeeautomaten zusteuerte.
„Grüß dich, Ernstl“, rief Maria Liliencron und winkte, obwohl der Kollege keine fünf Schritte mehr von ihr entfernt war. Aber aus irgendeinem Grund freute sie sich heute besonders, ihn zu sehen.
„Servus, Maria“, erwiderte dieser den Gruß, setzte seinen Weg zum Kaffeeautomaten aber fort.
Die Kollegin schloss sich ihm an. Bis zum Beginn der nächsten Stunde hatten sie noch ein paar Minuten Zeit.
„Was treibt dich denn ins Büro unseres Herrn Direktor Fred?“, fragte Ernst Braunsfelder, während er die verschiedenen Knöpfe des Kaffeeautomaten drückte.
„Ich wollte etwas –“, sie überlegte, ob sie Privates sagen sollte, entschied sich dann aber anders, „etwas Wichtiges mit ihm besprechen.“ Immerhin war Freds und Claudias seelisches Gleichgewicht nicht weniger wichtig, als es privat war.
„So“, meinte Ernst Braunsfelder und drückte immer unkoordinierter auf den Knöpfen über den Aufschriften Zucker, Kaffee mild, Kaffee stark, Milch, Ohne herum. Entweder litt er an akuter Entscheidungsschwäche oder der Automat verweigerte die Kooperation.
„Ja“, fuhr Maria Liliencron, von den Kaffeeproblemen des Kollegen vorerst unbeeindruckt, fort, „es war oder vielmehr: Es ist wichtig. Aber der liebe Fred hat keinen Kopf mehr für solche Lappalien.“
„Ja, ja“, entgegnete Ernst Braunsfelder und schien nicht ganz bei der Sache zu sein, jedenfalls nicht bei der liliencronschen, „Macht korrumpiert.“
Damit mochte er recht haben, aber Maria Liliencron brachte diese Aussage doch nicht ganz mit ihrem gescheiterten Gespräch mit Alfred Kuntz in Zusammenhang. Eher noch mit dem Kaffeeautomaten, der eine große Macht auf Ernst Braunsfelder auszuüben schien. Zumindest eine große Anziehungskraft, die aber jeden Augenblick in ebenso große Abneigung umzuschlagen drohte.
„Was hast denn, Ernstl?“, erkundigte sich Maria Liliencron deshalb besorgt.
„Der Automat will nicht, wie ich will“, schnaubte der Kollege. Nachdem er fünfzig Cent in die Maschine gesteckt und abermals wie wild auf deren Knöpfen herumgedrückt hatte, sagte er: „Jetzt bin ich neugierig, ob der Kaffee mit oder ohne Milch kommt.“
Gespannt starrten beide Lehrer auf die kleine Ausbuchtung des Automaten, aus der jeden Moment das gewünschte oder eben ein anderes Heißgetränk fließen musste.
„Vor allem kommt er ohne Becher“, sagte Maria Liliencron, indem sie auf den im Abtropfsieb versickernden hellbraunen Kaffeestrahl blickte.
„Manche Dinge ändern sich nie“, sagte nun auch Ernst Braunsfelder. Er schüttelte den Kopf und lachte plötzlich. „Ist eh besser fürs Herz“, verkündete er und machte sich auf den Weg in die 4b, die er jetzt in ihrer Muttersprache oder in der Muttersprache von zumindest drei Vierteln der Klasse unterrichten sollte.
Maria Liliencron sah ihm besorgt nach. Eigentlich hätte der Kollege froh sein müssen, sich überhaupt noch mit dem Kaffeeautomaten des Bad Auer Gymnasiums herumschlagen zu dürfen. Sein Posten war Ende des Wintersemesters nämlich auf der Kippe gestanden. Genau genommen war die Versetzung des Herrn Braunsfelder schon festgestanden. Zwangsversetzung, weil er der neuen Direktorin zu nahe getreten sein sollte. Was er nicht hätte tun sollen, nach eigenen Aussagen auch nicht getan hatte, aber da stand eben Aussage gegen Aussage, Mann gegen Frau, bis Frau die Handtasche warf, den Hut nahm und verschwand. Warum, weshalb, wieso wusste niemand. Na ja, fast niemand. Ernst Braunsfelder und Maria Liliencron wussten es auf jeden Fall definitiv nicht. Letztere hatte lediglich eine Vermutung. Nein, nicht in Bezug auf den Verschwindegrund der vorübergehenden, eigentlich vorüberlaufenden oder, um ganz genau zu sein, vorübergelaufenen Direktorin, sondern in Bezug auf ihren Kollegen Braunsfelder.
„Dem täte ein Besuch bei Frieda vielleicht auch nicht schlecht“, dachte Maria Liliencron nämlich, als sie sich ins Lehrerzimmer begab, um dort ihre Freistunde umzubringen, das heißt: herumzubringen, wenn sie sie schon nicht zu einem Gespräch mit Alfred Kuntz nützen konnte.
Nach insgesamt fünf Stunden Unterricht, unterbrochen von besagter Freistunde, war Maria Liliencrons Arbeitstag zu Ende. Wenigstens der offizielle Teil, sprich: der geistig wie auch körperlich anstrengende Deutsch- beziehungsweise Geografieunterricht in fünf verschiedenen Klassen. Jetzt ging es nach Hause, wo die Korrektur mehr oder weniger erbaulicher Schüleraufsätze und die Vorbereitung kommender Unterrichtsstunden auf dem Programm standen. Denn die Behauptung, dass der Lehrberuf ein geruhsamer wäre, traf nur auf altersfaule oder grundsätzlich unengagierte Lehrer zu.
Maria Liliencron gehört entschieden nicht zu diesen. Sie war auch nach einigen Jahren am Bad Auer Gymnasium selbstredend, nein, redlich darum bemüht, etwaigen Verhaltenskreativitäten ihrer Schüler mit ihrerseits kreativen Unterrichtsstunden entgegenzuwirken und die Aufmerksamkeit der Jugendlichen gerade dadurch zu erhalten, dass sie selbst von ihnen lernte. Ja, richtig: Maria Liliencron lernte von ihren Schülern, was so viele Vorteile hatte, dass sie gar nicht alle hätte aufzählen können. Die beiden wichtigsten waren vielleicht, dass Frau Liliencron sogar mit Anfang dreißig noch up to date war und dass ihre Schüler darum wetteiferten, ihr Wissen preisgeben zu dürfen. Dieser Umstand machte mündliche Prüfungen zwar beinahe obsolet, ließ schriftliche Texte allerdings mitunter in die Länge schießen. Und erhöhte damit die Korrektur- und Heimarbeit, zumal das Schülerwissen eher inhaltlicher Natur war und sich nur in ganz wenigen Fällen auf die Bereiche Orthografie und Grammatik erstreckte. Hier ließen die Jugendlichen ihrer Kreativität sogar für Maria Liliencrons Geschmack zu freien Lauf.
Deren Unterrichtstag war also zu Ende. Und weil die Anwesenheitspflicht für Lehrer über den eigentlichen Unterricht hinaus am Gymnasium in Bad Au mangels geeigneter wie auch ungeeigneter Räumlichkeiten zur sicheren Aufbewahrung von Lehrpersonen außerhalb der Klassenzimmer nicht umgesetzt werden konnte, packte Maria Liliencron einen Stapel Hefte in eine Leinentasche und verließ das Konferenzzimmer. Das heißt, sie wollte das Konferenzzimmer verlassen, stolperte dabei aber im wahrsten Sinn des Wortes über ihre Kollegin Waltraud Kranzlbauer, genauer: über deren Hinterteil, das unter dem Tisch hervorragte. Die Kollegin selbst kniete auf dem Boden und war eifrig darum bemüht, einen Haufen auseinandergerutschter Blätter zu einem Stapel zusammenzuschieben, was aufgrund der Sessel- und Tischbeine, die sich ihr beziehungsweise dem Papier in den Weg stellten, ein ziemlich schwieriges Unterfangen war.
„Huch“, machte Maria Liliencron, als ihr Bein das Gesäß der Kollegin streifte, und ruderte mit den Armen. Als sie wieder sicher stand, beugte sie sich hinunter, beäugte die Kollegin, die halb unter dem Tisch hockte, und lachte dann über das ganze Gesicht. Nicht etwa, weil Waltraud Kranzlbauer solch einen lustigen Anblick bot, obwohl das auf den ersten Blick durchaus auch der Fall war. Auf den zweiten Blick war hingegen deutlich zu erkennen, dass Frau Kranzlbauer sich nicht freiwillig ins Untergeschoss verkrochen hatte, sondern eifrig darum bemüht war, die dort verstreut liegenden Zettel zusammenzusammeln. Deshalb also nicht Erheiterung und noch weniger Schadenfreude aufseiten Maria Liliencrons. Die junge Lehrerin freute sich ganz einfach, die Kollegin zu sehen. Im vergangenen Herbst waren die beiden Frauen einander nämlich nähergekommen. Nicht nähergekommen in einem irgendwie anrüchigen Sinn, obwohl inzwischen selbst eine sexuelle Annäherung zwischen zwei Personen des gleichen Geschlechts nichts Anrüchiges mehr war. Zumindest nicht in den Augen halbwegs vernünftiger und aufgeklärter Menschen, von denen es in Bad Au zum Glück doch ein Paar gab.
Aber deswegen musste es nicht zwangsweise auf alle Kollegen und Kolleginnen gleichen Geschlechts zutreffen. Zwischen Maria Liliencron und Traude Kranzlbauer beschränkte sich die gegenseitige Zuneigung auf eine ganz normale, geradezu ordinäre Freundschaft. Zumindest seit besagtem Herbst. Seither war Maria Liliencron ein fröhlicher Mensch, ein richtig fröhlicher. Ob dank Frieda oder Traude sei dahingestellt. Im Grunde war es ohnehin egal, warum einer gute Laune hatte, solange es nicht auf Kosten eines anderen ging.
Auf Kosten von Traude Kranzlbauer ging Maria Liliencrons Lachen zwar nicht, dennoch schaffte es das Lachen oder auch nur Lächeln der älteren Kollegin in dieser Situation nicht bis an die Oberfläche, sondern blieb irgendwo unter dem Tisch stecken.
„Traude, um Gottes willen, was ist denn mit dir los?“, fragte Maria Liliencron angesichts Frau Kranzlbauers Miene schon wieder halb ernst, wobei sie deren Gesichtsausdruck irrtümlich mit der Bescherung auf dem Boden in Zusammenhang brachte. Ein bisschen hatten die beiden Dinge tatsächlich miteinander zu tun, aber eben nur ein bisschen, ein sehr kleines bisschen.
„Zettel zusammensuchen“, gab die Kollegin aus der Tiefe zur Antwort.
„Wart, ich helfe dir“, bot Maria Liliencron an, stellte ihre Leinentasche ab und bückte sich zu Traude Kranzlbauer auf den Boden hinunter.
Wider Erwarten schien das der Älteren gar nicht recht zu sein. „Lass nur“, wehrte sie ab, „ich mach das schon.“
Und die Jüngere hatte den Eindruck, dass sie das wirklich so meinte. „Geheimnisse?“, fragte sie scherzhaft.
„Nein, nein“, antwortete Traude Kranzlbauer, hatte aber schon einmal überzeugender geklungen.
„Zeitungen?“, fragte die Kollegin überrascht, nachdem sie ein paar von Traude Kranzlbauers Papieren in die Hand genommen und einen raschen Blick darauf geworden hatte. „Kopien von alten Zeitungen?“ Maria Liliencron wusste offensichtlich nicht, was sie davon halten sollte.
„Ach, das ist nichts“, sagte Kollegin Kranzlbauer abwehrend und nahm der anderen die einseitig bedruckten A4-Blätter aus der Hand. „Nur so eine dumme Sache.“
„Dumme Sachen sind nie gut“, stellte Maria Liliencron entschieden fest.
„Damit hast du zweifellos recht, liebe Maria, und gerade deswegen sollte man ihnen nicht zu viel Bedeutung beimessen.“ Damit richtete sich Traude Kranzlbauer auf, stopfte sämtliche Kopien in einen Trolley, wie alte und andere praktisch veranlagte Frauen ihn zum Einkaufen benutzten, und wollte sich von der Kollegin verabschieden.
Die schien jedoch vollkommen vergessen zu haben, dass sie selbst schon auf dem Heimweg gewesen war, bevor ihre schlanken Beine Traude Kranzlbauers Hinterteil touchiert hatten. „Erzähl mir von der dummen Sache“, forderte sie die Freundin/Kollegin auf.
Die, obwohl nicht mehr ganz so abwehrend, entgegnete jedoch: „Nicht heute. Ein andermal vielleicht, wenn du es dann immer noch wissen willst.“
„Ich will, versprochen“, antwortete Maria Liliencron.
Traude Kranzlbauer nickte stumm.
„Also, was ist das für eine dumme Sache, wegen der du gestern buchstäblich am Boden zerstört warst?“, fragte Maria Liliencorn am nächsten Tag in der großen Pause und ließ sich, eine Wurstsemmel mit Essiggurkerl in der Hand, neben Traude Kranzlbauer am langen Lehrertisch nieder.
„Nicht jetzt, Maria, und nicht hier“, wich die Kollegin aus. Aber es klang nicht nach Ausrede oder Ausflucht. Im Gegensatz zu gestern erweckte Frau Kranzlbauer heute durchaus den Eindruck, als wollte sie der Jüngeren wahrhaftig ihr Herz ausschütten. Nur eben nicht jetzt und vor allem nicht hier im Konferenzzimmer, wo in einem fort Lehrer ein- und ausgingen und neugierige Ohren nach Möglichkeit gerade das zu erhaschen versuchten, was ihre Träger ganz bestimmt nichts anging.
„Wie wär’s nach der Arbeit im Café Sisi?“ Maria Liliencron gab nicht auf.
„Nein, heute kann ich nicht, muss noch ins Stadtarchiv. Aber wenn du drauf bestehst, können wir morgen auf einen Kaffee gehen.“
„Ich bestehe darauf“, lächelte Maria Liliencron und biss von ihrer Wurstsemmel ab. „Morgen aber wirklich“, sagte sie kauend. Da huschte sogar über Frau Kranzlbauers Gesicht ein Lächeln.
Maria Liliencron und Traude Kranzlbauer gingen auch am nächsten Tag nicht ins Café Sisi. Das lag jedoch nicht daran, dass die Ältere wieder einen Rückzieher gemacht hätte und zur Jüngeren auf Distanz gegangen wäre, eher im Gegenteil. Nach dem letzten Herbst, in dem aus den beiden Kolleginnen so etwas wie Freundinnen geworden waren, wäre es Frau Kranzlbauer ein wenig merkwürdig und quasi anachronistisch vorgekommen, mit Maria ins Kaffeehaus zu gehen. Gewissermaßen wie ein Rückschritt, nachdem man doch schon so weit gegangen war, miteinander den intimsten Raum der Traude Kranzlbauer, die Küche, zu teilen.
„Warum eigentlich ins Café Sisi?“, fragte diese deshalb die Jüngere.
„Magst lieber ins Café Post oder ins Central gehen?“, wunderte sich die Kollegin beziehungsweise Freundin.
„Nein, um Himmels willen, nur nicht“, wehrte Traude Kranzlbauer erschrocken ab. „Kaffee kann man dort vielleicht noch trinken, aber die Mehlspeisen sind wirklich nicht gut. Dass die sich so was überhaupt anzubieten trauen.“ Frau Kranzlbauer schüttelte sich und die Blümchen auf ihrer Bluse gerieten in heftige Bewegung. „Nein“, fuhr sie fort, „was ich vorschlagen wollte war, dass wir zu mir gehen.“ Und sie fügte hinzu: „Das war im Herbst doch auch immer so gemütlich.“
Maria Liliencron war erleichtert, geradezu erfreut. „Aber ja, freilich, gern! Ich habe mich nur nicht einladen wollen, wo ich mich doch schon aufgedrängt habe.“
„Du und aufdrängen“, lachte Traude Kranzlbauer. „So anständig und zurückhaltend ist in dem Alter kaum jemand.“
Maria Liliencron schluckte. Ja, anständig und zurückhaltend. Aber wo führte eine wie sie das hin? In den Himmel vielleicht, aber der war von Marias ja schon geradezu überbevölkert.
Die junge, anständige, zurückhaltende Maria Liliencron kam zum Glück aber nicht dazu, sich weiter den Kopf über diese Angelegenheit zu zerbrechen, weil Freundin Traude ihr von einem Kirschstreuselkuchen vorschwärmte, den sie am Vortag gebacken hatte. Aus tiefgekühlten Früchten, versteht sich, denn wo hätte man Ende März frische Kirschen bekommen sollen. Natürlich – oder eher unnatürlicherweise – im Supermarkt, importiert von weiß Gott woher, garantiert geschmacksneutral und ein ebenso sicherer Beitrag zur Klimaerwärmung, gegen die Frau Kranzlbauer, die den Sommer liebte, zwar nicht unbedingt etwas einzuwenden gehabt hätte, die sie aber nicht durch den langfristig die heimischen Obstbauern schädigenden Kauf exotischer Globetrotterkirschen fördern wollte.
Kurz: Die Kirschen auf dem von ihr liebevoll nach bestem Wissen und Gewissen, vor allem aber nach einem alten Rezept gebackenen Streuselkuchen hatten ihren Weg aus dem kranzlbauerschen Garten über den Gefrierschrank bis unter die Streuseldecke gefunden. Dort ruhten sie jetzt und warteten darauf, in Maria Liliencrons Mund und Magen letzte Erfüllung zu sein. Weil danach ja nicht mehr gut von Kirschen gesprochen werden konnte, höchstens von Kirschkernen, falls man versehentlich einen solchen verschluckt hatte. Bei Traude Kranzlbauer konnte das schon mal passieren, weil die die Kirschen für ihre Kuchen nicht entkernte.
„Da gatschen sie so und das mag ich nicht“, hatte sie einmal entschuldigend erklärt, als Kollege Braunsfelder sich bei einer Lehrerkonferenz, die Frau Kranzlbauer zwar nicht abzukürzen, aber immerhin zu versüßen pflegte, beinahe einen Zahn ausgebissen hatte.
Die Kombination und Alliteration von Kuchen, Kirschen, Kernen und Kaffee versüßte auch jetzt das Gespräch der beiden Kolleginnen/Freundinnen, die den Spätnachmittag in Traude Kranzlbauers gemütlicher Küche verbrachten. Frau Kranzlbauer kam nicht sofort auf die dumme Sache zu sprechen und Maria Liliencron ließ ihr Zeit. Je länger sie ihr Geständnis hinauszögerte, umso länger kam Maria in den Genuss, die seelische Entspannung, die sie in Traudes Küche immer erfuhr, mit einer zunehmenden Anspannung beziehungsweise Ausdehnung des Magens zu kompensieren. Gerade heute war ihr das sehr recht. Maria Liliencron verspürte großen Appetit, auch wenn ihr, das musste sie insgeheim zugeben, ein Schokoladenkuchen noch lieber gewesen wäre. Mit viel Glasur obendrauf. In Kuchengenüssen und -fantasien schwelgend, vergaß Maria Liliencron ganz auf die Zeit. Ein Leiden oder eigentlich ein Segen, das beziehungsweise den sie in den vergangenen Wochen – oder waren es Monate? – regelmäßig an sich festgestellt hatte.
Auch Traude Kranzlbauer ließ sich, ihr und ihnen beiden Zeit. Sie, die die Dinge sonst immer beim Namen nannte, wusste nun nicht, wie sie beginnen sollte. Sie warf einen Seitenblick auf die junge Kollegin, die schon das zweite Stück Kuchen verspeiste. Der Altersunterschied machte es Frau Kranzlbauer nicht unbedingt leichter, den Einstieg zu finden. Obwohl Maria Liliencron mit ihren einunddreißig, zweiunddreißig Jahren eigentlich keine Rivalin war, überlegte sie. Vor allem aber zählte sie als Deutsch- und Geografielehrerin nicht zur unmittelbaren Konkurrenz. Denn hier, das muss ganz klar gesagt werden, ging es nicht um einen Mann. Und wenn doch, dann nur um den Herrn Landesschulrat, dessen Geschlecht nur zufällig beziehungsweise qualifikationsbedingt männlich war und hinter dem Amt zurückstand. Es war daher weder sexuell begründete Eifersucht noch Penisneid, was Waltraud Kranzlbauer an-, um- und in letzter Konsequenz unter Tische trieb, sondern höchstens Titelneid. Und dieser bezog sich nicht auf den Herrn Landesschulrat, sondern auf jüngere, besser qualifizierte Kollegen, gleich welchen Geschlechts.
Bevor Maria Liliencron sich ein drittes Stück Kirschkuchen auf den Teller laden konnte, fasste sich Traude Kranzlbauer ein Herz. „Die dumme Sache, die ich gestern angedeutet habe, liebe Maria, ist die, dass mir ein Titel fehlt“, begann sie endlich das Gespräch oder jedenfalls dessen ernsten Teil, der über oberflächliches, gleichwohl freundschaftliches Geplänkel hinausging.
Maria Liliencron verschluckte um ein Haar einen Kern. Sie hustete und Freundin Traude musste ihr auf den Rücken klopfen, damit sie den Fremdkörper wieder aus der falschen Kehle bekam.
„Bitte was?“, keuchte Maria Liliencron und rang noch ein bisschen nach Luft. „Wie kann das denn sein? Du hast doch studiert.“
„Natürlich habe ich studiert ...“, erwiderte Traude Kranzlbauer.
„Und du hast dein Studium abgeschlossen?“
„Ja, sicher, nur ...“
„Sag mir jetzt nicht, dass sie dich beim Plagiat erwischt haben“, rief Maria Liliencron ungläubig aus.
„Spinnst?!“, fragte Kollegin Kranzlbauer verärgert. „Das mit anständig und zurückhaltend nehme ich zurück.“
„Entschuldige bitte“, murmelte Freundin Maria plötzlich ganz kleinlaut. „Ich hätte wissen müssen, dass du nicht abgeschrieben hast. Es ist nur, man hört das in letzter Zeit so oft ... bei wichtigen Politikern und so ...“
„Schau ich aus wie ein Spitzenpolitiker?“, fragte Traude Kranzlbauer unwirsch und deutete auf ihre Blümchenbluse über dem ausladenden Busen.
Die jüngere Frau schüttelte erschrocken den Kopf. „Aber was ist dann passiert?“, wollte sie wissen.
„Ich habe meinen Abschluss in Französisch und Ernährungswissenschaft gemacht, die damals noch Ernährungskunde geheißen hat“, sagte sie zögernd.
„Aber du unterrichtest doch hauptsächlich Geschichte“, fiel die andere ihr verwundert ins Wort. „Und nur ein paar Stunden Französisch.“
„Eben“, meinte Traude Kranzlbauer in einem Tonfall, als wäre damit alles gesagt.
Die Freundin/Kollegin begriff jedoch gar nichts, hatte Kuchen, Kirschen und Co komplett vergessen und starrte die Ältere verständnislos an. Diese musste sich näher erklären, musste vor allem erläutern, dass sie damals, vor mehr als dreißig Jahren, die falsche Studienwahl getroffen hatte. Nur hatte sie nach drei Semestern nicht mehr wechseln können, weil es für sie dann keine finanzielle Unterstützung mehr gegeben hätte.
„Und Geschichte?“, fragte Maria Liliencron verwirrt.
„Da habe ich eigentlich nur hineinschnuppern wollen ... Ich habe dann zwar eine gute Nase davon genommen, aber für noch ein Studium hätten Zeit und Geld nicht gereicht“, antwortete Traude Kranzlbauer.
„Und deine Abschlussarbeit?“
„Habe ich in Französisch geschrieben. Über Kochbücher“, fügte Frau Kranzlbauer hinzu.
„Naheliegend“, meinte Kollegin Liliencron. „Aber wieso hast du dann nicht Ernährungskunde unterrichtet – an einer anderen Schule?“
„Weil ich schon während des Studiums gemerkt habe, dass mir das auf den Magen schlägt. Oder aufs Gemüt, wie du willst. Dass ich dabei jedenfalls die Lust am Backen verliere“, gestand Traude Kranzlbauer. „Da musste ich Prioritäten setzen.“
„Versteht sich“, pflichtete Maria Liliencron ihr bei und langte nun doch nach einem dritten Stück Kirschstreuselkuchen. „Aber wie konntest du dann bei uns am Gymnasium Geschichte unterrichten?“, fragte sie interessiert.
„Hat sich so ergeben“, meinte Frau Kranzlbauer, „einer ist unter dem Semester verunglückt und auf die Schnelle haben sie keinen Ersatz gefunden. Und ich war froh über die Mehrstunden. Du weißt ja, wie das ist.“
Maria Liliencron wiegte den Kopf hin und her.
„Dabei ist es geblieben“, fuhr Traude Kranzlbauer fort. „Niemand hat nachgefragt und irgendwann war’s dann fast schon Gewohnheitsrecht. Das Französische ist immer weniger geworden, aber die Geschichte wird immer mehr, je länger es die Menschheit gibt.“ Sie lachte, doch es klang gezwungen. „Nur kommen jetzt die ganzen Junglehrer, frisch von der Uni, supermotiviert und mit allen notwendigen und noch ein paar mehr Titeln. Da hat mir die Glaunigg-Althoff die Hölle heißgemacht.“
„Aber die ist doch jetzt eh weg“, warf Maria Liliencron ein.
„Schon“, meinte Traude Kranzlbauer, „aber den Landesschulrat hat sie trotzdem noch auf meinen Fall hingewiesen. Und wenn der Stein einmal ins Rollen gekommen ist, kannst ihn nicht mehr aufhalten.“
„Und was machst du jetzt?“, fragte Maria Liliencron besorgt.
„Geschichte studieren“, seufzte Traude Kranzlbauer.
„Was, in deinem Alter?“, platzte die Jüngere heraus.
„Danke, liebe Maria, das wäre nicht unbedingt notwendig gewesen. Du hast heute offenbar deinen charmanten Tag.“ Frau Kranzlbauer lächelte nachsichtig und fuhr dann wieder ernst fort: „Ja, in meinem Alter. Dabei bin ich gar nicht die Älteste. Du glaubst nicht, wie viele Alte Geschichte studieren. Nur sind die meisten Pensionisten, die jetzt endlich die Zeit dafür haben, sich mit dem zu beschäftigen, was sie interessiert. Ich brauche es, damit ich meinen Beruf weiter ausüben darf. Aber“, lenkte sie ein, „ich kann mir fast alles anrechnen lassen. Nur so eine Masterarbeit muss ich noch schreiben.“
Maria Liliencron ging ein Licht auf. „Deshalb die alten Zeitungen“, rief sie aus.
„Ja“, gab Traude Kranzlbauer zu, „das heißt ... eigentlich ist da noch etwas anderes.“
Maria Liliencron hielt in der Bewegung inne, die Kuchengabel stoppte auf ihrem Weg zum Mund und der Blick war erwartungsvoll auf Freundin Traude gerichtet, die wieder einmal nach dem richtigen Anfang der Fortsetzung suchte, den Absprung aber noch nicht schaffte und irgendwo an der Klippe hängen geblieben zu sein schien.
„Also“, sagte sie nach diesem Moment gespannter Erwartung aufseiten ihrer Zuhörerin und begann erst einmal mit dem Einfachen, den Fakten. „Für meine Masterarbeit habe ich mir etwas Naheliegendes gesucht, nämlich örtlich nahe, weil ich nach dem Unterricht nicht auch noch weiß Gott wohin fahren will, um irgendein verstaubtes Archiv zu durchforsten. Deshalb bin ich auf das Stadtarchiv von Bad Au gekommen. Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, ist das auch ganz schön verstaubt.“
Sie verzog das Gesicht, was Maria Liliencron darauf schließen ließ, dass sie verstaubt nicht nur im übertragenen Sinne meinte.
„Jedenfalls bin ich dort auf eine einzelne Ausgabe der Pförringer Wochenpost gestoßen. Die hat jemand mit einem handschriftlichen Vermerk zwischen die Ausgaben unserer Lokalzeitung gesteckt.“ Traude Kranzlbauer griff nach ihrer Kaffeetasse, die bisher unberührt neben ihrem Kuchenteller gestanden war. Beide waren leer.
„Entschuldige bitte, wie unhöflich von mir“, sagte Maria Liliencron betreten, legte ihre mit einem Stückchen Kirschkuchen gespickte Gabel zurück auf ihren Teller und beeilte sich, Freundin Traude ein besonders großes Stück von deren eigenem Kuchen zu kredenzen.
„Lass nur, ich bin ja die Gastgeberin“, wandte diese ein. „Und eine ziemlich schlechte, wie ich sehe, wenn sich der Gast selbst bedienen muss.“
„Selbst bedient hat“, präzisierte Maria Liliencron, als sie das Kuchenstück auf Traude Kranzlbauers Teller absetzte. „Ich habe heute offensichtlich wirklich nicht meinen anständigen und zurückhaltenden Tag.“ Sie lächelte die Freundin/Kollegin entschuldigend an.
„Ich bitte dich“, gab die zurück, während sie sich Kaffee einschenkte. „Ich freue mich doch, wenn es dir schmeckt.“
Damit war diese Sache erledigt und das Gespräch konnte zum eigentlichen Thema zurückkehren. Um zu demonstrieren, dass sie selbst ohne Anstand und Zurückhaltung keine schlechte Zuhörerin war, fragte Maria Liliencron: „Was stand denn drin in der Pförringer Wochenpost?“
„Viel stand drin, war ja eine Wochenzeitung und im Laufe einer Woche kann man als Journalist schon eine Menge zusammentragen, worüber sich die Leser in der Folge das Maul zerreißen.“
„So schlimm?“, fragte Maria Liliencron zweifelnd.
„Kennst du die Neue Pförringer Wochenpost?“, fragte Traude Kranzlbauer zurück.
„Ja“, gab die andere zu, „ich habe sie hin und wieder durchgeblättert, wenn ich in Pförring beim Gynäkologen war. Ist aber schon eine Weile her“, fügte sie hinzu.
„Hat sich in den letzten Jahren nicht wesentlich gebessert“, meinte Traude Kranzlbauer und war zugleich hellhörig geworden. „Wieso in Pförring?“, wollte sie neugierig wissen. „Ist das nicht ein bisserl weit? Wir haben in Bad Au doch auch einen Frauenarzt. Sogar zwei, wenn ich mich nicht irre.“
„Drei“, berichtigte Maria Liliencron, „sogar damals schon, obwohl seither Müllner junior den Senior abgelöst hat.“
„Und der Senior war dir ... unsympathisch?“, mutmaßte Traude Kranzlbauer.
„Nicht direkt“, meinte die Freundin/Kollegin, „aber vor zwölf oder dreizehn Jahren wäre es mir unangenehm gewesen, wenn mich die Leute dort jeden Monat hätten hingehen sehen. Auch wenn der Bauch spätestens ab dem sechsten Monat eh nicht mehr zu übersehen war.“
„Die ersten drei Monate erbrechen und die letzten drei kugeln oder so ähnlich“, sagte Traude Kranzlbauer, die derlei Probleme zu ihrem Bedauern nie am eigenen Leib erfahren hatte. Zumindest das Erbrechen nicht. Oder jedenfalls nicht das Erbrechen aufgrund einer Schwangerschaft.
„Nicht wirklich“, widersprach die Jüngere. „Schlecht ist mir eigentlich erst später geworden, als ich schon geglaubt habe, dass mir wenigstens das erspart bleibt. So im fünften, sechsten Monat. Angefangen hat’s ziemlich harmlos. Ich war nur unheimlich verfressen.“ Sie kicherte in Erinnerung an diese lang vergangene Zeit.
„Ach so, verstehe“, nickte Traude Kranzlbauer. Der Versuch, sich vertraut zu geben, war gescheitert. Sie überlegte kurz. „Richtig“, erinnerte sie sich wieder an den Punkt, an dem sie stehen geblieben war beziehungsweise sich von Freundin Maria vom rechten Weg hatte abbringen lassen. „Die Pförringer Wochenpost war um keinen Deut besser als die jetzige Neue Pförringer Wochenpost. Vielleicht sogar noch schlimmer, woran du siehst, dass früher nicht alles besser war. Auch die Menschen nicht. In jener Ausgabe der Zeitung war nämlich – und ich glaube, darum ging es demjenigen, der sie zu den Bad Auer Zeitungen gesteckt hat, weil ein Vermerk auf der Seite stand und dort alles andere ziemlich uninteressant war, also zumindest für mein Empfinden, was natürlich ...“
„Herrje, Traude, was stand dort?“
„Na ja, da war so eine Geschichte über eine Frau. Der Titel lautete: Schwarze Witwe oder Rachegöttin? Sie, also die Frau, hat anscheinend auf mysteriöse Weise ihren zweiten Ehemann verloren.“
„Wieso mysteriös?“
„Weil er sich mit der eigenen Dienstwaffe – er war Polizist – erschossen haben soll.“
„Absichtlich?“, wollte Maria Liliencron wissen.
„Genau darum geht’s in dem Artikel. Angeblich war’s ein Unfall, was die Polizei aber nur gesagt haben soll, weil einer aus den eigenen Reihen nicht Selbstmord begehen darf.“
„Und andere dürfen?“
„Wie? Nein, niemand darf Selbstmord begehen, obwohl es kein Gesetz dagegen gibt. Noch nicht, wer weiß, wo das alles noch hinführt mit der totalen Überwachung.“ Traude Kranzlbauer schüttelte missbilligend den Kopf.
„Es gab also Anzeichen dafür, dass der zweite Ehemann der guten Frau Selbstmord begangen hat. Wobei mir auf- und einfällt: Was ist mit dem ersten passiert?“
„Selbstmord“, antwortete Traude Kranzlbauer.
„Hat ihm das jemand erlaubt?“, konnte Maria Liliencron sich nicht verkneifen zu fragen.
„Maria, ich bitte dich, mach dich über solche Sachen nicht lustig. Zwei Selbstmorde bei zwei Ehemännern ist nichts, was man einer Frau wünscht“, erklärte Traude Kranzlbauer und ließ offen, ob nur die Suizide oder auch die Ehemänner den Grund ihres Mitleids darstellten.
„Das kommt auf die Ehemänner an“, sinnierte Maria Liliencron, die sich offenbar eine ähnliche Frage stellte. Sie dachte an Diana Martin, die am Bad Auer Gymnasium gemeinsam mit zwei Kolleginnen für die Sauberkeit des Schulgebäudes zuständig war. Was noch nichts mit einem oder gar zwei Ehemännern zu tun, aber über Umwege dazu geführt hatte, dass sie Maria Liliencron in einer schwachen Stunde und bei starkem Kaffee gewisse Andeutungen bezüglich ihrer alles andere als glücklichen Ehe gemacht hatte.
„So etwas Ähnliches haben die in der Zeitung auch geschrieben“, fuhr Traude Kranzlbauer trotz der Unkenntnis von Dianas Lebensgeschichte fort. „Dass die gute Frau vielleicht gar nicht so unglücklich darüber war, weil zumindest der zweite Ehemann einen Hang zur Gewalt gehabt haben soll. Nicht nur von Berufs wegen.“
„Anscheinend, angeblich, haben soll – das ist mir irgendwie alles zu vage“, wandte Maria Liliencron ein. „Wieso interessiert dich das überhaupt?“
„Weil es doch einen Grund geben muss, warum jemand diese Ausgabe einer ortsfremden Wochenzeitung im Stadtarchiv von Bad Au aufbewahrt wissen will.“
„Zufall, Spleen, Schlamperei“, tat Maria Liliencron die Sache, die sie für die eigentlich dumme zu halten schien, ab. „Außerdem ist Pförring Bezirkshauptstadt, was dort passiert, interessiert die kleineren Gemeinden immer, weil sich in ihnen halt nichts Nennenswertes tut.“ Dann nahm ihre Stimme einen scherzhaften Tonfall an. „Was mich aber wirklich interessieren würde: Ob ich womöglich noch ein Stückchen von deinem köstlichen Kirschkuchen bekommen könnte?“ Sie lachte und die vorübergehende Spannung zwischen den beiden Frauen löste sich in Wohlgeschmack auf.
„Selbstverständlich“, beeilte sich Traude Kranzlbauer zu sagen und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: „Schön, dass du so einen gesunden Appetit entwickelt hast. Musst nur ein bisserl auf deine Figur schauen.“
Maria Liliencron wich das Blut aus dem Gesicht. Sie schlug sich die Hand vor den Mund und hustete.
„Meine Güte, Maria, hast du schon wieder einen Kern verschluckt? Du weißt doch, dass ich die gatscherten entkernten Kirschen nicht leiden kann.“ Traude Kranzlbauer war aufgesprungen und hinter Maria Liliencron getreten, der sie jetzt kräftig auf den Rücken schlug.
Das Husten verstummte. Die Jüngere wischte sich eine Träne aus dem Gesicht und schniefte.
„Da, ein Taschentuch.“ Frau Kranzlbauer reichte der Freundin ein Täschchen aus geblümtem Stoff. Maria Liliencron zog dankbar ein Papiertaschentuch heraus und putzte sich geräuschvoll die Nase. „Vielleicht sollte ich die Kirschen das nächste Mal doch ...“, überlegte Traude Kranzlbauer.
„Nein, nein“, beeilte sich Maria Liliencron zu sagen, „es war allein meine Schuld. Aber das kommt wieder in Ordnung.“ Sie schnäuzte sich noch einmal, schob den leeren Kuchenteller von sich und bat: „Lass uns nur bitte von etwas anderem sprechen. Eine schwarze Witwe ist nicht unbedingt das beste Thema für einen angenehmen Nachmittagsplausch unter Freundinnen.“
Und so unterhielten sich die beiden Frauen während der folgenden eineinhalb Stunden über angenehmere Dinge, die da wären: die Last des Unterrichts, die Verhaltenskreativität gewisser Schüler, die um nichts hinter der gewisser Lehrer zurückstand, und die Freude darüber, wenigstens vorübergehend einen so sympathischen Mann aus dem Kollegenkreis als Direktor zu haben.