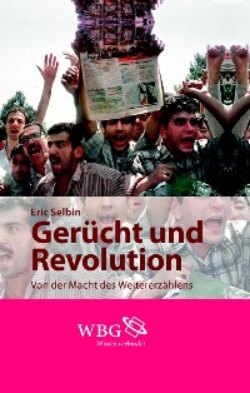Читать книгу Gerücht und Revolution - Eric Selbin - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEins
Prolegomenon, Apologie und Ouvertüre
Eine zweifellos apokryphe Geschichte, die häufig der Illustration des Endes einer Ära und des Beginns einer neuen dient, lautet, dass König Louis XVI, nachdem ihm sein Berater, der Duc de la Rochefoucauld, vom Fall der Bastille berichtet hatte, fragte: „C’est une révolte?“, woraufhin der klarsichtige und scharfsinnige Herzog antwortete: „Non, Sire, c’est une révolution“ (CUMBER-LEDGE, 1953: 407). Dies ist eine der berühmtesten Vorahnungen des mit diesen reichlich gesegneten Herzogs. Man sollte jedoch nicht außer Acht lassen, dass über die Jahre selbst eine so respekteinflößende Faktenquelle wie das Oxford Dictionary of Quotations nicht umhin kam, diese Geschichte noch etwas zu verbessern. So fragt in der beinahe 40 Jahre später erschienenen vierten Auflage der König – vielleicht unter dem Druck der Geschichte, vielleicht sind auch seine Gefühle durch das zurückliegende zweihundertste Jubiläum der Revolution verstärkt worden: „C’est une grande révolte?“ Der Herzog, inzwischen zum „französischen Sozialreformer“ avanciert, versichert seinem Lehnsherrn, dass es sich bei diesen Ereignissen nicht um eine bloße Revolte, sondern tatsächlich um „une grande révolution“ (PARRINGTON, 1992: 411; Hervorhebung durch den Autor) handelt. Der Herzog machte diese Unterscheidung vielleicht auch in Bezug auf seinen eigenen Aphorismus „es existiert eine Revolution von so umfassendem Charakter, dass sie die Geschmäcker und die Geschicke der Welt verändert“ (LA ROCHEFOUCAULD, 1896: 143) und erklärte – höchstwahrscheinlich in feierlichem, ernsten Tonfall – den Fall der Bastille bedeutungsvoll zu „une révolution“.1 C’est vrai – und die meisten modernen Auffassungen von Revolution stehen dafür tief in seiner Schuld.
Dann gibt es noch eine etwas aktuellere Geschichte, kaum mehr als eine Vignette und zweifellos ebenfalls apokryph. Ein Student in Mexico City besuchte ein Organisationstreffen, bei dem ein Sprecher versuchte, mithilfe einer Geschichte zu erklären, wie es ist, hingebungsvoll für eine Sache zu kämpfen. Ein Reporter fragte die inzwischen verstorbene Comandante Ramona der mexikanischen Zapatistischen Armee der Nationalen Befreiung (EZLN), die gerade aus einer Verhandlung mit mexikanischen Regierungsvertretern kam, wie lang die Zapatisten noch kämpfen würden. Die kleine Frau zuckte mit den Schultern und antwortete, dass sie, da sie bereits seit 500 Jahren im Kampf begriffen seien, genauso gut auch noch weitere 500 Jahre kämpfen könnten. Ist die Geschichte wahr? Sie erinnert an STEFFENS’ Kommentar zum angeblichen Kontakt des britischen Premierministers Lloyd George mit dem italienischen Duce, Mussolini: „Authentic? I don’t know … Like so many rumors,it was truer than the records … but somebody said it, somebody who understood what it was all about“ (1931: 809). Was diese Geschichte vermittelt, ist, dass ihr Kampf, der Kampf, einem anderen Zeitplan folgt, einem Plan in einer völlig anderen Größenordnung.
BURCKHARDT berichtet davon, dass in der Renaissance im späteren Italien eine Stadt – wahrscheinlich Siena – einen besonders tapferen und talentierten militärischen Führer hatte, der sie „aus der fremdländischen Unterdrückung befreite“. Die Stadtbevölkerung war bemüht, ihrem Helden seinen Lohn zukommen zu lassen und dabei so großzügig wie möglich zu sein. Sie trafen sich täglich, um über eine Belohnung zu beraten, die diesem großen Manne würdig wäre. Nachdem sie festgestellt hatten, dass selbst ihn zum „Herrscher der Stadt“ zu machen nicht ausreichend wäre, beschlossen sie, ihn umzubringen, um ihn dann als „,Schutzheiligen anbeten‘ zu können. Und dies taten sie, womit sie dem Beispiel folgten, das der römische Senat mit Romulus vorgegeben hatte.“ Laut BURCKHARDT ist hierbei besonders bemerkenswert, dass es „eine alte Geschichte ist – eine von denen, die wahr sind und auch unwahr, die überall und nirgendwo stattfinden“ (BURCKHARDT, 1958: 40).2 Das bedeutet, dass es Zeiten gibt, zu denen größere und tiefere Einsichten zugänglich sind, unabhängig davon, ob die Geschichte absolut treu wiedergibt, „was wirklich passiert ist“, oder nicht.
Diese kurzen Geschichten sind sehr unterschiedlich, sie variieren in Umfang und Ausmaß, Ton und Tenor, Intensität und Subtilität. Alle können auf eine entscheidende Grundaussage reduziert werden, die einen weitreichenderen Inhalt umfasst und eine Botschaft vermittelt, wenn auch nicht immer die ursprünglich beabsichtigte: Was aus der Geschichte wird, wie sie gehört und verstanden wird, unterliegt nicht mehr der Kontrolle des Geschichtenerzählers. Solche Geschichten stellen einen nicht endenden Moment dar, sie zeigen, dass es Konzepte und Anliegen gibt, die die Zeit überdauern und erinnern uns daran, dass wir, selbst wenn uns am Ende nichts anderes mehr bleibt, immer unsere Geschichten und somit einander haben.
Worin besteht die Geschichte?
Dass „es war einmal“ wohlvertraute, mit Zauber behaftete Worte für Kinder jeden Alters sind, liegt daran, dass die Geschichten, die sie einleiten, im Kleinen eine Erklärung dafür sind, wer, was, warum, wann, wo und wie wir waren, sind und sein werden. Zum Teil sind solche Geschichten nicht viel mehr als eine Beschreibung von Details des täglichen Lebens, sie werden genutzt, um anderen oder auch uns selbst zu vermitteln, was die materiellen und ideologischen Voraussetzungen unseres Alltagslebens ausmacht. Doch oftmals nutzen wir sie nicht nur, um aus unserem Leben zu erzählen – Erzählung und Geschichte sind hierbei nicht identisch – sondern um uns mitzuteilen, Neuigkeiten, Informationen und vieles mehr zu verbreiten: um zu führen, zu warnen, zu inspirieren, um das real und möglich zu machen, was ansonsten unrealistisch und unmöglich wäre. Geschichten ermöglichen es uns, die Umgestaltung unserer Leben und der Welt vorstellbar zu machen. Die Umgestaltung der materiellen und ideologischen Voraussetzungen unseres Alltagslebens, ganz zu schweigen von den größeren Weltgeschicken, die zumeist unseren Horizont weit übersteigen, wird oft von Revolution, Rebellion und Widerstand begleitet. Und es ist besonders die Revolution, die wir meinen und wonach wir suchen, wenn wir von Umgestaltung sprechen. Während Definitionen und Untersuchungen zum Thema Revolution kommen und gehen, haben Jahrzehnte sozialwissenschaftlicher Forschung wenig dazu beigetragen, unser Verständnis davon zu verbessern, warum Revolutionen hier und nicht dort geschehen, jetzt und nicht dann, bei diesen Menschen und nicht anderen. Die These dieses Buches lautet, dass der entscheidende Faktor zur Erklärung, wie und warum Revolutionen entstehen, die Geschichten von Revolution, Rebellion und Widerstand sind, die wir erzählen. Es ist insbesondere durch die Nutzung der Konzepte Mythos, Erinnerung und Mimesis möglich, vier archetypische Revolutionsgeschichten zu identifizieren und zu untersuchen, welche in einer überraschenden Anzahl von Orten und Kulturen über erstaunlich lange Zeiträume hinweg immer wieder auftauchen. Dies sind nicht die einzigen Revolutionsgeschichten und natürlich geht beim Versuch, sie in diese Gruppen einzusortieren, etwas verloren. Nichtsdestoweniger kann es einiges bringen, die Aussagen dieser Geschichten darüber zu verstehen, wer wir sind und wie wir uns verhalten, was wir zu tun bereit sind und unter welchen Umständen.
Es ist also notwendig, die systematische Wiederaufnahme der Geschichte in die sozialwissenschaftliche Methodologie zu fördern, sich für den mächtigen, alles durchdringenden Stellenwert der Mythen, Erinnerungen und der Mimesis auszusprechen und die elementaren Geschichten zu identifizieren, die den bewussten Widerstands-, Rebellions- und Revolutionsbemühungen der Menschen auf einer tieferen Ebene zugrunde liegen. Von zentraler Bedeutung hierbei sind die Anerkennung des Revolutionsmythos, der Erinnerung an die Revolution sowie der Kraft der Mimesis für die Mobilisierung und Aufrechterhaltung revolutionärer Aktivitäten. Diese sind in vier elementaren Geschichten erfassbar, die ein stetiges Zeugnis der menschlichen Situation ablegen, Geschichten, die nicht „nur“ existieren, um von dieser Situation zu berichten, sondern auch gleichzeitig als Auslöser fungieren, diese zu verändern. Sowohl um unser Verständnis von Revolution zu vertiefen, als auch um den Nutzen eines solchen Konzepts zu gewährleisten, benötigen wir einen neuen Ansatz, der sich explizit auf die Gedanken und Gefühle der Menschen bezieht, die an einem Revolutionsprozess mitwirken, eine Perspektive, die versucht, die weitergegebenen (und kontinuierlich umgearbeiteten) Geschichten vergangener Mühen und Ungerechtigkeiten mit den Bemühungen für eine bessere Zukunft zu verknüpfen.
Diese vier Geschichten sind: die Geschichte von der zivilisierenden und demokratisierenden Revolution, die Geschichte von der Sozialrevolution, die Revolutionsgeschichte von Befreiung und Freiheit und die verlorenen und vergessenen Revolutionsgeschichten. Jede repräsentiert einen Versuch, auseinanderliegende Stränge zu verknüpfen, die nichtsdestoweniger genug gemeinsam haben, um als Mittel der Menschen zu fungieren, der Vergangenheit einen Sinn zu geben, die Gegenwart zu erklären und eine Zukunft denkbar und möglich zu machen. Die Verbindungen sind nicht als Idealtypen gedacht und es gibt keinen Revolutionsprozess und keine Revolutionsströmung, die sich ausschließlich einer Kategorie zuordnen lassen. Viele Revolutionsprozesse lassen sich in mehreren Geschichten wiederfinden, immer abhängig davon, wer die Geschichte erzählt, wo, wann und wem. Wie ich bereits in einer anderen Arbeit betont habe (SELBIN, 2003: 84), ist entscheidend, dass wir unter Berücksichtigung der materiellen und strukturellen Umstände, die unsere Untersuchungen zu Widerstand, Rebellion und Revolution bisher geleitet haben, einen Platz für die Geschichten (und Erzählungen) finden müssen, die Generationen von Revolutionären über alle Zeiten und Kulturen hinweg zum Handeln bewegt und befähigt haben.
Die Rückkehr der Erzählungen in die sozialwissenschaftliche Untersuchung fundamentaler menschlicher Handlungen wie Widerstand, Rebellion und Revolution scheint überfällig, die Zeit für einen „storied turn“ in dieser Disziplin könnte gekommen sein. So löblich sie im Prinzip auch ist, hat die im 20. Jahrhundert praktizierte Ablehnung von reinen Erzählungen und „verschleiernden“ Geschichten auf der Suche nach einem umfassenderen Verständnis zu einer Distanzierung vom tatsächlichen Leben der Menschen geführt. Eine Konsequenz daraus ist, dass im spät- und postindustriellen Zeitalter die Geschichte und das Geschichtenerzählen so etwas wie eine Renaissance erfahren haben, vielleicht auch angetrieben von neuen Technologien, die es mehr Menschen als je zuvor erlauben, Geschichten zu erzählen, und die gleichermaßen dem uralten menschlichen Bedürfnis nach Verbindung zueinander und zu sich selbst entgegenkommen.
Die Rückkehr der Geschichten
Wissenschaftler wie BYATT (2001: 166), MCNEILL (2000: 9) und WHITE (1984: 19–20) haben das in Frage gestellt, was man als modernistische und postmodernistische Fixierung auf Bewusstsein und Intentionalität deuten kann, und versucht, das menschliche Bedürfnis nach Geschichten hervorzuheben. Es soll hierbei nicht der Eindruck vermittelt werden, dass Menschen „nur“ Erzähltes hören möchten; bei Geschichten geht es um einiges mehr. Sie eröffnen uns Einblicke in die Ansichten und Einschätzungen der Menschen, in ihre Konzeptionen davon, wie und warum die Welt funktioniert, sowie in ihre Auffassungen von Macht und Möglichkeit.
Dies und mehr zeigt sich in Arbeiten wie POLLETTAS fesselndem It was like a Fever: Storytelling in Protest and Politics (2006), TILLYS anspruchsvollem Klagelied The Trouble with Stories (2002) oder dem aufwühlenden Why? (2007), SMITHS einsichtsreichen Stories of Peoplehood (2003) und Sammelbänden wie BERGERS und QUINNEYS Storytelling Sociology: Narrative as Social Inquiry (2005a) oder DAVIS’ Stories of Change: Narrative and Social Movements (2002a). Ungeachtet ihrer Unterschiede eint diese Werke der Gedanke, dass man Geschichten als reichhaltige Wissensquellen untersuchen sollte, selbst wenn sie deren Nutzen eher zurückhaltend betrachten und sich der Schwierigkeiten und Grenzen dieses Unterfangens bewusst sind. Sie bilden das Fundament für vieles von dem, was nun folgen wird.
Auch innerhalb der Revolutionsstudien wurde dem Thema Aufmerksamkeit zuteil, wenn auch nur in Maßen. So haben beispielsweise Historiker wie SEWELL (2005) und FURET (1981) sowie dessen Mitarbeiter, hauptsächlich OZOUF (1991) und BAKER (1990), Geschichten einen mehr oder weniger großen Platz in ihren Untersuchungen eingeräumt. Auch führende Revolutionsforscher haben den Stellenwert der Geschichte nicht völlig außer Acht gelassen: GOLDSTONES hervorragendes Revolution and Rebellion in the Early Modern World (1991) widmet ein Kapitel einigen der Faktoren, die für die Entstehung von Geschichten verantwortlich sind, und PARKERS provokanter Essay Revolutions and History: An Essay in Interpretation (1999) spricht sich überzeugend für den Stellenwert der Erzählung aus. Geschichte und Erzählung gehören ebenfalls zu dem beeindruckenden Aufgebot von Einflussfaktoren, die FORAN in seinem Maßstäbe setzenden Versuch anführt, die neuesten Entwicklungen im Bereich der Revolutionsforschung zu erfassen: Taking Power: On the Origins of Third World Revolutions (2005). Weniger explizit betonen auch neuere Arbeiten von HOLLOWAY (2007) und KHASNABISH (2007) den Einfluss mitreißender Erzählungen und Geschichten auf jeglichen Umbruchsversuch von Bedeutung.
Einige Annahmen sind für die vorliegende Arbeit von zentraler Wichtigkeit. Die Wichtigste lautet, dass Menschen Geschichtenerzähler sind und dass die Geschichten, die wir erzählen, uns als Menschen definieren (als ein Volk oder das Volk); wir erschaffen, verstehen und regeln unsere Welt durch die Geschichten, die wir erzählen. Wenn es unsere Biologie ist, die uns menschlich macht, dann sind es unsere Geschichten, die uns zu Personen machen. Dies gilt insbesondere für allgemein bekannte, simple Geschichten, die gleichzeitig „universell“ und „zeitlos“ erscheinen, selbst wenn wir sie speziell auf unsere jeweiligen Umstände beziehen können, Geschichten, die überraschend allgegenwärtig sind und die selbst, wenn wir sie hier und jetzt mit dem Blick auf die Zukunft erzählen, Erinnerungen an die Vergangenheit und unsere Vorfahren wachrufen. Die hier aufgestellte These lautet, dass was und wer wir sind, untrennbar mit den Geschichten verbunden ist, die wir erzählen. Im Endeffekt sind Geschichten alles, und alles ist, in der einen oder anderen Form, eine Geschichte.
Wir nutzen und modifizieren unsere Geschichten für alle möglichen Zwecke, unter anderem auch für einige, deren wir uns nicht einmal bewusst sind. Sie sind unser Mittel, die uns umgebende, vorhandene Welt zu erklären sowie die Welt zu beschreiben, welche wir uns erhoffen. Geschichten legen das vielleicht beständigste Zeugnis der Überzeugungen und Werte ab, die uns am wichtigsten sind; sie sind das entscheidende Puzzleteil, ohne das jede Antwort unvollständig bleiben muss.
Wissenschaftler behaupten meist, sie würden keine Hypothesen aufstellen, zu denen sie bereits die Antwort kennen – ich denke allerdings, dass eine treffendere Darstellung des wissenschaftlichen Unterfangens die alte Anwaltsweisheit berücksichtigen müsste, nach der man niemals eine Frage stellt, zu der man nicht bereits die Antwort weiß. Die hier vorgeschlagene Antwort ist eine von vielen möglichen. Denn Antworten – verschieden zufriedenstellend und von unterschiedlicher Qualität – kommen und gehen. Es sind die Fragen, die bleiben. Diese Arbeit wird von der Frage geleitet, die so viele dazu brachte, sich mit dem Thema Revolutionen auseinanderzusetzen: Warum geschehen Revolutionen hier und nicht dort, jetzt und nicht dann, bei diesen Menschen und nicht anderen? Wie ich auf den folgenden Seiten ausführlich darlegen werde, befähigt das Erzählen fesselnder Geschichten die Menschen dazu, andere zu erreichen und gemeinsam zu versuchen, die materiellen und ideologischen Umstände ihres täglichen Lebens zu verändern. Durch detaillierte Befragungen und das Zusammentragen von Bestandteilen der Alltagskultur wie mündlichen Überlieferungen, Liedern, Theaterstücken, Fernsehsendungen etc. könnte es möglich sein, eine genauere Aussage über die Möglichkeit von Widerstand, Rebellion und Revolution zu jeder Zeit und in jeder Kultur zu treffen.
Was ist zu tun? Die Rückkehr der Geschichte
In den frühen Tagen der Sozialwissenschaften gab es zwei Hauptprojekte. Eines war die Bemühung, die Sozialwissenschaften nach dem Zweiten Weltkrieg zu profilieren und sich aus der Knechtschaft „großer Männer“ und epischer Reiche sowie den damit verbundenen Fabeln und Mythen zu befreien. Das andere spiegelte den steigenden Einfluss nördlicher und westlicher liberal-bürgerlicher Konzepte wider, wobei der Hauptuntersuchungsgegenstand das atomistische Individuum war. Daraus resultierend wurde es nötig, unser Weltverständnis in klar abgegrenzte, leicht greifbare Pakete zu unterteilen, die soziale (Soziologie), politische (Politologie), wirtschaftliche (Ökonomie), psychologische (Psychologie) und sogar kulturelle (Anthropologie) Aspekte separat behandelten. Zu den ersten Opfern dieses Umbruchs zählten die Geschichten, sie wurden an den Rand abgedrängt und misstrauisch beäugt. An dieser Stelle sind zwei kurze Anmerkungen sinnvoll.
Erstens: „Historie“ ist der Ausdruck, mit dem wir gemeinhin unseren Wissensvorrat bezeichnen; früher bestand dieser aus Überlieferungen, Geschichten und Sagen. Während die uns überlieferte Historie traditionell Geschichten erzählte und Fakten mit Fiktion vermischte, wurde dies plötzlich im Zuge der Aufklärung und besonders des Rationalismus des 19. Jahrhunderts entsetzt abgelehnt. Es wurde einiger Aufwand in die Erschaffung des Konzeptes investiert, dass Historiker „Handwerker“ seien, die sich ausschließlich mit „Fakten“ befassen. Während Geschichtenerzähler erfinden konnten, was immer ihnen beliebte, waren Historiker der Wahrheit verpflichtet, eine Überzeugung, die sich später im Wissenschaftsanspruch der Disziplin niederschlug und die Gesellschaftswissenschaften bis heute dominiert (SELBIN, 2008: 132). Wir benötigen jedoch nicht nur die Erkenntnisse der modernen Forschung, sondern auch das traditionelle Handwerkszeug der Gelehrten und der Revolutionäre, Rebellen und Dissidenten: kraftvolle und zielgerichtete Geschichten.
Zweitens: Diejenigen unter uns, die im nördlich/westlichen Kulturkreis leben und/oder dort studiert haben, sind wohlvertraut mit der klaren Unterscheidung von Dingen, die wir als Fakten ansehen, und anderen, die wir als Fiktion einstufen. Geschichten werden meist in den Bereich Fiktion eingeordnet. Doch es ist in der Tat ein relativ neues Unterfangen, die Myriaden von Geschichten, die wir erzählen, in Fakten und Fiktion zu unterteilen, wobei Erstere als nützlich und wichtig angesehen werden und letztere als reine Unterhaltung oder Bagatelle abgestempelt werden – sicherlich nicht als nützlicher Leitfaden für etwas von Bedeutung. Gerade in Geschichten werden jedoch tiefere Wahrheiten und verschüttete vergangene Ereignisse enthüllt und zugänglich gemacht.
Die Dinge haben begonnen, sich zu ändern. Die seit den 1950ern zeitweise widerstrebend aufgenommene Erkenntnis, dass beispielsweise „Eingeborene“ uns vielleicht auch etwas Nützliches zu sagen haben könnten, hat einen Prozess eingeleitet, der sich in jüngster Zeit unter anderem in der Rehabilitation von Herodot (STRASSNER, 2007; ROMM, 1998; THOMPSON, 1996) niedergeschlagen hat. Herodot gilt zwar als „Vater der Geschichtsschreibung“, wurde jedoch lange Zeit als Fabeldichter angesehen und für seine „Lügen“ verurteilt. Inzwischen wächst jedoch die Erkenntnis, man könne das Kind mit dem Bade ausgeschüttet haben und es steigt die Anerkennung dessen, was er uns mitteilen wollte. Man kann also feststellen, dass die binäre Trennung von „Fakten“ und „Fiktion“, so attraktiv sie auch sein mag, von sehr geringem Nutzen bei der Beantwortung der hier gestellten Fragen ist. Das soll nicht bedeuten, dass man Fakten erfinden kann. HOBSBAWM erläutert dies sehr überzeugend folgendermaßen: „[E]ither Elvis Presley is dead or he isn’t. The question can be answered unambiguously on the basis of evidence, insofar as reliable evidence is available, which is sometimes the case. Either the present Turkish government, which denies the attempted genocide of the Armenians in 1915, is right or not“ (1993: 63). Doch selten liegen die Angelegenheiten so einfach und auch die Fragen sind es zeitweise nicht.
Für vieles, was wir – mehr oder weniger sicher – „wissen“ oder mit dem wir uns näher beschäftigen möchten, gibt es nur wenige „verlässliche Beweise“. Und selbst wenn es sie gibt, kann es trotzdem genauso lehrreich sein zu versuchen, jene Menschen zu verstehen, für die Elvis nicht tot ist, und zu verstehen, warum er für sie nicht tot ist, wie festzustellen, dass er endgültig „das Gebäude verlassen hat“. Wirklich wichtig ist nur, wie die Menschen mit den Beweisen und Informationen umgehen, gerade auch wenn sie sich dafür entscheiden, nicht das zu glauben, was ihnen als „Fakt“ präsentiert wird. Das ist kompliziert, verwirrend und real. Die verwirrende Realität ist, dass unseren besten sozialwissenschaftlichen Bemühungen, alles zu kategorisieren und analysieren, zum Trotz Menschen letztendlich unsystematisch, kompliziert und widersprüchlich sind, Entscheidungen treffen, die ihren Interessen zu widersprechen scheinen, und sich ganz generell völlig irrational verhalten. Hinzu kommt, dass nicht wirklich klar ist, ob sie sich selbst ihrer Ansichten, ihrem Verständnis von der Welt im Allgemeinen und ihrem Platz und ihren Möglichkeiten in ihr bewusst sind – umso weniger sind ihre Beweggründe für Außenstehende erkennbar.
GALEANO beklagt die „arme Geschichte“: „[Sie hat] aufgehört zu atmen: In wissenschaftlichen Texten betrogen, in Klassenräumen falsch dargestellt und in Daten ertränkt haben sie sie in Museen eingesperrt und begraben, mit Blumenkränzen unter Bronzestatuen und Marmordenkmälern“ (1985: XV).3 MARCUS ist darüber besorgt, „[dass] unser Geschichtsverständnis, wie es sich heute in unserer alltäglichen Kultur darstellt, eingeengt, verarmt und gehemmt ist; dass die weitverbreitete Annahme, Geschichte existiere nur in der Vergangenheit, eine Mystifizierung ist, die enormen Widerstand leistet gegenüber jeglichen kritischen Untersuchungen, die enthüllen könnten, dass diese Annahme eine Täuschung oder ein Gefängnis ist. Es besteht der Verdacht, dass wir Geschichte leben, sie erschaffen und zerstören – sie vergessen und verleugnen – auf weit vielfältigere Art und Weise als wir es je wirklich gelernt haben“ (1995: 3–4). Doch die Wiedergabe von Geschichte ist eine Aufgabe, die man nicht unterschätzen sollte. So klagt der vom Versuch, den Revolutionsausbruch in Russland zu dokumentieren, frustrierte STEFFENS: „Wie kann man Geschichte schreiben, an Ort und Stelle, während sie geschieht? Verschiedene Geschichten verliefen gleichzeitig, unverbunden, oft gegensätzliche Erzählungen, die sich trafen und kreuzten, und sie alle waren ,Geschichte‘. Wir hörten viele von ihnen; weit mehr noch müssen wir verpasst haben. Niemand kann, niemand wird jemals alle von ihnen hören. Geschichte ist unmöglich“ (1931: 749). Und doch hat das Enthüllen und Wiederverhüllen der Geschichte die Menschen immer fasziniert, man führe sich nur die heroischen Bemühungen der Geschichtsschreibung vor Augen.
Traditionell wurde die Historie von oben herab konstruiert, von den Siegern komponiert, von den Mächtigen orchestriert, für die Bevölkerung gespielt und vorgetragen. Doch es gibt eine andere Geschichte, die in der Wahrnehmung der Menschen wurzelt, wie die Welt um sie herum sich kontinuierlich entwickelt und welchen Platz sie in diesem Prozess einnehmen. Dies ist eine Geschichte, die aus den Ideologien und Sichtweisen der Menschen gespeist wird, und die den materiellen und ideologischen Kontext des Alltagslebens wiedergibt, eine Geschichte, die über verschiedenste politischkulturelle Mittel der Bevölkerung zum Ausdruck gebracht wird. Meine These lautet, dass sich uns Historie über die Erzählungen der Menschen von ihrem Leben und der politischen Alltagskultur in ihrer Gesellschaft erschließt und dass diese Erzählungen für die Möglichkeit – oder das Fehlen – grundlegender Veränderungen verantwortlich sind.
Eine Rückkehr zu den Geschichten und dem, was sie uns sagen können, könnte Sozialwissenschaftlern dabei helfen, grundlegende menschliche Handlungen, wie das gemeinschaftliche Verhalten, das man unter der Rubrik Revolution, Rebellion und Widerstand einordnet, besser erklären zu können. Wir müssen einen Weg finden, die Gedanken und Gefühle der Menschen, die in einen Revolutionsprozess involviert sind, zu untersuchen, eine Perspektive, die die Geschichten, die sie von vergangenen Ungerechtigkeiten und Mühen erzählen, mit ihrem Kampf für die Zukunft verbindet. Es ist unumgänglich, dass wir gemeinsam mit den übrigen materiellen oder strukturellen Voraussetzungen – den Faktoren, die normalerweise unsere Forschung leiten – die Rolle anerkennen, die Geschichten und Erzählungen über Widerstand, Rebellion und Revolution spielen. Geschichten, die Generationen von Revolutionären angeregt und ermutigt haben. In Abwandelung einer alten Phrase: Hic sunt refragatio, rebellio, et revolutio – hier sind Widerstand, Rebellion und Revolution.4
„Widerstand“, „Rebellion“ und „Revolution“: Ein beiläufiger, wenn auch essentieller Einschub
„Revolution“ ist ein handlicher Sammelbegriff für eine überraschend große Zahl von gesellschaftlichen und kulturellen Ereignissen und Prozessen. Begriffe wie „Widerstand“, „Rebellion“ und „Revolution“ sind sehr eng mit sozio-politischen Angelegenheiten und gemeinschaftlichem Verhalten verknüpft und bilden daher den Ausgangspunkt dieses Einschubs. Was genau verstehen wir unter „Revolution“ und verwandten Begriffen wie „Widerstand“ und „Rebellion“?
Eine große Zahl von Forschern hat viel Zeit und Aufwand in die Definition der Unterschiede zwischen Widerstand, Rebellion und Revolution investiert. Unterschiede, die von Bedeutung sind, auch wenn darauf hingewiesen wurde, dass Überschneidungen ein grundsätzliches Charakteristikum der meisten Formen zivilen Ungehorsams sind (siehe MCADAM et al., 2001). Es ist wichtig, von Anfang an klarzustellen, dass Widerstand und Rebellion weder nötigenfalls noch häufig revolutionär sind. Doch beide tragen weitaus öfter zu einer Revolution bei, als man gemeinhin angenommen hat, nicht zuletzt durch die Geschichten von Rebellion und Widerstand, die ein Umfeld entstehen lassen, in dem die Revolution möglich zu erscheinen beginnt. So schafft die revolutionäre Vorstellungswelt („imaginary“), um PARKERS treffenden Ausdruck in einer abgewandelten Form zu verwenden (2003: 46),5 einen Raum, in dem diese unterschiedlichen Formen zu finden sind und für unsere Zwecke genutzt werden können.
Widerstand
Der Ausdruck „Widerstand“6 wird, wie „Revolution“, gemeinhin mit Anerkennung und Sachkenntnis benutzt, jedoch mit wenig Aufmerksamkeit für die Details. Das Konzept an sich ist etwas problematisch. HOLLANDER und EINWOHNER beklagen, dass „Widerstand“ oftmals sehr unfokussiert verwendet wird, sehr häufig sei es mehr „a political stance … [than] an analytical concept.“ Nichtsdestoweniger lassen sich in all den verschiedenen Definitionen und Diskursen zwei zentrale Elemente ausmachen: „action and opposition“ (HOLLANDER und EINWOHNER, 2004: 547, 538)7. LAHIRI-DUTT (2003: 13) verweist auf vier Kriterien, die authentischen Widerstand in der „mainstream literature“ charakterisieren: „[E]r muss kollektiv und organisiert sein statt persönlich und unorganisiert; er muss prinzipientreu und selbstlos sein statt opportunistisch und selbstsüchtig; er muss revolutionäre Konsequenzen haben; und er muss die Basis der Herrschaft negieren statt sie zu akzeptieren.“ SCOTT (1985) argumentiert jedoch überzeugend, dass Widerstand in den meisten Fällen in alltäglichen materiellen Zielen begründet liegt, und nicht in einem revolutionären Bewusstsein. Er warnt davor, zu überschätzen, wozu „alltäglicher Widerstand“ fähig ist und mahnt, nicht aus den Augen zu lassen, wie komplex das Leben der meisten Menschen gestrickt ist. „Wider-stand“ klar abzugrenzen ist also keine einfache Aufgabe.
Widerstand kann sich auch auf eine Form von Auflehnung beziehen, die sich darin äußert, dass die Bevölkerung dem augenblicklichen Regime oder den Autoritätspersonen die Unterstützung verweigert oder nicht kooperiert. Selbst wenn dies eher passiv erscheint, ist es Ausdruck einer Aktivität, einer „Aktion“. Es ist also nötig, anzuerkennen, dass es etwas gibt, was KAMPWIRTH (2002: 11) eine „Widerstandstradition“ („tradition of resistance“) genannt hat, „die Samen sät, die … viele Jahre später keimen, wenn die strukturellen, ideologischen und politischen Umstände richtig sind.“8 Zwar durchaus verwandt mit doch gleichzeitig abgegrenzt von Konzepten wie „political cultures of opposition“ und „relationship between culture and agency in revolutionary politics“ liegt der Fokus nach KAMPWIRTH auf der Rolle der Familie in der Sozialisation der Kinder. Ich vertrete die These, dass Geschichten das meistverbreitete und grundlegendste Mittel in diesem Prozess sind.
Meist spielen Frauen hierbei eine entscheidende Rolle. Denken wir nur an Scheherazade, welche die Geschichten aus 1001 Nacht erzählt. Nacht für Nacht verwebt sie die Erzählstränge ineinander, während sie versucht, ihren Tod hinauszuzögern und noch etwas weiterzuleben – was ihr gelungen ist, wohl weitaus länger, als sie oder ihre Geschichtenerzähler sich je hätten träumen lassen. Oder nehmen wir die Form des Widerstands, die PARELLI (1989: 104–5) als „einen ameisenartigen Widerstand“ bezeichnet, „gemacht aus Geduld, Worten, Gesten und vor allem gekennzeichnet durch das Nichtvorhandensein von Stille. Frauen redeten, Frauen kritisierten, Frauen protestierten, wie sie es immer getan hatten, wie sie es noch immer tun … In Zeiten, in denen Stille befohlen war, sprachen sie.“ Dies ist eine geläufige Rolle für Frauen, die ihnen Raum für Widerstand zugesteht. Beide Formen sind Ausdruck einer Kraft und Tapferkeit, die zu einem großen Teil aus Jahrtausenden der Unterdrückung in patriarchalen Kulturen resultiert und sich in dem widerspiegelt, was man als „gap between tactical obedience and pragmatic evasion, obedezco pero no cumplo“ („Ich gehorche, doch ich erfülle die Aufgabe nicht“) bezeichnet hat (ROWE und SCHELLING, 1991: 23) – kombiniert mit dem Willen, sich zu äußern, die Stille zu füllen und die Geschichten zu erzählen. Diese inhärent subversiven Konzepte – Geduld, einen Weg finden, den Buchstaben des Gesetzes zu folgen, doch nicht dessen Geist, sowie der Wille, zu sprechen – bilden oftmals die Grundlage für Widerstand.
In den meisten Fällen betrachten die Handelnden ihren Widerstand als Teil langwieriger Bemühungen, ein Konzept, das sich im kollektiven Gedächtnis der meisten Gesellschaften finden lässt. Wenn solch ein kollektives Gedächtnis auch im Allgemeinen eher die großen und glanzvollen Ereignisse beinhaltet, so gibt es auch immer das, was stillschweigend mit eingeschlossen und informell ist, diese gemeinsame Erinnerung („shared memory“) spiegelt das „Verständnis einer Gemeinschaft von ihrer … Herkunft, ihren Zielen, ihrer Entwicklung und ihrem gemeinsamen Leben“ wider (K’MEYER, 1996: 219). Eine Strategie des Widerstandes zu entwickeln ist äußerst schwierig, Widerstand als solchen zu identifizieren jedoch leicht. Die größere Herausforderung besteht darin, Widerstand zu erkennen, der sich nicht offensichtlich äußert. So schwer fassbar Widerstand auch erscheint, er ist sehr mächtig.
Rebellion
Thomas JEFFERSON (1955a: 93) schrieb: „I hold it that a little rebellion, now and then, is a good thing, and as necessary in the political world as storms in the physical … It is a medicine necessary for the sound health of government. “ Vom deterministischen Beiklang abgesehen, ist JEFFERSONS Bemerkung sehr aussagekräftig. Sie trägt der Allgegenwärtigkeit von Rebellion Rechnung9, einer Form von Aufstand, die nur selten versucht, das gesamte System zu verändern, sondern eher darauf abzielt, einzelne Punkte des etablierten Regierungssystems zu treffen oder die Regierung umzuorganisieren, um bestimmte Missstände zu bekämpfen oder spezielle Gegebenheiten zu verändern.
Im Unterschied zu ähnlichen Bemühungen wie der Revolte, dem Staatsstreich oder der politischen Revolution, sind Rebellionen zumeist spontane Aufstände, die zum Ziel haben, Anführer zu stürzen, bestimmte politische Entscheidungen oder sogar politische Institutionen zu verändern, jedoch nur selten auf die direkte Beeinflussung größerer Gesellschaftsstrukturen oder Normen und Werte abzielen. Irreführenderweise wird oftmals ein klassisches Beispiel für eine Rebellion mit dem Etikett „Revolution“ versehen, selbst wenn diese auf keiner Auflistung „großer Revolutionen“ auftaucht. Es wäre treffender, die „Amerikanische Revolution“ als eine erfolgreiche Rebellion in den britischen Kolonien Nordamerikas zu beschreiben (großzügiger betrachtet vielleicht auch als eine „politische Revolution“). Es geht hier nicht darum, die Bedeutung einer der bewegtesten Phasen in der Geschichte der USA zu schmälern, doch es handelte sich um keine echte Revolution im Wortsinn. Der besagte Konflikt war eine Rebellion, denn es ging darum, die Missachtung einer Autorität, in diesem Fall der britischen Regierung, zu demonstrieren. Außerdem sollte ein bestimmter Missstand durch Änderung der Politik, jedoch nicht der kompletten politischen Struktur, behoben werden. Zusätzlich zeigt dieses Beispiel auch, dass Widerstand, wie ihn in diesem Fall die Siedler ihren britischen Oberherrn entgegensetzten, durchaus ein Vorläufer oder Handlanger der Rebellion sein kann.
Rebellionen an sich können offensichtlich Wegbereiter, quasi-revolutionäre Momente sein, die zu Revolutionen führen können;10 D. E. H. RUSSELL definierte die Rebellion als „a form of violent power struggle in which overthrow of the regime is threatened by means that include violence“ (RUSSELL, 1974: 6). WALTON (1984) zeigt, dass Rebellionen auf den Philippinen (1946–53), in Kenia (1952–56) und Kolumbien (1946–58) zu signifikanten, wenn auch begrenzten wirtschaftlichen und politischen Reformen geführt haben und argumentiert, dass das Wort „Revolution“ seinen Nutzen verloren habe und durch „Revolte“ ersetzt werden sollte. Ich schließe mich hingegen BELL (1976: 5) an: „[A] revolt is quite a different matter, and a much less complex one. A revolt is narrower than a revolution.“ Auf jeden Fall ist die Entscheidung zur Rebellion eine außergewöhnliche, die normalerweise unter extremen Umständen getroffen wird, von Menschen, die glauben, keine andere Wahl zu haben.
Revolution
Überall auf der Welt und über alle Zeiten hinweg haben die Menschen ihre eigenen Vorstellungen vom Begriff „Revolution“ gehabt, geprägt von den Geschichten über Revolutionen, die sie erzählten. Es gibt nur wenige Konzepte, die so sehr alle Zeiten, Orte und Kulturen durchdringen, wie „Revolution“. Menschen sind nicht nur in der Lage, eine Revolution zu erkennen, wenn sie mit einer konfrontiert werden, in ihren Köpfen besteht von vornherein ein mehr oder weniger kohärentes Verständnis darüber, was eine Revolution ist und was nicht. Eine Revolution ist nichts, was die Menschen unmittelbar mit Furcht und Unruhe verbinden, für viele ist sie auch der Kampf für Nahrung, Land, Frieden, Gerechtigkeit und den Zugang zu Ressourcen und Möglichkeiten – ein Zuhause, medizinische Versorgung und Bildung. Viele Menschen assoziieren mit Revolution ein „better must come“11; generell bezeichnet der Begriff einen einschneidenden Umbruch, erreicht durch den Zusammenschluss von Menschen, die ihre Regierung stürzen und – wenn sie erfolgreich sind – weitreichende, signifikante Veränderungen in ihrer Gesellschaft bewirken. Bekannte Referenzen sind die Revolutionen in Amerika (1776), Frankreich (1789), Mexiko (1920), Russland (1917), China (1949) und Kuba (1959).
Die Beständigkeit des Themas „Revolution“ ist wenig überraschend, wenn man die überaus beeindruckende Bandbreite von Faktoren berücksichtigt, die der Ausdruck umfasst. „Revolution“ ist nach wie vor schwer greifbar. Heutzutage bezeichnet der Ausdruck nicht nur die (in Ermangelung eines besseren Ausdrucks) „traditionellen“ Konzeptionen, bei denen das Hauptziel die Erreichung der Regierungsgewalt zur fundamentalen Umstrukturierung der Gesellschaft ist, sondern auch die facettenreicheren Fälle der letzten zwei Jahrzehnte: die Wirren der osteuropäischen „Farbrevolutionen“ 1989–91 (siehe GOLDSTONE, 2009), die anhaltende Saga der Chiapas seit 1994 (KHASNABISH, 2007), die undefinierten doch immer noch andauernden Kämpfe in Kolumbien, die verschiedenen Facetten dessen, was gemeinhin (korrekt oder nicht) als „Islamische Revolution“ bezeichnet wird, sowie die unterschiedlichen Anti-Globalisierungs-Bewegungen (HOLLOWAY, 2002). „Anti-Globalisierung“ mag übrigens ein handlicher Begriff sein, ist jedoch vielleicht eher eine Fehlbezeichnung.
Wie ich an anderer Stelle bereits dargelegt habe, geht es bei Revolutionen hauptsächlich um die Menschen: „[T]hey are created by people, led by people, fought and died for by people, consciously and intentionally constructed by people“ (SELBIN, 2008: 130). Hierbei soll nicht der tiefgreifende Einfluss sozialer, politischer und ökonomischer Strukturen außer Acht gelassen werden (SELBIN, 1997b: 133), die Rolle der Ideologien, das internationale Umfeld, Metaerzählungen wie Aufklärung oder Globalisierung, Strömungen wie die Moderne oder der Fortschrittsglaube oder auch der unerbittliche Fluss der Geschichte. Wenn die Frage jedoch lautet, warum Revolutionen hier geschehen und nicht dort, jetzt und nicht dann, bei diesen Menschen und nicht anderen, müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf ebendiese Menschen und ihre Welt richten.
Bezogen auf die akademische Untersuchung scheinen die lange vorherrschenden Revolutionstheorien der „dritten Generation“ (SKOCPOL, 1979; GOODWIN, 2001) denen der „vierten Generation“ Platz zu machen (GOLDSTONE, 2001; FORAN, 2005; GOLDSTONE, 2009; SELBIN, 2009a, 2009b; sowie FORAN et. al., erscheint in Kürze).12 Genau wie bei den vorherigen Generationen bleiben die Erkenntnisse jedoch wichtig und nützlich; jede Generation baut auf dem Besten der vorangehenden Arbeit auf. Ich beziehe mich hier auf mehrere Quellen: SKOCPOLS immer noch führende Definition der sozialen Revolutionen als „rapid, basic transformations of a society’s state and class structures … accompanied and in part carried through by class-based revolts from below“ (1979: 4); die Arbeiten von GOLDSTONE (2001), KUMAR (2001) und besonders FORAN (2005) sowie auch meine eigene Arbeit, die dahingehend argumentiert, dass wir in unserem Verständnis von Revolution die menschlichen und kulturellen Aspekte weiter vertiefen müssen; außerdem TILLYS (1978) Fokus auf die Mobilisierung der Menschen und das, was PAIGE (2003: 24) als ihre „metaphysischen Grundannahmen“ bezeichnet. Somit ist die Revolution
das bewusste, formelle oder auch informelle Bestreben einer breit aufgestellten, aus dem Volk mobilisierten Gruppe von Akteuren, die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Institutionen, die ihr Leben bestimmen, tiefgreifend umzuwälzen; das Ziel ist dabei die grundlegende Änderung der materiellen und ideologischen Umstände ihres Alltagslebens. Dies spiegelt einen Prozess der Entstehung und des anschließenden Kampfes wider sowie ein Resultat, nämlich die Bemühungen um einen grundlegenden Wandel. Wenn beide Elemente verwirklicht werden, sind wir eher bereit, sie als ,große‘ oder ,soziale‘ Revolutionen anzusehen; kleinere Ereignisse werden oft als politische Revolutionen, Rebellionen, Revolten, Widerstände oder andere Arten kollektiven Handelns bezeichnet. (SELBIN, 2008: 131)
Was die akademische ebenso wie die populäre Vorstellung von Revolution angeht, so war die Darstellungsweise des Themas in den letzten 220 Jahren überraschend eindeutig.13 In den kommenden Kapiteln werde ich zeigen, dass genau diese Vorstellung sogar schon wesentlich länger existiert. Trotz TILLYS Hinweis darauf, „[dass] niemals eine natürliche, alle Revolutionen umfassende Geschichte möglich ist, die notwendige oder hinreichende Bedingungen spezifiziert, welche definitionsgemäß nicht wahr sind“ (2006: 159), soll der Leitgedanke hier eher der HIGONNETS sein, der Revolution unter Paraphrasierung BARTHES’ als scriptible („schreibbar“) mit einer erzählenden Qualität begreift: „[N]ebeneinanderlaufend und ineinander verwoben verstärken sich diese Stränge gegenseitig und werden schließlich immer fesselnder … [doch] … wie Sisyphus schreiben wir das Buch der Revolutionsgeschichte und schreiben es immer wieder neu, obwohl wir wissen, dass wir sie nie ganz erfassen können.“ Er fährt folgendermaßen fort: „Manche Strukturen helfen uns zu verstehen, so wie andere dies hoffnungslos erschweren“ (1998: 324). Unser Ziel besteht darin, alles zu erfassen, was uns möglich ist, um unser Verständnis zu verbessern.
Das bei Weitem bekannteste Konzept, hier mit der Bezeichnung „Sozialrevolution“ (Kapitel 6) versehen, basiert auf der Französischen Revolution von 1789. Sie ist groß, episch und einschneidend und ihr (brutales) Scheitern wird ebenso vom Nebel der Zeit verhüllt, wie ihre radikaleren Elemente. Ihre Sage zieht sich durch das 19. Jahrhundert bis nach Russland 1917, das niemals von seinen weitaus besseren Möglichkeiten Gebrauch machte und dessen Revolution beinahe so schnell wie Frankreichs als großes Versagen bzw. großer Verrat gesehen wurde – wer wollte schon zum Zeitpunkt ihres unrühmlichen Endes (oder gar 1939) Russland für sich beanspruchen? Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte man eine kleine Ahnung dessen erhaschen, was möglich sein könnte.14 Guatemala 1950–54, Bolivien 1952–54, Britisch-Guayana 1953–64, Vietnam und Algerien in den 1950ern gehörten zu den verlockenden Optionen. Es sind allerdings China und Kuba, die die Geschichte Mitte des Jahrhunderts bestimmten, und sie schließt in den meisten Fällen mit dem Iran und Nicaragua 1979.
Eine letzte Bemerkung dazu, wie wir vielleicht am besten verstehen können, was eine Revolution ausmacht: Es ist nicht etwa so, dass Menschen leichtfertig kämpfen, ihr Leben und das ihrer Familie riskieren oder ihre Hoffnungen und Träume aufs Spiel setzen; trockene, distanzierte theoretische Konzepte allein werden sie nicht dazu bewegen können. TROTSKY kommt zu dem zwingenden Schluss, dass Menschen nur dann eine Revolution beginnen, wenn es „keinen anderen Ausweg“ gibt (1957: 167). Selbst wenn jemand bereit ist, so weit zu gehen, sind selbstverständlich die Grundvoraussetzungen für eine Revolution völliges Engagement und tiefe Hingabe. Im Gegensatz zum Widerstand, der eine eher defensive Grundhaltung voraussetzt, oder der Rebellion, die sich eher auf die Behebung eines bestimmten Missstandes beschränkt, ist die Revolution im Grunde von Träumen und Sehnsüchten getrieben, Verzweiflung allein reicht nicht aus. Diese Träume und Sehnsüchte sind nicht einzig den Linken oder Volksnahen vorbehalten, auch Monarchisten und Konservative pflegen Imaginationen der Vergangenheit und die Ideale der Faschisten wurzeln zumeist in populären Vorstellungen und Zukunftsvisionen.15 Die „Ursachen“ einer Revolution sind ebenso kulturell wie auch sozial oder ökonomisch und es geht ebenso um das Individuum, wie es um die Gruppe oder Gemeinschaft geht.16 Angetrieben vom Versuch, die Anforderungen des Alltags unter unerträglichen Umständen zu meistern, gesteuert vom Verlangen nach Gerechtigkeit und einer Dynamik der Hoffnung, versuchen die Menschen, ihre Welt zu verändern, also die materiellen und ideologischen Umstände ihres Alltagslebens. Der Anstoß für eine Revolution ist zumeist Ungerechtigkeit, Armut, die Entrechtung der Bevölkerung sowie die Geschichten, die die Menschen von der ihnen zustehenden Freiheit und sozialen Gerechtigkeit erzählen. Diese Geschichten verleihen ihnen eine Stimme in ihrem jetzigen und zukünftigen Leben, dem ihrer Kinder und Enkel sowie innerhalb ihrer Kultur und Gesellschaft.
Revolutionsgeschichten17
Wie kann es dazu kommen, dass so unterschiedliche Faktoren wie Hoffnungen, Träume und Sehnsüchte, Wut, Ablehnung und Furcht, Ängste, Engagement und Leidenschaft sich verbinden? Wie kann es passieren, dass revolutionäre Imaginationen verschiedenster Art (BILLINGTON, 1980; PARKER, 2003; SALDANE, 2003; KHASNABISH, 2007) angeregt werden und die revolutionären Gefühle (FIRCHOW, 2008), die sie hervorrufen können, sich vertiefen und zu revolutionären Situationen (TILLY, 1978) führen? Wie gestaltet sich der verschlungene Pfad vom Unmöglichen zum Möglichen zum Plausiblen zum Wahrscheinlichen? Wie auch immer die verschiedenen Phasen des Revolutionsprozesses aussehen mögen – es gibt anscheinend mindestens drei (Kampf, Triumph, Transformation, siehe SELBIN, 1999) und vielleicht sogar fünf (von Vorstellung und Empfinden zur konkreten Situation, gefolgt von Triumph und Transformation) – es ist an jedem Punkt des Prozesses möglich, die Geschichten von Widerstand, Rebellion und Revolution zu identifizieren, die die Menschen warnen, inspirieren und leiten. Wenn dies alles viel linearer und „progressiver“ (womit eine Progression über verschiedene Stadien gemeint ist) erscheint, als es in der realen Welt möglich ist, spiegelt das nur unsere Art wider, Geschichten zu erzählen.
Bei Revolutionen geht es letztendlich um leidenschaftliche Hingabe und eine große Opferbereitschaft. Welcher übersehene oder unterschätzte Faktor könnte uns ermöglichen, dies zu erklären? Ich behaupte, dass es eine mythopoetische Komponente ist, die einen kleinen Einblick in die Herzen und Köpfe der Menschen erlaubt. Die Globalisierung hat Millionen von uns in eine Zeit und einen Ort wie aus einem Roman des magischen Realismus versetzt: sich gabelnde Pfade, geheimnisvolle Märkte und die liberale Demokratie; alles ganz und gar nicht das, wonach es zuerst aussah. Wohin werden wir gehen und was werden wir tun?
Es scheint nicht weiter notwendig, das Fantastische, das Mystische und das Magische näher zu untersuchen, in der Tat sind wohl nur die Wenigsten bereit, „six impossible things before breakfast“ zu glauben (CARROLL, 1946: 76). Und doch finden manche Leute es durchaus plausibel, dass Túpac Amaru und Túpac Katari, zwei Revolutionäre aus den Anden im 18. Jahrhundert, in verschiedenen Gestalten im Dschungelnebel, in einer anderen Person oder in mehreren Personen im gleichen Raum, wieder erscheinen können. Andere sehen (oder spüren) von Zeit zu Zeit ein Lagerfeuer und daneben das sagenumwobene weiße Pferd Emiliano Zapatas, des mexikanischen Revolutionärs aus dem frühen 20. Jahrhundert. Und die allgegenwärtigste Revolutionsfigur, Ché Guevara, wurde auch lange nach seinem Tode noch in verschiedenen Teilen von Afrika, Südamerika, Südostasien, Nepal und Palästina gesehen, passend zu der von Subcomandante Marcos, dem heutigen Anführer der Zapatisten, stammenden Behauptung, dass hinter der von ihm bevorzugten Skimaske viele verschiedene Menschen steckten und den Kampf vorantrieben, alle Marcos; so wie es die Menschen in Seattle, Genua, Davos und bei Aufständen anderswo skandierten: „Wir sind alle Marcos“, alle Zapatisten, überall und immer.18
Offensichtlich gibt es unzählbar viele Revolutionsgeschichten zu entdecken, weit mehr als wir ahnen. Doch bei all den unendlich vielen Variationen kristallisiert sich eine überraschend zeitlose, immer wieder erzählte Geschichte heraus: Sie handelt von mutigen, tapferen und hingebungsvollen – oft jungen – Menschen, die sich, nachdem ihnen die krasse Ungerechtigkeit ihrer Situation bewusst geworden ist, erheben und Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit verlangen. Diese zeitlose Geschichte reicht so weit zurück, wie wir uns erinnern können, und so weit in die Zukunft, wie wir uns vorstellen können. Während die unterschiedlichsten Leute die Geschichte erzählen können, scheint entscheidend zu sein, dass die Menschen eine Geschichte hören, die ihnen auf einer tieferen Ebene bereits bekannt ist, mit vertrauten Charakteren – vor allem Helden – und einer Handlung, die sie antizipieren können (ängstlich oder erwartungsfroh; siehe BATES, 1996: 72). Es sind Geschichten, die in der einen oder anderen Form von jeder Generation wieder neu aufgeschrieben werden, quer über alle Kulturen, eine Unzahl an Orten, erstaunlich lange Zeiträume und eine noch viel erstaunlichere Bandbreite von Völkern hinweg.19 Diese Geschichten werden nicht von einer Person erdacht20, sondern von allen geschrieben, sie werden über längere Zeiträume hinweg bearbeitet und von den bestehenden soziokulturellen Normen strukturiert, wenn auch nicht von den politischen Normen im engeren Sinne. Sie geben den Menschen eine „Realität“, die sie in Liedern, Theaterstücken und Geschichten verwenden können und deren mitreißende Vortragsweise mit dafür verantwortlich ist, wenn Menschen einen revolutionären Prozess beginnen, auch wenn sie nicht immer bis zum Ende dabei bleiben.
Eine weitere Sache verdient es, an dieser Stelle erwähnt zu werden: meine Position als Autor. Es wäre unaufrichtig vorzugeben, dass wer und was ich bin keinen Einfluss darauf hat, was Sie lesen, und ich bin mir absolut der damit einhergehenden Gefahren bewusst, als weißer, männlicher, nordamerikanischer Sozialwissenschaftler den „Reiseführer“ um die Welt zu spielen. Ebenso stimme ich nicht mit der Auffassung überein, nach der Historiker und Sozialwissenschaftler irgendwie über den Dingen stehen und eine „objektive“ Analyse liefern können. Meiner Meinung nach ist das Beste, was man tun kann, zu versuchen, alles so abzubilden, wie es sich darstellt, und sich dabei unvermeidlicher kultureller und anderer Einflüsse bewusst zu sein. Während dies mit Sicherheit Implikationen für das Folgende haben wird, hoffe ich doch, dass die negativen Konsequenzen sich in Grenzen halten werden.
Der Rest der Geschichte
Wahrscheinlich würden nur wenige Menschen behaupten, dass sich die Welt mithilfe handlicher, überschaubarer Geschichten darstellen lässt, „coherent stories endowed naturally with central subjects, highly organized plot structures, thematic integrity and moralizable conclusions“ (GRAZIANO, 1992: 2). Das nächste Kapitel erzählt etwas über die nun kommenden Geschichten – somit ist es eine Erzählung, die aber offen für Interpretationen ist. Praktisch heißt das, einige wichtige Bestandteile des Projektes werden vorgestellt, der Leser muss den vorliegenden Darstellungen jedoch nicht zwangsläufig zustimmen, damit die späteren Teile des Buches funktionieren. Nach weiteren einleitenden Überlegungen zur Geschichte, die das vertiefen, was bisher diskutiert wurde, wird die Geschichte als Methode und Mittel untersucht, wobei insbesondere die komplizierte Problematik von Übertragung und Übersetzung thematisiert wird. Die Rolle der Erzählung als separates Element und gleichzeitig als konstitutive Komponente der Geschichte wird ebenso betrachtet wie die des Geschichtenerzählers als Verbreiter der Magie. Menschen und Ereignisse kommen und gehen, Geschichten bleiben.
Kapitel 3 befasst sich mit drei heuristischen Methoden: Mythos, Erinnerung und Mimesis. Diese helfen, die Geschichte generell zu situieren, und dienen der Einleitung der dann folgenden Untersuchung der vier Revolutionsgeschichten. Mythos, Erinnerung und Mimesis sind mächtige und durchdringende Leitfäden, die uns dabei helfen können, das zu finden, was den bewussten und unbewussten Bemühungen der Menschen im Bezug auf Widerstand, Rebellion und Revolution zu Grunde liegt. Die Erforschung von Mythen und Erinnerungen sowie die Anerkennung der Kraft der Mimesis für das Entstehen und Bestehen von revolutionären und verwandten Phänomenen, macht es möglich, die vier Geschichten zu deuten. Es handelt sich um nachlesbare, die Zeiten überdauernde Erzählungen, die die Situation der Menschen adressieren, Geschichten, die nicht „nur“ existieren, um von dieser Situation zu berichten, sondern auch als treibende Kräfte zu ihrer Veränderung fungieren.
In Kapitel 4 geht es um das, was wir nach BENJAMIN (1999b: 846) „den Aufstand der Anekdoten“ nennen könnten. Unzweifelhaft ist jeder Fall von Widerstand, Rebellion und Revolution verschieden. Und doch hat auch jeder Fall mit den anderen Fällen etwas gemeinsam, so schwer fassbar oder flüchtig es auch sei. Die Sozialwissenschaften stehen den Naturwissenschaften in nichts nach, was ihre angestrengte Bemühung angeht, in allem „universale Gesetzmäßigkeiten“ aufzudecken, eine Art vereinheitlichende Feldtheorie, um eine riesige Bandbreite an Ereignissen und Prozessen zu erfassen. Die hier vorliegende Untersuchung der besonderen Arten von Kollektivverhalten bildet da keine Ausnahme.21 Gleichzeitig teilen wir das Interesse vieler Historiker an einer minutiösen Untersuchung von Details. Diese Vielzahl von Wünschen kann durch die Ausbreitung und Deutung mehrerer elementarer Geschichten erfüllt werden, die viele, wenn nicht gar die meisten, Fälle von Widerstand, Rebellion und Revolution erfassen. Um das gesamte Spektrum abzudecken, müssen einige Geschichten „oben“ beginnen, es sind elitäre Geschichten, in denen berühmte „Helden“ vertreten sind, große Prozesse widergespiegelt werden und die generell durch wichtige Ereignisse geprägt sind. Andere Geschichten wiederum wurzeln im Populären, es sind Geschichten „von unten“, die die örtliche Bevölkerung („kleine Leute“) zum Thema haben und den Fokus auf kleinere Ereignisse und permanente Prozesse legen. Die vier vorgestellten Revolutionsgeschichten sollen all dies und noch viel mehr abdecken.
Nachdem die Argumentation für die Geschichte an sich abgeschlossen ist, dargelegt wurde, wie Mythos, Erinnerung und Mimesis unserem Verständnis helfen könnten, sowie untersucht wurde, wie Bedeutung an sich entsteht und wie Menschen mobilisiert werden, beinhaltet der nächste Buchabschnitt vier Kapitel, die ausführlich auf die jeweiligen Revolutionsgeschichten eingehen. Kapitel 5 untersucht die Geschichte von der zivilisierenden und demokratisierenden Revolution, die sich um Vorstellungen von Zivilisation (was in dieser Geschichte die „westliche“ oder „nordwestliche“ Zivilisation bedeutet, die mit der vertrauten greco-romanischen/jüdisch-christlichen Triade verbunden ist), Fortschritt, Demokratisierung und, etwas zusammenhangslos, Adel rankt; wobei die Bedeutung des Adels hier im Sinne von noblesse oblige zu verstehen ist. Diese Geschichte untermauert den Triumph der Aufklärung und wird oft von den Mächtigen genutzt, um ihren Handlungen Legitimität und somit Autorität zu verleihen. Tatsächlich handelt es sich um eine „liberale“ Erzählung, sie dient einerseits der Belehrung, andererseits ist sie eine Lobrede auf die Reform. Die bekanntesten Modelle sind England (1688), Amerika (1776) und Frankreich (1789); diese drei werden hier untersucht.
Die Geschichte von der Sozialrevolution ist die bekannteste, sie umfasst sowohl einige der soeben angesprochenen elitären Aspekte als auch die noch folgenden populären Variationen. Hier trägt Frankreich im Jahre 1789 den Verdienst, das gesamte Konzept der Revolution verändert zu haben. Seit dieser Zeit bezeichnet „Revolution“ nicht mehr nur eine Variation des bereits Vorhandenen, sondern eine tiefgreifende soziokulturelle, politische und wirtschaftliche Umwälzung der Regierung, des Staates und vielleicht sogar der Welt. Den Menschen erschließt sich eine riesige Bandbreite neuer Möglichkeiten, die materiellen und ideologischen Konditionen ihres täglichen Lebens und somit ihre Welt zu verändern. Das Bestreben entspricht hierbei größtenteils der bereits genannten Definition von Revolution: der Kampf um die Staatsgewalt und schnelle und tiefgreifende Veränderungen der Staats- und Klassenstrukturen, teilweise durch zeitgleiche und sich gegenseitig verstärkende klassenbasierte Revolten, welche die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Systeme umstürzen. Nach Frankreich sind hierfür die bekanntesten Beispiele Russland (1917), China (1949) und Kuba (1959), wobei Mexiko (1920), der Iran (1979) und Nicaragua (1979) ebenfalls oft genannt werden. In dieser Untersuchung werden wir Frankreich einen weiteren Besuch abstatten, jedoch unter Betrachtung eines anderen Aspekts, wir untersuchen Russland als Aktualisierung der Französischen Revolution im 20. Jahrhundert, sowie Kuba, welches die Revolution in die „moderne“ oder zumindest zeitnähere Welt bringt. Um die besagten Revolutionen in einen Kontext zu stellen, werden auch die Pariser Kommune, China (die Ausbreitung der Revolution in die „Dritte Welt“) und einige von Kubas Abkömmlingen auftauchen.
Während man diese ersten beiden Geschichten durchaus noch als in Abstufungen elitär oder zumindest „top-down“ lesen kann, werden in Kapitel 7 die Bemühungen auf einem mittleren Level vorgestellt, die in der Revolutionsgeschichte von Freiheit und Befreiung zum Ausdruck kommen. Im Gegensatz zu den vorherigen Geschichten beginnt diese längere, loser gestrickte Geschichte vielleicht bereits mit Spartakus’ Sklavenrevolte 73–71 v. Chr. oder mit der biblischen Exodusgeschichte und handelt generell von den verschiedenen Revolten und Rebellionen gegen Sklaverei, Kolonialismus und Imperialismus überall auf der Welt, in denen die Menschen versuchen, sich von Unterdrückern und Gewaltherrschern zu befreien. Es geht um Egalitarismus, Glauben und „Selbstbestimmung“; Werte, die in Form von hohlen Versprechungen Millionen von Menschen nur zu bekannt sind. Die bemerkenswertesten Beispiele sind Haiti (1791), die Sepoy-Rebellion (1857), die Mahdi-Rebellion im damals ägyptischen Sudan (1880er), der chinesische „Boxeraufstand“ (1900) und die diversen antikolonialistischen Kämpfe des 20. Jahrhunderts. Repräsentativ für diese Geschichte sind Fälle wie Haiti, vielleicht die wichtigste und von der Welt am gründlichsten ignorierte Revolution, und Mexiko, der erste große soziale Umbruch des 20. Jahrhunderts, dem in Sachen Einfluss und Vielschichtigkeit nur China und Vietnam Konkurrenz machen. In dieser Geschichte wirft das Wiederaufleben des indigenen Widerstandes, der Rebellion und sogar der Revolution im frühen 20. Jahrhundert bereits seinen Schatten voraus.
Und dann gibt es noch die Geschichte auf der Mikroebene, wenn auch eine mit gewichtigen Konsequenzen für die Makro- oder Metaebene – die fragile, wenn auch hartnäckige verlorene und vergessene Revolutionsgeschichte. Ob kurz und kompakt oder lang und lose erzählt, was die anderen Geschichten auszeichnet, ist eine chronologische und folgegebundene Erzählstruktur, teleologisch und mit erkennbarem Plot. Dies ist offensichtlich hilfreich und beim Erzählen unvermeidlich – aber auch völlig illusorisch. Hier jedoch finden wir kürzere, obskurere, kleinräumigere und begrenztere Erzählungen. Das bedeutet nicht, dass vertraute Gestalten fehlen: Frankreich, Mexiko und Russland sind hier vertreten, wenn auch eher in einzelnen, lokalen, verloren gegangenen Momentaufnahmen als in den größeren, uns wohlbekannten Prozessen. Diese vage, eher impressionistische Geschichte der Kämpfe, die uns „verloren gegangen“ sind, erzählt vom alltäglichen Widerstand, alltäglicher Rebellion und Revolution. Uns liegen zwar Beispiele vor, doch wir können unmöglich einen Überblick gewinnen, da wir nicht wissen, was unserer Aufmerksamkeit entgangen ist und entgeht. Doch nehmen wir einmal die Anabaptistische Herrschaft in Münster 1534–35, die gewaltige Sklavenrevolte im 17. Jahrhundert, die in der für ca. 70 Jahre bestehenden Republik Palmares im Nordosten von Brasilien resultierte, die Neun-Tages-Revolte von Masaniello 1647 im damals spanischen Neapel, die „New York Conspiracy“ der Seemänner und Hafenarbeiter 1741, die nordamerikanischen „Geistertänzer“ im 19. Jahrhundert, die „Roten Bataillone“ der Casa del Obrero Mundial in Mexiko-Stadt 1911–14, der „Drei-Tages-Sowjet“ in Ghuangzhou (die sogenannte „Pariser Kommune des Ostens“), der Naxalitaufstand in Indien 1967 (der eine immer noch existente Bewegung hervorrief) oder die Volksrepublik von Greenwich Town auf Jamaika 1980. Die Verbindungen zwischen diesen verlorenen und vergessenen Episoden und den größeren Prozessen, zu denen sie gehören, sind nicht von sich aus entstanden sondern werden, ob hierarchisch oder lateral, direkt oder indirekt, durch aktive Agitatoren oder passivere Kommunikatoren, von Menschen hergestellt.
Schlussendlich können wir erörtern, wie diese Geschichten uns nicht nur dabei helfen können, herauszufinden, warum und unter welchen Umständen Revolutionen geschehen, sondern auch wo und wann. Während Menschen Geschichten ganz offensichtlich zu vielen verschiedenen Zwecken nutzen, sind sie doch grundsätzlich Werkzeuge, die wir für Aufbau und Organisation verwenden, für die Gestaltung unserer Zukunft.
Somit scheint es angebracht, sie als eine Form, ja sogar die Grundform, soziopolitischen Kampfes zu behandeln. Dies beinhaltet, die Geschichten sowohl inner- als auch außerhalb ihres Kontextes zu betrachten; wobei man nicht außer Acht lassen sollte, dass „Kontext“ mehr bedeutet als nur „Situation“. MCADAM et al. warnen davor, „conflict“ soweit auszuweiten, „[that] in Hegelian fashion, all politics becomes enmeshed in meaning“ (1997: 142). Wenn wir anerkennen, dass Geschichten relevanter Text sind, und zugeben, dass manchmal, vielleicht sogar generell, mehr „Wahrheit“ in diesen Geschichten zu finden ist, als in den Geschichtsbüchern, heißt das noch nicht, dass wir Alice in den Kaninchenbau folgen müssen. Die Geschichten versorgen uns mit allen relevanten Informationen und auf diesen basierend können wir zu Antworten gelangen. Natürlich ist hier Vorsicht geboten: Während Antworten kommen und gehen, sind es die Fragen, die bleiben. Die Fragen und die Geschichten.
Anmerkungen
1 Eine leicht abgewandelte Version hiervon befindet sich am Anfang von SELBIN, 1997a, 99–106.
2 Dieses autoritative, komplexe und problematische Werk wurde 1860 unter dem Titel „Die Kultur der Renaissance in Italien: ein Versuch“ veröffentlicht.
3 Dem geht eine ernüchternde Klage voraus: „History classes were like visits to the waxworks or the Region of the Dead. The past was lifeless, hollow, dumb. They taught us about the past so that we should resign ourselves with drained consciences to the present: not to make history, which was already made, but to accept it“ (GALEANO, 1985: XV).
4 Dies bezieht sich natürlich auf hic sunt dracones (hier sind Drachen), was, „wie jeder weiß“ am Rande der frühen Weltkarten stand. Tatsächlich lässt sich diese Aufschrift nur auf dem „Lenox-Globus“ (1505) finden, östlich von Asien.
5 Parker geht in einer Endnote näher auf seine sinnträchtige Formulierung ein: „By which I refer to a totality of symbolic resources available to a society to represent a real world, the entities within it and their mutual relationships“ (2003: 55, Endnote 6).
6 Interessante Standpunkte zum Thema Widerstand lassen sich bei SCOTT, 1985, 1990; VIRNO, 1996; GROVES und CHANG, 1999; TURIEL, 2003; MCFARLAND, 2004; MARTIN, 1992; HIGGINS, 2000; ECKSTEIN, 2001; LANGLEY, 2004 und ZIBECHI, 2005 finden.
7 HOLLANDER und EINWOHNER (2004: 539–44) untersuchen auch zwei Schlüsselvariablen, Widerstand und Intention, und schlagen eine Typologie des Widerstandes vor, die sich in offen, geschlossen, unabsichtlich, zielgerichtet, von außen definiert, missglückt und versucht gliedert (2004: 544–7).
8 KAMPWIRTH (2002: 11 n14) zitiert FORAN (1997a: 203–6; 1997b: 227–67; 1993a: 1–17; 1992: 3–27) und WICKHAM-CROWLEY (1992: 246) zu „political cultures of opposition“ sowie SELBIN (1997: 123–33; 1999) zu „the relationship between culture and agency in revolutionary politics“.
9 Interessante Ansichten zur Revolution finden sich bei WALTON, 1984; MASTERS, 2004; SAXTON, 2005; DUNÉR, 2005; HARVEY, 1998; WEEDE und MULLER, 1998; CLEARY, 2000; KRAUZE 2001; CANNON, 2004; ARMONY und ARMONY, 2005; SCHATZMAN, 2005.
10 Überzeugende Belege dafür lassen sich unter anderem in WOLF, 1969 finden.
11 Diese prägnante Formulierung stammt von dem jamaikanischen Sänger Delroy Wilson (1971). Der hymnische Songtitel wurde von Michael Manleys sozialdemokratischer und revolutionärer „People’s National Party“ aufgegriffen. Zu Jamaikas revolutionärer Natur siehe die kurze Abhandlung im ersten Abschnitt von Kapitel 4 sowie FORAN (2005: 169). Ob man den Begriff „Revolution“ auf Guatemala 1944–54, Chile 1970–73 und Jamaika 1972–80 anwenden kann, ist strittig.
12 Die paradigmatische Theorie der „dritten Generation“ findet sich bei SKOCPOL, 1979; GOLDSTONE liefert 1991 eine wichtige Verfeinerung und GOODWIN 2001 einen exzellenten Abschluss. GOLDSTONE (2001) und FORAN (2005) sind offensichtlich die naheliegendsten Kandidaten für die paradigmatische Theorie der „vierten Generation“, doch begreift zumindest FORAN noch die ältere Definition SKOCPOLS als „in full as my own“ (FORAN, 2005: 7). Das Konzept der „Generationen“ in den Revolutionstheorien stammt von GOLDSTONE, 1980; die mögliche „vierte Generation“ fand zuerst in FORAN 1993a Erwähnung.
13 Hier lasse ich mich von PARKERS (1999) Verwendung des Ausdrucks „Erzählung“ leiten. Neuere postmoderne Arbeiten betrachten die „Erzählung“ auf eine spezielle – und durchaus hilfreiche – Weise, doch ich möchte, wie ich in Kapitel 2 näher erläutere, die Erzählung von der Geschichte abgrenzen, zumindest bis zu einem Grad der möglich und sinnvoll ist.
14 Ich möchte hiermit nicht die vielen überwältigenden Möglichkeiten außer Acht lassen, die zwischen 1910 und 1920 und dann später wieder zwischen 1934 und 1940 in Mexiko erkennbar waren.
15 Obwohl seit dem Zweiten Weltkrieg der Faschismus gemeinhin mit den deutschen Nazis assoziiert wird, standen die frühen italienischen Faschisten für eine etwas andere Perspektive, die ebenso zu Nazi-Exzessen wie auch zu quasi-monarchistischen und rechts-katholischen Auswüchsen des Neo-Faschismus wie Franco in Spanien, Salazar in Portugal, Perón in Argentinien und Vargas in Brasilien führte.
16 Nach HIGONNET (1998: 13) sind Revolutionen „more cultural than social or economic in their origins and unfolding, even if social and economic forms were both critical cause and effect of cultural belief“. Er verweist auf FURET (1999).
17 Der Großteil dieses Abschnitts ist stark an SELBIN, 1997b: 88–92 angelehnt.
18 Wie ich an einem anderen Ort (SELBIN, 2000: 292; 2003: 89) zu bedenken gegeben habe, werfen solche multiplen Marcos zweifelsohne psychologisch gesehen Probleme auf – wie soll man einer solchen Nicht-Greifbarkeit begegnen, geschweige denn sie bekämpfen?
19 Diese Geschichten überleben, wie DORINGER argumentiert „for centuries, in a succession of incarnations, both because they are available and because they are intrinsically charismatic“ (2000: 26).
20 Selbst wenn es sich um eine einzige Person handelte, würde diese unausweichlich mehrere andere widerspiegeln; jeder von uns ist ein Kompendium. Siehe dazu auch die Diskussion zum Thema bricolage und bricoleur in Kapitel 2.
21 Ein hervorragendes Beispiel hierfür ist MCADAM et al. s (2001) Programm des Zivilen Ungehorsams. In einer früheren Veröffentlichung hatten sie beklagt: „The study of wars, revolutions, rebellions, (most) social movements, industrial conflict, feuds, riots, banditry, shaming ceremonies, and many more forms of collective struggle“, die sie dem Zivilen Ungehorsam zurechnen, „has not proceeded as a unified field“ (MCADAM et al., 1997: 143).