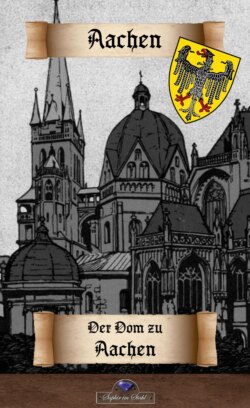Читать книгу Der Domschatz zu Aachen - Erik Schreiber, Friedrich Rolle, Leo Woerl - Страница 7
ОглавлениеI.
Das antike Element in der Elfenbeinschnitzerei bis zum 12. Jahrhundert.
Neben der byzantinischen und der durchaus barbarischen Kunstrichtung lässt sich in Deutschland während der romanischen Epoche noch eine dritte verfolgen, welche die antiken Traditionen bewahrte und auf dieser Grundlage schon im 11. und 12. Jahrhundert eine anhebende Renaissance vor der eigentlichen Renaissance und weit früher als im übrigen civilisirten Europa, Italien selbst nicht ausgenommen, erzeugte. Ihre Werke stehen dem Charakter des starren, ausgelebten Byzantinismus ebenso schroff gegenüber wie den barbarischen Gebilden der einheimisch-nationalen Kunst, indem sie einerseits zwar, wie die letzteren, das innere Leben der Seele zu beredtem Ausdruck zu bringen suchen, andrerseits aber einen vornehmen Adel der Form anstreben und nicht selten erreichen.
Den Glanzpunkt dieser noch keineswegs vollständig aufgeklärten antiken Kunstrichtung, die besonders in der Bildhauerei, aber auch in der Malerei, namentlich in verschiedenen Wandgemälden, offenkundig zu Tage tritt, bilden die herrlichen Skulpturen an der goldenen Pforte zu Freiberg, (Springer, die Quellen der Kunstdarstellungen im Mittelalter. (Abdruck aus den Berichten der phil. histor. Klasse der Kgl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften, 1879. S. 30 ff)) an der Kanzel und am Altare zu Wechselburg. (Wilh. Lübke, Geschichte der Plastik. 3. Aufl. S. 471. ff.) Diese Schöpfungen der hochentwickelten sächsischen Bildhauerschule aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts übertreffen an Schönheit der Komposition, an Schwung der Linienführung, an lebendiger Bewegtheit der Figuren und an Feinheit des seelischen Ausdrucks weit alles zu jener Zeit Geschaffene und lassen sich, wie der geniale Architekt und Gelehrte Gottfried Semper mit Recht annimmt, (Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten. Band II. S. 525.) nicht etwa aus der damaligen Überlegenheit der deutschen Prälaten und Fürsten in der klassischen Bildung“ allein erklären, sondern setzen mit Nothwendigkeit das Fortleben antiker Traditionen voraus.
Weit mehr noch als in der grossen Kunst lässt sich diese antike Strömung, dieses Anlehnen an römische Vorbilder bis herauf zur gothischen Periode, welche ihrerseits als reagirendes Selbständigwerden des germanischen Geistes einen Rückschlag auf Jahrhunderte herbeiführte und die sich entfaltende Kunstblühte wie ein nächtlicher Reif schon im Aufknospen versengte, an verschiedenen Werken der Kleinkunst, vor Allem an einer Anzahl von Miniaturen und Elfenbeinskulpturen wahrnehmen. (Ant. Springer, die Quellen der Kunstdarstellungen im Mittelalter, a. a. 0. S. 7.) Gerade diese letzteren zeigen in einer fortlaufenden Reihe von Denkmälern, angefangen vom 5. bis herab zum 12. Jahrhundert, dass sich nicht etwa bloss das technische Können fortgeerbt hat, was bekanntlich auch in der byzantinischen Kunst und zwar in noch weit hervorragenderer Weise der Fall war, sondern dass man das ganze Mittelalter hindurch genug ästhetische Feinfühligkeit besass, noch vorhandene antike Werke direkt nachzuahmen und an ihnen sich zu bilden. Es ist überhaupt tief im Wesen der Menschen begründet, dass sie sich von - jeher Belehrung suchend an frühere Zeiten wandten. Wie schon die Griechen bei den Ägyptern und Asiaten in die Schule gingen, wie ferner die Römer sich an den herrlichen Schöpfungen der Griechen begeisterten, so sehen wir vom 5. Jahrhundert n. Chr. an jede kommende Epoche an die vorausgegangene sich in bald mehr bald minder bewusster Weise anlehnen und häufig sogar bis auf die Römerzeit zurückgreifen. Man besass damals noch nicht die Fähigkeit, unmittelbar aus der Natur die künstlerischen Motive herauszuheben. Die einfache Wiederholung bereits künstlerisch gefasster Darstellungen bot den Vortheil, dass sie über die Schwierigkeiten der Komposition, der Gruppirung, der Bewegung hinweghalf. So musste, wie Anton Springer trefflich ausführt, (Die Quellen der Kunstdarstellungen im Mittelalter a. a. O. S. 7.) die altchristliche und antike Kunst den mittelalterlichen Bildhauern und Malern geradezu die Natur vertreten und ihren Lehrmeister auch in Formfragen bilden. Empfing. einer der letzteren die Aufgabe, ein Bildwerk zu schaffen, so holte er sich gewiss Rath bei der überlieferten Kunst und reproduzirte, was er an brauchbaren Darstellungen oder selbst Einzelgestalten daselbst finden konnte.
Zum vollen Verständniss der vorliegenden Abhandlung ist es nothwendig, den Faden zu zeigen, welcher von der antiken Kunst bis zu den Skulpturen in Freiberg und Wechselburg heraufleitete. Um den einfachen und lichten Gang der Gedanken nicht durch Überfülle des Stoffes zu verwirren, will ich mich hiebei, soweit es thunlich ist, auf die Elfenbeinskulpturen beschränken. Ich kann dies umso leichter, als die grosse Kunst, wenigstens soweit es die Plastik anbelangt, in der in Rede stehenden Zeit ohnehin nur eine untergeordnete, von der Architektur vollständig bedingte Rolle spielt. Zum Ausgangspunkt meiner Ausführungen will ich eine aus Bamberg stammende Elfenbeintafel wählen, auf welcher drei Frauen am Grabe und die Himmelfahrt Christi dargestellt sind. Professor Dr. J. A. Messmer, den der Tod leider zu früh seinem Berufe und der Wissenschaft entriss, hat an der- Hand dieser Tafel in der ihm eigenen geistreichen und scharfsinnigen Weise den Beweis erbracht, dass uns in dem Grabgebäude des Reliefs eine direkte Nachbildung der von Constantin dem Grossen erbauten heil. Grabkapelle zu Jerusalem erhalten ist. (Mittheil. der k. k. Centrallcommission in Wien, 1862. Nr. 4. S. 85 – 90).
Manche Gelehrte nun haben die eben genannte Relieftafel für eine byzantinische Arbeit des 4. Jahrhunderts n. Chr. gehalten und selbst der in solchen Dingen so feinfühlige Mess m e r hat sich durch die relative Schönheit der lebensvollen Figu-ren zu dieser Ansicht verleiten lassen. Allein die etwas zu gross gerathenen Hände und das Gedrungene der Gestalten sowie die für die abendländische Kunst so charakteristischen Köpfe in ihrer, man möchte fast sagen, etwas derben Realistik, weisen das betreffende Relief zweifellos dem Abendlande zu; denn diese Merkmale wird man selbst an den frühesten byzantinischen Werken vergeblich suchen. Gerade das Hinneigen zu einer mehr realistischen Art der Darstellung war es eben, was der abendländischen Kunst früher oder später eine Zukunft verhiess, während die byzantinische Kunst den Keim der Schwindsucht schon bei ihrer Geburt in sich trug.
Die in Rede stehende Elfenbeintafel nun stammt nach meiner Ansicht aus dem 5. Jahrhundert n. Chr. (Dieser Ansicht ist auch Springer, die Psalter-Illustrationen im frühen Mittelalter. (Des VIII. Bandes der Abhandlungen der phil. hist. Classe der Kgl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften Nr. 11.) Leipzig, S. Hirzel 1880. S. 203.) und steht mit dem damaligen Aufschwung der Elfenbeinschnitzerei in Ravenna und im nördlichen Italien in Zusammenhang. Ravenna ist als ein Mittelpunkt des abendländischen Kunstschaffens noch lange nicht hinlänglich gewürdigt worden. Man nimmt es gewöhnlich als Hauptstadt des byzantinischen Exarchats und die aus dieser Zeit stammenden Werke haben einzelne Forscher zu der Ansicht geführt, dass Alles, was in Ravenna geschaffen würde, einen byzantinischen Charakter trage oder direkt aus den Händen byzantinischer Künstler hervorgegangen sei. Und doch war dies, besonders in der früheren Zeit, durchaus nicht der Fall, namentlich nicht in Bezug auf die Elfen- beinschnitzereien, wie denn in Byzanz überhaupt der Skulptur nur, eine sehr stiefmütterliche Behandlung zu Theil ward. Was sich an ravennatischen Werken aus der Blüthezeit dieser Stadt auf den ersten Blick als byzantinischer Einfluss ansieht, das findet seine tiefere Begründung im damaligem Zeitgeist, welcher in der ravennatischen Kunst ebenso wie in der byzantinischen zum Ausdruck gelangte.
Es ist behauptet worden, dass die abendländischen Consular-Diptychen einen geringeren Kunstwerth hätten, als die byzantinischen. Doch Wilh. Meyer (Zwei antike Elfenbeintafeln der k. Staatsbibliothek in München. (Aus den Abhandlungen der k. b. Akademie d. Wiss. I. Cl. XV. Bd. I. Abth.) München 1879, Akademische Buchdryckerei von F. Straub.) hat gezeigt, dass eine solche Scheidung unmöglich ist, „da wir weströmische Diptychen nur aus dem 5., oströmische Diptychen nur aus dem 6. Jahrhundert haben, mit Ausnahme des weströmischen von 530.“ Dieses letztere ist nun allerdings beinahe eine direkte Nachbildung des oströmischen vom Jahre 513; dieses scheint dem abendländischen Bildschnitzer zufällig in die Hände gekommen und von demselben als Vorlage benützt worden zu sein. Freilich geschah dies erst im 6. Jahrhundert, als der byzantinische Einfluss in Ravenna bereits mächtiger geworden war; vordem aber hatten die ravennatischen und abendländischen Schnitzer noch künstlerisches Geschick genug, ihre Arbeiten selbständig anzufertigen oder höchstens sich an der Antike zu inspiriren. So ist z. B. das weströmische Diptychon des Boethius vom Jahre 487 eine wohlgelungene abendländische Arbeit, welche manche byzantinische Werke hinter sich zurücklässt. Es ist ferner bezeichnend genug, dass der Meister des berühmtesten Werkes byzantinischer Plastik, der gewöhnlich Augustio genannten Reiterstatue Justinian's, ein geborener Römer war. Kurz der byzantinische Einfluss war, was die Plastik anbelangt, im Abendlande besonders im 5. Jahrhundert, von kaum nennenswerther Bedeutung.
Es wäre auch sonderbar genug, wenn nur in Byzanz, seitdem es durch Constantin den Grossen zur Hauptstadt des östlichen Reiches geworden war (330), Kunst und Wissenschaft einen neuen Aufschwung genommen hätten, wenn nicht auch in Ravenna, seitdem es Kaiser Honorius zur Residenz des Westens erhoben (404), sich eine ähnliche Renaissance angebahnt hätte. Die Kunstschätze, welche zum Schmucke der neuen Hauptstadt aus Rom und anderen Städten dahingeschafft wurden, übten auf die einfachen Bewohner naturgemäss einen tieferen und nachhaltigeren Eindruck aus als auf die durch stetiges Anschauen abgestumpften Sinne der Römer; sie wurden wie den Byzantinern, so auch den Ravennaten Vorbilder, an denen sie ihren Geschmack läutern, ihr technisches Können erproben und sich zur Nachahmung begeistern konnten. Die neuen Aufträge, an denen es nicht fehlte, kamen dieser Anregung rechtzeitig zu Hilfe und so entstand gegen die dreissiger Jahre des 5. Jahrhunderts in Ravenna unter ganz ähnlichen Bedingungen, wie in Constantinopel schon um ungefähr ein halbes Jahrhundert früher, eine ganz eigenartige Kunstschule, welcher wir namentlich eine Reihe ausgezeichneter Elfenbeinskulpturen verdanken.
Es fehlt zwar nicht an gewichtigen Stimmen, welche diese Diptychen durchweg auf byzantinischen Ursprung zurückzuführen suchen, ja Labarte, der verdienstvolle Verfasser der „Histoire des arts industriels“ sieht fast in jedem Werke der bildenden Kunst vom 5. bis zum 12. Jahrhundert byzantinische Künstlerhände. Ihm genügt schon die orientalische Kopfbedeckung der Placidia auf dem Diptychon Valentinian's III. vom Jahre 430, um dieses Relief der abendländischen Kunst abzusprechen, als ob nicht auch ein Künstler des Westens eine sich griechisch kleidende Kaiserin naturgetreu zu porträtiren vermocht hätte! Kurz, die Gründe, welche Labarte und andere Gelehrte für ihre Ansicht ins Treffen führen, vermögen nicht gegen die naheliegende Thatsache aufzukommen, dass ein abendländischer Consul die Tafeln, welche er beim Antritt seines Amtes an die Behörden, Freunde und Gönner zu verschenken hatte, sicher auch im Abendlande und zwar zunächst in der Hauptstadt des Reiches, in der er sich eben am häufigsten aufhielt, herstellen liess.
Daher muss das herrliche, im Domschatz zu Monza aufbewahrte Diptychon Kaiser Valentinian's III. vom Jahre 430, welches ich als Consulardiptychon des Genannten in einem Aufsätze der „Wartburg“ endgiltig nachgewiesen zu haben glaube, (Die Wartburg, Organ des Münchener Alterthumsvereins. 1882. Nr. 1-4.) als die Arbeit eines ravennatischen Künstlers betrachtet werden, da Valentinian und seine Mutter Placidia vorzugsweise in Savenna ihren Aufenthalt hatten. Die Schönheit des Diptychons veranlasst mich, auf eine merkwürdige Erscheinung hinzuweisen, welche die bisherigen Ausführungen zu stützen geeignet ist.
Diejenigen, welche die Geschichte der Elfenbeinschnitzerei näher verfolgt haben, werden zu der Beobachtung gelangt sein, dass in Bezug auf Komposition und technische Ausführung jene Elfenbeinskulpturen die besten sind, welche noch dem 2. und 3. Jahrhundert n. Ch. angehören. Obgleich damals die grosse Kunst schon gänzlich darniederlag, lieferten die kleinen Künste, namentlich die Schnitzerei, doch noch eine Reihe vortrefflicher Werke, wie z. B. das ausgezeichnete Diptychon mit der Inschrift „Symmachorum – Nicomachorum“, dessen eine Tafel sich im South Kensington Museum zu London befindet, während die andere im Hotel Cluny zu Paris aufbewahrt wird Die Literatur darüber bei Wilh. Meyer a. a. O. S. 80. Nr. 53.), ferner das schöne Diptychon des Stadtvicars von Rom, Rufius Probianus, in der k. Bibliothek in Berlin (W. Meyer, a. a. O. S. 78. Nr. 44.) und viele ähnliche Relieftafeln.
Steigen wir dagegen um ein Jahrhundert herab und durchmustern die Elfenbeinreliefs des 4. Jahrhunderts n. Chr., so werden wir nicht ein einziges entdecken, das in künstlerischer Beziehung irgendwelches Interesse böte. Der Verfall ist nachgerade auch über die Kleinkunst hereingebrochen. Hingegen tritt uns seit dem Beginn des 5. Jahrhunderts wieder eine Reihe trefflicher Elfenbeinskulpturen entgegen, welche, wenn sie auch hinter der Schönheit jener aus dem 3. Jahrhundert stammenden zurückstehen, immerhin eine gewisse Grossartigkeit in Form und Haltung der Figuren zur Schau tragen und den Einfluss der Blütheepochen der Kunst auf einmal wieder wirksam zeigen.
Ich erinnere blos an das bereits genannte. Diptychon Valentinian's III. und an das berühmte Diptychon im Zither des Doms zu Halberstadt (Wilh. Meyer, a. a. U.), welches wahrscheinlich zum vierten Consulate des Feldherrn Aetius, des glorreichen Besiegers der Hunnen Attilla's, im Jahre 454 angefertigt worden ist. Für diese Erscheinung kann keine andere Erklärung gefunden werden als die, dass die Erhebung Ravenna's zur Residenz des westlichen Reiches vom Neuen die erschlaffenden Kräfte anspornte und so nochmals ein zeitweiliges Aufflackern der bereits im Erlöschen begriffenen Fackel der Kunst herbeiführte. Ravenna wurde auf diese Weise eine der wichtigsten Stationen, auf welchen die alte Kunst auf ihrem Zuge nach Norden Halt machte, nochmals einen Blick zurückwarf und sich zur Weiterreise sammelte. Wesentlich trug hiezu die grosse Menge von Elfenbein-Diptychen bei, welche der jeweilige Consul bei seinem feierlichen Amtsantritte an die Glieder des kaiserlichen Hauses, an die Behörden, an Freunde und Gönner verschenken musste und die er ohne Zweifel in der Residenzstadt herstellen liess.
Wenn demnach Ravenna als Mittelpunkt des abendländischen Kunstschaffens seit dem Beginn des 5. Jahrhunderts n. Chr. anzusehen ist, dann müssen alle Werke, welche in Geist und Stil mit den vorhin genannten Verwandtschaft zeigen, in Beziehung zu dieser Kunstschule gebracht werden. An erster Stelle wäre hier die berühmte Elfenbeinpyxis im Berliner Museum (Schaaase, Geschichte der bildenden Künste. 2. Aufl. Bd. III. S. 95 ff. - Kunsthistorische Bilderbogen. Leipzig, E. A. Seemann Nr. 42.) zu nennen, welche Carl Schnaase dem 3. Jahrhundert zuzuschreiben geneigt ist. Allein trotz der Schönheit der Komposition und der lebensvollen Bewegtheit der Gestalten ist dieselbe sicher doch nicht früher als das 5. Jahrhundert, wie Einzelheiten des Reliefs, Unkorrektheiten in der Zeichnung, Missverhältnisse in den Proportionen der Figuren, die etwas zu gross gerathenen Hände und Füsse und Anderes dergl. zur Genüge darthun. Dagegen zeigt ein einziger Blick auf die dargestellten Scenen, dass der betreffende Künstler sich an den früheren Werken der Kunst inspirirt hat, ja man möchte beinahe behaupten, dass er in seinem, die Apostel lehrenden jugendlichen Christus direkt den Stadtvikar Rufius Probianus auf dem obgedachten Diptychon kopirt hat. Auch die treffliche, wohl ebenfalls dem Anfang des 5. Jahrhunderts angehörige Elfenbeintafel in der Bibliothek zu Brescia, (W. Lübke, Grundriss der Kunstgeschichte. g. Aufl. S. 266.) auf welcher der Tod des Ananias und der Saphira dargestellt ist, setzt ein eingehendes Studium früherer Werke von Seite des betreffenden Schnitzers voraus.
Eine ähnliche Wahrnehmung lässt sich an einer Reihe anderer Elfenbeintafeln machen, unter ihnen namentlich auch an jener des Bayerischen Nationalmuseums, von welcher unsere Betrachtung ausging. Sie ist ungefähr gleichzeitig mit dem Diptychon Kaiser Valentinian's III., stammt also aus der Zeit um 430 n. Chr. und zeigt uns in der Nachbildung der Grabkapelle zu Jerusalem, wenn sonst Professor Messmer Recht hat, dass man damals die Werke der früheren Zeit, plastische wie architektonische, geflissentlich zu studiren und an ihnen sich zu begeistern pflegte.
Die gleiche Beobachtung können wir an einer Elfenbeintafel zu Brescia machen, von welcher Wilh. Meyer (a. a. O. S. 34 ff.) wahrscheinlich gemacht hat, dass sie zwischen 442 - 452 angefertigt wurde. Darauf sieht man eine genaue Nachbildung des Circus mit der Spina und den Meten, mit Statuen, Obelisk und Wasserbehälter. Kurz es besteht kein Zweifel, dass man im Laufe des 5. Jahrhunderts, absichtlich zum Studium der älteren Kunstwerke zurückkehrte und dadurch eine relative Blüthe der Kunst herbeiführte.
Kurze Zeit nachher erstand in Theoderich dem Grossen (gest. 526) ein Mann, welcher diese Richtung thatkräftigst unterstützte. Sein Bestreben, die alten Gebäude zu restauriren, seine direkte Aneiferung zum Studium der Werke des Alterthums legen ein vollgiltiges Zeugniss dafür ab, dass die einsichtsvollen Kreise damals das Heil der Kunst lediglich in der Anlehnung an die Antike erkannten. Diese Anlehnung ermöglichte noch Werke, wie die Elfenbeinskulpturen am Predigtstuhle des ravennatischen Erzbischofs Maximianus (546 - 552) in der Metropolitankirche zu Ravenna (Schnaase, a. a. O. Bd. III S. 219 ff. - J. O. Westwood, A descriptive Catalogne of the fictile ivories in the South Kensington Museum p. 31. 357.), obgleich an diesen schon eine leichte Dosis byzantinischen Einflusses bemerkbar ist.
Zeigt sich in diesen, unter antikem und byzantinischem Einflusse stehenden Arbeiten eine gewisse Selbständigkeit der betreffenden Künstler, so existiren andere, welche uns direkte Nachbildungen älterer Werke auch noch im 6. und 7. Jahrhundert vor Augen führen. Dahin gehören namentlich jene frühmittelalterlichen Diptychen, welche häufig geradezu Kopien römischer Vorbilder sind. Das wichtigste Denkmal dieser Art ist ein im Domschatz zu Monza aufbewahrtes Diptychon, welches auf der einen Tafel den König David, auf der anderen den hl. Gregor dargestellt zeigt. Beide Gestalten sind in Tracht und Attributen vollständig wie die Consuln gehalten, so dass manche Gelehrte zu der Ansicht kamen, dieselben seien ursprünglich wirkliche Consuln gewesen, welche erst später getauft und mit der Tonsur ausgezeichnet worden seien, eine Ansicht, welche indess von Wilh. Meyer gründlich widerlegt worden ist. (a. a. O. S. 76. Nr. 37.)
Genau dieselbe Erscheinung finden wir in den Miniaturen, wie Anton Springer an verschiedenen Beispielen schlagend gezeigt hat. (Anton Springer, die Psalter- IIlustrationen im frühen Mittelalter mit besonderer Rücksicht auf den Utrechtpsalter. Ein Beitrag zu Geschichte der Miniaturmalerei. (Des VIII. Bandes der philologisch- historischen Klasse der königl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften Nr. II.) Leipzig, S. Hirzel 1880.) Ich will nur eines. herausgreifen, den Sänger David mit seinen Chören im Canterbury-Psalter vom Jahre 700. „Dieses Bild“, sagt Springer, (a. a. O. S. 207.) „ist keine angelsächsische Erfindung, auch in der Technik, in der Anwendung der Deckfarben, in der Schattirung, durch tiefere Lokaltöne von der heimischen Übung abweichend. Dem Künstler lag ein älteres Malerwerk vor, welches er ziemlich schwerfällig nachahmte.“ Er erhielt somit die antiken Elemente allerdings nur in der bereits erstarrten und vielfach umstellten Umprägung, welche dieselbe in der altchristlichen Zeit erfahren hatten; immerhin aber ist das. Streben, ältere Werke zu Vorbildern zu nehmen, zur Genüge erwiesen.
Dass sodann in der karolingischen Zeit neben dem byzantinischen Einflusse auch ein italienischer, welcher von der Antike getragen wurde, sich geltend machte, ist selbstverständlich, wenn derselbe auch nicht mehr in der früheren Stärke vorhanden war. Ja, Anton Springer hat gezeigt (Die Quellen der Kunstdarstellungen S. 7.), dass es eben die karolingische Zeit war, welche die Vermittlerrolle spielte zwischen der altchristlichen Kunst und jener des 10. und der folgenden Jahrhunderte. Der genannte Gelehrte hat auch die Annahme eines byzantinischen Einflusses auf die Kunst des karolingischen Zeitalters, wenigstens soweit es die Miniaturen betrifft, auf ihr wahres Mass zurückgeführt (Die Psalter-Illustrationen etc.) und bewiesen, dass die „Verwandtschaft, die zwischen der byzantinischen Kunst und der früh-romanischen beobachtet wurde, vorwiegend auf dem Umstande beruht, dass da und dort gleichmässig die ältere (altitalienisch-römische) Kunst die unmittelbare Vorlage abgab und das mangelnde selbständige Naturstudium ersetzte.“ (Die Quellen der Kunstdarstellungen S. 7. ff) In den Miniaturen jener Zeit trifft man häufig Anklänge an die antik-römische Kunst. Ich meine nicht die Personifikationen der Sonne und des Mondes, der Winde, Flüsse u. s. w., auch nicht die Darstellungen des Cerberus, des Hymenäus u, dergl., da die damaligen Künstler hiezu schwerlich bestimmte Vorbilder hatten, sondern durch die Lektüre römischer Dichter oder durch die Predigten angeregt wurden. (Springer, die Psalterillustrationen, S. 203 ff). Der Einfluss des Alterthums, welcher sich hierin kundgibt, war nur ein rein stofflicher; formell dagegen wird er in gewissen Nachbildungen antiker Bauformen. Sehr interessant ist in dieser Beziehung der Rundtempel und die offene Giebelhalle in der Illustration des ersten Psalmes des um die Mitte des 9. Jahrhunderts entstandenen Utrechtpsalters in der Bibliothek der Universität zu Utrecht. (Springer a. a. O. S. 193. 203. 229.) An diesen beiden Bauten erscheinen nämlich Säulen mit Blätterkapitälen geschmückt, welche an die korinthische Weise erinnern; ja an den Säulen der Giebelhalle erscheint die attische Basis deutlich nachgebildet, so zwar, dass die Annahme gerechtfertigt ist, das Auge des Künstlers sei von einem realen Bauwerk gelenkt worden. Vielleicht war es eine Elfenbeinschnitzerei, welche ihm als Muster gedient hat. Hat er doch auch für die Illustration des XV. Psalmes getreu das Grabmal verwerthet, welches auf der bereits besprochenen Elfenbeintafel im Bayerischen Nationalmuseum zu sehen ist. Endlich setzt auch die Zeichnung eines Aquäducts in der Illustration des XXV. Psalmes die Kenntniss einer wirklichen römischen Wasserleitung voraus. Aber nicht blos im Bezug auf die Architektur, auch hinsichtlich der Plastik begegnet uns hin und wieder ein unmittelbarer Einfluss des antiken Formensinnes. So sehen wir in der Illustration des XXIV. Psalmes des Utrechtpsalters eine weibliche Gestalt von entschieden antikem Gepräge. „Sie hat den Mantel über den Kopf gezogen, so dass er gleichzeitig als Kopftuch dient, legt die Linke auf den Kopf eines der drei neben ihr stehenden Knaben und hält in der ausgestreckten Rechten eine Rolle. Ein langes, unter dem Busen gegürtetes Gewand deckt ihre schlanken Glieder und ist so geordnet, dass die runden Formen des einen Beines durchscheinen, während über das andere die Falten des Rockes in geraden, dichten Linien herabfallen.“ (Springer a. a. O.) Ein antikes Vorbild, vielleicht eine Gemme oder Münze, lag dem Künstler auch für den Streitwagen Gottes in der Illustration des LXVII. Psalmes vor. Wir sehen den Wagen aus der Tiefe herauskommen, sich in seiner ganzen Breite zeigen, indem die vier Pferde nach rechts und links ausweichen. Die gleiche Darstellung, aber als Sonnenbild, findet sich auch in der Aratus-Handschrift Nr. 250 in der Stiftsbibliothek zu St. Gallen (J. Rudolf Rahn, das Psalterium aureum von St. Gallen. St. Gallen, Huber & Cie. 1878. S. 55) und in der Bibel Karls des Kahlen in der Nationalbibliothek zu Paris. (Westwood, Pal. sacra pl. 26.)
Deutlicher kommt das antike Element in der abendländischen, namentlich in der deutschen Kunst vom Ende des 10. Jahrhunderts an wieder zum Vorschein. Es trugen dazu die Römerzüge der Kaiser und die nach dem Norden gekommenen, namentlich kleineren antiken und altchristlichen Kunstwerke wesentlich bei. Auch die Pilgerfahrten der Äbte und Mönche scheinen in dieser Beziehung nicht ohne nachhaltigen Einfluss gewesen zu sein; denn gerade die Klöster und Bischofssitze gehen in der Aufnahme antiker Elemente voran, wie sie damals überhaupt die Pflege der Kunst fast ausschliesslich in Händen hatten. Bekannt sind die Anstrengungen, welche Bischof Berward von Hildesheim zur Hebung der vaterländischen Kunst auf Grund seiner italienischen Erfahrungen machte. Wie sehr man sich um jene Zeit dem Studium der römischen Kunstwerke, soweit sie zugänglich waren, hingab, das zeigt uns ein, vielleicht dem Io. Jahrhundert angehöriger Autor, dessen Person in mysteriöses Dunkel gehüllt ist, der sog. Heraclius in seinem Buche „von den Farben und Künsten der Römer. (Herausgegeben mit Originaltext und Übersetzung, mit Einleitung, Noten und Excursen versehen von Albert Ilg. Wien 1873. IV. Band der „Quellenschriften zur Kunstgeschichte). Der Verfasser legt in diesem Werke zum grossen Theil die Ergebnisse seiner antiquarischen Untersuchungen nieder; er beschreibt die von den alten Römern geübten Künste und beklagt, dass das Verständniss hiefür seinen Zeitgenossen so gänzlich entschwunden sei. Am interessantesten ist das 5. Kapitel des ersten Buches, welches von den sog. Goldgläsern handelt. „Die Römer“, sagt dort Heraclius, „machten sich Schalen, sorglich unterbrochen mit Gold, eine überaus kostbare Sache. Daran habe ich mit höchstem Eifer meine Mühe gewendet und des Geistes Auge liess ich darüber brüten Tag und Nacht, auf dass ich die Kunst erringen möchte, durch welche die Schalen herrlichen Schimmer erhalten. Endlich brachte ich zuwege, was ich nun, mein Theuerster, offenbare. Ich fand, dass Goldplättchen sorgsam zwischen gedoppeltem Glase eingeschlossen sind. Als ich diese Arbeit öfter mit eigenen Augen genau betrachtet hatte, wurde ich immer mehr und mehr angeregt, endlich nahm ich mir mehrere Schalen von spiegelklarem Glase und bestrich sie mittels eines Pinsels mit klebrigem Gummi. Darauf begann ich sodann Goldplättchen zu legen und sobald sie getrocknet waren, grub ich Vögel und Menschen und Löwen, je nachdem es mir gut dünkte, darauf ein. Als das geschehen, zog ich darüber eine Schichte Glas, das ich am Feuer mit sachverständigem Hauche dünngeblasen hatte. Sobald nun das Glas in gleicher Weise die Hitze empfand, schloss es sich ringsum dünn in trefflicher Weise an. (Vergl. meinen Aufsatz: „Die Technik der Goldgläser“ in der Zeitschrift des Münchener Kunstgewerbevereins 1879 Nr. 11 u. 12.) Diese Worte bezeugen zur Genüge, dass man im Io. Jahrhundert dem Studium der sich noch hier und dort findenden Überreste altrömischer Kunst oblag und geflissentlich die verloren gegangenen Techniken und Künste wieder ins Leben zu rufen bemüht war.
Bei dieser Lage der Dinge kann es uns durchaus nicht Wunder nehmen, wenn wir in den Skulpturen da und dort antike Werke zum Vorbild nehmen, ja sie geradezu kopieren sehen. In den Klosterschulen hat man überhaupt fortwährend nach älteren Vorbildern gearbeitet. Freilich stammten diese Vorbilder, „da altchristliche nicht leicht mehr zum Vorschein kamen und Italien fast nichts mehr producirte, (Schnaase a. a. O: Bd. III. S. 732.) zum Theil auch aus Byzanz. Allein der Einfluss der letzteren war durchaus nicht von so wohlthätigen Folgen begleitet, wie man gewöhnlich anzunehmen geneigt ist. Die übertriebene und peinliche Subtilität in der Ausführung, welche die byzantinischen Skulpturen auszeichnet, war viel eher geeignet, jedweden Schwung der Phantasie zu lähmen als zu befördern. Diess sieht man deutlich an zwei Relieftafeln in der Bibliothek zu St. Gallen, die man dem berühmten Abte Tutilo (gestorben 915) zuschreibt. (Lübke, Geschichte der Plastik 3. Aufl. S. 395 - Kunsthistorische Bilderbogen. Taf. 92, 1 u. 2.) Die figürlichen Darstellungen dieser beiden Tafeln, in denen Schnaase noch Nachklänge der irischen Kunstübung erkennen will (a. a. O. Bd. III. S. 655 ff.), sind ohne Zweifel unter dem Einflusse byzantinischer Vorbilder entstanden. Dies bezeugt namentlich das enge und sorgfältig ausgeführte Gefältel der Gewänder. Wie wenig vortheilhaft aber dieser byzantinische Einfluss war, diess einzusehen genügt ein Blick auf die in Rede stehenden Reliefs. Der Akanthus dagegen, welcher das obere Feld der einen Tafel schmückt und der nach antikem Vorbilde geschnitzt wurde, ist so anmuthiger Natur, dass man gar nicht begreift, dass er von derselben Künstlerhand herrührt wie die darunter sich befindenden figürlichen Darstellungen. Das Gleiche gilt von dem mit Thieren bevölkerten Rankenwerk der anderen Tafel. Daraus geht hervor, dass der vornehme Adel der antiken Kunstwerke dem deutschen Geiste weit fördernder und fassbarer war, als die kleinliche Zerfahrenheit, welche die byzantinischen Denkmäler zur Schau tragen. Es ist daher selbstverständlich, dass man sich nach antiken Mustern und Vorbildern umsah, diese studirte, nachahmte und an ihnen seinen Geschmack zu läutern suchte. Man kann dieses Hervorsuchen und Studium antiker Denkmäler an einer Reihe von Miniaturen und Elfenbeinreliefs wahrnehmen. Ich will nur einige der letzteren namhaft machen, da über jene das bereits mehrfach genannte Werkchen von Anton Springer ohnediess hinlänglichen Aufschluss gibt.
Im Domschatze von St. Veit in Prag befindet sich ein Jagdhorn aus Elfenbein, auf welchem ein Wagenrennen dargestellt ist-. (Mittelalterl. Kunstdenkmale d. öster. Kaiserstaates von Dr. G. Heider u. Prof. R. v. Eitelberger. Bd. II. S. 127 - 143: „Über den Gebrauch der Hörner im Alterthume und das Vorkommen geschnitzter Elfenbeinhörner im Mittelalter“ von Dr. Fr. Bock.) Dieses „Wagenrennen sammt der Form der Quadrigen, sowie die Gestalten der Greifen und Centauren gegen welche sich Gladiatoren zum Kampfe anschicken, deuten auf direkte antike Vorbilder, während der Charakter des Blattornaments bereits die unverkennbar romanische Form zeigt, so. dass die Arbeit wohl dem 11. Jahrhundert angehören wird.“ (Lübke, Grundriss der Kunstgeschichte 9. Aufl. S. 367.) Mit diesem Urtheil des feinsinnigen Kunsthistorikers Lübke wird sicher jeder übereinstimmen, der sich in die Art und Weise des Kunstschaffens jener Zeit vertieft hat.
Von einem ähnlichen Gesichtspunkte aus sind jedenfalls auch die zwei Elfenbeintafeln in der k. Staatsbibliothek in München zu betrachten, welche in den hinteren Deckel der lateinischen Handschrift No. 23630 eingelassen sind. Wilhelm Mayer, welcher im fahre 1879 im Auftrage der k. bayer. Akademie der Wissenschaften eine Monographie hierüber veröffentlichte (Zwei antike Elfenbeinreliefs der k. Staatsbibliothek in München. München 1879. F. Straub.), hat sie mit Aufwand grossen Scharfsinnes auf antiken Ursprung zurückzuführen gesucht. Aber so viel Achtung ich vor den Ausführungen dieses Gelehrten habe, hierin kann ich ihm doch unmöglich beistimmen, um so weniger, als er diese vermeintliche antik-römische Arbeit in ziemlich frühe Zeit zu setzen geneigt ist. Auf keiner der römischen Elfenbeintafeln ist eine solche Rohheit in der Anordnung der Figuren, auch nur annähernd zu sehen, wie auf der schmäleren der in Rede stehenden Tafeln. (W. Meyer, a. a. O. Tafel III.) Es macht sich hier ein Missverständniss und eine Ungeschicklichkeit in der Raumbehandlung geltend, wie sie nur im Mittelalter zu finden ist. Im Alterthume bis herab zum 7. Jahrhundert war in Italien, von Konstantinopel gar nicht zu reden, eine solche Unbehilflichkeit in Bezug auf die Raumbehandlung ganz undenkbar. Die Nachwirkungen der Werke aus der klassischen Zeit waren noch aller Orten zu lebendig, ja das Studium derselben wurde, wie wir gesehen, noch überall eifrig betrieben und von den Königen, wie z. B. Theoderich, in jeder Weise gefördert, so dass eine solche Arbeit höchstens in Gallien etwa im 6. oder 7. Jahrhundert hätte entstehen können. Dafür aber ist die Technik und sind die Gestalten an sich, vor Allem die Charakteristik der Köpfe wieder viel zu gut. Kurz die beiden Tafeln sind in Anlehnung an antike Vorbilder im Mittelalter entstanden; dies zeigen namentlich die Details. Da steht auf der grösseren Tafel zunächst eine männliche Gestalt in reicher Kleidung, welche in höchst ungeschickter Weise die Trabea nachahmt. Ganz abgesehen von dem Wurfe der einzelnen Stücke, ist das gestickte Ornament, welches aus in Kreise eingeschlossenen Sternen besteht, in so missverstandener Weise angebracht, dass man auf den ersten Blick den Nachahmer erkennt. Der Schnitzer hat, nachdem das Gewand fertig war, den Zirkel angesetzt und die Kreise in der ungenirtesten Weise gleich über mehrere Gewandstücke hingezogen, von der Nichtbeachtung der Falten gar nicht zu reden. Wilh. Meyer meint zwar, dem Künstler sei die Anbringung des Ornamentes noch ungewohnt gewesen. Allein zu der Zeit, in welcher diese reiche Tracht für die Konsuldarstellungen typisch wurde, um die Mitte des 5. Jahrhunderts, stand gerade die Elfenbeinschnitzerei auf einer sehr hohen Stufe, wie ich oben des Weiteren ausgeführt habe. Hinter dieser Gestalt die irgend etwas in dem Mantel trägt, (Meyer hält den Gegenstand für eine Rolle; ein antiker Künstler hätte eine solche sicher nicht so gross gebildet.) wird ein Gegenstand sichtbar, der schwerlich etwas Anderes als die missverstandene Nachbildung eines kurulischen Sessels sein kann. Oberhalb dieses Sessels, aus ihm gleichsam herauswachsend, sieht man endlich eine männliche Figur mit Speer, welche den Kopf stark seitwärts neigt, was wieder nur einer späteren Zeit entspricht. Ähnlich unverstanden und ungeschickt ist die Darstellung der zweiten Tafel. Auf dieser sieht man unten einen Mann in langem Talare, einen Stock in der Rechten; aus ihm herauswachsend befindet sich dann nach oben hin eine Victoria, welche in einem Kranze ein männliches Brustbild über ihrem Kopfe emporhält. Einer solchen Anordnung der Figuren begegnet man auf keinem antiken Elfenbeinrelief. Kurz, die beiden Skulpturen zeigen so viel Anomalien, dass sie der römischen Zeit nicht zugeschrieben werden können. Ich würde sie als das Machwerk eines lombardischen oder fränkischen Elfenbeinschnitzers ansehen, wenn nicht die technische Ausführung und die Charakteristik der Köpfe sowie die Gestalten an sich hie für zu gut wären. Man sieht auf den ersten Blick, der betreffende Elfenbeinschnitzer hat für jede Figur ein antikes Vorbild benützt und daher stammt die relative Schönheit der Gestalten; in ihrer Anordnung aber war er auf sein eigenes Unvermögen angewiesen.
Es lässt sich daher für die Entstehung der betreffenden Reliefs keine bessere Zeit angeben, als das 11. oder 12. Jahrhundert, in welchem sich gerade in der Elfenbeinschnitzerei der Einfluss der Antike wieder geltend zu machen begann. Die betreffenden Elfenbeintafeln stellen sich demnach in eine Reihe mit jenen, welche auf antiker Grundlage entstanden sind. Die wichtigsten dieser interessanten Denkmäler sind die Elfenbeinreliefs an der Kanzel des Doms zu Aachen, von welchen im Folgenden die Rede sein wird.