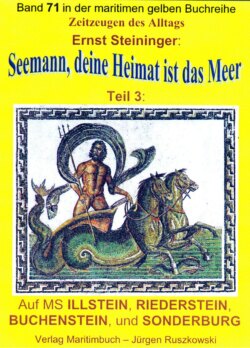Читать книгу Seemann, deine Heimat ist das Meer - Teil 3 - Reisen auf ILLSTEIN, RIEDERSTEIN, BUCHENSTEIN, SONDERBURG - Ernst Steininger - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Motorschiff ILLSTEIN
Оглавление13. Kapitel
Motorschiff ILLSTEIN
Auszug aus dem Seefahrtbuch Nr. 0266, Seite 34/35
Inhaber ist angemustert als Matrose auf MS „ILLSTEIN“
Reeder: Norddeutscher Lloyd
Unterscheidungssignal: DDSG
Br.- Raumgehalt: cbm 4952
Heimathafen: Bremen
Geführt von Kapitän Dietze
Reise: Große Fahrt
Zeit: unbestimmt
1. Einsatz:
Der Dienstantritt erfolgte 21.10.1965
Das Seemannsamt Bremen, den 05. Nov. 1965
Der Inhaber hat
In der Zeit vom 21.10.1965 bis zum 01.07.1966
8 Monate und 12 Tage als Matrose gedient
2. Einsatz:
Der Dienstantritt erfolgte 29.11.1966
Das Seemannsamt Bremen, den 01. Dez. 1966
Der Inhaber hat in der Zeit vom 29.11.1966 bis zum 27.02.1967
3 Monate und 7 Tage als Matrose gedient
Zusätzliche Daten
Entnommen: Seefahrt – Norddeutscher Lloyd – Naxos
MS ILLSTEIN, Bj. 1959; BRT.: 4952;
Zugehörigkeit: bis 1972; ab 1970 Hapag-Lloyd;
1972 verkauft nach Mogadischu. Neuer Name: „MINSHAN“;
1978 verkauft nach China. Neuer Name: „LONSHAN”;
1992 in Lloyds Register noch so verzeichnet.
MS SIEGSTEIN – Schwesterschiff der ILLSTEIN
Nach dem „Eunuchentrip“ – den INNSTEIN-Reisen zu den Großen Seen – sollte mich mein nächstes Schiff unbedingt wieder einmal an liebesfreundlichere Gestade bringen. Demzufolge absolvierte ich vorerst mehrere vierzehntägige Urlaubsvertretungen auf verschiedenen mir nicht genehmen Lloyd-Schiffen, bis mir endlich die ILLSTEIN fürbass kam. Die ILLSTEIN war einer jener kleineren Neubauten, mit denen der Lloyd die zentralamerikanischen Staaten einschließlich Mexiko und den Nordosten Brasiliens bediente. In der Regel konnte es sich ein einfacher Matrose nicht aussuchen, mit welchem Lloyddampfer er auf die Reise gehen würde, denn das bestimmte Herr Pauli, der norddeutsch kühle, unbestechliche Chef des lloydeigenen Heuerbüros. Dass es mir dennoch gelang, Schiffe mit ungeliebten Reisezielen wie die US-Ostküste, US-Golf, die Westküste-Nord oder gar Australien zu vermeiden – das hatte ganz bestimmt nicht mit dem typisch österreichischen „Schmäh“ zu tun – weil ich nun einmal absolut kein Schmähtandler bin, eher ein gerader „Michel“…
Urlaubsvertretung – das war für die, die zu vertreten waren, natürlich eine gute Sache. Meist waren es Fahrensleute, die es nicht allzu weit nach Hause hatten, also von der „Waterkant“ stammten. Aber auch für mich, der ich doch meist völlig abgebrannt aus meinem „verlängerten“ Urlaub an die Küste zurückkehrte, war es eine gute Einrichtung, denn sie brachte mich stets umgehend in Brot und Lohn. Andererseits war mir das Pendeln zwischen Antwerpen, Rotterdam, Bremen und Hamburg ein Graus. Die Hektik in diesen Häfen, die kurzen Seereisen, die langen Revierfahrten und die Animositäten innerhalb solcher „Fremdbesatzungen“ waren nicht dazu angetan, das Seemannsherz zu erfreuen. Außerdem war der Urlaubsvertreter schließlich nur Gast und hatte sich mit der ihm zugewiesenen Unterkunft einfach abzufinden. Das tat er natürlich auch, schließlich saß er sowieso, bildlich gesprochen, die ganze Vertreterzeit auf seinem Seesack. Das besonders Unangenehme aber war, dass man keinen eigentlichen privaten Rückzugsort zur Verfügung hatte, um seine „Batterie“ wieder aufzufüllen. So ist es halt auch nicht verwunderlich, dass so ein quasi „heimatloser“ Janmaat in den genannten Häfen seine karge Freizeit lieber an Land als an Bord verbrachte.
Bei einer solchen Gelegenheit lernte ich auch Hamburg etwas besser kennen. Hamburg!? Na, damit ist natürlich die Gegend um St Pauli gemeint, die „Große Freiheit“ und die sündige Meile der Stadt, die Reeperbahn. Nun ist es aber nicht so, dass diese Ecke Hamburgs für mich gestandenen Seemann Neuland gewesen wäre, nein, ganz bestimmt nicht. War ich doch bereits im Jahre 1956, als eben flügge gewordener Grünschnabel, per Autostopp bis nach Hamburg gelangt. Damals nahm mich ein Polizist, dessen Absichten ich da noch nicht ahnen konnte, unter seine Fittiche. Das kam so: Ich trieb mich in der Speicherstadt herum und beobachtete von einer Brücke aus – offensichtlich sehr interessiert – einen Helmtaucher und seine Gehilfen bei ihrer Arbeit. Der Polizist hingegen, ein Mann um die Vierzig, musste mich anscheinend schon eine Weile im Visier gehabt haben. Jedenfalls war ich nicht wenig überrascht, als ich plötzlich energisch angefasst und vom Geländer der Brücke weg gezerrt wurde. Der gute Mann war der absurden Meinung, dass ich mich in den Kanal stürzen wollte. Sicherlich, ich hatte gerade noch ganze zehn Mark in meiner Hosentasche, und die Jugendherberge, in der ich zu übernachten gedachte, hatte mich kurz vorher wegen Überbelegung abgewiesen. Aber mich deswegen ersäufen? Im Gegenteil: ich war guter Dinge, voller Zuversicht, in Aufbruchstimmung: Was kostet die Welt?!
Der Polizist aber, der mich nötigte, ihm mein Dasein zu erklären, war vorerst misstrauisch und ließ mich nicht einfach laufen, obwohl meine Papiere in Ordnung waren. Doch schleppte er mich auch nicht auf die nächstgelegene Wache, sondern bot mir freundlichst seine Begleitung an. Eigentlich, auch wenn er noch in Uniform sei, habe er bereits dienstfrei, und wenn ich nur möchte, würde er mir ein Stück Hamburg, sein Revier, zeigen. Ich war nicht abgeneigt, zumal er mir versicherte, dass er mir dann auch noch eine Schlafstelle besorgen wolle. Überdies versprach er, mir bei der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit nach Hause behilflich zu sein.
Also überließ ich mich vertrauensselig dem freundlichen Ordnungshüter und hatte es schließlich auch nicht zu bereuen. Der gute Mann lotste mich vorerst am Baumwall entlang, Richtung Landungsbrücken. Er zeigte mir den Einlass zum Elbtunnel, die U-Bahn-Haltestelle, das gewichtige Bismarck-Monument und schließlich und endlich auch noch die Reeperbahn. Er erklärte mir, dass die knapp einen Kilometer lange Straße ihren Namen von den Reepschlägern, den vormaligen Schiffstaudrehern, erhalten hatte. In früheren Tagen, lange bevor aus ihr die „Sündige Meile“ wurde, war die Reeperbahn nichts weiter als ein sich in die Länge ziehender, zugiger Arbeitsplatz. Genau betrachtet ist sie das ja auch noch heutzutage, Schiffstaue aber werden hier nicht mehr produziert. Allerdings – frei von Fallstricken ist die Reeperbahn bis heute nicht. Ich jedoch hatte nichts zu befürchten, darauf achtete schon mein Freund und Helfer, der Polizist. Kraft seiner Begleitung sah ich sogar das eine oder andere Animierlokal kurz von innen. Auch in die wie ein öffentliches Pissoir mit Sichtblenden abgesicherte Herbertstraße ließ er mich hineinlugen. Was ich da so erspähte, die halbnackten Damen, die prallen Schenkel, Pos und Brüste, vorm Anfassen nur geschützt durch eine Schaufensterscheibe, das bewegte meine Fantasie noch lange danach…
Mein Freund bediente nicht nur meine Neugierde. In einer der vielen Eintopf-Buden verpflegte er mich auch noch mit Erbsensuppe und Wiener Würstchen. Die Zeche bezahlte er nicht etwa mit Geld, sondern mit Marken, die er von einem handlichen Papierblock abtrennte. Das fand ich genial. Weniger angetan war ich aber dann von der Art und Weise, wie er mich anschnauzte, weil ich den Senf auf dem Papierteller beim Verzehr der Würstchen etwas unorthodox verteilte. Das gab mir zu denken. Überhaupt irritierte mich sein ganzes Verhalten nicht wenig. Mal gab er sich väterlich jovial, dann wieder herrisch und gereizt. Auch machte es mich stutzig, dass er mir die Davidswache, das wohl bekannteste Polizei-Revier der Welt – und von dem ich annahm, dass es seine Dienststelle sei – mit einer vagen Ausrede vorenthielt. Dennoch ging ich auf seinen Vorschlag ein, ihn nach Hause zu begleiten. Seine Wohnung läge in der Nähe des Bahnhofs Hamburg-Altona, da würde sich auch eine Schlafgelegenheit für mich finden. Allerdings, wie sich dann herausstellte, war die angepeilte Schlafstelle ein Bett in seiner Wohnung. Dies, so erklärte er mir, sei möglich, weil seine Lebensgefährtin gerade verreist sei.
Eigentlich ja ganz plausibel. Der Verdacht, dass mit dem Mann vielleicht doch nicht alles in Ordnung und er eventuell „andersherum“ sein könnte, kam mir erst, als er mich bei Kaffee und Kuchen mit erotischem Gelaber belöffelte. Dieser Versuch aber, mich auf Kommendes vorzubereiten, verpuffte bei mir völlig wirkungslos. Ich brauchte mich gar nicht dumm zu stellen, ich war es einfach. Zwar hatte ich sicher schon von Schwulen und Lesben gehört, aber das war für mich eine Welt, an der ich nicht das geringste Interesse hatte. Kerle wie Hans Albers, in jedem Arm eine „seute Deern“, waren die Vorbilder meiner pubertierenden Seele. Und dann dies: Ich als angehender Seemann, Aspirant eines Berufstandes, der für mich der Inbegriff aufrechten, kernigen Mannsvolks war, sollte mit einem Polizisten ins Bett gehen? Ha, deswegen war ich nicht aus der heimatlichen Enge ausgebrochen, um mich dann in der Fremde so einfach vernaschen zu lassen…
Schließlich wurde die Situation auch meinem Polizisten zu dumm. Jedenfalls begriff er, dass er in mir keinen willigen Lustknaben gefunden hatte. Und er war anständig genug, von mir abzulassen. Zu guter Letzt brachte er mich genau in der Jugendherberge unter, die mich an diesem Tag schon einmal abgewiesen hatte. Vorher noch zeigte er mir innerhalb eines Hafengeländes, in der Nähe des Fischmarktes einen Getreideumschlagplatz, der von Fernlastern aus ganz Deutschland belagert wurde. Ja, zum Abschied beschenkte er mich noch mit ein paar Essenmarken aus seinem praktischen Abreißblock. Es gelang mir am nächsten Tag auch tatsächlich, an dem von ihm bezeichneten Ort einen Fernlaster zu ergattern, der mich bis Passau brachte. Diesen Wohltaten ist es sicher zu verdanken, dass mir der gute Mann bis heute im Gedächtnis geblieben ist.
Soviel zu meinen Hamburg-Erlebnissen aus dem Jahre 1956.
Werftanlage Blom und Voss, Hamburg 1957
Zehn Jahre später hatte sich die Gegend zwischen der Reeperbahn und dem Johannisbollwerk wohl weniger verändert als ich mich selbst. Der Blick des „Eisernen Kanzlers“, der imposanten Bismarckstatue unweit der Landungsbrücken, konnte noch immer ungehindert die andere Seite der Norderelbe kontrollieren. Da mochte sich sein „teutsches“ Gemüt an der beeindruckenden Kabelkrananlage der Stülcken-Werft erfreuen. Da sollten die wie ein deutsches Wahrzeichen in den blauen „Wirtschaftswunderhimmel“ aufragenden Kräne von Blom + Voss, einer der großen Rüstungsschmieden des Reiches, sein „eisernes“ Herz erquicken. Auferstanden aus Ruinen – oder sollte man besser sagen: Auferstanden kraft blutbesudelten Runen-Kapitals...
Hamburg 1960er Jahre
Der Bismarck, St. Michaelis, das „Graue Haus am Meer“ (gemeint ist das für den Seefahrer so unangenehm weithin sichtbare Hafenkrankenhaus), der Kuppelbau über dem Fracht-Lift des Elbtunnels standen also wie eh und je unverändert an ihren angestammten Plätzen.
Ich hingegen hatte mich verändert. Meine Unschuld war perdu! Was nicht heißen soll, dass ich inzwischen schwul geworden wäre, das nicht. Aber ansonsten genoss ich, sofern ich es mir leisten konnte, die sexuelle Freizügigkeit der Hafenstädte schon. Nicht, dass ich für andere Dinge überhaupt kein Interesse mehr gehabt hätte. Aber wie das so ist in einer reinen Männergemeinschaft, der Gruppenzwang und die daraus resultierende Dynamik bestimmten letztlich meistens, wo es lang ging. Oft zog es uns – selbstverständlich nur im „feinen Zwirn“, der damals noch durchaus zur Ausrüstung eines selbstbewussten Matrosen gehörte – ins vornehme Reeperbahn-Tanzlokal „Cafe Keese“. Dieses Etablissement war bekannt für seinen „Ball der einsamen Herzen“. Sozusagen ein heißer Tipp. Die Chancen, im „Keese“ ein einsames lusthungriges Frauenherz zu erobern, waren durchaus reell. Trotzdem gelang es einem der Unsrigen aber nur sehr selten von einer der meist nicht mehr ganz taufrischen Damen abgeschleppt zu werden. Weshalb? Na, Seeleute haben es halt nicht nötig, langatmig zu parlieren. Hinzu kommt noch der schnelle Griff zum Glas. Ein kleines Übermaß an Bier mit Sekt und dann womöglich auch noch Wein ließen die selbsternannten Lords den ursprünglichen Grund ihres Kommens schnell vergessen. Vergessen? Na, eher war es wohl so, dass uns die Damen mehr oder weniger deutlich machten, wir sollten sie vergessen. Besonders Vergessliche unter uns, die oft nicht mehr wussten, wo sie waren, wurden dann wenig sanft von routinierten Rausschmeißern daran erinnert…
So endete der Ausflug ins „Café Keese“ nicht selten in einem ungeordneten, individuellen Rückzug. Der war dann auch vielfach so verschlungen wie die Gangart des jeweiligen Individuums. Den einen zog es in den eher biederen „Silbersack“, den anderen vielleicht in die hinterfotzige „Ritze“. Der Rest versackte ganz schlicht in einer der unzähligen Kaschemmen auf der Großen Freiheit. Für diejenigen, die es noch schafften, war dann die „Washington-Bar“ der Abschluss oder – je nachdem – der Höhepunkt des Landgangs. Diese Bar war so etwas wie die externe Heimat aller gestandenen Lloyd-Fahrer. Hier hausten sie, all die erfahrenen Dirnen, die genau wussten, was ein Seemannsherz im desolaten Zustand am meisten benötigt…
Und das ist nicht nur Sex. Eine in Ehren erblondete Beischläferin könnte doch glatt nach all dem seelischen Ballast, den die „Jungens“ auf ihren mütterlichen Busen abgeladen hatten, ihr Examen als Psycho-Expertin machen. Hanna, die mit dem Holzbein, hatte sich zwar nicht direkt als Psychologin, dafür aber wegen ihres schlagfertigen Mund- und Beinwerks einen Namen gemacht. Sie und ihr Holzbein – das sie notfalls wie einen Baseball-Schläger zu handhaben wusste – waren in Seefahrerkreisen so bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. So mancher Lümmel, der sich nicht zu benehmen wusste, wusste hinterher ein Lied über Hannas Bein „welch Pein, welch Pein“, zu singen…
In diesem trauten „Milljö“ machte ich Hans Ballermanns; (Name geändert), Bekanntschaft. Hans war einer der hässlichsten Kerle, die mir je über den Weg gelaufen waren. Nichts, aber auch gar nichts passte in seiner für sein Gegenüber geradezu beleidigenden Visage zusammen. Besonders abstoßend waren seine oberen Schneidezähne, die sich wie bei einem Biber gelb und mächtig unter der bockwurstförmigen Oberlippe hervor schoben. Darüber steckte eine verknorpelte Nase im breitflächigen Gesicht. Die untere Kieferpartie gemahnte an die Funktion eines Nussknackers, was ihm dann später, an Bord der ILLSTEIN, auch folgerichtig den Spitznamen „Nussknackerface“ einbrachte. Vermutlich war ihm dieser Rufname sogar angenehmer als sein Familienname. Seine flachsfarbenen Haare standen wirr und stachelig in alle Himmelsrichtungen. Kurz gesagt, er hatte die Physiognomie einer Vogelscheuche, ein Alptraum – wenn da, ja wenn da nicht die großen, weit auseinander stehenden, samtbraunen, so wundersam sanft blickenden Augen gewesen wären. Dieser sanfte, warme Blick und die Art seines Sprechens, eine fast singende, sich unmerklich einschmeichelnde Redeweise versöhnten mich immer wieder schnell mit seinem fürs erste so erschreckenden Anblick. Die Gestik, mit der er seine Rede unterstrich, war wohl eindringlich, dabei aber völlig unaufgeregt. Seine Sprache war das akkurateste Hochdeutsch, das ich unter uns gemeinem Volk je vernommen habe. Niemals geschah es, dass sich aus seinem Mund ein unbedachtes, ein zu lautes oder gar unfeines Wort löste. Hans, der Penner, der er war, hatte die Seele eines Heiligen, selbst wenn er sturzbesoffen war, wurde er in keiner Weise ausfällig…
Na, möglicherweise übertreibe ich jetzt ein bisschen. Dass er aber der friedfertigste Mensch war, der mir bislang in meinem schon ziemlich langen Leben begegnet ist, davon nehme ich kein Jota! Wie und warum Hans, der Sohn eines höheren Landesbeamten, zum Penner wurde, darüber ließ es sich trefflich spekulieren. Ich meine halt, dass es sein entstelltes Gesicht war, welches ihn zum Außenseiter stempelte. Derselbe Grund war aber vielleicht auch die Ursache seiner gepflegten Umgangsmanieren. Allein dadurch gelang es ihm, sein abstoßendes Erscheinungsbild erheblich abzumildern.
Hans kannte den Kiez wie seine Westentasche. Das mit der Weste ist natürlich nur bildlich zu verstehen, seine Bekleidung entsprach eher der eines Lumpensammlers. Sein Revier, auf das er mich neugierig gemacht hatte, lag rund um St. Michaelis. In dieser abseits der Reeperbahn gelegenen Ecke gelangte ich dank seiner Begleitung in Spelunken, die ich in Deutschland nicht, nicht einmal in Hamburg, für möglich gehalten hätte. Dunkel erinnere ich mich an spärlich beleuchtete Kellergewölbe, an schemenhafte Gestalten, die sich dicht an dicht stehend oder hockend an einem anscheinend endlosen Tresen festhielten. Anderes, genauso wenig Vertrauen einflößendes Volk belagerte die mit Gläsern und Flaschen voll beladenen Stehtische am Rande des Gewölbes. In den wenigen Sitzgelegenheiten hingen schwer gezeichnete Zecher – wie angeschlagene Boxer in den Seilen. Einige zur Gänze abgestürzte Alkoholleichen krümmten sich auf dem vorsorglich mit Sägespänen bestreuten Stein- oder Ziegelboden…
Instinktiv versuchte ich zu kneifen. Das war mir nun doch eine Nummer zu surreal. Ich sah mich in einen Film zurück versetzt, in dem sich biedere Bürger nach Einbruch der Dunkelheit in Ratten verwandelten, allerdings, ohne dabei ihre menschliche Gestalt einzubüßen. Und, im Gegenteil zu Ballermanns Kellerratten, waren es sehr elegant gekleidete Männlein und Weiblein. Das Anstößige daran war, dass den blütenweißen Stehkragen der schwarzbefrackten Herren menschlich aussehende Rattenköpfe aufgesetzt waren. Ebensolche, jedoch weitaus putzigere Köpfchen, zierten die mit glitzernden, gleißenden Colliers behängten, aber sonst nackten Hälse der Damen. Überhaupt zeigten die Damen – außer anschmiegsamen Fuchs- und Marderpelzen – sehr viel glatte Haut. Auch kamen sie mit dem obligaten Rattenschwanz, den sie vorwiegend wie eine Stola um die blanke Schulter trugen, viel besser zurecht als ihre männlichen Partner…
Ratte, ratte, rette sich wer kann – mein lieber Mann, das ist leichter gesagt als getan! Eine, nein, keine Ratte – eine mausgraue Alte, schwere, trübe Hornbrille auf der ausgetrockneten, verknautschten Nase, hält mir kommentarlos die Bild-Zeitung unter meine lange, feuchte Nase: „Vorlesen!“ Ich lese vor, lese und trinke und versinke, versinke unaufhaltsam in Hans Buhmanns Welt…
Zu Hansens Ehre sei gesagt, er war kein Bettler. Vollmatrose, der er war, verdiente er sich seinen Lebensunterhalt als Gelegenheitsarbeiter im Hafen oder wenn es sich ergab, eben als Urlaubsvertreter auf Hapag- und Lloydschiffen. Er kannte sich und seine Unzuverlässigkeit und mied daher „feste Anstellungen“. Die Vorstellung, eine längere „Durststrecke“, also eine mehrmonatige Seereise auf sich zu nehmen, entsprach nicht seiner Lebensphilosophie. Trotzdem ergab es sich, dass wir zusammen – für „fest“ – auf der ILLSTEIN anheuerten.
Ende Oktober 1965, Auslaufen Hamburg. An dieser Stelle würde ich gern meine ureigensten Originalberichte, die ich gelegentlich so zwischendurch verfasste, mit einfließen lassen. Soll ich? All right – ich wage es…
Zwei Uhr morgens, Auslaufen Hamburg. Die Janmaaten stehen schon klar bei „Leinen los!“ Der letzte Schauermann jumpt noch eben über die Verschanzung. Die Gangway haben wir dem etwas zu säumigen Agentenlehrling bereits unter den Füßen weggezogen. Die Schlepptrossen straffen sich; ab geht die Post. Wer über die Abschiedsgepflogenheiten in der ordinären Frachtschifffahrt im Unklaren sein sollte, dem sei kurz gesagt: Es gibt keine. Kein Ehrensalut, keine Deutschmeisterkapelle oder vielleicht gar einen Shanty-Chor, auch keine Kusshändchen hauchenden Dockschwalben. Selbst die höchst anständigen Ehegattinnen, die des Kapitäns, der Offiziere und Ingenieure, des Funkers und des Chefstewards, haben ihre Männer schon vor Stunden verlassen. Wer lässt sich schon gerne um zwei Uhr morgens an die kühle Nachtluft setzen.
Langsam zieht der Vorderschlepper das Schiff durch den Kaiser-Wilhelm-Hafen. Vorbei an der langen Reihe der Lagerschuppen: Schuppen Nr. 74, Nr. 73, Nr. 72, Nr. 71; hier liegen sie, die Lloyd- und HAPAG-Liner, Bug an Heck, aufgereiht wie die Perlen an einer Gebetsschnur. Mich fröstelt es, meine Laune ist am Tiefpunkt. Die Vorstellung, dass allmächtige Konzernherren die Schiffe samt Fracht und Menschen wie die Perlen einer Gebetsschnur durch ihre gepflegten Hände gleiten lassen, macht mich auch nicht fröhlicher. Im grellen Licht zahlloser Hochkerzen rotieren auf engstem Radius unentwegt schlanke Kräne neuester Bauart. Sie erinnern mich an Geier, deren Schnäbel Hiev um Hiev in den geöffneten Bäuchen der Frachter verschwinden, um ihnen entweder ihre fremdartigen Schätze zu entreißen oder sie mit profanen Kisten, sperrigen Konstruktionen oder Fahrzeugen vollzustopfen.
An Backbord gleißt, zu einem sprühenden Lichtbündel verschmolzen, die bläuliche Flammenglut vieler Schweißaggregate. Pausenloses Gedröhne, Geratter, Gezische: Die Werft – für jeden rechtschaffenen Seemann ein Ort der Verwünschung. Wehe dem Schiff, das notgedrungen in die Hände der Werftarbeiter fällt. Da bleibt kein Auge trocken. Alles, was dem Seemann heilig ist, ist diesen Barbaren völlig wurscht. Überall dort, und nicht nur dort, wo sie zu tun haben, hinterlassen sie „verbrannte Erde“. Die Motormänner stehen tränenden Auges vor ihren einstmals blitzblanken Handrädern und Ventilen, die Reiniger sehen fassungslos auf ihre verölten, verdreckten Flurplatten… Wir Decksbauern schaufeln uns durch Unmengen von Schlacke, abgeblätterten Rost, verkohlte Farbe, durch Berge von Elektroden- und Verpackungsresten… Das Küchenpersonal vermisst den Schlüssel für die Provianträume, dem Steward sind Teller und Tassen abhanden gekommen, und dem Messeboy fehlen Kehrblech, Handfeger und die letzten Rollen Toilettenpapier. Dreck, Lärm, Rauch und Gestank dringen durch alle Ritzen. Eine Werftzeit kann man eigentlich nur im Suff aussitzen. Und wenn die Werft, wie in diesem Fall, Howaldt heißt, dann ist man im „Levermann“, der nächstgelegenen Kneipe, bestens aufgehoben.
Wir, die Achtergang, stehen noch immer wegen des Einholens der Schlepptrosse klar. Im Moment ist sie gespannt wie eine Gitarrenseite, der Schlepper zieht das Heck, natürlich samt Schiff, um das an Steuerbord liegende Kaiser-Wilhelm-Höft herum. „Achterschlepper los!“ schallt es plötzlich aus dem Lautsprecher der Wechselsprechanlage. Im selben Augenblick klatscht auch schon die vom Schlepperkapitän per Slip-Haken gelöste Leine ins Wasser. Mit geübten Griffen werfen wir sofort das in Achterschlingen um einen Doppelpoller liegende schwere Drahtseil los, nachdem wir es mit ein paar Törns ums Spill vor dem Ausrauschen gesichert haben.
Kaum ist die Schleppleine im Wasser, will der Alte – von Statur ein kleiner Mann, dafür aber ein ganz großes Nervenbündel – auch schon wissen: „Ist die Schraube klar?“ – „Nein, Schraube ist noch nicht klar!“ antwortet der Zweite dem Lautsprecher. „Ist die Schraube klar?“ – „Nein, Schraube ist noch nicht klar!“ brüllt der Zweite gereizt in den Lautsprecher hinein. Aber aus diesem schallt es unentwegt, zuerst forsch fordernd, dann zunehmend anklagend und schließlich geradezu winselnd zurück: „Schraube klar, Schraube klar, ist die Schraube klar…“
Inzwischen ziehen wir – in „Gänsemarschaufstellung“, Hand über Hand – das nasse, dreckverschmierte, frisch gelabsalbte Stahlseilende mit Muskelkraft durch den Hafengrund an Deck. So eine Schlepperleine kann ganz schön lang und ganz schön schwer sein; dementsprechend kann es schon einige Minuten länger dauern, bis endlich das Auge unterm Schiffsarsch sichtbar wird.
„Ist die Schraube klar, Schraube klar?“ Das unentwegte Gequake und Gewinsel des Alten raubt dem Zweiten seine sonst mit so viel Nachdruck zur Schau gestellte Gelassenheit. Seiner tadellosen Uniform und seiner feinen Lederhandschuhe nicht achtend, reißt er wie ein wild gewordener Matrose nun ebenfalls an der nicht endenden wollenden Stahltrosse. Zwar könnten wir zum Einholen der Leine auch das eigens dafür gedachte Spill verwenden. Aber unser Bootsmann, ein von der Hunte stammender, schollenflüchtiger Kleinbauer, hat wohl eine angeborene Aversion gegen technische Geräte. Also nutzt er jede Gelegenheit, dem „nümodschen Kram“ eins auszuwischen. Und weil ihm die Übersetzung des Verholspills zu langsam ist, heißt es dann: Nix wie ran, und mit „man tau“ und „noch een“ wird wieder einmal mehr „aleman winscha“ geübt…
Endlich klatscht das mit Mudd behängte Auge an Deck. Der Zweite macht einen Satz in Richtung Lautsprecher, schreit lauthals die befreiende Meldung: „Schleppleine ein, Schraube klar!“ in den Trichter. Aus dem ist noch kurz ein letztes Schniefen des Alten und dann die Stimme des Ersten zu vernehmen: „Genug achtern!“ Damit wären wir eigentlich entlassen, aber wie ich unseren Bootsmann einschätze…
Vielleicht sollte ich noch kurz erklären, warum das möglichst schnelle Einholen der achteren Schleppleine von so großer Wichtigkeit ist. Ohne Umdrehungen der Schraube ist das Schiff praktisch manövrierunfähig. Erst der durch die Umdrehungen erzeugte Druck auf das Ruderblatt macht dieses als Steuerelement wirksam. Aber solange sich besagte Stahltrosse in diesem sensiblen Bereich befindet, ist an eine Benutzung des Eigenantriebs nicht zu denken. Zu groß ist die Gefahr, Ruder wie Schraube, die Achillesferse eines Schiffes, zu beschädigen. Von daher ist die Nervosität so mancher Kapitäne während dieser bangen Momente schon verständlich, weil im stark frequentierten Fahrwasser, im versetzenden Strom und womöglich noch bei schlechter Sicht das Schiff quasi gelähmt ist. Weniger verständlich aber bleibt die sinnlose Antreiberei. Aber unser kleiner Kapitän, dessen unüberhörbares „Sächseln“ hinter seinem Rücken immer wieder zur allgemeinen Heiterkeit beiträgt, hat halt nicht mehr die besten Nerven.
Der Bootsmann entlässt uns natürlich noch nicht – wie richtig ich ihn doch eingeschätzt habe! Erst wenn die Leinen „weggeschossen“ sind, dürften wir die Station verlassen. Purer Unsinn! Die Leinen seefest zu verstauen, hätte bei der langen Revierfahrt die Elbe hinunter auch noch bis morgen Zeit. Aber unser Bäuerlein will halt wieder einmal glänzen. „Gut so“, sagt der Zweite und verzieht sich auf die Brücke, um dem Alten sein Sprüchlein aufzusagen: „Achtern alles klar, Herr Kapitän. Der Bootsmann schießt noch eben die Leinen auf.“ Noch eben! Noch eben mal dies, noch eben mal das – dieser biedere Ausdruck noch biederer Bootsmänner hat selbst schon die friedfertigsten Janmaaten zur Weißglut gebracht. Bedeutet er im Klartext doch nichts anderes, als dass eine aufschiebbare Arbeit unnötiger Weise sofort zu erledigen ist, während eine unumgängliche Schwerarbeit gern zur Nebensache verniedlicht wird.
Inzwischen ist es halb vier geworden. Dem Urteilsvermögen des Ersten, na, wahrscheinlich eher dessen Laune, habe ich es zu verdanken, dass ich wieder einmal mehr Vier-Acht-Wächter bin. Während sich meine Kollegen in ihr Logis verdrücken, um bis zum Arbeitsbeginn noch schnell eine Mütze voll Schlaf zu nehmen, versuche ich noch schnell meine Unterarme mit einer Handvoll Twist von der eklig klebenden, übel riechenden Labsalbe zu befreien. Die Labsalbe, was für ein hübsches Wort, ist ein im „Eigenbau“ vom Bootsmann oder von dessen rechter Hand, dem Kabelgatts-Ede, nach uralten Segelschiffs-Rezepten hergestelltes Drahtseil-Konservierungsmittel. Und je nach Dummheit oder Gehässigkeit dieser „Experten“ ist halt dann die Schmiere auch mit mehr oder weniger Tran und Braunteer vermischt.
Wir passieren Toller Ort. Der Vorderschlepper wird entlassen, der Hafenlotse geht von Bord, die Maschine beginnt zu wummern, das Schiff nimmt Fahrt auf. Während ich mich über die Außentreppen auf den Weg nach oben mache, schweift mein Blick noch einmal kurz zurück. Ein Blick zurück, im Zorn? St. Pauli, der Michel, die Landungsbrücken: Im diffusen Lichte der Stadtbeleuchtung, der aufdringlichen Reklamelichter, erscheint mir auf einmal alles irgendwie abgestanden, säuerlich… Hamburg: Tor zur Welt, Stadt der mächtigen Reeder, Stadt der Wirtschafts- und sonstiger Kapitäne, Stadt der Nutten und Lottls, Verteilungslager bajuwarischer, österreichischer, spanischer, türkischer Seefahrer. Hamburg, du alte … – ach scheiß drauf, Scheiß Hamburg…
Leidlich gesäubert melde ich mich auf der Brücke, um sogleich den Rudergänger abzulösen. Mit der üblichen Redewendung „Ich geh dann mal eben nach unten“ – was soviel heißt wie: Ich tauche bis zum Lotsenwechsel in Brunsbüttelkoog erst einmal ab – macht sich der Alte davon. Der an Bord gebliebene Revierlotse ist sichtlich erleichtert, die „Tratschtante“ los zu sein. Er kann sich nun völlig auf seine Arbeit konzentrieren. Sachlich, im ruhigen Ton, gibt er seine Anweisungen an den Rudergänger und an den am Maschinentelegrafen stehenden Offizier. Sie sind schon eine Klasse für sich, diese Revierlotsen. Immerzu mit heiklen Situationen konfrontiert, wirken die meisten von ihnen doch ruhig und gelassen. Ob auf der Elbe, der Weser oder der Schelde, ob auf der Themse, der Seine oder dem Mississippi – ganz egal, auf welchen Revieren auch immer – ihr Beruf verlangt ihnen diese spezifischen Eigenschaften einfach ab: Übersicht, Durchsetzungsvermögen, Entschlossenheit und nicht zuletzt Gelassenheit. Dennoch kann auch der beste Lotse dem Kapitän die Verantwortung nicht abnehmen. Und deshalb wird unser hochgradig nervöser Käpt`n Dietze beim leisesten Furz der Maschine oder nach einer nur etwas zu heftig durchgeführten Kursänderung sofort wieder, wie weiland Rumpelstilzchen, auf der Brücke herumspringen.
Das mache ich jetzt auch. Ich springe zurück in die Gegenwart, um mich aber sogleich wieder von den Erinnerungen an Kapitän Dietze, Hans Ballermann, Rosaria und Paule gefangen nehmen zu lassen. Falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte: Das Reiseziel war die Westküste Zentralamerikas. Die Überfahrt bis zum Panama-Kanal verlief für die Jahreszeit – Oktober / November – ganz normal. Das heißt, bis weit über die Azoren hinaus hatten wir das übliche nordatlantische Schweinewetter.
nordatlantische Schweinewetter
Ein Foto, das ich von der Nock aus „geschossen“ habe; lässt erahnen, mit welcher Wucht und Gewalt die See auf ein Schiff einschlagen kann. Offensichtlich konnte ich mich im letzten Moment noch in die Brücke hinein retten, weil es sonst zumindest dieses Foto nicht gäbe. Bei längerem Betrachten des Bildes bekomme ich nachträglich noch weiche Knie! Dass das Schiff diesen „Kaventsmann“ überstand, das war wohl mehr Glück als Seemanns-Verstand…
Zu Hans Ballermann (Name geändert), von dessen Anwesenheit ich mir geistige Anregung versprach, hatte ich während der ganzen Reise kaum Kontakt. Gerade, dass wir uns bei der Wachablöse – er war Null-Vier-Wächter – begegneten. Das änderte sich auch dann nicht, als das Wetter besser wurde und das Arbeiten an Deck wieder zuließ. Denn nun ging es ums Geldverdienen, sprich: Überstundenkloppen! Und das nicht nur im übertragenen Sinn. Herr Schwertfisch, (Name geändert), erster Offizier und ein Mann mit der Statur eines Hufschmiedes, war der damals noch durchaus gängigen Meinung, dass die Masten und Schotten der ILLSTEIN von ihrem dicken Farbanstrich befreit werden sollten. Teure Farbe, oft genug überflüssigerweise, dafür aber Reise für Reise, also wenigstens vierteljährlich, übers ganze Schiff verteilte, fachmännisch verarbeitete Farbe sollte also partiell entfernt – und dann wieder neu aufgetragen werden. Immerhin gelang es auf diese Weise, das stetige Anwachsen der „Farbenringe“ zu unterbrechen. Nach meinem Verständnis schlicht ein Schildbürgerstreich, den ich aber schlecht unserem sächsischen Kapitän anlasten konnte. Diese Art der Ressourcenverschleuderung war in der „Nachkriegs-Blütezeit“ der deutschen Seefahrt allgemein üblich. Beim Lloyd wurzelte es sozusagen im System: Kein Kapitän, kein Erster konnte es sich leisten, mit einem ungepflegten Schiff in das Visier eines Lloyd-Inspektors zu geraten. Schließlich hing von dem sein Weiterkommen ab. Aber selbst wenn sie sich das nur eingebildet haben sollten, es lag nun einmal in der Natur der Sache, dass der eine Kapitänsanwärter dem anderen vorgezogen werden wollte. Und so waren unisono alle ersten Offiziere bemüht, dass ihr jeweiliges Schiff bei der Ankunft in Bremen wie ein frisch gewienertes Osterei glänzte.
Schwertfisch war nicht mehr der Jüngste. Möglicherweise war er bei der einen oder anderen Beförderungswelle schon mal übersehen worden. Wie dem auch sei und was auch immer der wahre Grund dafür sein mochte: Er ließ „Farbe kloppen“. Das bedeutete, dass fast die gesamte Deckscrew, mit handlichen Kugelhämmern ausgestattet, von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends auf die ausgesuchten Objekte losgelassen wurde. Das waren in der Regel zumeist der Schornstein, die Masten, Lüfter etc. Um die Farbe abplatzen zu lassen, bedurfte es schon ziemlich kräftiger Schläge, die mitunter etwas zu kräftig ausfielen – z. B. auf die nicht ganz so dickwandigen Schutzbleche der Lüfterköpfe. Das wiederum war nicht in des Schwertfisches Sinne und zog für denjenigen, der so seine Unwilligkeit am wehrlosen Metall demonstrierte, eine kurze Aussprache mit dem Ersten nach sich. Die fand dann an einer nicht einsehbaren Stelle des Kapitänsdecks statt. Obwohl sich die Delinquenten nur sehr vage über die Art der Aussprache ausließen, wurde es doch ruchbar: Der Mann wurde handgreiflich. Eigenartigerweise schadete das dem Ansehen des an sich wortkargen Mannes nicht, im Gegenteil! Auch Hans Ballermann, der wiederholt zu einer dieser wortkargen Aussprachen zitiert wurde – allerdings nicht wegen mutwilliger Sachbeschädigung – beschwerte sich hinterher nicht nur nicht, sonder meinte nur lapidar, dass diese Art der Aussprache allemal besser sei als eine Tagebucheintragung…
Na, und so vergingen die Tage bis zur Panamakanal-Passage in kurzweiliger Eintönigkeit. Halb vier: „Reise, reise, raus aus der Scheiße“, Seewache bis acht Uhr. Halb neun: Werkzeugsausgabe durch den Kabelgatts-Ede und hurtig, mit neu gestieltem Kugelhammer, frisch geschliffenem Winkelroststecher und verknautschter Plastik-Schutzbrille, hinauf auf den mir zugeteilten Pfahlmast. Nach der einstündigen Mittagspause, in der die Mahlzeit möglichst schnell hinuntergewürgt wird, damit noch Zeit für ein Nickerchen im Freien bleibt, wiederholt sich dieselbe Prozedur bis zum „Koffiteim“. Nach der Kaffeepause (15:00 h bis 15:20 h) vertausche ich erst einmal den Hammer gegen Pinsel und Rostschutzfarbe, um den allgegenwärtigen, lüstern lauernden Rostbazillen mit bleihaltiger Mennige den Appetit zu verderben. Für diese wichtige Arbeit bleibt mir bis 17:30 h Zeit. Dann aber ist es schon wieder höchste Zeit, notdürftig gesäubert das Abendbrot hinunter zu schlingen und pünktlich um 18:00 h auf der Brücke zum Wachtörn zu sein. Zwanzig Uhr: Endlich Feierabend! Summa summarum war dann unsereins, abgesehen von dem kurzen Mittagsnickerchen, sechzehn Stunden auf den Beinen. Bei einem achtstündigen Arbeitstag ergab das dann aber keineswegs auch acht Überstunden. Oh nein, nach Abzug der Essenspausen waren es – nach Adam Ries und dem Manteltarif – nur noch deren sechs hart erworbene Überstunden. Aber immerhin, die Vier/Acht-Wächter scheffelten so – im Vergleich zu den anderen Wachen – die meisten Überstunden. Na und? Was heißt da, na und! Schließlich waren es die Überstunden, die den Kohl, sprich: die im Grunde jämmerliche Heuer, etwas fetter machten. So viel nur zum Farbe- und Überstundenkloppen…
Themenwechsel: Die Westküste Zentralamerikas erstreckt sich vom Golf von Darién (Panama) bis zum Isthmus von Tehuantepec (Mexiko). Insgesamt drei ILLSTEIN-Reisen führten mich an diesen Küstenabschnitt. Und sicherlich haben wir auch alle wichtigen Häfen der anliegenden Bananenstaaten der Reihe nach angelaufen. Leider will es mir in diesem Fall nicht mehr so recht gelingen, die sich daran knüpfenden Erinnerungen auf die Reihe zu kriegen.
An der Pazifikküste Panamas hatten wir anscheinend gar nichts verloren, oder aber es gab dort nichts zu holen. Jedenfalls ist mir da nicht ein einziger prägnanter Hafenname in Erinnerung geblieben. Auch der zur Hilfe genommene Atlas bringt mich da nicht weiter. Oder doch? Bei dem Wort Golfito, einem Hafen im Golfo Dulce – mein Gott, gleich schmelze ich hin! – blitzt in meinem Langzeitgedächtnis ein schwacher Funke auf; mehr aber nicht, leider…
Golfito ist der südlichste Pazifik-Hafen Costa Ricas. Costa Rica y Castillo de Oro, reiche Küste und goldene Burg, taufte 1502 der vom Goldwahn benebelte Columbus die karibische Landseite. Die ihm nachfolgenden Konquistadoren mussten aber schon sehr früh feststellen, dass der Entdecker Westindiens einmal mehr gewaltig geflunkert hatte. Die goldenen Burgen erwiesen sich als schroffe Berge, und das davor ausgebreitete Tiefland gab nichts her – außer wild wachsenden Bananen und außer einfältigen, zu ihrem Verderben viel zu leichtgläubigen Eingeborenen. Deshalb aber Costa Rica als einen Bananenstaat zu bezeichnen, ist schlicht gesagt eine dümmliche Frechheit. Seit das Land 1821 das spanische Joch abgeschüttelt hatte, gab es nur noch zwei kurze Perioden der Gewalt, die die Demokratisierung des Landes beeinträchtigten. (Wikipedia)
Schließlich wird dieses Land wohl nicht umsonst die Schweiz Mittelamerikas geheißen. Die Schweiz? Das könnte natürlich auch ein dezenter Hinweis auf unauffällige Geldwäsche sein. Aber nein, sicher sind damit unter anderem die hohen Berge gemeint. Zum Beispiel überragt der 3.820 m hohe Chirripo Grande zwar nicht das Matterhorn, dafür aber um ganze 22 Meter Österreichs stolzen Großglockner. Auch das angenehme Hochland-Klima im Inneren des Landes und die fast ausschließlich „weiße“ Bevölkerung müssen für diesen Vergleich herhalten. Vor allem aber ist damit die aktive, unbewaffnete Neutralität Costa Ricas gemeint. Am 8. Mai 1949 schaffte Präsident José Figueres Ferrer per Verfassungsbeschluss die Armee ab. Pikanterweise war besagter Präsident erst durch einen zwei Monate währenden Bürgerkrieg an die Macht gekommen, an dem er selbst nicht ganz unschuldig war. Spätestens an dieser Stelle, der Abschaffung der Armee, wird doch ein erheblicher Unterschied zur Schweiz deutlich. Übrigens, die dadurch frei gewordenen Gelder kommen seitdem dem Bildungs- und Gesundheitswesen zugute. In keinem Land Lateinamerikas außer Kuba gibt es weniger Analphabeten…
Bei der Erinnerung an den Namen Puntarenas, damals der wichtigste Kaffee-Verladehafen Costa Ricas, blitzen die Neuronen in meinem Langzeitgedächtnis schon etwas häufiger, aber noch immer nicht häufig genug. Also flüchte ich noch einmal ins Allgemeinwissen und stelle fest: Die Kaffeebohne ist längst nicht mehr die Nummer Eins des costaricanischen Exports, sondern – die Banane. Und weil die am besten im östlichen Tiefland gedeiht, ist nur folgerichtig, dass das an der Karibikküste liegende Puerto Lemon inzwischen der wichtigste Hafen des Landes ist. Über diesen Hafen wüsste ich schon einiges mehr zu berichten. Jedoch gehören diese Erlebnisse zu einem anderen Schiff und in eine andere Zeit…
Auf der Rückreise waren die Kaffeebohnen, das „grüne Gold“, immer der mit Abstand größte Posten an Ladung. Angeliefert und verladen wurden sie in ganz gewöhnlichen Jutesäcken, die aber immerhin ein ganz schönes Gewicht hatten. Außerdem waren diese Säcke nur schwer zu fassen, denn selbstverständlich verbot es sich von selbst, sie mittels eines handlichen Stauhakens im Laderaum zu stauen. Zwar ist das „Stauen“ nicht unbedingt Matrosenarbeit, aber verschont blieben wir davon dennoch nicht. Immer wieder einmal gefiel es einem der obergescheiten „Supercargos“ – das sind bestellte Ladungsexperten – das Schiff vom Volldecker zum Schelterdecker zu deklarieren. Das ist lediglich ein Vermessungstrick und dient dazu, den Raumgehalt des Schiffes abgabengünstig zu verändern. Warum das den Experten immer erst einfiel, wenn das Schiff bereits so gut wie abgeladen war, das entzieht sich dem Sachverstand eines simplen Matrosen. Dafür aber durften wir die Zugänge zu den Ablaufventilen im Zwischendeck, die ja schon eingestaut waren, Sack um Sack wieder frei räumen. Solch schweißtreibende Arbeiten, mit einem quakenden, quiekenden Kapitän und einem „Schwertfisch“ im Rücken, solche Höhepunkte unnötiger Schinderei vergisst man auch nach Jahrzehnten nicht. Übrigens: Hans Ballermann war da schon nicht mehr mit von der Partie – er war irgendwo ganz schlicht abhanden gekommen. Tatsache ist, dass es nicht die Kaffeesäcke waren, sondern eher die „leichten Mädchen“, die nicht immer nur sanften, aber sonst ach so hingebungsvollen Latinas, die mich an diese Küste zogen. Na, da sollte mir dazu doch auch etwas einfallen. Da war doch noch was…
Da war… Nein, es war, es war wahrscheinlich ein Sonn- oder Feiertag. Die Sonne stand schon wieder sehr hoch, als wir uns, Hans und ich und ein paar andere Janmaaten noch immer im Innenhof der ach so gastlichen „Ranch“ aufhielten, die uns die vergangene Nacht über beherbergte. Möglicherweise hatten wir ja wirklich einen korrekt beglaubigten „freien Tag“. Wahrscheinlicher aber ist, dass wir uns den „freien Tag“, der uns nach der so gut wie schlaflosen Nacht zur Erholung nötig schien, einfach selbst verordnet hatten. Die Ranch war natürlich kein nobler Pferdehof, aber irgendwie hatte sie doch etwas von einem „Gestüt“. Die in sich geschlossene Anlage bot dem Seemann alles, was sein Herz begehrte. Das war im Grunde nicht viel: Wein, Weib, Gesang… Na ja, Gesang musste nicht unbedingt sein…
Was unbedingt sein musste, war eine Bar mit einem mehr oder weniger langen Tresen, hinter dem sich wie auf einem Laufsteg die kulleräugigen Schönheiten darboten. Und so nach und nach kam ein jeder unter Dach und Fach. Das „Dach“ war eine mit ein paar schnellen Schritten über den Innenhof erreichbare Kemenate. Das „Fach“ eine verhältnismäßig breite „Werkbank“, wie Hein Seemann das Lotterbett zu bezeichnen pflegte. Und, und das ist wirklich betonenswert, die Putas waren in der Regel lieb und treu, ja oft genug treuer, als so manch einem von uns lieb sein mochte. Während der kurzweiligen Nacht, davon darf man ausgehen, gab es wohl reichlich von all dem, was das Seemannsherz halt so erfreut. Und weil es so schön und so lustig und ganz sicher auch noch jede Menge Alkohol im Blut war, blieben Hans und ich vernünftigerweise eben da. Auf der Veranda gemütlich in Rohrstühlen sitzend, vor drohendem Sonnenstich sicher durch ein dichtes Palmenblätterdach geschützt, ließen wir träge Beine und Seele baumeln. Aufmerksame, eifrige Bedienerinnen sorgten dafür, dass auch stets frisches Eis im stets nachgefüllten Glas zischte. Eine vielleicht etwas Übereifrige überraschte uns mit einer ganz besonderen Art von Bedienung: Kurz entschlossen entblößte sie eine ihrer prallen Brüste, nahm sie, die Brust, zwischen ihre Hände und drückte und spritzte einen Strahl Milch zielgerecht in meinen Drink. Fröhlich lachend taufte sie diese mir noch neue Kreation Cuba libre con leche! Um es gleich zu sagen, in diesem pikanten Fall erwies ich mich, ich, der doch allem Neuen gegenüber stets aufgeschlossen war, als stockkonservativer Trinker und verlangte, trotz hübschester An- und Aussicht, nach dem traditionellen Cuba libre con lemon…
Ein anderes Erlebnis: Allerdings kann ich weder von dem eben geschilderten noch von dem zu schildernden mit Sicherheit behaupten, ob es sich im costaricanischen Puntarenas oder im nicaraguanischen Corinto abgespielt hat. Eigentlich ist es ja e wurscht. Nun ist es aber so, dass die doch sehr unterschiedliche Qualität der zugrunde liegenden Ereignisse Rückschlüsse auf die Verhältnisse der angesprochenen Städte zulässt, und das ist dann vielleicht doch wieder nicht ganz so wurscht. Ich denke, der Film, den ich gerade in meinem Kopf ankurble, scheint sich eher in Corinto abzuspielen.
Vor meinem inneren Auge entsteht eine düstere, nur spärlich mit künstlichem Licht ausgeleuchtete, gespenstisch anmutende Welt. Im Vordergrund, bis an die Hafenmole reichend, breitet sich ein Rangierbahnhof aus, auf dem zusammengekoppelte Güterwaggons in langen Reihen wie kopf- und schwanzlose Blechschlangen herumstehen. Im Hintergrund, vor nur noch schwach erkennbarer Bergsilhouette, unter nur noch schwach fluoreszierenden Federwolken, liegt vermutlich das „Zentrum“. Genau da will ich hin. Ich bin spät dran und solo – und jetzt sehe ich mich auch noch massiv daran gehindert, mein Vorhaben zügig auszuführen: Eine dieser Blechschlangen versperrt mir den Weg. Weil ich mir nicht sicher bin, ob die Schlange nicht etwa doch einen fauchenden, rußenden Kopf hat, wage ich es vorerst nicht, die Blockade einfach zu unterkriechen. Die üppig mit Disteln und Dornen ausgestattete Vegetation links und rechts des Teerstranges, der den Namen Straße nur seiner Konkurrenzlosigkeit verdankt, zwingt mich zum Handeln: Entweder – oder…
Immer wiederkehrende Rangier-Blockaden verleiden mir den Weg ins „Zentrum“, von dem ich eh schon gar nicht mehr glaube, dass es ein solches überhaupt gibt. Inzwischen scheint mir das weitere Vordringen sowieso nicht mehr nötig zu sein. Beidseitig der Zufahrtsstraße, aber auch direkt im Bahngelände, neben den Gleissträngen, stehen vereinzelt oder sich gegenseitig stützend hölzerne oder aus Ziegelresten zusammengeflickte Bruchbuden. Mit bunten Lämpchen und lärmender Musik-Box werben sie um die in dieser trostlosen Einöde umherirrenden Nachtschwärmer. Im Licht einer Straßenlaterne glaube ich ein mir wohlbekanntes Gesicht zu sehen. Ja doch, es ist der Moses! Spuckend, rotzend, wie ein Rohrspatz schimpfend kommt er auf mich zu. Er ist so mit sich beschäftigt, dass er mich kaum wahrnimmt. Ich stelle ihn zur Rede und frage teilnahmsvoll: „Na, Moses, was ist los mit dir? Hast du etwa was Falsches in den Hals gekriegt?“ Der Bursche, vielleicht gerade sechzehn Jahre alt, sieht mich anstelle einer Antwort trotzig, ja fast zornig an. Dann bricht es aus ihm heraus: „Pfui Teufel, so eine Scheiße! Diese alten Lügner! So ein verlogener Mist, das nun soll das Tollste sein, das man einer Frau antun kann?“ Dabei rubbelt er intensiv mit dem Zeigefinger über seine Lippen und die zum Spucken vorgestreckte Zunge, so als wolle er sie von irgendwas befreien. Ah, nun kapiere ich: Irgendjemand hatte ihn dazu gebracht, das zu tun, was unter Janmaaten „In den Keller steigen“ genannt wird. Und weil das „In den Keller steigen“ oft genug in geselliger Saufrunde als das „Non plus Ultra“ sexuellen Abenteuers geschildert wurde, musste man es auch mindestens einmal gemacht haben, um mitreden zu können …
Ich versuche ihn zu besänftigen: „So was bringt einen Seemann doch nicht um!“ Und wenn ihm schon einige Härchen im Rachen hängen geblieben sein sollten, dann sollte er nicht wie ein Lama in der Gegend herumspucken, sondern sich lieber schnell noch ein Bier in den Hals kippen. Mitfühlend klopfe ich ihm auf die Schulter und ermuntere ihn, mich in die nächstgelegene Pinte zu begleiten. Aber sein momentaner Widerwille gegen die ganze Matrosen-Zunft, mich eingeschlossen, ist offensichtlich stärker; immer noch zutiefst beleidigt, trollt er sich spuckend von dannen…
Ob ich in dieser Nacht noch bis ins Zentrum der Lustbarkeiten gelangte, das weiß nur mein Schutzengel, und der ist nicht sehr redselig (wahrscheinlich weil er genau weiß, dass es wenig Sinn hat, mir ins Gewissen zu reden). Jedenfalls war ich am Morgen zum Arbeitsbeginn wieder an Bord, wenn auch in leicht lädiertem Zustand. Hans Ballermann aber fehlte – als einziger. Er fehlte auch noch, als wir am späten Nachmittag damit begannen, das Schiff wieder seeklar zu machen. Ich machte mir Sorgen um ihn. Der Hafen lag im Herrschaftsbereich des berüchtigten Somoza-Regimes. Es hieß, dessen „Fänger“ gingen mit achteraus gesegelten, mittellosen Seeleuten nicht besonders fürsorglich um. Also ging ich zum Ersten und machte mich erbötig, noch eben mal nach Hans Ballermann sehen zu dürfen. Schwertfisch sah mich an, als ob er mich gleich im Ganzen verschlingen wollte: „Sie, Sie ganz bestimmt nicht!“ zischte er – und beorderte die doofe „Oase“, den allgemein als Arschkriecher betitelten Offiziersanwärter, mit der Suche nach Hans. Hans zu finden, war dann auch nicht allzu schwer, angeblich lag er vor der erstbesten Kneipe im Staub. Und danach sah er auch aus, als er völlig abgerissen im Schlepptau des OA die Gangway herauf torkelte. Ein Bild des Jammers! Ich schämte mich für ihn, schämte mich meiner Freundschaft zu ihm und wandte mich feige ab. Später dann, auf See, nahm sich Schwertfisch in seiner bewährten Art den inzwischen ausgenüchterten Ballermann zur Brust. Darauf angesprochen, erklärte uns Hans, dass er die Abreibung ja verdient habe und dass ihm so eine unbürokratische Abmahnung lieber sei als Tagebucheintragungen und Geldstrafen. Außerdem vertraute er mir noch an, dass es nicht die Faustschläge des Ersten waren, die sein Ego verletzten, sondern, dass er ausgerechnet von der dämlichen Oase aufgespürt und abgeführt wurde…
Nikaragua: Der Name dieses „Bananenstaates“ geht wohl auf den toltekischen Kaziken Nicarao zurück. Dieser Kazike, so erfahre ich durch Wikipedia, versuchte vorerst mit dem europäischen Räuberpack, das Columbus nachfolgte, im Guten auszukommen. Der Goldgier und der christlich verbrämten Menschenverachtung der königlich-spanischen Mord-AG hielt aber auch diese Strategie nicht lange stand. Die indigenen Völker Nicaraguas wurden alsbald versklavt und als Arbeitstiere in die Silberminen Perus verschleppt. Der Mönch Bartolomé de las Casas, sozusagen das unfreiwillige historische Gewissen der Konquistadoren, schrieb 1552: „Im gesamten Nicaragua dürften heute 4.000 bis 5.000 Einwohner leben, früher war es eine der am dichtesten bevölkerten Provinzen der (spanischen?) Welt“.
Das Wappen Nicaraguas zieren fünf wie Reihenhäuser aneinander gefügte Vulkane. Über diesen gleichförmigen Zuckerhüten schwebt, gleichsam wie der „Heilige Geist“, eine rote Jakobinermütze. Ob diese Mütze, die der französischen „Briefmarken-Marianne“ so hübsch steht, stilisierter Ausdruck einer permanenten Revolution sein soll? Eher nicht. Eher war sie das Freiheits-Symbol des Generalkapitanats Guatemala, zu dem auch Nicaragua gehörte und das sich am 15. September 1821 von Spanien lossagte. Die daraus entstehende Konföderation „Vereinigte Provinzen von Zentralamerika“ hielt nicht lange vor, und seitdem wurschtelt jede dieser ehemaligen Provinzen als Kleinstaat vor sich hin. Innerhalb der einzelnen Staaten kämpften (und kämpfen) dann jeweils die Eliten aus konservativen und liberalen Kreisen um die Macht.
In Nicaragua rissen 1909 – mit tätiger Hilfe der USA – die Konservativen mit einem Putsch die Macht an sich. Der Preis für die nicht ganz uneigennützige Hilfe der Nordamerikaner war der Ausverkauf des Landes. Fortan kontrollierten US-Gesellschaften den Bergbau, die Eisenbahn, die Banken und das Zollwesen. 1926 nahm der legendäre Freiheitskämpfer Sandino mit vorerst nur dreißig Mann den Kampf gegen die US-Besatzungsmacht auf. Mit Erfolg: Sandinos stetig anwachsende Guerilla setzten den Yankies so zu, dass sie 1933 entnervt das Land verließen. Daraufhin legten die Sandinos ihre Waffen nieder – ein folgenschwerer Fehler! Denn das war die Stunde Anastasio Somozas, der natürlich gar nicht daran dachte, seine von den Amerikanern bezahlte und geschulte Nationalgarde vertragsgemäß ebenfalls zu entwaffnen. 1934, nach der programmgemäßen Ermordung Sandinos, war der Weg frei für die vierzig Jahre währende Diktatur des Somoza-Clans. Aber so wie sich die Somoza-Diktatur wie Mehltau über das Land ausbreitete, so gärte Sandinos Vermächtnis, wie der Geist in der Flasche, im mundtot gemachten Volk. Aber ich will nicht vorgreifen… So viel noch, ich zitiere: Am 17. Juli 1979 verließ Somoza unter Mitnahme der Staatskasse und der Särge seines Vaters und Bruders das Land und setzte sich nach Miami ab. Nicaragua war befreit. Der Befreiungskampf hatte mehr als 50.000 Nicagaruaner das Leben gekostet und hinterließ ein weitgehend zerstörtes Land.
(http.//www.globales-lernen.de/Nicaragua/nicaragua/geschichte.htm)
Dass sich die US-Politik so sehr für Nicaragua interessierte, lag nicht zuletzt an der natürlichen Wasserstraße zwischen der Karibik und dem Nicaragua-See, da sie sich als mögliche Alternative zum Panama-Kanal geradezu anbot. Sogar die Spanier liebäugelten bereits mit dieser Möglichkeit. Ich zitiere: Bereits 1539 entdeckte Diego Machuca den Rio San Juan als Wasserstraße zwischen der Karibik und dem Nicaragua-See. 1551 äußerte sich bereits der spanische Chronist Francisco López de Gómara: „Man fasse nur den festen Entschluss, die Durchfahrt auszuführen, und sie kann ausgeführt werden. Sobald es am Willen nicht fehlt, wird es auch nicht an Mitteln fehlen.“ Doch der spanische König Felipe II. sah in der Landbrücke zwischen den beiden Meeren Gottes Schöpfung, und an der wollte er nicht rütteln… (http://de.wikipedia.Org/wiki Nicaragua)
Ach, hätten die spanischen Könige nicht auch im Menschen Gottes Schöpfung erkennen können? Aber auf diesem Auge waren sie wohl blind oder – und das erscheint mir eigentlich noch glaubhafter – ein Gott, der in seiner unermesslichen Gnade Spitzbuben, Mörder und Henker als Potentaten auf seine Erbthrone hievt, der muss wohl ganz und gar mit Blindheit geschlagen sein…
Bei der Recherche zu diesem Bericht stieß ich – wiederum dank Wikipedia – auch auf ein pikantes Detail der Kanonenbootpolitik des längst verflossenen deutschen Kaiserreiches.
Zitat: Bei der Eisenstuck-Affäre 1876 – 1878 handelte es sich um eine diplomatisch–militärische Auseinandersetzung zwischen dem Deutschen Reich und der Republik Nicaragua. Sie war verbunden mit der größten Operation, die die Kaiserliche Marine im ausgehenden 19. Jahrhundert in Mittelamerika durchgeführt hat. Sie fand sowohl an der Pazifik- als auch an der Atlantikküste statt.
Worum es dabei ging? Um nichts Geringeres als um die Ehre des Herrn Honorarkonsuls Eisenstuck. Die Stieftochter dieses honorigen Herrn lag in jenen Jahren in Scheidung von ihrem nicaraguanischen Ehegespons und hatte sich wohl wieder in die väterliche Obhut zurück geflüchtet. Der verlassene Ehemann, offensichtlich ein Heißsporn, nahm ihr das übel. Da er aber der Dame seines Herzens – bzw. seines Hasses – nicht so ohne weiteres wieder habhaft wurde, wurde er tätlich. Zuerst schoss er – nicht auf die Dame, sondern auf den Konsul, den er aber verfehlte. Der eifersüchtige oder vielleicht auch nur in seinem Stolz gekränkte, aber sicher sehr einflussreiche Patron ließ jedoch nicht locker. Beim zweiten Anschlag bediente er sich gedungener Polizeisoldaten, die den bedauernswerten Vertreter deutscher Interessen zuerst auf offener Straße böse verprügelten und hinterher auch noch verhafteten. Das Gericht hob die Verhaftung zwar sofort wieder auf, vertrat aber sonst die Meinung, dass es sich bei dem Vorfall lediglich um eine Familienfehde handle. Es empfahl dem Herrn Eisenstuck, den Weg der Privatklage einzuschlagen.
Diese lapidare öffentliche Reaktion Nicaraguas war aber ganz und gar nicht im Sinne einer beleidigten Nation, zumal die sich gerade anschickte, als junge Großmacht auf internationalem Parkett mitzumischen. Das Deutsche Reich verlangte Satisfaktion: Bestrafung der Täter, 30.000 $ Schmerzensgeld und ein Flaggensalut der nicaraguanischen Soldaten. Diese Forderungen stießen in Managua allerdings auf taube Ohren; sie wurden einfach ignoriert…
Das wiederum wollte und konnte sich Berlin nicht bieten lassen. Also, was tun in so einem Fall, wenn die Diplomatie versagt? Man – man ist immerhin deutscher Kaiser, wenn auch von Bismarcks Gnaden – greift zum Schwert und lässt die „Kanonenboote“ von der Leine. Gleich vier Schiffe der kaiserlichen Admiralität, die sich in jenen Tagen „Flagge zeigend“ auf den Weltmeeren herumtrieben, wurden vor die Küsten Nicaraguas detachiert. Aus den Weiten des Pazifiks herbeieilend, trafen sich die Korvetten SMS „LEIPZIG“, SMS „ARIADNE“ und SMS „ELISABETH“ vor der Westküste Nicaraguas, um das kleine unscheinbare Hafenstädtchen Corinto, „Breitseite zeigend“, zu bedrohen. Das in Westindien herumschippernde Kadettenschulschiff SMS „MEDUSA“ traf zwischen dem 17. und 18. März 1877 vor der Ostküste Nicaraguas ein. Die Republik Nicaragua sah sich also plötzlich von beiden Seeseiten bedroht und – lachte sich ins Fäustchen, als sie gewahr wurde, dass die kaiserlichen Kriegsschiffe für Landungsoperationen gar nicht ausgerüstet waren. Dennoch beugte sie sich dann doch klugerweise der Kanonenbootspolitik des aufstrebenden Deutschen Reiches und erfüllte die gestellten Bedingungen. Das war sicherlich auch ganz im Sinne des Herrn Konsul Eisenstuck – aber dass seine Stieftochter, derer Ehestreitigkeiten die ganze Kanonenboot-Affäre ja erst ausgelöst hatte, nach all der Aufregung, so als ob gar nichts gewesen wäre, wieder zurück in die Arme ihres Gatten eilte, ob das auch in seinem Sinne war – das darf bezweifelt werden…
Im letzten Viertel des neunzehnten Jahrhunderts wusste es der Rest der Welt noch nicht, dass er am „deutschen Wesen“ genesen sollte – ja, potz Blitz, vielleicht gar nicht wollte. Um das zu ändern, entsandte das „Preußisch-Deutsche-Kaiserreich“ die vorläufig noch sehr bescheidenen maritimen Streitkräfte an die entferntesten Küsten dieser Erde: Ob nun Corinto oder Fernando Po, ob Samoa oder Klein-Popo (Togo), ob Tschemulpo (Korea) oder Kamerun, die SMS LEIPZIG hatte viel zu tun. Dafür aber, für die „Überzeugungsarbeit“ vor Ort, bedurfte es menschlichen Materials, das auf der LEIPZIG aus ca. 425 Mann Besatzung bestand. Das sind, denke ich, ganz schön viele Männeken für ein Schiff von gerade einmal ca. 85 m Länge und 14 m Breite. Da das Schiff aber so etwas wie einen „Semi-Antrieb“ hatte, das heißt, es konnte sowohl unter Benutzung der Segel als auch mit Hilfe einer Kohle fressenden Expansionsdampfmaschine vorgetrieben werden, bedurfte es schon vieler Hände, um so ein Fahrzeug in Bewegung zu halten. Die Segelfläche betrug immerhin 2.600 m², und um die Schraube zum Drehen zu bringen, dafür bedurfte es auch vieler schwieliger Trimmer-Hände, weil die Kohle halt nicht von selbst vom Bunker in die Esse sprang. Kohle, kohlen, immer wieder kohlen, dass war die Achillesferse des deutschen Überseegeschwaders…
1891, auf einer „Einsatz-Reise“ nach Chile – Chilenischer Bürgerkrieg – gingen der LEIPZIG die Kohlen vorzeitig aus. Sie musste sich abschleppen lassen. Welch eine Schande für ein Schiff mit Segeln! Darüber, über das Wieso und Warum, hätte ich gerne mehr gewusst, aber Wikipedia gibt da nichts her. Außerdem beschäftigt mich eigentlich eine andere Frage, nämlich die, wie und wo die 425 Mann Besatzung an Bord untergebracht waren? Dass ihnen, jedenfalls dem gemeinen Volk, keine Kabinen zugebilligt waren, versteht sich ja von selbst. Wahrscheinlich schliefen sie schichtweise, jeweils zwei Wachgänger für eine Hängematte, zwischen Segel-Gerätschaften, Kohlebunkern und Ringkanonen. Ringkanonen? Kann mir vielleicht jemand verraten, was das ist, eine Ringkanone? Hat die etwa einen Nasenring, damit man sie wie einen wilden, gefährlichen Stier sicher führen kann? Ich meine, ganz im Ernst, irgendwie musste man die schweren Dinger doch seefest zurren können, bevor sie sich bei schwerem Wetter selbständig machten…
Also, ein Honiglecken waren diese ausgedehnten Seereisen von ein bis zwei oder gar mehreren Jahren für die Besatzungen dieser Korvetten ganz sicherlich nicht. Die kleine Glattdeckskorvette SMS ARIADNE – Länge über alles: 68,16 m, Breite: 10,80 m, Besatzung ca. 240 Mann – lief am 4. November 1877 aus Wilhelmshaven Richtung Südamerika aus und kehrte erst am 30. September 1881 in den Heimathafen zurück. In der Zwischenzeit hielt sie sich zwecks kolonialer Bereicherung des Reiches hauptsächlich in der Südsee auf. Bei einem Kurzaufenthalt in Sidney benutzten einige Matrosen die Gelegenheit zur Desertion. Wenn Sie mich fragen – die waren sicher nicht die Dümmsten…
Eigentlich wollte ich doch über meine eigenen Abenteuer schreiben und nicht über die der kaiserlichen Matrosen. Apropos „kaiserliche Matrosen“, wissen Sie, wie kaiserliche Militärärzte Geschlechtskranke kurierten? Sie schnitten dem Delinquenten den Peniskopf zwar nicht ab, aber dafür auf, um so besser an die Gonokokken zu gelangen. Diese rabiate und wohl auch sehr schmerzhafte Operation hatte – für den Operateur – immerhin den Vorteil, dass der Operierte nicht so schnell wieder rückfällig wurde. Allerdings, um bei der Wahrheit zu bleiben, ich kenne diese Geschichte nur vom Hörensagen…
Okay, vergessen wir die „Kaiserlichen“ und finden uns wieder auf der ILLSTEIN ein. Die nahm inzwischen Kurs auf den Golfo de Fonseca. Die Ufer dieser Meeresbucht werden gleich von drei Staaten, von Nicaragua, Honduras und El Salvador, beansprucht. Während Nicaragua in dieser Region mit keinem bedeutenden Hafen vertreten ist, sind die Häfen Puerto La Union für El Salvador und Puerto Amapala auf der Isla Tigre für Honduras schon von Bedeutung. San Lorenzo, ebenso zu Honduras gehörig, ist (oder war) für Tiefwasserschiffe nicht erreichbar.
Honduras – das heißt nichts weiter als Tiefe. Was Columbus, der 1502 an der karibischen Küste des Landes in der Nähe der heutigen Stadt Trujillo anlandete, zu dieser vergleichsweise fantasielosen Namensgebung bewog, das bleibt wohl sein Geheimnis. Wiewohl ihm die „Tiefe“ des Ozeans ebenso ein Geheimnis sein musste. Seine Lotleinen werden kaum über 15 Faden (ca. 150 Meter) Tiefe erreicht haben. Immer wieder verfalle ich, bei dem Gedenken an die Kapitäne jener Epoche, in Ehrfurcht. Mit wie viel Geduld und Umsicht sie sich doch an das zu erkundende Neuland heranpirschen mussten. Dennoch, einen wegen vorgelagerter Riffe sperrigen Küstenstreifen bloß „Tiefe“ zu taufen… Beim Anblick der alles überwuchernden Vegetation hätte er doch immerhin ein „O Santa Verde!“ oder noch besser: „O verde inferno!“ ausrufen können. Der Ausruf aber: „O Republica de`l Bananas“ bleibt, mit Vorbehalt, uns Nachgeborenen vorbehalten. Mit Vorbehalt deswegen, weil sich mir schon längstens die Überzeugung aufdrängt, dass sich die Territorien der Bananenrepubliken nicht bloß auf Zentralamerika beschränken. Wenn als Maßstab dafür Korruption, Selbstbedienung, Verantwortungslosigkeit der Verantwortlichen gelten, dann, ja dann…
Allerdings, dem über viele Jahrzehnte hinweg von der United Fruit Company beherrschten Honduras den Titel Bananenrepublik streitig zu machen, das dürfte selbst der Bundesrepublik schwer fallen. Innerhalb von 55 Jahren, von 1821 bis 1876, 85 Regierungen zu verbraten – das schafft man ja nicht einmal in Italien. Und, als Draufgabe, 125 Militärputsche in nur 150 Jahren, das will auch erst einmal nachgemacht werden! Und als Nachtisch: Der jüngste Putsch fand gerade eben erst statt – wir schreiben das Jahr 2009!
Winter 1965/66: Die ILLSTEIN steuert zunächst die Isla Tigre an. Ich zitiere aus dem „Handbuch der Westküste Südamerikas:
Von Peru bis Guatemala, 1969: Puerto Amapala an der NW-lichen Ecke von Isla Tigre ist der einzige Seeschiffen zugängliche Hafen an der pazifischen Küste von Honduras. In der Stadt mit etwa 3.000 Einwohnern (1964) sind gute sanitäre Verhältnisse… In der Ansteuerung und der Hafeneinfahrt ist mindestens 5,5 m Wassertiefe… Isla Caracolita, auch Knob Islet genannt, liegt dicht vor der Westseite von Isla Tigre etwa 1¼ sm SSW-lich der NW-Ecke der Insel. Dicht westlich der kleinen, dicht bewaldeten Insel ist eine versunkene spitze Klippe an Stromkabbelungen kenntlich…
(Eigener Einschub: Vielleicht ist ja gerade diese versunkene Klippe der Hort einer der viel gesuchten Schatztruhen des Freibeuters Francis Drake, der sich ja bekanntlich auch im Golfo de Fonseca herumgetrieben hatte.)
Lotsen sind nicht vorhanden, doch leitet auf Anforderung eine Barkasse auf den Ankerplatz vor der Stadt. Ankerplätze sind etwa ¼ sm nördlich von Isla Meanguera auf 7 m Wasser und gegenüber der Stadt auf 11 bis 16 m Wasser über gut haltendem Grund. Der Hafen von Amapala ist wenig geräumig, etwa ½ sm breit und durch mehrere vereinzelt liegende flache Stellen mit weniger als 6 m Wasser zusätzlich beschränkt. Ein 122 m langer hölzerner Pier reicht vom östlichen Teil der Stadt NW-wärts bis in 3,4 m Wassertiefe. Dicht SW-lich des Piers steht ein kleiner Turm. An dem Pier können nur Leichter und kleinere Fahrzeuge anlegen. Die Ladung wird in Leichter umgeschlagen, von denen etwa 15 vorhanden sind.
Amapala ist demnach ein Hafen, dem sich ein größeres Schiff nur mit größter Vorsicht nähern sollte. Dass sich inzwischen aber sogar „Kreuzfahrer-Schiffe“ – wie man dem Internet entnehmen kann – in das Gebiet wagen, hat mich nun doch etwas überrascht. Nicht so sehr wegen nautischer Probleme, sicher ankern diese Schiffe außerhalb des Gefahrenbereiches, denn ihre Fracht, die Passagiere, können sie ja bequem mit den wendigen Barkassen überall hin befördern. Das, was mich wirklich überrascht, um nicht zu sagen bestürzt, ist die Effektivität des modernen Massentourismus, dem anscheinend keine Grenzen mehr gesetzt sind. Aber ausgerechnet Amapala? Ich frage mich, was es denn da – außer den bildhübschen Mädchen auf der Internetseite – zu bestaunen gibt. Ich zumindest kann mich bei dem Namen Amapala weder an signifikante Bauwerke, noch an wohlfeile Mädchen erinnern...
Woran ich mich aber noch sehr gut erinnere, ist der 783 Meter hohe Vulkankegel der Insel. Aus lauter Jux und Tollerei – vermutlich hatten wir einen freien Tag – kamen einige meiner Kollegen auf die Idee, den begrünten Basaltkegel zu besteigen. Klar, dass ich, sozusagen der Alpinist vom Dienst, mit von der Partie war. Zunächst ließ sich das Vorhaben ganz gut an. Zwar orteten wir sofort nach der Anlandung im Hafen so etwas wie eine Bar, die wir aber links liegen ließen – es war ja noch Vormittag. Die Stadt selbst kann so bedeutend nicht gewesen sein. In meinen Erinnerungsbildern tauchen lediglich abgeblätterte Fassaden, ausgewaschene Gehsteige und staubige Lehmstraßen auf.
Einem festgetretenen Karrenweg folgend, der sich an eingegrenzten, landwirtschaftlich genutzten Parzellen entlang schlängelte, näherte sich unser kleiner Trupp relativ rasch dem Ziel. Je näher wir kamen, desto enger wurde der Weg, bis wir zuletzt nur noch auf kaum erkennbaren Pfaden unter Bananenstauden und zwischen Zuckerrohrpflanzen entlang stolperten. Dann aber, am Bergeshang angelangt, endete plötzlich die Welt der Kulturpflanzen und mit ihr auch der letzte Pfad. Ein breiter Gürtel mannshohen Grases machte uns Eindringlingen das Weiterkommen schwer. Wie Schilf dicht beieinander stehendes, kratzbürstiges Staudengras nahm uns nicht nur die Sicht, es verhinderte ebenso ein kontrolliertes Aufsetzen des Fußes auf dem zerklüfteten Boden. Spätestens hier gaben die ersten auf. Genau genommen konnten wir nach der Überwindung des tückischen Grasgürtels eigentlich nur noch zwei Mann gewesen sein. Der dritte Mann, ein semmelblonder, überlanger Kerl hatte sich in diesem Grasgewirr total verheddert. Sein hochroter Kopf mit der gelben Haarbürste überragte selbst noch das hohe Gras und war in dieser Situation einer exotischen Frucht nicht unähnlich. Aber ganz offenkundig war der Saft raus aus dem Früchtchen, und in seiner Not schrie er aus Leibeskräften: „Ihr Schweine, Schweine, Kameradenschweine…“
Na ja, die widerborstige Vegetation forderte den „Einzelkämpfer“, da musste man einfach durch. Anstatt sich die Lunge aus dem Hals zu schreien, hätte er besser die Zähne zusammenbeißen sollen. Im Übrigen war der Semmelblonde sowieso einer jener überheblichen Norddeutschen, die alle jenseits des Weißwurstäquators Geborenen mit Verachtung strafen. Man darf also getrost annehmen, dass ich dessen jämmerliches Geschrei mit nicht geringer Genugtuung „überhörte“. Wo der zweite Mann abgeblieben ist, fehlt in meiner Erinnerung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich zuletzt ganz allein dem Gipfel, der eigentlich gar keiner war, zustrebte.
Diesen zu erreichen, war nach Durchdringen der Grasbarriere keine besondere Herausforderung mehr. Zwischen unzähligen großen und kleinen, sehr scharfkantigen Basaltblöcken ging es stetig auf schwarzem, grobkörnigem Sand bergan. Müßig zu sagen, dass ich selbstverständlich nicht mit zünftigen „Goiserern“ ausgerüstet war, sondern nur so was Ähnliches wie Turnschuhe an den Füßen hatte. Der „Gipfel“ der sich schier endlos hinziehenden Rundkuppe war dann, schlicht gesagt, der Mühe nicht wert. Meinem enttäuschten Auge bot sich nichts Spektakuläres: Keine qualmenden Löcher, kein rätselhafter Kratersee, kein erbauender Rundblick, rein gar nichts… Der schon vor langer Zeit entschlafene Vulkan hatte von seiner Ursprünglichkeit nur noch seine konische Kegelform behalten. Nun, ehrlich gesagt, wie weit ich mich einem richtigen, noch tätigen Vulkan angenähert hätte, das werde ich in diesem Leben wohl nicht mehr beantworten können…
Dass aber auch tote, zumindest scheintote Vulkane gefährliches Potential in sich bergen, das musste ich auf dem Rückweg feststellen. Überhaupt war der Abstieg noch um einiges riskanter als der Aufstieg. Zunächst bot der schwarzsandige Boden keinen festen Halt. So versuchte ich, von einem „Trittstein“ zum nächsten zu gelangen. Das ging eine Weile ganz gut, bis – ja bis direkt unter meinem zum Sprung angehobenem Fuß eine Schlange hochschnellte. Ich erstarrte augenblicklich und verharrte, wie weiland Lots Frau, minutenlang in dieser unbequemen Stellung. Man stelle sich vor: Mit einem Fuß auf einem wackeligen Stein stehend, den anderen, unter dem das schwarz glänzende Reptil züngelte, hoch erhoben, mit ausgestreckten Armen den Oberkörper ausbalancierend – welch ein heroisches Bild! Zu meinem Glück begnügte sich die Schlange mit der eindrucksvollen Drohgebärde und zischte ab, ohne mich angegriffen zu haben. Der Matrose Steininger aber stand noch eine ganze Weile wie versteinert, sozusagen als sein eigenes Denkmal, auf dem steinernen Sockel. Sollte wirklich jemand einmal auf die Idee kommen, mir ein Denkmal zu setzen, dann würde ich, sozusagen als eine Metapher für meinen ganzen Lebenslauf, diese groteske Figur (mit oder ohne Schlange) vorschlagen…
Aber Schlangen hin, Schlangen her; ich musste weiter, musste wieder runter von diesem verdammten Scheißberg. Heutzutage würde man in solch bedrohlicher Situation zum Handy greifen und in aller Seelenruhe auf den Hubschrauber vom Dienst warten… Aber, aber der langen Rede kurzer Sinn, ich kam sicher unten an und das noch vor dem Untergang der Sonne, die sich in den Tropen und Subtropen bekanntlich sehr früh und auch noch sehr schnell verabschiedet. Und ich dankte wieder einmal meinem Schutzengel, der mich ungeachtet meines Leichtsinns das Abenteuer heil überstehen ließ…
PS: Und ich war doch nicht allein – Freund Paul versicherte mir inzwischen, dass er doch dabei war.
Puerto La Union ist der NW-liche Arm von Golfo de Fonseca, an dessen SW-lichen Ufer etwa 5 sm innerhalb der Einfahrt die über 16.000 Einwohner zählende Stadt La Union liegt. Der Hafen, der von vielen Schifffahrtslinien angelaufen wird, gilt als der beste in El Salvador.
… Der völlig vom Land umschlossene Hafen ist großer Hitze ausgesetzt, da im Allgemeinen nur schwache Wind auftreten. In der Trockenperiode von Dezember bis Mai weht allerdings oft starker Nordwind, und während der Regenzeit treten auch gegen 23:00 Uhr die „Chubascos“ auf. (Aus dem Handbuch für…)
Die „Chubascos“ sind beileibe keine Marimba klimpernden Musikanten, sondern es sind die aus dem Landesinneren stets pünktlich eintreffenden frontartigen Gewitter mit mitunter heftigen Sturmböen. Das gilt jedoch nur für die sommerliche Regenzeit und – bis dahin sind wir schon wieder ganz woanders.
Hafenanlagen: Muelle Cutuco ist ein 320 m langer Betonpier, der etwa ¾ sm NW-lich von Punto Cutuco NO-wärts und ostwärts verläuft. Beiderseits des Molenkopfes sind 155 m lange Liegeplätze mit 7,3 bis 10,7 m Wassertiefe längsseits. Beide Seiten der Mole haben Gleisanschluss; sämtliche Ladungen werden mit dem Schiffsgeschirr bearbeitet. Auf der Mole stehen zwei fahrbare 5- und 10-t-Kräne …
(Handbuch für…)
Der erwähnte Betonpier – der, das tut ja richtig weh, bislang war ich felsenfest davon überzeugt, dass das Wort Pier weiblich sei – war aber zusätzlich auch noch so etwas wie ein Kopfbahnhof. Jedenfalls endete hier der aus dem Hinterland kommende Schienenstrang. Warum ich das erwähnenswert finde? Abwarten! Zuvörderst ein paar Anmerkungen über die damaligen Verhältnisse im Staate El Salvador.
Die Geschichte El Salvadors ist geprägt von unglaublicher Gewalttätigkeit der Herrschenden gegenüber der besitzlosen Unterschicht; ganz besonders gegenüber der indigenen Bevölkerung. Ich zitiere aus Wikipedia:
La Matanza („das Massaker“), die Niederwerfung des Volksaufstandes unter Agustin Farabundo Marti durch General Maximiliano Hernández Martinez 1932 gilt als das Ende der Pipil El Salvadors. Es heißt, Menschen seien einfach auf Grund des Unterscheidungsmerkmals getötet worden, dass sie Nawat (Pipil) sprachen oder „indianische“ Kleidung trugen. Etwa 30.000 Menschen, mehrheitlich unbewaffnete indigene Bauern, wurden dabei niedergemacht. Unter General Hernández erlassene Gesetze machten den Gebrauch indigener Sprachen auch offiziell strafbar.
Wie seit jeher üblich in El Salvador, war der durch einen Putsch an die Macht gekommene General im Grunde nur ein williges Werkzeug der weißen Großgrundbesitzer, die im Falle eines „Aufmuckens“ der Landlosen auch stets mit der tatkräftigen Hilfe der Yankies rechnen durften. 1932 waren es, wen wundert’s, ebenfalls die Amerikaner, die dem Putsch-General beim Ermorden der als „Bolschewiken“ bezeichneten Aufständischen den Rücken frei hielten.
Wie alle Welt inzwischen ja weiß, haben sich die maßgeblichen Politiker der USA in ganz Lateinamerika nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Zusätzlich zu ihren geopolitischen Interessen taten sie stets das, was „United Fruit“, die eigentliche Beherrscherin aller „Bananenrepubliken“, von ihnen verlangte. Kennedy mochte da zumindest im Ansatz eine Ausnahme gewesen sein, aber… Aber auf ihn folgten gleich wieder die Hardliner der Republikaner, und die trieben es dann in ihrem zentralamerikanischen Hinterhof schlimmer denn je.
Im Dezember 1981, der Schauspieler und Western-Darsteller Ronald Reagen war gerade zum US-Präsidenten gekürt worden, wurde in El Mozote durch Regierungssoldaten ein Massenmord an völlig wehrlosen Menschen verübt. 900 Menschen, Männer, Frauen und Kinder wurden gnadenlos niedergemetzelt. Weil man sie für Guerilla-Sympathisanten hielt, wurden sie erschossen, vergewaltigt, verstümmelt und verbrannt. Die Mordbuben, Soldaten der Armee El Salvadors, denen noch viel mehr Gräueltaten zuzuschreiben sind, gehörten zu der berüchtigten Todesschwadron Batallón Atlacatl. Sie mordeten im Auftrag der Staatsmacht, aber ausgebildet und in ihrem „Handwerk“ geschult wurden sie durch US-amerikanische Green Berets, unter denen sich der Colonel John David Waghelstein besonders „verdienstvoll“ hervortat (Wikipedia).
In diesem Zusammenhang darf ich auch noch auf das WHISC – Western Hemisphere Institute for Security Cooperation – hinweisen. Hinter dieser neutralen Bezeichnung verbirgt sich das US-Trainingscamp Fort Benning in Columbus (Georgia), USA. Die „vornehmste“ Aufgabe dieser Institution ist es, den amerikanischen „Hinterhof“ mit den Mitteln des Terrors gefügig zu halten. Ich zitiere Wikipedia:
Zu den Absolventen gehörten lateinamerikanische Soldaten, Offiziere und spätere Junta-Generäle wie Leopoldo Galtieri, Roberto Viola, der bolivianische Diktator Hugo Banzer, der panamesische General, Ex-CIA-Mitarbeiter und Rauschgifthändler Manuel Noriega sowie der peruanische Geheimdienstmitarbeiter Vladimiro Montesinos, weiter Efrain Rios Mont, Guillermo Rodriguez und Omar Torrijos. Auch Roberto D’ Aubuisson, der Auftraggeber des Mordes an Oscar Romero, dem Erzbischof von San Salvador, wurde in der SOA (School of the Americas) ausgebildet. Aus diesen Gründen wird diese Einrichtung auch als „School of the Assassins“ (Mörderschule) bezeichnet.
Übrigens: Dass sich die Todesschwadron den Namen Atlacatl gab, ist schon an sich eine Perversion und widerliche Beschmutzung, ja unerträgliche Erniedrigung eines heldenhaften Anführers der Pipil. Atlacatl stemmte sich vier Jahre lang, von 1524 bis 1528, den spanischen Eroberern erfolgreich entgegen, bis ihn der Conquistador Diego de Alvarado besiegte und ihn wie einen Verbrecher hängen ließ. Die Verbrecher von El Mozote, so ist zu befürchten, laufen möglicherweise noch immer frei herum…
Nun bin ich aber „meiner Zeit“ einige Jährchen vorausgeeilt. Soweit ich mich zurück erinnere, hatte 1965/66 die Staatsmacht das Land fest im Griff. Die Pier, das ganze Hafengelände wurden von Soldaten kontrolliert. Unter „Staatsmacht“ waren in El Salvador bislang nicht so sehr die meist nur vorgeschobenen Politiker oder einer der Putsch-Generäle zu verstehen, sondern der ominöse Klan der 14 Familien. Marcel Niedergang schrieb in seinem 1963 erschienenen Buch „20 mal Lateinamerika“ darüber.
Zitat: Die Namen dieser insgesamt vierzehn Männer sind an den Türen der Bürogebäude, an den Pforten der Handelsgesellschaften, der Banken und der Versicherungsfirmen von San Salvador zu lesen. Sie spielen alle gerne Golf, sie veranstalten Empfänge am Rande ihrer Schwimmbecken, sie sind Mitglieder von sehr geschlossenen Clubs. Sie besitzen riesige Kaffeefincas in der Provinz Libertad und Baumwollfelder bei Sansonate. Diese vierzehn Familienoberhäupter beherrschen das wirtschaftliche und politische Leben von El Salvador. Man findet sie alle – sie selbst, ihre Schwiegersöhne, ihre Neffen, ihre Vettern – an der Spitze aller großen Geschäfte und vor allem im Kaffeegeschäft, das den größten Reichtum von El Salvador bedeutet. Sie haben ihre Hand auf der Baumwolle, dem Kakao, dem Zucker, dem Palmöl, auf den Phosphaten und dem Vieh. Sie herrschen über die Zementfabriken, die Verkehrsmittel, den Verkauf von Coca Cola, Bier, Mineralwasser und amerikanischen Autos. Ohne direkt einzugreifen, haben sie alle Regierungen, die nach der Unabhängigkeitserklärung aufeinander folgten, aufgestellt oder abgesetzt. Die Lektüre der Gesellschaftsspalten in den Zeitungen von San Salvador gibt Aufschluss über alle politischen Intrigen eines Landes, das fast größer ist als Belgien. Die Duenos, die Regalado, die Hill, Mesa, Ayau, Sola, die Sol Milet, Guirola, Alvarez, Melendez, Menendez, Castro und Deininger: Diese weiße Oligarchie herrscht über eineinhalb Millionen Mischlinge.
Tja, und ich, ich hatte natürlich nichts Besseres zu tun, als den Reichtum dieser 14er-Bande indirekt zu mehren, indem ich ihre Produkte – Bier und Cola, Rum und Sex – bedenkenlos konsumierte. Die Straße weg vom Hafengelände führte direkt in den Puff. Dieser war eigentlich so etwas wie ein Dorf, ein Straßendorf, in dem sich Kneipe an Kneipe reihte. Wohin man sich auch wandte, von rechts und links lockte aus dunklen Türschlünden das eindringliche Wispern der Sirenen. So ist es halt auch nicht weiter verwunderlich, dass wohl keiner von uns Banausen je bis an das andere Ende der Dorfstraße gelangte. Was man, nachträglich gesehen, sogar als einen Glücksfall betrachten kann, denn, so geht die Mär, das Ende war eine Sackgasse – der Gottesacker! Gottesacker? Na, wohl eher ein Schindanger, der unheilige Friedhof für so frevelhafte Geschöpfe wie Seeleute und Nutten, die es da in ungeweihter Erde fortan in alle Ewigkeit mit dem Teufel treiben mochten…
La Union ist so und so ein heißes Pflaster; die Liegezeiten zogen sich hin, obwohl rund um die Uhr Betrieb war. Das lag an der zögerlichen Anlieferung der Kaffeesäcke, die per Bahn nur schubweise herangekarrt wurden. Tagsüber, wenn wir nicht gerade in den Luken zu tun hatten, war es ja noch auszuhalten. Meistens bearbeiteten wir auf übergehängten Stellagen oder vom Arbeitsfloß aus die Seeseite des Schiffes. So waren wir Decksbauern wenigstens tagsüber an der „frischen“ Luft. Aber nachts war es in den vermieften, nur unzureichend belüfteten Logis’ kaum auszuhalten. Weiß Gott ein triftiger Grund, die Nächte anderswo zu verbringen…
So setzte dann auch allabendlich ein Exodus in Richtung Kneipen ein, nur noch der Nacht- und die Lukenwächter – und die Offiziere, die sich gegenseitig auf ihre Moralfestigkeit beäugten, hatten an Bord zu bleiben. Die Entfernung zu unserem Nachtasyl war nicht der Rede wert, vielleicht bei noch guter Gangart 20 Minuten, der Rückweg aber konnte sich auch schon einmal hinziehen. So wie im Hafen, lief auch der Amüsierbetrieb rund um die Uhr, denn da gab es ja auch noch Schiffsbesatzungen anderer Nationen, die es mit der Arbeitsmoral nicht ganz so genau nahmen wie die diensteifrigen Deutschen. Nun, auch da gab es Ausnahmen, siehe Hans Ballermann. Aber im Allgemeinen war der deutsche Seemann jener Tage schon noch so getrimmt, dass er Dienst und Schnaps auseinander halten konnte.
Der gute Hans, der sich ja bekanntlich von solch altdeutschen Parolen nicht beeindrucken ließ und für den die Zustände im Puff von La Union sicher ideal gewesen wären, war da ja leider bereits verschütt gegangen. Leider, weil ich nun niemanden mehr hatte, dem ich meine fragwürdige Fürsorge angedeihen lassen konnte. Dafür aber fand ich in Paul, der eigentlich Georg heißt und als Motorenwärter auf der ILLSTEIN gemustert war, einen kongenialen Partner. Müßig zu sagen, dass wir uns nicht etwa an Bord, sondern in den Kneipen vor Ort kennen und schätzen lernten. Üblicherweise gab es an Bord immer schon diese spezifische Rivalität zwischen Deck und Maschine, die aus einem grundsätzlich unterschiedlichen Verständnis für Schiff und See resultiert. In der Praxis sah das dann so aus, dass, zumindest in der Mannschaftsmesse, die Decksbauern als auch die Maschinesen an getrennten Tischen ihr gemeinsames Mahl zu sich nahmen. Während unsereins trotz reichlichen Frischluftaufenthalts häufig nach „Labsalbe“ – Farbe und Verdünnungsmittel – roch, hatten die Klamotten der Motorenwärter, Schmierer und Reiniger naturgemäß immer diesen penetranten Gasölgeruch an sich. Zu diesen Äußerlichkeiten kam dann noch stets der Grad der Wertstellung: Was oder wer denn nun für das Schiff die wichtigere Funktion darstelle…
Für Paul und mich war das keine Frage. Lag es doch auf der Hand, dass ein jeder auf seinem Posten wichtig war, schon allein für das Gemeinwohl. Kleinliche Auseinandersetzungen waren nicht unser Bier, im Gegenteil, wir ließen, koste es was wolle, die Puppen tanzen. Das galt ganz besonders für La Union, denn hier gab es reichlich davon. Das Angebot an bildhübschen, willigen, bisweilen aufdringlichen jungen Frauen war einfach sagenhaft. Das führte nicht selten dazu, dass sich rassige Schönheiten wegen eines ungetreuen Freiers wortwörtlich in die Haare gerieten. Aber auch als „Freier“ lebte man nicht ganz ungefährlich, wenn man gewisse ungeschriebene Gesetze nicht einhielt. So mancher knickrige Krümelkacker oder treulose Casanova war, eh er sich’s versah, mittels einer Glasscherbe oder einer Rasierklinge für sein ganzes Leben gezeichnet. Zwar griffen in solchen „Notfällen“ die „Kellner“ schnell ein und setzten die meist angetrunkenen Chicas irgendwie fest, wenn sie sie nicht gleich einer Polizei-Patrouille übergaben. Und die fackelte bei Gegenwehr nicht lange. Auch so mancher Seemann fand unter solchen Umständen einen unrühmlichen „Seemannstod“ und landete auf besagtem Gottesacker…
Auch Paul und ich lebten vielleicht nicht ganz ungefährlich, denn wir waren bald als „Mariposas“, als Schmetterlinge, abgestempelt. Hatte man erst einmal diesen Ruf, war aber sonst großzügig, ließ es sich damit leben. Schließlich machte auch in diesem Milieu der Ton die Musik. Paul allerdings war wohl einmal sehr knapp am Limit. Er hatte sich vorgenommen, vielleicht aufgrund meiner Sticheleien, Rosaria zu zähmen. Rosaria hätte besser Randalia oder gar La Tigra geheißen. Sie war klein, aber geschmeidig wie ein Jaguar – und leider ebenso kratzbürstig. Sie soff wie ein Loch. Die meisten, die da meinten, sie mit genügend Drinks gefügig gemacht zu haben, scheiterten kläglich. Diejenigen, die es dennoch bis in ihr Bett geschafft hatten, verliehen ihr den Nimbus einer unberechenbaren Wildkatze. Paul war nun einer jener Haudegen, die sich schier vor nichts fürchteten – auch nicht vor Rosaria. Den Trinktest, bei dem ich ihn nach Kräften unterstützte, bestand er. Nach ungezählten Cuba Libre und Gin con Gin glitt sie plötzlich wie eine Schlange vom Barhocker, griff sich Paul und verschwand mit ihm in ihre Kemenate. Das ging ganz schnell, die Kammern der Mädchen lagen direkt im kreisrunden Hinterhof der Bar.
Nach geraumer Zeit kehrte er, total verschwitzt und hochrot im Gesicht, an den Tresen zurück. Ohne sich groß zu erklären, bestellte er sich ein Bier und schüttete es in einem Zuge hinunter. Das wiederholte sich noch einige Male. Sein Äußeres erinnerte mich an den alten Witz, in dem ein liebesgeiler Trapper aus Versehen einen Grizzlybär vergewaltigt. Das sagte ich ihm aber nicht. Leider, trotz meiner freundschaftlichen Rücksichtsnahme, verriet er mir nicht, was sich in Rosarias Höhle nun tatsächlich abgespielt hatte. Dabei hätte ich doch zu gerne gewusst: hat er sie nun, wie weiland Siegfried die Brünhilde, im fairen Ringen aufs Kreuz gelegt, oder war er schmählich unterlegen, und die Wildkatze hatte ihn vernascht – oder nur verarscht? Wie auch immer, aus Paul war diesbezüglich nix Konkretes herauszukriegen.
Und Rosaria, die tauchte wenig später ebenfalls wieder vor dem Tresen auf. Ihr war kaum etwas anzumerken. Sich lasziv räkelnd, musterte sie mich mit dem rätselhaften Blick einer Sphinx. Ich aber fühlte mich nicht zum Dompteur geboren und bevorzugte lieber brave, anschmiegsame Kätzchen, die es ja auch gab. Der Semmelblonde, der mich kürzlich noch als Kameradenschwein beschimpft hatte, war gar sterblich in so ein anschmiegsames, braves Mädchen verliebt. Sein geistiges Weltbild war sehr einfach gestrickt, und treudoof wie er halt war, hielt er sich für unwiderstehlich. Möglicherweise war er ja wirklich und wahrhaftig in seinem Leben zum ersten Mal richtig verliebt. In diesem bedauernswerten Zustand erzählte er zum Gaudium aller, dass er seine Herzensdame nach Deutschland nachbringen lassen wolle, um sie dort zu heiraten. Die „Dame“, die er verehrte, war eine jener dunkellockigen Schönheiten mit makelloser weißer Haut, die ganz bestimmt noch niemals für längere Zeit der gnadenlos sengenden Sonne ausgesetzt war. Was Wunder, pendelte sie doch nur zwischen Bett und Bar. Dabei pendelte sie auch mir eines schönen Nachmittags, vielleicht an einem Sonntag, in die Arme. Ohne Gewissensbisse, ja, um ehrlich zu sein, mit einer gewissen Genugtuung, folgte ich der Auserwählten unseres Romeos ins Liebesnest. Doch weil es der Deibel so wollte, hatte auch der Semmelblonde zur selben Stunde frei und pochte kurz darauf intensiv an die verschlossene Tür, hinter der ich mich mit der Dame seines Herzens verlustierte. Er pochte und pochte und klagte und winselte wie ein von seinem Frauchen ausgesperrter Hund. Die Schwarzgelockte legte einen ihrer Zeigefinger an die blutroten Lippen – weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz – machte „Psst“, ließ sich aber sonst von dem Gewinsel des Kerls vor der Tür nicht weiter stören. Mich allerdings störte es schon, und so rief ich schließlich laut und vernehmlich, dass er sich zum Teufel scheren soll – was er aber nicht tat. Geduldig wartete der arme Tropf ab, bis wir fertig waren und ich, das Kameradenschwein, ihm die Tür frei gab. Ohne Umschweife drückte er sich hinein; ich sah noch, wie er vor seiner Angebeteten niedersank und sie ihm sanft lächelnd seinen Strohkopf streichelte.
Die manchmal bis zu 14 Tagen dauernde Liegezeit in La Union ging einem körperlich wie materiell ganz schön an die Substanz. Aber der frühmorgendlich Vorsatz, heute einmal nicht an Land zu gehen, war spätestens zum „Koffiteim“ verflogen. Ein Erlebnis aber von ganz besonderer Art hätte um ein Haar für Paul und mich das Ende aller Landgänge sein können. War es nun Geldmangel oder einfach nur Abgeschlafftheit, vielleicht hatten wir auch nur ganz schlicht den Kragen voll, jedenfalls machten wir uns früher als sonst auf den Heimweg. Schon relativ nahe dem Hafengelände kreuzte die Straße den Schienenstrang. Neben dem Gleis stand direkt am Straßenrand ein Schienenfahrzeug – eine kleine Arbeitsplattform auf Rädern. Des Gehens überdrüssig, kam einer von uns beiden auf die glorreiche Idee, dieses Vehikel als Schienentaxi zu benutzen. Gedacht, getan! Mit vereinten Kräften setzten wir die hölzerne Plattform mit dem Unterbau einer Lore auf den Schienenstrang. Das Gelände zum Hafen war leicht abschüssig, so dass es keine besondere Mühe war, das Ding zum Laufen zu bringen. Wir schwangen uns, einer rechts, einer links, auf das Gefährt, das allerdings den Nachteil hatte, dass man sich nirgendwo festhalten konnte. Zunächst, bei langsamer Fahrt, war das ja noch kein Problem. Dann aber, mit zunehmender Fahrt, wurde die Situation ungemütlich, zumal das Gefährt ja auch keine Bremse hatte. Die Hafenlichter kamen uns bedrohlich schnell näher, auch sah es irgendwie nach Rangierverkehr aus, jedenfalls funkelten uns zwei grelle Lichter böse entgegen. Pauls Versuch, die Geschwindigkeit per „Fußbremse“ zu verringern, scheiterte am völlig ungeeigneten Schuhwerk – sofern man Badelatschen als solches bezeichnen darf. Da wir uns nicht darauf verlassen mochten, dass uns eventuell eine günstige Weichenstellung vor dem drohenden Zusammenstoß retten würde, hatten wir keine Wahl: Wir mussten runter! Also hechtete der eine rechts, der andere links ins – Ungewisse. Ich landete sehr unsanft zwischen allerlei Gesträuch auf dem abschüssigen Bahndamm und rollte wie ein Kaffeesack auf den Grund eines mit losen Steinen übersäten Grabens. Obschon etwas benommen, vernahm ich noch im selben Augenblick das hässliche Geräusch, das entsteht, wenn Eisen auf Eisen knallt. Kurz darauf peitschten auch noch vereinzelt Schüsse durch die Nacht…
Was tun? So eine Scheiße, aber immerhin, alle Knochen waren heil geblieben. Gewaltsam ernüchtert rekapitulierte ich: Paul war auf der anderen Seite des Bahndammes, aber den Damm zu queren, das verbot sich wegen des schießwütigen Militärs von selbst, und lauthals zu rufen, war sicher auch nicht ratsam. Außerdem und überdies war meine Seite die – Straßenseite. Also, was blieb mir übrig? Ich überließ Paul seinem Schicksal und schlug mich mühsam durch das pechdunkle, verfilzte Gelände bis zur Straße durch. Dort, am Straßenrand, verharrte ich im Schutze der Dunkelheit so lange, bis sich die Aufgeregtheit im Hafengelände gelegt hatte. Dann nahm ich all meinen Mut zusammen, stellte mich mitten auf die Straße und ging schnurstracks, dabei laut und falsch pfeifend, direkt auf das Hafentor zu. Die Torposten, denen ich längst bekannt war, winkten mich ohne Umschweife durch, was ich nicht ohne Genugtuung zur Kenntnis nahm. Es lohnte sich doch immer wieder, sich Wachpersonal, ganz besonders militärisches, mit kleinen Geschenken gewogen zu halten…
An Bord angekommen, leckte ich erst einmal meine „Wunden“. Im Grunde nur Kleinigkeiten, alles halb so wild. Die diversen Prellungen sollten sich erst später bemerkbar machen. Dann hätte ich mich ja liebend gerne zur Ruhe begeben, aber – wo blieb Paul? Was sollte ich tun? Bei der Schiffsleitung eine „Vermisstenanzeige“ machen? Um Himmels Willen, da stand Schwertfisch davor; der würde unverzüglich den Behördenapparat in Gang setzen, und dann, ja dann gute Nacht. Sollte ich mich selbst noch einmal, dem Schienenstrang folgend, hinaus wagen? Unmöglich, die Eisenbahner, die Soldaten würden sofort auf mich aufmerksam werden. Was sollte ich nur machen? Während ich also sorgenvoll am oberen Ende der Gangway ausharrte und hin und herüberlegte, wen ich eventuell ins Vertrauen ziehen könnte, tauchte urplötzlich Paul am unteren Ende der Gangway auf. Nicht weniger abgerissen als ich und irgendwie fußlahm humpelte er an Bord. Leider, sagte er, hätte sich bei dem Bremsversuch ein Eisensplitter in die Ferse gebohrt, und außerdem musste er noch nach dem verloren gegangenen Badelatsch suchen, deshalb die „Verspätung“…
La Union war in El Salvador aber nicht die einzige Anlaufstelle für unser Schiff. Es folgten noch La Libertad und Acajutla und San José und Champerico im nördlichen Nachbarstaat Guatemala. Diese Häfen waren für unsereins relativ schwer zu erkunden, weil die Ladung aufgrund fehlender oder desolater Pieranlagen auf Reede umgeschlagen wurde. An Champerico habe ich so gut wie keine Erinnerungen. In meinem alten Handbuch steht zu lesen:
Fondeadero Champerico (14° 18`N, 91° 56` W) ist eine offene Reede etwa 11 sm NW-lich von San Luis und der Einklarierungshafen für den westlichen Teil von Guatemala. Die Stadt Champerico hat über 4.000 Einwohner. Sie ist schon aus größerer Entfernung an mehreren auffälligen Gebäuden erkennbar. Ein Haus mit rotem Dach steht etwa 0,6 sm NW-lich und eine Gruppe von drei Palmen etwa 1 sm SO-lich des Piers. Ein gutes Radarecho wurde bei der Ansteuerung von dem auf der Pier stehenden Wellblechschuppen bereits in 24 sm Abstand in den Peilungen 335° bis 30° beobachtet; die Küste selbst reflektiert nur schwach.
Ankerplatz wird etwa ¾ sm SSO-lich des Pierkopfs empfohlen. Bei hoher Dünung oder zu erwartenden schweren Rollern muss man näher am Pier vor Anker gehen. Sobald der Anker gefallen ist, sollen drei lange Töne als Schallsignal gegeben werden. Wegen der hohen Brandung vor der Küste ist das Landen gefährlich, doch erleichtert der Pier die Ladungsarbeiten und das Landen von Passagieren. Die Dünung ist hier schwerer als an anderen Plätzen dieser Küste; oft sind Ladungsarbeiten erst möglich, wenn das Schiff mit dem Bug gegen die See gebracht ist. Bei Vollmond und Neumond setzen oft schwere Roller aus südlicher Richtung ein, die zeitweise bei gänzlicher Windstille schon auf 7 m Brandung aufwerfen. …
Also, somit liegt es auf der Hand, in Champerico sah unsereins kein Land. Vielleicht war das ja sogar ganz gut, denn – so steht es im Handbuch – die „sanitären“ Einrichtungen in der Stadt sind schlecht…
Dasselbe gilt auch für San José: Kein Landgang, keine Erinnerung…
Ich zitiere:
Fondeadero San José ist eine offene Reede etwa 6 sm westlich von Itapa. Dieser Haupthafen von Guatemala gewinnt dadurch an Bedeutung, dass er mit der 72 sm entfernt liegenden Stadt Guatemala durch eine Eisenbahn verbunden ist. Im Jahre 1965 hatte die Stadt San José etwa 5.000 Einwohner. Die sanitären Verhältnisse in der Stadt sind schlecht, so dass Malaria und Darmkrankheiten vorherrschen.
Fondeadero Acajutla (13° 35’ N, 89° 51’ W) ist eine offene Reede und den Westwinden mit starkem Seegang völlig ausgesetzt. Besonders in der örtlichen Regenzeit von Mai bis September ist es ein unbequemer Ankerplatz. Acajutla hat fast 16.000 Einwohner (1964) und ist der Haupthafen von El Salvador und Umschlagplatz für die Waren aus dem westlichen Teil des Landes, insbesondere für die Kaffeeprodukte der Santa Ana-Region. … Die Gesundheitsverhältnisse sind gut, lästig sind die vielen Fliegen und Moskitos aus den hinter der Stadt liegenden Sümpfen. Es gibt keine sanitären Einrichtungen...
Hafenanlagen: Muelle Nacional, eine 4 Kblg lange, L-förmige Mole, etwa 1 ¼ sm südlich der Stadt, hat einen über 300 m langen und fast 40 m breiten Kopfteil mit etwa 10 m Wasser längsseits, an dem zwei große Schiffe sicher liegen können… (Auszug aus dem Handbuch der Westküste Südamerikas, II. Teil, von Peru bis Guatemala, 1969)
Dass es in Acajutla keine sanitären Einrichtungen gab, da möchte ich nun doch widersprechen. In diesem Hafen lagen wir an dem erwähnten Pier. Ergo hatte ich meinen Fuß auch an Land gesetzt. Vermutlich hatte ich Nachtwache, denn die „Landnahme“ erfolgte bereits nach dem Frühstück. Auf dem Pier, der in meinem Gedächtnis nichts weiter als eine glitschige Holzbrücke ist, begegnete ich als erstes einem kleinen Hammerhai. Der mochte maximal 1½ Meter lang gewesen sein, lag auf dem Rücken, und seine Flossen hingen schlapp zur Seite. Der Fisch lag da – wie gekreuzigt… Neugierig betrachtete ich das exotische Tier, das ich bislang noch nicht einmal in einem Aquarium gesehen hatte. Der schlanke, elegante Körper, und dann dieser unmögliche Kopf, der eigentlich eher die Form eines Schneepfluges als eines Hammers hat, das passt einfach nicht zusammen. Sozusagen eine ästhetische Entgleisung. Was hatte sich da der unberechenbare Schöpfer bloß wieder ausgedacht! Na, was geht’s mich an, sowohl die Kreatianisten als auch die Atheisten haben sicher eine Antwort darauf. Und ich, ich dachte, dass ein Fisch ins Wasser gehört und schwimmen sollte. So rollte und schob ich das Tier per Fuß bis an den Rand des Pier und schubste es über die Kante. Und siehe, der Fisch schwamm – allerdings mit dem Bauch nach oben, ich machte, dass ich wegkam. Vom Land her näherten sich zwei, drei sonnenverbrannte, hagere Männer in abgerissenen Klamotten, Fischer…
Ach ja, die sanitären Anlagen, die gab es reichlich in Form von luftigen Kneipen. Freiluft-Bars unter Schatten spendenden Palmwedeln, unter die ich mich nur allzu gern vor der beißenden, stechenden Sonne flüchtete. Aber, saß man erst einmal beim Cuba Libre, ging es Schlag auf Schlag. Erst ein Drink, dann noch ein Drink, dann das erste Vögelchen, dann noch weitere Vögelchen, die wollten auch alle gefüttert sein. Schließlich, bevor die letzten Scheinchen über den Tresen geflattert, hat man sich vielleicht noch schnell ein williges Vögelchen ergattert…
Höchst wahrscheinlich hatten die etwas höher benoteten Scheinchen den Besitzer schon gewechselt, als ich mich gezwungen sah, der Runde den Offenbarungseid zu leisten. Ein pummeliger Spatz gab sich mit dem Rest zufrieden, und ich folgte ihm in seinen Schlag. In dem verlotterten Anbau der Bar gab es eine Menge kleiner, schmaler hölzerner Türchen, durch die man in ebenso kleine, schmale hölzerne Verschläge gelangte. Das ganze Mobiliar darin war – ein niedriges, schmales, mit einer groben Rosshaardecke abgedecktes hölzernes Bettgestell. Zugegeben, dieser „sanitären“ Anlage konnte man wahrhaftig kein Gütesiegel ausstellen – schon gar nicht am hellen Tag…
Und das, was da am helllichten Tag geschah – ist schnell erzählt. In einer raschen Bewegung entledigte sich das Pummelchen ihres ausgewaschenen, fadenscheinigen Kleidchens und legte sich ohne Umschweife auf den Rücken. Kurioser Weise stemmte sie als erstes, noch bevor ich irgendetwas tat, ihre Hände und Füße gegen die Bretterwände des Verschlages um mit unglaublicher Finger- und Zehenfertigkeit wenigstens einige der zahlreichen Astlöcher zu verstopfen. Leicht irritiert, forschte ich nach dem Grund dieses seltsamen Verhaltens. Doch spätestens dann, als ich das Geflüster und Gekicher jenseits der Bretterwände wahrnahm, wurde mir klar, dass ich zum Objekt einer Peep-Show geworden war…
Fondeadero La Libertad (13° 29’ N, 89° 19’ W), 16 sm WNW-lich der Rio Jiboa-Mündung, ist eine offene, völlig ungeschützte Reede, die nur bei guten oder bei nördlichen Winden als sicher gelten kann. In den Monaten von Juli bis Oktober sollte man den Platz überhaupt nicht anlaufen. Oft läuft die See ruhig auf den Strand, aber bei Neumond und bei Vollmond kommt oft noch auf 7 m bis 9 m Wassertiefe in 1 ¼ sm Abstand vom Land Brandung vor. Diese plötzlich auftretenden Brecher können Ankerketten brechen lassen, wenn nicht genügend Kette gesteckt ist. Das Landen ist zu dieser Zeit schwierig; selbst bei gutem Wetter sollen Boote gefährdet sein. (Aus dem Handbuch…)
Stimmt auffallend, jedenfalls das Letztere kann ich nur bestätigen. Nach längerer Seereise, von Europa kommend, schwoite das Schiff auf der Reede von La Libertad untätig um den Anker. Warum nicht umgeschlagen wurde, ob es die Wetterverhältnisse oder irgendwelche anderen Gründe waren, ist mir entfallen. Dass aber nicht wenige unter uns scharf wie Lumpi auf einen baldigen Landgang lauerten, daran kann ich mich schon erinnern. Einer der jüngeren Offiziere hatte dem Alten wohl den Floh ins Ohr gesetzt, das längst fällige Bootsmanöver durchführen zu lassen. Bootsmanöver, das umständliche Aus- und Einsetzen des Rettungsbootes, waren bei niemandem beliebt. Nicht beim Ersten und seinem Bootsmann, die die Leute lieber arbeiten sahen, nicht bei den Maschinisten, nicht beim Küchenpersonal und den Stewards, die sich alle nur ungern aus ihrem Alltagstrott heraus lösen mochten, und auch für uns Matrosen war es eher eine ungeliebte Pflichtübung. Warum? Ja, weil es – da es so selten geübt wurde – häufig mit „Beinahe-Katastrophen“ verbunden war. Mal klemmten die Ausleger der Davits, mal versagte die Bremse, mal riss der Steg, an dem die Manntaue befestigt waren, mal machte der Sliphaken Scherereien, mal …
Zu den möglichen technischen Gebrechen gesellten sich dann noch gern die Tücken der See. Kaum zu Wasser, wird das Boot auch schon zum Spielball der Wellen, die es je nach Intensität heben und senken. So wird es durchaus zum Kunststück, bei unruhiger See ein großes schweres Rettungsboot sicher zu wassern. Die beiden Matrosen, die an den beiden spitzen Enden des Gefährtes an den Auslösehaken der Davit-Taljen klar stehen, müssen dann unbedingt im selben Moment den Slipmechanismus auslösen, denn sonst… Sonst hängt das eine Ende vielleicht noch hoch in der Luft, während das andere, bereits aufgeschwommene Ende, von den verspielten Wellen im Wasser gefangen gehalten wird. Im Extremfall, den ich gottlob nicht erlebt habe, kann das schon einmal in einer mittleren Katastrophe enden. Aber auch im Normalfall waren verstauchte Knochen, Quetschungen, Platzwunden – verursacht durch die hin- und herpendelnden Taljen-Blöcke – keine Seltenheit. Deshalb war es selbst bei nur mäßigem Seegang nicht gerade opportun, Bootsmanöver abzuhalten…
Wir aber lagen – vor La Libertad! Und in der Tat – dass es uns gelang, das Boot unter erschwerten Bedingungen sicher zu wassern, spricht für das Können der Mannschaft. Eigenartiger Weise hatten sich eine erkleckliche Anzahl von Besatzungsmitgliedern, die gewöhnlich Mord und Zeter schrien, wenn sie zu einem Bootsmanöver vorgeladen wurden, ganz freiwillig zum Mitmachen gemeldet. Nun, so viel steht fest, die Übernahme der „Unbedarften“ über die Lotsenleiter verlief unfallfrei, und auch vom Schiff kamen wir schnell frei. Dann aber erfasste uns ebenso schnell eine unwiderstehliche Strömung, die uns zügig genau in die richtige Richtung trug – direkt zum Landungssteg vor dem niederen, weißgekalkten Gehöft, welches uns doch schon von Bord aus so sehr ins Auge gestochen hatte…
Um es gleich vorweg zu nehmen, das Gehöft war, so wie erhofft, kein Amtsgebäude, sondern erwies sich als ein gastfreundliches „Mädchenpensionat“. Und nachdem feststand, dass es einfach unmöglich war, gegen Wind und Strom noch vor Sonnenuntergang das „Mutterschiff“ wieder zu ereichen, überließen wir uns dem Schicksal, das es so gut mit uns meinte. Die durchweg jungen und außergewöhnlich hübschen Senoritas zeigten sich hoch erfreut über die so überraschend angeschwemmte Horde Seemänner, die sich selbstverständlich nicht lange bitten ließen. Vielleicht hatte der verantwortliche Offizier – mindestens einer davon musste ja mit im Boot gewesen sein – gewisse Bauchschmerzen, alle anderen aber genossen diese nicht ganz herkömmliche Art eines Bootsmanövers.
Das Bordell war aber auch wirklich vom Feinsten. Gab es doch so etwas wie einen Speiseraum mit einem langen, mit einer weißen Spitzendecke überzogenen Tisch. Die Rohrsesselchen hatten Pölsterchen, und wir tranken Sekt aus gläsernen Kelchen. Ich glaube sogar, mich an gegrillte Shrimps zum Sekt erinnern zu können… Dieses eher ungewöhnliche Ambiente veranlasste die Sensibleren unter uns, sich an fast vergessene Manieren zu erinnern. Ja, so mancher entpuppte sich als Charmeur, machte seiner Herzensdame den Hof und entführte sie zum Tanze. Auch ich bemühte mich redlich um eine schmalgesichtige, hauchzarte Nymphe, deren unschuldsvoller Blick dummerweise meine Seele berührte. So kam es denn, nachdem sich alle in eitler Wohlgefälligkeit in die hinteren Räumlichkeiten des Gehöftes verzogen hatten, dass mir mein Engelchen irgendwie entschwebt war. Dass ich den Rest der Nacht mutterseelenallein auf einer Pritsche verbrachte, daran war sicherlich wieder einmal mehr der Alko schuld. Dabei entsinne ich mich noch ganz genau, dass mich, bevor ich ganz weg war, eine Jemandin zärtlich streichelte und mit bekümmertem Tonfall feststellte: Ernesto dormir solo…
Der eigentliche „Point of Return“ einer Westküste-Zentral Reise, der aber deswegen nicht immer zwangsläufig angelaufen wurde, war der im Golf von Kalifornien versteckte mexikanische Hafen Guaymas. Meine bleibenden Eindrücke an diesen Hafen und dessen „wüstes“ Hinterland gehören aber zu einem anderen Schiff und müssen deshalb hier konsequenter Weise außen vor bleiben. Der Golfo de California selbst ist ein Nebenmeer des Pazifiks zwischen dem mexikanischen Festland und der sich über 1.000 km nach Süden hinziehenden, relativ schmalen Halbinsel Baja California. Der spanische Entdecker Francisco de Ulloa benannte den Golf, von dem er ja nicht wissen konnte, dass es sich nur um eine maritime Sackgasse handelte, nach seinem Auftraggeber: Mar de Cortéz. Ulloas Auftrag war es, nach der legendären Straße von Anián zu suchen, die, dem Wunschdenken jener Zeit entsprechend, eine Verbindung zum St. Lorenz-Strom ermöglichen sollte. Dafür rüstete ihn Hernán Cortés mit drei Schiffchen aus, die am 8. Juli 1539 von Acapulco aus mit nördlichen Kursen in See stachen. Im September befand sich die inzwischen auf nur noch zwei Schiffe reduzierte Flotte vor der Mündung eines Flusses, der uns heute als Colorado-River bekannt ist. Ob Ulloa versucht hat, den Fluss zu erkunden, ist mir nicht bekannt. Laut Wikipedia drehte er um und versuchte sein Glück „außen“ herum. Er umsegelte also das südliche Ende Baja Californias und richtete den Kurs seiner Schiffe erneut gen Norden aus. Der raue Pazifik aber, dessen Launen die kleinen Schiffe nun ungeschützt ertragen mussten, zwang den Entdecker vor Isla de Cedros, also bereits am 28. nördlichen Breitengrad, vorzeitig zur Umkehr. Obwohl es durch Francisco de Ulloas vergebliches Bemühen als erwiesen galt, dass es sich bei Baja California nur um eine Halbinsel handeln konnte, wurde sie doch noch eine ganze Weile auf den damaligen Atlanten als eine Insel dargestellt. Die fixe Idee von der Straße von Anian, also der „Nordwestpassage“, basierte auf der Annahme, dass Nordamerika kein Kontinent, sondern lediglich ein riesiger Archipel sei. An dieser Fehleinschätzung des 16. Jahrhunderts sollten sich noch so manche Erforscher und Entdecker die Zähne ausbeißen…
Das Mar de Cortéz bzw. den Gulf of California, dieses Gewässer habe ich als eines der angenehmsten und erlebnisreichsten überhaupt in Erinnerung. Nichts als eine azurblaue, völlig glatte bis leicht gekräuselte Oberfläche, durchbrochen nur durch das muntere Spiel ausgelassener Tümmler. Blasende Wale ziehen unbeirrt ihre Bahnen oder verabschieden sich, wenn’s ihnen gerade einfällt, mit einem gewaltigen Klatscher ihrer mächtigen Fluke in die Tiefe. Dann wieder beginnt die See stellenweise wie siedendes Wasser zu kochen: Die Oberfläche beginnt plötzlich zu zittern, bekommt eine „Ganslhaut“, hat auf einmal unzählige kleine Krater, so als ob schwere Regentropfen darauf prasselten. Das kann aber nicht sein, denn Regen fällt hier so gut wie nie. Nein, was da die Oberfläche dermaßen aufwühlt, sind große Schwärme kleiner Fische, die wiederum zur Beute der großen Fische werden. Ein ums andere Mal sind es große Leder- oder Suppenschildkröten, die durch die Bugwelle unseres Schiffes in ihrer Siesta gestört werden. Das aber ist für diese Meeres-Dinos weitaus weniger unangenehm, als wenn sie in die Strudel des Kielwassers gerieten. Aber das können sie nicht wissen. Übrigens: Auch von uns konnte oder wollte damals noch keiner wissen, dass die moderne Schleppnetzfischerei mit ihren mörderischen Fangmethoden bereits begonnen hatte, die Meere nicht nur leer zu fischen, sondern überhaupt alles Meeresgetier rücksichtslos auszurotten.
Welchen Hafen man im Golf auch ansteuert, die parallel verlaufenden Küsten sind nie all zu weit entfernt. Hüben wie drüben ragen die Zacken der Berge aus endlosen Gebirgsketten mal in den Morgen-, mal in den Abendhimmel. Besonders beeindruckend sind die pittoresken Sonnenuntergänge vor der Silhouette Baja Californias… Fürwahr, so wenig die Bezeichnung „Stiller Ozean“ auf den gesamten Pazifik zutrifft, um so mehr passt sie auf dieses vortrefflich geschützte Randmeer. Zu meinem großen Bedauern liefen wir niemals einen Hafen auf der Halbinsel selbst an; jedenfalls habe ich keine Erinnerung daran. Aber auch dann hätte ich ja von der fremdartigen, exotischen Fauna und Flora der Halbwüsten entlang der Sierra Gigantes wohl kaum etwas gesehen.
Außer Guaymas (Sonora) war nur noch Mazatlan fixer Anlaufhafen an der mexikanischen Westküste. Mazatlan liegt etwas südlich des nördlichen Wendekreises und ist der wichtigste Hafen der Region Sinaloa. Vor der Hafeneinfahrt dräut ein kantiger, kegelförmiger Felsklotz, ein für Seefahrer willkommener Markierungspunkt. Ansonsten aber waren meine Eindrücke von der Stadt keineswegs so, dass ich da unbedingt noch einmal hin müsste. Das flache Sumpfgelände, das feuchtheiße Klima scheinen mir ein guter Nährboden für die Anopheles-Mücke zu sein. Allerdings habe ich nicht die geringste Erinnerung daran, dass die Malaria irgendwie prophylaktisch ernst genommen wurde, weder von der Schiffsleitung noch von uns simplen Seeleuten. Viel mehr beschäftigte uns das Problem, wo denn das außerhalb der „Stadtmauern“ gelegene Ranchito zu finden sei. Im Gegensatz zum restlichen Lateinamerika ist in Mexiko das Rotlichtviertel nicht unbedingt in unmittelbarer Nähe des nächsten Kirchturms zu finden. Aus welchen Gründen auch immer, ob moralischer oder schlicht hygienischer Art, der Kietz, hier Ranchito genannt, ist außen vor. Und was für einer, da wird nicht gekleckert, da wird geklotzt! Da stehen inmitten der meist kargen Natur in langer Reihe grellbunt aufgetakelte Amüsierbuden. Bei Nacht ist das ganze Gelände wie ein gleißender, glitzernder, laut plärrender Jahrmarkt – der es im Grunde ja auch ist. Bei Tag aber sollte selbst der lüsternste Seemann besser nicht in dieses Reich der „Königinnen der Nacht“ eindringen…
Dorthin zu gelangen, war dann aber selbst im Dunklen gar kein Problem – die Taxistas warteten schon in Schlangenlinie vor dem Hafentor auf Kundschaft. Und natürlich gingen wir davon aus, auf dieselbe bequeme Art auch wieder zurück befördert zu werden. Aber dazwischen war die halbe Nacht verflossen; auch hatte es in Strömen gegossen. Die am frühen Abend noch so belebte Sandpiste war wie leergefegt. Kein Taxi, weit und breit auch nicht ein Taxi: „Ach, da sah’n sich traurig an, Pilgersfrau und Pilgersmann.“ So oder so ähnlich heißt es in einer von Wilhelm Buschs Moritaten. Paul und ich, wenn auch beileibe keine frommen Pilgersleut, mochten uns wohl ebenso angeschaut haben…
Der Gedanke, in den gerade verlassenen Schoß des „Etablissements“ zurückzukehren, lag nahe, aber da war halt das verdammte Pflichtbewusstsein davor, und außerdem – außerdem war in allen Taschen „Ebbe“ … Also was soll’s: „Wozu ist die Straße da? Zum Marschieren…“ Das war leichter gesungen als getan. Auf dem fest gefahrenen Untergrund hatte der Regen eine schmierige Oberfläche hinterlassen, auf der man nicht einmal barfuß sicher laufen konnte. Das war aber noch immer nicht das höchste der Gefühle. Plötzlich tauchte die Piste in eine wassergefüllte Senke, die sich zu einem kleinen See weitete. Aus einiger Entfernung irrlichterte die Stadtbeleuchtung über die dunkle, vor sich hin gurgelnde Flut. Nun war es klar, warum kein Taxi zu bekommen war. Aber ebenso klar war, dass wir da durch mussten. Die Schuhe hatten wir sowieso längst in den Händen, aber nun ging es ans Eingemachte. Das Hochkrempeln der Hosenbeine reichte nicht, denn stellenweise stand uns das Wasser bis zum Nabel. Trotzdem hatten wir noch unseren Spaß dabei, denn Paul und ich waren ja nicht allein unterwegs, inzwischen planschte eine ganze Schar mehr oder weniger angetrunkener Wasserratten durch eine waschechte „Wasserstraße“…
Auch dieses Abenteuer hatte weder für Paul und mich noch für alle anderen Beteiligten irgendwelche Folgen. Kein Schlangenbiss, keine Lungenentzündung, keine Malaria, keine Syphilis… Obwohl wir an diesem Schlamassel völlig schuldlos waren, konnte sich’s Kapitän Dietze nicht verkneifen, uns seinen Standardspruch zum wiederholten Male an den Kopf zu werfen: „Saufn wie de Großn, benähm wie de Gleen!“ Dieses Bonmot wiederum bringt mir Hans Ballermann in Erinnerung. Das eben geschilderte Erlebnis muss sich auf meiner zweiten Reise ereignet haben, während der gute Hans die ILLSTEIN ja schon nach der ersten Reise verlassen musste. Er hatte, was niemand verwunderte, ihn selbst am allerwenigsten, den „Sack“ bekommen. Das heißt, es wurde ihm bei Ankunft im ersten deutschen Hafen ordentlich gekündigt. Für Hans persönlich war das kein Malheur, er würde sich halt wieder in gewohnter Weise durchbringen. Aber eine Nachricht kurz vor Deutschland, die ihn über Norddeich-Radio erreichte, erregte sein Gemüt gar sehr: Seine betagten Eltern hatten sich, ebenfalls bei Ankunft in Deutschland, zu Besuch angemeldet. Hans geriet völlig aus dem Häuschen, hatte er doch außer seinen abgerissenen Arbeitsklamotten nichts anzuziehen. Wie sollte er nur seinem alten Herrn, einem pensionierten hohen Beamten, gegenübertreten? Und dann auch noch das Mütterchen, Hans war völlig verzweifelt…
Da geschah etwas Seltsames. Hans, dessen selbstverschuldete Misere im Grunde niemanden berührte, eigentlich ja nicht einmal ihn selbst, wurde zum Objekt des allgemeinen Bedauerns. Eine Kollekte wurde veranstaltet. Jeder von uns simplen Janmaaten gab, was er eben noch entbehren konnte: Taschentücher, Unterwäsche, Krawatten, eine Sonnenbrille, ein blütenweißes Hemd, eine mit Bootsmannsnähten sorgsam zusammengeflickte, ausgeblichene Jeans. Ja, sogar eine Kamelhaarkutte, ausgestattet mit schicken Holzknebeln, war darunter. In der Tat, so eingekleidet mauserte sich Hans Ballermann zu einem flotten Seelord. Zum Glück bemerkten wir noch rechtzeitig, dass die Badelatschen nicht so recht zu seinem Aufzug passen wollten. Aber auch da fand sich Abhilfe, jemand opferte – nicht eingedenk der Tatsache, dass es bei Ankunft Bremen in Europa Winter sein wird – ein Paar elegante Leinenschuhe. Schließlich fehlte bloß noch eine würdevolle Kopfbedeckung. Die obligate blaue Pudelmütze schien uns für den Spross eines Beamten zu gering. Da es aber dann doch zu riskant war, einem der Offiziere seine Schirmmütze zu entwenden, und auch sonst – bis auf einen etwas zu breitkrempigen mexikanischen Sombrero – nix Anständiges aufzutreiben war, musste unser Musterknabe barhäuptig bleiben. Unter uns gesagt: Kein Hut der Welt hätte es vermocht, Hansens Visage auch nur annähernd zu mildern. Im Gegenteil, die Pudelmütze passte zu ihm wie zum deutschen Gartenzwerg die Zipfelmütze. Als dann doch tatsächlich im Bremer Überseehafen unter dem normalen „Empfangskomitee“ auch ein graues, unscheinbares, sich gegenseitig stützendes Pärchen auszumachen war, da waren wir alle ob unserer guten Tat zu Tränen gerührt. Nachträglich glaube ich sogar, dass ich mich an den Abgang der Ballermanns erinnern kann. Noch heute sehe ich Hans in Begleitung seiner gebrechlichen alten Eltern, die er um Haupteslänge überragt, entlang einer langen Kranflucht entschwinden…
Salina Cruz – fast hätte ich diesen Hafen vergessen – war in den 1960er Jahren ein kleines, verschnarchtes, halb versandetes Städtchen im Golf von Tehuantepec. Einstmals als pazifischer Brückenkopf am Isthmus von Tehuantepec gedacht, hat es einen künstlich geschützten Hafen, in dem auch große Seeschiffe Platz finden. Die im 19. Jahrhundert hochfliegenden Pläne, die 200 Kilometer breite Landenge als „trockenen Kanal“ auszubauen, wurden vorerst durch die Inbetriebnahme des Panama-Kanals gestoppt. Heutzutage sind die USA, schon damals treibende Kraft, wieder sehr an der Verwirklichung des alten Planes Puebla-Panama, kurz PPP, interessiert. Ich zitiere Wikipedia:
Vorgesehen sind ein „trockener Kanal“ für einen Hochleistungszug für den internationalen Containertransport sowie eine Mautautobahn zwischen Coatzacoalcos am Atlantik und Salina Cruz am Pazifik. Entstehen soll ein Korridor für die Petro- und Maquiladoraindustrie und großflächige Eukalyptusplantagen für die Papierproduktion. Ausgebaut werden sollen Fischerei und Tourismus. Das Leben der rund 2,2 Millionen betroffenen Einwohner des Isthmus und zugleich die Wirtschaft ganz Mexikos sollen ungekrempelt werden.
Vermutlich würde ich heutzutage Salina Cruz sicher nicht wieder erkennen, denn inzwischen ist es dank des Erdölförderers PEMEX, der da 1979 eine Raffinerie hinstellte, zu einem Industriezentrum und zur wichtigsten Hafenstadt des Bundesstaates Oaxaca geworden. Davon war damals natürlich noch keine Rede. Mir ist heute noch schleierhaft, was wir da eigentlich zu suchen hatten. Aber immerhin gab es ja bereits eine Bahnlinie zur anderen Seite des Isthmus; vielleicht hatten wir ja bloß ein paar Postsäcke abzuliefern. Das ist kein Witz, die Lloyd-Schiffe waren wirklich allen Ernstes auch Postschiffe! Aber eines waren diese Schiffe ganz gewiss nicht: nämlich auf dem jeweilig modernsten Stand der Technik. Aber selbst mittels eines Bugstrahlruders – falls es so was in den sechziger Jahren schon gegeben haben sollte – hätte die ILLSTEIN gegen die liebestolle Umklammerung des von der Sierra Madre herunterbrausenden Fallwindes keine Chance gehabt. Der Wind drückte das Schiff mit Herkuleskraft an die Innenseite der Außenmole, so dass selbst mit Schlepperhilfe an ein Ablegen nicht zu denken war. Da half auch alles Knirschen unseres kleinen Kapitäns nichts, dem der launige Wind den „Fahrplan“ verhagelte. Das „Knirschen“ ist übrigens nicht bloß bildlich gemeint. Die vom Gebirge herabstürzenden Fallwinde, unserem Fön vergleichbar, wirbelten jede Menge Sand auf. Mit diesem losen Material peitschten sie wie ein phänomenales Sandstrahlgebläse auf alles, was sich ihnen entgegenstellte, unbarmherzig ein. Warum ich das so genau weiß? Weil ich es nicht lassen konnte, den Zwangsaufenthalt des Schiffes zu einem Landgang zu nutzen. Aber selbst mit meinem provisorischen Gesichtsschutz kam ich nicht weit. Der Wind, nein, von nur einem Wind man da wirklich nicht sprechen, die Winde trieben mich von einer Ecke zur anderen, peitschten mich durch menschenleere Straßen; weit und breit keine, auch nur einen Türspalt offene Kneipe… Letztlich musste ich froh sein, dass mich diese Furie von einer „Windsbraut“ doch wieder an Bord absetzte, wenn auch reichlich zerzaust und mit brennender Haut und tränenden Augen …
Mit dieser windigen Angelegenheit will ich nun endlich meine Westküste-Zentralamerika-Reisen beenden. Zu Ehren der Schiffsführung – gemeint sind Kapitän Dietze und Chief Heinsohn – sind aber noch unbedingt ein paar Sätze hinzufügen. Freund Paul, gelernter Werkzeugmacher – inzwischen zum Motorenwärter avanciert – hatte den unbedingten Ehrgeiz, es bis zum Schiffsingenieur zu bringen. Nebenbei gesagt, hat er sein damaliges Fernziel, eines Tages als Chief die Maschine zu dirigieren, auch tatsächlich erreicht. Ich, nicht ganz so ehrgeizig, wollte doch wenigsten den Rang eines Steuermanns erklimmen. Aber mit Klimmzügen alleine war es ja nicht getan. Paule, weniger verträumt als ich, begann Nägel mit Köpfen zu machen. Das sah dann so aus, dass wir uns in unserer kargen Freizeit – natürlich nur auf See – auf den „Kusch“ stürzten. Für alle Ahnungslosen: Der „rote Kusch“ (wegen der Farbe seines Umschlags) ist – oder war – das Standard-Lehrbuch für Mathematik und Geometrie. Da wir unsere „Studien“ in aller Öffentlichkeit betrieben – z. B. während der Mittagspause und eben auch nach Feierabend, blieb unser „verdächtiges“ Verhalten auch niemandem verborgen. Unsere „Bühne“ war das auf dem Poopdeck abgestellte hölzerne Arbeitsfloß. Dort ließ es sich auch in der Tropensonne aushalten, ohne dass wir auch noch von unten angebraten wurden. Kurz gesagt: Wir büffelten im Schweiße unseres Angesichtes und – zogen so die Häme der lieben Kollegen auf uns. Bedingte dieser „Geisteseinsatz“ doch einen halbwegs nüchternen Dauerzustand. Aber, man lese und staune, wir erhielten massive Rückenstärkung – von ganz oben!
Zwei der drei „Eisheiligen“, der Alte und der Chief, waren auf unser „Tun“ aufmerksam geworden und mischten sich ein. Und zwar in der Art, dass sie damit begannen, für uns knifflige Rechenaufgaben zu ersinnen. Davon war ich im Grunde alles andere denn erbaut; meine Defizite auf mathematischer Ebene waren schlicht zu groß; Paul war da viel versierter oder einfach nur klüger… Na, wie dem auch war, unsere beiden Protagonisten beließen es nicht bei verqueren Dreisatzaufgaben und nüchternen Prozentrechnungen. O nein, sie übertrafen sich gar bald im Aushecken schwieriger Problemstudien, über die sie schließlich selbst in Streit gerieten. Das war schon sehr lustig, der ganze Dampfer amüsierte sich… Im Übrigen galt für Paul und mich – sehr zum Kummer unseres menschenfreundlichen Kapitäns – diese „enthaltsame“ Lernzeit nur für die Dauer der jeweiligen Atlantik-Überfahrt. Was auch immer diesen Gutmenschen in der Annahme bewog, dass wir uns fortan auch unter der Küste anständig benehmen würden – er wurde stets aufs Neue enttäuscht. Resignierend wusch er seine Hände in Unschuld und sprach wie gehabt: „Saufn wie de Großn, benähm wie de Gleen!“…