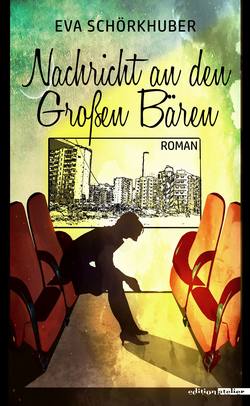Читать книгу Nachricht an den Großen Bären - Eva Schörkhuber - Страница 7
ZÄHNEKNIRSCHEN
Оглавление»Vor drei Jahren hat es begonnen«, seufzt sie und stellt die Teetasse auf den Tisch. »Jede Nacht weckt mich sein Zähneknirschen mindestens einmal, so furchtbar ist dieses Geräusch.«
»Ja, Paula, ich weiß.« Luise blickt sie über den Rand der Brille hinweg an. »Aber weißt du, er könnte etwas dagegen tun. Beim Zahnarzt gibt es diese Schutzvorrichtungen aus Plastik. Er legt sie vor dem Schlafengehen über seine Zähne, und fertig. Kein Knirschen mehr.«
Paula schlägt sachte mit dem Teelöffel gegen die Porzellantasse: »Ja, ja. Er hat mir auch versprochen, zum Zahnarzt zu gehen. Aber …«
»Nicht nachgeben, Paula, es ist ja zu euer beider Wohl.« Luise nimmt die Zuckerdose und lässt zwei Stück Zucker in die Tasse gleiten.
»Dieser Leopold, ach wirklich!« Annemarie prüft mit den Fingerspitzen den Halt ihrer Frisur. »Immer noch so dickköpfig.«
Paula und Luise wechseln Blicke. Durch das Fenster fällt die Spätnachmittagssonne in den Raum und spinnt honiggelbe Lichtfäden in die weißen Locken Annemaries.
»Na, der soll froh sein, dass er noch Zähne hat zum Knirschen.«
Helga schlägt ein Bein über das andere: »Meine Lieben, langsam wird es Zeit …«, sagt sie und legt die Karten auf den Tisch.
Die frühen Abendstunden tröpfeln in die Porzellantassen und verdunsten darin. Vor dem Fenster vertieft sich der Himmel in einen satten Blauton. Aus den Stillleben an den Wänden ziehen sich die matten Orange- und Ockertöne zurück. Sie verdunkeln sich und gähnen braunschwarze Löcher in die Tapete. In den Gesichtern werden die Lichtkorridore schmaler, ihre Falten werfen immer längere Schatten. Die Tür geht auf, die Schwester kommt herein und schaltet das Licht an. Der Teppichboden verschluckt ihre schnellen Schritte. Sie zieht die Vorhänge vor das Fenster und knipst die Stehlampe neben dem Sofa an. Vor dem Tisch bleibt sie stehen. Sie stellt die Porzellantassen und die Zuckerdose auf den kleinen Wagen, sammelt die Teelöffel ein und arrangiert sie in einer der leeren Tassen zu einem silbernen Bouquet.
»Meine Damen, langsam wird es Zeit …«
Als Paula auf die Straße tritt, ist es beinahe schon ganz dunkel. Nur am Horizont balanciert noch ein schmaler, heller Lichtstreifen zwischen dem Nachthimmel und der in der Abenddämmerung versunkenen Stadt.
»Gute Nacht, Paula, komm’ gut heim.« Helga sperrt das Auto auf. Luise lässt sich auf den Beifahrerinnensitz fallen.
»Gute Nacht, bist nächste Woche! Kommt gut heim.« Paula atmet tief durch. Sie ist müde. Letzte Nacht hat sie wieder einige Stunden wach gelegen. Nein, dieses Zähneknirschen, sie hält es nicht mehr aus. Luise hat recht, Leopold muss endlich etwas dagegen unternehmen. Der Weg nach Hause erscheint ihr mühsam und anstrengend, obwohl sie nur zwei Straßen entfernt wohnt von der Residenz, in der Annemarie lebt und wohin sie allwöchentlich zum Kaffeekränzchen lädt. Niemand ist auf der Straße. Ein schmaler Schatten huscht vor Paulas Füßen über den Asphalt. Die geschmeidige Bewegung hinterlässt einen dunklen Fleck auf Paulas Netzhaut. Sie bleibt stehen und starrt in die trübe Dunkelheit der Vorgärten. Sie kann nicht sagen, ob es nun eine Katze oder ein Frettchen, ob das Tier braun, grau oder schwarz gewesen ist. Einige Meter von ihr entfernt raschelt es. Ein kurzes Aufbäumen gegen die nebelige Stille der Kleinstadt. Paula bekreuzigt sich und setzt ihren Weg fort. Die Straße, in die sie jetzt einbiegt, ist von Thujenhecken gesäumt. Paula greift in eine der Hecken. So schön dicht ist die, ob ihre jemals so kräftig werden wird? Thujenhecken geben ihr Sicherheit. Sie sind hoch und aufrichtig. Sie schützen vor neugierigen, vor zudringlichen Blicken und unerwarteten Begegnungen. Sie berührt noch die eine oder andere Hecke, bevor sie in ihre Straße einbiegt. In ihrer Straße gibt es viel weniger Thujenhecken. Ein paar Holzzäune, ein paar niedrige Buchenhecken. Einige Vorgärten liegen sogar offen da und setzen die Häuser schutzlos fremden Blicken aus. Von Paulas Haus aber ist von der Straße aus nichts zu sehen. Sie greift in ihre Thujenhecke, um sie mit der schönen, dichten zu vergleichen. Nein, sie muss den Vergleich nicht scheuen. Auch ihre Hecke ist dicht, blickdicht und hochgewachsen. In der Küche brennt Licht. Paula schließt die Tür auf, zieht die Sandalen aus, schlüpft in die Hausschuhe und betritt die Küche.
»Guten Abend Leopold.«
Leopold sitzt am Tisch und liest Zeitung. Vor ihm stehen eine Flasche Bier und ein Teller mit Wursthautresten.
»Na, da bist du ja.« Er hebt den Kopf. Sein Blick fällt auf Paula und rinnt langsam über ihr Gesicht, ihre Bluse, ihre Hände.
»Kein Kuchen heut’?«
»Nein, Helga hat Zimtschnecken mitgebracht, aber nur vier Stück.«
»Schade.« Sein Blick zieht sich von Paulas Händen zurück auf die Schlagzeilen.
»Hast du’s schon gehört? Bei der Maria im Wirtshaus ist eingebrochen worden, das Geld ist weg und die Schank verwüstet. Die Zapfhähne sind abgerissen und die Bierflaschen zerschlagen. Sie vermuten …«
Paula atmet tief aus und sagt: »Das kann ich mir schon denken. Das haben sie davon. Alles muss seine Grenze haben, auch das Mitleid …«
Leopold sieht Paula an. »Aber die sind doch bei der Maria untergebracht, die werden nicht …«
Paulas Blick fixiert einen Punkt an der Wand, knapp über Leopolds Kopf: »Die kommen mit nichts und erwarten sich alles. Dass wir ihnen alles geben, Essen, Kleidung, ein Dach über dem Kopf, und dann wollen sie auch noch, dass wir …«
Leopold seufzt und schlägt die Zeitung zu.
»Wie war’s heut’ bei der Annemarie?«
Paula hebt die Schultern und lässt sie wieder fallen: »Wie immer.« Sie geht zur Anrichte und wischt mit dem Geschirrtuch ein paar Wassertropfen auf.
»Leopold«, Paula nähert sich dem Tisch, »Leopold, können wir noch einmal über deine Zähne reden?«
Er blickt sie an: »Ah ja, das wollte ich dir sagen. Ich bin heut’ beim Zahnarzt gewesen und hab’ mir das hier besorgt.« Aus der Tasche zieht er einen kleinen, halbrunden Behälter und klappt ihn auf. Darin liegt die Schutzvorrichtung aus Plastik, von der Luise heute Nachmittag gesprochen hat.
»Na, langsam ist es auch Zeit geworden …«
Luise sitzt auf ihrem Balkon und blickt auf das dunkle, gleichmäßig rauschende Flussband. Die Postkarte, die sie heute von ihrer Tochter bekommen hat: Irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Zu euphorisch ist sie gewesen, zu sehr ist sie ins Detail gegangen. Zwischen den genauen Schilderungen ihres Tagesablaufes, zwischen den Lobgesängen auf das Wetter, das Essen, die Menschen verbirgt sich doch etwas. Ihre Tochter, die sonst kaum Postkarten schreibt. Und wenn, dann verschickt sie nur knappe Grußbotschaften. Seltsam. Vielleicht ist sie aber auch wirklich begeistert von diesem Land, von diesem so fremden Land. Luise zieht an ihrer Zigarette. Dass Annemarie noch immer so tut, als wäre sie vertraut mit Leopold. Dabei ist das sechzig Jahre her, das mit dieser Jugendliebe. Obwohl – ein Traumpaar sind sie damals schon gewesen, die Annemarie und der Leopold. Sie haben wild und unkonventionell gelebt, sind gereist, haben auf Ehepapiere gepfiffen und so weiter. Nur dann, dann hat Annemarie beschlossen, auszuwandern. Sie wollte in die USA gehen, weil die dort ihrer Meinung nach schon viel weiter, viel aufgeschlossener waren als hier in Europa. So hat sie versucht, Leopold zu überreden, mitzukommen. Der aber hat Angst bekommen. Das ist ihm zu weit gegangen, das mit dem Auswandern in die USA, auf einen anderen Kontinent.
Luise zieht fest an ihrer Zigarette, Rauchfahnen steigen aus ihrem Mund. Wie angespannt die Stimmung zwischen Annemarie und Leopold in dieser Zeit gewesen ist. Annemarie hat jede Gelegenheit genutzt, um das Leben in Amerika zu loben, um seine Vorzüge hervorzuheben, die Weite des Landes, den Lebensstandard. Leopold hingegen ist immer verschlossener geworden, immer gereizter. Schließlich ist Annemarie allein abgereist und Paula ist auf den Plan getreten. Ob sie zuvor schon in Leopold verliebt gewesen ist, das weiß Luise nicht. Auf jeden Fall ist Paula nach Annemaries Abreise öfter mitgefahren bei den Wochenendausflügen. Helga, Paula, Leopold und sie haben Ausflüge gemacht zu den Seen, in die Berge. Das sind so kurz nach dem Krieg die einzigen Möglichkeiten gewesen, hinauszukommen aus der Stadt, hinauszufahren aufs Land. Paula ist nie gerne gereist. Luise muss lächeln. Die Paula, denkt sie, die ist in ihrem Leben noch nie im Ausland gewesen, außer in Deutschland, aber damals … Auf jeden Fall hat sie immer gute Gründe dafür gefunden, warum sie in dieses oder jenes Land nicht reisen könne, klimatische Zumutungen, kulinarische Waghalsigkeiten, unzuverlässige Mentalitäten. Bei ihr hat der Leopold keine Angst haben müssen, dass sie je auswandern würde. Luise dämpft die Zigarette aus. Paula und Leopold haben geheiratet, und Annemarie ist viele Jahre später zurückgekommen, geschieden und voller Lebenserfahrung. Im Grunde ist Annemarie von ihnen allen am weitesten gekommen, sie hat am meisten erlebt. Warum sie dennoch zurückgekehrt ist in diese Kleinstadt, das weiß keine. Zumindest haben sie das noch nie zusammen besprochen, Annemarie, Helga, Paula und sie. Vielleicht ist das so wie bei den Lachsen, die nach einem aufregenden und wilden Leben viele, viele Kilometer zurücklegen, um an ihren Geburtsort zurückzukehren, um dort zu laichen und zu sterben.
Das mit dem Laichen allerdings wird nichts mehr werden bei Annemarie, denkt Luise und lacht. Was, wenn sich ihre Tochter entschließen sollte, dort zu bleiben, in dem fremden Land? Wenn auch sie auswandern sollte? Würde sie versuchen, sie davon abzuhalten? Würde sie sie unterstützen? Würde sie sich darauf freuen, auf Besuch dorthin zu fahren? Luise zündet sich eine neue Zigarette an. Das Feuerzeug wirft eine kleine Flamme in die Dunkelheit, ein Aufflackern, ein Aufglimmen. Warum sollte sie dann nicht gleich zu ihrer Tochter in das fremde Land ziehen? Sie könnte doch auch auswandern. Dafür gibt es keine Altersbeschränkung, und wenn sie sich vorstellt, dass sie jetzt, in ihrem Alter noch ein neues Leben beginnen würde, das wäre … ja, das wäre auch eine Genugtuung. Annemarie hat es damals gewagt, auszuwandern, sie ist aber zurückgekommen und hängt immer noch an ihrem früheren Leben hier. Diese Bemerkungen, die sie immer wieder über Leopold fallen lässt, mit denen sie versucht, an eine alte, längst verjährte Vertrautheit anzuknüpfen, sie haben auch etwas Trauriges, etwas verbrämt Nostalgisches. Alte Liebe rostet schnell – das weiß sie, davon kann sie ein Lied singen. Dieses Lied möchte zwar niemand hören, aber es ist die Wahrheit, keine reine, sondern eine schmutzige, aber immerhin – eine Wahrheit.
Zwei Schatten wachsen aus dem Schilfgeflecht am Flussufer. Es raschelt. Es knirscht. Wie die Zähne vom Leopold, denkt Luise und stellt sich vor, dass diese raschelnden und knirschenden Schatten ein Liebespaar sind, ein junges Liebespaar, das noch nicht verrostet, noch nicht eingerostet ist. Sie muss lachen. Der Zigarettenrauch fährt aus ihrer Nase. Sie muss husten. »Ein Drache bin ich, ein alter Drache.« Sie muss wieder lachen. Sie lehnt sich zurück. Schwer wiegen sie, die Augenlider, gleichmäßig rauscht es, das Wiegenlied. Und da Heidschi Bumbeidschi is kumma … vor vielen Jahren hat sie das ihrer Tochter vorgesungen, dieses schreckliche Wiegenlied, einfach so, weil auch ihre Mutter damals schon … is kumma, und hat ma des Biable mitgnumma, er hat ma’s mitgnumma und hat’s neamma bracht, drum winsch i meim Biable a recht guade Nacht … Kindesentführung durch einen Schlafgeist, oder ist es gar der Tod, der den einschlafenden Kindern in die Ohren gelegt wird? Der Heidschi-Bumbeidschi-Tod, der Freund Hain, der mit den Zähnen klappert, klapprig und elend dieser Tod mit seinem Grinsen, seinen Zahnreihen, seinen gebleckten Zähnen. Was denk’ ich da, so von den Zähnen, nein, vom Tod weg, alles denke ich weg, aber hier ist doch ein Zimmer, oder nein, ein Salon, und in dem steht Helga. Aus ihrem Mund wächst ein Schweif, ein Pferdeschweif, der kräuselt sich dem Boden zu. Eine Lockenkaskade, die zu Boden fällt, den Boden bedeckt. Auf dem rauen Holzboden bildet sich ein Haarnest, ein weißer Lockenkopf schraubt sich aus dem Boden, schnell, immer schneller – Annemarie, Annemarie, bist du das, dieser Kopf-Kreisel, der durch den Raum stiebt und tobt, wie aufgezogen und losgelassen, ein Haarwirbel, ein Locken-Taifun, aber Annemarie, Annemarie! Und dort auf dem Stuhl, da sitzt Paula. Gefaltet sind ihre Hände im Schoß, faltenlos glatt ist ihr Gesicht, sie aber ist uralt. Ihr Mund ist gespitzt, ein Kussmund, ein verdorrter Kussmund, der aus dem Gesicht fällt und auffliegt. Mit keiner Wimper zuckt die nun mundlose Paula, sie sitzt mit den Händen im Schoß gefaltet und wartet – worauf Paula, worauf?! In das faltenlos glatte Gesicht fräst sich ein Mund, von rechts nach links reißt das Wangenfleisch auf und macht der Mundhöhle Platz. In die Mundhöhle fallen die Zähne, Fallbeile sind es, die herabsausen, ihr Knirschen ist das Knirschen der Wirbel-, der Schädelknochen, die brechen und splittern. Paulas Zähne knirschen unermüdlich, zwischen ihnen hängen Knochensplitter und Fleischreste. Woher hast du das ganze Leben genommen? Paula, Paula, langsam wird es doch Zeit …
Paula sitzt am Bettrand, ihre Hände liegen gefaltet im Schoß. Hinter ihrem Rücken hört sie, wie Leopold die Hausschuhe abstreift und die Bettdecke zurückschlägt. Schwer fällt der Körper auf das Bett. Paula spürt, wie sich die Matratze auf ihrer Seite hebt. Ein Knacken hört sie, es sind die alten Knochen, die zur Ruhe gebettet werden. Da ist noch ein anderes Geräusch, ein Klicken, ein Behälter schnappt auf und dann wieder zu. Und dann noch ein Schmatzen, ein gedämpftes Mahlen der Zähne. Leopold brummt »Gute Nacht« und knipst das Licht auf seiner Seite aus. Paula murmelt »Gute Nacht« und bleibt sitzen. Sie lässt die Hausschuhe von ihren Füßen gleiten. Unter ihren Fußsohlen kräuselt sich der blonde Bettvorleger. Im Schlafzimmer ist es angenehm kühl. Der dunkle Kleiderschrank und der gepolsterte Lehnstuhl werfen kompakte Schatten. Das alte, hölzerne Schaukelpferd zeigt im Halbdunkel seine Zähne. Auf und davon kann es nicht, nur taktvoll wippen. Die Porzellanfigur auf dem Nachtkästchen streckt ihren weißen Arm in die trockene, mehlige Luft. Zur fragilen Salzsäule ist sie erstarrt, die Primaballerina. Ihre Beine zittern nicht beim Spitzentanz, der Tüll ihres Rockes wogt nicht im Rhythmus des Balletts. Eingelassen in Porzellan sind die Bewegungen der Arme und Beine, der Schwung der Rockfalten. Glasiert die weiße Haut, der blaue Stoff, sie ringen nach Atem. Unter dem Lichtkegel der Nachttischlampe ruhen Paulas Hände auf dem weißen Stoff ihres Nachthemds. Knochige, von dünner, rot und blau marmorierter Haut umspannte Finger bilden ein schmales, ein andächtiges Zelt. Was ihr schon alles durch die Finger gegangen ist, denkt Paula und hebt die Hand zum Gruß. Im aschfahlen Dämmerlicht zittert ein ausgestreckter Arm wie ein knorriger Ast im reißenden Gebirgsbach. Hinter den halb gesenkten Augenlidern nimmt Paula Schritte vor sich wahr, hört ihr Knirschen im Kies. Ein Paar alter, abgewetzter Bergschuhe wühlt sich seinen Weg über die Schotterstraße. Sie kann kaum Schritt halten, sie hastet hinterher, keucht: »Warte, nicht so schnell.« Der Weg säumt eine Schlucht. Der zwischen den Steinwänden eingepferchte Bach schäumt. Leopold dreht sich um: »Woher hast du das ganze Leben genommen, Paula?« Sie versteht nicht, was er meint. Sie lebt, sie ist lebendig, sie ist mit ihm, sie ist da und will nicht weg. Immer mehr Schritte hört sie, immer mehr Füße wühlen sich ihren Weg über die Schotterstraße. Das Knirschen im Kies wird lauter. Eine Stimme ruft: »Und links, zwo, drei, vier …« Die vielen Schritte vereinigen sich zu einem einzigen lauten Stampfen. Da ist kein Knirschen, keine Unordnung mehr in den Bewegungen. Sie kann Schritt halten. Das Gehen bereitet ihr keine Mühe. Jede Bewegung sitzt. Da läuft sie nicht Gefahr … Paula schreckt auf. Da ist ein Geräusch gewesen, da, in ihrem Garten. Sie schlüpft in ihre Hausschuhe und geht zum Fenster. Die Straßenlaterne wirft blasse Lichtflecken in den Vorgarten. Scharfrandige Schatten fallen von der Hecke auf das Gras, malen schwarze Türme und Zinnen. Ein Rascheln, direkt unter dem Fenster. Paula hält den Atem an. Sind sie jetzt gekommen? Zuerst haben sie Marias Wirtshaus überfallen, und nun … Vor denen kann auch ihre schöne, blickdichte Thujenhecke sie nicht beschützen. Ein schmaler, schwarzer Schatten springt über den Rasen in die Hecke. Auf Paulas Netzhaut hinterlässt er einen dunklen Stern. Paula atmet auf, bekreuzigt sich. »Oh Herr, erlöse uns von dem Bösen, denn Dein Reich komme …«, Paula muss husten. Ihre Kehle ist trocken. Sie schleppt sich in die Küche. Ein Glas Wasser trägt sie ins Schlafzimmer und stellt es auf dem Nachtkästchen ab. Sie knipst das Licht aus und legt sich schlafen. Paula konzentriert sich auf den gleichmäßigen Atem Leopolds. Er schläft. Kein Zähneknirschen ist zu hören. Hoffentlich hält das. Sie würde so gern wieder eine Nacht durchschlafen.
Wie schwarzer Velours legt sich die Nacht in Paulas Schlafzimmer über die Menschen und Gegenstände und lässt ihnen einen nur flachen Atem. Mit ihren seichten Atemzügen, dem leisen Krachen der Scharniere und Knochen stanzen die Menschen und Gegenstände kleine Löcher in den Stoff, aus dem die Nacht ist. Die Geräuschsterne funkeln in den Ohren Paulas. Sie hält kurz den Atem an, so schön sind sie. Auf dem schwarzen Lauschfirmament taucht ein neuer Stern auf. Er ist groß und grell. Er knirscht. Paula fährt herum. Das darf doch nicht wahr sein! Schon wieder!
Der knirschende Stern wird größer. Er ist so grell, dass er die anderen Sterne übertönt. Er wächst weiter, er schwillt an. Dann explodiert er. In Paulas Ohren dröhnt das Knirschen unzähliger Zähne, unendliche Zahnreihen reiben sich und stoßen aneinander. Das dunkle Lauschfirmament wird blendend weiß. Paula kann die Ohren nicht schließen. Das Knirschen der Zähne zermalmt das Trommelfell, es gräbt sich in die Gehörgänge, die Ohrmuschel ist voll von brennendem Kalk.
Paula hält sich die Ohren zu. Sie steht auf dem Appellplatz. Einer der Hunde beißt gerade einer Frau die Kehle durch. Sie kann die Schreie nicht hören. Sie nimmt ihre Reitgerte und schlägt auf eine der Frauen in der ersten Reihe ein. Die darf nicht schreien. Die ist noch nicht tot. Paula schreit. Die Frau liegt am Boden. Sie muss aufstehen und die Leiche wegtragen. Der Hund geht bei Fuß. Zwischen seinen Zähnen hängen Hautfetzen. Paula geht in die Wachstube und trinkt ein Glas Schnaps. Es ist Mittag. Zeit, zu essen. Die Kantine ist voll. Das Rindfleisch ist faserig, aber immerhin, sie haben noch Fleisch. Paula nimmt einen Zahnstocher, um das Fleisch zwischen den Zähnen zu entfernen. Sie stochert zwischen den Zähnen herum, gedankenverloren. Zwischen zwei Backenzähnen ist ein größerer Brocken hängengeblieben. Sie sticht hinein und zieht ihn heraus. Eine Erbse ist es, eine Erbse mit weißem Flaum. Schimmel, denkt Paula, doch der weiße Flaum wächst, er kräuselt sich über ihre Finger, die den Zahnstocher mit der aufgespießten Erbse halten. Die Locken fallen auf die Tischplatte. Die Erbse ist ein verschrumpelter Lockenkopf, der sich wild dreht. Der Kopf-Kreisel schraubt sich über den Zahnstocher hinaus und fällt auf den Tisch. Der Zahnstocher schnellt zurück wie ein Degen und springt in Paulas Mund. Er fährt zwischen die Zähne und hebelt sie aus. Ein Zahn nach dem anderen tröpfelt auf die Tischplatte. Die Zähne sind blutig. Fleischreste hängen an ihren Wurzeln, Knochensplitter rieseln herab. »Woher hast du das ganze Leben genommen?«, hört Paula Luise sagen und: »Langsam wird es doch Zeit.«
»Wofür?« fragt Paula und stellt die Tasse auf den Tisch. Luise lässt Paulas Zähne in die Tasse gleiten und rührt um.
»Aber weißt du, es ließe sich etwas dagegen tun …«
Paula schlägt sachte mit dem Teelöffel gegen die Porzellantasse: »Nicht jetzt.« Annemarie prüft mit den Fingerspitzen den Halt ihrer Frisur.
»Immer noch so dickköpfig.«
Durch das Fenster fällt die Spätnachmittagssonne in den Raum und spinnt blutrote Lichtfäden in die weißen Locken Annemaries.
»Dieser Rotbuschtee schmeckt ohne Zähne am besten.«
Helga schlägt ein Bein über das andere und legt ihre Zähne auf den Tisch. In der bernsteinfarbenen Flüssigkeit versickern die frühen Abendstunden. Vor dem Fenster kräuseln sich die Wolken, tiefblau ist die Kopfhaut des Himmels. Der Wein und die Früchte der Stillleben verschwinden in den dunklen Mundhöhlen an den Wänden. Die Schatten in den Gesichtern werden länger. Die Schwester tritt ein und knipst die Stehlampe an. Unter ihren Schritten knirscht der Boden.
»Meine Damen, langsam wird es Zeit«, sagt sie und räumt den Tisch ab. Sie stapelt die Tassen und Teller auf dem kleinen Wagen, sammelt die Zahnstocher ein und arrangiert sie in einer der leeren Tassen zu einem Bouquet. Sie nimmt die Zuckerdose und leert die verbliebenen Zähne auf den Boden.
»Meine Damen, wir müssen immer schön schauen auf uns. Dass es nur nichts zum Zähneklappern gibt. Das ist ungesund.«
Sie lacht und streicht sanft über Paulas Wange.
Du wirst dich jetzt wieder auf meine Stimme konzentrieren. Meine Stimme wird dir dabei helfen, den Aufenthaltsraum der Seniorenresidenz zu verlassen, um weiter zu kommen. Sie wird dich aus den Untiefen deiner Traum-, deiner Erinnerungsfluchten führen in andere, noch tiefere Bereiche deiner Angst. Du wirst sehen, wie es dir dann ergehen wird. Ich zähle jetzt bis zehn. Wenn ich bei zehn angelangt bin, wirst du dich wieder auf den Weg gemacht haben, um die Welt zu verändern. Ich sage: eins. Du ziehst dich langsam von dem großen Fenster zurück. Zwei. Du wirfst einen letzten Blick in das geräumige Zimmer mit den schwarz klaffenden Mundhöhlen an den Wänden. Drei. Du fliegst zurück zum Bahnhof. Vier. Deine Hände und deine Finger werden wärmer und schwerer. Fünf. Die Wärme dehnt sich aus von deinen Händen über deine Arme, deine Schultern und deinen Nacken. Sechs. Deine Füße und deine Beine werden schwerer. Sieben. Du sinkst langsam. Acht. Du spürst wieder Boden unter deinen Füßen. Neun. Du nimmst deine weiche, schwarze Reisetasche und prüfst, ob mit deinen Papieren alles in Ordnung ist. Bei zehn wirst du in einem Zug sitzen, der aus der Kleinstadt hinausrollt. Ich sage: zehn.