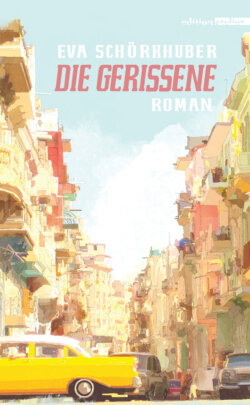Читать книгу Die Gerissene - Eva Schörkhuber - Страница 6
1. KAPITEL
ОглавлениеWie Mira in Marseille Mülltonnen durchwühlte und
dabei zur berühmten Modeschöpferin avancierte
So viele Wendungen mein Leben auch genommen, so viele Rückschläge ich auch hingenommen haben mag, es sind immer wieder jene hellen Momente aufgetaucht, die mich aus einer misslichen Lage befreit, die eine unglückliche Situation plötzlich in einem anderen Licht haben erscheinen lassen. Viele haben gemeint, dass ich ein Glückspilz sei, ein Sonntagskind. Davon aber kann keine Rede sein, sondern vielmehr davon, dass mich das Unglück stets begleitet hat, so wie jener kompakte und undurchdringliche Schatten, der mich gehen und atmen lässt. Nur hat sich mein Unglück in manchen Momenten derart verdichtet, dass es sich, solcherart zur Potenz genommen, in Glück verwandelt hat.
Während der ersten Stunden meines Aufenthaltes in meiner ersten Hafenstadt bin ich von Missgeschicken geradezu heimgesucht worden. Dabei ist das Ankommen in dieser Stadt am Rande des Mittelmeeres äußerst vielversprechend gewesen. Am Vorplatz des Bahnhofs bin ich gestanden, zu meinen Füßen hat sich eine Kaskade aus Steinstufen ergossen, eine prächtige Einladung, hinunter in die Stadt zu steigen. Die Steinlöwen, die die Treppe flankieren, strahlten majestätisch im honiggelben Abendlicht und sprachen mir Kraft und Mut zu. Also habe ich mich auf den Weg gemacht, hinunter in die Stadt. Als ich beinahe am Ende der Steintreppe angelangt war, sprachen mich zwei Männer an. Trotz des goldenen Abendlichts waren ihre Gesichter fahl, wie zwei gehetzte Tiere huschten ihre Augen hin und her. Sie gaben mir zu verstehen, dass sie etwas Geld benötigten, und ich, noch ganz bewegt von dem pompösen Empfang, den diese Stadt mir hier bereitet hatte, zog meine Geldtasche hervor. Noch bevor ich das Fach mit dem Kleingeld öffnen konnte, riss mir einer der Männer die Geldtasche aus der Hand. Dann rannten beide davon, und ich stand mit leeren Händen da. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sah ich uniformierte Menschen, mit Maschinengewehren patrouillierten sie vor dem Eingang eines Geldinstituts. Ich ging hin und erklärte ihnen mit Händen und Füßen, durchsetzt von ein paar Brocken Englisch, dass ich gerade ausgeraubt worden sei. Gelangweilt sahen sie mich an, einer zeigte mit einer ausholenden Geste auf ein Gebäude fünfzig Meter weiter. »Police«, sagte er und sah über mich hinweg. Ich ging in die Polizeistation hinein und versuchte mich dort einem Beamten gegenüber verständlich zu machen. Er sah mich an, klopfte mit Zeige- und Mittelfinger auf seine Wange und fragte: »Black?« – »No, white«, sagte ich, und er wollte meinen Ausweis sehen. Sein Blick sprang von meinem Pass in mein Gesicht und wieder zurück. »Très jeune«, murmelte er, und »Marseille is une ville dangerous.« Ich hätte ihm gerne erklärt, dass das nicht stimme, dass das ein Vorurteil sei, das aus den zahlreichen Mafiafilmen stamme, die in und über diese Stadt gedreht worden sind, dass ich das aus zuverlässiger Quelle hätte, von Marie und Asra nämlich, mit denen ich von Mailand bis nach Aix en Provence gefahren war, die das wissen mussten, denn schließlich haben sie lange hier gelebt. All das hätte ich dem Beamten gerne erklärt, aber mir fehlten dazu die Gesten und die Wörter auf Englisch, von Französisch ganz zu schweigen. Ich nickte, wollte aufstehen und gehen, aber da nahm er mich am Arm und meinte: »Not eighteen, tu must stay ici.« »What?«, stieß ich hervor, und er sah mich ernst an: »Tu stay ici, I will appeler your parents.« »But … but I …«, versuchte ich zu protestieren, aber da hatte er mich schon in eine Zelle geschoben und hinter mir abgeschlossen.
Da saß ich nun, in Polizeigewahrsam. Anstatt durch die Stadt zu spazieren, anstatt durch den Hafen zu streunen und das Kommen und Gehen zu beobachten, musste ich mich für die Nacht in dem kleinen kahlen Raum einrichten. Die prächtige Treppe, die sich wie eine Kaskade in die Stadt hinunterergoss, hatte mich schnurstracks ins Gefängnis geführt. Nein, auch hier war ich nicht gut angekommen, ebenso wenig wie in dem Dorf, in das meine Eltern gezogen waren auf ihrer Suche nach einem besseren Leben, die sie aber nur in den Schlachthof geführt hatte, wo sie ihre Tage mit Hilfs- und Putzarbeiten verbrachten, ihre langen Tage, die jetzt, nachdem ich abgereist war, wohl mit der bangen Hoffnung endeten, ich könnte plötzlich wieder nach Hause, ich könnte vielleicht doch wieder zurückkommen. Habe ich mich nicht auch auf den Weg gemacht, um wenn schon nicht ein besseres, so doch ein weiteres Leben zu finden? Und wo war ich gelandet, schon am Tag meiner Ankunft? In Gedanken so kratzig wie die Filzdecken auf den Zellenpritschen war ich verstrickt, als sich die Tür öffnete. Ich sprang auf in der Hoffnung, ich werde nun doch entlassen und könne hinaus, hinaus in die Stadt, hinaus in den Hafen. Die Tür aber hatte sich nicht für mich geöffnet, sondern für einen anderen Menschen, der in die Zelle trottete und auf der Pritsche mir gegenüber Platz nahm. Lang und verfilzt waren seine Haare, so wie die Haare der Leute von der Alten Mühle. Ein paar Wortfetzen stieß der Mensch zwischen den Zähnen hervor. An der Stimme erkannte ich, dass es sich um eine Frau handelte. Nach ein paar Augenblicken hob sie den Kopf, sagte »Bonsoir« und sah mich schief an. »What the fuck …«, zischte sie, nachdem ihre Augen ein, zwei Blicke lang auf meinem Gesicht geruht hatten. »T’es très jeune, qu’est tu fous ici?« – »No français«, stotterte ich, und sie fragte mich auf Englisch, was ich hier mache. Ich erzählte ihr von meinen Missgeschicken und fügte hinzu, dass die Polizei meine Eltern unter gar keinen Umständen anrufen dürfe, weil die nur darauf bestehen würden, dass ich zurückkehre in das Dorf, das tatsächlich eine uneinnehmbare Festung sei, mit seinen Wällen aus Gepflogenheiten und seinen Gräben des Misstrauens gegenüber allem, das sich nicht umstandslos den Anstands- und Alltagsmechanismen unterwerfe. »I will never go back, never«, rief ich, und die Frau legte ihre Hand auf meinen Arm, um mich zu beruhigen. »You don’t have to go back, I have an idea«, sagte sie. »Tiens, here is a phone number, a French phone number from Marseille.« Ich solle einem anderen Polizeibeamten sagen, ich hätte Familie in Marseille, weshalb ich hier sei, das habe der andere Kollege leider nicht verstanden. Sollte der andere Polizist auch kein Englisch sprechen, könne sie ja für mich dolmetschen. Auf jeden Fall könne die Polizei bei der Nummer anrufen, das seien Freundinnen, die würden alles bestätigen. Aus eigener Erfahrung wisse sie, dass die Polizei hier immer froh sei darüber, keine Scherereien zu haben. »They will let you go as soon as they have the confirmation on the phone that you’ve got family here.« Ich war sprachlos vor Staunen und Dankbarkeit. Sie aber lachte nur und stellte sich vor. Stella, so heiße sie, wie Stella maris.
»Mira«, sagte ich und: »Why are you here?« Stella führte ihren Zeige- und ihren Mittelfinger an den Mund und schürzte die Lippen, als würde sie an einer Zigarette ziehen. Die Polizei habe sie auf dem Schirm, sie würde sie jedes Mal hopsnehmen, wenn sie mit ein paar Gramm unterwegs sei, dann müsse sie einige Wochen lang regelmäßig zur Kontrolle kommen. Wenn das vorbei sei, würde sie weitermachen, mit dem Rauchen und dem Verkaufen. Bis zum nächsten Mal.
Die Nacht im Gefängnis ist lang gewesen und kühl. Ich habe mich nicht überwinden können, die kratzige Filzdecke zu verwenden, also bin ich fröstelnd auf der Pritsche gelegen und habe im Halbschlaf den vorangegangenen Tagen, meiner Abreise und meinem Ankommen nach gedacht. Die Bahnfahrt nach Italien habe ich Revue passieren lassen, ich habe mich zusammengekauert im Abteil sitzen sehen, voll Angst, von jemandem angesprochen, von jemandem erkannt zu werden, voll Freude, endlich davongekommen zu sein. Vor den Fenstern ist die Landschaft vorbeigezogen und hat sich zu falten begonnen. Die leuchtenden Berggipfel und die dunklen Täler haben mich träumen lassen von den Höhen und Tiefen, die ich durchwandern, von all dem Licht, in dem ich stehen würde, und von den großen Schatten, die auf jene fielen, die versuchten, mich aufzuhalten. Ich habe an Mailand gedacht, an mein zielloses Gehen durch die Stadt, die zu groß, zu laut für mich war, an das kleine Café, in dem ich Espresso getrunken und Asra kennengelernt habe. Asra mit den dunklen Augen und der roten Jacke, die mich auf Englisch angesprochen und mir schließlich vorgeschlagen hat, mit ihr und ihrer Freundin nach Frankreich zu fahren, nicht direkt ans Meer, aber in die Nähe davon. Mit Marie und Asra im Auto, ein blauer Peugeot, die laute Musik, das Singen und Lachen, die Zigaretten und die Sandwiches, schließlich die Einladung, mit ihnen in das Dorf zu fahren, in dem sie lebten. Meine Panik davor, wieder in eine Umlaufbahn hineinkatapultiert zu werden, die ich nur kraft der fremden Saite, die in meine Existenz hinein- und hinausschwingt, verlassen kann, so wie das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Meine zögerliche Ablehnung, Maries Verständnis, Asras Unverständnis, ihre Diskussionen darüber, ob ein Leben am Land oder ein Leben in der Stadt freier und selbstbestimmter sei, alles auf Englisch, damit ich ihnen zuhören konnte, ich aber schweigend, neugierig, mit gespitzten Ohren und ängstlich. Die Erleichterung, als Marie und Asra mich in Aix en Provence am Bahnhof aussteigen ließen, Marie, die mit mir zum Schalter ging, das Ticket kaufte und mich in den Zug nach Marseille setzte. Die Aufregung, als ich Richtung Marseille abfuhr, das Kribbeln in den Armen, den Beinen, jeden Augenblick der Fahrt festhalten, jeder Lichtfleck auf den Fassaden, den Hügeln und Bäumen schien mir aus Sternenstaub. Die steinernen Kaskaden im Abendlicht, die fahlen Gesichter und gehetzten Augen, die grelle Wachstube, all das hat sich in dieser Nacht verdichtet und mich kreisen, taumeln und torkeln lassen. Irgendwann, als die ersten Morgengeräusche schon dumpf in die Zelle gedrungen sind, habe ich meine Eltern gesehen, ein verschwommenes Bild hat sich auf meine Augenlider gelegt, wie sie mit blutverschmierten Kleidern und Händen dastehen. Ihre Gesichter sind ruhig, folgsam, beinahe andächtig. Verachtung ist in mir hochgestiegen, ein bitterer Klumpen, der in meiner Brust pulsierte und seine galligen Strahlen den Rachen hinaufschickte. Gerne hätte ich die traurigen Ikonen meiner Eltern durch ein anderes Bild ersetzt, eines, auf dem sie zu sehen waren, wie sie mit Freunden im Garten saßen, wie sie Kuchen und Schnaps kredenzten, in ihren alten und neuen Sprachen Sprüche klopften. Aber es ist mir nicht gelungen, das Bild zu verändern.
Am nächsten Morgen wurden Stella und ich gemeinsam entlassen. Stella hatte sich schriftlich dazu verpflichtet, dass sie dreimal die Woche zur Polizeistation kommen, sich melden und ihre Urinproben abgeben würde, und ich, ich hatte einem Beamten die Telefonnummer von Stellas Freundinnen gegeben, er hatte angerufen und von den Freundinnen die Bestätigung erhalten, dass ich ihre Nichte sei, auf die sie schon sehnsüchtig warteten. Von der Polizeistation traten wir in den warmen Vormittag hinaus, auf die breite Straße, auf der so viele unterschiedliche Menschen unterwegs waren, wie ich sie in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen hatte. Menschen in zerschlissener, vor Schmutz steifer Kleidung gingen neben Menschen in silbrig schimmernden Anzügen, kräftige Rot-, Grün- und Blautöne leuchteten auf schwarzer Haut, weiße, braune und rote Köpfe bahnten sich ihre Wege, schoben sich über das Pflaster und drängten in die Busse. Ich konnte meinen Blick nicht lösen von dem Treiben, von dem farbenprächtigen Wogen und blieb wie angewurzelt vor dem Eingang der Polizeistation stehen. Stella berührte mich schließlich am Arm und fragte, wo ich denn eigentlich wohnen wolle, hier in Marseille. Ich zuckte mit den Schultern. Einen Moment lang zögerte sie und meinte dann, dass ich mit ihr kommen solle, sie wisse einen Platz, wo ich bis auf Weiteres unterkommen könne. »In the port?«, fragte ich ganz aufgeregt. »Mais non, that’s not a hotel, that’s La Reine.« Also gingen wir nicht in den Hafen, sondern die breite Straße noch ein Stück hinauf, an der Stufenkaskade vorbei, die sich vom Bahnhofsvorplatz in die Stadt hineinergoss, und bogen in eine dunkle Seitengasse ein. Auf den Treppen vor den Hauseingängen saßen Frauen in engen Kleidern und mit grellen Farben im Gesicht, mit rubinroten Lippen und türkisblauen Augenlidern. Sie rauchten und blickten gelangweilt auf die Straße. Eine von ihnen erhob sich, schritt auf uns zu, die hohen Absätze ihrer schwarzen Lackstiefel bohrten sich in den Asphalt.
»Stella, ma chérie, tu m’as apporté quelque chose?«
Die Stimme der Frau klang wie die in die Höhe geschraubte Stimme eines Mannes. Stella schüttelte den Kopf und wechselte mit der Frau ein paar Worte auf Französisch, ich verstand nur »police« und »désolée«. Die Frau stand mit zusammengepressten Lippen da und machte immer wieder eine Handbewegung, als wolle sie eine Fliege verscheuchen.
Zum Abschied küsste sie Stella und umarmte sie. Als wir unseren Weg die dunkle Straße hinauf fortsetzten, erzählte mir Stella, dass Hervé einer ihrer Kunden sei, dass er immer bei ihr das Gras kaufe.
»He?«, fragte ich erstaunt. Sie lachte und meinte: »T’es vraiment très jeune, yes, Hervé is a man, he just works in women clothes.« An diesem Tag habe ich nicht verstanden, dass die Männer und Frauen in den engen Kleidern und mit den grellen Farben im Gesicht auf Freier, manchmal auch auf Freierinnen warteten, ich habe das wenig später selbst herausgefunden. Stella aber wollte ich an jenem Vormittag nicht mehr fragen, zu sehr habe ich ihr »t’es très jeune« gefürchtet, von dem ich damals nur erahnen konnte, dass es etwas mit mir, mit einem Mangel an mir zu tun hatte.
Am Ende der dunklen Straße überquerten wir einen Platz, bogen danach in ein paar weitere Gassen ein und standen schließlich vor einem Haus, auf das ein großes Bild von einem Mädchen mit langen roten Haaren gemalt war. Wie ein langes, aufgeblähtes Segel standen die Haare seitlich vom Kopf weg, ein Kopf-, ein Haarsegel, das sich über der Hauswand ausgebreitet hat. Neben die Eingangstür, auf der zentimeterdick Plakate und Aufkleber geschichtet worden waren, war ein N mit Pfeil gesprayt, feuerrot wie das Haarsegel. »Nous voilà«, sagte Stella und klopfte an die Tür. Mit den zwei Frauen, die die Türe öffneten, wechselte sie ein paar Worte, und gemeinsam gingen wir in das Haus hinein, stiegen die Treppen hoch in den fünften Stock. Eine Tür zu einer kleinen Kammer öffnete sich, ein Stahlbett, ein schwarz lackierter Tisch und ein wackeliges Regal, zusammengezimmert aus unterschiedlichen Holzplatten, standen darin.
»Here you can stay for a while.« Ich sah Stella an und ging langsam in die Kammer. »So, have a good stay here, see you.«
Ob sie denn nicht hier wohne, wollte ich wissen. Sie meinte, dass sie hier einmal gewohnt, jetzt aber eine kleine Wohnung in der Nähe gemietet habe, »avec ma petite amie«, fügte sie hinzu und lächelte. Wir verabschiedeten uns und ich blieb in der kleinen Kammer zurück, in meiner ersten Wohnung auf einer Reise, die mich jener seltsamen Bewegung näherbringen sollte, die Menschen über Meere trägt, die den Fluchtpunkt einer wogenden Sehnsucht bildet, von dem wir ausgehen, dem wir folgen auf Pfaden, die manchmal farbenprächtig und verheißungsvoll, ein anderes Mal in ein dämmriges Blau gehüllt sind.
Ich habe es kaum erwarten können, in den Alten Hafen zu gehen, um dort die Menschen zu beobachten, wie sie ankommen, wie sie abreisen, wie sich ihre Wege kreuzen und tangieren, wie sie ihre flüchtigen Spuren hinterlassen, bevor das Meer sie wieder fortträgt. Also habe ich mich auf den Weg gemacht, durch die Stadt bin ich geschlendert, habe mich in die Gesichter der Menschen vertieft, wollte in ihnen die zurückgelegten Wege lesen wie auf Karten, in denen alle möglichen Passagen verzeichnet sind. Die Gesichter aber sind verschlossen gewesen, hier und da hat sich ein schmales Lächeln auf die Lippen gelegt, sacht und leise, die Augen hingegen haben mir keinen Einlass gewährt. Grüne, blaue und braune Blicke haben mich gestreift, gleichgültig und unbeteiligt sind sie meinen stummen Fragen nach ihrem Woher und Wohin begegnet: die alten Männer, die auf den Straßen gestanden und auf den Terrassen der Kaffeehäuser gesessen sind, vertieft in eine Schale Tee oder Kaffee, als könnten sie daraus die Zukunft, eine bessere Zukunft lesen; die jungen Männer, die an den Straßenecken Sprüche geklopft haben; die Frauen in langen, weiten Kleidern, die mit vollen Körben und Taschen ihrer Wege gegangen sind; die jeunes filles, die im schwindelerregenden Redetempo Neuigkeiten ausgetauscht haben; die Damen und Herren, die schnellen Schrittes dahingeeilt sind und ihr pardon! jedem entgegengeschleudert haben, der ihnen in die Quere gekommen ist, der ihnen hat ausweichen müssen auf den schmalen Gehsteigen. Sie alle haben mir nichts von ihrem Ankommen hier, in dieser Hafenstadt am Rande Europas zeigen wollen.
Im Hafen selbst wird es wohl anders sein, habe ich mir gedacht und meine Schritte beschleunigt, um so schnell wie möglich hinunterzukommen. Als ich jedoch am Ende des Boulevards stand, an der Kreuzung, die ich überqueren musste, um in den Alten Hafen zu gelangen, sah ich weder die großen Schiffe noch die Menge der An- und Abreisenden, mit denen ich gerechnet hatte, sondern nur Kutter und kleine Segelboote, die im Hafenbecken vor Anker lagen. Die Menschen, die sich auf der Hafenpromenade tummelten, sahen auch nicht aus wie Seeleute oder Abenteurerinnen, sondern eher wie die Tagestouristen, die mit ihren karierten Blusen und wadenlangen Hosen in das Dorf gekommen waren. Die einzigen Schiffe, die immer wieder an- und ablegten, waren Ausflugsschiffe, die auf die nahe gelegenen Inseln fuhren. Mir wurde ganz schlecht vor Enttäuschung – das also sollte der Hafen sein, an dem all die Menschen ankamen, die ich auf den Straßen gesehen hatte, all die Menschen mit ihren braunen und grünen Augen, ihrem schimmernden Teint, ihrer farbenprächtigen Kleidung und ihren Kopfsegeln? Hier gab es kein Ankommen zu studieren, nur satte Bequemlichkeit und stupide Selbstgefälligkeit, die sich auf den Terrassen der Bars und Restaurants an den Hafenkais breitmachten, sich in die tiefen Clubsessel fläzten. Die Übelkeit, die mir dieses Szenario bereitete, trieb mich aus dem Alten Hafen fort, den breiten Boulevard hinauf und zurück in das Haus mit dem feuerroten Haarsegel, in dem ich die kleine Kammer bezogen hatte.
Der Eindruck meines ersten, entsetzlich enttäuschenden Hafenspazierganges hat so tief gesessen, dass ich die darauffolgenden Wochen das Haus nicht mehr verlassen habe. So habe ich immerhin die bunte Gesellschaft, die in dem Haus gewohnt hat, besser kennengelernt. Die meisten sind den ganzen Tag über beschäftigt gewesen, haben Lebensmittel aufgetrieben, Veranstaltungen geplant, Kampagnen organisiert und jenen Menschen geholfen, die sich ohne Papiere in der Stadt aufhielten. Die Gruppe rund um Berthe und Louise ist mit Fahrrädern durch die Stadt gefahren, hat Supermärkte abgeklappert und Mülltonnen durchsucht, um die Hausgemeinschaft mit Essen zu versorgen. Marie und André haben sich um die Partys gekümmert, Konzerte, Lesungen und Cocktailbars haben sie veranstaltet, meistens um Geld zu sammeln. Brigitte, Claire und Aaron haben in der kleinen Werkstatt Plakate und Flugzettel gedruckt, während Renée, Pascale, Georges und Martine die Aktionen für die sans papiers koordiniert haben, sie haben Rechtsberatung angeboten und spontane Demonstrationen bei Polizeirazzien und Deportationen organisiert. Sie sind es auch gewesen, deren Telefonnummer mir Stella auf der Polizeistation gegeben hat und die sich, ohne mich zu kennen oder auch nur den Anflug einer Ahnung von meiner Geschichte zu haben, den Polizeibeamten gegenüber als meine Verwandten in Marseille ausgegeben haben. Neben diesem aktiven Kreis der Bewohnerinnen und Bewohner hat es auch einige gegeben, die sich, wie sie es zumeist nannten, auf ihre eigene Arbeit konzentrieren wollten, unter ihnen Céline, die an einem großen Roman schrieb, der den Titel »Zeitlose Untergänge« tragen sollte; Robert, der unentwegt winzige, bis ins kleinste Detail penibel ausgestaltete Comicszenen ent- und wieder verwarf; und schließlich Stan, mein Zimmernachbar, der seine kurzen Tage und langen Nächte mit dem Lesen und Verfassen philosophischer Schriften verbrachte. Er war es auch, der mir anbot, mir mit der französischen Sprache auf die Sprünge zu helfen. Jeden Tag sollte ich eine Stunde lang zu ihm ins Zimmer kommen, um Französisch zu lernen. Vor meinem ersten Besuch dachte ich, er würde mir zunächst die einfachsten Alltagswendungen beibringen, bonne journée, au revoir, s’il vous plaît etcetera. Aber ich habe mich getäuscht.
Als ich sein Zimmer betrat, das dunkel, verraucht und von oben bis unten mit alten, zerfledderten Büchern vollgestopft war, forderte er mich auf, ein Buch auszuwählen. »We will read this book together – en français bien sûr«, meinte er. Auf meine schüchterne Anmerkung hin, dass ich noch kein einziges Wort Französisch sprechen, geschweige denn lesen könne, schüttelte er nur den Kopf. »Take one book and – choose well«, sagte er, und ich wühlte mich auf der Suche nach einem Titel, der mir irgendetwas sagte, durch die Papierberge. Schließlich zog ich ein Buch mit einem schlichten, beigefarbenen Cover hervor. La Peste stand in großen roten Lettern drauf. Ich dachte mir, dass La Peste wohl so etwas wie Die Pest bedeutete und dass ich da wenigstens so halbwegs wüsste, worum es geht, nämlich um die schreckliche Krankheit, die es nicht mehr gab, die es aber im Mittelalter gegeben und einigen Millionen Menschen das Leben gekostet hatte. Als ich dieses Buch aus einem der Stapel zog, leuchteten Stans Augen, »Bravoooo«, rief er, »that is indeed a very good choice«. Und wir begannen gemeinsam La Peste zu lesen.
Während dieser Wochen, in denen ich mich enttäuscht von der Stadt mit dem langweiligen Alten Hafen abgewandt habe, haben mich von den ganzen Aktivitäten im Haus vor allem die Feste interessiert. Sie sind nicht so schön und stimmungsvoll gewesen wie in der Alten Mühle, wo Pete, Agnès und die anderen mit ihrer Musik flüchtige Unendlichkeiten in die Ohren, die Herzen und Köpfe der Dorfbewohner gelegt hatten. An sie erinnere ich mich gerne.
Die Alte Mühle lag wenige Kilometer außerhalb des Dorfes am Fluss, ein großes, altes Steinhaus mitten in einer grünen Auenlandschaft. Wie lange die Mühle schon nicht mehr bewirtschaftet worden war, hatte ich nicht herausfinden können, ich kannte sie nur als verlassenes und immer etwas unheimliches Gemäuer. An jenem fünfzehnten Mai, am Tag des ersten Festes, aber hatte sich das gesamte Dorf auf den Weg zur Alten Mühle gemacht. Um Punkt halb sieben Uhr abends standen alle auf der Wiese vor dem Steinhaus. Die Abenddämmerung legte einen blauen Lichtschleier auf die Granitsteinmauern, die satten Grüntöne der Wiesen und Bäume vertieften sich in ein dunkles Moll. Vor dem Eingang zur Mühle hingen Papierlampions, aus Pappmaché geformte Vögel, die mit ihren Lichtflügeln helle Flecken in die blaue Luft zeichneten. Die Stille, die sich über den Platz gelegt hatte, begann zu vibrieren, ein zarter Ton schwang sich auf, über unsere Köpfe hinweg flog er auf der Suche nach Weite. Ich drängte mich durch die Menge, um das Instrument sehen zu können, das diese Töne erzeugte. Vor dem Eingang zu dem alten Steinhaus saß eine Frau mit kurzen, grauen Haaren, eine seltsame tränenförmige Gitarre in der Hand. Meinen Blick konnte ich nicht abwenden von ihren Händen, mit denen sie den Saiten die Klänge entnahm, die in meinem ganzen Körper ihren Widerhall fanden. Ich wollte lachen und weinen gleichzeitig und war froh darüber, dass ich Norbert, Andrea, Stefan und Romana in der Menge zurückgelassen hatte, dass sie nicht neben mir standen und ich ihnen nicht beweisen musste, dass ich völlig unberührt blieb von den Klängen der tränenförmigen Gitarre, zu der sich nach und nach andere Saiten gesellten, Geigen- und Harfensaiten, Zither- und Violoncellosaiten. In den Lichtkegeln vor dem Steinhaus standen sie, die Menschen mit den langen verfilzten Haaren, und machten Musik. Der Abend sank langsam auf den Platz, auf die Wiese und den Auenwald, der sanfte, blaue Lichtschleier der Abenddämmerung wich einem dichteren, samtenen Gewebe. Mit angehaltenem Atem lauschten die Dorfbewohner dem Konzert. Nachdem der letzte Ton verklungen war, setzte Stille ein, schwer und leichtfüßig zugleich, ein Andante des Schweigens. Der alte Hofer, der trotz seiner schweren Krankheit zur Alten Mühle gekommen war, war der erste, der zu klatschen begann. Die anderen setzten ein und über den Platz vor dem alten Steinhaus ergoss sich schließlich tosender Applaus. Einen Augenblick lang fragte ich mich, ob vielleicht auch die anderen im Dorf eine verbotene Saite in sich trugen, die sie verbergen wollten.
Der Applaus hielt an, die Menschen von der Alten Mühle verbeugten sich und stellten sich vor. Sie erzählten, dass sie aus verschiedenen Städten, aus verschiedenen Ländern kämen, dass sie hier in der Alten Mühle nun leben wollten, Gemüse und Obst anbauen, Fahrräder reparieren, Tische, Stühle, Schränke bauen und Holzspielzeug schnitzen. Und natürlich Feste feiern, zusammen mit allen, die im Dorf lebten. Überhaupt seien alle jederzeit willkommen, und jetzt sei auch das Buffet endlich eröffnet. Alle drängten sich in die Alte Mühle, um den Umbau, die neuen Wohnungen und Werkstätten zu besichtigen, vor allem aber, um ans Buffet zu gelangen. Von ein paar unzufriedenen Stimmen abgesehen, die sich halblaut darüber beschwerten, dass es am Buffet kein Fleisch gäbe, war die Stimmung in und vor der Alten Mühle ausgezeichnet. Alle tranken, redeten und ein paar tanzten sogar bis in die frühen Morgenstunden hinein.
Die Feste im Haus in Marseille sind nicht so stimmungsvoll gewesen, aber sie haben mir die Möglichkeit gegeben, mich in verschiedenen Lagen auszuprobieren, mich mit verschiedenen Menschen und Substanzen bekannt zu machen. Während der ersten Abende und Nächte bin ich immer la petite gewesen, die Kleine, die an ihrem Bier genippt und ihren Platz am Rande des Konzert- und Tanzgeschehens eingenommen hat. Mit der Zeit aber bin ich aufgetaut und habe meine ersten französischen Sätze ausprobiert, die, da sie nicht an herkömmlichen Bonne-Journée-Au-Revoir-Lehrwerken, sondern an La Peste geschult waren, durchaus mit Interesse aufgenommen wurden. Von traurigen Städten im Süden des Mittelmeers, die mit dem Rücken zum Meer lagen, habe ich gefaselt, von der Absurdität der menschlichen Existenz und der Tiefe einer Humanität, die jenseits jeglicher Metaphysik liege. Der Haken an Stans Methode allerdings war, dass ich zwar durchaus in der Lage war, die Sätze aus dem Buch zu wiederholen und an die französischsprachige Frau oder an den Französisch sprechenden Mann zu bringen, aber Gespräche über mein Sätzereservoir hinaus zu führen, habe ich nicht gelernt. Die Unterhaltungen über die menschliche Existenz, das Absurde und die algerische Stadt Oran sind dementsprechend schnell versandet, und ich habe mich mit der Hilfe von Alkohol, Marihuana und anderen Substanzen entweder über den Verlust meiner Gesprächspartner hinweggetröstet oder mir Mut zugesprochen, ein neues Gespräch zu beginnen. So habe ich die ersten Wochen in Marseille verbracht, mit langen Nächten und kurzen Tagen im Haus, das in der ganzen Stadt unter dem Namen La Reine, die Königin, bekannt gewesen ist, wohl aufgrund des feuerroten Haarsegels, das sich über seiner Fassade ausgebreitet und mir beim Betreten des Hauses stets das Gefühl vermittelt hat, ein Schiff zu besteigen, ein Schiff mit geblähtem Segel, das nach egal-wohin fuhr, Hauptsache hinaus, hinaus aufs Meer, auf dem das dämmrige Blau einer vagen Sehnsucht bald einer klaren, sonnentrunkenen Sicht auf unbegrenzte Weiten weichen würde.
Eines Tages liefen Marie und André aufgeregt im ganzen Haus herum und fragten alle irgendetwas. Stan erklärte mir, dass an diesem Abend ein Konzert stattfinden solle, ein Oud-Konzert, dass sich aber Malika, die eine Oud-Spielerin, am Finger verletzt habe und nicht spielen könne.
»There have to be two ouds, so they are looking for someone who can play the oud. But I guess that they won’t find anybody, it is very difficult to play the oud.«
»I can play the oud«, sagte ich, und Stan sah mich mit großen Augen an.
»Well, a little bit, but I’ve learned it when I lived in the small village«, fügte ich noch hinzu, er aber hatte mich schon am Ärmel geschnappt und zu Marie und André geschleppt. André fiel mir um den Hals und Marie schnalzte anerkennend mit der Zunge. Sie würden mir eine Oud aus dem Haus bringen, sie sei zwar alt, aber noch in Ordnung. Gegen drei komme Joseph, der zweite Oud-Spieler, wir hätten dann noch genügend Zeit, um uns aufeinander einzustimmen. Als mir André die Oud in die Hand drückte, legten sich meine Finger wie von selbst auf die Saiten. Etwas zittrig waren die ersten Töne, dann aber zogen sie immer weitere Kreise, bis sie sich leise federnd auf die Stühle und Tische, auf die Köpfe und Schultern legten. An Agnès dachte ich dabei, an ihr Spiel, das Entfernungen auslotete, das Weiten eröffnete, um flüchtige Unendlichkeiten in die Ohren, die Herzen und Köpfe zu legen. Sie hatte nicht ins Dorf gepasst, genauso wenig wie die anderen von der Alten Mühle, das Dorf war zu eng für sie gewesen, sie hätte aber zu mir gepasst, und das hätte ich den Leuten aus dem Dorf damals sagen sollen. Tränen bahnten sich ihre Wege, über meine Wangen rollten sie und tröpfelten auf meine Hände, die an den Saiten der Oud Trost suchten und Halt fanden. André trat an mich heran und streichelte mir über den Kopf: »Ne sois pas triste«, sagte er. »Tu joues très bien de l’oud.«
Wir vereinbarten, dass ich mit Joseph am Nachmittag ausprobieren sollte, ob wir zusammenspielen könnten, und dass ich dann eine Portion Mut und Verwegenheit aus Maries und Andrés Spezialdepot erhalten sollte. Die Probe mit Joseph verlief sehr gut, wir konnten kein Wort wechseln, aber unsere gemeinsame Sprache waren ohnehin die Töne, die einander begleiteten, neckten und umgarnten. Nach der Probe drückten mir Marie und André einen zusammengerollten Geldschein in die Hand und hielten mir ein Stück Papier, auf dem feines, kristallines Pulver zu einer weißen Linie zusammengeschoben worden war, unter die Nase. »Tiens, ça donne du courage«, meinte Marie, und André fügte hinzu, dass ich kurz vor dem Konzert noch einmal eine kleine Portion Verwegenheit erhalten würde. Mit Müh und Not sog ich die hellen Kristalle durch das Papierröhrchen in die Nase. Anschließend legte ich den Kopf in den Nacken und wartete darauf, dass etwas Außerordentliches, etwas Exorbitantes passieren würde. Zunächst aber geschah gar nichts. Die Innenseiten meiner Nasenflügel brannten und juckten, sodass ich einige Male kräftig niesen musste. Ansonsten keine Reaktion, nichts, rien. Als ich aber hinausging, hinaus aus dem Veranstaltungsraum, begannen meine Augenlider zu zucken. Ich blinzelte, was das Zeug hielt, schlug meine Lider auf und nieder im Takt eines infernalen Bassrhythmus, und da setzte auch das andere Jucken, das Jucken in den Schläfen, in den Armen und Beinen ein. Ich schüttelte mich und sprang herum wie ein aufgezogener Hampelmann. Große Gedanken, luftig und schillernd wie Seifenblasen, flogen durch meinen Kopf, wunderbar anzusehen, aber unmöglich zu fassen. Der Vorraum, ja das ganze Haus erschienen mir plötzlich zu eng, und ich lief hinaus auf die Straße, überquerte den Platz mit seinen Bars und Cafés. Federnder Schritte wippte ich durch die Gassen, die grellen Blicke der Menschen, die vor ihren milchig-weißen Apérolgläsern saßen, stachelten mich an, ich fing sie auf wie Bälle, die mir zuflogen und die ich durch die Luft wirbelte in einem rasenden Reigen, der immer größer, immer schneller wurde, ein tausendäugiger Kreisel, der immer weitere Bahnen zog, ein Orkan der Blicke, dessen ruhendes Auge ich war, ich auf meinem Weg durch die Stadt, die ich nicht mehr sehen wollte, die ich jetzt aber eroberte, ich, Jongleuse der Blicke, die aus den Gesichtern purzelten, den goldbraunen und goldgelben Gesichtern, die in der Abendsonne glänzten und ihr Ankommen, ihr Ankommen-Wollen verbargen, so gut es ging. Ich aber, ich sah es schimmern, nein, leuchten in ihren Augenhöhlen, die in den Abend hineingähnten, während ich mit ihren Blicken jonglierte, einhändig, zweihändig, vielhändig, durch das Farbtosen hindurch, bis es in meinen Augen krachte, mit den Lidern schlug ich den Takt meiner Füße, schneller, immer schneller die Fuß-, nein die Augentritte, hinauf, herum, links zwo drei und hinunter, die Canebière hinunter, auf der große und kleine, breite und schmale Gestalten ihre Bahnen zogen. Farbtöne pulsierten aus ihnen hinaus, olivgrün, weinrot und honiggelb waren die Klangkörper, an denen ich mich vorbeidrängte, im Takt meiner Augenlider flatterten die Füße auf dem Pflaster, auffliegen wollten sie, hineinsegeln in das blaue Tuch, das sich über den Himmel legte und Schatten in die Gesichter warf. Die Farbtöne verblassten, der Glanz in den Gesichtern blutete aus, nur ich war noch das Irrlicht, das die Straße hinuntergeisterte, das grell aufflackerte, ein Licht, an dem sich niemand wärmen konnte, kaltes Licht, das in die Augen stach, das die Blicke aus den Augenhöhlen löste.
Anlauf nahm ich, wie ein Komet wollte ich in den Alten Hafen hinuntersausen, um mit einem Satz sein spießgeselliges Treiben, sein stumpfsinniges Verleugnen der blaudämmrigen Sehnsucht auszulöschen, doch meine Beine machten vor der Kreuzung kehrt, bogen ab in eine Straße hinein, die rechter Hand vom Hafen wegführte, leicht anstieg und gesäumt war von dunklen Fassaden, vor denen Menschen, vom Dämmerlicht ihrer Farben beraubt, saßen und standen. Schattenspiele vor abbröckelndem Stuck, vor von Feuchtigkeit angeschwärztem Mauerwerk, große und kleine, breite und schmale Gestalten, die in fremden, kehligen Lauten sprachen, die mit den Händen Huhn und Reis aßen. In das dunkle Gewirr von Rufen und Sätzen, von raschelnden Stoffen und dichten Gerüchen zog es mich hinein, ich stieg die Straße hinauf, kein Komet, kein Irrlicht mehr, sondern ganz Ahnung, leise pochende Ahnung, dass ich hier, an den Rändern dieser Straße ein Ankommen finden würde. Ich ging weiter, taumelnd und torkelnd hielt ich mich an einem brüchigen, einem fadenscheinigen Zipfel meiner selbst fest, um nicht verlorenzugehen in den Schattenspielen, um nicht eins zu werden mit dem schwarzen Mauerwerk, mit dem Dunstgewebe aus Tierfett, Kohle und Holz. Die Mauern wichen plötzlich zur Seite und gaben mir den Weg frei durch Innenhöfe, in denen Wäsche vor gesprungenen, notdürftig mit Pappkarton geflickten Scheiben trocknete, Flügel, die mich hineinwinkten, weiter, weiter hinein in den Gang, der mich umhüllte, der mich umschloss. Feuchter Moder legte sich in meine Nase, legte sich auf meine Haut, die vibrierte wie eine angeschlagene Saite. Eine steile Treppe führte aus einem der Höfe hinaus, ich stieg sie hoch, hinauf zu den flackernden Lichtsprengseln am Ende der Passage, am Ende meiner Passage durch das steinerne Meer. Ich stand nun in einer Gasse, die sich um alte, gedrungene Häuser herumwand, die sich mit anderen Gassen verzweigte zu einem Gassengewirr, in dem das Duftgewebe aus Tierfett, Kohle und Holz noch dichter, die Schattenspiele noch gedrängter waren als in der anderen Straße. In diesen Gassen verlor ich mich, ich suchte Halt in den Blicken, die blau und dämmrig waren wie der Wunsch nach einem Ankommen, der sich hier breitgemacht, der sich wie ein schwerer Mantel über die Häuser und Gassen gelegt hatte. Die Sehnsucht hier war nicht seiden wie ein zum Abschied gezücktes Taschentuch, sondern kratzig wie die Decke in meiner Gefängniszelle. Wie Krätze hatte sie sich auf die Haut gelegt, das Jucken überall, auf den Armen, den Beinen, in den Gesichtern die blutig-eitrigen Krater, die sich ausdehnten, die anwuchsen und anschwollen zu Pestbeulen. »La peste, la peste«, schallte es aus allen Ecken und Winkeln. Ich fing die Rufe auf wie heiße Kohlen, die mir zugeworfen wurden, ein glühender Tanz der Hände, der Ohren, der Münder, die sich aufeinander warfen, die sich ineinander verkeilten in einem verzweifelten Kampf, in einem trotzigen Aufbäumen gegen das Verdikt, das durch die Gassen hallte, durch die Gassen dieser verfluchten Stadt, die dem Meer ihren Rücken zeigte und jenseits des steinernen Meeres lag, das ich durchquert hatte, die Hauswände hatten sich geteilt und ich war hindurchgeschritten, um dieser Stadt zu Hilfe zu eilen, um sie zu erlösen von der Pest, die sich wie ein schwarzes Tuch auf die Häupter, die Hände, Ohren und Münder legte, die offen standen, verformt zu einem Schrei, der den filzigen, kratzigen Stoff nicht zu durchdringen vermochte.
Ich streckte meine Arme denjenigen entgegen, die an den Rändern der Gassen hockten und an den Hausmauern lehnten. Jenen, die gezeichnet waren von der Sehnsucht anzukommen, ihnen bot ich meine helfende Hand. Aus den Schattenspielen löste sich ein Augenpaar. Es fixierte mich, und plötzlich prasselte ein tiefes, klares Lachen auf mich nieder. In einem Schwall aus glucksenden Lauten stand ich mit ausgebreiteten Armen und verklärtem Gesicht, bereit, die Menschen hier von der kratzigen Sehnsucht zu erlösen, um sie mit einer geschmeidigeren zu versehen. Das Lachen ließ meine Knie weich und meine Augen feucht werden. Doch so jäh, wie es herausgeplatzt war, so abrupt verstummte es auch wieder. Eine Hand legte sich auf meine Schulter, ein warmer Blick berührte mein Gesicht und ein paar Worte schmiegten sich tröstend in meine Ohren. »Ma petite, qu’est-ce que tu fous ici, qu’est-ce que tu cherches ici, chez nous?«
»Je veux vous aider«, murmelte ich, und Worte purzelten aus mir heraus, auf Französisch, Englisch und Deutsch erzählte ich der Frau, dass ich helfen wolle, die Geflohenen, die Wandernden, die Gestrandeten von ihrer Sehnsucht zu erlösen, deshalb sei ich hier.
Wieder legte sich die Hand auf meine Schulter. Der Blick aber berührte mich dieses Mal nicht so sanft, auf Distanz blieb er, und in den Augenwinkeln lag leiser Spott. Erlöst könne hier niemand werden, sagte die Frau und: »Il vaut mieux que tu rentres.« Sie wies mir den Weg hinunter in den Alten Hafen und ich schlenderte zurück, in Gedanken versunken, die so blau und unruhig waren wie das Meer bei Sonnenuntergang.
An diesem Abend habe ich die Oud gespielt wie nie zuvor. Aus den Augen der Konzertbesucher hat sich der Wunsch, irgendwo, bei irgendjemandem gut anzukommen, von selbst gelöst, in kräftigen Farbtönen ist er aufgestiegen und hat den ganzen Raum in ein klingendes Farbenspiel verwandelt. Saitenweise habe ich den kratzigen Stoff durchtrennt, der über dem seidenen Sehnsuchtsgewebe lag, und ihn neu verknüpft, zu einem Teppich, der sich über die Köpfe erhob, um das Weite zu suchen. Joseph legte mir nach dem Konzert den Arm um die Schulter und meinte: »Tu joues comme une grande voyageuse.« Dass ich die Oud spielte wie eine große Reisende, war das schönste Kompliment, das ich jemals bekommen hatte. Joseph und ich sind Freunde geblieben, wir haben unser Saitenspiel bei verschiedenen Gelegenheiten fortgesetzt. Ihm verdanke ich, dass ich es zu einer ganz passablen Oud-Spielerin gebracht habe.
Nach meinem ersten rauschenden Streifzug habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, ausgedehnte Spaziergänge über die Straße, die rechter Hand vom Hafen wegführt und leicht ansteigt, durch die Passage de Lorette hinauf in den ältesten Teil der Stadt zu machen. Die Straßen und Gassen sind voll gewesen von Menschen, von Waren und verschiedenen Sprachen. Französische und arabische Wörter, auf verschiedene Arten und Weisen akzentuiert, sind durch die Luft gesegelt, in der immer auch die Gerüche von Tierfett, Kohle und Holz gelegen sind. Menschen haben hier gelebt und gehandelt, die aus Ländern jenseits des Mittelmeeres gekommen sind, aus Algerien, Tunesien, Mali, dem Senegal und vielen anderen. Ihr Ankommen in dieser Stadt hat sich meist über viele Jahre hinweggezogen, ist von Behörden, aber auch schlicht von Mittellosigkeit blockiert und boykottiert worden. Eines Tages, als ich mich wieder einmal in dem Gassengewirr des Panier, des Korbes, wie das Viertel genannt wird, verloren hatte, traf ich Renée aus unserem Haus. Sie stand bei einer Gruppe Menschen und versuchte, ihnen etwas begreiflich zu machen. So sah es zumindest aus. Sie gestikulierte und zeigte immer wieder auf ein Flugblatt, das sie unter den herumstehenden Menschen verteilte. Ich gesellte mich zu ihnen, Renée begrüßte mich und meinte, dass sie sich gleich mit den anderen, mit Pascale, Georges und Martine treffen würde, ich solle doch mitkommen. Wir schlenderten zu einem kleinen Platz, auf dem sich ein Café mit einer einladenden Terrasse befand. Wir setzten uns an einen der Tische. Aus dem Dunkel des Cafés, in dem sich eine kleine Bar abzeichnete, auf der schmutzige Gläser und blaue Tonvasen mit Sonnenblumen standen, trat eine großgewachsene Frau. Sie trug eine Art Turban, leuchtend gelb türmte sich der Stoff auf ihrem Kopf. »Mesdames?«, fragte sie und lachte. Renée bestellte einen café und ich ein Glas Mineralwasser. Sie fragte mich, wie es mir denn hier, in Marseille, gefiele. Ich schilderte ihr meine Eindrücke, sprach auch kurz von dem Ankommen, das ich kennenlernen wollte.
»Oui, c’est vrai. Arriver ici, c’est vraiment difficile«, seufzte sie und erzählte mir, dass die rafles, die Razzien, zunahmen, bei denen Menschen ohne offizielle Ausweisdokumente festgenommen und abgeschoben wurden. »Tu sais, il y aura un autre problem avec cette ville«, sagte sie, nachdem sie ein paar Sekunden lang gedankenverloren in ihrem Kaffee gerührt hatte. Die Stadt werde nach und nach herausgeputzt, um zahlungskräftigere Menschen als die jetzt Ankommenden anzulocken. Noch sei davon nicht allzu viel zu bemerken, doch die Bautätigkeiten hätten schon eingesetzt und würden sich im Laufe der kommenden Jahre über das gesamte Stadtzentrum ausbreiten. Wie Fäulnis würden sich die Fassadensanierungen – denn darum ginge es, um prächtige Fassaden und nichts weiter – hinauffressen, vom Alten Hafen bis hin zur Joliette. Was mit all den Menschen, die hier lebten, die die alten Häuser bewohnten, geschehen werde, wollte ich wissen. Renée verzog das Gesicht. Sie presste die Lippen aufeinander und zog die Mundwinkel nach unten. »Alors«, sagte sie, die würden verdrängt und vertrieben werden, entweder zurück in ihre sogenannten Heimatländer, die viele aber gar nicht kannten, da sie hier geboren seien. Oder sie würden hinausgedrängt werden an die Ränder der Stadt, in die quartiers nords, die Banlieues. Diese riesigen Wohnviertel waren berüchtigt und sehr schlecht angebunden an das Stadtzentrum. Die U-Bahnen verkehrten auf diesen Strecken nur bis zum späten Nachmittag und die Busse waren unzuverlässig. Für all jene, die kein Auto besaßen, war es so gut wie unmöglich, regelmäßig in die Stadt zu pendeln, zur Schule oder zur Arbeit ins Zentrum zu fahren. Am glücklichsten seien noch jene, meinte Renée, die nach Noailles, in das Marktviertel hinter dem Alten Hafen ziehen könnten. »Pourtant«, sagte sie, auch das sei nur eine Frage der Zeit, bis sie auch aus dieser Gegend vertrieben werden würden. Sie vermute, dass es im Fall von Noailles Vernachlässigung sein werde, die die Menschen aus ihren Häusern treiben würde. Sie traue der Stadtverwaltung sogar zu, die Häuser einfach einstürzen zu lassen, um die wertvollen Grundstücke verhökern zu können. Menschenleben hin oder her, das seien Männer und Frauen, die der Stadt nicht allzu teuer wären. Wir schwiegen eine Weile. Ich versuchte mir vorzustellen, wie die Straße, die vom Alten Hafen wegführte, aussehen würde ohne die Menschen, die ihre Tage vor den Häusern verbrachten, ihre Waren feilboten, aßen und tranken und in ihren kehligen Lauten und Akzenten Neuigkeiten austauschten.
»Mais ça va changer toute l’atmosphère dans la ville«, sagte ich und Renée nickte.
»Mais oui, imagine-toi …« und dann beschrieb sie mir, wie die Straßen und Viertel bald aussehen würden. Eine Straße mit protzigen Hausfassaden, die Häuser würden großteils leer stehen, sie würden nichts anderes mehr beherbergen als Anlagekapital und potemkinsche Straßenläden. Wahrscheinlich würde der Stadtverwaltung nichts anderes einfallen, als die leer stehenden Geschäftslokale mit großen Plakaten zuzukleben, auf denen Straßenszenen, geschäftiges Treiben und schöne, einkaufende Menschen abgebildet seien. Dieser potemkinsche Straßenzug würde, so stellte ich mir vor, in seiner aufpolierten Herrlichkeit gespenstischer sein als jetzt mit seinen Schattenspielen vor abbröckelndem Stuck, vor von Feuchtigkeit angeschwärztem Mauerwerk.
»Et est-ce que tu penses que ça va arriver aussi au Panier?«, fragte ich. Renée ließ ihren Blick über den kleinen Platz schweifen und schüttelte dann sachte den Kopf. Nein, sie glaube, dass den Panier mit seinen schmalen Gassen ein anderes Schicksal ereilen werde, schmucke Boutiquen, Cafés und Restaurants würden sich ansiedeln, die die Touristen aus dem Alten Hafen anlockten und den längerfristig Ankommenden immer weniger Raum ließen. Ich malte mir aus, wie sich statt des Duftgewebes aus Tierfett, Kohle und Holz Tourismuskitsch breitmachte, Stadtaccessoires an allen Ecken und Enden, die einen Flair verbreiteten, der die Ausdünstungen dieser Hafenstadt am Rande Europas übertünchen sollte.
Auf meinem Weg zurück durch das Gassengewirr des Panier, die Rue de la République hinunter in den Alten Hafen, fielen mir an manchen Stellen jene Bautätigkeiten auf, von denen Renée gesprochen hatte. In das Stadtbild frästen sich die ersten Schneisen, durch die Geld ein- und menschliches Strandgut ausfließen sollte. Der einsetzende Verfall dieser Stadtteile, in denen die Ankommenden lebten und aus denen sie nach und nach vertrieben wurden, hat auf seltsame Art und umgekehrte Weise mit meinem Ankommen korrespondiert. Während die einen von äußeren Kräften aus ihren Bahnen hinauskatapultiert wurden und ihre gewohnte Stadtumgebung verloren, konnte ich immer besser Fuß fassen. Es gelang mir, immer weitere Kreise zu ziehen und dabei etwas Neues in Umlauf zu bringen, so als hätte sich das Unglück der anderen derart verdichtet, dass es sich, solcherart zur Potenz genommen, in mein Glück verwandelte.
Begonnen hat alles freilich wiederum mit einer ausgesprochen unglücklichen Situation, in der ich mich befunden habe. Im Laufe der Zeit sind sowohl meine ohnehin geringen Geldreserven knapp und meine Kleidung immer abgetragener geworden. An den Kauf neuer Kleidung war nicht zu denken, also habe ich mich, dem Vorbild von Berthe und Louise folgend, die mit ihren Fahrrädern durch die Stadt gefahren sind, um weggeworfene Lebensmittel für die Hausgemeinschaft einzusammeln, auf den Weg gemacht, um in den Mülltonnen nach noch brauchbaren Kleidungsstücken zu suchen. Und wie erfolgreich ich dabei gewesen bin! Als ich zum ersten Mal den Deckel eines Müllcontainers hochklappte und mich hineinbeugte, pochte die Scham noch in meinen Schläfen, kribbelte das Gefühl, nun am untersten Ende der Verbraucherkette angekommen zu sein, in meinen Armen und Beinen. Als ich jedoch zwischen den stinkenden Plastiksäcken einen marineblauen Pullover hervorzog, verflogen die schamvollen Bedenken und ich wühlte mich durch die Mülltonnen verschiedener Straßen und Gassen. Die erste Ausbeute war beachtlich, neben dem marineblauen Pullover fischte ich an diesem Tag zwei bunte T-Shirts und zwei Paar Hosen aus den Abfällen. Zwar hatten die Kleidungsstücke an manchen Stellen Löcher, waren da und dort ausgefranst und lädiert, aber in meiner Kammer im Haus erweiterte ich die Löcher kreativ, schnitt Muster hinein und verflocht die Fransen zu Quasten, die an den Ärmeln und Hosenbeinen baumelten.
Mein neues Outfit hat im Haus Aufmerksamkeit erregt, und angestachelt durch das eine oder andere Kompliment habe ich meine gerissene Garderobe sukzessive erweitert, habe immer neue alte Kleidungsstücke aus den Müllcontainern gefischt und auf meine Art und Weise präpariert. Dabei ist es durchaus ausschlaggebend gewesen, aus welchem Teil der Stadt die Kleidungsstücke stammten: In der Gegend rund um unser Haus, um unsere La Reine, sind es zunächst Second-, manchmal auch Thirdhand-Stücke gewesen, die ich aus dem Müll gezogen habe. An ihnen habe ich mich austoben können, ihre brüchigen und löchrigen Gewebe habe ich mit allerhand Schnittmustern und Fransen versehen. Ein paar Straßen weiter sind die Hemden, T-Shirts und Röcke, die in den Containern gelandet sind, in einem viel besseren Zustand gewesen. Ein paar wenige aufgeriebene und ausgebleichte Stellen haben ihre früheren Trägerinnen dazu bewogen, die Teile, die vorwiegend von kleinen, lokalen Mode-Labels entworfen worden waren, wegzuwerfen. Bei ihnen ist mir oft nichts anderes übrig geblieben, als ein paar Quasten anzubringen. In den wirklich reichen Vierteln, dort, wo mit ungetrübtem Blick aufs Meer die Stadtvillen stehen, habe ich vor allem Kleidung mit gediegenen Schnitten und Mustern gefunden. Mit großer Hingabe habe ich sie entstellt, ich habe sie zerschnitten, ausgebeult, mit den farbenprächtigen Stoffresten aus den ärmsten Gegenden versehen und sie so in flatternde Monumente der Vielfältigkeit dieser Stadt verwandelt.
Marie und André sind es schließlich gewesen, die mich auf die Idee gebracht haben, dass ich Teile meiner Kollektion bei einem der Hausfeste ausstellen und verkaufen könne. An jenem Abend, an dem ich zum ersten Mal meinen Verkaufsstand öffnete, war ich sehr aufgeregt. Zur Feier des Tages trug ich meine ersten Stücke, den marineblauen Pullover, dessen linker Schulterteil zerrissen gewesen war und den ich weiter aufgeschnitten hatte, sodass die Schulter keck hervorragen, sich kalt oder anschmiegsam, ganz nach Lust und Laune, zeigen konnte, sowie die gelbe Hose, die am rechten Knie aufgerissen war und die ich so bearbeitet hatte, dass das Loch wie ein vor Staunen aufgerissener Mund mit gelben Fransenzähnen aussah. Die zum Kauf angebotenen Kleidungstücke breitete ich auf Stühlen und Tischen aus, gleich neben der Bar, sodass die auf ihre Getränke Wartenden einen Blick darauf werfen konnten. Mit Marie und André hatte ich vereinbart, dass ich die Stücke aus meiner Kollektion zu freien Preisen anbieten würde. Der Abend war ein voller Erfolg, die Partymenschen kauften begeistert die mit sternenförmigen Löchern gespickten T-Shirts und die Hosen mit unterschiedlich langen Beinen. Auch die Jacken mit den luftigen Ellbogenherzen fanden reißenden Absatz.
Von nun an habe ich bei jedem Fest, bei jedem Konzert im Haus ausgewählte Stücke aus meiner gerissenen Garderobe zum Kauf angeboten. Auf diese Art und Weise habe ich meinen Lebensunterhalt verdient und mir bei den Menschen, die in La Reine gewohnt und verkehrt haben, einen Namen gemacht. La Trouturière haben mich alle genannt, und bei jedem Streifzug durch die Stadt habe ich meine Kollektion erweitert. Im Laufe der Monate ist mir aufgefallen, dass sich die Inhalte der Müllcontainer veränderten. Immer mehr der kaum abgetragenen, aus eigenwilligen Stoffkombinationen gefertigten Stücke der kleinen Mode-Labels sind in der Gegend um unser Haus aufgetaucht. Dafür habe ich aus den Containern in Noailles, im Marktgebiet im Zentrum der Stadt, nun jene abgewetzten und verschlissenen Second- und Thirdhand-Teile gezogen, die mich am meisten inspiriert haben. Konstant gediegen sind nur meine Fundstücke aus den reichsten Gegenden geblieben. Es ist aber zusehends schwieriger geworden, sie mit den rauen und farbenprächtigen Stofffetzen aus den ärmeren Vierteln zu versehen, immer höher habe ich die Rue de la République hinaufsteigen, immer tiefer ins Gassengewirr des Panier hineingehen müssen, um aus den Containern letzte Gewebereste herauszufischen.
In dieser Zeit bin ich auch öfter zu den Treffen gegangen, die Renée, Pascale, Georges und Martine veranstaltet haben, um die Aktionen für die sans papiers zu koordinieren, für jene Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung, deren Ankommen von den Behörden, aber auch schlicht von Mittellosigkeit blockiert und boykottiert worden ist. Ehrlich gesagt ist es mir dabei weniger um die allgemeinen Infoveranstaltungen oder die Demonstrationen bei Polizeirazzien und Abschiebungen gegangen, die besprochen und organisiert worden sind, als um die Rechtshilfe, die für mich nur ein Gesicht und einen Namen getragen hat – Olivier. Olivier war ein Student der Rechtswissenschaften, mit strahlend blauen Augen und einem verschmitzten Lächeln, mit dem er die Welt um sich herum bedachte und, wie ich es sah, beglückte. Er wohnte nicht bei uns im Haus, sondern in einer Garçonnière, die seine Eltern für ihn gekauft hatten. Seinen Eltern verdankte ich auch, dass ich ihn bei den Treffen kennenlernte. Sie hätten ihn lieber in einer anständigen Anwaltskanzlei gesehen, doch er hatte sich, um ihnen eins auszuwischen, für das ehrenamtliche Engagement in der sans-papiers-Gruppe entschieden. Obwohl er, pour ainsi dire, von Haus aus privilegiert sei, läge ihm viel daran, ein besseres Leben für alle zu ermöglichen, pflegte er zu sagen, und ich dachte an Pete von der Alten Mühle, der auch immer davon gesprochen hatte, die Welt verändern zu wollen, zumindest ein bisschen:
Die Eindrücke, die ich beim ersten Fest in der Alten Mühle gesammelt hatte, hatten mich lange beschäftigt. Ich wollte herausfinden, was Menschen aus verschiedenen Städten und Ländern dazu bewegen konnte, in das Dorf zu kommen, und machte mich in den Tagen nach dem Eröffnungsfest auf den Weg zur Alten Mühle. Über den Kirchplatz ging ich, die Straße hinter zum Fluss, über die Brücke und dann die zwei Kilometer durch das Flusstal in den Auenwald hinein. Am ersten Tag kam ich bis zur letzten Biegung vor dem alten Steinhaus, dann verließ mich der Mut und ich machte kehrt. Am zweiten Tag pirschte ich mich näher heran. Hinter einem Holzstoß hockte ich und beobachtete den Platz vor dem Haus. Immer wieder gingen Menschen ein und aus, viele trugen Holzbretter und Eimer. Alles wirkte sehr friedlich und entspannt, den letzten Schritt hin zum Haus aber wagte ich auch dieses Mal nicht. Am dritten Tag saß ich wieder hinter den Holzscheiten und behielt das Kommen und Gehen im Auge. Nach einer Weile kam die Frau mit den kurzen, grauen Haaren, setzte sich in einen Schaukelstuhl vor dem Haustor und spielte auf ihrer tränenförmigen Gitarre. Zu weit entfernt war ich, um den wundervollen Klang des Instrumentes hören zu können, also schlich ich mich näher heran. Auf allen Vieren kroch ich zwischen den Sträuchern hindurch und versteckte mich hinter einer niedrigen Buche wenige Schritte vom Haus entfernt. Von dort aus lauschte ich dem Saitenspiel. Ich war so tief darin versunken, dass ich nicht bemerkte, wie sich jemand von hinten näherte. Als sich eine Hand auf meine Schulter legte, kippte ich vor Schreck nach hinten. Ein tiefes, volles Lachen schwappte über mich: »Was machst du hier? Warum versteckst du dich?«
»Ich … ich, äh, ich … habe Musik gehört.«
»Warum kommst du nicht zum Haus und setzt dich zu uns?« Das Gesicht des Mannes, der sich über mich beugte, war viel schmaler, als es sein Lachen und seine Stimme vermuten ließen. Seine Augen waren klar und himmelblau, auf seiner linken Augenbraue hing einer kleiner Goldring, seine dünnen blonden Haare waren zu einem struppigen Kamm hochfrisiert. Langsam richtete ich mich auf und klopfte mir das Moos von den Hosen. »Ich … ich will euch nicht stören«, murmelte ich, da aber hatte mich der Mann schon am Arm genommen und ging mit mir Richtung Steinhaus.
»Ich bin übrigens Pete«, meinte er und lächelte mich an.
»Mira«, sagte ich, und mein Name erschien mir so fremd und eigenartig wie noch nie zuvor.
»Freut mich, Mira, und jetzt komm, ich stell dir Agnès vor, die mit der Oud.«
Die Frau mit den kurzen, grauen Haaren erhob sich aus dem Schaukelstuhl, als wir auf den Platz vor dem Eingang zur Alten Mühle traten. Sie streckte mir die Hand entgegen und sah mich an. Grün leuchteten ihre Augen, nicht grasgrün wie meine, sondern dunkel-, beinahe smaragdgrün.
»Agnès, das ist Mira. Mira, das ist Agnès.« Pete verbeugte sich mit einer ausholenden Geste vor uns. »Mira hat dir dort hinten im Gebüsch zugehört. Ich glaube, ihr gefällt, wie du die Oud spielst.«
Von diesem Tag an bin ich beinahe täglich zur Alten Mühle gegangen. Alle, die dort gelebt und gearbeitet haben, lernte ich kennen. Da waren Ali und Samira mit ihren kehligen H, Katja mit ihren harten Auslauten, Simón mit dem rollenden R, Jana mit dem singenden M und natürlich Agnès mit ihrem näselnden N und Pete mit dem kecken L. Sie waren aus allen möglichen Ländern zunächst in die Hauptstadt und schließlich hierhergekommen. Sie hatten auf Baustellen und Schiffen, in großen Fabriken und Läden gearbeitet und sich eines Tages auf den Weg gemacht, um ein besseres Leben zu finden. Warum sie gerade hierhergekommen seien, fragte ich Pete eines Tages, schließlich arbeite niemand von ihnen im Schlachthof oder in der Papierfabrik. Er legte den Arm um meine Schulter und lachte: Hier gebe es doch die hübschesten Frauen, das sei schließlich … Ich musste ihn sehr erschrocken angesehen haben, denn sofort wurde er ernst: »Hier können wir unser Gemüse, unser Obst selbst anbauen. Hier gibt es genügend Platz für unsere Werkstätten, und außerdem …«, die Grübchen in seinen Wangen vertieften sich und seine Augen funkelten wie Regentropfen im Sonnenlicht, »wollen wir die Welt verändern, ein bisschen zumindest.«
Ich fragte ihn, was sie denn hier im Dorf verändern wollten. Das müsse er mir ins Ohr flüstern, meinte er und zog mich an sich heran. Mir wurde schwindelig, ich fühlte, wie mein ganzer Körper steif wurde, ein morscher Ast war ich, der jederzeit zu zersplittern drohte.
»Pete, what the fuck?!« Agnès war aus dem Haus getreten. Pete ließ mich los und machte eine vage Bewegung mit den Schultern. Agnès schüttelte den Kopf. »Mira, komm, setz dich zu mir.« Sie zog zwei Stühle zu dem Tisch vor dem Eingang. »Was wollte Pete von dir? Hat er dir wehgetan?« Ich schüttelte den Kopf und erzählte ihr von unserem Gespräch, davon, das ich wissen wollte, was sie hier im Dorf verändern wollten. »Schließlich kommt doch niemand außer mir zur euch. Abgesehen vom Fest.«
Agnès’ Augen lagen ruhig auf mir. »Warum kommst du zu uns?« Ich versuchte, ihr von der fremden Saite in mir zu erzählen, von den Klängen der singenden Säge und der tränenförmigen Gitarre, wie sie mich berührt hatten und warum die anderen nichts davon wissen durften. Die Worte aber blieben mir im Hals stecken, einzelne nur brachte ich hervor, sie kullerten über den Tisch, zusammenhanglos wie die Perlen einer gerissenen Halskette. Agnès stand auf und ging ins Haus. Ich dachte schon, dass ich sie gelangweilt hätte, da stand sie wieder in der Tür mit zwei Gläsern, in denen eine bernsteinfarbene Flüssigkeit schaukelte. »Lass uns einen Schluck trinken, da erzählt es sich besser«, sagte sie und stellte eines der Gläser vor mich hin. Ich steckte die Nase ins Glas, wie feuchtes Holz roch die schimmernde Flüssigkeit. Mit geschlossenen Augen nahm ich vorsichtig einen kleinen Schluck. Die Schärfe, die sich auf meine Zunge gelegt und mich zunächst erschreckt hatte, verwandelte sich in Wärme, in eine angenehme Wärme, die von meinem Hals in meine Brust und meinen Bauch wanderte. Ich nahm noch einen Schluck und spürte, wie sich meine Zunge löste, wie meine Worte wieder ihren Zusammenhang fanden. »Weißt du, Agnès«, sagte ich, »ich habe eine Saite in mir, die ich nicht verstehe. Die niemand versteht. Dabei versuche ich doch, alles richtig zu machen.« Und dann erzählte ich ihr, wie mir plötzlich alles im Dorf eng und öd, klein und schäbig erschienen war. »Ich will, dass diese fremde Saite in mir reißt, dass sie verschwindet, dass sie mich nicht mehr stört, dass ich …« Meine Knie wurden weich und meine Augen feucht.
»Wie wäre es, wenn du lernst, die Saite zu spielen, anstatt sie zerreißen zu wollen?« Ernst und streng klang Agnès’ Stimme. Sie ging ins Haus und kam mit der tränenförmigen Gitarre in der Hand zurück. »Da, spiel!« Sie legte mir das Instrument auf die Oberschenkel.
»Aber ich kann doch gar nicht …«
»Dann wirst du es lernen. Spiel!« Jede Widerrede wäre zwecklos gewesen, also nahm ich die Gitarre in die Hand, strich mit den Fingern über die glatte Oberfläche und tastete mich den Saiten entlang. Als ich eine anschlug, grub sie sich tief in meine Fingerkuppe, so fest und straff war sie. Ich ließ sie los, sie federte zurück und gab einen kurzen, metallenen Klang von sich. Der erste Ton, den ich mit meinen Händen produziert hatte, war das gewesen. Ich zupfte jede Saite einzeln an, strich dann mit der ganzen Hand über die Saiten, spürte, wie sie vibrierten, wie ihre Klänge durch meine Finger gingen. Agnès ließ mich nicht aus den Augen.
»Wenn du möchtest, zeige ich dir ein paar Griffe.«
Ich nickte und sie setzte sich neben mich, ordnete meine Finger auf dem Hals der Oud an und bedeutete mir, dass ich nun über alle elf Saiten streichen solle. Ein ganz anderer Ton flog auf, unbeholfen flatterte er zwischen Agnès und mir herum und zog sich erleichtert wieder in den tränenförmigen Gitarrenkörper zurück. So hatte ich begonnen, die Oud zu spielen. Mit jedem Tag waren die Klänge, die mir durch die Finger gingen, weiter geflogen. Ich hatte Gefallen daran gefunden, neue Griffe und Akkorde für mich zu erobern.
Olivier war es nun, den ich in Marseille erobern wollte. Die Zeit bei den Treffen der sans-papier-Gruppe verbrachte ich damit, mit allen Mitteln seine Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Ich meldete mich zu Wort und zu Telefondiensten, ich zitierte Sätze aus La Peste und trug die schönsten Stücke aus meiner gerissenen Garderobe.
An einem Abend, bei einem Fest, war es schließlich so weit. Mit Hilfe von Bier und Marihuana habe ich mir selbst so viel Mut zugesprochen, dass ich Olivier einfach küsste. Es war der erste Kuss meines Lebens und ich wusste nur ungefähr, aus Filmen und von Beobachtungen, wie es funktionierte. Ich presste meine Lippen auf seine und streckte meine Zunge schnell in den vor Staunen aufgerissenen Mund. In der Mundhöhle angekommen verlor meine Zunge allerdings die Orientierung und glitt hilflos über Zahnreihen und Gaumen. Da aber kam mir seine Zunge zu Hilfe und nahm sich meiner an. Sie verwickelte sie in ein Spiel, das mir gleichzeitig sehr angenehm und sehr peinlich war wegen der Speichelfäden und des warmen Zungenfleisches, das sich ineinanderschob. Wir ließen unsere Zungen an diesem Abend noch oft zusammen tanzen, und zu einer fortgeschrittenen Stunde fuhr Olivier mit seiner Hand unter die Fransen meines froschgrünen Häcksel-T-Shirts. Über meine Taille, meinen Bauch hinauf zu meinen Brüsten wanderte seine Hand, mit kreisenden Bewegungen umspielte sie meine Brustwarzen, und eine warme Gischt brandete über meinen Körper. Mein Verlangen war so groß, dass ich ihn fragte, ob wir auf mein Zimmer gehen wollten. Dort lagen wir auf meinem Bett, zwei Körper, die sich aneinanderpressten, die wogten, zuckten und stöhnten bis in die frühen Morgenstunden hinein, die einen grauen, milchigen Lichtschleier über uns breiteten.
Olivier und ich haben uns seitdem regelmäßig gesehen, er hat in meiner Kammer und ich in seiner Garçonnière übernachtet. Die Leute aus dem Haus haben mich geneckt und gemeint, ich hätte jetzt einen petit ami, mit dem ich ausgehen würde. Tatsächlich sind wir aber kaum ausgegangen, ab und zu in ein kleines Lokal, um zu essen, aber meistens sind wir in La Reine gewesen. Ganze Nächte haben wir damit verbracht, Betrachtungen über die Welt anzustellen, über die Absurdität unseres Daseins, über die Sinnlosigkeit menschlichen Strebens und die Kraft, die in der Verneinung liegt.
»Worum es geht, ist die Klarsicht, dass alles, was wir unternehmen, umsonst ist. Wenn wir das begreifen, sind wir frei.«
Zunächst dachte ich, dass er sich mit Sätzen dieser Art darüber hinwegtrösten wollte, dass Menschen, die er beraten hatte, immer wieder abgeschoben wurden. Ich versuchte, ihn aufzumuntern, indem ich ihm von Rieux, dem sagenhaften Arzt aus La Peste erzählte, der sich mit großer Beharrlichkeit und Ausdauer gegen die furchtbare Seuche stemmte. Olivier lachte und meinte, dass auch dieser Kampf vergeblich sei, worüber sich Rieux, d’ailleurs, durchaus im Klaren sei, ich müsse nur an den Schluss des Buches denken. »Und doch wusste er, dass dies nicht die Chronik des endgültigen Sieges sein konnte«, das stünde doch dort, »n’est-ce pas?«
»Oui, mais …« Dort stand auch, dass sein Bericht über die Pest in Oran ein Zeugnis davon war, was all die Menschen vollbringen mussten, die trotz ihrer inneren Zerrissenheit gegen die Herrschaft des Schreckens ankämpften und die die Heimsuchung nicht anerkennen wollten. Olivier küsste mich, »T’es mignonne«, sagte er und klärte mich darüber auf, dass es im Grunde egal sei, was wir taten, es ohnehin sinnlos sei. Wie in einem Spiel taumelten wir von Entscheidung zu Entscheidung, die wir, je nach der Rolle, die wir gerade einnahmen, treffen würden. Das Wichtigste, la chose la plus importante, sei, sich dafür zu entscheiden, frei zu sein und ohne Illusionen zu leben, tu comprends? Ich habe damals nicht verstanden, was Olivier meinte, schließlich ging er regelmäßig zu den Organisationstreffen und versuchte auf seine Art, den Menschen zu helfen. Während der langen Abende, die ich bei meinem Verkaufsstand im Haus verbrachte, dachte ich darüber nach, suchte nach Fragen und Argumenten, mit denen ich Olivier beim nächsten Mal konfrontierten wollte.
An einem dieser Abende kamen Leute, die ich noch nie zuvor gesehen hatte, zu mir und wollten Stücke aus meiner gerissenen Garderobe kaufen. Sie seien nur wegen mir hier, erklärte mir einer, an einem Bekannten hätten sie die außergewöhnlichen Kleidungsstücke gesehen und wollten nun auch welche erwerben. Ich verkaufte ihnen drei T-Shirts mit sternen- und faustförmigen Löchern, zwei Röcke mit zerfransten Seitenschlitzen und vier Hosen mit unterschiedlichen Beinlängen und Kniemäulern. Für alles zusammen gaben sie mir zehn Euro, was ich für ausgesprochen knausrig hielt. In den darauffolgenden Wochen kamen immer mehr Leute wegen meines Verkaufsstandes zu den Festen, und obwohl sie besser gekleidet und genährt waren als die meisten, die in La Reine wohnten und verkehrten, bezahlten sie deutlich weniger für die Kleidungsstücke aus meiner Kollektion. Das ging so weit, dass ich eines Tages beschloss, die Verkaufspreise festzulegen, schließlich musste ich auch von etwas leben. Als ich aber die Preisschilder anbrachte an den Stühlen und Tischen, auf denen ich meine Kollektion ausgebreitet hatte, tauchte Marie auf und stellte mich aufgebracht zur Rede. Was ich hier mache, fragte sie, und warum ich ohne Absprache mit ihr und André Preisschilder anbringe, was, wie ich wohl wisse, in La Reine nicht gern gesehen sei. Mein Versuch zu erklären, dass die Leute zu knausrig seien, um auch ohne Schilder angemessene Preise zu bezahlen, versandete in Maries Redefluss, der nach und nach alle umstehenden Menschen mitriss. An jenem Abend gab ich meinen Verkaufsstand im Haus auf und beschloss, einen eigenen kleinen Laden zu eröffnen, in dem ich die Verkaufspreise bestimmen konnte.
Die für die Eröffnung eines kleinen Ladens nötige finanzielle Unterstützung kam von Olivier, oder vielmehr von seinen Eltern. Mit ihrer Hilfe eröffnete ich ein Bankkonto, auf das ich mit einer Kreditkarte jederzeit von jedem Ort aus zugreifen konnte, und mietete ein kleines Gassenlokal in der Nähe von La Reine, das ich mit den Fundstücken, die die Marseiller Straßen und Gassen bereitstellten, einrichtete. Ich malte La Trouturière über die Eingangstür, im selben feuerroten Farbton wie das Haarsegel, das sich über der Fassade unseres Hauses ausbreitete und mir beim Betreten stets das Gefühl vermittelte, ein Schiff zu besteigen, ein Schiff mit geblähtem Segel, das nach egal-wohin fuhr, Hauptsache hinaus, hinaus aufs Meer, auf dem das dämmrige Blau einer vagen Sehnsucht bald einer klaren, sonnentrunkenen Sicht auf unbegrenzte Weiten weichen würde. Mein kleines Gassenlokal wurde mein Flagship-Store, in dem ich meine Tage damit zubrachte, die aus den Mülltonnen der Stadt herausgefischten alten Kleidungsstücke zu zerschneiden, zu zerreißen, auszufransen und zu verkaufen. Die Leute aus dem Haus kamen ab und zu vorbei, auf der Suche nach einem neuen alten Kleidungsstück oder um zu plaudern. Langsam aber veränderte sich meine Klientel und erweiterte sich, vor allem, nachdem ein kleiner Bericht in der Stadtzeitung erschienen war, über den alternativen Kleiderladen, in dem kreative Einzelstücke zu guten Preisen feilgeboten wurden.
Ich verbrachte immer weniger Zeit in La Reine und immer mehr in Oliviers Garçonnière. Dort sprachen wir nicht mehr über die Absurdität unseres Daseins, über die Sinnlosigkeit menschlichen Strebens und die Kraft, die in der Verneinung liegt. Wir schauten Filme, spielten Schach und kochten für befreundete Paare. Olivier erwies sich als gewandter Gastgeber, dem es gelang, aus seiner kleinen Wohnung einen richtigen Salon zu zaubern. Es durfte nur indirektes Licht in den Raum fallen, die Lampen wurden so montiert, dass sie die hohe Decke und die weißen Wände anstrahlten. Auf dem Sofa waren Tücher mit orientalischen Mustern ausgebreitet, auf dem Tisch standen filigrane Weingläser mit zarten Gravuren, die von verschiedenen Flohmärkten stammten. Überall lagen Bücher von zeitgenössischen französischen Denkern herum, aufgeschlagen, als wäre eine konzentrierte Lektüre eben erst unterbrochen worden. Vor jedem geselligen Abend drapierte er diese Bücher sorgfältig auf den Stühlen, auf dem Boden und auf dem Sofa. Sie dienten als unaufdringlicher Leitfaden durch die Gespräche, die er mit Umsicht führte und die sich zumeist um aktuelle Kinofilme und Theatervorstellungen drehten, bevor sie sich zu fortgeschrittener Stunde, bei der dritten oder vierten Flasche Wein, in die Höhe allgemeinerer Betrachtungen schraubten, flankiert von halbwegs zitierten Sätzen aus den verstreuten Schriften.
Zu dieser Zeit gab Olivier auch seine Tätigkeit bei der sans-papiers-Gruppe auf. Als ich ihn danach fragte, ob er diese Entscheidung völlig frei und ohne Illusionen getroffen habe, schüttelte er unwillig den Kopf. Ich wisse ja, dass der Abschluss seines Studiums bevorstünde, er habe nun einfach weniger Zeit. Zu seinem Einstand in einer renommierten Anwaltskanzlei kauften ihm seine Eltern eine größere Wohnung, in die ich mit einzog. Die Garçonnière vermietete Olivier zu einem, wie er meinte, fairen Preis an Pascale, die einen Rückzugsort wollte, um sich von der anstrengenden Arbeit in der sans-papiers-Gruppe zu erholen.
Mein kleiner Laden lief so gut, dass ich mich mit Expansionsplänen trug. Ich streunte durch jene Straßen, in denen sich die Boutiquen der kleinen Mode-Labels befanden. Die ansehnlichen Preise, mit denen die weiten Hosen und Kleider aus eigenwilligen Stoffkombinationen ausgeschildert waren, beflügelten mich, und ich beschloss, in dieser Gegend ein Geschäft zu eröffnen. Alles sei eine Frage des Standortes, erklärte ich Oliviers Eltern und sie gaben mir Geld, um ein neues Verkaufslokal anzumieten und einzurichten. Auf die Wandfarbe verzichtete ich dieses Mal. Ich ließ ein dezentes Schild anfertigen, auf dem in einem nüchternen Schriftzug La Trouturière zu lesen war. Die Preise für meine gerissene Garderobe erhöhte ich dem neuen Standort entsprechend, wodurch sich meine Klientel erneut veränderte und mein Marktwert stieg. Ich trat nun nicht mehr als Kleidermacherin auf, sondern als Designerin. Mein Ruf verbreite sich über die ganze Stadt. Es kamen Leute aus den schickeren und reicheren Vierteln zu mir. Viele kauften die Kleidungsstücke, die sie zuvor wegen ein paar abgetragener, leicht abgewetzter Stellen weggeworfen hatten, zurück und zahlten dafür annähernd den Preis, zu dem sie sie einst neu erstanden hatten. Mira im Glück war ich zu dieser Zeit. Ich kreiste um meine gerissene Kollektion, und die Bahnen, die ich dabei zog, schraubten sich höher und höher. Die Sterne schienen in Griffweite.
Eines Tages stand ein etwas untersetzter Mann in meinem Geschäft. Seine Sonnenbrille nahm er auch dann nicht ab, als er die Stücke aus meiner Kollektion eingehend in Augenschein nahm. Zuerst hielt ich ihn für einen aufdringlichen Touristen, der von meiner gerissenen Garderobe Wind bekommen hatte und sie nun vor Ort als Kuriosum französischen Modebewusstseins betrachten wollte. Als er jedoch ein Notizheft aus seiner Tasche hervorzog und begann, etwas hineinzukritzeln, wurde ich stutzig. Etwas ungehalten machte ich ihn darauf aufmerksam, dass er gerne etwas kaufen könne, dass es aber verboten sei, die Einzelstücke zu fotografieren oder abzuzeichnen. Er verzog den Mund zu einem unangenehmen Lächeln und fragte, ob die Chefin hier sei und ob er sie sprechen könne. »Me voilà«, sagte ich und trat hinter dem Verkaufstisch hervor. Er schob die Sonnenbrille auf seine Nasenspitze und sah mich von unten herauf an. »C’est vous, la patronne, vous, la petite dame?« Nun wurde ich richtig zornig. Dass er wohl nicht von hier sei, fuhr ich ihn an, dass mich alle in der Stadt kennen würden und dass er nun besser mein Geschäft verlasse. Er aber lachte nur, lobte mein Temperament und meinte, dass er in der Tat nicht aus Marseille sei, sondern aus – Paris. »Paris« sprach er aus, als handle es sich um einen anderen Stern, nein, um ein ganz anderes Universum, das das Ziel aller irdischen Sehnsüchte darstelle, aber nur wenigen Auserwählten vorbehalten sei. Ich winkte ab, erklärte ihm, dass mir das egal sei und er sich verziehen solle. Ein paar herablassende Sätze über die Provinz und das Benehmen der Leute hier, ließ er fallen, bevor er ganz nahe an mich herantrat und mir die Hand entgegenstreckte. »Félicitation«, sagte er, ich hätte den Prix de la Mode Periphère gewonnen. In zwei Monaten werde er mir – ja, in Paris – überreicht, in der Zwischenzeit komme ein Fernsehteam, um eine Reportage zu drehen über periphere Moden und meine Kollektion als mustergültiges Beispiel für die Verschränkung von urbanen Lebensrealitäten und innovativer Modeschöpfung.
So hatte mein Ruf also auch die Grenzen von Marseille überschritten. Ich wurde nach Paris eingeladen, nahm an Modeschauen und anderen Aufsehen erregenden Veranstaltungen teil. Die Rohstoffe für meine gerissene Garderobe, die alten Kleidungsstücke aus den Abfällen Marseilles, konnte ich nun nicht mehr selbst besorgen, zu beschäftigt war ich mit Interviewanfragen und Einladungen. Ich beauftragte andere Menschen damit, mir neue alte Kleidungsstücke zu bringen. Ich kaufte sie ihnen zu einem Preis ab, der dem Materialwert entsprach. Das Zerschneiden, Zerreißen und Ausfransen musste natürlich weiterhin in meiner Hand bleiben, schließlich war es mein Stil, mein unverwechselbares Design, das meiner Kollektion ihre ganz spezielle Note, ihren kaum hoch genug zu schätzenden Wert verlieh. Mit zunehmender Bekanntheit allerdings kam ich immer weniger dazu, die alten Kleidungsstücke zu präparieren. Ich rief eine neue Kollektion aus meiner gerissenen Garderobe ins Leben, La Mode Trouvée, die gefundene Mode. Ich verkaufte die aus den Müllcontainern gefischten Jacken, Kleider, Hosen, Hemden und T-Shirts so, wie sie gefunden wurden, ohne sie zu bearbeiten. Der Erfolg war berauschend, die Stücke aus der Kollektion La Mode Trouvée erzielten exorbitante Preise und ich beschloss, ein weiteres Mal den Standort zu wechseln und ein helles, geräumiges Geschäftslokal in den frisch renovierten und herausgeputzten Hafendocks zu mieten.
Eines schönen Frühlingstages habe ich mich auf den Weg gemacht, um meinen neuen Verkaufsraum zu besichtigen. Ich ging zu Fuß die Canebière hinunter, die sich vor mir ausbreitete wie ein farbenprächtiger Teppich. Olivgrün, weinrot und honiggelb schimmerte der Boulevard, eine glänzende Weite, die vor mir lag, voller Versprechen auf ein angenehmes und angesehenes Leben. »Mira«, sagte ich zu mir selbst, »jetzt bist du angekommen, du wirst ein Geschäft in den Hafendocks, im neuesten und angesagtesten Geschäftsviertel der Stadt, eröffnen.« Beschwingt und voller Tatendrang bog ich in die Rue de la République ein, in der der abbröckelnde Stuck, das von Feuchtigkeit angeschwärzte Mauerwerk den neuen, herausgeputzten Fassaden gewichen war. Die wenigen Menschen, die auf der Straße waren, eilten vor den leer stehenden Straßenlokalen auf und ab. Plötzlich klingelte es in meinen Ohren. Zuerst dachte ich, ein Bettler scheppere mit den Münzen in seinem Becher, um weitere Geldstücke anzulocken, doch zu sehen war niemand, der hier in dieser Straße um Geld fragen würde. Das Klingeln wurde lauter, in meinen Ohren begann es zu surren und zu quietschen. Da ruckelte es auf einmal in mir, ein Ruckeln, das sich ausbreitete, das regelmäßiger und rhythmischer wurde, bis es schließlich zu vibrieren begann wie in einem Klangkörper, in dem eine Saite angeschlagen wurde, eine alte, eine verrostete Saite. Jene Saite in mir regte sich wieder, von der ich einst gedacht hatte, dass es sie nicht geben dürfe, die ich schlicht vergessen hatte, da ich endlich angekommen war, gut angekommen in dieser Stadt, in diesem Land. Widerwillig schüttelte ich den Kopf und setzte die Füße fest aufs Pflaster der Rue de la République, um weiter, weiter voranzukommen. In diesem Moment legte sich ein Pfeifen in meine Ohren. Zuerst dachte ich, dass auch dieses Pfeifen ein inneres sei, dass sich zu der verrosteten Saite ein anderes, ein schrilleres Instrument gesellt habe, das mit aller Kraft versuche, mich von dem farbenprächtigen Weg, der vor mir lag und der mich in die renovierten Hafendocks zu meinem neuen Geschäftslokal führte, abzulenken. Doch dann sah ich die Gruppe, die die Straße hinunter direkt auf mich zu ging. Eine kleine Ansammlung von Menschen versuchte, sich mit Trillerpfeifen und selbstgemalten Plakaten Aufmerksamkeit zu verschaffen. »Une ville pour tous« stand auf den Transparenten und »nous restons ici«. Es handelte sich um eine Kundgebung, bei der die Menschen, die vor Jahren in dieser Stadt angekommen waren, um hier ein besseres Leben zu finden, und die während der letzten Monate aus ihren gewohnten Stadtumgebungen vertrieben worden waren, versuchten, sich zur Wehr zu setzen. Ich blieb stehen und ließ den Demonstrationszug passieren. Grüne, blaue und braune Blicke streiften mich. Feindselig waren sie nicht gerade, aber in ihnen lag etwas, eine Art unverwandte Kälte, die mich unangenehm berührte. Als ich mich abwenden und meinen Weg fortsetzen wollte, vernahm ich jenes tiefe, klare Lachen, das sich während meines ersten rauschenden Streifzuges durch das Gassengewirr des Panier über mich ergossen hatte. Zwischen den grünen, blauen und braunen Blicken hielt ich Ausschau nach dem Augenpaar, das sich damals mit leisem Spott von mir abgewandt hatte. Doch die Gesichter der demonstrierenden Menschen waren ernst, in keinem zeigte sich ein Lachen, nicht einmal ein leises, ein spöttisches. Da schwang wieder jene Saite in meine Existenz hinein, die kurz zuvor noch vergeblich und rostig in mir vibriert hatte. Der verheißungsvolle Weg, der vor mir gelegen hatte, wechselte sein Farbenkleid. Blau gewandet war er nun, in ein dämmriges Blau gehüllt die Pfade, die sich eröffnet hatten vor meinen Füßen, die mich zwar weiterhin die Rue de la République entlang zu den Hafendocks trugen, die aber an den neuen, herausgeputzten Geschäftslokalen vorbei in das Hafengelände hineinliefen.
Ich stand im Personenhafen, in Gedanken verstrickt, die so kompakt und undurchdringlich waren wie der Schatten, der mich gehen und atmen ließ. Mein Leben, mein ganzes Leben hier in Marseille erschien mir plötzlich öd und leer. Über das Ankommen, über jene seltsame Bewegung, die uns über die Meere trägt, die den Fluchtpunkt der Sehnsucht bildet, von dem wir ausgehen, dem wir folgen, habe ich nicht viel erfahren, abgesehen von der kratzigen Sehnsucht, die nicht geschmeidig war und kleidsam wie das blaue Tuch, mit dem ich zum Abschied gewinkt habe, zu jenem Abschied, den ich weder von Olivier noch von meinem Geschäft genommen habe, als ich auf das Fährschiff gestiegen bin, um über das Mittelmehr zu fahren.