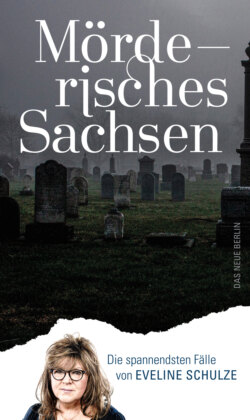Читать книгу Mörderisches Sachsen - Eveline Schulze - Страница 7
ОглавлениеDer Mann, der (k)ein Mörder war
Freitag, 30. Juni 1967
Um 18.20 Uhr erscheint im Volkspolizeikreisamt Zittau ein kleiner Mann, wenig größer als eins-sechzig und etwa Mitte dreißig. Er wolle eine Aussage machen, oder genauer gesagt: eine Anzeige, sagt er an der Wache. Es gehe um Mord.
Für Mord ist das Kommissariat I der Kriminalpolizei zuständig. Es wird der diensthabende Genosse Götte, Leutnant der K, zum Eingang gerufen. Götte bittet den Mann, der sich als Karl Morche ausweist, ihm in sein Dienstzimmer zu folgen, um dort die Anzeige aufzunehmen. Morche gibt als Adresse die Innere Oybiner Straße Nr. 6 in Zittau an, er ist ledig und als Transportarbeiter im VEB Robur in der Eisenbahnstraße beschäftigt. Leutnant Götte notiert anschließend im Protokoll: »Der Bürger Morche machte während der Tatschilderung einen ruhigen und selbstsicheren Eindruck. Alkoholgeruch oder Verhaltensweisen, die auf Alkoholgenuss hindeuten würden, konnten nicht wahrgenommen werden.«
Dieser Hinweis ist nicht unwesentlich, denn die von Morche erstattete Anzeige richtet sich gegen ihn selbst. »Nach eigenen Angaben will er im Jahre 1949 eine weibliche Person in unmittelbarer Nähe der in Zittau befindlichen Weberkirche durch Schläge mit einer Eisenstange vorsätzlich getötet haben.«
Siebzehn Jahre zuvor, am 28. Juli 1950, einem Freitag, ist in den frühen Morgenstunden die 48-jährige HO-Verkäuferin Anna Hölzel auf der Straße vor der Weberkirche tot aufgefunden worden. Der vermutliche Raubmord ist nie aufgeklärt worden. Sollte die Sache nunmehr abgeschlossen werden können?
Leutnant Götte nimmt sofort telefonisch Rücksprache auf mit seinem Chef, dem Leiter des Kommissariats I, Oberleutnant der K Strengeld. Der weist an:
»1. Verständigung des K-Leiters, der Kreisdienststelle des MfS, des Staatsanwalts und des Amtsleiters.
2. Sofortmeldung bzw. Ergänzungsmeldung absetzen.
3. Aufnahme des Geständnisses auf Tonband.
4. Erste Überprüfungen zum Sachverhalt.
5. Erstaufklärung zur Person führen.
6. Einlieferung Morches in VP-Gewahrsam.«
Samstag, 1. Juli
Das Kommissariat III der Abteilung K nimmt Einsicht in die Kreismeldekartei und bestätigt, dass ein Karl Franz Morche unter der von ihm angegebenen Adresse in Zittau gemeldet ist.
Im Register finden die Ermittler weitere vier Personen dieses Namens: den selbständigen Schneidermeister Josef Morche (1893–1962) und dessen Frau Agnes, geborene Raaz (1892–1957), die verstorbenen Eltern des vermeintlichen Täters, sowie die Verkäuferin Ursula Morche, geborene Tzscherlich – von 1953 bis 1960 mit dem »Selbststeller« verheiratet – und Dietmar Morche, ihr gemeinsames Kind, welches 1952 geboren wurde. Beide, die Mutter und der inzwischen 15-jährige Sohn, wohnen in der Neusalzaer Straße 13 in Zittau.
Oberleutnant der K Kehler, Leiter der Kriminalpolizei in Zittau, und VP-Oberleutnant Fessel in seiner Eigenschaft als Operativer Diensthabender (ODH) des Volkspolizeikreisamtes setzen ein zweites Fernschreiben an den ODH/Stab der Bezirksdirektion der Volkspolizei in Dresden ab:
»Betr.: 1. Ergänzungsmeldung zur Sofortmeldung vom 30.06.67; Bezug: Raubmord durch Erschlagen in der Nacht vom 27. zum 28.07.1950.«
Anlass dieser zweiten Meldung für die vorgesetzte Dienststelle in Dresden ist die Entdeckung, dass etwas mit Karl Morche offenbar nicht stimmt.
»Morche entstammt einer Handwerkerfamilie, absolvierte bis 1945 die Volksschule und erlernte im elterlichen Betrieb den Beruf eines Herrenschneiders. Die geistige Entwicklung verlief bis 1952 vollkommen normal. Seit 1952 wiederholt kurzzeitige Aufenthalte in der Heil- und Pflegeanstalt Großschweidnitz. Nähere Angaben werden am 10.07.67 gegen 07.30 Uhr erwartet.« Und noch etwas: »M. gab an, das Wetter am Tattag sei regnerisch und trüb gewesen. Rückfrage Wetterstation Olbersdorf bestätigt dies für die Nacht vom 27. zum 28.07.1950 nicht mit absoluter Sicherheit (Luftfeuchte 86 Prozent), in der Nacht vom 04. zum 05.06.1949 (Tatzeit nach Meinung M.) war es regnerisch.«
Am Samstagnachmittag wird eine weitere Ergänzungsmeldung erforderlich. Man habe, so tickern die Zittauer Ermittler nach Dresden, sowohl gegen den Selbstbezichtiger Morche ein Ermittlungsverfahren gemäß §211 Strafgesetzbuch eingeleitet als auch einen »Unterbringungsbefehl in die psychiatrische Spezialklinik Großschweidnitz« beantragt. In jener Klinik soll Morche seit 1952, wie die ersten Recherchen ergaben, bereits neun Mal zur Behandlung gewesen sein. Ferner lässt man die vorgesetzten Genossen an der Elbe wissen, dass Zittau den Fall an das Kommissariat II in Görlitz übergeben hat. Es sei bereits eine »Anleitung durch die MUK Dresden und durch Staatsanwalt Elsner von der Bezirksstaatsanwaltschaft Dresden« erfolgt. Vermutlich wurde dort entschieden, dass Görlitz den Fall Morche übernimmt.
Um 11.20 Uhr war Ursula Morche zur Zeugenvernehmung im VPKA Zittau erschienen. Bis 14.20 Uhr wurde Morches Ex-Frau von Oberleutnant Horstmann befragt. Die Quintessenz des sechsseitigen Protokolls führte offenkundig zu jener ersten Ergänzungsmeldung, die alsbald nach Dresden per Fernschreiber übermittelt worden war.
Ursula Morche leitet den HO-Laden für Molkereierzeugnisse in der Zittauer Geschwister-Scholl-Straße. Sie ist Jahrgang 1932 und Tochter eines Fleischermeisters. 1948 lernte sie in der Tanzstunde Karl Morche kennen. Natürlich kreisen Horstmanns Fragen alsbald um Morches geistige Auffälligkeiten im Mordjahr.
»Frage: Gab es zu dieser Zeit bereits Merkmale einer Nervenkrankheit?
Antwort: Nein. Ich fand Herrn Morche vollkommen normal, von einer nervlichen Krankheit waren keine Anzeichen vorhanden.
Frage: Auch im Jahre 1950 nicht?
Antwort: Ja, auch zu dieser Zeit nicht.
Frage: Wie drückte sich Ihr persönlicher Verkehr zu dieser Zeit aus, speziell im Jahre 1950?
Antwort: Ich weiß nur noch, dass ich im Jahr 1949 die Tanzstunde beendete. Danach sind wir bereits familiär verkehrt, wir haben uns wechselseitig in den Familien besucht.
Frage: Gab es zwischen Ihnen bereits in den ersten Jahren, so zwischen 1948 und 1950, intimen Verkehr?
Antwort: Zu Anfang auf keinen Fall. Es ist möglich, dass wir im Jahr 1950 bereits intim verkehrten. In jener Zeit waren wir hauptsächlich an den Wochenenden zusammen und weniger in der Woche. Wir besuchten Tanzveranstaltungen, gingen ins Theater oder ins Kino.
Frage: Wie war das Verhalten des Morche zu Ihnen?
Antwort: Es war auf jeden Fall so, dass ich spürte, dass mich Morche liebte und mich heiraten wollte.
Frage: Haben Sie sich verlobt?
Antwort: Wir verlobten uns erst 1952. Ich muss hierzu erklären, dass meine Eltern gegen die Verbindung waren. Dabei richtete sich die Abneigung meiner Eltern nicht direkt gegen Morche, es betraf mein Alter.
Frage: Ist Ihnen bekannt, dass im Jahr 1950 in Zittau an der Weberkirche ein Mord geschah?
Antwort: Mir ist erinnerlich, dass in Zittau ein Mord geschah, auch dass es an der Weberkirche war. Ich kann mich aber auf die Jahreszahl nicht festlegen.
Frage: Können Sie sich erinnern, ob Morche mit Ihnen darüber sprach?
Antwort: Nein, das ist mir nicht erinnerlich.
Frage: Wann haben Sie sich verlobt?
Antwort: Wir verlobten uns im Monat April 1952. Da war ich bereits schwanger von Morche. Unser Junge wurde am 4. September 1952 geboren.
Frage: Wo war Morche zu dieser Zeit beschäftigt?
Antwort: Morche war die gesamte Zeit über (während ihrer Beziehung – E. Sch.) im Geschäft seiner Eltern als Schneider beschäftigt. Es handelte sich dabei um die Schneiderei in der Inneren Oybiner Straße 28 in Zittau. Dort arbeiteten drei Angestellte und der Schneidermeister, Vater Morche.
Frage: Wann traten erstmals nervliche Krankheitsmerkmale auf?
Antwort: Zwischen der Verlobung und der Trauung am 7. April 1953.
Frage: Wie zeigte sich das, und was geschah darauf?
Antwort: Morche wohnte bei seinen Eltern. Er ging nicht arbeiten und blieb im Bett. Ich wurde geholt und sollte ihn umstimmen, doch auch mir gelang das nicht. Ein andermal wollten wir zu seinen Verwandten nach Plauen fahren, auch das fiel ins Wasser. Er war fast nicht ansprechbar. Dr. Knoch-Weber überwies ihn zur Behandlung in die Krankenheilanstalt Großschweidnitz.
Frage: Spielte Morche bereits zu dieser Zeit in der Kapelle? (Morche hatte in seiner Aussage erklärt, in seiner Freizeit als Pianist in einer Betriebskapelle zu musizieren. – E. Sch.)
Antwort: Nein. Damit hat er erst später begonnen.
Frage: Können Sie sich noch an die Einkünfte von Morche erinnern? Hatte er viel Geld?
Antwort: An die Höhe von Morches Lohn kann ich mich nicht erinnern. Besonders viel Geld hat er nie gehabt. Auch nicht vorübergehend.
Frage: Wenn Sie miteinander ausgingen: Was trank er da an Alkohol?
Antwort: Vor unserer Ehe trank er kaum. Wenn wir ausgingen, etwa zu Tanzveranstaltungen, blieb der Alkoholgenuss stets im Rahmen. Ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals stark betrunken war.«
Nachdem Horstmann weitere Fragen zu Einnahmen und Anschaffungen vor und während der Ehe gestellt hatte, kommt er neuerlich auf Morches vermutliche Geisteskrankheit zu sprechen.
»Frage: Gab es zu Beginn der Ehe Auffälligkeiten?
Antwort: Bereits eine Woche nach der Trauung musste er in die Krankenheilanstalt Großschweidnitz eingeliefert werden. Schon am Polterabend hatte es erste Anzeichen gegeben. Zum Termin auf dem Standesamt erschien er zunächst nicht. Meine Schwiegereltern mussten ihn erst holen. Es war wohl die zweite oder gar dritte Einweisung.
Frage: War es eine Liebesheirat?
Antwort: Ich habe mich aus zwei Gründen zur Heirat entschieden. Erstens war unser Sohn bereits geboren, zweitens wollte Morche von zu Hause weg. Das war auch der Grund, weshalb mir seine Eltern laufend Vorhaltungen machten. Sie sagten sogar, ich sei schuld an seiner Nervenkrankheit.
Frage: Gab es während der Ehe Besonderheiten?
Antwort: Wir wohnten bei meinen Eltern. Es gab schon bald Auseinandersetzungen. Morche übernahm grundsätzlich keine Arbeiten im Haus. Er kehrte weder die Straße noch besorgte er Holz und Kohlen zum Heizen usw. Er begann auch zu trinken. Das ging damit einher, dass er als Laienmusiker auftrat.
Frage: Hat Morche Ihnen gegenüber irgendwann einmal erwähnt, dass er ein Verbrechen begangen hat?
Antwort: Nein. Darüber hat er niemals mit mir gesprochen.
Frage: Wie verhielt sich Morche zu Ihnen unter Alkoholeinfluss?
Antwort: In den sieben Jahren unserer Ehe, von 1953 bis 1960, hat Morche übermäßig Alkohol genossen und stark geraucht. Wenn er betrunken nach Hause kam, krakeelte er, brüllte herum und zerschlug Geschirr. In den ersten Jahren gingen wir mitunter noch zusammen aus. Doch weil er kein Maß beim Trinken kannte, ging ich nicht mehr mit ihm weg. Während der Ehe ist er mehrere Male in ärztlicher Behandlung in Großschweidnitz gewesen. Dort informierte mich ein Arzt, dass mein Mann zeitweise aggressiv werden könne, was ich ja schon selbst mehrmals erlebt hatte. Am Ende war auch ich nervlich kaputt und mein Sohn nervös. Ich zog den Schluss, die Ehe zu beenden und reichte die Scheidung ein.
Frage: Gab es Besonderheiten nach der Scheidung?
Antwort: Nein.
Frage: Haben Sie oder hat Ihr Sohn Verbindung zu Morche?
Antwort: Ich habe keinerlei Verbindungen. Mein Sohn Dietmar besucht manchmal seinen Vater. Zu Geburtstagen schenkt er ihm Geld. Auch zur Jugendweihe erhielt er Geld von ihm.
Frage: Hat Ihr Sohn Ihnen über Besonderheiten in der Zeit nach 1960 berichtet?
Antwort: Ja. 1965 oder 1966 war mein geschiedener Mann wieder krank. Mein Sohn mied ihn damals.
Frage: Haben Sie noch irgendwelche anderen Besonderheiten im Verhalten von Morche in Erinnerung?
Antwort: Ja. Vor einigen Jahren kam meine Mutter von der Spätschicht nach Hause, da stand Morche vor unserem Haus. Am Morgen stand er noch immer dort. Ich sprach mit ihm. Er wollte den Jungen haben, um mit ihm spazieren zu gehen. Ich sagte ihm, dass Dietmar zur Schule müsse und dafür keine Zeit habe. Später bekam ich Postkarten von Morche aus Berlin, Leipzig und Dresden. Er reiste viel. Dann hörte ich aus seinem Betrieb, dass er oft nicht zur Arbeit käme.
Frage: Gab es bei Ihrem geschiedenen Ehemann Besonderheiten sexueller Art?
Antwort: Mir sind keine solchen Besonderheiten aufgefallen. Es war zwischen uns in sexueller Hinsicht ganz normal. Wenn er betrunken war, war er ganz besonders sexuell erregt und führte Geschlechtsverkehr mit mir aus.
Frage: Wie ist die Frage des Unterhalts des Sohnes geregelt?
Antwort: Ich erhalte direkt von seinem Betrieb, dem VEB Robur, den Unterhalt, und zwar 65 MDN.
Frage: Gibt es Besonderheiten in der Entwicklung Ihres Sohnes?
Antwort: Mein Sohn entwickelt sich normal. Er hat in der Schule durchschnittliche bis gute Leistungen und besucht jetzt die 8. Klasse.
Frage: Trauen Sie Ihrem geschiedenen Mann ein Verbrechen größerer Art zu?
Antwort: Ich kann nur noch einmal betonen, dass Morche im Jahre 1950 von mir als ganz normaler junger Mensch eingeschätzt wurde. Ich verspürte damals und auch später niemals eine besondere Unruhe in seinem Wesen. Auch hat er niemals Äußerungen in dieser Hinsicht gemacht. Ich traue ihm diesen Mord an der Weberkirche nicht zu. Nach meiner Überzeugung ist diese Behauptung Ausdruck seines nervlichen Zustandes.
Ich habe das Protokoll selbst gelesen. Der Inhalt entspricht in allen Teilen meinen Angaben. Meine Worte sind darin richtig wiedergegeben.«
Noch am gleichen Tag entspricht Staatsanwalt Pollack dem an die Strafkammer des Kreisgerichts Zittau gerichteten Antrag, Karl Morche in Haft zu nehmen. Offiziell heißt das »Unterbringungsbefehl gemäß §151 (2) StPO«.
Als Gründe für den Haftbefehl nennt Pollack:
»Morche steht nach dem eigenhändig unterschriebenen Geständnis im dringenden Tatverdacht des Mordes gem. §211 StGB an der Verkäuferin Hölzel, die am 27.07.1950 an der Weberkirche in Zittau überfallen, erschlagen und ausgeraubt wurde.
Über das von Morche abgelegte schriftliche Geständnis hat er auch auf Befragen durch die Angehörigen der MUK und des Vertreters des Bezirksstaatsanwaltes die Aussage bekräftigt, obwohl das von ihm genannte Datum nicht mit dem Tattag übereinstimmt.
Durch weitere Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass Morche ab 1952 insgesamt neun Mal im Fachkrankenhaus Großschweidnitz zur Behandlung weilte, im Ergebnis der Beobachtungen sind Erscheinungen schizophrener Depressionen gegeben. Diese Umstände lassen den Schluss zu, dass Morche sich zurzeit in einem solchen Zustand befindet. Nach Rücksprache mit dem ärztlichen Direktor des Fachkrankenhauses Großschweidnitz ist Morche in diesem Zustand der §51 (1) StGB zuzubilligen.
Es ist notwendig, Morche zur weiteren Beobachtung und Begutachtung dem Fachkrankenhaus für Psychiatrie Großschweidnitz zuzuführen bzw. dort unterzubringen.«
Um 14.30 Uhr an jenem Samstag, dem 1. Juli 1967, hatte Karl Morche seine Unterschrift unter das Vernehmungsprotokoll gesetzt. Nach der Lektüre des am Vorabend geschriebenen Befragungsprotokolls quittierte er zuvor auch dieses. »Ich habe mir das am 30. Juni 1967 gefertigte Befragungsprotokoll nochmals durchgelesen und halte die dort gemachten Angaben in vollem Umfange aufrecht. Die Angaben aus dem Befragungsprotokoll mache ich auch zum Gegenstand meiner heutigen Vernehmung und habe dem nichts mehr hinzuzufügen.«
Die Vernehmung erfolgte durch drei Offiziere der Kriminalpolizei, die das 23 Seiten umfassende Protokoll in dieser Reihenfolge unterzeichnen: Schulze, Leutnant der K; Kehler, Oberleutnant der K; Götte, Leutnant der K. Das Tonband läuft mit.
»Frage: Haben Sie gut geschlafen? Sie sind zu uns gekommen, und wir haben Ihnen Gelegenheit gegeben, sich noch etwas auszuruhen. Sie haben doch sicherlich geschlafen?
Antwort: Ich habe geschlafen. Ich konnte erst nicht gleich einschlafen.
Frage: Fühlen Sie sich gesund?
Antwort: So einigermaßen.
Frage: Sind Sie in der Lage, uns noch einmal die gesamte Geschichte zusammenhängend zu schildern?
Antwort: Was wollen Sie denn wissen?
Frage: Zunächst möchte ich Sie zu Ihren Personalien befragen. Sie heißen?
Antwort: Karl Morche.
Frage: Wann sind Sie geboren?
Antwort: Am 3. November 1931 in Friedland im Isargebirge, heute Tschechoslowakei, keine dreißig Kilometer von hier.
Frage: Und wo arbeiten Sie?
Antwort: Beim VEB Robur als Transportarbeiter.
Frage: Und wo wohnen Sie?
Antwort: Hier in Zittau, Innere Oybiner Straße 6.
Frage: Sind Sie verheiratet?
Antwort: Nein, ich bin geschieden seit 1960.
Frage: Hatten Sie Kinder?
Antwort: Ich habe einen Sohn.
Frage: Und wie alt ist der?
Antwort: Anfang September wird er 15.
Frage: Wir möchten Sie bitten, dass Sie uns diese Geschichte, die Sie bereits zu Protokoll gegeben haben, noch einmal zusammenhängend schildern.
Antwort: 1949 ist es gewesen, da bin ich, als ich nach Hause gehen wollte, wie ich von meiner Freundin komme, wie ich nach Hause gehen will, da, es war sehr trüb und regnerisch an diesem Abend. In der Nacht vom 4. zum 5. Juni 1949. Wie ich nach Hause gehen will, gehe ich die Äußere Weberstraße in Richtung nach Hause, und unterwegs fand ich das Stück Eisen, so ungefähr so in der Größe.
Frage: Wie lang schätzen Sie es ungefähr?
Antwort: So 60 Zentimeter ungefähr, 50 bis 60 Zentimeter ungefähr.
Frage: Wie dick war das Eisen?
Antwort: Es war ungefähr in der Stärke von zehn bis zwölf Millimeter.
Frage: Wie sah denn das Eisen aus? War das ein breites?
Antwort: Nein, es war ein rundes Eisen, so wie der Stahl so. Und das habe ich mir dann mitgenommen, und wie ich auch ein Stück weitergehe, so kurz vor dem Volkshaus, da kam dann eine Frau raus, die kam aus dem Volkshaus raus. Und der Frau bin ich dann hinterhergegangen, und ich konnte bloß erkennen, die Frau, die hatte hier diesen Bauchladen, und die Frau ist dann über die Straße der Roten Armee gegangen, und ich lief ihr hinterher, und bei der Weberkirche habe ich dann zugeschlagen. Hab ihr auf den Kopf geschlagen. Das war dann an der Weberkirche, kurz hinter der Türe, wo es raufgeht zur Orgel. Und sie trug auch so einen, wie die Verkäuferinnen auch jetzt tragen, so einen Haarschutz. Also Verkäuferinnen, die in der Lebensmittelbranche beschäftigt sind oder auch in Gaststätten arbeiten. Raupe oder wie man dazu sagt. Oder Häubchen oder Raupe oder wie man dazu sagt. Und dann, ich hab bei der Frau nicht nachgesehen wegen Geld, ich hab mich sofort dann vom Tatort entfernt. Bin noch ein Stück durch den Park gegangen, und dann bin ich in die Äußere Oybiner Straße gegangen, bis zur Mandaubrücke, und dann habe ich das Eisen weggeworfen. Und dann bin ich nach Hause gegangen, wo meine Eltern wohnten, Innere Oybiner Straße 28. Ich hatte damals schon ein eigenes Zimmer, und meine Eltern haben mich nicht heimkommen hören.
Frage: War das alles?
Antwort: Was wollen Sie denn noch wissen?
Frage: Sie sagen also, Sie sind wo gewesen, an diesem Tag? Woher wissen Sie das überhaupt noch, wieso können Sie sich an dieses Datum erinnern? Es liegt doch schon eine ganze Zeit zurück?
Antwort: Es ist schon ein ganz paar Jahre.
Frage: Wieso ist Ihnen dieses Datum noch so in Erinnerung? Noch so genau? Sie sagen vom 4. zum 5., sagten Sie. Welchen Monat?
Antwort: In der Nacht vom 4. zum 5. Juni 1949.
Frage: Juni oder Juli?
Antwort: Juni, der sechste Monat.
Frage: Ja, woher wissen Sie das Datum noch so genau? Sie sagen ja selber, dass es schon einige Jahre zurückliegt, und trotzdem können Sie sich noch so genau erinnern. Gab es da etwas Besonderes an diesem Tage?
Antwort: Vielleicht bin ich auch etwas aufgeregt gewesen an diesem Tage. Es war im Sommer.
Frage: Sie wissen es also noch sehr genau, es war vom 4. zum 5 Juni.
Antwort: In der Nacht vom 4. zum 5. Juni.
Frage: Und wo sind Sie hergekommen?
Antwort: Von der Neusalzaer Straße, von meiner Freundin.
Frage: Wie spät war es da ungefähr?
Antwort: So ungefähr in der zwölften Stunde.
Frage: Mittags?
Antwort: Nein, in der Nacht, gegen 24 Uhr. So in der zwölften Stunde bin ich weggegangen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie lange ich gelaufen bin.
Frage: Sie sagen, Sie waren bei Ihrer Freundin. Wer war denn Ihre Freundin?
Antwort: Das war meine spätere Frau.
Frage: Wie heißt sie denn?
Antwort: Wie sie jetzt heißt?
Frage: Ist sie wieder neu verheiratet?
Antwort: Soviel ich weiß, ist sie nicht wieder verheiratet.
Frage: Wie hieß sie denn damals?
Antwort: Ursula Tzscherlich.
Frage: Und sie wohnt hier in Zittau?
Antwort: Hier in Zittau. Neusalzaer Straße 3.
Frage: Sie waren also bei Ihrer damaligen Freundin?
Antwort: War damals bei meiner Freundin zu Besuch und bin dann nach Hause gegangen. Ich wollte nach Hause, und unterwegs dann, da ist das passiert.
Frage: Von der Neusalzaer Straße kamen Sie. Wie sind Sie denn da gelaufen?
Antwort: Die Neusalzaer Straße reingelaufen über die Freudenhöhe und dann bloß auf der Äußeren Weberstraße reingegangen bis zur Weberkirche, also beim Volkshaus vorbei und dann der Frau hinterher.
Frage: Auf welcher Straßenseite sind Sie denn gelaufen? Sie sind also aus der Richtung Stadtgrenze in Richtung Stadtmitte, und auf welcher Straßenseite sind Sie da gegangen?
Antwort: Auf der linken Straßenseite. Bloß auf der linken Straßenseite.
Frage: Und welches Gebäude liegt auf der linken Straßenseite?
Antwort: Da liegen mehrere Gebäude.
Frage: Welches besondere Gebäude liegt dort?
Antwort: Das Volkshaus.
Frage: Sie sind demnach direkt am Volkshaus vorbeigelaufen?
Antwort: Da bin ich direkt vorbeigegangen.
Frage: Wie war denn der Betrieb auf der Straße?
Antwort: Es war sehr ruhig schon, weil schlechtes Wetter war. Es war trübe, und es war regnerisch. Es war nasses Wetter.
Frage: Haben Sie jemanden dort getroffen?
Antwort: Nein, gar niemanden. Keinen Bekannten und niemanden getroffen.
Frage: Waren Sie schon am Volkshaus vorüber, oder war es noch vor dem Volkshaus, wo Sie der Frau begegnet sind? Oder wo Sie die Frau das erste Mal gesehen haben. Erzählen Sie doch bitte nochmals, wie das mit der Frau gewesen ist.
Antwort: Kurz vor dem Volkshaus, wo ich kurz vor dem Volkshaus laufe, da kommt die Frau aus dem Volkshaus raus. Früher sind auch schon zwei Eingänge gewesen. Der eine Eingang oder Aufgang zum Hotel und zur Gaststätte, und zuvor der Eingang zum Saal, zum Tanzsaal. Und jetzt da ist es auch so, nur man hat jetzt gebaut, und es ist einiges verändert worden. Aber die Frau kam von der Gaststätte.
Frage: Wenn Sie also aus Richtung Freudenhöhe kamen, der wievielte Eingang: der erste oder der zweite?
Antwort: Von der Freudenhöhe gesehen: der zweite Eingang. Wenn man von der Freudenhöhe kommt, ist der erste Eingang zum Saal und der zweite zur Gaststätte.
Frage: Und die Frau ist wo rausgekommen?
Antwort: Von der Gaststätte.
Frage: Hat die Frau Sie gesehen, und haben Sie sie angesprochen? Oder wie war das?
Antwort: Ich kannte die Frau gar nicht, und sie hat mich vielleicht auch nicht gesehen. Oder ich weiß es nicht, ob sie mich bloß kurz gesehen hat, oder sie hat auch nicht dergleichen getan.
Frage: Die Frau ist also gekommen, ist rausgegangen aus dem Grundstück. In welche Richtung ist die Frau gelaufen?
Antwort: In Richtung Stadt, Stadtmitte. Vielleicht wollte sie zum Handelshof. Vielleicht wollte sie, weil sie bei der HO gearbeitet hat, vielleicht wollte sie zum Handelshof.
Frage: Woher wissen Sie denn, dass diese Frau bei der HO gearbeitet hat? Ich denke, Sie haben die Frau nicht gekannt.
Antwort: Ich hab die Frau nicht gekannt.
Frage: Sie sagten doch eben, sie hätte bei der HO gearbeitet.
Antwort: Sie kam mit dem Bauchladen.
Frage: In welcher Entfernung waren Sie denn, als die Frau aus dem Volkshaus kam?
Antwort: Bloß so kurz vorher.
Frage: Wie viele Meter mögen das gewesen sein?
Antwort: Vielleicht drei bis vier Meter ungefähr.
Frage: Können Sie anhand dieses Zimmers ungefähr andeuten, in welcher Entfernung das gewesen sein könnte? Sie waren ziemlich dicht dran an dieser Frau?
Antwort: Ich war ziemlich nahe, ja.
Frage: Wie viele Meter schätzen Sie?
Antwort: Es waren keine vier Meter. Es waren knapp drei Meter.
Frage: Haben Sie mit der Frau gesprochen?
Antwort: Nein.
Frage: Hat die Frau Sie angeschaut?
Antwort: Das weiß ich nicht.
Frage: Wo haben Sie denn dieses Eisen gefunden?
Antwort: Auch auf der Äußeren Weberstraße. Nein, auf der mittelsten Straße nicht, sondern so seitlich am Fußweg.
Frage: Wo denn da? Sie sind doch Zittauer.
Antwort: Nein, ich bin nicht Zittauer. Ich wohne bloß seit 1945 in Zittau.
Frage: Beschreiben Sie mir doch bitte einmal, wo Sie das Eisen gefunden haben.
Antwort: Ungefähr bei Karosserie Winter.
Frage: Das ist doch ein ganz schönes Stück entfernt vom Volkshaus.
Antwort: Das sind ein ganz paar Meter.
Frage: Und wo hat das Eisen denn dort gelegen?
Antwort: So seitlich am Fußweg.
Frage: Und weshalb haben Sie das Eisen überhaupt mitgenommen? Wozu brauchten Sie es?
Antwort: Ich wollte … Ich hatte mir schon vorgenommen, so etwas zu tun.
Frage: Was hatten Sie sich vorgenommen?
Antwort: Wegen meinem Cousin. Es mag etwas eigenartig klingen, aber mein Cousin ist im Krieg geblieben, und ich wollte meinen Cousin rächen.
Frage: Was hat Ihr Cousin mit dieser Frau zu tun, die Sie doch gar nicht kannten?
Antwort: Es mag eigenartig klingen, aber …
Frage: Wie heißt denn Ihr Cousin?
Antwort: Der heißt wie ich.
Frage: Morche. Und sein Vorname?
Antwort: Auch Karl.
Frage: Wo hat der denn gewohnt, Ihr Cousin?
Antwort: In Friedland, in den Sudeten.
Frage: Hat er noch Angehörige?
Antwort: Nein, der lebt nicht mehr.
Frage: Ich meine seine Verwandten. Seine Mutter zum Beispiel.
Antwort: Seine Mutter ist 1946 in Westdeutschland gestorben.
Frage: Wer kennt diesen Cousin noch? Haben Sie noch Angehörige?
Antwort: Bloß meinen Bruder.
Frage: Wo lebt denn Ihr Bruder?
Antwort: Auch in Westdeutschland.
Frage: Wen haben Sie denn noch hier wohnen, bei uns in der Republik?
Antwort: Meinen Jungen, und hier in Zittau wohnt eine Cousine von mir. Die wohnt in Zittau in der Willi-Gall-Straße. Sie hat auch erst in der Äußeren Oybiner Straße gewohnt.
Frage: Wie heißt sie denn?
Antwort: Rosl Hübner.
Frage: Frau Hübner müsste ja Ihren Cousin, der im Krieg geblieben ist, auch kennen.
Antwort: Den hat sie gekannt.
Frage: Sie sagten vorhin, Sie hätten sich das schon früher einmal vorgenommen. Was ist darunter genau zu verstehen?
Antwort: Vielleicht schon einige Wochen vorher.
Frage: Hatten Sie einen bestimmten Plan?
Antwort: Nein, keinen bestimmten Plan. Bloß vielleicht hat das mitgespielt an diesem Abend, weil bei meiner Schlechtigkeit und bei der Tat, die ich begangen habe, das Wetter günstig war, und so konnte das dann den nächsten Tag oder die nächsten Tage oder in den nächsten Wochen nach der Tat im Jahre 1949 … konnte das nicht gleich aufgeklärt werden.
Frage: Das verstehe ich nicht: Es konnte nicht gleich aufgeklärt werden. Was hat das denn mit dem Wetter zu tun?
Antwort: Mit den Fußspuren und so.
Frage: Sie haben also geglaubt, da hinterlassen Sie keine Spuren, wenn schlechtes Wetter ist? Hat es denn so kräftig geregnet?
Antwort: Es hat ganz schön geregnet.
Frage: Was haben Sie an diesem Tag angehabt?
Antwort: Das weiß ich nicht mehr so genau.
Frage: Sie haben also dieses Eisen gefunden. Warum haben Sie es mitgenommen?
Antwort: Ich hatte mir vorgenommen, so etwas zu tun.
Frage: Haben Sie das Eisen wirklich dort gefunden?
Antwort: Das war so am Zaun, und da habe ich es weggenommen.
Frage: Sie sind also der Frau hinterhergegangen. Sie sagen selbst, Sie wären ziemlich dicht hinter der Frau gelaufen, und es sei sehr wenig Betrieb auf der Straße gewesen.
Antwort: Es war sehr wenig Betrieb auf der Straße. Man kann sagen: Es war sonst niemand zu sehen. Vielleicht so im Volkshaus, da sind Leute gewesen, aber draußen ist niemand zu sehen gewesen.
Frage: Wie ist die Geschichte dann weitergegangen? Sie sind also der Frau gefolgt. Sie liefen also vom Volkshaus aus auf welcher Seite? Links oder rechts?
Antwort: Auf derselben Seite, wo das Volkshaus ist, wo jetzt die PGH Bild und Ton ist, und beim Hirsch vorbei, wo jetzt die Textilverkaufstelle ist. Da ist die Frau über die Straße der Roten Armee gegangen. Damals ist das noch etwas anders gewesen, da ist später viel gebaut worden, an der Weberkreuzung. Vor einigen Jahren ist an der Weberkreuzung so eine Insel gebaut worden, aber verkehrsmäßig wird das nicht richtig genützt. Der Ring ist Einbahnstraße, und wenn man die Äußere Weberstraße mit dem Auto fährt, da müssen die Autos halten, weil die Autos am Grünen Ring, also die von der Straße der Roten Armee runter kommen und in die Innere Weberstraße einbiegen wollen bzw. nach der Dr.-Brinitzer-Straße fahren wollen, dann müssen die Autos warten auf der Äußeren Weberstraße. Damals, 1949, da ist die Straße gleich gewesen, da war das noch nicht so gebaut, da waren noch keine Ampeln, und da konnte man und da war bloß … kam man so beim Hirsch vorbei auf dem Bürgersteig … und dann runter auf die Straße, und die Straße war glatt. Jetzt ist sie ein bissel anders gebaut.
Frage: Waren damals schon die Ketten dort?
Antwort: Sie meinen die Schutzketten? Ich glaube, da waren schon welche. Aber nicht so lange, weil das … was weiß ich … weil jetzt alles anders gebaut ist.
Frage: Die Frau ging also hinüber zur Weberkirche?
Antwort: Die Frau ist über die Straße gegangen und wollte in die Stadtmitte, in Richtung Handelshof.
Frage: Der Handelshof ist aber doch ganz hinten. Was kommt denn da zunächst erst mal, wo die Straße hochläuft?
Antwort: Hinter der Weberkirche kommt erst das jetzige Fischgeschäft. Also früher war dort auch schon ein Fischgeschäft … Die wollte auf derselben Seite laufen. Aber bei der Weberkirche habe ich zugeschlagen.
Frage: Wo denn da bei der Weberkirche?
Antwort: Bei der Frau?
Frage: Die Frau war doch immer vor Ihnen gewesen. Sie sagten vorhin: etwa vier Meter.
Antwort: Bei der Weberkirche. Da habe ich sie eingeholt.
Frage: Haben Sie mit der Frau gesprochen? Das muss sie doch bemerkt haben?
Antwort: Nein. Sie hat sich vielleicht darauf konzentriert, den Bauchladen im Handelshof abzugeben.
Frage: Wie lief die Frau? Langsam oder schnell?
Antwort: So mittelmäßig. Nicht schnell und nicht langsam. So mittleres Tempo.
Frage: Sie konnten das Tempo mithalten?
Antwort: Ich konnte das Tempo mithalten. Damals habe ich noch nicht geraucht. Damals kriegte ich noch besser Luft beim Laufen.
Frage: Sie sind also der Frau nachgelaufen und kamen dann zur Weberkirche.
Antwort: Bei der Weberkirche kommt man wieder auf den Bürgersteig, den Fußweg, und wenn man über die Straße der Roten Armee läuft, da geht es zum Haupteingang hoch, also ich weiß nicht, wie das früher war. Links geht es zum Friedhof, so in den Garten rein bei der Weberkirche. Und wenn man so über die Straße der Roten Armee kommt und man will zur Weberkirche, da geht’s die Stufen hoch, und da ist der Haupteingang, und an dem Fußweg hier vorbei, da ist dann, wenn man schon ein Stück rum ist, da ist so eine kleine Tür … Da habe ich zugeschlagen. Da sind so Bäume in der Nähe, und es war finster, nicht so eine gute Straßenbeleuchtung wie heute, und das Wetter, das trübe Wetter, und es war finster.
Frage: Zeigen Sie bitte, wie Sie zugeschlagen haben.
Antwort: Ich habe mit links zugeschlagen, weil ich Linkshänder bin. Wenn ich Holz hacke – bloß mit links. Oder wenn ich einen Ball werfe. Mit links kann ich weiter werfen als mit rechts. Mit rechts bin ich ungeschickt. Da kann ich weiter werfen, und wenn ich Holz hacke, bin ich mit links kräftiger.
Frage: Versuchen Sie mal mit diesem Bleistift zu demonstrieren, wie Sie zugeschlagen haben.
Antwort: Nur mit der einen Hand. Nur mit der linken Hand.
Frage: Wo haben Sie die Frau getroffen?
Antwort: Auf den Kopf.
Frage: Wo genau auf dem Kopf?
Antwort: Hier oben so.
Frage: Sie zeigen auf den Hinterkopf. Oder war es die Wirbelgegend, etwa hier?
Antwort: Soviel ich erkennen konnte … Da waren so zusammengenähte Rüschchen, und darunter ein Streifen.
Frage: Sie haben also zugeschlagen. Und was ist dann geschehen?
Antwort: Die Frau ist gestürzt und dann liegen geblieben. Ich habe dann …
Frage: Hat die Frau noch was gesagt?
Antwort: Gar nicht. Sie konnte auch nichts mehr sagen.
Frage: Warum konnte sie nichts mehr sagen?
Antwort: Weil sie schon tot war.
Frage: Sie war schon tot? Woher wissen Sie das so genau?
Antwort: Sie bewegte sich nicht mehr.
Frage: Was hatte die Frau an?
Antwort: Sie hatte ein Kleid an. Oder einen Rock.
Frage: Ist Ihnen noch etwas von der Kleidung der Frau in Erinnerung?
Antwort: Die Frau ist auch etwas größer gewesen als ich. Ich bin ungefähr 1,63 oder 1,64 Meter. Die Frau ist etwas größer gewesen, und sie trug längeres Haar, so einfach frisiert.
Frage: Wie war denn die Gestalt der Frau?
Antwort: Die war etwas größer als ich. Sie war nicht übermäßig dick, aber gut gewachsen und kräftig.
Frage: An Details der Bekleidung können Sie sich nicht mehr erinnern.
Antwort: Da konnte ich nicht viel erkennen, weil es finster war und so duster.
Frage: Was hat denn die Frau alles mit sich geführt? Was hatte sie bei sich?
Antwort: Hauptsächlich den Bauchladen.
Frage: Was war denn in dem Bauchladen?
Antwort: Das weiß ich nicht, was da drin war. Vielleicht … ich weiß auch nicht, wo sie verkauft hat an dem Abend. Vielleicht musste sie noch mal ins Volkshaus gehen und das Geld hinschaffen und so. Nach dem Geld habe ich gar nicht geguckt. Ich habe mich gar nicht um die Frau gekümmert. Ich habe auch nichts gesucht bei ihr. Wegen Geld und so.
Frage: Wie lange haben Sie bei der Frau verweilt? Sie haben zugeschlagen, und dann?
Antwort: Ich habe zugeschlagen und hab mich nicht mehr um die Frau gekümmert. Ich bin dann rübergegangen, in die Innere Weberstraße, wo das Hospital ist. Jetzt ist dort das Feierabendheim »Rosa Luxemburg«. Und da bin ich quer rübergegangen, wo jetzt der Springbrunnen ist, bei den Bänken vorbei, und bin ein Stück durch den Park gelaufen und dann über die nächste Kreuzung, das heißt bei Fuhrmann Hentschel vorbei, nach der Äußeren Oybiner Straße bis zur Mandaubrücke. Dort habe ich das Eisen weggeworfen. Von der Brücke in die Mandau.
Frage: Auf welcher Seite denn?
Antwort: Ich glaube auf der linken Seite. Wenn man die Äußere Oybiner Straße auf die Brücke zugeht, da kommt dann die andere Straße, also es sind beide Straßen Einbahnstraßen … Auf der linken Seite.
Frage: Ist dort nicht so ein kleines Wehr?
Antwort: So ein kleines Wehr, wo das Wasser etwas stärker läuft.
Frage: Haben Sie zugeguckt, wie das Eisen ins Wasser flog, oder woher wissen Sie das so genau?
Antwort: Ich bin noch ein Stück gegangen, dass es ins Wasser runter fällt.
Frage: Warum haben Sie das Eisen denn ins Wasser geworfen?
Antwort: Dass es nicht mehr zu sehen ist.
Frage: Warum denn?
Antwort: Es sollte niemand sehen … Das war so ein rundes Eisen.
Frage: Warum sollte niemand das Eisen sehen?
Antwort: Ich wollte es verschwinden lassen, weil ich so etwas damit getan hatte.
Frage: Was haben Sie dann weiter gemacht?
Antwort: Dann bin ich nach Hause gegangen. Ich bin wieder die Äußere Oybiner Straße zurückgegangen, bei Fuhrmann Hentschel vorbei, über die Kreuzung, und dann ist gleich das Haus Innere Oybiner Straße 28. Das ist so ein großes Eckhaus. Da haben meine Eltern gewohnt, und ich habe damals auch bei meinen Eltern gewohnt. Mein Vater hatte damals eine Maßschneiderei. Ich bin dann durchs Haus gegangen. Meine Eltern waren im Schlafzimmer. Sie schliefen bereits. Ich brauchte bloß durch die Küche zu gehen. Neben der Küche hatte ich mein eigenes kleines Zimmer. Meine Eltern haben gar nicht gemerkt, wann ich nach Haus gekommen bin.
Frage: War das damals oft der Fall, dass Sie spät in der Nacht unterwegs waren?
Antwort: Ich bin öfter mal spät abends nach Hause gekommen.
Frage: Wo sind Sie da gewesen?
Antwort: Bei meiner Freundin. Wir haben uns 1948 bei der Tanzstunde kennengelernt.
Frage: Erzählen Sie bitte weiter.
Antwort: Ich bin nach Hause gekommen und musste mich erst waschen. Und meine Kleidung musste ich aufräumen, und dann bin ich nach und nach schlafen gegangen.
Frage: Was trugen Sie in dieser Nacht für Kleidung?
Antwort: Das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, ob ich jetzt lange Hosen oder Knickerbocker … Ich trug damals auch so eine Jacke mit Sattel. Das wurde damals getragen. Von zweierlei Stoff. Es war so heller Stoff, und oben so ein Sattel eingearbeitet.
Frage: War an der Kleidung Blut zurückgeblieben?
Antwort: Nein. Da war nichts zurückgeblieben.
Frage: Haben Sie sich an der Weberkirche über die Frau gebeugt?
Antwort: Nein. Ich habe mich nicht mehr nach der Frau umgesehen.
Frage: Nach dem Schlag sind Sie gleich weggelaufen?
Antwort: Ein bissel erschreckt bin ich schon. Aber ich habe mich dann nicht mehr um die Frau gekümmert. Ich bin dann über die Innere Weberstraße davongelaufen.
Frage: Nachdem Sie mit der Eisenstange zugeschlagen hatten, haben Sie sich die Frau angeschaut?
Antwort: Ich wollte bloß sehen, dass ich …
Frage: Was ist aus dem Bauchladen geworden?
Antwort: Der ist bei der Frau geblieben.
Frage: Wie lag die Frau? Wie ist sie gestürzt?
Antwort: Sie ist nach vorn gestürzt.
Frage: Erklären Sie das näher.
Antwort: Die Frau ist vor mir gegangen. Ich hatte in der linken Hand die Eisenstange. Und so habe ich sie geschlagen. Die Frau ist dann vornüber gestürzt.
Frage: Wie hat die Frau dann gelegen?
Antwort: Die hat also ein … an der Biegung an der Weberkirche hat sie gelegen. Nicht auf der Straße, sondern auf dem Fußweg, also auf dem Bürgersteig. An der Mauer an der Weberkirche.
Frage: Würden Sie die Stelle wiederfinden? Könnten Sie uns diese zeigen?
Antwort: Die könnte ich Ihnen zeigen.
Frage: Sie wissen ganz genau, wo das war?
Antwort: Hinter der Türe.
Frage: Wie hat die Frau gelegen?
Antwort: Mit dem Kopf auf die Mauer zu.
Frage: Und die Füße? In welche Richtung zeigten sie?
Antwort: So ungefähr auf die Kreuzung zu.
Frage: Und wie war die Lage der Arme?
Antwort: So an der Seite, oder beim Bauchladen. So. Ich habe ja bei der Frau nicht gewartet. Ich kann das nicht so genau sagen. Der Bauchladen ist kaputtgegangen durch den Aufprall, als sie gestürzt ist.
Frage: Wie oft haben Sie zugeschlagen?
Antwort: Zweimal. Beide Schläge auf den Kopf. Ich habe aber beide Male mit links geschlagen. Nur mit links.
Frage: Haben Sie irgendjemandem von dieser Geschichte erzählt?
Antwort: Habe niemandem etwas erzählt.
Frage: Haben Sie etwas im Kalender oder in einem Tagebuch vermerkt?
Antwort: Da habe ich auch nichts festgehalten. Ich habe mir nichts aufgeschrieben.
Frage: Es ist unwahrscheinlich, dass Sie sich so genau an alles erinnern können. Was hat Sie veranlasst, sich alles so genau zu merken?
Antwort: Mein Freund – vielleicht kennen Sie ihn auch –, der Herr Ferner, der hat mir mal die Geschichte erzählt … Wir sind darauf zu sprechen gekommen, als er mal zu Besuch bei mir war. Kollege Ferner arbeitet in der Verwaltung vom VEB Robur, in der Materialverbrauchs-Normung. Das war schon in der neuen Wohnung, also nach 1962. Mein Vater ist 1962 gestorben, ich konnte damals die große Wohnung nicht behalten. Bekam dann 1962 die Zwei-Zimmer-Wohnung in der Inneren Oybiner Straße, wo ich jetzt wohne. Da sind wir mal ins Gespräch gekommen. Ich weiß nicht, wodurch ich angeregt wurde, durch Zeitungen, Radio oder so. Wir kamen darauf zu sprechen, von der Frau, die an der Weberkirche damals erschlagen wurde. Da hat er mir erzählt, dass er den Mord entdeckt hat. Er ist später dort gewesen. Woher er gekommen ist, weiß ich nicht. Er wohnte damals auch schon in der Dr.-Friedrich-Straße. Aber sonst haben wir weiter nicht mehr davon gesprochen.
Frage: Hat die Frau geschrien, als Sie sie mit der Eisenstange schlugen?
Antwort: Hat nicht geschrien. Weil es schnell gegangen ist.
Frage: Sind Sie am nächsten Tag noch einmal dorthin gegangen? Haben Sie sich umgesehen, ob Sie eventuell etwas verloren hatten?
Antwort: Am nächsten Tag wurde von dem Mord bei uns in der Werkstatt erzählt. Mein Vater hatte eine Maßschneiderei und mehrere Gehilfen beschäftigt. Und da sind viele Leute, auch welche aus unserer Straße, dann zur Weberkirche gelaufen und haben sich das angesehen. Mittlerweile war aber der Tatort schon abgesperrt und die Frau mit einer Plane zugedeckt. Ich habe mir das nicht angesehen. Ich weiß es nur vom Erzählen her. Ich bin nicht hingegangen.
Frage: Herr Morche, wie kommt es, dass Sie heute, nach so vielen Jahren, zu uns gekommen sind und ein Geständnis abgelegt haben? Hat Sie jemand geschickt?
Antwort: Nein, es hat mich niemand geschickt.
Frage: Gab es einen Moment, einen Grund, der Sie veranlasst hat, hierherzukommen?
Antwort: Vielleicht trug dazu bei, weil ich mit nach der ČSSR fahren wollte. Aber da habe ich mir gesagt: Du musst erst mal das melden. Du musst erst mal fragen. Ich hätte das schon viel eher sagen sollen.
Frage: Mit wem wollten Sie in die Tschechoslowakei fahren?
Antwort: Mit Arbeitskollegen aus dem Betrieb. Es sollte auch in die alte Heimat gehen, nach Friedland und ins Isergebirge, nach Gablonz und Reichenberg. So hat es mir ein Kollege am Telefon gesagt. Und da ist gestern Vormittag ein Kollege bei mir gewesen und hat gesagt, ich sollte einen Tagesausweis im Kreispolizeiamt holen, das ist bis 18 Uhr geöffnet. Und er sagte auch, es sind viele Leute, da kannst du auch später gehen. Als ich zur Anmeldung kam, wo es die Formulare gibt, war schon geschlossen.
Frage: War das der Anlass, dass Sie zu uns gekommen sind? Haben Sie meine Frage verstanden?
Antwort: Ich hätte schon viel eher kommen sollen.
Frage: Und warum sind Sie nicht schon früher gekommen?
Antwort: Manchmal dachte ich, ich käme darüber hinweg. Aber da kam ich nicht drüber weg. Das kann man nicht einfach vergessen.
Frage: Sie haben bis 1952 eine sehr ansprechende Entwicklung genommen. Sie haben die Volksschule, Hauptschule, dann die Oberschule besucht, haben einen Beruf erlernt …
Antwort: Ich bin in Friedland zur Schule gegangen.
Frage: 1952 wurden Sie erstmals in die Nervenheilanstalt Großschweidnitz eingeliefert. Was war der Anlass dafür?
Antwort: Also, man kann sagen, 1952 bin ich das erste Mal hingekommen. Aber das war keine eigentliche Behandlung. Das war mehr zur Beobachtung. 1953 bin ich das erste Mal zur Behandlung hingekommen.
Frage: Was hat man denn 1952 bei Ihnen beobachtet?
Antwort: Das weiß ich nicht.
Frage: Wer hat Sie denn nach Großschweidnitz geschickt? Sind Sie von allein hingegangen?
Antwort: Nein. Herr Dr. Knoch-Weber hat mich überwiesen. Wegen meinem nervlichen Zustand. Erst bin ich depressiv gewesen, dann bin ich wieder lebhaft und unruhig gewesen. Das fing 1952 an.
Frage: Warum hat das 1952 angefangen? Gab es einen Grund?
Antwort: Vielleicht berufliche Anstrengungen. Es hat 1952 vor meiner Verlobung angefangen, da war ich beruflich überanstrengt. Da war ich niedergeschlagen. Vielleicht sollte ich mich nicht erst verloben …
Frage: Worauf ist die Nervengeschichte zurückzuführen?
Antwort: Vielleicht auch schon mit der ganzen Sache an der Weberkirche … Das hat schon etwas dazu beigetragen. Es steckte in mir, dass ich die Tat begangen habe.
Frage: Haben Sie schon früher so etwas gehabt?
Antwort: Nein.
Frage: Was haben Sie in Großschweidnitz dem Arzt erzählt? Er wird Sie doch sicher gefragt haben, was Sie für Sorgen haben, für Nöte. Wie es Ihnen geht. Und Sie werden ihm ja eine Antwort gegeben haben. Können Sie sich daran erinnern? An das Aufnahmegespräch.
Antwort: Wenn man in Großschweidnitz aufgenommen wird, dann wird man dem Arzt vorgestellt. Und der Arzt setzt sich mit der Frau in Verbindung, oder mit der Braut. Oder mit den Eltern setzt er sich auch in Verbindung. Der Arzt wird wahrscheinlich auch mit meinen Eltern gesprochen haben.
Frage: Hat er auch mit Ihnen gesprochen?
Antwort: Mit mir hat er auch gesprochen.
Frage: Was haben Sie denn da gesagt?
Antwort: Dem habe ich überhaupt nichts gesagt. Vielleicht habe ich es auf den Beruf geschoben, auch arbeitsmäßige Überlastung.
Frage: Sie sagten vorhin: Vielleicht hat es schon in mir gefressen. Warum haben Sie ihm das nicht gesagt?
Antwort: Über so etwas kann man nicht einfach sprechen. Da versucht man wieder drüber wegzukommen. Aber auf die Dauer ist das auch nichts Gutes.
Frage: Herr Morche, wissen Sie nach so vielen Jahren, wie die Frau heißt, wo sie gewohnt hat, was sie gemacht hat, ob sie Angehörige oder Kinder hatte?
Antwort: Welche Frau meinen Sie?
Frage: Die Frau, die Sie niedergeschlagen haben.
Antwort: Marianne Böhmer. Sie wohnte auf der Freudenhöhe gegenüber der Gaststätte. Früher war da die Fleischerei. Jetzt ist, glaube ich, ein Gemüseladen drin. Der Eingang zu diesem Haus ist von der Dresdner Straße. Unten, wenn man die Straße runtergeht … Ich weiß nicht, was da jetzt drin ist. Vor einiger Zeit ist der VEB Kohlehandel drin gewesen.
Frage: Wie kommen Sie auf diese Frau und diesen Namen?
Antwort: Die Frau hat auch einen Sohn. Der wohnt noch in diesem Haus.
Frage: Woher wissen Sie, dass sie Böhmer hieß?
Antwort: Es wurde damals doch viel davon gesprochen und erzählt.
Frage: Haben Sie die Frau schon früher gekannt?
Antwort: Nein, da habe ich sie nicht gekannt.
Frage: Es ist also für Sie eine fremde, unbekannte Frau gewesen?
Antwort: Eine ganz fremde Frau. Bloß später, wo das passiert war, erfuhr ich, dass sie auf der Freudenhöhe wohnte. Und der Junge war damals noch klein.
Frage: Wie alt war denn der Junge damals?
Antwort: Das weiß ich nicht. Jetzt ist er groß und erwachsen und arbeitet auch in der HO.
Frage: Von wem haben Sie denn erfahren, dass die Frau auf der Freudenhöhe wohnt und Böhmer heißt?
Antwort: Das wurde so erzählt auf der Neusalzaer Straße. Oder es wurde auch bei uns in der Werkstatt erzählt. Oder auf der Oybiner Straße. Und dann hat es auch in der Zeitung gestanden. Und das wurde erzählt und davon gesprochen.
Frage: Sie sagten vorhin, Sie wollten Ihren Cousin rächen. Das habe ich noch nicht so richtig begriffen, was der Tod Ihres Cousins mit der Frau zu tun hat. Sie haben eben gesagt, dass Sie die Frau nie zuvor gesehen und nicht gekannt haben.
Antwort: Ich habe die Frau nicht gekannt.
Frage: Warum haben Sie sich ausgerechnet an dieser Frau gerächt?
Antwort: Wie ich an dem Abend nach Hause gehe und ich bin am Volkshaus ran, kam die Frau. Und ich bin der Frau hinterhergegangen. Und da, bei der Weberkirche, wo es so finster ist, habe ich zugeschlagen.
Frage: Hätten Sie das auch getan, wenn es ein Mann gewesen wäre?
Antwort: Das kann ich nicht sagen.
Frage: Dass es aber eine Frau war, haben Sie erkannt?
Antwort: Ich habe gesehen, dass es eine Frau war. So mit den Rüschen, mit dem weißen Häubchen. Männer tragen auch Bauchläden, das gibt es auch. Aber eine Frau läuft anders. Die tritt nicht so schwer auf wie ein Mann. An dem Gehen ist das schon zu sehen, ob es ein Mann oder eine Frau ist.
Frage: Und warum wollten Sie sich wegen Ihres Cousins rächen?
Antwort: Mein Cousin ist im Krieg geblieben. Und damals, vier Jahre nach dem Krieg … Als ich es getan habe, es mag eigenartig sein, aber …
Frage: Was hatte die Frau mir Ihrem Cousin zu tun?
Antwort: Gar nichts zu tun.
Frage: Wie fühlen Sie sich? Sind Sie müde? Abgespannt?
Antwort: Etwas müde.
Frage: Aber Sie verstehen uns?
Antwort: Ich kann Sie gut verstehen.
Frage: Möchten Sie schlafen?
Antwort: Nein, ich möchte jetzt nicht schlafen.
Frage: Wenn wir jetzt sagen würden: Sie können jetzt schlafen gehen, würden Sie da gleich schlafen?
Antwort: Das kann ich nicht genau sagen, ob ich gleich einschlafen würde. Etwas müde bin ich. Aber ob ich sofort einschlafen würde, das kann ich nicht sagen.
Frage: Trinken Sie Alkohol?
Antwort: Ja, ich trinke, wenn wir mit der Musik unterwegs sind. Wir haben vorgestern Abend auch gespielt. Zur Urlauberbetreuung im Chemieheim in Olbersdorf. Wir sind Kollegen vom Betrieb. Wir sind Amateurmusiker. Da haben wir zur Urlauberbetreuung gespielt. Wenn wir unterwegs sind, da trinke ich auch manchmal ein paar Biere. Oder zu Hause trinke ich auch mal eine Flasche Bier. Oder Freitag und Sonnabend kaufe ich mir auch im Geschäft mal ein paar Flaschen Bier.
Frage: Was verdienen Sie im VEB Robur?
Antwort: Ungefähr 500 MDN brutto.
Frage: Beim Musikmachen verdienen Sie auch?
Antwort: Da verdiene ich auch etwas. Das kommt auf die Stunden an. Manchmal jeden Sonnabend, manchmal auch wochentags. Im Durchschnitt so 25 MDN pro Abend.
Frage: Sparen Sie das Geld?
Antwort: Manchmal kann ich mir etwas sparen. Manchmal brauche ich es für die Miete. Oder wenn ich mir halt etwas zum Anziehen kaufe. Oder zu essen.
Frage: Haben Sie überhaupt etwas gespart? Wo haben Sie das?
Antwort: Bei der Bank für Handwerk und Gewerbe.
Frage: Fühlen Sie sich gegenwärtig ruhiger als in den vergangenen Jahren und Tagen?
Antwort: Etwas.
Frage: Was bedrückt Sie denn noch?
Antwort: Die Ungewissheit, was mit mir werden soll.
Frage: Möchten Sie lieber nach Hause gehen?
Antwort: Ich kann nicht nach Hause gehen. Nicht ohne weiteres. Sie können mich hierbehalten.
Frage: Herr Morche, bedroht Sie jemand? Haben Sie vor irgendjemandem Angst?
Antwort: Nein, mich erpresst niemand. Mich bedroht auch niemand, und Angst habe ich auch nicht.«
Montag, 3. Juli
Der Staatsanwalt des Kreises Bautzen, Kroschk, stellt auf Anforderung der Ermittler die Akte in der »Mordsache Hölzel« dem Volkspolizeikreisamt Zittau zu. Dem Anschreiben ist zu entnehmen: zu Händen »Genossen Oberleutnant Strengeld«.
Donnerstag, 6. Juli
Das Kommissariat II der Kriminalpolizei in Görlitz quittiert den Eingang aller Unterlagen aus Zittau, die Bearbeitungsfrist für das Ermittlungsverfahren wird auf den 15. Juli 1967 festgelegt. Viel Zeit lässt man sich also nicht. Es wird, so heißt es auf der Quittung, wegen »dringendem Tatverdacht des Mordes« seit dem 1. Juli gegen den Transportarbeiter Morche ermittelt.
Dazu ordnet Oberleutnant der K Horstmann als amtierender Leiter der Abteilung K in Görlitz an:
»1. Ermittlung und Vernehmung von Zeugen
2. Vernehmung des Beschuldigten auf Tonband
3. Überprüfung des Gesundheitszustandes des Beschuldigten und Einholung gesundheitsmäßiger Gutachten
4. Beantragung eines Unterbringungsbefehls
5. Zusammenwirken und Übergabe des Ermittlungsverfahrens mit Kommissariat II organisieren.«
Montag, 10. Juli
Oberleutnant Strengeld sucht in Zittau das Haus Äußere Weberstraße 70 auf, in welchem Anni Hölzel bis zu ihrer Ermordung 1949 gewohnt hat. Unmittelbarer Anlass für diesen Ortstermin, den er gemeinsam mit Unterleutnant Kahlert von der Abteilung Schutzpolizei des VPKA wahrnimmt, ist die Selbstbezichtigung Morches, eine Marianne Böhmer erschlagen zu haben. Sie habe in dem Haus gegenüber der HO-Gaststätte Freudenhöhe über der Fleischerei gewohnt. Im Protokoll steht: »Weiterhin erklärte der Beschuldigte, dass die Marianne Böhmer einen Sohn hat, der jetzt noch in dem bezeichneten Hause wohnhaft sei.«
Strengeld und Kahlert notieren nach dem Ortstermin: »Wie einige seit 1945 in diesem Hausgrundstück wohnhafte Hausbewohner erklärten, hat in diesem Haus nach 1945 nie eine Marianne Böhmer gewohnt.«
Bei der Gelegenheit erkundigen sich die beiden Polizisten auch, was aus dem Sohn der tatsächlich ermordeten Verkäuferin, Wolfgang Hölzel, geworden sei. »Nach dem Ableben seiner Mutter«, so heißt es in der Aktennotiz, sei er verzogen, sein derzeitiger Aufenthaltsort sei den Hausbewohnern nicht bekannt.
Wie sich also zeigt, liegt bei dem offenkundig geistig verwirrten Morche eine namentliche Verwechslung vor. Es geschah damals tatsächlich ein Mord in Zittau, aber nicht, wie er meint, 1950, sondern bereits im Jahr zuvor. Und das Opfer hieß nicht Marianne Böhmer, sondern Anni Hölzel. Das Einzige, was stimmt, ist der Fundort der Leiche.
Was aber hat Karl Morche mit diesem Mordfall zu tun? Gibt es überhaupt eine Verbindung? Und war er damals noch klar im Kopf, also schuldfähig, als er vielleicht zum Mörder wurde?
Dienstag, 11. Juli
Oberleutnant der K Strengeld beantragt beim Staatsanwalt des Kreises Zittau die Anordnung der Durchsuchung der Wohn- und Nebenräume des Transportarbeiters Karl Morche in der Inneren Oybiner Straße 6.
»Es ist bekannt, dass der Beschuldigte schon mehrfach wegen manischer Depressionen in der Pflegeanstalt Großschweidnitz durch Ärzte eingewiesen worden war. Unbeschadet dessen ist zu befürchten, dass der Beschuldigte tatsächlich den Mord, dessen er sich selbst bezichtigt, begangen haben kann. Deshalb ist die Durchsuchung der Wohn- und Nebenräume des Beschuldigten zwingend notwendig und auch rechtlich begründet, um nach Beweismitteln (Handtasche der Ermordeten mit Inhalt u.a.m.) zu suchen.«
Am gleichen Tag geht ein von Hauptmann der K Niebel unterzeichnetes Schreiben von Görlitz an das Amt für Meteorologie in Dresden. Die Ermittler wollen wissen, »welche Witterungsverhältnisse im Stadtgebiet von Zittau herrschten,
a) am Freitag, dem 28. Juli 1950, in der Zeit von 00.40 bis 01.30 Uhr
b) am Sonntag, dem 05. Juni 1949, in der Zeit von 00.40 bis 01.30 Uhr.
Bei den erbetenen meteorologischen Angaben interessieren u.a. insbesondere Temperatur, Windrichtung und -stärke, Bewölkungsart und -dichte, Sichtverhältnisse, Niederschlag (Dauer, Art und Menge), Mondaufgangs- und -untergangszeit, Mondphase.«
Drei Tage später kommt die Antwort: Am 5. Juni 1949 war es in der fraglichen Zeit mit elf Grad vergleichsweise frisch und der Himmel leicht bewölkt. Der Mond befand sich im ersten Viertel. Es war trocken, der letzte Regen am Tag zuvor am Morgen gefallen.
Am 28. Juli 1950 maß man in Zittau ebenfalls nur elf Grad, es war windstill und wolkenlos, ein Tag vor Vollmond und also hell. Geregnet hatte es letztmalig am Nachmittag des Vortages.
Dienstag, 18. Juli
Die Kriminalpolizei durchsucht Morches Wohnung. Dabei werden unter anderem eine schwarze Damenlederhandtasche, ein Taschenspiegel und ein leeres Parfümfläschchen beschlagnahmt.
Das »Durchsuchungs- und Beschlagnahmeprotokoll«, unterzeichnet von Staatsanwalt Pollack, Oberleutnant der K Strengeld und Leutnant der K Täsche umfasst elf Positionen, darunter sechzehn »Zettel mit unverständlichen Aufzeichnungen«.
Die Kriminalisten vermuten, dass es sich bei der Tasche, dem Spiegel und dem Flakon um persönliche Gegenstände der Ermordeten handeln könnte. Sie legen später diese Handtasche und drei weitere Taschen verschiedenen Zeugen vor.
Donnerstag, 20. Juli
Hauptmann der K Niebel bittet schriftlich bei der Deutschen Post in Dresden (Fernmeldeamt/Fernsprechbuchstelle) um die leihweise Überlassung Zittauer Telefonbücher. Sie ermittelten in einer Raubmordsache, schreibt er. »Die Ermordete hatte damals vor dem Verbrechen von ihrer Arbeitsstelle ein Ferngespräch (Stadtgespräch) geführt. Bei den jetzt notwendig werdenden Überprüfungen wird ein Fernsprechverzeichnis der Stadt Zittau aus dem Jahre 1950 und ein solches aus dem Jahre 1952 benötigt.«
Was man sich davon verspricht, wissen allein die Kriminalisten.
Am 17. August gehen die Bücher in Görlitz ein.
Mittwoch, 26. Juli
Gegen die Hausdurchsuchung und die Beschlagnahme führt Karl Morche Beschwerde, insbesondere protestiert er gegen die Konfiszierung der Handtasche, die für ihn ein Andenken an seine verstorbene Mutter sei.
Oberleutnant Strengeld reagiert nach einer telefonischen Information durch die Kreisstaatsanwaltschaft Zittau mit einem Schreiben an Staatsanwalt Pollack. Er beantragt, den Einspruch abzuweisen. Als Untersuchungsorgan habe die Kriminalpolizei »zu prüfen, ob der Beschuldigte oder eine andere Person Täter ist. Der ermordeten HO-Verkäuferin Hölzel hat damals, am 28. Juli 1950, der Täter eine schwarze lederne Handtasche offenbar geraubt. Leider ist im Rahmen der damaligen Aufklärungsarbeit die Handtasche der Ermordeten so mangelhaft beschrieben worden, dass jetzt von vornherein nicht festgestellt werden kann, ob die in der Wohnung des Beschuldigten gefundene und beschlagnahmte Damenhandtasche die der Ermordeten ist oder nicht. Das ist jetzt zu überprüfen. Hierzu sollen mehrere schwarze lederne Damenhandtaschen sowohl Personen aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis sowie ehemaligen Kolleginnen der Ermordeten als auch Verwandten des Beschuldigten vorgelegt werden.«
Um 15.30 Uhr sendet die Görlitzer Kriminalpolizei ein Fernschreiben an die Kollegen im VPKA Glauchau. Man erbittet dort die Anschrift und Personalien des Ofensetzmeisters Erich Thieme, der 1950 in Glauchau wohnhaft gewesen sein soll. »Hatte intime Beziehungen zu der HO-Verkäuferin Anni Hölzel«, heißt es da. »Diese wurde in Zittau am 28.07.1950 Opfer eines ungeklärten Tötungsverbrechens. Aktenmaterial weist nicht aus, dass Th. damals überprüft wurde (Alibi).«
Das Fernschreiben endet mit der Weisung, Thieme »nicht befragen«. Die Antwort erbitten die Görlitzer bis zum 28. Juli.
Wodurch man auf Thieme aufmerksam wurde und ihn offenkundig für eine heiße Spur hält, geht aus den Unterlagen nicht hervor. Auch nicht, ob er überhaupt jemals vernommen wird.
Einen Tag vor Ablauf der Frist rattert 7.15 Uhr der Fernschreiber. Thieme wohnt in Glauchau, Platz der Freundschaft 4, meldet der Oberleutnant der K Schumann.
Montag, 31. Juli
Morgens um 8.30 Uhr wird der Flussmeister Martin Lange von Oberleutnant der K Strengeld befragt. Die Ermittler wollen wissen, ob die – vermeintliche oder tatsächliche – Tatwaffe, jene von Morche genannte Eisenstange, eventuell in dem etwa vierzig Kilometer langen Flüsschen namens Mandau gefunden worden ist. Martin Lange war im Sommer 1958 als Tiefbauarbeiter des VEB Gewässerunterhaltung und Meliorationsbau Dresden an Arbeiten am Flussbett der Mandau in Zittau beteiligt.
Im Frühjahr jenes Jahres gab es ein starkes Hochwasser, welches erheblichen Schaden im Flussbett angerichtet hatte. »So war u.a. das Wehr unter der Brücke der nach Olbersdorf führenden Straße am Einlauf Pfortmühlgraben stark beschädigt. Der Pfortmühlgraben war mit Sand zugeschwemmt worden. Dadurch hatten Textilbetriebe wie die Firma Könitzer kein Brauchwasser. Es musste der Pfortmühlgraben geräumt und das beschädigte Wehr instand gesetzt werden. Oberhalb und unterhalb des Wehres erfolgte eine grundhafte Beräumung des Mandauflussbettes.«
Geräumt wurden dreißig Meter flussauf- und fünfzig Meter flussabwärts von der Brücke. Der »Aushub« sei nach Hartau auf eine Kippe gefahren worden. Es habe sich um Müll und Schrott gehandelt.
Ob darunter auch eine Eisenstange gewesen sei, kann Flussmeister Martin Lange allerdings nicht sagen.
Samstag, 5. August
Der 3. Strafsenat des Bezirksgerichts beschließt, dass Morches Beschwerde wegen der Durchsuchung seiner Wohnung und der Beschlagnahme von Gegenständen als unbegründet zurückgewiesen wird. Gegen ihn werde schließlich wegen des Verdachtes, einen Raubmord verübt zu haben, ermittelt. In der Begründung der Entscheidung heißt es weiter:
»Der Beschuldigte hat sich selbst der Kriminalpolizei gestellt und angegeben, dass er die in der Nacht vom 27. zum 28. Juli 1950 ums Leben gekommene Bürgerin Hölzel mit einer Eisenstange erschlagen habe. Der Mord an dieser Frau ist bisher nicht geklärt. Da der Beschuldigte sich selbst der Tat bezichtigt, und einige Angaben von ihm nicht ausschließen, dass er der Täter sein kann, besteht gegen ihn dringender Tatverdacht. Die in seiner Wohnung beschlagnahmten Gegenstände sind zum Zwecke des Beweises erheblich, insbesondere die Handtasche.«
Dienstag, 8. August
Am Vormittag, von Oberleutnant der K Strengeld befragt, macht der Klempner Wilhelm Schrumpf – seit zwanzig Jahren im Karosseriewerk Gustav Winter beschäftigt und seitdem dort auch Betriebsgewerkschaftsleiter (BGL) – eine Zeugenaussage. Die Ermittler wollen von ihm vor Ort wissen, ob der Täter, wie behauptet, in der Äußeren Weberstraße 1950 ein Rundeisen gefunden haben könnte.
Entrüstet weist Schrumpf die Frage zurück: »Seinerzeit herrschten hier im Betrieb die gleiche Ordnung und Sauberkeit, wie sie auch heute herrschen.«
Er schließt völlig aus, dass irgendwelches Material auf dem Bürgersteig vor dem Betriebsgrundstück herumgelegen haben könnte. Und selbst wenn etwas auf dem Betriebsgelände gelegen haben sollte: »Das Zauntor ist nach Arbeitsschluss auch damals immer verschlossen worden.«
Mithin, Morches Aussage, er habe vor dem Karosseriewerk eine Eisenstange gefunden, mit der er später Anni Hölzel (bzw. Marianne Böhmer) erschlagen haben will und die er anschließend in die Mandau warf, scheint reine Fantasie.
Freitag, 18. August
Die Kriminalisten in Görlitz bringen in Erfahrung, dass Wolfgang Hölzel, der Sohn der Ermordeten, am 28. Dezember 1955 »illegal nach Westdeutschland verzog«.
Eine Marianne Böhmer wird in den Einwohnerregistern ebenfalls gefunden. Allerdings ist diese 1943 geboren, war also im Jahr 1950, als Morche sie niedergeschlagen haben will, gerade erst sieben Jahre alt. Damit kommt sie als »Opfer« nicht infrage. Morche sprach schließlich stets von einer Frau.
Ferner ermittelt man einen Oswald Burckhardt, einen Gärtner und Landwirt, der angeblich mit Anni Hölzel liiert gewesen sein soll, oder, wie es im Protokoll von Leutnant Kummer, der bei der Kriminalpolizei in Görlitz Dienst tut, heißt, »ein intimes Verhältnis mit der Ermordeten vor deren Ableben unterhalten hat«. Natürlich, danach war dies schlechterdings nicht möglich.
Auch die Adresse von Morches Cousine Rosl Hübner ist ermittelt – die 55-Jährige lebt in Zittau in der Willi-Gall-Straße 13.
In den Meldekarteien der Abteilung Pass- und Meldewesen, kurz P/M, der Deutschen Volkspolizei findet man auch die Adressen ehemaliger Arbeitskollegen von Morche und Hölzel, die man ebenfalls befragen wird.
Dienstag, 22. August
Oberleutnant der K Wenderlich – zu Beginn der sechziger Jahre Leiter der Abteilung Kriminalpolizei im VPKA Zittau – gibt in der Sache Morche zu Protokoll: Er erinnere sich, dass »im Jahre 1962 oder 1963, ein genauerer Zeitpunkt kann nicht mehr angeführt werden«, Karl Morche bei ihm vorstellig wurde und sich als Mitarbeiter beworben hat. Als Begründung »brachte er vor, dass er einen Diebstahl von MDN 50,00 im VEB Robur Zittau, Arbeitsstelle des Morche, und den Mord an der Weberkirche in Zittau aufklären wollte«.
Um die Ernsthaftigkeit seiner Bewerbung zu unterstreichen, legte ihm Morche einen »Aufklärungsplan« vor. »Es handelte sich dabei um einen weißen Bogen im Format DIN A1, auf den verschiedene aus illustrierten Zeitungen ausgeschnittene Bilder geklebt waren, welche mit verschiedenfarbigen Strichen untereinander wahllos verbunden waren.«
Karl Morche habe damals allerdings nicht erklärt, was er jetzt behauptet – nämlich, dass er der Mörder jener Frau gewesen sei.
Für ihn, Oberleutnant Wenderlich, steht außer Frage, »dass es sich bei Morche um einen nervenkranken Menschen handelte«. Kurz nach der Vorsprache in der Kriminalpolizei Zittau sei er auch in die Psychiatrische Klinik Großschweidnitz eingeliefert worden.
Dienstag, 29. August
Oberleutnant der K Strengeld sucht im VEB Robur die Transportbrigade Prasse auf. Sie arbeitet in der Eisenbahnstraße. In dieses Kollektiv ist Karl Morche seit sieben Jahren eingebunden. An der im Protokoll als »Aussprache« bezeichneten Zusammenkunft nehmen der Meister Erich Adam, der Brigadier Heinz Prasse sowie die Transportarbeiter Werner Wehle, Günter Jonas und Manfred Haußig teil.
»Die Kollegen sind sich darüber einig, dass Morche niemals fähig sei, einem Menschen etwas zuleide zu tun, schon gar nicht fähig, einen Menschen umzubringen.« Nicht minder apodiktisch erklären sie aber dem Oberleutnant auch, dass ihr Kollege »nicht normal, sondern verrückt im Kopf sei«.
Jedes Jahr im Frühsommer, 1966 ausgenommen, hätten sie bei ihm einen »Krankheitsschub« beobachtet, danach sei er durchschnittlich ein Vierteljahr in der Heilanstalt in Großschweidnitz gewesen.
Wie sich ein solcher Anfall bemerkbar gemacht habe, will der Ermittler wissen.
Indem »Kollege Morche stundenlang in die Sonne stierte und dabei die Körperlast auf ein Bein legt und dabei das andere Bein entlastet, wie bei der militärischen Rührt-euch-Stellung. Dann angesprochen sieht er seinem Gegenüber stier in die Augen und braucht lange Minuten, um auf gestellte Fragen zu antworten. Ihm übertragene Aufträge werden erst nach minutenlangem Überlegen langsam ausgeführt.
In solchen Fällen sorgten in der Vergangenheit die Kollegen dafür, dass er wieder in fachärztliche Betreuung nach Großschweidnitz kam.«
Strengeld urteilt: »Von der Brigade habe ich die besten Eindrücke. Ich zweifle nicht daran, wenn mir versichert wurde, dass man sich die erdenklichste Mühe gegeben hat. Morche ist niemals wegen seines Leidens gehänselt oder gekränkt worden. Die Brigademitglieder schätzen Kollegen Morche als guten und verlässlichen Mitarbeiter. Man hat es wegen seiner Krankheit weitgehend vermieden, ihn zu körperlich schweren Arbeiten heranzuziehen, schon um eventuelle Unfallgefahren zu vermeiden. In seiner Freizeit hat Kollege Morche in einer Laienkapelle als Pianist mitgewirkt, und die Kollegen sagen, dass er sehr intelligent ist und alles aus dem Kopf spielte, auch klassische Musik.«
Morches Leumund ist positiv. Und darum habe seine Teilnahme am Busausflug in die Tschechoslowakei am 2. Juli nie zur Disposition gestanden. Werner Wehle habe Morche kurz zuvor noch angerufen, da Morche im Juni im Lager eingesetzt gewesen ist und nicht in der Brigade arbeitete. Wehle hatte ihm die Route genannt, es sollte in Morches frühere Heimat und auch in seinen Geburtsort Friedland gehen, auch nach Haindorf, wo Morches Großeltern auf dem Friedhof liegen. Darauf habe er erklärt, dass er am Freitag, dem 30. Juni, sich den Tagespassierschein im VPKA abholen werde. Als Morche am Sonntagmorgen nicht zur Abfahrt des Busses erschien, habe man angenommen, dass er verschlafen hat, wollte aber nicht warten. Erst in der Woche darauf erfuhr die Brigade, dass Morche wieder in Großschweidnitz ist.
»Die Kollegen meinen«, so schreibt Strengeld, dass die bevorstehende Reise »ihn seelisch so aufgewühlt haben könnte, dass bei ihm neuerlich ein Schub seiner Geisteskrankheit einsetzte«.
Offenkundig gaben sie sich eine Mitschuld.
Inwieweit der Hinweis der Transportarbeiter zutraf, dass auch Morches Mutter »irgendwie geisteskrank gewesen« und ihr Kollege vielleicht erblich belastet sei, vermag der Oberleutnant nicht zu beurteilen.
Das Kommissariat Görlitz beantragt bei der Staatsanwaltschaft Zittau eine Verlängerung der Bearbeitungsfrist bis zum 1. Oktober.
Zur Begründung wird Morches Beschwerde wegen der beschlagnahmten Handtasche angeführt. Deshalb habe der »Vorgang sehr lange beim Bezirksgericht bzw. der Bezirksstaatsanwaltschaft in Dresden« gelegen, das heißt die Unterlagen, »so dass während dieser Zeit die im Untersuchungsplan vorgesehenen Ermittlungs- und Untersuchungshandlungen nicht weiter fortgeführt werden konnten«.
Zudem müsse »erst geprüft werden, inwieweit der Beschuldigte wieder vernehmungsfähig ist«. Dieser befindet sich noch immer »aufgrund eines richterlichen Unterbringungsbefehles in der Pflegeanstalt Großschweidnitz«.
Zwei Wochen später, am Donnerstag, dem 14. September 1967, bittet Görlitz erneut um eine Fristverlängerung, diesmal bei der Bezirksstaatsanwaltschaft in Dresden. Zwar hege man unverändert Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit Morches, dennoch müsse »ernsthaft und unvoreingenommen« geprüft werden, »ob er das Verbrechen nicht etwa doch begangen hat oder anderweitig in strafrechtlicher Beziehung zu diesem Verbrechen steht«.
Hauptmann der K Niebel erklärt in seinem Anschreiben, dass man bei den Ermittlungen schon gut vorangekommen wäre, doch es sei noch eine Zeugin zu vernehmen, »die damals vor der Tat mit der Geschädigten (womit das Mordopfer Hölzel gemeint ist – E. Sch.) Dienst versah und damals offenbar nicht vernommen worden ist. Die Zeugin befindet sich z. Zt. zu einem Ferienaufenthalt in Bulgarien.
Des Weiteren soll die geschiedene Ehefrau des Beschuldigten nochmals vernommen werden.«
Dienstag, 12. September
Rosl Hübner, Morches Cousine, als Weberin im VEB Textilkombinat Zittau beschäftigt, wird von Oberleutnant Strengeld am Nachmittag befragt. Das Gespräch im VPKA dauert fünfzig Minuten. Rosl Hübners Mutter ist die Schwester von Morches Vater.
Man zeigt ihr die vier schwarzen Damenhandtaschen, von denen sie keine kennt. Auf Strengelds Frage, woher sie wisse, dass ihr Cousin wieder einmal in Großschweidnitz sei, antwortet sie: von Josef Ferner, dem Leiter der Kapelle, in der ihr Cousin als Pianist spiele. Herr Ferner habe sie am 3. September daheim besucht. Morches Kollege kümmere sich ein wenig um ihren Cousin, der »sehr zurückgezogen« lebe, seit er geschieden ist. Er habe ihr gesagt, »dass mein Cousin wieder fortgekommen ist in die Nervenheilanstalt. In diesem Zusammenhang sagte Herr Ferner auch, dass mein Cousin sich bezichtigt hätte, 1950 einen Mord hier in Zittau an der Weberkirche begangen zu haben«.
Sie selber habe von diesem Verbrechen überhaupt keine Kenntnis, weil sie von 1949 bis 1951 in Westdeutschland gelebt hätte.
Ob Morche noch weitere Verwandte in der DDR habe, erkundigt sich der Oberleutnant. Sie sei die einzige, sagt Rosl Hübner, seit Karl Morches Eltern auf dem Friedhof liegen. In Freiburg im Breisgau lebe nach ihrer Kenntnis ein Bruder, Josef Morche.
Zur geschiedenen Frau ihres Cousins habe sie »keinerlei Verbindung«.
Damit ist die Befragung zu Ende.
Knapp zwei Stunden später, genauer gesagt um 17.10 Uhr, sitzt auf dem gleichen Stuhl der LPG-Bauer Oswald Burckhardt aus Hörnitz. Strengeld befragt ihn zu Anni Hölzel. Damals habe er eine Gärtnerei besessen, berichtet er, und er sei Witwer gewesen. Frau Hölzel habe sich »von Zeit zu Zeit«, so alle zwei oder drei Wochen, Gemüse bei ihm geholt.
Als Erstes werden auch ihm die vier Handtaschen gezeigt. Er kennt davon keine, den Spiegel und das Parfümfläschchen hat er auch nie zuvor gesehen.
Wie sich zeigt, ist das Burckhardt nachgesagte »intime Verhältnis« zu der Ermordeten offenkundig nur ein Gerücht. Er weiß weder, in welcher HO-Verkaufsstelle sie tätig war, noch wie ihr Sohn mit Vornamen hieß. Und mit einem »Bauchladen« hat er sie auch nie gesehen.
Der Ermittler Strengeld fragt nach Erich Thieme und Karl Morche. »Diese Namen habe ich noch niemals gehört«, sagt der Landwirt, auch Frau Hölzel habe sie ihm gegenüber nie erwähnt.
Der Kriminalist bittet ihn um eine Charakterisierung Anni Hölzels. Burckhardt bezeichnet sie als eine »recht ordentliche und anständige Frau«. Was darunter konkret zu verstehen ist, sagt er nicht. Das aber ist für den Fall Morche ohnehin unerheblich.
Gleichwohl signalisieren Strengelds Fragen, dass es ihm auch um die Lösung des damals ungeklärten Mordfalls geht.
»Sie war sehr beredt, d.h. sie konnte mit dem Mundwerk gut fort, war aber immer nett und freundlich.« Ob sie Feinde gehabt hätte? Davon wisse er nichts, sagt Burckhardt, sie habe dergleichen ihm gegenüber nie verlauten lassen.
Am Ende des Protokolls heißt es: »Ich lese meine Vernehmung nicht durch, weil ich infolge meines schlechten Sehvermögens damit nicht zurechtkomme.«
Nachdem ihm alles vorgelesen wird, signiert er mit blauem Kugelschreiber jedes der drei Blätter.
Um 18.10 Uhr verlässt Burckhardt gemeinsam mit seiner Frau das Volkspolizeikreisamt Zittau.
Die kürzeste Befragung an jenem Tag findet von 15.40 Uhr bis 16.15 Uhr statt. Strengeld vernimmt Annliese Fischer, die 1950 als Anneliese Koschnick in der HO-Gaststätte Dreiländereck als Verkäuferin tätig war. Jetzt arbeitet sie bei der Firma Könitzer & Haebler als Weberin.
Nach siebzehn Jahren kann sie sich kaum noch an Personen und Vorgänge erinnern, ihre damalige Kollegin Hölzel habe sie »nicht näher« gekannt. Anni Hölzel habe damals am Kuchenbüffet gearbeitet, sie selbst habe am Stand daneben Süßigkeiten verkauft. Sie hätten alle Schicht gearbeitet, immer wenn sie frei hatte, hätte ihre Kollegin hinterm Tresen gestanden, weshalb man sich nur kurz gesehen und gesprochen habe. Nur an jenem Tage arbeiteten sie gemeinsam, weil Anni Hölzel den Dienst einer Kollegin übernommen hatte. Den Grund könne sie nicht mehr sagen. Die Schicht sei von 16 bis 24 Uhr gegangen. Das wisse sie deshalb so genau, weil sie »damals noch in der Nacht von der Kriminalpolizei in meiner Wohnung vernommen« wurde.
Zum »Bauchladen«, den Morche erwähnte, sagt Anneliese Fischer, dass keine Kollegin aus dem »Dreiländereck« jemals als Straßenverkäuferin eingesetzt worden ist. Auch Anni Hölzel nicht.
Donnerstag, 14. September
Kriminalmeister Steppan und Oberleutnant Strengeld protokollieren ihre Ermittlungsergebnisse »bezüglich der am Freitag, dem 18. Juli 1950, zwischen 00.40 und 01.30 Uhr in Zittau, Innere Weberstraße, auf dem Bürgersteig an der Südseite der Weberkirche herrschenden Lichtverhältnisse«.
Darin fließen die Auskünfte der Meteorologen ein und jene von Johannes Korditzke und Fritz Klemm, Mitarbeiter des VEB Energieversorgung Dresden, Meisterbereich Zittau. Diese klärten die Ermittler auf, dass »keinerlei Pläne aus dem Jahr 1950 mehr vorhanden seien«, aber sie waren sich ziemlich sicher, dass schon damals die Beleuchtung am Tatort so war, wie sie heute noch immer ist: »Es sind über der Fahrbahn an Überspannungen aufgehangene Lampen, die aber damals mit anderen Glühbirnen (es sollen jeweils zwei Glühbirnen gewesen sein) bestückt waren. Welche Leistungen die damals, 1950, in den fraglichen Straßenlampen am Auffindort der Ermordeten und dessen Umgebung befindlichen Glühbirnen hatten, konnte nicht mehr angegeben werden, weil auch darüber keine Aufzeichnungen vorhanden sind.
Mehr konnte nicht in Erfahrung gebracht werden, auch nicht, ob in der fraglichen Zeit alle diese Straßenlampen brannten.«
Zwei Tage später überprüft Oberleutnant Strengeld bei einem Ortstermin die Angaben der beiden. »Der Abstand der Straßenlampen in der Inneren Weberstraße hinunter in Richtung Weberkirche beträgt von Lampe zu Lampe ca. 35 Meter. Die Entfernung von der letzten Straßenlampe im untersten Teil der Inneren Weberstraße bis zum Auffindort des Opfers beträgt ca. 15 Meter. Die Entfernung vom Auffindort des Opfers bis zu der über der Straßenkreuzung hängenden Straßenlampe beträgt ca. 20 Meter.«
Resigniert schließt er: »Heute kann nicht mehr ermittelt werden, welche Leistung (Lichtstärke) seinerzeit diese Straßenlampen hatten.«
Dienstag, 19. September
Zwischen 15.10 Uhr und 17.20 Uhr vernimmt Oberleutnant Strengeld Josef Ferner. Ferner, Jahrgang 1920, arbeitet als Sachbearbeiter beim VEB Robur und spielt mit Morche in einer Band. Er kennt diesen seit 1959 und schildert ihn als »ruhig, bescheiden, hilfsbereit und gutmütig«. Er habe allerdings auch den Eindruck, dass Morche »Minderwertigkeitskomplexe« hat.
Natürlich hätten sie im Betrieb von seiner Krankheit gewusst. Diese sei immer schubweise aufgetreten, vornehmlich im Juni. Wenn der Monat ohne Anfall vorübergegangen war, sei man überzeugt gewesen, dass der Rest des Jahres gut verlaufen würde.
»Auch deshalb warteten wir immer auf den Geburtstag unseres Staatsratsvorsitzenden, Walter Ulbricht, also auf den 30. Juni, weil dieser Tag neben seiner genannten Bedeutung für uns bezüglich Morche immer so eine Art Erinnerungsmarke war.«
Als Symptome nannte Ferner »gläsern wirkende Augen und sehr schweißige Hände«. Karl Morche bemerkte dies selbst und wurde daraufhin immer unruhiger und unsicherer. Er habe dann auch bald »wirres Zeug« geredet.
Dazu gehörte beispielsweise, dass er sich als »berufen« erklärte, Unrecht, das andere Menschen begangen hatten, »wieder in Ordnung zu bringen. So wollte er die Welt bessern und verändern.« Er habe einmal einen Diebstahl im Betrieb aufklären wollen. Einer Kollegin waren fünfzig Mark gestohlen worden, was Morche für ein Drama hielt.
»Mir ist auch bekannt, dass er sich einmal bei der Kriminalpolizei beworben hat«, gibt Ferner zu Protokoll. Allerdings habe Morche selbst im Wahn nie etwas von einem Mord an der Weberkirche erzählt.
Der Tod des Vaters während der Osterzeit 1962 habe Morche völlig aus der Bahn geworfen. Er habe in der elterlichen Wohnung, in der er seit der Scheidung wieder lebte, damals unter Alkoholeinfluss ziemlich randaliert. Als Leiter der Laienkapelle würde er aber immer darauf achten, dass sich Morche während ihrer Auftritte nicht betrinke.
Das sei kein Problem, Morche lasse sich von ihm »leicht führen«, zitiert Strengeld Josef Ferner im Protokoll. »Morche ist höchst unselbständig und bedarf der Führung, insbesondere dann, wenn seine Krankheit ausbricht«. Er, Ferner, habe sich seiner angenommen, »weil er mir leidgetan hat, und er hat sich auch von mir immer beraten und führen lassen. Er hat Vertrauen zu mir.«
Als bei der Befragung das Gespräch auf den Mord an Anni Hölzel kommt, erklärte Josef Ferner, dass er sich noch an die »große Aufregung« erinnere, die damals in Zittau geherrscht habe, als die Tat publik wurde. Er könne sich deshalb noch an das Datum 28. Juli 1950 genau erinnern, weil sie damals auf dem Kulturfest der IG Metall im Volkshaus gespielt hätten.
Zu jener Zeit habe er Morche noch nicht gekannt. Und später habe dieser auch nie über den Mordfall mit ihm gesprochen. Für ihn käme Morche schon deshalb als Mörder nicht infrage, weil die Tat Ende Juli erfolgt sei, also nach dem Juni, wo die Krankheitsschübe in der Regel immer auftraten. »Ich halte Karl Morche für unfähig, einen solchen Mord zu begehen.« Darum sei er von der Information »völlig überrascht und direkt sprachlos« gewesen, dass Morche sich selbst bezichtigt habe, die HO-Verkäuferin Hölzel erschlagen zu haben.
Josef Ferner macht dem Kriminalisten klar, warum Morche ausgerechnet an jenem 30. Juni ins VPKA gegangen war, um sich selbst anzuzeigen. Das weiß dieser aber bereits von Morches Arbeitskollegen.
Im Unterschied zu früheren Unternehmungen, bei denen einer aus dem Arbeitskollektiv sich um Vorbereitung und Unterlagen für den Brigadeausflug gekümmert hatte, musste sich diesmal jeder selbst einen Tagespassierschein für die Tschechoslowakei besorgen. »Er ist ein Phlegmatiker und hat das immer aufgeschoben. Bis zum Donnerstag, dem 29. Juni, hatte er sich noch nicht um den Passierschein bemüht. Deshalb habe ich ihn scharf gemacht.« Am Abend hätten sie gemeinsam gespielt, und Ferner habe ihm gesagt, dass er anderentags – also am Freitag – unbedingt zur Polizei gehen müsse, um das Papier abzuholen. Das wäre die letzte Gelegenheit, ansonsten könne er nicht mitfahren.
»Das hat er mir auch versprochen«, zitiert das Protokoll Josef Ferner. Er habe am Freitag auch von Kollegen aus Morches Brigade gehört, dass diese im gleichen Sinne Morche bedrängt hatten. Der Brigadier Manfred Haußig will dabei Veränderungen bei Morche beobachtet haben. Er hätte zum Beispiel jedes Wort wiederholt, das Haußig ihm gesagt habe, was doch ungewöhnlich gewesen sei.
Morche ging also, wie aufgefordert, gegen 18 Uhr zum Volkspolizeikreisamt – aber nicht, um einen Tagespassierschein für den Brigadeausflug am Sonntag zu beantragen, sondern um sich selbst anzuzeigen.
Vor drei Tagen, so schließt Josef Ferner seine Aussage, habe er in Großschweidnitz Morche besuchen wollen. Obgleich er sich zuvor telefonisch erkundigt hatte und ihm gesagt worden war, dass einem Besuch nichts entgegenstünde, musste er zurückkehren, ohne Morche gesehen zu haben. Dessen Gesundheitszustand, so der Arzt, habe sich »überraschend« verschlechtert.
Donnerstag, 21. September
Von 8.40 Uhr bis 11.30 Uhr wird die Zeugin Ursula Morche, geborene Tzscherlich, von Oberleutnant der K Strengeld neuerlich vernommen. Wie schon bei ihrer ersten Befragung am 1. Juli durch Oberleutnant Horstmann wird sie zuvor belehrt, welche strafprozessualen Folgen Falschaussagen nach sich ziehen können.
»Frage: Haben Sie die vier schwarzen Lederhandtaschen oder eine davon irgendwo schon einmal gesehen? Kommt Ihnen eine der Ihnen vorgelegten Handtaschen irgendwie bekannt vor?
Antwort: Ich habe die mir vorgelegten vier Handtaschen genau angesehen. Keine davon habe ich jemals gesehen, keine kommt mir bekannt vor.
Frage: Kennen Sie die Gaststätte Freudenhöhe in der Neusalzaer Straße?
Antwort: Ja, diese Gaststätte kenne ich. Sie befindet sich unweit von meinem Elternhaus, in dem ich wohnhaft bin. Das ist die Neusalzaer Straße 13, wo ich geboren und aufgewachsen bin.
Frage: Kennen Sie das Eckhaus Äußere Weberstraße 70, welches sich gegenüber der Gaststätte Freudenhöhe befindet?
Antwort: Ja, dieses Wohngrundstück ist mir bekannt. Dort befand sich früher die Fleischerei Halangk. Jetzt ist dort das Lebensmittelgeschäft Dippold mit Gemüseverkauf.
Frage: Kennen Sie Bewohner des Hauses Äußere Weberstraße 70?
Antwort: Ich kannte Fleischermeister Halangk sowie Annemarie Drossel, die als Verkäuferin in der Konsum-Lebensmittelverkaufsstelle Rathausplatz, Ecke Brüderstraße beschäftigt war, wo ich auch einmal gearbeitet habe. Sonst kannte ich keinen aus dem Haus. Eine Anni Hölzel, die im Haus Äußere Weberstraße 70 gewohnt haben soll, ist mir unbekannt. Die Frau, deren Lichtbild mir vorgelegt wurde, kenne ich nicht. Mir ist gesagt worden, dass es sich um Frau Hölzel handele.
Frage: Kennen Sie einen Wolfgang Hölzel, der ebenfalls in der Äußeren Weberstraße 70 wohnhaft gewesen ist?
Antwort: Der Name Wolfgang Hölzel sagt mir ebenfalls nichts. Auch der Hinweis darauf, dass wir fast zur selben Zeit geboren wurden – er im Januar 1932 und ich im Mai 1932 – und wir beide in unmittelbarer Nähe wohnten, was bedeutete, dass wir beide die gleiche Schule, vielleicht sogar die gleiche Klasse besuchten, ändert daran nichts. Ich kann mich an einen Wolfgang Hölzel nicht erinnern. Vielleicht liegt das daran, dass ich ab dem 5. Schuljahr, also ab 1942/43, die Mittelschule in Zittau besucht habe. Ich habe die Schule 1946 mit der 8. Klasse verlassen. Danach besuchte ich ein Jahr lang die Haushaltsschule, und anschließend absolvierte ich eine dreijährige Lehrzeit als Verkäuferin im Lebensmittelgeschäft Walter Schneider in der Breitestraße 25 in Zittau.
Frage: Hatte Ihr Vater, der selbständige Fleischermeister Walter Tzscherlich, Telefon im Hause?
Antwort: Ja. Wir hatten einen Telefonanschluss zu Hause. Mein Vater verstarb am 14. Dezember 1957 an Lungenkrebs. Wann meine Eltern den Fleischerladen schlossen, weiß ich nicht mehr. Sie betrieben die Fleischerei schon nicht mehr im Jahr meiner Eheschließung. Das Telefon existierte bereits 1950 nicht mehr. Auf der fotokopierten Ausgabe des Fernsprechanschlussverzeichnisses der Stadt Zittau von 1950, die mir vorgelegt wurde, finde ich den Telefonanschluss meines Vaters auch nicht mehr.
Frage: Hatten Ihre Schwiegereltern, hatte der Schneidermeister Josef Morche einen Telefonanschluss?
Antwort: Als ich 1948 meinen späteren Ehemann kennenlernte, hatten Morches noch keinen Anschluss. Später hatten sie Telefon im Hause, aber genau kann ich das nicht sagen. Anhand der vorgelegten Fotokopien des Telefonanschlussverzeichnisses von Zittau kann ich sagen, dass erst in der Ausgabe von 1952 mein damaliger Schwiegervater Josef Morche unter der Telefonanschlussnummer 3566 verzeichnet ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass mein geschiedener Ehemann und ich oft miteinander telefoniert hätten. Er hat mich nur selten im Geschäft, also auf der Arbeitsstelle, angerufen, sonst nicht.
Frage: Waren Sie mit Ihrem geschiedenen Ehemann in den HO-Gaststätten Volkshaus und Dreiländereck in Zittau zu Gast?
Antwort: Ja. Vor unserer Ehe und auch zu Anfang bin ich manchmal mit ihm an Wochenenden oder an Feiertagen dorthin gegangen. Andere Gaststätten haben wir nur selten aufgesucht.
Frage: Kannten Sie oder Karl Morche Angestellte aus dem Volkshaus oder dem »Dreiländereck«?
Antwort: Persönlich kenne ich nur den Kollegen Raschke, den Objektleiter des »Dreiländerecks«, und den Kollegen Schulz, den Objektleiter des Volkshauses. Sonst kenne ich keinen Angestellten dort. Ob mein geschiedener Mann irgendeinen weiblichen oder männlichen Angestellten in den beiden HO-Gaststätten kennt, weiß ich nicht.
Frage: Können Sie sich erinnern, wie oft Sie von Karl Morche 1950 besucht wurden?
Antwort: Ich kann mich nicht erinnern, dass er einmal bis Mitternacht geblieben wäre. Das hätten meine Eltern auch nicht geduldet. Ich war 1950 erst 18 Jahre alt. Es kann nur sein, dass wir einmal ausgegangen sind und er mich nach Hause gebracht hat. Wir waren meist im Kino. Was er nach der Verabschiedung gemacht hat, ob er eventuell noch wo hingegangen ist, weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht, dass er im Anschluss noch irgendetwas unternommen hat. Ich halte es auch für völlig ausgeschlossen, dass er außer zu mir Beziehungen zu anderen Frauen gehabt oder solche gesucht hat. Es war nicht seine Art, nach anderen Frauen zu schauen. 1950 hat er niemals übermäßig Alkohol getrunken. Ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals angeheitert oder gar betrunken gewesen ist.
Frage: Haben Sie im Sommer 1950 an einer großen Kulturveranstaltung im Volkshaus teilgenommen, zu der die IG Metall eingeladen hatte und an der Volkskunstgruppen der Volkspolizei und des VEB Phänomen, heute Robur, mitwirkten?
Antwort: Nein. Später besuchte ich einmal im Volkshaus eine solche Kulturveranstaltung, 1950 bestimmt nicht. In welchem Jahr das war, weiß ich nicht. Ich glaube, da waren wir schon verheiratet. Karl Morche hielt sich oft an der Theke auf und war ziemlich angeheitert. Obwohl wir bereits verheiratet waren, wohnten wir noch getrennt bei unseren Eltern. Er brachte mich nach Hause, glaube ich jedenfalls.
Frage: Welchen Weg nahm Karl Morche, wenn er von Ihnen zurück zu seinen Eltern ging?
Antwort: Ich nehme an, dass er über die Äußere Weberstraße nach der Inneren Oybiner Straße 28 gegangen ist. Also am Ende der Äußeren Weberstraße müsste er gegenüber der Weberkirche in die Grünanlagen neben dem Feierabendheim »Rosa Luxemburg« oder in die Dr.-Brinitzer-Straße zur Inneren Oybiner Straße gelaufen sein.
Frage: Nachdem Sie am 1. Juli 1967 in der zu klärenden Sache erstmals als Zeugin vernommen wurden und Sie wissen, dass Ihr geschiedener Ehemann sich selbst bezichtigt hat, an der Weberkirche eine Frau getötet zu haben, hatten Sie Zeit, alles in Ruhe zu überdenken. Haben Sie von Ihrem geschiedenen Mann, auch andeutungsweise, jemals gehört, dass er mit diesem Tötungsverbrechen in Verbindung stünde?
Antwort: Nein, niemals. Ich habe niemals, auch nicht andeutungsweise, aus dem Mund meines geschiedenen Ehemannes etwas dazu gehört. Selbst wenn er betrunken war, und das war später in unserer Ehe oft der Fall, hat er nichts von einem derartigen Tötungsverbrechen erzählt. Auch unter seinen persönlichen Sachen befand sich nichts, was von einer Frau hätte sein können. Ich traue meinem geschiedenen Mann ein solches Tötungsverbrechen nicht zu. Dazu halte ich ihn für nicht fähig. Mein geschiedener Ehemann ist geisteskrank. Er war meines Wissens schon mindestens acht Mal im Fachkrankenhaus für Psychiatrie Großschweidnitz untergebracht. Wenn er seine Anfälle bekam, erzählte er immer den unmöglichsten Blödsinn. Er wollte dann die Einheit Deutschlands zustande bringen und andere verrückte Sachen machen. Aber von einer Mordsache hat er selbst bei solchen geisteskranken Anwandlungen niemals erzählt.
Frage: Sind Sie oder Ihr Sohn Dietmar von Ihrem Ehemann jemals misshandelt worden?
Antwort: Nein. Einmal hat er im betrunkenen Zustand einen Polstersessel auf mich geworfen, als ich im Bett lag und ihm den ehelichen Verkehr verweigerte. Sonst kam es zu keinen Misshandlungen an mir oder meinem Sohn. Mein geschiedener Ehemann hängt sehr an unserem Sohn. Er hat, nachdem wir bereits geschieden waren, Dietmar am Morgen vor dem Haus abgepasst und ist mit ihm spazieren gegangen. Ich habe daraufhin die Schulleitung schriftlich gebeten, auf meinen Sohn aufzupassen und ihn nicht auf Ersuchen meines geschiedenen geisteskranken Mannes vom Unterricht freizustellen.
Sonst kann ich eigentlich nichts sagen. Mein geschiedener Ehemann hat außer seiner Cousine Rosl Hübner keine Angehörigen in Zittau. Alle seine Verwandten, darunter sein Bruder Josef Morche, leben in Westdeutschland.«
Montag, 25. September
Oberleutnant der K Strengeld und Kriminalmeister Steppan suchen am Vormittag Irma Gröne in ihrer Wohnung in Olbersdorf auf. Die Leiterin der dortigen HO-Gaststätte Volksbad arbeitete 1950 als Kuchenverkäuferin im »Dreiländereck«. Sie ist, wie die beiden Zittauer Kriminalisten erstaunt hören, damals von der Kriminalpolizei nicht vernommen oder befragt worden. Sie kennt auch keine der vier Damenhandtaschen. Selbst beim Foto von Anni Hölzel zögert sie. Sie habe ihre Kollegin »anders in Erinnerung«.
Zum Mordfall selbst steuert sie ein interessantes Detail bei: Wegen der warmen Witterung wären die Gaststätten-Angestellten in ihrer leichten Dienstbekleidung nach Hause gegangen. »Es ist damals erzählt worden, dass der vermutliche Täter aufgrund des HO-Kittels, den Kollegin Hölzel trug, angenommen haben könnte, dass sie die Einnahmen noch bei sich hat und er sie deshalb ermordete.« Ob sie aber auch das Haarhäubchen noch getragen habe, vermag sie nicht zu erinnern. Allerdings glaube sie das nicht, denn das habe man immer als Erstes abgelegt.
Und niemand von ihnen wäre als Straßenverkäuferin mit einem Bauchladen unterwegs gewesen, zu keiner Zeit, beteuert Irma Gröne.
Alle weiteren Angaben – zu den Dienstzeiten, zum Schichtbetrieb, zu Hölzels kurzzeitigem Schichttausch etc. – decken sich mit den bisherigen Feststellungen. Die beiden Kriminalisten erfahren nichts Neues. Auch hinsichtlich der Charakterisierung des Mordopfers bleibt es beim Bekannten.
»Mit Frau Hölzel war immer ein gutes Auskommen. Sie war eine nette, eine sympathische Kollegin. Sie war sehr redegewandt, und ich wüsste nicht, dass sie unter den damaligen Kolleginnen und Kollegen Feinde gehabt hätte. Ich kann mich nicht erinnern, dass damals unter verschiedenen Kollegen und Kolleginnen der HOG Dreiländereck unmoralische Beziehungen bestanden haben.«
Was damit gemeint ist, lässt Irma Gröne offen.
Nein, getrunken habe Kollegin Hölzel nicht, schon gar nicht während des Dienstes. Da sei sie immer sehr korrekt gewesen. Was natürlich im glatten Kontrast steht zu dem Gerücht, das alsbald die Runde gemacht habe. »Sie soll mit Morphium geschoben haben«, sei nach ihrem gewaltsamen Tod gemunkelt worden. Nun ja, die Leute quatschen viel, wenn der Tag lang ist, sagt Gröne.
In dieses Fach fällt auch der Verdacht, es könne auch ein Russe Anni Hölzel auf dem Gewissen haben, also ein Soldat der Besatzungsmacht.
Oberleutnant Strengeld legt ihr ein Foto von Karl Morche vor. Das Gesicht des jungen Mannes komme ihr »irgendwie« bekannt vor, erklärt die Gaststättenleiterin zunächst. Doch wann und unter welchen Umständen sie ihn gesehen haben will, kann sie nicht sagen.
Die Ausbeute ist dürftig, die siebzehn Jahre seit der Mordtat sind nicht spurlos an der Erinnerung der Zeugin vorübergegangen. Die beiden Kriminalisten notieren abschließend verärgert, dass ihre Kollegen es nicht nur versäumt hatten, Irma Gröne seinerzeit zu befragen. Sie unterließen es damals auch, drei weitere Kolleginnen aus dem »Dreiländereck« zu vernehmen: Hertha Mehnert, Ursula Michel und Ilse Dellinger. Sehr gründlich scheinen die Kriminalisten 1950 nicht gearbeitet zu haben. Das erklärt, weshalb der Mordfall bis zur Stunde unaufgeklärt ist.
Aber weiter sind sie heute auch nicht gekommen.
Mittwoch, 4. Oktober
Der Bezirksstaatsanwalt verfügt, dass sechs Eisenrohre zu beschaffen seien, die so ähnlich aussehen wie die vermeintliche Tatwaffe, die Morche benutzt haben will. Die Ermittler sollen sie bei der nächsten Vernehmung Morche vorlegen. Dieser solle sagen, welche Stange er beim Mord benutzt hat.
Mittwoch, 18. Oktober
Leutnant der K Täsche nimmt persönlich Rücksprache mit dem Fachkrankenhaus für Psychiatrie in Großschweidnitz. Konkret fragt er den behandelnden Arzt, wann Morche wieder vernommen werden könne. Darauf erklärt Dr. Otta: »Jederzeit«.
Allerdings gibt der Mediziner zu bedenken, dass der Patient »laufend krankhafte Schübe hat und darum eben Gesagtes fast im selben Atemzug widerrufen kann«.
Im Protokoll des Gespräches vermerkt Tusche: »So hat der Patient dem behandelnden Arzt auch geschildert, wie er den Mord an der HO-Verkäuferin Hölzel durchgeführt hat. Wenige Stunden aber nach dem Geständnis erklärte er jedoch, dass er diesen Mord nicht begangen habe.«
Der Arzt bleibt die Auskunft schuldig, wann Karl Morche aus der Anstalt entlassen werden könne.
Montag, 23. Oktober
Oberleutnant der K Strengeld telefoniert mit Staatsanwalt Elsner in Dresden und bittet abermals um Fristverlängerung. Diesmal setzt man als Termin den 15. November 1967.
In dem erbetenen schriftlichen Antrag, den Hauptmann Niebel unterzeichnet, wird als Grund für die Verschiebung die Erkrankung des zuständigen Sachbearbeiters angegeben.
Dienstag, 31. Oktober
In der Klinik in Großschweidnitz suchen Oberleutnant Strengeld und Leutnant Täsche Karl Morche auf und vernehmen ihn neuerlich als Beschuldigten. Morche befindet sich inzwischen seit vier Monaten in der Psychiatrie. Das Gespräch dauert etwas über zwei Stunden.
»Frage: Wie fühlen Sie sich? Haben Sie irgendwelche Beschwerden?
Antwort: Ich habe keine Beschwerden. Ich fühle mich ganz gut so.
Frage: Weshalb befinden Sie sich denn zur Zeit hier in diesem Fachkrankenhaus?
Antwort: Ich bin jetzt das zehnte Mal hier im Fachkrankenhaus für Psychiatrie in Großschweidnitz zur stationären Behandlung. Ich bin vom Kreisgericht Zittau eingewiesen worden, weil ich Ende Juni 1967 unglaubwürdige Erklärungen bei der Kriminalpolizei abgegeben habe.
Frage: Ist Ihnen in Erinnerung, welche Erklärungen Sie bei der Kriminalpolizei in Zittau abgegeben haben?
Antwort: Ich habe bei der Kriminalpolizei angegeben, dass ich die HO-Verkäuferin Marianne Böhmer aus Zittau bei der Weberkirche erschlagen hätte. Das stimmt aber alles nicht, was ich bei der Kriminalpolizei in Zittau erzählt habe. Das ist alles nicht wahr.«
Im Weiteren berichtet Morche all das, was er Monate zuvor wiederholt zu Protokoll gab – aber stets mit dem Zusatz, dass das die Unwahrheit gewesen sei. Warum er das getan habe, wisse er auch nicht. »Mir sind die Nerven durchgegangen.« Ja, es träfe zu, dass sein Cousin Karl Morche in der Sowjetunion gefallen ist und dass er sich 1960 bei der Kriminalpolizei beworben hat. Zutreffend sei ebenfalls, dass er 1947/48 beim Organisten der Weberkirche Musikunterricht erhalten hat, weshalb er die örtlichen Gegebenheiten an und in der Kirche so genau kennt. Sein Sohn Dietmar sei in dieser Kirche 1954 getauft worden, doch später habe er sie nie wieder betreten. »Ich bitte nochmals, mein Verhalten zu entschuldigen, dass ich den Behörden so viel Arbeit gemacht habe. Aber das hat an meinen Nerven gelegen.«
Montag, 6. November
Die Kriminalisten in Görlitz schließen die Akten. Hauptmann der K Niebel informiert den Staatsanwalt des Kreises Zittau, dass das Ermittlungsverfahren gegen den Transportarbeiter Karl Morche, der seit dem 1. Juli im Fachkrankenhaus für Psychiatrie Großschweidnitz untergebracht ist, abgeschlossen wurde. Er schnürt ein Aktenbündel und bittet den Staatsanwalt auf dem beigefügten Schreiben,
1. beim Kreisgericht Zittau zu beantragen, den gegen den Beschuldigten erlassenen Unterbringungsbefehl aufzuheben, was auf den zehn nachfolgenden Seiten begründet wird;
2. die beigefügte Scheidungsakte Morche ./. Morche wieder dem Kreisgericht zuzuleiten;
3. die anliegende Personalakte des Beschuldigten der Kaderleitung des VEB Robur Zittau zu übersenden;
4. die Wohnungsschlüssel des Beschuldigten entgegenzunehmen und, wenn Morche einer Person Vollmacht erteilt hat, dieser Person den Schlüssel auszuhändigen;
5. die Beschlagnahme der in der Wohnung des Beschuldigten gefundenen Sachen aufzuheben;
6. dem Staatsanwalt des Kreises Bautzen Mitteilung zu machen, dass die Mordsache Hölzel mit dem Vorgang Morche der Bezirksstaatsanwaltschaft zugeleitet wurde;
7. die Unterlagen des Ermittlungsverfahrens gegen Karl Morche an die Bezirksstaatsanwaltschaft Dresden zu übersenden mit der Bitte, dieses Ermittlungsverfahren einzustellen.
Aus der Begründung geht hervor, dass nach Übergabe des Ermittlungsverfahrens gegen Karl Morche an das Kommissariat II in Görlitz »auch die Akte über die Voruntersuchungen bezüglich des an der HO-Verkäuferin Anna Hölzel begangenen Raubmordes beigezogen wurde.
Nach erfolgter Durcharbeit des uns übergebenen Aktenmaterials wurde ein Untersuchungsplan erarbeitet, nach welchem dann die von uns geführten Untersuchungen getätigt wurden.
Dabei ist von hier versucht worden, nach Möglichkeit noch Lücken zu schließen und Versäumnisse nachzuholen, die seinerzeit (1950) bei den Untersuchungen zur Aufklärung dieses Raubmordes entstanden sind.«
So schreibt Niebel, der Chef der Görlitzer Kriminalisten, im November 1967.
Zwar hätten die alten Akten zum Nachweis geführt, »dass Karl Morche diesen Raubmord an der HO-Verkäuferin Hölzel niemals begangen haben kann«, aber sie offenbarten auch die Nachlässigkeit bei den Ermittlungen 1950. Im Untersuchungsplan der Görlitzer Kriminalisten von 1967 heißt es zum Beispiel: »Eines darf jedoch grundsätzlich festgestellt werden, dass nach dem heutigen Stande beurteilt die damaligen Ermittlungen völlig ungenügend waren.«
Dann werden die Fehler im Einzelnen aufgezählt: »Der Tatortbefundbericht ist völlig unzureichend und gibt über wichtige Fragen keine Auskunft. […] Der Tatort wurde nicht vermessen, Zeichnungen von Tatort und Umgebung wurden nicht angefertigt, Angaben zu Spurensuche und -sicherung am Tatort, an der Leiche und deren Bekleidung fehlen; äußere und innere Leichenbesichtigung hätte, soweit es sich um Spurensicherung handelt, fotografiert werden müssen.
Wo ist das präparierte knöcherne Schädeldach des Opfers verblieben? […]
Der damals verantwortliche Untersuchungsführer, VP-Oberkommissar Knarr, hat sich auch nicht die Frage gestellt und zu klären versucht, ob der als Tatort ausgewiesene Ort, nämlich der Bürgersteig an der Südseite der Weberkirche in Zittau, auch wirklich Tatort oder nicht etwa bloß der Fundort war? […]
Unverständlich ist auch, dass nicht diejenige Person damals ermittelt werden konnte, mit welcher die Geschädigte ein Telefongespräch von der HOG Dreiländereck führte, nachdem sie dem HOG-Leiter Banik zugesichert hatte, für eine erkrankte Kollegin einzuspringen und nicht nur bis 18 Uhr, sondern bis 24 Uhr den Dienst am Kuchenbüfett zu versehen. Da das Telefongespräch während des größten Geschäftsandranges erfolgte, muss es von großer Wichtigkeit gewesen sein.
Für die Untersuchungen hätten die Blutgruppe und die Blutfaktoren Bedeutung erlangen können. Darüber gibt das Obduktionsprotokoll auch keine Auskunft. Gleichermaßen war wissenswert, welchen Blutalkoholspiegel das Opfer hatte. Wo ist die neben der Leiche gefundene Zigarettenkippe verblieben? Welche Zigarettenmarke? Warum wurde nicht versucht, die Blutgruppe des Rauchers zu bestimmen? Wo verblieb das neben der Leiche gefundene Stückchen Glanzpapier (vermutlich Bonbonwickel)? Welche Bonbonmarke oder -art?«
Im Weiteren listen die kritischen Görlitzer Autoren des Untersuchungsplanes Fragen auf, die sich ihre Kollegen 1950 hätten stellen (und beantworten) müssen, was sie jedoch nicht taten:
»Welchen Weg hat die Geschädigte am Freitag, dem 28.7.1950, genommen, als sie 00.40 Uhr ihre Arbeitsstelle verließ? […] Wurde sie erwartet? Von wem? Etwa von dem nicht ermittelten Telefongesprächspartner? […]
Hatte Anni Hölzel überhaupt ihre Handtasche bei sich, als sie ihre Arbeitsstelle verließ? Wenn sie diese bei sich hatte: Weshalb hat sie der oder haben die Täter diese mitgenommen? Liegt ein einfacher Raubmord vor, das heißt handelte der Täter zufällig und aus einer ihm günstig erscheinenden Situation heraus? Wurde der unbekannte Täter vielleicht durch sexuelle Beweggründe veranlasst, die ihm entweder unbekannte oder bekannte Frau zu töten? Befand sich in der Handtasche der Ermordeten etwas, an dessen Besitz der oder die Täter besonders interessiert war bzw. waren?
Das heißt also: Welcher Art waren die Beziehungen zwischen Täter und Opfer?
Was tat die Geschädigte in der Zeit vom Verlassen der HOG Dreiländereck gegen 00.40 Uhr bis zu ihrem Auffinden gegen 01.30 Uhr? Wo war sie in dieser Zeit, mit wem war sie zusammen?«
So lesen die Görlitzer anno 1967 ihren früheren Kollegen die Leviten.Nach 17 Jahren jedoch sind auch sie nicht mehr in der Lage, den Mordfall Hölzel aufzuklären. Allerdings schließen sie nicht aus, dass es sich auch um einen Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht gehandelt haben könnte. Eine (inzwischen verstorbene) Insassin des Feierabendheims »Rosa Luxemburg« hatte seinerzeit als Zeugin ausgesagt, »dass in der Tatnacht an der Weberkirche dreimal versucht wurde, ein Kraftfahrzeug zu starten«.
Alles offene Fragen, die die Görlitzer Kriminalisten zwar stellen, aber nicht beantworten können. Der Fall Hölzel bleibt ungeklärt.
Aber sie sind erfolgreich in ihrem Bemühen, dem Mann, der sich selbst der Mordtat bezichtigte, nachzuweisen, dass er unschuldig ist und die Tat ganz gewiss nicht begangen haben kann.
So heißt es denn in der Begründung, weshalb der Unterbringungsbefehl aufzuheben ist und Morche als »freier« Mann in der Psychiatrie verbleiben kann, zu dessen Entlastung: »Der von ihm geschilderte Tathergang stimmt mit dem tatsächlichen Tathergang keinesfalls überein. […] Karl Morche gibt den Tatzeitpunkt mehr als ein Jahr früher an, nämlich die Nacht vom 5. Juni 1949, als er tatsächlich geschah (Nacht zum 28. Juli 1950). […] Er schildert die Witterungsverhältnisse, die zur Tatzeit herrschten, als nass und regnerisch. In Wirklichkeit regnete es weder in der Nacht am 5. Juni 1949 noch am 28. Juli 1950. […]
Angeblich sei die HO-Verkäuferin größer als er selbst gewesen. Seine eigene Körpergröße gibt er mit 163–164 Zentimeter an, was der Wahrheit entspricht. Die ermordete Anni Hölzel war aber nicht größer, sondern kleiner als der Beschuldigte, nämlich nur 150 Zentimeter, wie das Sektionsprotokoll ausweist.
Die Kleidung, welche die Ermordete zum Tatzeitpunkt trug, war eine andere, als vom Beschuldigten angegeben. Vor allem trug die Ermordete niemals eine Haarrüsche oder gar ein Verkaufstablett (Bauchladen) für den ambulanten Handel.
Vom Beschuldigten wurde erklärt, dass er eine Marianne Böhmer, wohnhaft gewesen Zittau, Äußere Weberstraße 70, erschlagen habe. In diesem Hausgrundstück hat wohl die ermordete Anni Hölzel, niemals aber eine Marianne Böhmer gewohnt. […]
Die in der ersten Vernehmung vom Beschuldigten abgegebenen Erklärungen bauen offensichtlich auf dem auf, was der Beschuldigte über das Tötungsverbrechen in der Sächsischen Zeitung vom 2. August 1950, Ausgabe für den Stadt- und Landkreis Zittau, gelesen hatte. […] Dazu ist von Herrn Dr. Otta im Fachkrankenhaus für Psychiatrie erklärt worden, dass für die Erkrankung des Patienten Morche typisch sei, dass derartige Kranke sich in gelesene Geschehnisse so hineinzuleben vermögen, dass sie glauben, diese betreffende Handlung selbst ausgeführt zu haben.
Aus all dem erklärt sich, dass dem Beschuldigten folglich Details der Straftat nicht bekannt sein können, weil er sie eben nicht begangen haben kann. […]
Die Hinterhauptverletzung der Geschädigten kann kaum mit dem vom Beschuldigten beschriebenen Tatwerkzeug (Eisenrohr bzw. Eisenstange) möglich gewesen sein. Der Beschuldigte ist Linkshänder, die Platzwunde am Hinterkopf der Geschädigten verlief aber horizontal, was sich auch nicht mit den Einlassungen des Beschuldigten in Einklang bringen lässt.«
Im Abschlussbericht verweisen die Ermittler auch auf ihre zweite Vernehmung am 31. Oktober, in welcher Morche alles widerrief und sich einige Male dafür entschuldigte, »dass er den Strafverfolgungsbehörden so viel Arbeit gemacht hat«.
Die geleistete Arbeit war in der Tat immens, wenn man die gesamte Ermittlungsakte studiert. Aber auch das hier erstmals veröffentlichte Konzentrat offenbart dies. Wie es auch alle juristischen Schritte, eines Rechtsstaats angemessen, nachprüfbar belegt.
Die Staatsanwaltschaft folgt dem Vorschlag, das Ermittlungsverfahren gegen Karl Morche entsprechend §164 Abs. 1 Ziffer 2 StPO einzustellen und den Unterbringungsbefehl aufzuheben.
Karl Morche verbleibt als Patient im Fachkrankenhaus. Er verstirbt zu Beginn der achtziger Jahre in der psychiatrischen Anstalt.
Der Mord an Anni Hölzel ist bis heute nicht aufgeklärt.