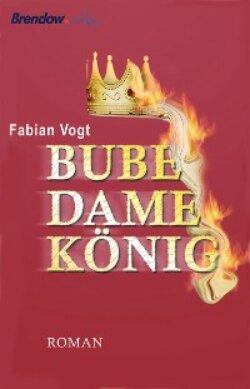Читать книгу Bube, Dame, König - Fabian Vogt - Страница 8
5. Dezember
ОглавлениеLord Kilmarnok betrachtete sein grün unterlaufenes Auge im Spiegel und fluchte laut vor sich hin. Die Beschimpfungen verfingen sich in den schweren golddurchwirkten Vorhangstoffen, und für einen Moment schien es dem Adligen, als verdunkelten seine Worte das exquisit eingerichtete Zimmer der Herberge an der Themse. Im Laufe des Tages hatte der Ärger über sein Versagen immer weiter zugenommen und sich zuletzt mit einer beängstigenden Verzweiflung verbunden, die nach und nach Besitz von ihm ergriff. Es war nicht nur der Ärger über den verfehlten Schuss, sondern das Erschrecken darüber, dass er derart die Kontrolle über sich verloren hatte. Eine eigentümliche Scham erfüllte ihn, ohne dass er dieses zermürbende Gefühl hätte näher beschreiben können; eine Demütigung, ein Unbehagen, das sein ganzes Dasein in Frage stellte, als wären die in ihm angestauten Gefühle wie ein Tor zur Seite geschwungen und hätten den Blick auf einen dahinter liegenden Abgrund freigegeben, in dessen Tiefe er zu stürzen drohte. Die Glockenschläge, die von Big Ben herüberzogen, hallten dumpf in seinem Kopf nach, und Lord Kilmarnok stellte sein Whiskyglas so fahrig auf den Tisch, dass sich der Inhalt über den Rand auf den Tisch ergoss.
Am frühen Nachmittag hatte der Adlige seinem Diener, einem untersetzten, dunkelhaarigen Schweizer namens Felix, harsch befoh len, die eben in den Schränken verstauten Kleider wieder einzupacken und eine Überlandkutsche zu bestellen. Er verspürte das dringende Bedürfnis, den Ort seiner entblößenden Niederlage so schnell wie möglich zu verlassen. Doch während er dem unterwürfigen Begleiter beim Zusammenlegen der seidenen Hemden zugesehen hatte, war ihm zunehmend bewusst geworden, dass er nicht vor dem floh, was geschehen war, sondern vor dem, was geschehen könnte. Sein spontaner Vorschlag, diese Frau in Hosen für etwas zu bezahlen, das ihm Schmerzen bereiten würde, kam ihm inzwischen gänzlich absurd vor. Ärgerlich wischte er sich den kalten Schweiß von der Stirn, der immer dann auftrat, wenn er sich verunsichert fühlte. Die Vorstellung, sich erneut der Geschichte seines Feindes stellen zu müssen, die er doch in seiner Fantasie schon Tausende von Malen durchlitten hatte, erschreckte ihn zutiefst. Sie war bei aller Abscheu im Laufe der Jahre zu seiner eigenen Geschichte geworden und vertrug keine Korrekturen.
Schwer ließ sich der Lord in einen der Sessel am Fenster fallen. Er wollte sich gerade zur Beruhigung eine Zigarre anstecken, als er bemerkte, dass sich das von draußen einfallende Licht verändert hatte: Unruhig schwamm es durch die Glasscheiben und brach sich wie Wellen im Spiegel. Die große Brücke vor dem Fenster brannte! Er sprang wieder auf und starrte durch die Vorhänge hindurch in den weiten Feuerwall, der die über den Fluss gezogene Häuserreihe in ein zuckendes Abendrot tauchte. Wie rötliche Geysire schossen die Flammen bis zu den Kaminen empor und züngelten hämisch gen Himmel, als wollten sie das Dunkel aus der hereinbrechenden Nacht lecken. In den Torbögen der Gebäude flogen Funken umher und suchten gierig nach Nahrung. An den Wänden aber wiegten sich im Rhythmus des Flackerns die Schatten der Menschen, die verzweifelt versuchten, den heißen Wellen Einhalt zu gebieten.
Verwirrt beobachtete der Lord, dass einige der Umstehenden heftig Beifall klatschten, als forderten sie eine Zugabe. Einer von ihnen, ein langer, dunkelhaariger Arbeiter mit schwerem Matrosengang, stellte sich den Löschmannschaften in den Weg und trat demonstrativ gegen die schweren Holzeimer der Helfer, bis das Wasser hinausschwappte. Kurz darauf kam es zwischen den verschiedenen Gruppen zu ersten Schlägereien. Wütende Schreie hallten durch die Gassen. Der Adlige wollte sich gerade abwenden, als er unter den zahllosen Schaulustigen, die das Feuer angelockt hatte, auch das kleine Mädchen bemerkte, das ihm am Vormittag den Weg gewiesen hatte. Es stand wohl auf einer Tonne oder etwas Ähn lichem und lugte neugierig über die Köpfe der Versammelten hinweg auf den Brandherd. Dann plötzlich war es verschwunden. Wenig später bemerkte der Beobachter, dass es behände zwischen den Beinen der Erwachsenen hindurchschlüpfte und versuchte, zum Kai zu kommen. Lord Kilmarnok ergriff seinen Mantel und lief ins Freie.
Als er sich der Themse näherte, spürte der Suchende bei jedem Schritt die zunehmende Hitze im Gesicht. Die Flammen waren inzwischen auf eines der vorderen Häuser übergesprungen und bemalten die weiße Fassade mit schwarzen Zacken. Schwer atmend erreichte er das Ufer in der Nähe eines schräg liegenden Frachtkahns, dessen Heck halb gesunken zu sein schien. Das Mädchen war nirgends zu sehen.
»Kann ich Ihnen helfen, Sir?«
Felix, der seinem Herrn gefolgt war, ergriff indigniert dessen Mantel und legte ihn ordentlich zusammen. Lord Kilmarnok ließ währenddessen seinen Blick durch die Menge schweifen. Die Zahl der Zuschauer war noch weiter gestiegen, und rund um die brennende Brücke rangen Menschen aller Altersklassen miteinander. Ein geschickter Maler hätte in dem Durcheinander der vom Feuer beleuchteten Kämpfer prachtvolle Motive für ein Höllenszenario entdeckt. Der Adlige betrachtete das Geschehen, ohne es zu begreifen. Laut, um das Schreien der Menschen zu übertönen, sagte er: »Was ist hier eigentlich los?«
Der Diener rümpfte die Nase und nickte mit dem Kopf Richtung Gasthaus: »Die Bürger der Stadt haben die Brücke angezündet, Sir. Zum zweiten Mal in wenigen Wochen.«
Lord Kilmarnok ignorierte die auffordernden Blicke seines Dieners: »Warum? Warum sollte jemand so töricht sein und die Londonbridge anzünden?«
Felix hustete und hielt sich ein Taschentuch vor den Mund, um den Rauch nicht einatmen zu müssen: »Nein, Sir, sie haben nicht die Londonbridge angezündet, sondern die dahinter liegende Holzbrücke, eine vorübergehende Hilfskonstruktion. Habt Ihr auf der Hinfahrt gar nicht bemerkt, dass wir über eine Behelfsbrücke gefahren sind?« Er zögerte: »Mit Verlaub, Eure Lordschaft, seit Ihr heute Morgen ohne mich die Herberge verlassen habt, wirkt Ihr bedrückt. Gibt es etwas, das ich für Euch tun kann?«
Der Adlige schüttelte unsicher den Kopf. Sein Kammerdiener wartete eine kurzen Moment, dann fuhr er mit seiner Erklärung fort: »Die große alte Brücke soll doch abgerissen werden. Das ist auch dringend nötig. Im Lauf der Jahre hat man die neunzehn Pfeiler wegen der vielen Brückenhäuser so oft befestigt und verstärkt, dass jetzt fünf Sechstel des Flusses zugebaut sind. Wie Ihr seht, schießt das Wasser mit ungeheurem Druck durch die Bögen. Schiffe passen da schon lange nicht mehr durch, und die kleinen Kähne kämpfen mühsam mit der wilden Strömung. Ich habe jedes Mal Angst, wenn ich über dieses labile Ungetüm fahre. Und ich scheine nicht der Einzige zu sein. Darum hat die Stadt beschlossen, eine neue Brücke mit größeren Bögen zu bauen. Auf der soll es aber keine Häuser mehr geben. Im Augenblick ist die Brücke eine kleine Ortschaft für sich – mit Hunderten von Bewohnern. Sie alle wehren sich gegen den Neubau, demonstrieren gegen den Abriss und boykottieren die Arbeiten, wo sie nur können.«
Aus der Geräuschkulisse drangen immer häufiger Schmerzensschreie. Lord Kilmarnok beugte sich zu seinem Begleiter: »Ich begreife das nicht. Sie wollen ihre Häuser retten, indem sie sie anzünden?«
Die Antwort war nur schwer zu verstehen: »Nein, Sir, indem sie die Ersatzbrücke anzünden. Das Ganze ist ein völliger Irrsinn. Die Bewohner der Brücke zünden die Holzbohlen an und behindern die vierhundert Bauarbeiter beim Löschen. Aus Rache scheren die sich nicht darum, wenn die Flammen auf die Gebäude der alten Brücke überspringen. Warum auch? Sie sollen ja ohnehin abgerissen werden. Und so stehen beide Seiten da: Jeder möchte, dass die Brücke des anderen brennt und die eigene vor den Flammen bewahrt wird. Und weil sich die Gruppen jetzt auch noch Straßenschlachten liefern, werden bald beide Brücken abgebrannt sein. Das ist die Krönung der Dummheit.«
Der Diener trat einen Schritt zurück, als sich eine kleine Gruppe Kämpfender näherte. Hasserfüllt schlugen die Männer mit qualmenden Holzstöcken aufeinander ein und beschimpften ihre Gegner wüst, während hinter ihnen die Flammen immer mehr Häuser anfraßen. Der Lord hielt weiter nach dem Mädchen Ausschau: »Was für ein Trauerspiel! Diese Leute wollen die Zukunft verhindern und zerstören damit ihre Vergangenheit?«
Felix wich erneut einen Schritt zurück, da nun regelmäßig Funkenschwärme vom Wind ans Ufer getrieben wurden: »So könnte man es auch ausdrücken.«
Sein Herr schüttelte den Kopf: »Das ist dumm, es ist einfach dumm!«
In einem der brennenden Häuser öffnete sich auf einmal ein Fenster und das Gesicht des Mädchens tauchte neben vielen anderen in dem dunklen Rahmen auf. Die Kinder streckten ihre Köpfe heraus und musterten die Umgebung, als wollten sie abschätzen, wie viel Zeit ihnen im Inneren noch bliebe. Jedes von ihnen hielt einige Gegenstände umklammert, wohl um sie aus dem Feuer zu retten.
»Plündern sie oder lassen sie sich von den Bewohnern für ihre Rettungsaktionen bezahlen?«, fuhr es Lord Kilmarnok durch den Kopf. Ohne nachzudenken, hob er die Hand und winkte dem Mädchen zu. Sie sah es und schaute einen Moment überrascht und verwundert zu ihm hin. Dann erkannte sie ihn offensichtlich, denn ihr Mund öffnete sich zu einem breiten Lachen und sie winkte unbefangen zurück. So schnell, wie sie erschienen war, verschwand sie wieder.
Felix, der versuchte, seinen Herrn vor den vorbeifliegenden Funken zu bewahren, die vom aufkommenden Wind in immer größeren glitzernden Schwärmen herangetragen wurden, fuchtelte hektisch über dessen Kopf herum und stieß dabei gegen die ausgestreckte Hand. Entschuldigend zog er sich zurück. Dann murmelte er: »Darf ich fragen, was Ihr da tut, Sir?«
Der Adlige senkte plötzlich den Blick. Er nahm spielerisch die Hand herunter, holte ein Tuch aus der Tasche und putzte umständlich seine Nase. Dann lächelte er den Bediensteten an: »Ich weiß es selbst nicht genau. Ich dachte, ich hätte ein kleines Mädchen gesehen, dem ich zwei Münzen für einen kaputten Spielzeugkinderwagen schuldig geblieben bin.«
Felix schluckte elegant einen Kommentar hinunter. Dann fragte er unterwürfig zweifelnd: »Einen Spielzeugkinderwagen? Habe ich Euch richtig verstanden, Eure Lordschaft?«
Der Adlige lächelte: »Ja, ich habe etwas versprochen und es nicht gehalten. Ich möchte nicht, dass das Kind von mir enttäuscht ist. Es ist schrecklich, enttäuscht zu werden.«
Der gut gekleidete Mann empfand beim Anblick der brennenden Bauten auf einmal eine tiefe Zufriedenheit, auch wenn ihm die Hitze Tränen in die Augen trieb. Das Schicksal hatte für ihn entschieden und ihm die Qualen eines langen, zögerlichen Nachdenkens abgenommen: Es würde Tage dauern, bis zumindest eine der zerstörten Brücken wieder passierbar sein würde. Die Fähren auf der Themse fuhren sonntags nicht und wären für sein Reisegepäck ohnehin zu klein gewesen. So konnte er, ob er wollte oder nicht, frühestens am nächsten Morgen auf die andere Seite gelangen, um die Heimreise anzutreten. Zumindest an diesem Abend würde er sich daher mit der Frau treffen, um von ihr etwas über die Geschichte seines verhassten Feindes zu hören. Und jetzt, da es keinen Ausweg gab, war er bereit, die Begegnung zu riskieren. »Es ist verrückt«, dachte er, »weil die Entscheidung gefällt ist, kann ich mit ihr leben. Als ich sie selbst hätte fällen sollen, bin ich vor ihr davongelaufen.«
Der Lord drehte seinem Diener den Rücken zu und ließ sich in den Mantel helfen, der durch den permanenten Funkenflug an einigen Stellen kleine Brandlöcher bekommen hatte. Er klang entspannt, als er seine Anweisungen gab: »Du kannst die Koffer wieder auspa cken, Felix. Da die Brücke zerstört ist, können wir ohnehin nicht nach Hause fahren. Wir bleiben also auf jeden Fall bis morgen hier.«
Der Diener wischte einen glimmenden Punkt, der sich gerade auf dem feinen Stoff niedergelassen hatte, von der Schulter des Adligen. Er musterte seinen Herrn einen Atemzug lang und sagte dann verhalten: »Eure Lordschaft, Ihr habt sicher nur vergessen, dass London seit einigen Jahren eine zweite Brücke hat. Die Westminsterbridge ist nun wahrhaftig kein großer Umweg. Wir können also sehr wohl fahren. Die Kutsche müsste sogar schon eingetroffen sein.«
Lord Kilmarnok schaute auf seinen Bediensteten und verfluchte ihn innerlich. Gleichzeitig wusste er, dass sich das Ja zu einer Begegnung mit der Tochter des Schneiders in ihm festgesetzt hatte wie der Angelhaken in einem Fisch. Es jetzt noch zu entfernen, würde unnötige Wunden hinterlassen. Abgesehen davon empfand er die Entscheidung, nachdem er sie innerlich getroffen hatte, plötzlich als konsequent und klar, so klar, dass er nicht einmal gewillt war, über eine Änderung des Plans nachzudenken: »Wir bleiben hier. Es geht nicht anders.«
Er wandte sich um und ging mit festem Schritt Richtung Soho. Felix sah ihm unschlüssig hinterher. Schließlich lief er schimpfend zurück zum Gasthaus.
In der Little Chapel Street hing der Mond schläfrig in den Bäumen und beobachtete zwei Katzen, die seit Stunden umeinander herumstrichen. Obwohl die Bewohner der Häuser verpflichtet waren, die Straße vor ihrer Tür von 18 bis 23 Uhr zu beleuchten, lag alles im Dunkeln. Wer in Soho wohnte, war meist froh, wenn er die Miete auf bringen konnte, Geld für kostspielige Brennstoffe besaß er nicht. Der leichte Wind, der die Häuserschlucht entlangzog, brachte die Schilder der Handwerker über den Eingängen der Werkstätten zum Schwingen und das Aneinanderreiben der Kettenglieder erfüllte die Luft mit einem stetigen Seufzen. Gegen neunzehn Uhr tauchten wie jeden Abend die roten Laternen der Latrinenleerer das Viertel in ein warmes Licht, das mit dem süßlich-schweren Gestank der Exkremente um die Aufmerksamkeit der Anwohner buhlte, bis es träge Richtung Leicester Square davonschlich.
Lord Kilmarnok zog angewidert die Nase hoch, als er wenig später die Gasse betrat und sich dem Haus mit der Nummer 5 näherte. Vor den Stufen zum Eingang hielt er einen Augenblick inne, dann schüttelte er energisch den Kopf, stieg hinauf und klopfte. Die Tür war nur angelehnt und sprang von selbst auf. Vorsichtig blickte der Adlige in das hell erleuchtete Innere.
Einen Augenblick war er überzeugt, sich in der Tür geirrt zu haben, denn er erkannte den Raum nicht wieder. Er wollte sich schon, eine Entschuldigung murmelnd, zurückziehen, als er plötzlich die junge Frau entdeckte, die wieder vor der hinteren Wand kniete und Bögen mit Mustern anbrachte. Die Farben dieser Blätter waren so verschieden von denen des Morgens, dass sich die gesamte Atmos phäre des Raumes verändert hatte. Diesmal hatte die Künstlerin ein warmes Blau gewählt, auf dem zarte weiße Linien die Wellen andeuteten, zwischen denen kleine Ruderboote ihre Bahn zogen. Auf den ersten Blick schienen dem Ankömmling die kleinen Kähne mit ihren weit nach hinten gelehnten Ruderern alle identisch zu sein, bis er erkannte, dass im hellen Fond jedes Bootes andere Menschen saßen: einmal ein verliebtes, kosendes Pärchen, einmal zwei streitlustige Alte, dazwischen ein in der Bewegung erstarrtes Geigenquartett, eine stillende Mutter oder ein steif thronender Soldat mit ordenübersäter Brust. Wie ein Bilderbuch eröffnete die Wand den Einblick in eine winzige, verlockende Welt und weckte die Sehnsucht, die vielfältigen Geschichten der farbenfrohen Personen kennen zu lernen. Und während am Mittag der Raum mit der Pflanzentapete wie eine wohlige Höhle gewirkt hatte, schien er nun weiter und größer. Lord Kilmarnok war es, als betrete er eine Uferpromenade, während er die Türschwelle überschritt.
Die junge Frau hatte das Quietschen der Tür gehört. Sie legte ihren Pinsel zur Seite und drehte sich um. Verwundert sagte sie: »Ich hätte nicht gedacht, dass Ihr tatsächlich kommt!«
Der Mann trat langsam ein und versuchte, seine Sinne an den neuen Anblick zu gewöhnen: »Ich auch nicht! Aber jetzt bin ich hier.«
Er schloss die Tür hinter sich und legte zwei Pakete, ein langes und ein breites, auf den Schneidertisch, bevor er sich der Frau näherte, die sich erhob und demonstrativ zwischen ihm und der Kammer Aufstellung nahm. Der Adlige sah sich suchend um: »Wo sind die anderen?«
Isabelle, die diesmal einen einfachen Rock über dem Mieder trug, rührte sich nicht. Ihre Worte abwägend, sagte sie: »Bei der brennenden Brücke. Dort scheint sich ja die ganze Stadt zu versammeln. Jedenfalls wollten mein Vater und Jizchak das einzigartige Schauspiel nicht verpassen. Kaum war der rote Glanz am Himmel, sind sie losgerannt. Philipp …« Ihre Stimme zitterte leicht: »… wird jeden Augenblick zurück sein, und meine Tochter ist gerade nach Hause gekommen. Sie wäscht sich.« Scharf fügte sie hinzu: »Ihr solltet aber trotzdem nicht auf dumme Gedanken kommen! Ihr müss tet mich töten, um zu ihm zu gelangen!«
Jetzt erst entdeckte Lord Kilmarnok die blitzende Schere in ihrer Hand. Obwohl er spürte, dass die Nähe des ihm so verhassten Mannes ihn tatsächlich unruhig werden ließ, versuchte er zu lächeln. Es misslang. Schnell versteckte er sein Gesicht hinter einem seidenen Taschentuch und sagte verschnupft: »Ich bin vor allem gekommen, um mich zu entschuldigen. Ich kann mir vorstellen, was du nach diesem Tag von mir denkst. Ich habe mich wie ein Verrückter benommen – aber ich will nicht, dass du mich verachtest.« Er hielt ihren prüfenden Blicken stand: »Tatsächlich möchte ich diesen Widerling immer noch umbringen, aber gerade jemand, der einen unehrenhaften Menschen beseitigen möchte, sollte sich dabei selbst ehrenhaft benehmen. Mein Auftreten heute Mittag war äußerst verwerflich, und ich bitte dich um Vergebung.«
»Bitte geht!«
»Erst, wenn du meine Entschuldigung angenommen hast.«
Mit hochgezogenen Brauen sah der Lord Isabelle direkt in die Augen, verbeugte sich dann tief und wandte dabei die Augen bewusst zum Boden, bevor er sich wieder aufrichtete. Die dunkelhaarige Frau musste unwillkürlich lächeln, weil zum ersten Mal in ihrem Leben jemand vor ihr eine Verbeugung gemacht hatte. Dann fing sie plötzlich an, wie ein kleines Mädchen zu kichern. Irritiert runzelte Lord Kilmarnok die Stirn, unsicher darüber, wie er ihre Reaktion deuten solle. Zudem kam sie mit gezückter Schere auf ihn zu. Die erheiterte Frau aber griff zu ihrem Zeichenblock, der auf einem Stuhl lag, und zog den verwunderten Mann ins Licht. Sie musterte neugierig seine Gesichtszüge und sagte: »Ihr seht gruselig aus. Ihr wart offensichtlich auch beim Feuer. Vielleicht hättet Ihr Euch waschen sollen, bevor Ihr hierher kommt. Obwohl: Das Muster auf Eurem Gesicht gefällt mir.«
Mit wenigen Strichen skizzierte Isabelle auf dem Papier die Ascheflecken, die das Gesicht des Edelmannes bedeckten und durch die die Tränen helle Kanäle gezogen hatten. Dabei lachte sie weiter vor sich hin. Sie riss das Blatt mit den dunklen Konturen ihres neuen Entwurfes ab und legte es zur Seite. Ehe der verblüffte Lord überhaupt reagieren konnte, hatte sie ihren Daumen an der Zun ge angefeuchtet und rieb ihm die Rußpartikel von der Wange. Fassungslos starrte der Mann die junge Frau an, was diese nicht da von abhielt, ihr Werk zu Ende zu bringen. Dann aber stockte sie kurz und zog dem Verdutzten mit einem Ruck den Hut mit-samt der Perücke vom Kopf und hielt beides wie eine Trophäe in der Hand. Die dunkelblonden Locken darunter glänzten schweißdurchzogen und räkelten sich der neu gewonnenen Freiheit entgegen. Mit einem grimmigen Ächzen griff der Adlige nach der Perücke – und ließ sie dann mit einem Aufschrei fallen. Isabelle bückte sich vorsichtig danach und hielt das traurige weiße Häuflein in die Luft: »Einige Funken haben sich in Eurer Perücke einge nistet, Eure Lordschaft, und kohlen nun mit den Haaren vor sich hin. Aber wenn Ihr sie unbedingt wieder aufsetzen wollt, bitte schön!«
Frederik von Kilmarnok trat einen Schritt zurück. Man sah ihm an, dass er den Ärger über die Art, wie sie ihn behandelte, unterdrücken musste, denn sein Adamsapfel zuckte fast ebenso schnell wie sein Atem. Er setzte sich auf den Stuhl und schlug verkrampft die Beine übereinander. Unentschlossen deutete er auf das Paket, das er auf den Tisch gelegt hatte, und sagte mit nasaler Stimme: »Ich habe als Zeichen meines Bedauerns ein Geschenk mitgebracht. Ich hoffe, es ist dir von Nutzen.«
Isabelle folgte seinem Finger mit den Augen. Mit einem kindlichen Jauchzer nahm sie das eingeschlagene Präsent in die Hand, bemerkte verwundert das Gewicht und löste dann mit kleinen, flinken Bewegungen das Wachspapier. Im Inneren fand sie ein Buch, dessen Titel sie mit einem Aufschrei las: »Das ›Complete Body of Architecture‹! Das ist doch erst in diesem Herbst erschienen. Seid Ihr wahnsinnig?«
Der Adlige lehnte sich zurück: »Du kennst das Buch?«
Sie begann in den Seiten zu blättern: »Natürlich. So viele Bücher über Tapeten gibt es ja nicht. Wobei ›kennen‹ viel zu viel gesagt ist. Ich habe ein einziges Mal kurz hineingeschaut. Meine Freundin Kathrin arbeitet als Zofe in einem vornehmen Haus. Sie hat mir erzählt, dass ihre gnädige Frau sich ein Buch über Inneneinrichtungen gekauft hat, und sie weiß, dass ich immer davon geträumt habe, so etwas zu machen. Sie hat mich dann, weil ich so gebettelt habe, einige Tage später, als ihre Herrschaften einen längeren Ausflug machten, heimlich in die Wohnung gelassen – obwohl es sie ihren Job gekostet hätte, falls man mich erwischt hätte. Dort konnte ich drei Stunden darin lesen und mir einige Dinge abschreiben. Weil es dieses Buch gibt, habe ich überhaupt erst angefangen, Muster für Tapeten zu entwerfen. Hier steht nämlich drin, dass es bald in allen Häusern Tapeten geben wird.«
Lord Kilmarnok machte eine abwertende Geste: »Nun, jetzt hast du ja selbst ein Exemplar. Und wie ich sehe, hat es sich gelohnt, den Buchhändler an einem Sonntag aus seiner Wohnung holen zu lassen. Offensichtlich habe ich ihm deine, wie nennst du es, ›Arbeit‹, also deine Beschäftigung, richtig beschrieben.«
Isabelle sah den Wartenden mit halb geöffneten Lippen nachdenklich an. Dann schlug sie das Buch langsam wieder zu und legte es zurück in den Umschlag. Ruhig faltete sie das Papier zusammen und hielt das fertige Paket mit ausgestrecktem Arm von sich: »So, wie Ihr eben noch ausgesehen habt, mit Ruß im Gesicht und qualmender Perücke, müsst Ihr dem Verkäufer viel Geld gegeben haben, damit er euch sonntags bedient hat. Ich will das Buch nicht.«
Der Adlige öffnete fragend beide Arme. »Warum denn nicht?«
Sie legte das Paket in seinen Schoß: »Ich weiß nicht, wer Ihr seid und was Ihr wollt. Und ich bedaure es, dass ich eben für einen Moment mein Misstrauen vergessen habe. Denn eines ist sicher: Ich nehme kein solch teures Geschenk von Euch an. Ihr könnt Euch vielleicht sonst alles von Eurem Geld kaufen, aber einen Ablass für Euer haltloses und verbrecherisches Verhalten bekommt Ihr von mir nicht. Auch nicht für ein so kostspieliges Buch. Lasst mich bitte in Frieden.«
Lord Kilmarnok fühlte sich ohne Perücke unwohl und schaute Isabelle zornig an: »Es ist ein Geschenk, nur ein Geschenk. Und ja, ich gebe es dir dafür, dass ich heute in diesem Haus unbeherrscht gewütet habe. Ich möchte mein Verhalten wieder gutmachen. Es ist einfach eine Entschuldigung. Musst du denn alles so kompliziert machen?«
»Ich?« Isabelle wurde mit jedem Wort lauter: »Wer kommt denn hier wie ein Berserker hereingestürmt, schießt um sich, bietet mir Unsummen für die privaten Erinnerungen, die Geschichte des Königs, und bringt dann abends ein Geschenk, für das ich normalerweise vier Monate arbeiten müsste? Vielleicht ist es wirklich besser, wenn Ihr jetzt geht.«
Angriffslustig blitzte sie Lord Kilmarnok an.
Von der Seite kam eine helle Stimme: »Nein, er darf nicht gehen!«
Isabelle erschrak, griff hinter die Abdeckung der Treppe und zog ihre Tochter an den Haaren hervor: »Schascha!« Der Klang schwang nach. »Wie lange sitzt du schon da?«
Das Mädchen, dessen weit auseinander stehende, tiefgrüne Augen der Lord zum ersten Mal bewusst wahrnahm, wand sich unter dem Griff seiner Mutter und blickte trotzig blinzelnd in den hellen Raum: »Das ist doch ganz egal! Warum willst du, dass er geht?«
Isabelle ließ so plötzlich los, dass die Kleine nach hinten stolperte. Die Stimme der jungen Frau war plötzlich sanft und ernst. Als sei der Lord gar nicht mehr anwesend, sagte sie: Wut und Angst. Das ist eine fürchterliche Mischung. So fürchterlich, dass er den König töten wollte. Er ist ein Mörder! Ganz gleich, ob er die Tat schon begangen hat oder nicht. Wäre Jizchak der König gewesen und hätte dieser Mann hier besser geschossen, dann wäre der König jetzt tot. Wir haben also gesehen, dass er dazu fähig ist. Bei so jemandem musst du sehr vorsichtig sein Denn wer andere verachtet, der verachtet auch sich selbst. Und das ist schlimm. Jemand, der sich selbst gern hat, der sich wirklich liebt, der tut anderen nicht weh. Verstehst du das?«
Schascha schaute zu Boden. Leise sagte sie: »Nein! Ich mag ihn, Mama. Er ist doch nur traurig.«
Lord Kilmarnok fühlte, dass seine Hände zitterten. Blass griff er nach seiner Perücke, dem zweiten Paket und dem Buch und drehte sich zur Tür. Er hatte die Klinke schon in der Hand, als ihn das Mädchen noch einmal anrief: »Du, Lord Frederik! Du schuldest mir noch etwas!«
Der Adlige hielt inne, zog mit fahrigen Fingern seinen Geldbeutel hervor und schnürte ihn auf. Schascha aber lief hinter ihm her und zog an seinem Mantel: »Darf ich mir etwas wünschen? Bitte!«
Sie schlüpfte unter seinem Arm hindurch und stellte sich in die Tür. Ihre Augen glänzten. Stolz auf ihren Einfall, rief sie mit einem kurzen Seitenblick zu ihrer Mutter: »Schenk mir das tolle Buch mit den Wohnungseinrichtungen!«
Isabelle, die sich schon wieder zu ihrer Tapete gewandt hatte, fuhr herum. Ihre Pupillen waren unnatürlich geweitet. Doch über das Gesicht des Lords zog ein befreites Lächeln. Er streckte der Kleinen das Buch hin: »Gerne! Hier hast du es.«
Ehe ihre Mutter reagieren konnte, hatte Schascha das Paket ergriffen. Lord Kilmarnok aber zwängte sich an dem Mädchen vorbei und verschwand in der Dunkelheit.
Ängstlich schaute das Mädchen in den Raum. Tränen schossen in ihre Augen, als sie den verzweifelten Gesichtsausdruck ihrer Mutter bemerkte, die ihre Sicherheit verloren hatte und mit einem Mal sehr jung und verletzlich aussah. Nach einem Moment des Schweigens nahm Isabelle eine wollene Mantille vom Stuhl, legte sich die Zipfel des Schals über die Brust und knotete sie hinter dem Rücken zusammen. Dann lief auch sie wortlos in die Nacht.
Am Ende des Blocks hatte sie den Lord eingeholt, der mit weiten Schritten in der Mitte der Straße Richtung Themse eilte. Einige Meter hinter ihm blieb sie schwer atmend stehen und rief: »Ihr sollt die Geschichte hören.«
Er hielt inne. Erst in diesem Augen blick bemerkten beide, dass es angefangen hatte zu regnen. Lord Kilmarnok schaute auf die glänzenden Steine und fühlte wegen der fehlenden Perücke nach langen Jahren zum ersten Mal wieder Regentropfen auf seiner Kopfhaut. Fast tonlos sagte er: »Lass mich!«
Sie trat neben ihn: »O nein! Ich bleibe niemandem etwas schuldig, genauso wenig wie Ihr. Es ist Euch mit einem schäbigen Trick gelungen, das kostbare Buch in unserem Haus zurückzulassen, aber es wird Euch nicht gelingen, mich zu beschämen.«
Ihre Stimme wurde leiser: »Möglicherweise mache ich einen großen Fehler, aber da Ihr wie besessen zu sein scheint, kann Euch nur die Wahrheit heilen. Ja, ich möchte, dass Ihr erfahrt, wie der König wirklich ist, und dass die Gefühle, die Ihr ihm gegenüber hegt, falsch sind. Ich kann nämlich Hass nicht ausstehen.« Sie nickte ihm auffordernd zu: »Also: Kommt!«
Der Adlige schüttelte langsam den Kopf. Er redete mehr mit sich selbst als mit der jungen Frau: »Vielleicht hattest du vorhin doch Recht. Es ist alles nicht so einfach, wie ich dachte. Ich kann jedenfalls nicht mehr in das Haus gehen, in dem er liegt. Jedes Mal, wenn ich ihm zu nahe komme, zerbreche ich innerlich. Irgendetwas Fremdes nimmt dann von mir Besitz, das mich Dinge tun und sagen lässt, die ich niemals wollte – die ich zumindest nicht geplant, geschweige denn bewusst gewünscht habe. Es ist, als träte ich in eine andere Welt ein, in der alle meine Verletzungen, Zweifel und Fragen wie fratzenschneidende Dämonen um mich stehen und über mich spotten. Dann fühlt es sich an, als ob genau in diesem Moment mein Schicksal entschieden würde. Und ich ahne, dass ich verlieren werde, gegen mich selbst und gegen die Welt. Dann will ich nur noch fliehen, aber ich weiß nicht, wohin.«
Isabelle schloss zu Lord Kilmarnok auf: »Hört mir doch erst einmal zu. Vielleicht habt Ihr Euch einfach geirrt. Vielleicht hat man Euch falsch informiert. Wir laufen alle mit Lebenslügen herum. Und die meisten davon entstammen einfach der Furcht vor der Wahrheit. Aber nicht jede Wahrheit schmerzt. Im Gegenteil. Eine Lüge hat immer nur die Macht, die wir Ihr verleihen. Bitte! Kommt! Auch wenn ich Eure Vorbehalte verstehe: Wir können nicht hier im Regen bleiben.«
Der Adlige, der noch immer das lange Paket in Händen hielt, öffnete die darumgewickelten Schleifen, zog einen langen Gegenstand hervor und hielt ihn der jungen Frau hin. Die wich schnell einen Schritt zurück. Ratlos fragte sie ihn: »Was ist das? Ein Gewehr?«
Lord Kilmarnok schmunzelte unwillkürlich: »Nein! Das ist kein Gewehr. Das ist ein Schirm, ein Schirm gegen den Regen. Ich habe ihn vorhin in einem Laden gekauft, als ich mich entschlossen habe, zu Fuß zu dir zu gehen. Das ist eine ganz ungewöhnliche neue Erfindung. Du hältst dieses Ding über den Kopf und wirst nicht nass.«
Vorsichtig nahm ihm Isabelle das lange Gebilde aus der Hand, hob es in die Höhe und stellte sich darunter. Traurig sagte sie: »Es funktioniert nicht!«
Sie sah so enttäuscht aus, dass der Lord jetzt trotz seiner Not lauthals loslachen musste. Er nahm der jungen Frau den Schirm aus der Hand und öffnete ihn. Dann breitete er die aufgespannte Fläche über sie und beugte sich zu ihr: »Also gut! Erzähl!«
Er reichte Isabelle schüchtern den Arm. Sie zögerte einen Moment, dann atmete sie zweimal tief, bevor sie sich bei ihm einhakte und langsam mit ihm in Richtung St. James’s Park ging.
{{{
THEODOR SCHAUTE DER erdfarbenen Strömung des Rheins hinterher und ließ es zu, dass sich sein Blick nach und nach in den Wellen verfing, bis alles vor seinen Augen zu schwimmen begann. Mit einer trotzigen Geste wischte er die Tränen weg, von denen die erste schon beinah sein schmales Oberlippenbärtchen erreicht hatte. Der siebzehn jährige Student saß in etwa zwei Metern Höhe rittlings auf dem abgespreizten Ast einer großen Eiche in den Auen vor der Stadtmauer Kölns, während die untergehende Sonne über das Wasser sprang und die Luft mit glitzernden Reflexen füllte.
Vorsichtig versuchte er, eine andere Position zu finden, um seinen im Lauf der Stunden steif gewordenen Körper zu entlasten. Es half nichts. Die Druckstellen blieben. Er warf einen halb flehenden, halb verärgerten Blick Richtung Himmel und konzentrierte sich wieder auf seine Arbeit. Das Rauschen des Windes nahm zu. Nach kurzem Zögern knüllte er das halb beschriebene Blatt auf seinen Knien zusammen und zog ein neues aus der Tasche, die an seiner Seite hing. Er legte es sorgsam auf das Buch, das ihm als Unterlage diente, und schrieb zum wiederholten Male: »8. September 1708«. Weiter kam er nicht. Süßlich poetische Zeilen schossen ihm wie Kometen durch den Kopf, beglückten seine Seele für einen kurzen Moment und ließen tief vergrabene Wünsche aus ihm hervorbrechen – bis sie in einem Akt freudloser Zensur verglühten. Nicht eine der Ideen genügte seinen Sehnsüchten. Diesmal wollte er endlich Worte finden, in denen sein Hoffen wahrhaftig gegenwärtig wäre, Worte, in denen er irgendwie das Unendliche, das ihn zu sprengen drohte, einfangen konnte, Worte, die wie ein Zauberspruch den Bann lösen und eine veränderte Welt hervortreten lassen würden.
Das Blatt blieb leer. Falls es solche Zeilen gab, hielten sie sich zumindest in diesem Moment verborgen und verwehrten dem jungen Mann ihre Kraft. Theodor, dessen blonde Locken ihm vom lauen Wind, der das Rheintal heraufzog, immer wieder ins Gesicht geweht wurden, biss so heftig auf seine Schreibfeder, dass sie zerbrach.
Kraftlos steckte der junge Mann die zerfransten Überreste in die zerklüftete Rinde des Baumes und griff dann mit zitternden Fingern in seine Tasche. Fast zärtlich zog er ein eingewickeltes Kreuz hervor und legte es frei. Es glänzte wie Elfenbein, als es die Sonnenstrahlen einfing. Seine Finger fühlten lange die Formen der Holzschnitzarbeit nach, in die er mit feinen, geschwungenen Buchstaben den Namen »Mariana« geritzt hatte. Die Enden des Kreuzes waren mit metallenen Beschlägen versehen, deren winzige Nägel über die glatte Oberfläche des Holzes zu wachen schienen. Ein Lächeln flog über das Gesicht Theodors; so verträumt war er, dass seine Augen bald nur noch in die Unendlichkeit starrten.
»Theodor! Bist du hier?«
Der Gerufene steckte das Kreuz blitzschnell in seine Weste, verbarg das Blatt mit den vergeblichen Liebesmühen zwischen den Seiten seines Buches und öffnete es an einer beliebigen Stelle.
»Theodor. Was machst du denn da oben? Wir warten auf dich!«
Es war, als klettere die Antwort erst mühsam den Baum herunter, ehe sie sich dem Frager zuwandte. Sie klang wie ein Seufzen: »Hallo, Ludwig. Ich lese.«
Der leicht schielende, schwarzhaarige Junge, der mit Theodor am Kölner Jesuitenkolleg studierte, zog seine Jacke aus, warf sie gewollt lässig über die Schulter und blickte hinaus auf das Wasser: »Was hältst du davon, runterzukommen und anständig mit uns zu feiern? Es ist nicht gerade höflich, was du hier tust. Du bist offiziell eingeladen.«
»Ich will nicht.« In der Stimme Theodors schwang Trotz mit: »Außerdem ist Plutarch viel zu aufregend.«
Ludwig hob langsam den Kopf: »Wie bitte? Du liest lieber antike Heldengeschichten, statt selbst welche zu erleben?« Er fing an, heftig zu winken: »He, es gibt ein Fest. Gute Laune, guter Wein, fantastisches Essen. Wann bekommen wir das schon? Und du Dickschädel beschäftigst dich mit den großen Taten heroischer Männer.« Er lehnte sich zurück, um hoch in den Baum schauen zu können, und schirmte dabei seine Augen gegen die Sonne ab: »Los, genug jetzt von Alexander dem Großen, Cäsar und Cicero. Vergiss die Toten und komm runter!«
Theodor schaute unverwandt in das Buch. Dozierend sagte er: »Du weiß selbst, dass Plutarch überhaupt keine Heldensagen verfasst hat. Er schreibt ganz klar: ›Ich erzähle keine Geschichten, sondern Lebensbilder, weil sich der Wert eines Menschen nicht in seinen großen Taten ausdrückt. Oft wirft eine unbedeutende Handlung, ein einzelnes Wort oder ein Scherz ein schärferes Licht auf den Charakter als Schlachten mit Tausenden von Toten, Zusammenstöße der mächtigsten Heere oder Belagerungskriege um einflussreiche Städte.‹« Endlich erbarmte er sich und schaute nach unten: »Ludwig, es geht um Vorbilder, um die wesentlichen Charakterzüge großer Persönlichkeiten. Bei Plutarch kann man lernen, was bedeutende Männer auszeichnet. Du siehst: Gerade du könntest von dem Priester aus Delphi einige Nachhilfe gebrauchen.«
Ludwig setzte sich mit dem Rücken gegen den Baum und streckte genüsslich die Beine aus, weil ihm die Streitgespräche mit Theodor allzu vertraut waren. Den Tonfall Theodors nachahmend, sagte er: »Bravo, du weiser Mann. Du kannst es ja sogar auswendig. Was für ein gelehriger Schüler. Aber vergiss nicht: Plutarch war nur sehr kurz in Delphi. Die meiste Zeit hing er in dem kleinen, elendigen Dorf Chaironeia in Boiotien herum. Offensichtlich haben ihm all seine Einblicke in das Wesen großer Heroen nicht besonders viel gebracht. Mann, Theodor, du bist ein Träumer.« Er unterdrückte ein hämisches Lächeln: »Ich hätte übrigens noch einen Anreiz für dich. Vielleicht möchtest du ja wissen, was der liebe Graf und Mariana gerade treiben.«
Bevor ihn das Buch schmerzhaft im Rücken traf, hatte sich Ludwig schon zusammengekrümmt und seinen Nacken schützend mit den Händen bedeckt. Er stand auf und sprang feixend um den Baum: »Na bitte! Du bist gar nicht im Gelehrtenhimmel verschollen. Es ist noch ein Stück Leben in dir. Sieh an! Der schlaue Theodor hat Gefühle. Ach, und was ist denn das hier?« Ludwig hob das Blatt auf, das beim Wurf aus dem Buch gerutscht war: »Du wolltest ihr einen Brief zu ihrem Namenstag schreiben. Vielleicht eine Liebeserklärung. Möchtest du es endlich wagen, dein Herz zu öffnen?«
»Hör auf!« Theodor erschrak über seinen eigenen Schrei. Verschämt sagte er: »Es hat doch alles keinen Sinn.«
Ludwig bog den Kopf in den Nacken: »Warum? Seit Wochen grämst du dich, dabei weißt du noch gar nicht, was sie für dich empfindet.«
»Das muss ich auch nicht. Ich weiß, was ich sehe. Sie liebäugelt mit diesem widerwärtigen spanischen Grafen, lacht über seine schäbigen Witze und ... kannst du mir erklären, warum er jetzt am Tisch an ihrer Seite sitzen darf?«
Ludwig hob das Buch auf und strich die Seiten glatt: »Warum? Weil er ein Graf ist. Und weil sein Vater dem Professor etwa dreimal so viel für die Unterkunft bezahlt wie unsere Eltern. Was willst du? Du bist eben nur ein kleiner Baron. So ist das Leben.«
Mit verkniffenem Gesicht beugte sich Theodor nach unten: »Nein, so ist das Leben nicht. Und wenn doch, dann darf es nicht so sein. Begreifst du? Es darf nicht sein, dass einem dahergelaufenen Grafen, dessen Intelligenz die eines ungepolsterten Stuhls nicht übersteigt, wegen seines dämlichen Titels die Gunst der Frauen zufällt. Der Kerl ist doch beschränkt.«
Der junge Mann wandte den Kopf in Richtung des Flusses, damit sein Freund die zurückkehrenden Tränen nicht bemerkte. Der aber hörte, wie brüchig die Stimme des Barons geworden war: »Du bist ja wirklich eifersüchtig. Ich dachte, dass das alles nur ein Spaß wäre.«
»Ein Spaß! Haha! Wenn das ein Spaß ist, dann habe ich nicht viel zu lachen. An meiner Eifersucht erkenne ich erst, wie heftig ich liebe. Ich vergesse Essen und Trinken, ich bringe die Nacht ohne Schlaf zu – und dieses Liebesfeuer, das mich verzehrt, bringt mich bald um. Verdammt noch mal, wäre ich als Prinz geboren, würde sie nur mich sehen.«
Ludwig schnipste eine vorwitzige Ameise von seinem Bein und sagte aufmunternd: »Wenn du ein Prinz wärst, dann hättest du sie wahrscheinlich gar nicht kennen gelernt. Und wenn eine Frau dich nur wegen deines Titels liebt, dann vergiss sie lieber gleich. So eine weiß gar nicht, was Gefühle sind.« Der Schalk überkam ihn wieder: »Übrigens: Hast du schon gehört, was der Graf Mariana geschenkt hat? Nein? Pass auf! Einen riesigen Blumenstrauß, Rosen in allen Farben, bunt, prall und mit einem betörenden Duft. Und weil die Rose ein Sinnbild Mariens ist, konnte er dieses, sagen wir mal, äußerst delikate Zeichen sogar in Anwesenheit ihres Vaters überreichen.«
Theodor stöhnte leise auf. Doch Ludwig bemerkte es nicht. Er genoss seine Schilderung: »Das Beste kommt erst noch. In der Blüte der schönsten Rose, einer kecken Floribunda, steckte ein riesiger Diamant. Der muss ein Vermögen gekostet haben. Ist das nicht abstoßend?«
Der Baron war blass geworden und hielt sich mit letzter Kraft an dem rauen Baumstamm fest. Er zog voller Ekel das Kreuz aus seiner Weste und warf es mit einem gequälten Laut auf den mit Steinen abgegrenzten Weg, wo es in mehrere Stücke zerbrach. Zart glänzten die Teile zwischen den Kieseln, als sprächen sie einen leisen Vorwurf aus. Sein Kommilitone schaute erst zu Theodor hoch, dann erhob er sich und sammelte die Stücke auf: »Was soll das denn? Warum hast du das gemacht?«
Der Baron lachte höhnisch auf: »Was meinst du, was Mariana denkt, wenn ich damit ankomme? Dieser Hundsfott schenkt ihr einen Diamanten und ich, ich bringe ihr eine banale Holzschnitzerei mit, ein bisschen Gekratze mit dem Messer. Meinst du, ich habe Lust, mich zum Gespött der Leute zu machen?« Er imitierte die hohe Stimme des Grafen:
»›O Theodor, was für ein großzügiges Geschenk, ein Stück Holz! Komm, wir legen es mal neben den Dia manten.‹ Ich könnte kotzen.«
Der Freund fügte die Bruchstücke in seiner Hand zusammen: »Das Kreuz ist einfach wunderschön. Theodor, du bist ein Narr.«
»Genau, ein Narr, der geglaubt hat, Mariana könne sich in den Spross eines enterbten Barons verlieben. Du hast Recht: So ist nun mal das Leben.«
Hilflos hielt Ludwig dem Verbitterten das Kreuz hin:
»Theodor, komm! Na los! Sie hat schon mehrfach nach dir gefragt.«
Der Baron legte demonstrativ die Arme übereinander und sagte mit einem Kratzen in der Stimme: »Gib mir bitte mein Buch, ich werde nicht gehen.«
Ludwig ließ die Überreste des Kreuzes in seine Hosentasche gleiten, hob eilig den Plutarch auf und trat damit ans Flussufer. Mit ausgestreckter Hand hielt er den Band über das Wasser:
»So! Du kommst jetzt runter und gehst mit mir zum Fest. Oder ich lasse deinen Lieblingsautor ins Wasser gehen.«
»Das wagst du nicht!«
Der Freund drehte sich einmal um sich selbst: »Hör mal zu, Theodor. Deine Mutter versucht alles, um dir diese Ausbildung zu ermöglichen. Ich weiß: In Münster ist der Herr Baron für seine rhetorische Begabung und seine Übersetzungen ausgezeichnet wor den – aber hier in Köln musst du die Spielregeln erst noch lernen. Und die lauten: Wenn ein Professor zum Namenstag seines Töchterleins ein Gartenfest ausrichtet, dann erscheinen die Studenten. Ist das klar?«
»Ich habe dir gesagt: Ich mache mich nicht lächerlich.«
Ludwig blätterte belustigt in dem Buch: »Mit welchem Helden soll ich anfangen? Welcher große Mann ist dir am wichtigsten? Wer soll zuerst in unserem herrlichen deutschen Rhein baden gehen? Wie wäre es mit Demosthenes?«
Er riss genüsslich eine Seite aus dem Buch und ließ sie in den Fluss fallen, wo sie, sich langsam im Kreise drehend, nach Norden gezogen wurde. Theodor schrie zornig auf, kletterte von seinem Ast und rannte hinter Ludwig her, der bereits lachend die Flucht ergriffen hatte.
Als die beiden jungen Männer um Atem ringend die lang gezogene Hecke des Gartens erreichten, war Theodors Wut verflogen. Neugierig sah er sich um. Die Festgesellschaft hatte sich schon im Garten verteilt. Die Älteren saßen unter den Bäumen an einem Tisch, der unter dem Aufgebot an Speisen fast zusammenzubrechen drohte, und die Jüngeren tollten auf der blumenbedeckten Wiese umher. Einige Dienstboten entzündeten gerade klobige Fackeln, die rundherum im Boden steckten.
Als Ludwig und Theodor näher kamen, hielt Eva, die jüngere Tochter des Professors, kichernd den Finger vor den Mund und hieß die beiden Neuankömmlinge, stille zu sein. In der Mitte der freien Fläche stand Mariana mit verbundenen Augen und versuchte, einen der Mitspieler zu erhaschen. Sie trug ein schlichtes Gewand mit Pagodenärmeln, das hinten wallend den Po bedeckte. Darunter konnte man wegen ihrer vielen Bewegungen die beiden am Mie der befestigten Röcke fliegen sehen. Der Saum des Manteaus aber hatte das gleiche Muster wie die Haube, unter der das dichte dunkelbraune Haar hervorschaute. Eva nahm Theodor an der Hand, und ehe er sich sträuben konnte, hatte sie ihn so in die Nähe Marianas geschoben, dass diese ihn mit ihren suchenden Händen ergreifen konnte. Siegessicher rief die junge Frau: »Ah. Ich habe jemanden. Nun, wer seid Ihr? Ich werde es gleich herausfinden.«
Theodor spürte, dass er über und über rot wurde, als ihre kleinen Hände geschickt sein Gesicht abtasteten und er sich der Blicke bewusst wurde, die ihn von allen Seiten musterten. Ihren eigenen Vater nachahmend, rezitierte Mariana mit dunkler, professoraler Stimme: »Mmh, weit auseinander liegende Augen, dichte Brauen, eine lange vorwitzige Nase, ein Schnurrbart ...« Die anderen Mädchen pressten feixend die Lippen aufeinander. »... wenn ich nicht wüsste, dass er mich versetzt hat, würde ich sagen: Ich habe Theodor von Neuhoff gefangen. Obwohl ...« Sie zog demonstrativ die Nase hoch: »Derjenige, den ich hier erwischt habe, riecht ein wenig nach, mmh ..., nach frischem Schweiß. Sehr interessant. Er muss es wohl sehr eilig gehabt haben, zu mir zu kommen.«
Siegesgewiss streifte sie die Binde ab und blitzte den Baron mit tiefgrünen Augen an, bevor sie ihm die Hand darbot. Eine zu laute Stimme schallte über die Schulter des Studenten: »Na, na, na! Frischer Schweiß. Ihr seid mir ja ein wilder Kavalier, von Neuhoff. Könnt es nicht erwarten und eilt herbei. Obwohl: Vielleicht ist ja auch ein wenig alter Schweiß dabei. Der Herr Baron liebt sein samtenes Jäckchen ja so sehr, dass er sich nie von ihm trennt.«
Ein belustigtes Prusten zog durch die Gruppe und erzeugte in Theodors Eingeweiden einen verheerenden Sog. Mariana dagegen reichte die Stoffbahn sanft lächelnd ihrer Schwester und sah den jungen Mann fragend an. Doch ehe sich die Blicke der beiden begegnen konnten, hatte sich der spanische Graf schon zwischen sie geschoben und den Arm des Mädchens ergriffen: »Liebste Mariana! Ihr habt mir den ersten Tanz versprochen. Ihr erlaubt doch, Baron von Neuhoff?«
Er gab den auf einer Bank sitzenden Musikanten ein Zeichen, zog die schlanke Frau an sich und drehte sie leidenschaftlich im Kreis.
Theodor begab sich mit Ludwig zur Festtafel, begrüßte seinen Professor und die übrigen Gäste und setzte sich mit einem Glas Rotwein in die Nähe der kleinen Streichergruppe, die gerade ein Menuett anstimmte. Wortlos stippte er ein Stück Brot in den Wein und steckte es gedankenverloren in den Mund. Ludwig hatte inzwischen Blick kontakt mit Eva aufgenommen und beachtete den Freund erst, als der anfing, mit dem Absatz Löcher in die Wiese zu bohren: »Was ist?«
Theodor druckste: »Guck sie dir doch an: Ich weiß, wie gern sie tanzt. Sie hat es mehrmals erwähnt. Und dieser Dummschwätzer von Graf kann es einfach zu gut. Guck doch, wie er sich bewegt. Kein Wunder, dass sie strahlt. Frauen lieben gute Tänzer.«
Ludwig stieß ihm aufmunternd in die Seite: »Dann fordere sie doch auf!«
»Ich? Mein Gott, ich kann überhaupt nicht tanzen. Jedenfalls nicht so.« Theodor zupfte nervös an seiner Jacke: »Ich kann gerade mal den Takt halten. Aber er, er kennt Tausende von Figuren. Ich weiß nicht, wie man richtig führt, und ich weiß nicht, wann und warum man den Grundschritt variiert. Wahrscheinlich verliere ich ohnehin alle Kraft, wenn ich ihr so nah bin.« Ein verächtliches Keuchen kroch aus seinem Mund: »Außerdem hast du ja gehört, was sie gesagt hat. Ich stinke. Ich stinke! Kann eine Frau einem Mann etwas Schlimmeres sagen? Es ist identisch mit ›unattraktiv, abstoßend, eklig, billig, ungepflegt, viehisch und ärmlich‹. Sie hat mir vor dem Grafen gezeigt, wo mein Platz ist: beim Pöbel. Und er, er darf ihre Wange mit der seinen berühren, ihren Rücken spüren und ihre Hand halten. Warum?«
Ludwig schnitt Eva eine Grimasse, die diese mit gebleckten Zähnen und rollenden Augen erwiderte. Dann nickte sie kurz mit dem Kopf Richtung Tanzfläche. Ludwig wollte aufstehen, aber Theodor hielt ihn am Rock fest. Er flüsterte: »Da! Siehst du! Guck es dir an: Jetzt tuscheln sie. Und schauen dabei andauernd zu mir her. Sie machen sich über mich lustig, sie amüsieren sich über den kleinen Stinkebaron. Hast du dieses Grinsen des Grafen bemerkt? Wie beschämend. Ich hätte nie gedacht, dass Mariana so hinterhältig ist. Ich kann doch nichts dafür, dass ich nur eine Jacke besitze. Bitte, Ludwig, lass mich jetzt nicht allein.«
Der Freund legte ihm die Hand aufs Knie: »Theodor! Ich bin beim Tanzen nur fünf Meter von dir entfernt – und ich komme gleich wieder. Weißt du was: Wenn das heute klappt, dann werde ich Eva bestimmt küssen dürfen. Und vielleicht erlaubt sie mir ja sogar einen kleinen Griff in ihren Ausschnitt. Mannomann, sind das herrliche Brüste. Sei ehrlich: Hätte Mariana dich erwählt, wärst du doch jetzt auch in ihren Armen.«
Er stand auf und lief zu dem aufreizend strahlenden Mädchen, das schon auf ihn wartete. Neckisch zog er die Nase nach oben und sah für einen Moment wie ein Wiesel aus. Eva schmiegte sich an ihn. Theodor aber konnte seine Augen nicht von Mariana und dem Grafen wenden, die leichtfüßig über die Wiese flogen, während er sich an seinem Weinkelch festhielt. Er fühlte sich immer unbehaglicher, versuchte mehrmals unauffällig, seinen eigenen Geruch wahr zunehmen, und entdeckte, dass er sich der aufsteigenden Verzweiflung nicht entziehen konnte. Wie eine Krankheit kam sie tief aus seinem Inneren, schlich sich in alle Glieder und verdrängte nach und nach die letzte Hoffnung. Er wollte schreien, doch es war keiner da, zu dem er hätte rufen können. Und in seinen Gedanken trugen zwei Schreckensbilder einen schmerzhaften Kampf aus: Da stritten »Mariana und der Graf, Wange an Wange« gegen »Mariana und der Graf, wie sie leise und erregt über ihn sprachen«. Theodor musste seine ganze Kraft aufbieten, damit ihm nicht wieder die Tränen in die Augen traten; sie flossen stattdessen in seine Seele.
Als er mit verhangenem Blick auf die Tanzfläche sah, löste sich Mariana gerade aus den Armen ihres Tanzpartners, der sie offensichtlich zu etwas ermutigte, und nickte schelmisch in seine Richtung, woraufhin der Graf äußerst süffisant lächelte. Theodor wurde von einer würgenden Angst gepackt, die mit jedem Schritt wuchs, den die junge Frau auf ihn zu machte. Er erhob sich, als sie vor ihm stand, und hörte sie wie in weiter Ferne sprechen:
»Baron! Wie soll ich denn das verstehen? Erst kommt Ihr zu spät und dann fordert Ihr mich nicht einmal auf. Ich habe noch niemals mit Euch getanzt. Kommt, lasst es uns probieren! Zeigt mir, wie viel Taktgefühl Ihr besitzt!«
Der junge Mann vernahm die Worte, doch in seiner Fantasie verzog sich der fröhliche Mund der erregten Frau zu einer triumphierenden Fratze, die ihn vor allen der Lächerlichkeit preisgab. Sie konnte es nicht ernst meinen. Es war, als filtere seine Angst alle Schönheit aus dem Leben, er musste schlucken und durfte doch nicht. Ohne ein Wort zu sagen, drehte er sich um und lief vor seinen Tränen davon.
Es war längst dunkel geworden, als Theodor die aufsteigende Gasse zum Haus des Professors erreichte. Er war stundenlang ziellos durch die Rheinauen gezogen, verletzt und mit der entschlossenen Wut eines Menschen, der sich in die Enge getrieben fühlt. Ihn fröstelte, denn mit dem Mond stieg an diesem 8. September auch die erste herbstliche Kälte aus den Wiesen und erkundete klamm die Innenstadt. Weil die Fledermäuse auf der Promenade immer frecher um seinen Kopf geflogen waren, hatte sich der Baron der Frage entzogen, die ihn verfolgte: »Wie sollte ich Mariana jemals wieder unter die Augen treten?« Seine Verzweiflung war im Lauf der Stunden einer betäubenden Leere gewichen, die sich festzusetzen drohte.
Als Theodor den Schlüssel zur Haustür aus der Tasche zog, hörte er hinter sich ein verhaltenes, schabendes Geräusch. Instinktiv zog er seinen Degen und ging in den Grundschritt. Ein leises Pfeifen zog durch den Vorgarten. Dann kam eine ruhige Stimme aus der Dunkelheit: »Lieber Baron von Neuhoff. Nicht so hitzig.« Der Sprecher sog die frische Luft ein, als könne er sich daran berauschen. Weich sagte er: »Ihr hättet auf dem Fest etwas mehr Feuer zeigen sollen. Jetzt und hier ist es überflüssig.« Theodor entdeckte unter dem Kirschbaum die aufglimmende Spitze einer Zigarre und erahnte in der winzigen Lichtquelle die Umrisse des Grafen. Der löste sich langsam aus dem Dunkel und hob grüßend die Hand: »Ihr habt Euch heute ziemlich töricht benommen, Baron. Und Mariana ...«
»Schweigt!« Wilder Hass stieg in dem Angesprochenen auf. Erregt ließ Theodor den Schlüssel zurück in die Tasche gleiten und zog seine Jacke aus: »Das genügt!« Er presste die Sätze hervor: »Erst beleidigt Ihr mich, indem Ihr verkündet, dass ich rieche, und jetzt nennt Ihr mich einen Dummkopf. Glaubt Ihr, dass Euer Titel Euch alle Unverschämtheiten erlaubt? O nein! Zieht Euren Degen!«
Der spanische Graf wich zurück. Seine Bewegungen zeigten erstmals Unsicherheit. Bewusst beherrscht sagte er: »Baron, hängt nicht an die Fehler von heute Abend noch einen weiteren dran. Ihr habt Euch da in etwas verrannt. Es geht hier doch gar nicht um meine möglicherweise etwas saloppen Worte. Das war ein Spaß, den Ihr mir sicher vergeben werdet. Ich bitte Euch: Lasst uns in Ruhe darüber sprechen, was Mariana und ich ...«
Theodor ließ seinen Degen mehrmals durch die Luft kreisen. Die Worte sprangen jetzt unter größter Anspannung aus seinem Mund: »Ich wusste es: Ihr seid ein Feigling, ein Prahlhans und ein Charakterschwein. Ohne Euch wäre die Welt ein wesentlich schönerer Ort. Schlagt Euch mit mir!«
Noch während er sprach, näherte sich der Baron seinem Gegner, und nur Sekunden später trafen die Klingen aufeinander.
Da der Graf sich offensichtlich nur verteidigte und nicht ernsthaft kämpfte, geriet Theodor immer mehr in Rage. Verbissen hieb er auf den Adligen ein, der, während er die Angriffe parierte, immer wieder energisch bat, den Kampf zu beenden. Doch der beleidigte junge Mann legte all den angestauten Zorn in seine Hiebe und ließ sich nicht beirren. Minutenlang waren nur noch das Ächzen der Fechter und das harsche Klirren der Degen zu hören. Je weiter der Baron den Grafen in die Dunkelheit unter den Bäumen trieb, desto schwerer wurde es für beide, die Ausfälle des anderen überhaupt zu sehen.
Vom metallenen Schlagen der Waffen geweckt, entzündeten mehrere Bewohner der nahe liegenden Häuser Kerzen, doch als sich auch noch eine Wolke vor den Mond schob und endgültig alle Dinge ineinander flossen, ließ Theodor verärgert den Degen sinken. Ein letztes Mal, in einem abschließenden Auflodern seiner Aggression, stach er wahllos in die Dunkelheit – und spürte, wie sein Degen tief in das Fleisch des Grafen eindrang. Wie ein Messer, das in den Sand gesteckt wird. Erschrocken ließ Theodor die Waffe los, als der Körper schwer neben ihn auf den Boden fiel.
Wie erstarrt hörte der Baron die fahle Stimme des Verwundeten: »Neuhoff, Idiot. Mariana liebt Euch. Keinen sonst. Ja, ich war an ihr interessiert, aber beim Tanzen hat sie mir endgültig einen Korb gegeben. Weil sie nur Euch will. Sie hat so verdammt verliebt von Euch gesprochen, dass ich selbst sie gebeten habe, mir das zu ersparen und zu Euch zu gehen. Und Ihr, Ihr habt alles kaputtgemacht – durch Eure Angst vor Euch selbst.«
Zitternd floh Theodor in die Nacht. Ohne noch einmal sein Quartier zu betreten, rannte er davon und verließ die Stadt nur mit dem, was er am Leibe trug. Drei Wochen später erreichte er die Wohnung seiner Mutter in Paris, nachdem er, um seine Spuren zu verwischen, mit dem Schiff rheinabwärts nach Rotterdam gefahren war. Elisabeth, seine Schwester, überreichte ihm einen Brief Ludwigs, in dem dieser dem Freund mitteilte, dass der spanische Graf tatsächlich seiner Verletzung erlegen war und Mariana, als sie die Teile des Holzkreuzes erhielt, diese zärtlich geküsst und anschließend verzweifelt geweint hätte.
{{{
Lord Kilmarnok blieb abrupt stehen. Isabelle, die sich beim Reden seinen schnellen kleinen Schritten angepasst hatte, kam aus dem Tritt und musste sich an seinem Arm festhalten: »Was ist los?« Sie versuchte in der Dunkelheit seine Augen zu finden, doch es gelang ihr nicht.
Der Adlige starrte die Straße hinunter: »Ich wusste das alles nicht!«
»Das kann sein. Soweit ich weiß, hat er nicht einmal seiner Mutter davon erzählt.«
Heftig packte der Mann seine Begleiterin mit beiden Händen an den Oberarmen und zog sie vor sich. Sein Unterkiefer zitterte leicht: »Ach, und jetzt plötzlich rückt er damit heraus. Woher weißt du eigentlich, dass das Ganze nicht eine seiner bekannten überdrehten Lügen ist? Wahrscheinlich wird dieser Scharlatan am Ende seines Lebens sentimental und sucht nach einer Rechtfertigung für sein verkorkstes Dasein. Abgesehen davon: Du hast doch selbst gesagt, dass er inzwischen öfter wirr spricht und Personen nicht erkennt.«
Ruhig löste Isabelle ihre Arme aus dem Griff des Lords. Müde sagte sie: »Ich muss jetzt nach Hause. Der König will mich heute Nacht noch einmal sehen. Ich glaube, dass er Angst hat zu sterben, bevor er alles erzählen konnte. Das ist die Realität, die ich sehe. Ob er mir die Wahrheit erzählt, kann ich nicht sagen. Ich bin allerdings gar nicht sicher, ob Ihr überhaupt etwas anderes hören wollt als Eure eigene Wahrheit. Und genau so etwas hasse ich: Menschen, die zwar diskutieren wollen, aber nur dann zufrieden sind, wenn man sie bestätigt.« Ihre Augen blitzten in der Dunkelheit auf, als sich das Licht einer Laterne darin spiegelte: »Ich weiß nicht, woher Euer Hass kommt, aber eines weiß ich: Ihr kennt den König nicht.«
Lord Kilmarnok konnte das Lächeln nicht sehen, das ihre Lippen weitete, aber er spürte es in ihren Worten: »Ach, um Euch wegen des Wahrheitsgehaltes zu beruhigen: Ludwig, der damalige Studienkollege, hat 1736, im Jahr der Krönung seiner Majestät, ein Büchlein über das unselige Duell veröffentlicht. Komisch, oder? Damals wollten sie alle an seinem Ruhm verdienen, all die vielen Freunde und Bekannten, heute, zwanzig Jahre später, kommen solche unwissenden Leute wie Ihr daher und machen einem alten, unglück lichen Mann schwere Vorwürfe. Ihr, der Ihr alles habt, was man sich wünschen kann, wollt einem verarmten und verbitterten Träumer die letzten Tage rauben! Ich frage mich, ob nicht Ihr der Kranke seid.« Isabelle streckte ihm die Hand entgegen: »Ich bekomme ein Pfund von Euch!«
Lord Kilmarnok zog nachdenklich seinen Geldbeutel aus der Weste und legte eine Münze auf die geöffnete Handfläche der jungen Frau, die das Geld direkt in ihrem Korsett verschwinden ließ. Dann drehte sie sich um. Doch die Stimme des Mannes hielt sie noch einmal zurück: »Ich möchte auch wissen, was er dir heute Nacht erzählt!«
Eine weiche Trauer legte sich auf ihr Gesicht: »Warum? Wenn Ihr doch ohnehin der festen Überzeugung seid, dass er lügt.«
Der Lord ging einen Schritt auf sie zu. Er sagte unsicher: »Ja! Ich weiß noch nicht, ob ich ihm glauben kann, aber ich stimme Plutarch zu: Vielleicht versteht man einen Menschen wirklich nur dann, wenn man neben den äußerlichen Kennzeichen seines Lebens die verborgenen Züge seines Wesens erblickt, wenn man – unabhängig von allen Gefühlen – anfängt, eine Beziehung aufzubauen. Es stimmt: Ich weiß alles über die großspurigen Taten, die leeren Versprechungen und die bösartigen Intrigen dieses Mannes, der ja wohl zu Recht als Erfinder des ungedeckten Schecks bezeichnet wird. Aber ich frage mich seit so vielen Jahren, warum er das alles getan hat. Ich frage mich das so sehr, dass es zu meiner eigenen Frage geworden ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst: dass eine Frage derart nach einer Antwort giert, dass das Leben sich völlig darauf ausrichtet. Sag mir, kennst du das, dieses ›Ich muss es wissen‹?« Er schüttelte sich, als könne er die Anspannung dadurch vertreiben: »Ich dachte, ich könnte das ›Warum?‹ in mir töten, wenn ich ihn töte. Aber jetzt wird mir klar, dass diese Frage mir weiterhin die Kraft rauben wird. Bitte hilf du mir, eine Antwort zu finden.«
Isabelle zögerte: »Ich weiß nicht, wie viel er mir heute noch erzählen wird. Vielleicht soll ich auch nur zu ihm kommen, um ihm vorzu lesen.«
»Das ist mir gleich. Ich werde mich morgen mit dir treffen.«
In einem der Häuser fing ein Paar an zu streiten und ihre erbosten Schreie brachten die junge Frau zum Lachen. Sie suchte in den Fassaden nach der Quelle der Laute und sagte freundlich, aber bestimmt: »Ich kann morgen nicht. Ich habe zu viel zu tun: Ich muss neue Muster entwerfen, ich muss dem König zuhören und ich brauche Zeit, um all das aufzuschreiben, was er mir erzählt. Es geht nicht.«
Lord Kilmarnok deutete auf ein schwach erleuchtetes Fenster im dritten Stock, auf dessen Vorhang sich das undeutliche Schattenspiel der Streitenden bewegte. Behutsam fragte er: »Was ist mit morgen früh?«
»Da gehe ich um fünf zum Fischmarkt nach Billingsgate. Ich nehme nicht an, dass ein Mann wie Ihr um diese Zeit auf den Beinen ist.«
Er zog den Hut: »Ich werde da sein!«
»Nein, das werdet Ihr nicht!« Drohend kamen diese Worte aus der Dunkelheit, so dass die beiden zusammenfuhren. Verwundert starrten sie in die Richtung, aus der sich, mit jedem Schritt deutlicher zu erkennen, Jizchak den beiden näherte. Der Jude grummelte etwas Unverständliches vor sich hin, dann mischte sich Erleichterung in seine hohe, enge Stimme: »Gott sei Dank! Isabelle, hier bist du. Wir haben uns unglaubliche Sorgen gemacht. Schascha hat uns gesagt, dass du allein mit diesem Wahnsinnigen unterwegs bist.«
Er hielt sich die Seite und atmete schwer: »Ich habe mir schon Vorwürfe gemacht, dass ich einfach davongerannt bin, um meine Sensationsgier zu befriedigen. Das war unüberlegt und egoistisch. Verzeih mir. Ich dachte, dass Philipp bei dir wäre. Jedenfalls sind wir alle erschrocken, als wir hörten, dass du mit … mit dem da … weggegangen bist.«
Der alte Mann baute sich vor Lord Kilmarnok auf und sah ihn drohend an. Da er ihm trotz des hochgereckten Kopfes nur bis zum Kinn ragte, musste die junge Frau unwillkürlich lächeln. Der Jude blitzte sie mit seinen Augen an: »Lach nicht. Dein Vater und Philipp ziehen auch durch die Straßen, um dich zu suchen. Wer weiß, was so einer wie der da mit dir anstellt?«
Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, hielt er seinen Arm mit dem verbundenen Streifschuss wie eine Trophäe hoch. Dann wurde sein Blick milder: »Nun gut, wie ich sehe, ist ja nichts passiert. Isabelle, Albrecht möchte nicht, dass du diesem Mann so viel über den König erzählst. Wer weiß, was er wirklich will. Und Ihr, Ihr schießwütiger ... Mensch: Lasst uns bitte in Ruhe. Ich bete zum Herrn, dass Eure Seele Frieden findet.«
Jizchak nahm Isabelle am Arm und zog sie mit sich. Nach einigen Schritten drehte die junge Frau noch einmal den Kopf und warf Frederik einen herausfordernden und zugleich fragenden Blick zu, in dem unbändige Lebenslust loderte. Als die beiden verschwunden waren, faltete Lord Kilmarnok seinen Schirm zusammen, hob den Kopf und ließ den kalten Regen auf sein zerschlagenes Auge laufen, das angefangen hatte zu pochen. Wäre Felix dort gewesen, er hätte gewusst, dass sein Herr soeben sein Herz verloren hatte.
III.
Madame hier, Madame da! Oh, es hat mir wirklich gut getan, sie zu verachten: Elisabeth Charlotte, das dicke Elend. In ihrer prallen Hilflosigkeit wurde sie mein größter Ansporn, mich weiterzuentwickeln. Denn wenn ich eines nicht sein wollte, dann so herausgeputzt verloren wie sie. Alles an ihr zeugte trotzig davon, dass ihr Leben eine einzige Enttäuschung war: die Ernüchterung über ihren homophilen Ehemann Philipp, den jüngeren Bruder des Sonnenkönigs, der sein Vermögen immer wieder aufs Spiel setzte und sie in eine desaströse Einsamkeit zwang, die Scham über den Verlust ihrer bodenständigen Heidelberger Heimat, die sie gegen die aufgeblasene Hülle des Pariser Hofes tauschen musste, die Verweigerung der vielen Pfunde, ihre ausladenden Hüften zu verlassen, und die frustrierende Erkenntnis, dass sich letztlich das ganze Leben als ein Spiel entpuppte, dessen Ausgang niemanden interessiert außer den Spieler selbst. Ich habe sie gehasst, und das hat mich stark gemacht. Positive Vorbilder sind wertlos, denn sie erzeugen nur billige Imitate – negative Bilder dagegen, markante Darstellungen des Unschönen, zwingen den Beobachter dazu, sich sein eigenes Profil zu erarbeiten. Vielen Dank, altes Ekel.
Wenn einer – wie diese Frau – nur noch die Enttäuschung kennt, dann bleibt ihm nichts anderes übrig, als sie zu kultivieren. Wer in seinem Leben keinen Sinn findet, erklärt das letzte bisschen Elend, das ihm bleibt, zum Sinn. Und so fing auch Madame an, ihre Desillusionierung, diese abgründige Entzauberung ihres Daseins, selbst zu verzaubern. Sie schmückte das Fiasko prächtig aus, setzte es auf einen goldenen Thron und huldigte ihm mit einer Hingabe, die sie möglicherweise einem wirklichen Daseinsgrund niemals hätte zuteil werden lassen. Erregt schwelg te die eitle Herzogin von Orleans im Kummer, huldigte ihrer Verbitterung frenetisch und zelebrierte ihr Leiden wie einen Gottesdienst: eine Priesterin der ekstatischen Verzweiflung. Ich habe sie beobachtet, forschend und ahnend, und ich glaube, dass ihr mein Wissen zuwider war, denn sie behandelte mich all die Jahre distanziert.
Andererseits: Zu wem war sie nicht distanziert? Weil ihr das reale Leben zwischen den Fingern zerrann, schrieb sie alles auf, was es festzuhalten gab. Ihre blumigen Briefe, die Briefe der Liselotte von der Pfalz, haben sie, wie ich vor kurzem hörte, inzwischen berühmt gemacht. Seltsam. Da ist es dieser frustrierten Kuh, die aus ihren sicherlich vorhandenen Talenten und Möglichkeiten nichts, aber auch überhaupt nichts gemacht hat, in einer ironischen Laune des Schicksals gelungen, ihr Versagen in ein sinnstiftendes Ziel zu verwandeln. Siebzig Jahre hat sie ihr Hass auf das Leben am Leben gehalten und ihr dabei geholfen, für andere zum Segen zu werden.
Der Graf von Montague, ein Verehrer meiner Mutter und ein Ehrenkavalier von Madame, führte uns am Pariser Hof ein. Und wie es häufig bei desillusionierten Menschen ist: Die Herzogin fand Gefallen an unserem Leiden. Sie verschaffte uns eine äußerst großzügige Wohnung in der Nähe des Palais Royal und versorgte meine Schwester Elisabeth mit einer Mitgift von zweihunderttausend Franken, die es ihr ermöglichte, den Grafen von Tre veaux zu heiraten. So hatte es wenigstens eine aus unserer Familie geschafft, eine Verbesserung ihres Standes zu erreichen. Mir, dem nicht fertig ausgebildeten Flüchtling, gab Madame ohne viel zu fragen eine Stelle als Page in ihrem Haus. Ich bin sicher: Es war ihr ein besonderes Vergnügen, uns freigebig zu helfen. Und als meine Mutter in zweiter Ehe den Zollpächter Marneau heiratete und nach Metz zog, war die Herzogin sichtlich gekränkt, dass ihr damit der Triumph entging, diese leidgeprüfte Frau mit einem Adligen zu verbinden. Wir waren ihre Spielfiguren – so wie sie selbst eine Spielfigur war. Wir alle behandeln die Menschen um uns herum so, wie wir selbst behandelt worden sind, ganz gleich, ob wir das wollen oder nicht.
Auch Enttäuschung braucht Formen, und so baute sich Madame ihren »Ersatzsinn« zu einem Ersatzleben aus: Die von ihrem Mann verweigerte Liebe fand sie bei ihren sieben Hunden, die ich regelmäßig ausführen musste, das für sie selbst unerreichbare Schönheitsideal verkörperten ihre unzähligen Vögel und die überall hervorquellende Langeweile vertrieb sie mit wilden Parforcejagden und schwelgerischen Einladungen. Ihr Tag war so angefüllt mit Verabredungen, Veranstaltungen und anderen gesellschaftlichen Pflichten, dass ihr keine Zeit blieb, sich mit dem Übel der Leere, die in ihren Eingeweiden wütete, zu beschäftigen. Und so wurde sie, ganz gegen ihre Absicht, zu einem Kind ihrer Zeit, das sich im höfischen Benehmen eine Trutzburg gegen die Gefahr der Alltäglichkeit bauen wollte.
Nur eines hat Madame immer zurückgewiesen: den Verfall der Sitten; etwa diese Kleider, die den Busen herausdrücken statt ihn zu verdecken, und die Selbstverständlichkeit, mit der man sich einen Liebhaber hielt. Doch auch in diesem Punkt folgte sie wohl mehr ihrem Groll gegen das ausschweifende Leben ihres Mannes als einem eigenen Moralkodex. Das Leben von Elisabeth Charlotte war eine einzige Reaktion, nie hat sie etwas aus sich heraus getan, sie folgte ihren Verletzungen und Ängsten.
In meiner Zeit als Page habe ich alles aufgesogen, was man über das Dasein bei Hofe wissen muss. Ich lernte – endlich – richtig zu tanzen, fand heraus, welche Floskeln man wann sagen sollte, wenn man bestimmte Erfolge erzielen will, wandelte immer sicherer über das glatte Parkett der Etikette, verbesserte meinen Umgang mit dem Degen und der Pistole, begann, nett zu plaudern und dabei kleine, aber feine Intrigen zu spinnen, führte berühmte Gäste durch die üppigen Gärten und die weiten Gänge des Schlosses und entlockte ihnen nach und nach alle Geheimnisse der höfischen Diplomatie.
Ich habe schnell erkannt, dass ich den Makel meiner niederen Geburt nur mit Wissen ausgleichen konnte. Und so stürzte ich mich atemlos in diese fremde Welt, eroberte sie im Sturm und beherrschte ihre Spielregeln nach kurzer Zeit besser als manche der in ihr Geborenen. O ja, ich genoss die sich daraus entwickeln de Macht wie eine Droge. Bald konnte ich mit den Konventionen und Gepflogenheiten des Hofstaats derart versiert umgehen, dass ich mir bereits gestatten durfte, sie zu untergraben. Da man mich als exzellenten Vertreter des Kodex kannte, durfte ich mir erst winzige, dann immer größere Übertretungen erlauben. Alles, was dem Spiel Spannung verlieh, war gestattet.
So wurde ich ein Meister des schönen Scheins, brillant, strahlend – und meiner Falschheit wohl bewusst. Doch im Lauf der Jahre verwischten die Grenzen und ich verlor den Überblick da rüber, wo denn ich und wo die Kunstfigur Theodor begann. Und wenn ich anfangs den Menschen, von denen ich mir Förderung erhoffte, sehr bewusst nach dem Mund redete, war es mir bald zu einer zweiten Natur geworden, meinem Gegenüber genau das zu sagen, was es hören wollte. Ich roch förmlich, wonach es diesem gelüstete, denn ein Mensch dünstet seine Wünsche gleichsam aus. Es ist wirklich befriedigend, das Strahlen in den Augen eines Mannes oder einer Frau zu sehen, die gerade in ihrem tiefsten Wollen bestätigt wurden. Wer es lernt, Menschen auf sich selbst stoßen zu lassen, der hat immer Freunde. Na ja, soweit man in diesem Metier von Freundschaft sprechen kann.
Welch ein Glück, dass ich eines Tages, sehr viel später, die Frau traf, die mich wieder aus dem Strudel der Verlogenheiten herausziehen konnte. All die Jahre habe ich über Liselotte und ihr Ersatzleben gespottet, heute frage ich mich, ob ich nicht auch nur ein Ersatzleben geführt habe. Julia, du weißt das doch. Du kannst doch hinter meine verquollenen Gedanken schauen. Das konntest du vom ersten Augenblick an. Bei dir war ich plötzlich ich – völlig überrascht, dass es so etwas in mir gibt. Julia, wie gut habe ich es bei dir. Julia, ich werde dir noch viel erzählen müssen, damit dieser Brief ihm deutlich macht, was mit mir passiert ist. Aber bevor ich erzähle, lies mir noch ein paar Seiten vor, vielleicht nur ein paar Zeilen. Sie sind so ... so verlockend. Julia, kommst du?