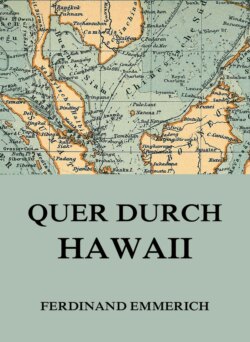Читать книгу Quer durch Hawaii - Ferdinand Emmerich - Страница 4
Quer durch Hawaii Erstes Kapitel.
ОглавлениеMein Kurs lag ostwärts. Meine Aufgabe war nahezu erfüllt. Noch blieb mir die Durchquerung der Insel Hawaii, dann winkte mir eine längere Ruhepause. Wie sehr ich mich nach einer solchen sehnte, kann nur der ermessen, der sich in die Lage eines Menschen hineinzudenken vermag, der über ein Jahr lang alle die kleinen Bedürfnisse entbehren mußte, die nun einmal die Kultur dem Manne anhängt. Viele Monate hindurch sah ich kein Bett. Der harte Boden, mit einer Schicht Blätter als Unterlage, dazu den weiten Himmel als Dach über dem müden Haupte, vertrat die Stelle eines Nachtlagers. Halbgares, halbverbranntes Fleisch, mit großen Schwierigkeiten beschafft und oft unter Lebensgefahr am Feuer geröstet, bildete die Kost, wenn nicht die Nähe mordgieriger Eingeborener uns auch diesen Leckerbissen verwehrte. Unsägliche Strapazen, über schroffe Gebirgszüge, durch nie von Menschen betretene Urwälder, durch Sümpfe und über verdorrte Steppen führende, fluchtartige Wanderungen, dazu Hunger und Durst, verschärften die täglich wiederkehrenden Anforderungen an unsere Willensstärke – und nun winkte die Ruhe.
Celebes lag hinter mir. Einen Teil meiner Erlebnisse auf jener Insel findet der Leser in den Schilderungen meines fünften Bandes. Jetzt stand ich auf dem Deck eines deutschen Frachtdampfers, der mich nach Hawaii bringen sollte. Ich wählte in Yokohama diesen schlichten Landsmann aus der Mitte der amerikanischen, englischen nnd kanadischen Luxusdampfer, um wieder einmal einige Wochen heimatliche Laute unvermischt zu hören, um wieder einmal derbe deutsche Schiffskost zu genießen.
Kapitän Michelsen machte anfangs Schwierigkeiten, mich auf seinem Dampfer »Schleswig« als Passagier mitzunehmen. Nicht allein, weil dem Schiffe die Einrichtungen für Fahrgäste fehlten, sondern in echt deutscher Rücksichtnahme auf das, was die Agenten der großen Dampferlinien wohl dazu sagen würden ... Durch Überredung und mit freundlicher Unterstützung des in Japan ansässigen Großkaufmanns Vogel brachte ich jedoch den guten Michelsen dahin, daß er mich der Form wegen unter seine Mannschaft einreihte – als Kajütsjunge! Damit war die Rücksichtnahme auf Engländer, Amerikaner und die schlitzäugigen Japanesen untertänigst gewahrt (o Michel!), und ich durfte mitfahren.
Nach viertägigem herrlichen Wetter suchte uns eine »gute« Brise auf. Sie sorgte ausgiebig dafür, daß mich die Langeweile verschonte. Der wind nahm den Mund ordentlich voll und legte sich fest in die schwellenden Segel, die damals noch von allen Dampfschiffen geführt wurden. So, unter dem Druck von Segel und Dampf, liefen wir in guter Fahrt durch die mehr und mehr auflaufende See. Der langentbehrte Genuß eines in wildem Zorne aufschäumenden Weltmeeres bannte mich fast ununterbrochen auf das Deck, und freudig legte ich Hand mit an, als gegen Mitternacht die Kraft des Windes den Kapitän zwang die meisten Segel fortzunehmen.
Gegen Morgen hatten wir einen richtigen Sturm. Hoch auf die Spitze der Wellenberge kletterte die kleine »Schleswig«, um gleich darauf sausend in ein tiefes Tal hinabzutauchen. In allen Fugen knarrte und ächzte das wackere Schiff, und einem mutigen Renner gleich schüttelte es die schweren Wogen von seinem Rücken, die ihm die gierige See in seinem unaufhaltsamen Laufe ostwärts freigebig spendete.
Mittags lief ein großer englischer Australiendampfer an uns vorbei. Ein gewaltiger Bau gegen unsere kleine »Schleswig«. Aber auch er mußte sich dem gewaltigen Ozean beugen. Heftig rollte er von einer Seite auf die andere, und das leere Deck bewies, daß die Fahrgäste der Seekrankheit zum Opfer gefallen waren.
Fast zwei Stunden lang konnten wir den Engländer vor uns dahintanzen sehen. Dann änderte er plötzlich seinen Kurs etwas südwärts, und wir bemerkten nun ein Fahrzeug, das sich allem Anscheine nach in Seenot befand. Da das Segelschiff fast recht im Kurse des Australiendampfers lag, konnte man sich bei uns dessen Fahrtänderung nicht recht erklären. Kapitän Michelsen sprach kopfschüttelnd sein Befremden über das Manöver aus. Ich aber war in der Lage, eine Erklärung für diese Handlungsweise zu geben. Hatte ich doch – wie ich das in meinem ersten Bande schilderte – am eigenen Leibe die Menschenfreundlichkeit der Engländer erfahren. Ich sagte den Schiffsgenossen den Hergang voraus:
»Geben Sie acht, Kapitän! Der Dampfer da vor uns rührt keine Hand, um dem andern beizustehen. Im Gegenteil, er geht südwärts, um sich zu drücken!«
»Nein, das glaube ich denn doch nicht!« erwiderte Hilmer, der erste Offizier, der mit dem Glase angestrengt nach dem notleidenden Fahrzeug ausgespäht hatte. »Es ist ein Engländer. Ich sehe die Notflagge und die Landesfarbe. Dem wird der Postdampfer sicher Hilfe leisten!«
»Warten Sie es ab!« antwortete ich. »Der Kerl weiß genau, daß wir ihm die Rettung abnehmen, obgleich wir mit uns selbst genug zu tun haben. Sehen Sie nur wie er nach Süden abfällt! Lieber riskiert er ein paar eingeschlagene Fenster, als daß er ein halbes Dutzend Menschenleben dem Verderben entreißt. Die Scheiben zahlt die Versicherung. Ob er für die Nahrung der paar Seeleute eine Vergütung erhält, weiß er noch nicht! Da nimmt er lieber das sichere. Was liegt dem an ein paar Menschen!?«
Die beiden Deutschen sahen mit steigendem Grimm dem abtreibenden Postdampfer nach. Jetzt hätte er Rettungsmanöver einleiten müssen, denn er befand sich in gleicher Höhe mit dem notleidenden Segelschiffe. Unsere gesamte Mannschaft verfolgte gespannt den Kurs des großen Dampfers. Rufe der Erwartung wurden laut ....
Da entrang sich den Lippen des ersten Offiziers eine harte Verwünschung:
»Bei Gott, Sie haben recht!« schrie er, schäumend vor Wut. »Der Hund läßt seine eigenen Landsleute ertrinken! Daß dich doch ....« Das Ende der Rede verschlang die heulende Windsbraut.
Kapitän Michelsen sprang auf das Deck hinunter.
»Klar bei den Booten!« schrie er, den Sturm übertönend. »Freiwillige vor, zur Rettung der Barkbesatzung!«
Während die Mannschaft die Vorbereitungen traf, richtete der kleine »Schleswig« seinen Bug auf die Leeseite des Wracks. Zwar warf uns der Sturm mit zermalmender Gewalt so in der wilden See umher, daß wir oft an den eigenen Untergang dachten. Aber trotzdem gab es keinen Mann an Bord, der es nicht für selbstverständlich hielt, daß das eigene Leben zur Rettung der notleidenden Seeleute gewagt werden mußte.
Wir erkannten bald mit bloßem Auge, daß das hilfesuchende Schiff in leckem Zustande war. Der Großmast war über Bord gegangen und gekappt. Vom Fockmast fehlte der ganze obere Teil. Klüverbaum und Vordergeschirr trieb neben dem Schiff in der See. Das Rettungsboot fehlte. Wie ein Ball flog das Fahrzeug in der hochgehenden See auf und nieder, und schwere Wogen wuschen über das Deck. Jede neue Welle konnte das Ende der Bark besiegeln.
Unser zweiter Offizier Vahsel unternahm das Wagnis mit dem Zimmermann und fünf Matrosen, die mit dem Tode ringenden Seeleute von ihrem sinkenden Schiffe zu holen. Lange dauerte es, bis das Rettungsboot eine günstige Woge erhaschte, die es unversehrt von unserm Dampfer fortbrachte. Eine herankommende Welle würde es unfehlbar an unserer Seite zerschmettert haben.
Atemlos folgten wir dem dahingleitenden Fahrzeuge, in dem sieben brave deutsche Männer dem Tode trotzten, um in heldenmütigster Weise ihren notleidenden Kameraden Hilfe zu bringen. Mit welchen Gefühlen müssen die Schiffbrüchigen ihrem eigenen Landsmanne nachgeblickt haben, als er sie schnöde im Stiche ließ, und welche tiefe Dankbarkeit mag in jenem Augenblick die Seele der Armen erfüllt haben, als sie das kleine Boot des winzigen deutschen Dampfers auf sich zukommen sahen – jetzt hoch auf der Spitze einer Woge balanzierend, jetzt hinabgeschleudert in ein tiefes Wellental.
Wir hatten uns dem Wrack allmählich so genähert, daß wir mit dem Fernglase die Mannschaft zählen konnten. Es waren neun Mann, die sich, an den Maststumpf und andere Schiffsteile angebunden hatten, während das Schiff von der schäumend darüberhin brechenden See bald auf die eine, bald auf die andere Seite geworfen wurde.
Unser Boot war nach unsäglichen Mühen der Bark so nahe gekommen, daß eine Verständigung möglich wurde. Wir bemerkten, wie die Mannschaft der Bark einen runden Gegenstand, an dem Taue befestigt waren, über Bord warf, der von unserm Boote aufgefischt wurde. Damit war die Verbindung hergestellt. Nun sahen wir einen Rettungsgürtel von dem Boote abtreiben, der an dem Tau auf die Bark gezogen wurde. Der Schiffsjunge des Wracks sprang, angetan mit dem Schwimmgürtel, als erster ins Meer. Wild schlugen die Wellen über dem kleinen Körper zusammen. Es durchrieselte uns kalt, als uns die hochgehenden Wogen den Ausblick versperrten, und uns über das Rettungswerk im Unklaren ließen. Eine gewaltige Welle zeigte uns dann für Sekunden den Kopf des Jungen; sofort verschwand er wieder im tosenden Brechen der sich überstürzenden Seen, während jetzt unser Boot mit den fieberhaft arbeitenden Rettern hoch oben auf dem gläsernen Kamme schwebte. So vergingen bange, aufregende Minuten. Endlich erblickten wir acht Menschen im Rettungsboote und wußten nun, daß der Junge gerettet war.
Der nächste Schwimmgürtel brachte gleich zwei Männer durch die zornige See in das rettende Fahrzeug. Dann noch einige Male, und als letzter warf sich der Kapitän des Seglers in den kochenden Gischt, nachdem er noch dem Wasser freien Eingang in das Wrack verschafft hatte, um dessen Sinken zu beschleunigen.
Nun steuerte das Boot, durch die kräftige Beihilfe der Geretteten bewegt, mit raschen Ruderschlägen dem kleinen »Schleswig« entgegen. Grüßend hoben sich die Hände der Schiffbrüchigen, als wollten sie schon jetzt ihren Dank für die ausgeführte Heldentat aussprechen. Aber noch war die Gefahr nicht vorüber. Noch waren die Männer im Boote in der Gewalt der tosenden See.
Kapitän Michelsen wußte den schwer kämpfenden Männern jedoch zu helfen. Er steuerte den Dampfer so, daß er das Boot in die dem Winde abgekehrte Seite brachte und trieb den Ankommenden geschickt entgegen. An Bord wurden inzwischen alle Vorkehrungen getroffen, um der mit der See kämpfenden Mannschaft das Anlegen zu erleichtern. Alle freien Männer standen an Deck mit Tauen und Ringen bereit und verfolgten mit klopfendem Herzen jede Bewegung des herankommenden Bootes. Bald sah man es hoch auf dem Rücken eines Wogenkammes, bald war es wieder hinabgeschleudert in ein tiefes Wellental und unsern Blicken entzogen – Aber das Steuer lag in der Hand eines echten deutschen Seemannes, dessen scharfem Blick keine Bewegung des Meeres entging und dessen kundige Hand den heimtückischen Angriffen der See zu begegnen wußte.
Wohl über eine Stunde lang dauerte der Kampf der braven Bootsmannschaft mit der wilden See. Dann erst gelang es, unserm Dampfer nahe genug zu kommen. Wie oft schon glaubten wir in dieser qualvoll langen Zeit, den Sieg errungen zu haben. Jedesmal aber faßte eine heranschießende Woge das zerbrechliche Boot und schleuderte es weit hinaus in den kochenden Gischt. Endlich aber gelang es, das Boot so heranzubringen, daß ein Zerschellen an der Bordwand nicht zu befürchten war. Mit einer Hast, die durch die ausgestandene zweitägige Todesangst verständlich wurde, kletterten nun die Schiffbrüchigen an Bord. Dort sanken sie der Mannschaft in die Arme und lachten und weinten vor Freude über die Errettung vor dem sicheren Tode.
Vahsel und der Bootsmann hatten dann noch große Schwierigkeiten zu überwinden, bis sie das Boot wieder glücklich in seine Davits verbracht hatten. Alle Hände strecken sich den wackeren Helden mit den heißesten Dankesworten entgegen, als ihr Fuß endlich wieder das sichere Deck betrat. Sie wehrten jedoch bescheiden jede Huldigung ab.
»Was wir vollbrachten, würde jeder andere deutsche Seemann auch getan haben,« sagte Vahsel. »Wir sind ja Gott sei Dank keine Engländer.«
Der brave Offizier trat dann, da seine Wache gerade anfing, seinen Dienst an, als ob er in seiner Koje ausgeruht und nicht sechs lange Stunden einen Kampf auf Leben und Tod mit der rasenden See gekämpft hätte.
Wenige Stunden nach der Rettung der Barkmannschaft ließ der Sturm nach, und bald lag die See wie ein blanker Spiegel vor uns.
Vor Oahu gingen wir vor Anker. Hier schied ich von den wackeren Seeleuten und nahm im Hause eines Bekannten der Firma Hackfeld in Honolulu Wohnung. Eine ganze Anzahl Briefe aus der Heimat, die mich zum Teil schon seit vielen Monaten von Ort zu Ort verfolgten, ohne mich zu erreichen, bannten mich einige Tage an den Schreibtisch. Mitten in diese ungewohnte Beschäftigung platzte eines Morgens mein Gastfreund mit der Meldung:
»Eben läuft unser Küstenschoner ein. Wenn Sie die Gelegenheit benutzen wollen, um die Kanaken noch ziemlich »roh« zu genießen, dann packen Sie das Nötigste ein. Heute abend schlafen Sie schon auf Deck.«
Das ließ ich mir natürlich nicht zweimal sagen. Da ich immer reisefertig bin, kam ich schon an Bord, als der Schoner noch im vollen Laden begriffen war. Mit Sonnenuntergang löste er die Segel, und bald träumte ich wieder in den harten Kissen einer Seemannskoje.