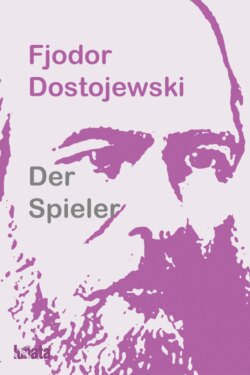Читать книгу Der Spieler - Fjodor Dostojewski - Страница 6
Zweites Kapitel
ОглавлениеIch muß gestehen: dieser Auftrag war mir nicht angenehm. Ich hatte mir zwar vorgenommen gehabt, mich gleichfalls am Spiel zu beteiligen, dabei aber in keiner Weise angenommen, daß ich damit anfangen würde, es für andere zu tun. Das stieß mir gewissermaßen meine Pläne über den Haufen, und so betrat ich denn die Spielsäle in einer recht verdrießlichen Stimmung. Unausstehlich ist mir die Lakaienhaftigkeit in den Feuilletons der Zeitungen der ganzen Welt und namentlich unserer russischen Zeitungen, wo fast in jedem Frühjahr unsere Feuilletonisten von zwei Dingen erzählen: erstens von der prachtvollen, luxuriösen Einrichtung der Spielsäle in den Roulettstädten am Rhein, und zweitens von den Haufen Goldes, die angeblich auf den Tischen liegen. Bezahlt werden ja die Schriftsteller dafür nicht; sie erzählen das aus eigenem Antrieb, aus uneigennütziger Dienstfertigkeit. Von Pracht ist in diesen dürftigen Sälen nicht die Rede, und Gold bekommt man überhaupt kaum zu sehen, geschweige denn, daß es in Haufen auf den Tischen läge. Allerdings, manchmal erscheint im Laufe der Saison plötzlich irgendeine wunderliche Persönlichkeit, ein Engländer oder ein Asiat oder wie in diesem Sommer ein Türke, und verliert oder gewinnt auf einmal eine sehr große Summe; aber alle übrigen spielen um ein paar lumpige Gulden, und im großen und ganzen liegt auf den Tischen immer nur sehr wenig Geld.
Als ich in den Spielsaal trat (es war das erstemal in meinem Leben), konnte ich mich eine Zeitlang nicht dazu entschließen mitzuspielen. Ich fühlte mich durch das dichte Gedränge abgestoßen. Aber auch wenn ich allein dagewesen wäre, auch dann wäre ich wohl am liebsten bald wieder weggegangen und hätte nicht angefangen zu spielen. Ich bekenne: das Herz klopfte mir stark, und ich war nicht kaltblütig; ich glaubte zuverlässig und sagte mir das schon lange mit aller Bestimmtheit, daß es mir nicht beschieden sein werde, aus Roulettenburg so ohne weiteres wieder fortzukommen, daß sich da mit Sicherheit etwas zutragen werde, was für mein Lebensschicksal von tiefgehender, entscheidender Bedeutung sei. Das sei ein Ding der Notwendigkeit und werde so geschehen.
Mag es auch lächerlich sein, daß ich vom Roulett soviel für mich erwarte, für noch lächerlicher halte ich die landläufige, beliebte Meinung, daß es töricht und sinnlos sei, vom Spiel überhaupt etwas zu erwarten. Und warum soll denn das Spiel schlechter sein als irgendein anderes Mittel des Gelderwerbs, zum Beispiel schlechter als der Handel? Das ist ja richtig, daß von hundert nur einer gewinnt. Aber was geht mich das an?
Jedenfalls beschloß ich, zunächst nur zuzusehen und an diesem Abend nichts Ernstliches zu unternehmen. Wenn an diesem Abend überhaupt etwas geschah, so sollte es nur zufällig und nebenbei geschehen; das war meine Absicht. Überdies mußte ich doch auch das Spiel selbst erst lernen; denn trotz tausend Beschreibungen des Rouletts, die ich stets mit großer Gier gelesen hatte, verstand ich, ehe ich nicht seine Einrichtung selbst gesehen hatte, schlechterdings nichts davon.
Von vornherein erschien mir alles überaus schmutzig, ich meine im übertragenen Sinne garstig und schmutzig. Ich rede nicht von jenen gierigen, unruhigen Gesichtern, die zu Dutzenden, ja zu Hunderten die Spieltische umgeben. Ich sehe absolut nichts Schmutziges in dem Wunsch, möglichst schnell und möglichst viel Geld zu gewinnen; als sehr dumm ist mir immer der Gedanke eines behäbigen, wohlsituierten Moralphilosophen erschienen, der auf jemandes Entschuldigung: »Es wird ja nur niedrig gespielt«, antwortete: »Um so schlimmer, da dann der Eigennutz kleinlich ist.« Als ob kleinlicher Eigennutz und großartiger Eigennutz nicht auf dasselbe hinauskämen! Das sind nur relative Begriffe. Was für Rothschild eine Kleinigkeit ist, das ist für mich eine große Summe; aber was Gewinn und Profit anlangt, so geht das Streben der Menschen nicht etwa nur beim Roulett, sondern auf allen Gebieten nur darauf, einander etwas wegzunehmen oder abzugewinnen. Ob Profitmachen und Gewinnen überhaupt etwas Garstiges ist, das ist eine andere Frage, auf deren Beantwortung ich mich jetzt nicht einlasse. Da ich selbst im höchsten Grade von dem Wunsch, zu gewinnen, erfüllt war, so hatte all dieser Eigennutz und, wenn man es so ansehen will, all dieser Schmutz des Eigennutzes beim Eintritt in den Saal für mich sozusagen etwas Vertrautes und Verwandtes. Das beste ist, wenn einer dem andern gegenüber keine gewundenen Redensarten macht, sondern offen und ehrlich verfährt; und nun gar sich selbst zu betrügen, was hat das für einen Zweck? Eine ganz wertlose, unökonomische Tätigkeit!
Besonders häßlich erschien mir auf den ersten Blick bei dem unfeinen Teil der Roulettspieler die Wichtigkeit, die sie ihrer Tätigkeit beilegten, das ernste, sogar respektvolle Wesen, mit dem sie alle die Tische umringten. Darum wird hier scharf unterschieden zwischen derjenigen Art zu spielen, die als »mauvais genre« bezeichnet wird, und derjenigen, die einem anständigen Menschen gestattet ist. Es gibt eben zwei Arten zu spielen: eine gentlemanhafte und eine plebejische, selbstische, das ist die der unfeinen Menge, des Pöbels. Hier wird dazwischen ein strenger Unterschied gemacht; und doch, wie wertlos ist in Wirklichkeit dieser Unterschied! Ein Gentleman wird zum Beispiel fünf oder zehn Louisdor, selten mehr, setzen oder auch, wenn er sehr reich ist, tausend Franc; aber er darf das lediglich um des Spieles willen tun, nur zum Zeitvertreib, eigentlich nur um den Vorgang des Gewinnens oder Verlierens zu verfolgen; für den Gewinn selbst darf er durchaus kein Interesse zeigen. Hat er gewonnen, so darf er zum Beispiel laut lachen, zu einem der Umstehenden eine Bemerkung machen; er darf sogar noch einmal setzen und dabei verdoppeln, aber einzig und allein aus Wißbegierde, um die Chancen zu beobachten und Berechnungen anzustellen, aber nicht in dem plebejischen Wunsch zu gewinnen. Kurz, all diese Spieltische, Rouletts und Trente-et-quarante-Spiele darf er nur als einen Zeitvertreib betrachten, der lediglich zu seinem Amüsement eingerichtet ist. Von der Gewinnsucht und den Fallstricken, die die Grundlage und Einrichtung der Spielbank bilden, darf er nicht einmal eine Ahnung haben. Sehr gut wäre es sogar, wenn es ihm schiene, daß auch alle übrigen Spieler, dieser Pöbel, der um einen Gulden bangt und zittert, daß auch sie ebensolche reichen Leute und Gentlemen seien wie er selbst und nur zur Zerstreuung und zum Zeitvertreib spielten. Eine solche völlige Unkenntnis der Wirklichkeit und harmlose Meinung von den Menschen wäre gewiß sehr aristokratisch. Ich sah, daß viele Mütter ihre unschuldigen, hübschen, fünfzehn- oder sechzehnjährigen Töchter zum Spieltisch vorwärtsschoben, ihnen einige Goldstücke gaben und sie über das Spiel belehrten. Die jungen Damen gewannen oder verloren, lächelten aber in jedem Falle und traten sehr zufrieden wieder zurück. Unser General kam in gemessenem Schritt und würdevoller Haltung zum Spieltisch; ein Diener eilte herbei, um ihm einen Stuhl zu reichen; aber er bemerkte den Diener gar nicht. Sehr langsam zog er seine Börse heraus, sehr langsam entnahm er ihr dreihundert Franc in Gold, setzte sie auf Schwarz und gewann. Er nahm den Gewinn nicht, sondern ließ ihn auf dem Tisch. Wieder kam Schwarz; auch diesmal nahm er nichts an sich, und als nun beim drittenmal Rot kam, verlor er mit einem Schlag zwölfhundert Franc. Er ging lächelnd weg und fiel nicht aus der Rolle. Ich bin überzeugt, daß sein Herz sich krampfhaft zusammenzog, und daß, wäre der Einsatz zwei- oder dreimal so groß gewesen, er seiner Rolle nicht treu geblieben wäre, sondern seine Erregung verraten hätte. Übrigens gewann in meiner Gegenwart ein Franzose bis zu dreißigtausend Franc und verlor dann diese Summe wieder, beides mit heiterer Miene und ohne jede sichtbare Erregung. Ein wirklicher Gentleman darf, selbst wenn er sein ganzes Vermögen im Spiel verlöre, sich nicht darüber aufregen. Das Geld muß so tief unter der Würde eines Gentleman stehen, daß es kaum wert erscheint, daß man sich darum kümmere. Gewiß, es würde sehr aristokratisch sein, die ganze moralische Unsauberkeit des gesamten Pöbels und der gesamten Umgebung überhaupt nicht zu bemerken. Manchmal indessen ist das entgegengesetzte Verfahren nicht minder aristokratisch, nämlich dieses ganze Pack zu bemerken, das heißt, es zu betrachten, es etwa durch die Lorgnette in Augenschein zu nehmen, aber nur in der Weise, daß man diesen ganzen Schwarm und diesen ganzen Schmutz als eine Art von Zerstreuung auffaßt, gleichsam als eine zur Unterhaltung der Gentlemen arrangierte Vorstellung. Man kann sich selbst in dieser Menge mit herumdrängen, muß dabei aber mit der festen Überzeugung um sich blicken, daß man eigentlich nur ein Beobachter ist und in keiner Weise zu dieser Gattung gehört. Übrigens würde es auch wieder ungehörig sein, wenn man all dies sehr aufmerksam betrachten wollte; das wäre wieder nicht gentlemanhaft, weil dieses Schauspiel jedenfalls eine längere und besonders aufmerksame Betrachtung nicht verdient. Überhaupt gibt es wenige Schauspiele, die einer besonders aufmerksamen Betrachtung von seiten eines Gentleman würdig wären. Persönlich war ich trotzdem der Meinung, daß all dies recht wohl einer sehr aufmerksamen Betrachtung wert sei, namentlich für denjenigen, der nicht allein um der Betrachtung willen gekommen ist, sondern sich selbst offen und ehrlich zu diesem ganzen Pack zählt. Was aber meine innersten moralischen Überzeugungen anlangt, so ist für die natürlich in meinen jetzigen Überlegungen kein Platz vorhanden. Mag es meinetwegen so sein; ich rede, um mein Gewissen zu erleichtern. Aber eines möchte ich hervorheben: in der ganzen letzten Zeit ist es mir sehr zuwider gewesen, meine Handlungen und Gedanken an irgendwelchen moralischen Maßstab zu halten. Etwas ganz anderes hat die Herrschaft über meine Seele übernommen ...
Die Art, in der der Pöbel spielt, ist tatsächlich sehr unsauber. Ich kann mich sogar des Gedankens nicht erwehren, daß dort am Tisch manchmal ganz gewöhnlicher Diebstahl vorkommt. Die Croupiers, die an den Enden der Tische sitzen, nach den Einsätzen sehen und die Zahlungen berechnen, haben eine gewaltige Arbeit. Die gehören auch mit zum Pöbel. Es sind größtenteils Franzosen. Übrigens verfolge ich hier bei meinen Beobachtungen und Bemerkungen ganz und gar nicht den Zweck, das Roulett zu beschreiben; ich stelle diese Beobachtungen vielmehr im Hinblick auf mich selbst an, um zu wissen, wie ich mich künftig zu verhalten habe. Ich bemerkte zum Beispiel als einen sehr gewöhnlichen Hergang folgendes: wenn ein am Tisch Sitzender gewonnen hat, so streckt sich auf einmal von hinten her der Arm eines anderen vor und nimmt sich den Gewinn. Dann beginnt Streit und nicht selten lautes Geschrei; und nun soll einmal der erste beweisen und Zeugen dafür suchen, daß der Einsatz der seinige war!
Anfangs war das ganze Spiel mir so unverständlich wie Chinesisch; was ich erriet und merkte, war nur, daß auf die Zahlen, auf Paar und Unpaar und auf die Farben gesetzt wurde. Von Polina Alexandrownas Geld beschloß ich es an diesem Abend mit hundert Gulden zu versuchen. Der Gedanke, daß ich mich auf das Spiel nicht für mich, sondern für einen andern einließ, verwirrte mich einigermaßen; diese Empfindung war sehr unangenehm, und ich wünschte, sie so schnell wie möglich loszuwerden. Es kam mir vor, als untergrübe ich mein eigenes Glück dadurch, daß ich damit anfinge, für Polina zu spielen. Kann man denn mit dem Spieltisch nicht in Berührung kommen, ohne sogleich vom Aberglauben angesteckt zu werden? Ich begann damit, daß ich fünf Friedrichsdor herausnahm, das sind fünfzig Gulden, und sie auf Paar setzte. Das Rad drehte sich, und es kam Dreizehn; ich hatte verloren. Mit einer peinlichen Empfindung, lediglich um irgendwie loszukommen und wegzugehen, setzte ich noch fünf Friedrichsdor auf Rot. Es kam Rot. Ich setzte alle zehn Friedrichsdor; es kam wieder Rot. Ich setzte wieder das Ganze auf einmal; es kam wieder Rot. Nachdem ich so vierzig Friedrichsdor erhalten hatte, setzte ich zwanzig auf die zwölf mittleren Zahlen, ohne zu wissen, was dabei herauskommen kann. Es wurde mir das Dreifache ausgezahlt. Auf diese Art hatte ich statt zehn Friedrichsdor auf einmal achtzig. Eine mir bisher fremde, sonderbare Empfindung bedrückte mich dermaßen, daß ich beschloß wegzugehen. Es schien mir, daß ich in ganz anderer Weise spielen würde, wenn ich für mich selbst spielte. Jedoch setzte ich alle achtzig Friedrichsdor noch einmal auf Paar. Diesmal kam Vier; es wurden mir noch achtzig Friedrichsdor hingeschüttet; ich ergriff den ganzen Haufen von hundertsechzig Friedrichsdor und ging, um Polina Alexandrowna zu suchen.
Sie promenierten alle im Park, und ich fand erst nach dem Abendessen die Möglichkeit, mit ihr allein zu sprechen. Beim Abendessen war diesmal der Franzose nicht anwesend, und der General ging infolgedessen mehr aus sich heraus: unter anderem hielt er für nötig noch einmal zu bemerken, er wünsche nicht, mich am Spieltisch zu sehen. Nach seiner Meinung würde es ihn sehr kompromittieren, wenn ich große Spielverluste haben sollte. »Aber selbst wenn Sie sehr viel gewönnen, so würde auch das für mich kompromittierend sein«, fügte er ernst und bedeutsam hinzu. »Gewiß, ich habe kein Recht, Ihnen über Ihre Handlungen Vorschriften zu machen; aber Sie werden selbst zugeben ...« Hier brach er nach seiner Gewohnheit mitten im Satz ab.
Ich erwiderte ihm trocken, ich hätte nur sehr wenig Geld und könne folglich keine erheblichen Summen verspielen, selbst wenn ich zu spielen anfinge. Als ich nach meinem Zimmer hinaufging, hatte ich die Möglichkeit, Polina ihren Gewinn einzuhändigen; ich erklärte ihr, ein zweites Mal würde ich nicht mehr für sie spielen.
»Warum denn nicht?« fragte sie aufgeregt.
»Weil ich für mich selbst spielen will«, antwortete ich, indem ich sie erstaunt ansah, »und das stört mich.«
»Also verbleiben Sie fest bei Ihrer Ansicht, daß das Roulett Ihr einziger Rettungsanker ist?« fragte sie spöttisch.
Ich bejahte diese Frage ernst und fügte hinzu, was meine Überzeugung betreffe, daß ich bestimmt gewinnen werde, so möge diese ja lächerlich sein, das wolle ich zugeben; aber man möge mich darin nicht zu beirren suchen.
Polina Alexandrowna bestand darauf, ich solle unter allen Umständen von dem heutigen Gewinn die Hälfte für mich nehmen, und wollte mir achtzig Friedrichsdor abgeben; sie machte mir den Vorschlag, ich möchte auch in Zukunft das Spiel unter dieser Festsetzung fortsetzen. Ich weigerte mich entschieden, die Hälfte anzunehmen, und erklärte auf das bestimmteste, ich könne für andere nicht spielen, nicht etwa, weil ich keine Lust dazu hätte, sondern weil ich aller Wahrscheinlichkeit nach verlieren würde.
»Und doch«, sagte sie nachdenklich, »mag es auch eine Dummheit sein, setze auch ich selbst meine Hoffnung fast nur auf das Roulett. Und darum müssen Sie unbedingt weiterspielen, halbpart mit mir; und das werden Sie selbstverständlich auch tun.«
Nach diesen Worten ging sie von mir weg, ohne auf meine weiteren Erwiderungen hinzuhören.