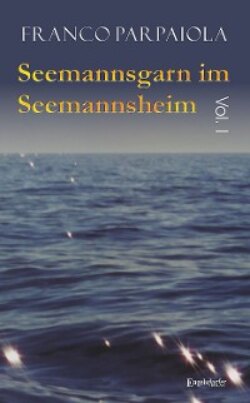Читать книгу Seemannsgarn im Seemannsheim: Vol. I - Franco Parpaiola - Страница 6
DER STURM
ОглавлениеDer längst angekündigte Sturm erreichte uns mit voller Wucht, kurz vor Mittag.
Das Barometer fing an zu sinken, das Ding ging in kaum einer halben Stunde von 1040 auf 1000 Millibar und fiel, während der Himmel in der kürzesten Zeit rabenschwarz wurde unaufhaltsam weiter ab.
Das Meer fing an zu brodeln und fast schlagartig befanden wir uns in der Scheiße.
Die Biskaya hatte sich fast blitzartig von einem freundlichen blauen, der Südsee ähnlichen friedlichen Gewässer zu einer tobenden Bestie entwickelt.
Es ging alles so schnell vor sich und der alte Arsch wurde so dermaßen überrascht, dass er sogar vergaß, die Fahrt des Schiffs zu reduzieren.
Die Kondor, immer noch von meinen Deutz-Bullen nach vorne getrieben, tanzte wild hin und her, sie bohrte sich ein paar Mal in gewaltige Wellen hinein, kam aber immer brav wieder raus.
„Wollen Sie den Motor zu Schrott fahren oder wollen Sie das Schiff versenken und uns alle umbringen, Kapitän?“, fragte ich scheinheilig, als ich sah, dass der Mann immer noch nicht mit der Fahrt runterging und wie hypnotisiert am Fenster auf das tobende Meer schaute.
Vorsorglich, in Erwartung des Sturms, hatte ich an dem Sonntagmorgen die Jungs und Peter, unseren Bootsmann-Koch, angewiesen, sämtliche Außenschotten und Türen abzuschließen und dafür zu sorgen; dass in der Messe und im Kabelgatt alles gut weggestaut und abgesichert wurde.
Luwala, jene Mischung aus Rottweiler und Mastino Napoletano, der unser Bordmaskottchen war, hatte ich in meiner Kabine eingeschlossen.
Vorsorglich hatte ich auch eine Runde im Maschinenraum gedreht, dort aber war für mich die Welt in Ordnung, denn ich hatte die Gewohnheit, niemals lose Gegenstände herumliegen zu lassen, von dort also erwartete ich keine Probleme.
Mein Problem – oder besser gesagt unser Problem – kam in Person des Steuermannes, der kurz vor dem Rest der Bande auf der Brücke erschienen war.
Er musste mit seinem Kopf gegen irgendwas gestoßen sein, denn auf seiner linken Stirnseite war eine große Beule zu sehen.
„Das ist die Strafe“, murmelte er vor sich hin.
„Die Strafe für was denn, Steuermann?“, fragte ich alarmiert.
„Die Pontons im Zwischendeck, Chief, ich habe sie aufgrund des schönen Wetters gestapelt gelassen und nicht in Position gebracht, die sind aber sehr gut gelascht worden“, antwortete er mir kleinlaut.
„Du Vollidiot, was hast du dir denn da dabei gedacht?“, zischte ich ihm ins Gesicht.
„Jetzt aber haben wir eine schöne Scheiße am Hals“, schimpfte Peter gleich los und schaute mich dabei kreidebleich an.
„Aber, meine Herren, ich bitte euch. Es gibt doch keinen Grund zur Panik. Der Sturm ist doch gleich wieder vorbei, und die Pontons im Laderaum sind gut gelascht worden“, dekretierte der Kapitän.
Mir reichte es, denn meine innere Warnanlage war wie von Sinnen am Bimmeln.
Jener sechste Sinn, der tief in mir, der meine eigene Alarmglocke war, war mir bestens bekannt. Das letzte Mal, wo er mich gewarnt hatte, war damals im Barbizon-Hotel gewesen, bevor ich auf das Motorschiff El Castillo stieg, damals war es nur ein Warnsignal, diesmal aber bedeutete der Klang meiner inneren Alarmglocke nur ein Ding, nämlich: den Tod!
„Nix da, mein lieber Kapitän, Sie gehen jetzt sofort auf ganz langsame Fahrt runter und Kopf auf See und ich geh in den Laderaum, ich will mich dort selbst vergewissern, was Sache ist, denn ich hab keine Lust, in der Biskaya abzusaufen.“
Ohne lange herumzumäkeln, setzte der Alte den Bug des Schiffes noch mehr gegen den Wind und reduzierte die Fahrt um noch einige Umdrehungen.
„Weniger geht nicht, Chief, ich brauch Ruderwasser. Passen Sie bitte auf!“, mehr sagte der alte Mann nicht und ich ging, gefolgt von Peter, nach unten.
Von der Tür auf der Steuerbordseite zum Arbeitsdeck und von dort bis zur Einstiegstür zum Laderaum waren es ein paar Meter. Unter diesen Umständen aber waren es ein paar sehr gefährliche und lebensbedrohliche Meter. Der Kapitän hatte das Schiff aber so manövriert, dass die Kondor mit ein paar für mich lebenswichtigen Graden rechts der Wellenrichtung lag.
„Pass bloß auf dich auf, Meister!“, bat mich Peter, der genauso wie ich durch das Bullauge an der Tür die Sequenz der Wellen beobachtete.
Wir ließen uns Zeit und erst, als ein paar größere Wellen an uns vorbeizogen und das Arbeitsdeck wieder frei von Wasser wurde, öffneten wir das wasserdichte Schott zum Deck und ich war, während Peter hinter mir die Tür wieder schloss, draußen am Deck.
Wie ich es schaffte, in den Laderaum zu gelangen, ohne über Bord gespült zu werden, weiß ich bis heute nicht, ich weiß nur, dass ich es schaffte und dass ich heute, fast fünf Jahre später, darüber berichten kann.
Mehr weiß ich nicht.
„Verdammt kurz und schnell, diese Wellen!“, dachte ich, als ich die Sprossenleiter zum Laderaum runterging.
Unten im Zwischendeck war das ganze Getöse des Sturms und des gestressten Schiffes fast unerträglich.
Die Gefährlichkeit und Mystik der Geräusche, die sich da abspielten, war mit nichts, was ich vorher auf See gehört hatte, zu vergleichen.
Es klang fast wie Musik; nein, es war Musik: Eine tödliche Symphonie, die mir fast das Blut in den Adern gefrieren ließ, spielte sich da in meinen Ohren ab und für einen kürzesten Augenblick hörte ich wie hypnotisiert gebannt zu.
Erst danach schaute ich mich um.
Die Pontons achtern waren im Laderaum zwar gestapelt, die lagen aber auch fest gegen die Aufbauten, die waren so gut einzeln am Schott gelascht worden, dass die nirgendwohin gehen konnten, so, als ob die ein fester Teil des Schiffes gewesen wären.
Diese Pontons waren immer dort, so wie die waren, und wurden in ihren jeweiligen Positionen in dem Zwischendeck eingesetzt, nur wenn es im Raum Teilladung zu stauen gab, sonst nicht.
Was ich aber sah, als ich nach vorne schaute, raubte mir für einen kurzen ewigen Moment fast den Verstand: Die vordersten zwölf Pontons, die man nur frei im Raum stapeln und laschen konnte, hatten ihre Ketten gesprengt. Sie lagen nun, vom schaukelnden Schiff herumgewirbelt, über- und untereinander. Sie waren durcheinander eingekeilt und gestapelt, Vorkante Laderaum Backbord und bewegten sich mit ihren scharfen Kanten knirschend gegen den Schiffsrumpf.
Fast wie in Trance schnappte ich mir von irgendwoher so viel Holzbretter, wie ich nur finden konnte und setzte sie, wohl achtend, wohin ich mit meinen Füßen ging, zwischen die scharfen Kanten der Pontons und die Schiffsaußenhaut.
Mit Gottes Hilfe fand ich auch auf Anhieb einige größere Holzkeile und einen Vorschlaghammer, wie besessen hämmerte ich so viele Holzklötze zwischen die eisernen Pontons und das Deck, wie ich nur konnte.
Mir ging es primär darum, eine weitere Verschiebung der Teile zu vermeiden und erst als es mir schien, dass das Ganze doch etwas ruhiger da lag, ging ich wieder nach oben, um Verstärkung zu holen.
„Ich machte mir langsam Sorgen um dich, Meister!“, sagte Peter, als ich wieder bei ihm war.
Unterwegs nach oben informierte ich ihn, was im Laderaum los war und was ich getan hatte. Ich sagte ihm auch, dass wir gleich wieder da runter mussten, um die losen Pontons mit Ketten und Spant-schrauben an den Spanten des Schiffes so zu verankern, dass die sich nicht mehr bewegen konnten.
Auf der Brücke war der alte Arsch gerade dabei, freudig und munter seinem Steuermann und die Jungs eine Lehrstunde in Ozeankunde zu geben.
Er erklärt denen gerade, wie sich die Wellen auf hoher See verhalten und wo der Unterschied zwischen einem Längs- und einem Querläufer zusehen und interpretieren war.
„Vorne, die Pontons, die ihr so gut gelascht und gesichert habt, meine Herren, die haben die Laschketten gesprengt. Wir müssen in den Laderaum gehen und sie allen, einzeln irgendwie sichern, sonst gehen die uns noch durch die Wand und dann ist wohl Feierabend mit lustig und wir gehen alle baden!“, erklärte ich denen.
Der Kapitän schien nicht begriffen zu haben, was ich da gesagt hatte, denn als ob ich nicht da gewesen wäre, laberte er und dozierte weiter mit den Jungs über Wasser und Wellen.
„Sagen Sie mal, Kapitän, haben Sie mir überhaupt zugehört?“, fragte ich wütend den alten Sack, der immer noch am Schnacken war.
„Wie bitte?“, fragte der alte Mann fast erschrocken.
In aller Ruhe erklärte ich noch einmal, in welcher prekären Lage wir uns befanden und was ich dagegen tun wollte.
„Ja, Chief, wenn das so ist, dann haben Sie natürlich recht. Ich will mir aber zuerst selber die Lage im Laderaum anschauen!“
„Den Teufel werden Sie tun, mein Lieber. Sie bleiben hier brav auf der Brücke und fahren das Schiff und gehen nirgendswo hin!“, antwortet ich bissig, ohne ihn weiterreden zu lassen.
„Ich bin der Kapitän und ich muss mir selber ein Bild über den Zustand meines Schiffes machen!“, antwortete mir der alte Sack trotzig.
„Falls Sie jetzt die Brücke verlassen, um in den Laderaum zu gehen, so breche ich Ihnen ein Bein. Auf den Steuermann ist kein Verlass, Sie sind hier jetzt der Einzige, der das Schiff in so einer Situation fahren kann und ich brauche die Jungen und den Koch mit mir im Raum. Wir sind tief in der Scheiße und alles, was ich zur Verfügung habe, sind zwei achtzehnjährige Jungs, die zum ersten Mal auf See sind, und Peter. Hinzu kommt ein Steuermann, der von nichts eine Ahnung hat und ein 68 Jahre alter Kapitän, der, obwohl er kaum auf den Beinen stehen kann, in den Laderaum gehen will, nur weil er den Kapitän spielen will und ich soll dem Mann kein Bein brechen?“, fragte ich zum Schluss, verbittert und angeekelt über seinen Hochmut und seine überhebliche Einstellung.
Ohne mich weiter um den alten Mann zu kümmern, ging ich aus der Brücke, Peter und die Jungs folgten mir ohne Widerrede.
Ein paar Minuten später waren wir alle vier zwar etwas nass und außer Atem, aber mit heilen Knochen bei dem losen Pontons im Laderaum.
Wir brauchten gut und gerne zwei Stunden, um all die Pontons so zu sichern, dass die einigermaßen gut und fest an der Backbordseite des Schiffes sicher befestigt worden waren.
So was hört sich einfach an, es war aber nicht so und ungefährlich war’s erst recht nicht.
Wir befanden uns im vordersten Teil des Laderaums, und das Schiff sprang wie ein wilder Mustang mit bis zu sechs Metern in die tiefen Wellentäler.
Am Ende aber, ohne uns dabei die Knochen zu brechen, hatten wir es fertig gebracht, nicht nur jeden der losen Pontons an die Spannten des Schiffes festzumachen, wir hatten auch noch eine gehörige Portion Holzpolster zwischen diese und die Schiffswand gesetzt.
Ganz felsenfest gelascht waren die nicht, wir hatten es nur geschafft, die alle gut zu befestigen, dort, wo die waren und so, wie die dort auch lagen.
Mehr war in so einer Lage einfach nicht drin gewesen.
Um zu vermeiden, dass die sich durch Eisen-auf-Eisen-Reibung noch weniger bewegen konnten, waren wir in der Lage gewesen, eine gute Verkeilung, nicht nur zwischen jedem Einzelnen von denen, sondern auch zwischen denen, die direkt an Deck lagen, und das Deck selbst hinzukeilen.
Damit hatten wir zur Rettung unserer Leben all das getan, was uns unter den gegebenen Umständen möglich gewesen war, der Rest lag nur noch in Gottes Hand.
Mir ist es heute noch ein Rätsel, wie wir es immer schafften, von unserem Wohnbereich in den Laderaum zu gelangen und zurückzukommen, ohne dabei von den anrollenden Brechern über Bord befördert zu werden.
Tatsache ist, dass wir es alle schafften und das alles auch ohne Verletzungen.
Auf der Brücke dann berichtete ich dem Kapitän, wie die Lage nun war, ich erklärte ihm, was wir getan hatten und was ich davon hielt.
Dabei machte ich ihm klar, dass die Pontons keineswegs sicher waren, sondern dass die eben nur so sicher waren, wie das Schaukeln des Schiffes es eben zuließ, mehr nicht und nicht weniger.
Mittlerweile hatte der Sturm an Stärke zugenommen.
Er schien sich bei einer steifen neun mit bis zu guten zehn Windstärken eingependelt zu haben.
Das Schiff schaukelte im Sekundentakt bis auf Dreißig-Grad-Neigung wild hin und her und man konnte nicht auf den Füßen stehen, ohne sich nicht irgendwo festzuhalten. Solange wir aber Kopf auf See blieben, war das im Grunde genommen zwar verflixt unangenehm und gefährlich, wir hätten es aber überleben können.
Hinzu kam, dass das Gewicht der Pontons, die an Backbord gestapelt waren, uns zwangsläufig ein paar Grade willkommener Schlagseite gab und das half noch mehr, die Scheißdeckel dort zu halten.
Jeder Kapitän, den ich kenne, aber auch die blödesten unter denen – und davon gibt es viele – wäre nun weiter, bis sich der Sturm beruhigt hatte, Kopf auf See geblieben.
Nur dieses Arschloch von Kapitän nicht, nein, der Trottel, als er hörte, dass die Pontons im Laderaum befestigt worden waren, schien nur den Teil meines Berichtes in sich aufzunehmen, der ihm passte zu begreifen.
„Mensch, Chief, danke, das war gute Arbeit, jetzt kann ich wieder auf Kurs gehen und mich bei Ouessant Radio abmelden!“, das war es, was der Herr Kapitän mir sagte.
Meine Antwort kam postwendend.
„Wenn Sie es wagen, dieses Schiff auch nur einen einzigen Grad aus dem gegenwärtigen Kurs zu bringen, so schließe ich Sie in Ihre Kammer und übernehme das Schiff!“, mehr sagte ich nicht.
„Das ist ja Meuterei. Ich werde Sie ins Tagebuch eintragen und bei der nächstbesten Gemeinheit den Hafenbehörden anzeigen!“, weiter kam er nicht.
„Machen Sie es ruhig, Kapitän, und da Sie schon dabei sind, setzen Sie meinen Namen gleich dazu!“, schrie ihn Peter auf Holländisch sofort an. „Falls Sie lebensmüde sind, so springen Sie meinetwegen gleich außenbords. Dieses Schiff drehen Sie aber nicht, nicht jetzt, denn ich habe Frau und Kinder daheim und die wollen mich wiedersehen, haben Sie mich verstanden, Herr Kapitän!“
Peter, als erfahrener Bootsmann, hatte die Gefährlichkeit unserer Lage sofort erfasst und war mir zu Hilfe gekommen.
„Da draußen gibt es manche Sturmböen, die fast Orkanstärke haben!“, sagte ich zu dem alten Mann und dabei deutete ich mit meiner Hand auf die rollenden Wellen, die an uns vorbeizogen. „Wo zum Teufel wollen Sie eigentlich hin, Kapitän?“, fragte ich den alten Mann, der, erschrocken über Peters Einmischung, sprachlos geworden war.
„Ihre Pflicht ist es, am Ouessant Radio unsere Situation zu melden, wir sind faktisch in Seenot. Jede Minute kann sich ein Ponton lösen, jede Minute kann einer davon durch die Schiffswand gehen und wir saufen, ohne dass es jemand merkt, einfach ab; Kapitän, melden Sie uns unverzüglich der französischen Küstenwache als Schiff in Seenot, bitte!“
Der Mann, der nur an sich selbst und sein eigenes Ansehen dachte, griff wortlos nach dem UKW-Mikrofon und rief Ouessant Radio an.
Ruhig, mit fast monotoner Stimme, meldete er unsere Position und Schiffslage und bat sie, wenn wir auch quer zum Fahrweg standen, dort bleiben zu können, wo wir waren, so wie wir waren.
Er beantwortete all die Fragen, die Ouessant Radio ihm über Schiffsgröße, Tiefgang, Art der Ladung, Ausgang und Ankunftshafen sowie Reederei und Agentennamen stellte. Er gab alles durch, und am Ende verlangte die Küstenradiostation, nachdem sie uns auf ihrem Radar festgenagelt hatte, von ihm bis auf weiteres im Fünfzehn-Minuten-Takt Position und Schiffszustandsmeldung.
Danach wünschte sie uns Hals- und Beinbruch und beendete somit das Gespräch.
Gerade als ich dachte, nach unten zu gehen, um meinen nassen Kombianzug zu wechseln, begann am Peildeck über uns etwas gegen etwas anderes zu knallen.
Die Schläge kamen im Rhythmus des rollenden Schiffes und wurden immer lauter.
„Was zum Teufel soll denn das jetzt schon wieder sein?“, fragte mich Peter, der genau so wie ich und die Jungs bis auf die Knochen nass und am Frieren war.
„Es gibt nur einen Weg, um es herauszufinden, Junge, lass uns nach oben gehen, und wir werden es wissen!“, antworte ich.
Ohne zu zögern, von Steuerbord aus, ging ich, gefolgt von Peter, an dem teilnahmslosen Steuermann vorbei, der immer noch neben der Tür stand und stumpfsinnig verbissen, wie in Trance, nach draußen schaute an Deck.
Das Peildeck ist das höchste Deck eines jedes Schiffes, denn höher als das sind nur noch der Kamin und die Masten.
Dort, auf fast jedem Schiff älterer Bauart, befinden sich in einer Holzkiste die Zwölf-Volt-Batterien für die Funkanlage des Schiffes.
Gerade der Scheiß hatte sich teilweise losgerissen und knallte mit dem rollenden Schiff gegen die Reling.
Wenn es nicht einfach gewesen war, auf das Peildeck zu gelangen, war es beileibe noch weniger einfach, die schwere Kiste wieder gegen die Reling zu bringen.
Der Pendelweg des Schiffes dort oben ist am stärksten und sehr gefährlich.
Mit vereinten Kräften, teilweise flach an Deck liegend, klatschenass und halb erfroren, schafften Peter und ich es aber doch nach einer Weile, die Kiste wieder gegen die Reling gedrückt zu halten.
Daraufhin knallte ich meine 110 Kilo darauf, hängte irgendwie meine Beine und Arme über die Reling und schaffte es auch, mit meinen fast eingefrorenen Arschbacken die verdammte Kiste in Position zu halten, bis Peter in dem kleinen Abstellraum im Schornstein zum Glück genügend alte Wurfleinen fand, um die verflixte Kiste an der Reling wieder festzulaschen.
„Falls die Reling auch noch vergammelt ist und nachgibt, so lade ich samt den Batterien Vierkant in den Bach und dann wird es das wohl gewesen sein!“, dachte ich grinsend, als ich wie ein Affe am Baum da am der Reling hing, während die Gischt der vorbeiziehenden Wellen mir die Fresse polierte.
Wenn von dem Brückenfenster aus der Anblick des Sturms würdevoll und überwältigend war, so sah es von dem Peildeck schlicht und ergreifend majestätisch und atemberaubend zugleich aus.
Ergriffen, fast in der tiefsten Demut, lauschte ich dort dem Konzert aus rauschenden Wassermassen, aus dem Stampfen des Schiffes gegen die anrollenden Wellen und aus den Hunderten von Violinen und Posaunen, die die Windböen durch die Aufbauten des Schiffes hindurch spielen ließen.
Aus dem manchmal ruhigen Lauf meiner Deutz-Bullen, die, sobald der Propeller aus dem Wasser kam, ihren Lauf, skandiert durch die trockenen Luftschläge der Abgasturbine, schlagartig von einem „Andante con Brio“ zu einen „Andante Furioso“ änderten, dort wurde mir auf einmal klar, dass kein Maler jemals in der Lage sein würde, solch ein Bild malen zu können.
Kein Schriftsteller, auch der begabteste nicht, so was in Worte aufs Papier zu bringen.
Kein Musiker, auch nicht der inspirierte, so eine Symphonie komponieren zu können.
So was muss man gesehen, gehört, erlebt und vor allem empfunden haben. Beschreiben mit Musiknoten, erklären mit Worten oder mit Farben, im Nachhinein jemanden nachempfinden lassen, was einer da sieht und empfindet, das kann man nicht, kein Mensch kann das.
So etwas beschreiben zu wollen, wäre nichts anderes als reiner, purer, dämlicher menschlicher Hochmut, nicht mehr und nicht weniger als das.
Viele, zu viele Schiffe sind während solcher Stürme auf See gesunken.
Viele, zu viele feine Männer haben dabei ihr Leben verloren: Gestorben auf havarierten Schiffen, erfroren im eiskalten Wasser auf See, ertrunken im Sog des sinkenden Schiffes.
Keiner dieser Männer hätte zu sterben brauchen, nicht ein einziger von denen, denn kein Schiff ist zum Sinken gebaut worden.
Stürme kann man in den meisten Fällen umgehen und wenn nicht, besonders die Küsten Europas bieten für solch extreme Fälle weiß Gott genügend Landschutzmöglichkeiten, wo Schiffe einen sicheren Ankerplatz finden können.
Es ist immer und nur der Mensch, der sich selbst und andere in Gefahr bringt, sei es aus schierer Dummheit oder Unerfahrenheit, aus reiner Fahrlässigkeit oder aus Feigheit vor dem Reeder, dass nur aus einem fahrenden Schiff Gewinn für sich selbst und seine Kommanditisten zu Buche schlagen kann.
Die drei Ritter des Todes auf See heißen: Inkompetenz, Unachtsamkeit, Missmanagement.
Bei uns an Bord erschienen sie alle drei zusammen in Gestalt des Steuermann, des Kapitän und des Agenten in Holland und sie setzten sich alle drei gleichzeitig zum Ernten bereit und schauten uns stumm zu, wie wir ums nackte Überleben kämpften.
Der der Inkompetenten: Der Steuermann hatte die Pontons des Zwischendecks dem schönes Wetter wegen nicht in Position gebracht, sondern nur notdürftig übereinandergestapelt und obendrauf nicht richtig gelascht.
Der der Unachtsamen: Der Kapitän hatte seinem jungen und unerfahrenen Steuermann nicht über die Schultern geschaut und ihn nicht angewiesen, aufgrund der uns bevorstehenden langen Seereise, die Pontons, wie es sich gehörte, auf ihre dazu vorgesehenen Positionen zu setzen.
Der des Missmanagements: Welcher Trottel an Land hatte uns einen 74-jährigen alten Große-Fahrt-Kapitän ohne jeglichen Kümo-Erfahrung an Bord geschickt?
Ich persönlich, wenn ich mir überhaupt für diesen Zustand einen Vorwurf, hätte machen können, so hatte ich eventuell nur einen einzigen Fehler gemacht: Aus lauter Betriebsgewohnheit hatte ich mich auf alles und alle verlassen.
Damals aber war Markus als Kapitän an Bord und der hatte seine Augen überall, mit ihm wäre so was gewiss nicht geschehen, denn er hätte bei so einem Fall den Steuermann in den Hintern getreten und ihn sofort angewiesen, die Pontons auf ihren Plätze zu setzen.
Der Markus war aber nicht da, dafür aber waren wir an Bord tief in der Scheiße.
Nachdem wir die Batteriekisten gut gelascht hatten, halb im Liegen, durchnässt und halb erfroren, uns gegenseitig helfend, schafften wir es wieder unbehelligt und ohne Verletzungen, vom Peildeck runter zu kommen und zurück ins Steuerhaus zu gelangen.
Wir waren nicht nur nass, wir waren nicht nur vor Kälte am Zittern, wir waren auch stinksauer und hatten nur noch Mordsgedanken im Kopf.
Gerd hatte in der Zwischenzeit, wie auch immer, in der Kombüse für uns alle heißen Tee gemacht und so empfing er uns damit und das brachte uns sofort mehr oder weniger auf besseres und besonnenes Gedankengut.
Erst nach der zweiten Tasse Tee dachte ich, dass es langsam Zeit war, im Maschinenraum eine Runde zu drehen.
Der Fahrtstand auf der Brücke hatte zwar all die Parameter, die ich brauchte, um den Laufzustand der Anlage zu kontrollieren, aber ein Rundgang war sicherer. Mir war auch klar, dass die Alarmanlage in bester Ordnung war, aber ich bin nun mal ein alter Maschinenonkel, der sich immer vor Ort über den Zustand seiner Anlage vergewissern will.
So sagte ich den Herren, dass ich mal kurz in den Maschinenraum gehen wollte und ging nach unten.
„Bevor ich mich auch umziehen geh, wollte ich noch mal mit Gerd kurz in dem Laderaum nach dem Rechten schauen, könntest du noch eine Weile hier bleiben, Meister?“, fragte Peter.
„Klar, Peter, geh nur, aber sei bitte vorsichtig!“, antwortete ich.
„Aber ihr seid doch vor kaum einer Stunde dort gewesen, was soll denn das?“, fragte der Kapitän trotzig.
„Verdammt noch mal, sind Sie denn so sicher, dass die Scheißpontons noch festgelascht sind? Es ist doch Ihre Schuld, wenn wir in Seenot sind, und beten Sie zu Gott, dass, falls wir es schaffen, heil aus dieser Scheiße rauszukommen, ich Sie nicht bei der Seefahrtinspektion bei uns zu Hause in Holland anzeige!“, fauchte ihn Peter sofort auf Holländisch an.
Der alte Mann verstummte auf der Stelle.
Während Peter und Gerd nach unten gingen, schenkte ich mir noch eine Tasse Tee ein und ging mit meinem Mock nach draußen auf das Steuerbordnock, um die beiden im Auge zu behalten.
„Wir haben noch ein paar Spant-schrauben und noch ein paar Ketten angebracht, wir haben auch noch mehr Holzkeile und Bretter hingesetzt, einige Pontons hatten sich doch etwas frei bewegt. Wir müssen am besten jede Stunde da unten nachschauen gehen!“, berichtete uns Peter eine halbe Stunde später, als er zusammen mit Gerd wieder auf die Brücke kam.
„Wir werden am besten Wachen aufstellen müssen, Kapitän. Ich schlage vor, dass Peter und Gerd sich jetzt schlafen legen, Martin und ich übernehmen die erste Laderaumwache bis zwanzig Uhr, danach sind Sie dann dran!“
„Ja, Chief, machen wir es so, ich bleibe sowieso hier auf der Brücke“, antwortete der Mann, der doch in ein paar Stunden um Jahre gealtert zu sein schien.
Endlich konnten Peter und ich uns umziehen gehen. Martin hatte ich schon vorher, während die beiden im Laderaum waren, nach unten geschickt, wo er seine nasse Klamotte wechselte.
Gerd hatte sich noch, bevor er wieder auf die Brücke kam, schnell umgezogen, nun waren wir beide dran, und so gingen wir in unsere Kabinen.
Schnell zog ich mich im Badezimmer aus, ließ die nassen Sachen auf den Boden fallen, trocknete mich rasch ab und zog mir frische, saubere und vor allem trockene Klamotten an.
Luwala lag immer noch selig auf dem Rücken in meiner Koje.
Sie hatte sich zwischen die Matratze und den Schott eingekeilt, sie musste aber irgendwann aus der Koje gekommen sein, denn sie hatte auf den Boden gepisst.
„Gut für dich, dass du nicht in die Koje gepisst hast, du alte Sau!“, sagte ich ihr und ohne mich um ihre treudoofen Augen zu kümmern, legte ich ein paar Putzlappen auf ihre Pisse drauf und ging in den Maschinenraum zu den Deutz-Bullen.
Dort, wie erwartet, war alles bestens.
Vorsichtshalber aber tat ich, was ich von Anfang unserer Misere und aufgrund der übermäßigen Schaukelei hätte tun sollen: Ich stellte nämlich den Schmierölseparator ab, ließ den zweiten Hilfsdiesel anlaufen und brachte es parallel zu dem anderen aufs Netz.
Das hätte ich wirklich früher tun müssen, denn ein Blackout war das allerletzte, was wir in so einem Zustand hätten brauchen können.
Danach erinnerte ich mich, dass ich seinerzeit am Schott im Maschinenraum neben der Ballastwasserpumpe an Steuerbord eine Zehn-Millimeter-Schraube eingeschraubt gesehen hatte.
Dieser Schott ist die Trennung zwischen Maschinenund Laderaum und ich wunderte mich damals sehr, dass jemand so dämlich gewesen sein konnte, dort ein Loch zu bohren.
Ohne lange zu zögern, schraubte ich den Bolzen raus und schon hatte ich eine Verbindung zum Laderaum.
Welches wunderbare Arschloch auch immer das getan hatte, war mir Wurst, insgeheim aber bedankte ich mich bei ihm für seine Dämlichkeit, denn aus dem Loch kam kein Wasser; das Schiff war also noch dicht.
Unterwegs nach oben traf ich Peter, der gerade aus der Kombüse mit einer Plastiktüte voll mit Wurstbroten kam, und ich bat ihn, kurz mit mir in den Maschinenraum zu kommen.
Dort zeigte ich ihm das Loch am Schott und gleich darauf, wieder unterwegs nach oben, bat ich ihn, jede halbe Stunde während seiner Wache danach zu sehen, ob Wasser daraus kommen würde.
„Wenn ich da Wasser rauskommen sehe, dann ruf ich dich, okay?“
„Eben, dann schauen wir mal nach, wie groß das Loch im Laderaum ist. Wenn es nur ein kleines Loch ist, dann sehe ich zu, das Wasser außenbords zu pumpen und ihr dichtet es ab, wenn es zu groß ist, kommen wir nicht gegen an, dann springen eventuell alle gemeinsam samt dem Hund außenbords in die Rettungsinsel“, antwortete ich genauso lapidar.
Als ich auf die Brücke kam, war mein erster Eindruck, dass der Sturm am Nachlassen war.
Die Jungs hatten anscheinend ganz andere Sorgen im Kopf, denn als Peter denen sagte, dass er etwas zu essen mitgebracht hatte, stürzten sich die beiden wie hungrige Wölfe auf die Brote und fingen an; wie die Wilden an zu mampfen.
„Es lässt nach, Chief!“, sagte der Kapitän, nachdem er sich zum x-ten Mal bei Ouessant Radio gemeldet hatte.
„Diesen Eindruck hab ich auch, Kapitän, es scheint nur noch so gute sieben bis acht da draußen zu pusten“, pflichtete ich ihm bei.
„Es ist noch hell, wenn Sie möchten, könnten wir jetzt doch mal in den Laderaum gehen.“
„Dann nichts wie hin, Chief!“, antwortet er sofort und ohne sich um den Steuermann zu kümmern, der immer noch wie angewurzelt neben der Tür zum Steuerbordnock stand, rief er Peter am Fahrtstand.
„Bootsmann, halte den jetzigen Kurs, sollte die Ruderanlage ausfallen, so geh sofort auf Handsteuerung, versuch diesen Kurs, bis wir wiederkommen, bei zu behalten.“
„Das geht klar, Kapitän, 315° liegen an!“, bemerkte Peter. Er nahm seine Stellung am Fahrtstand an und der Alte und ich gingen in den Laderaum.
Auch dieses Mal schafften wir es ohne Probleme dorthin zu gelangen.
Wir bekamen noch nicht mal nasse Füße.
Im Laderaum hatten auch die Geräusche des Schiffes im Sturm nachgelassen.
Der Hauptmotor jaulte zwar immer noch, aber nicht mehr so oft und nicht mehr so wild, fast rabiat und laut, wie Stunden zuvor.
Beim Anblick des Raums vorne wurde der Kapitän blass.
„Danke, Chief!“, mehr sagte er nicht, für mich aber war das mehr als genug.
Dort kontrollierte ich noch den Zustand der Spannketten und Schrauben, ich fand alles wie gehabt und so zeigte ich dem alten Kapitän die abgerissenen Spannten am Schiffsrumpf. Nicht nur die zwölf Stück an Steuerbord, nein, ich zeigte ihm auch die dreizehn Stück an Backbord. Ich ließ ihn auch das abgerissene Ballastwassertank-Peilrohr nochmals an Steuerbord begutachten und machte ihm klar, dass gerade dieses Rohr höchstwahrscheinlich dazu beigetragen oder eben gerade verhindert hatte, dass einer der Pontons uns nicht glattweg durch die Wand ging.
„Wie konnte das bloß geschehen?“, fragte der Mann fassungslos.
„Sie sind immer auf großer Fahrt gewesen, Kapitän, dort haben Sie immer gute Steuerleute, gute Bootsmänner und gute Matrosen gehabt, hier an Bord haben Sie einen unerfahrenen Steuermann und zwei unerfahrene Jungs als Deckbesatzung, unser aller Betriebsgewohnheit tat den Rest, deswegen sind wir hier und heute fast zugrunde gegangen“, antwortete ich ihm.
„Mit achterlichen Seen ist dieses Schiff Weltmeister, die schaukelt zwar etwas, aber nicht so viel, die Pontons sind soweit gut gesichert, das Wetter hat merklich nachgelassen, meinen Sie nicht, dass wir doch beidrehen können und unter Landschutz fahren sollten, wir müssen all die Pontons im Zwischendeck setzen, so können wir nicht weiter fahren. Wie viel Zeit brauchen Sie, um die Pontons wieder in Position zu bringen, Chief?“
„Normalerweise keine zwanzig Minuten, nun aber wird es wohl eine gute Stunde dauern, Kapitän, mehr nicht.“
„Nur eine knappe Stunde Ruhe und ich könnte weiterfahren!“, murmelte der Alte vor sich hin.
Am liebsten hätte ich dem alten Sack eine geschmiert, denn er dachte immer noch nur an sich.
„Es gab Leute auf See, die, um ihr Leben zu retten, nur noch Sekunden brauchten, die bekamen sie aber nicht, eine Stunde dagegen sind viele Ewigkeiten, Kapitän.“
„Gut, Chief, Danke noch mal, dann lass uns nach oben gehen, wir wollen den Dampfer drehen und hoffentlich behalten Sie auch dieses Mal recht“, sagte der Mann und ging, sich immer noch gut festhaltend, aus dem Raum, nach oben zum Fahrtstand.
„Während ihr im Laderaum wart, hat der Steuermann hier sich beschwert, weil es heute weder ein warmes Mittag- noch Abendendessen gab“, informierte uns Peter, als wir wieder auf der Brücke waren.
Während der Kapitän seinen Platz am Ruder einnahm und dabei den Steuermann der sich langsam zum Leben erweckt und von seinem Posten neben der Tür zu dem Radar gewechselt hatte, von oben nach unten, fast verachtend anschaute, fragte ich Gerd, was er dazu getan hatte.
„Nichts Besonderes, den hab ich nur kurz am Hals gepackt und ihm gesagt, dass, falls er nur noch ein einziges Wort sagen würde, ich ihn vierkant außenbords werfen würde.“
Aus den Augenwinkeln sah ich dann, wie der Kapitän sich grinsend auf die bevorstehenden Manöver vorbereitete und ebenfalls lächelnd fragte er Gerd, warum er das eigentlich nicht getan hatte.
Bevor der Alte den Dampfer drehte, meldete er sich noch einmal bei Ushant Radio und gab unsere Position durch, er gab sein Vorhaben an und fragte um Erlaubnis, unter Landschutz fahren zu dürfen.
Das wurde ihm sofort gewährt.
Die wünschten uns nochmals gute Reise und der Alte machte sich bereit, das Schiff zu drehen.
Souverän schaute der alte Sack nach draußen zu den anrollenden Wellen; noch waren wir nicht so ganz aus dem Schneider, aber der Sturm da draußen hatte vorläufig aufgehört, den ganz wilden Onkel zu spielen.
Er blies uns zwar immer noch gute sechs bis sieben ins Gesicht und das Meer war immer noch ziemlich rau, wir konnten aber bei so einem Wetter unser Schiff drehen, und das war die Hauptsache.
„Okay, meine Herren, es geht herum!“, warnte uns der Kapitän, als er den Fahrthebel bis zum Anschlag nach vorne drückte und das Ruder hart nach Backbord setzte.
Daraufhin, als die Bullen losbrüllten, schien sich das Schiff fast überrascht erst mal zu schütteln, dann aber, erst fast zögernd, sozusagen diesen neuen Zustand erst mal testend und die Lage peilend, dann immer schneller, fast frenetisch, nahm sie Fahrt auf und im Nu drehte sie sich wie auf einem Teller und zeigte alsbald dem Sturm ihren breiten Hintern.
Zufrieden über das gelungene Manöver setzte der Kapitän den Fahrthebel, den er während der Wendung immer in seiner Hand gehalten hatte, auf halbe Kraft voraus und ließ das Schiff, das fast nicht mehr schaukelte, laufen.
„Ich brauche etwas für Luwala zu essen, Peter, die hat bestimmt einen Mordshunger und steht bestimmt schon vor der geschlossenen Tür meiner Kammer, ich muss die rauslassen, ansonsten kackt die mir noch die Bude voll.“
„Dann nichts wie hin, Meister“, antwortete Peter und ging nach unten. Ich folgte ihm und in der Tat, als ich die Tür zu meiner Kammer aufmachte, stand die Kleine davor und sprang mir freudig und schwanzwedelnd entgegen.
Im Gang machte ich die wasserdichte Tür zum Bootsdeck auf.
Es pustete zwar immer noch, aber ich konnte sie rauslassen, denn das Schiff lag fast ruhig im Wasser. Luwala schnupperte erst mal neugierig durch die geöffneter Tür nach draußen, ging zuerst stockend, dann aber doch schnell nach draußen – und kackte uns wieder mal das Deck voll.
Die alte Sau, die.